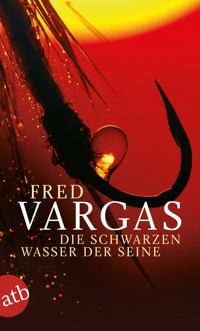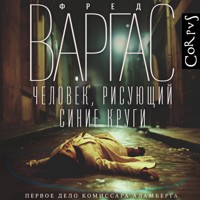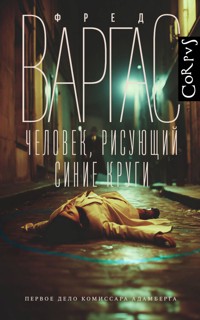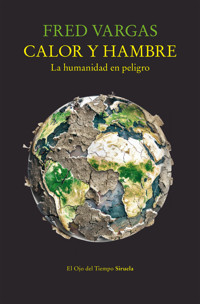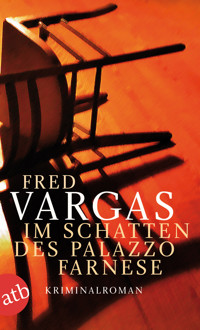10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die Pest bedroht Paris – oder ein kaltblütiger Mörder ... Der dritte Fall für Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg!
Die Pest ist zurück! Nachdem nachts auf Wohnungstüren eine gespiegelte Vier erschienen ist und am nächsten Tag ein Toter auf der Straße lag, hält das Gerücht, der schwarze Tod sei zurück, ganz Paris in Atem. Kommissar Adamsberg wird mit den Ermittlungen betraut und muss herausfinden, was es mit der rätselhaften lateinischen Formel auf sich hat, die auf den betroffenen Türen stand. Und wer ist dieser Bretone, der auf den Straßen von Paris lateinische Texte vorliest und dabei immer mehr Menschen um sich schart? Die vermeintlichen Pestopfer werden immer mehr, als Adamsberg einen Einfall hat, der absurd erscheint – aber der Schlüssel zu dem mysteriösen Fall sein könnte …
»Fred Vargas' Krimis sind etwas Besonderes – eigenwillig, mit geradezu genialem Plot und viel französischem Esprit!« Bestsellerautorin Sophie Bonnet
»Lässig, klug, anarchisch und manchmal ziemlich abgedreht – die Krimis von Fred Vargas sind sehr französisch und zum Niederknien gut.« Bestsellerautor Cay Rademacher
»Fred Vargas erschafft nicht nur Figuren, sondern echte Charaktere. Sie kennt die Abgründe, die Sehnsüchte und die Geheimnisse der Menschen – und Commissaire Adamsberg ist für mich einer der spannendsten Ermittler in der zeitgenössischen Literatur.« Bestsellerautor Alexander Oetker
Wenn Ihnen die Krimis um Kommissar Adamsberg gefallen, lesen Sie auch die Evangelisten-Reihe unserer internationalen Bestseller-Autorin Fred Vargas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Die Pest ist zurück! Nachdem nachts auf Wohnungstüren eine gespiegelte Vier erschienen ist und am nächsten Tag ein Toter auf der Straße lag, hält das Gerücht, der schwarze Tod sei zurück, ganz Paris in Atem. Kommissar Adamsberg wird mit den Ermittlungen betraut und muss herausfinden, was es mit der rätselhaften lateinischen Formel auf sich hat, die auf den betroffenen Türen stand. Und wer ist dieser Bretone, der auf den Straßen von Paris lateinische Texte vorliest und dabei immer mehr Menschen um sich schart? Die vermeintlichen Pestopfer werden immer mehr, als Adamsberg einen Einfall hat, der absurd erscheint – aber der Schlüssel zu dem mysteriösen Fall sein könnte …
Lesen Sie auch die anderen unabhängig voneinander lesbaren Kriminalromane um Jean-Baptiste Adamsberg!
Autorin
Fred Vargas, geboren 1957, ist ausgebildete Archäologin und hat Geschichte studiert. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin mit internationalem Renommee. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis, 2012 den Europäischen Krimipreis für ihr Gesamtwerk und 2016 den Deutschen Krimipreis in der Kategorie International für »Das barmherzige Fallbeil«.
Von Fred Vargas bei Blanvalet bereits erschienen
Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord · Bei Einbruch der Nacht · Die Nacht des Zorns · Das barmherzige Fallbeil · Der Zorn der Einsiedlerin · Fliehe weit und schnell
Besuchen Sie uns auch auf
www.instagram.com/blanvalet.verlag und
www.facebook.com/blanvalet
Alle unabhängig voneinander lesbaren Bände der
Kommissar-Adamsberg-Reihe:
1. Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord
2. Bei Einbruch der Nacht
3. Fliehe weit und schnell
4. Der vierzehnte Stein
5. Die dritte Jungfrau
6. Der verbotene Ort
7. Die Nacht des Zorns
8. Das barmherzige Fallbeil
9. Der Zorn der Einsiedlerin
Fred Vargas
Fliehe weit und schnell
Kommissar Adamsberg ermittelt
Der 3. Fall
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Pars vite et reviens tard« bei Éditions Viviane Hamy, Paris.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© Copyright der Originalausgabe Fred Vargas und Viviane Hamy, Paris, 2001.
Taschenbuchausgabe 2022 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe
© Deutsche Erstveröffentlichung Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2003, 2012.
Übersetzung: Tobias Scheffel
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: mauritius images / Westend61/Christina Falkenberg
JaB · Herstellung: sam
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-28946-1V002
www.blanvalet.de
1
Und dann, wenn Schlangen, Fledermäuse, Dachse und all die anderen Tiere, die in den Tiefen unterirdischer Gänge hausen, in Massen auf die Felder strömen und ihren angestammten Lebensraum verlassen; wenn Obst und Gemüse zu faulen beginnt und von Würmern befallen wird (…)
2
Die Leute in Paris laufen viel schneller als in Le Guilvinec, das hatte Joss schon lange festgestellt. Jeden Morgen strömten die Fußgänger mit einer Geschwindigkeit von drei Knoten durch die Avenue du Maine. An diesem Montag machte Joss fast dreieinhalb Knoten, um eine zwanzigminütige Verspätung aufzuholen. Das lag daran, dass sich der gesamte Kaffeesatz über den Küchenboden verteilt hatte.
Das hatte ihn nicht weiter überrascht. Schon lange hatte Joss begriffen, dass den Dingen ein geheimes, bösartiges Leben innewohnte. Abgesehen vielleicht von bestimmten Deckaufbauten, die ihn noch nie angegriffen hatten, war die Welt der Dinge seit bretonischem Seemannsgedenken ganz offensichtlich von einer Kraft erfüllt, die auf nichts anderes abzielte, als den Menschen zur Weißglut zu treiben. Jeder kleinste Fehler bei der Handhabung löste – indem er dem Ding eine wenn auch noch so unbedeutende plötzliche Freiheit bot – automatisch eine Kettenreaktion von Vorfällen aus, die sich von einer bloßen Unannehmlichkeit bis zur Tragödie steigern konnten. Der Korken, der den Fingern entgleitet, war dabei das Grundmodell in kleiner Form. Denn ein fallen gelassener Korken rollt nicht einfach vor die Füße des Menschen zurück, der ihn fallen lässt, keineswegs. Wie eine Spinne, die an einen unzugänglichen Ort flüchtet, zieht er sich bösartig hinter den Herd zurück und stellt seinen Verfolger, den Menschen, vor eine Reihe unterschiedlichster Bewährungsproben – Verschieben des Herdes, Lösen des Anschlusses, Hinunterfallen des Werkzeugs, Verbrennung. Der Fall heute Morgen war eine etwas komplexere Verkettung mehrerer Elemente, ausgelöst durch einen harmlosen Fehlwurf, der zur Destabilisierung des Abfalleimers sowie seinem seitlichen Kippen und zur Verteilung des Kaffeefilters samt Inhalt auf dem Fußboden geführt hatte. Auf diese Weise gelang es den Dingen, getrieben von legitimen Rachegelüsten, die sich aus ihrem Sklavendasein speisten, für kurze, aber intensive Augenblicke dem Menschen ihrerseits ihre geheimnisvolle Macht aufzuzwingen, ihn dazu zu bringen, sich zu winden und zu kriechen wie ein Hund, wobei sie weder Frauen noch Kinder verschonten. Nein, um nichts in der Welt hätte Joss den Dingen vertraut, ebenso wenig wie den Menschen oder dem Meer. Erstere rauben einem den Verstand, die Zweiten die Seele und Letzteres das Leben.
Als kampferprobter Mensch hatte Joss das Schicksal nicht herausgefordert und den Kaffeesatz aufgesammelt bis zum letzten Krümel, ergeben wie ein Hund. Ohne zu murren, hatte er Buße getan, und die Welt der Dinge hatte sich wieder ins Joch gefügt. Dieser morgendliche Zwischenfall schien unbedeutend, allem Anschein nach nur eine harmlose Unannehmlichkeit, für Joss aber, der sich nicht täuschen ließ, war er eine unmissverständliche Erinnerung daran, dass der Krieg zwischen den Menschen und den Dingen weiterging und dass der Mensch in diesem Kampf nicht immer siegreich war, bei Weitem nicht. Eine Erinnerung an Tragödien, an entmastete Schiffe, an zerschmetterte Trawler und an sein Schiff, Le Vent de Norois, das am 23. August um drei Uhr morgens und mit acht Mann an Bord in der Irischen See leckgeschlagen war. Joss hatte die hysterischen Anwandlungen seines Trawlers bei Gott immer respektiert, und Mensch und Schiff brachten einander bei Gott einiges Verständnis entgegen. Bis zu jener verdammten Sturmnacht, als er in einem Wutanfall mit der Faust auf das Dollbord eingeschlagen hatte. Le Vent de Norois hatte schon fast auf Steuerbord gelegen und war im Heck jäh leckgeschlagen. Die Maschine war buchstäblich abgesoffen, sodass der Trawler die ganze Nacht auf dem Meer trieb, die Männer hatten pausenlos Wasser geschöpft, bis das Schiff schließlich bei Tagesanbruch auf ein Riff gelaufen war. Vor vierzehn Jahren war das gewesen, und zwei Männer hatten dabei ihr Leben gelassen. Vierzehn Jahre war es her, dass Joss den Schiffseigner der Norois mit Tritten vermöbelt hatte. Vierzehn Jahre, dass er den Hafen von Le Guilvinec verlassen hatte, nachdem er neun Monate wegen Körperverletzung mit Tötungsabsicht im Knast gesessen hatte. Vierzehn Jahre war es nun her, dass beinahe sein ganzes Leben in jener Wasserstraße versunken war.
Joss ging die Rue de la Gaîté hinunter, mit zusammengebissenen Zähnen und jener Wut im Bauch, die ihn jedes Mal packte, wenn die im Meer versunkene Vent de Norois auf den Wellenkämmen seiner Erinnerung auftauchte. Im Grunde war es nicht die Norois, gegen die sich sein Groll richtete. Der gute alte Trawler hatte mit dem Ächzen seiner im Lauf der Jahre verrotteten Planken einfach nur auf den Stoß geantwortet. Joss war vollkommen davon überzeugt, dass das Schiff die Tragweite seines kurzen Aufbegehrens nicht ermessen haben konnte und sich seines hohen Alters, seiner Gebrechlichkeit und der Wucht der Wellen in jener Nacht einfach nicht bewusst gewesen war. Mit Sicherheit hatte der Trawler den Tod der zwei Seeleute nicht gewollt, und jetzt, wo er wie ein Idiot in der Tiefe der Irischen See ruhte, bereute er vermutlich alles. Häufig bedachte Joss ihn mit Worten des Trostes und der Absolution und hatte das Gefühl, dass es dem Schiff, wie ihm selbst, mittlerweile gelang, Schlaf zu finden, und dass es sich dort unten ein neues Leben geschaffen hatte, ebenso wie er, Joss, hier in Paris.
Absolution für den Schiffseigner jedoch kam nicht infrage.
»Auf, Joss Le Guern«, hatte dieser gesagt und ihm auf die Schulter geklopft, »bei Ihnen macht’s der Kahn noch zehn Jahre. Er ist kampferprobt, und Sie wissen, wie man mit ihm umgeht.«
»Die Norois ist gefährlich geworden«, hatte Joss hartnäckig wiederholt. »Sie schlingert, und die Beplankung verzieht sich. Die Lukendeckel haben sich gelockert. Bei schwerer See übernehme ich keine Verantwortung mehr. Und das Beiboot entspricht auch nicht mehr den Vorschriften.«
»Ich kenne meine Schiffe, Kapitän Le Guern«, hatte der Eigner in schneidendem Ton erwidert. »Wenn Sie vor der Norois Angst haben, dann brauche ich nur mit den Fingern zu schnippen und hab zehn Männer, die bereit sind, Ihren Posten zu übernehmen. Männer, die Mumm in den Knochen haben und nicht ständig wie Beamte über die Sicherheitsvorschriften jammern.«
»Und ich, ich hab sieben Jungs an Bord.«
Der Eigner hatte sein fettes Gesicht bedrohlich vorgeschoben.
»Falls Sie auf den Gedanken kommen sollten, zum Hafenamt zu gehen und sich dort auszuweinen, Joss Le Guern, dann verlassen Sie sich darauf, dass ich dafür sorge, dass Sie auf der Straße sitzen, bevor Sie’s merken. Und von Brest bis Saint-Nazaire werden Sie nicht einen mehr finden, der Sie einstellt. Ich rate Ihnen, sich das gut zu überlegen, Kapitän.« Ja, Joss bereute immer noch, dass er den Typen am Tag nach dem Untergang der Norois nicht richtig fertiggemacht, sondern ihm nur einen Arm gebrochen und das Brustbein eingeschlagen hatte. Aber ein paar Besatzungsmitglieder hatten ihn mit aller Kraft zurückgehalten. Mach dir nicht alles kaputt, Joss, hatten sie gesagt. Sie hatten sich ihm in den Weg gestellt und ihn davon abgehalten, dem Schiffseigner den Garaus zu machen – und auch dessen Knechten, die ihn nach der Entlassung aus dem Knast aus den Verzeichnissen gestrichen hatten. Joss hatte so laut in allen Kneipen herumgegrölt, die hohen Tiere im Hafenamt würden Provisionen kassieren, dass er der Handelsmarine hatte Lebewohl sagen können. Nachdem er in einem Hafen nach dem anderen abgelehnt worden war, hatte sich Joss schließlich an einem Dienstagmorgen in den Zug Quimper–Paris gesetzt und war, wie so viele Bretonen vor ihm, an der Gare Montparnasse gestrandet. Er hatte eine Frau hinter sich gelassen, die ohnehin schon abgehauen war, sowie neun Typen, die er lieber hätte umbringen sollen.
In Sichtweite der Kreuzung Edgar-Quinet angekommen, verstaute Joss seine nostalgischen Haßgefühle in seinen Gehirnwindungen und beeilte sich, die Verspätung aufzuholen. Diese ganzen Geschichten mit dem Kaffeesatz, dem Krieg der Dinge und dem Krieg der Menschen hatten ihn mindestens eine Viertelstunde gekostet. Nun war aber gerade Pünktlichkeit ein Schlüsselelement seiner Arbeit, und er legte großen Wert darauf, dass die erste Ausgabe seiner ausgerufenen Nachrichten um acht Uhr, die zweite um zwölf Uhr fünfunddreißig und die Abendausgabe um achtzehn Uhr zehn begann. Zu diesen Zeiten war der Andrang am größten, und die Zuhörer hatten es in dieser Stadt viel zu eilig, um auch nur die geringste Verzögerung zu dulden.
Joss nahm die Urne von dem Baum, an dem er sie immer mittels eines doppelten Bulinknotens und zweier Schlösser für die Nacht befestigte, und wog sie in der Hand. Nicht schwer heute Morgen, er würde die Lieferung recht schnell sortieren können. Er lächelte kurz, während er den Kasten in die Werkstatt hinter dem Laden trug, die Damas ihm zur Verfügung stellte. Es gab noch anständige Typen auf der Welt, Typen wie Damas, die einem einen Schlüssel und die Ecke eines Tischs überließen, ohne gleich Angst zu haben, man würde mit der Kasse abhauen. Damas, was für ein Vorname. Er war Inhaber des Rollerskates-Geschäfts am Platz, Roll-Rider, und gewährte Joss Zutritt, damit er seine Ausgaben im Trockenen vorbereiten konnte. Roll-Rider, was für ein Name.
Joss entriegelte die Urne – einen groben Holzkasten, den er eigenhändig aus Schiffsplanken gezimmert und auf den Namen Le Vent de Norois II getauft hatte, um dem lieben Verstorbenen die Ehre zu erweisen. Vielleicht war es ja nicht sehr schmeichelhaft für einen großen Hochseetrawler, einen gemeinen Briefkasten in Paris als Nachkommen zu haben, doch es war schließlich kein beliebiger Kasten. Es war ein genialer Kasten, entworfen nach einer genialen Idee, die vor sieben Jahren das Licht der Welt erblickt und es Joss ermöglicht hatte, wieder fabelhaft auf die Beine zu kommen, nach drei Jahren Arbeit in einer Konservenfabrik, sechs Monaten in einem Spulenwerk und zwei Jahren Arbeitslosigkeit. Die geniale Idee war ihm in einer Dezembernacht gekommen, als er, zusammengesackt, ein Glas in der Hand, in einem zu drei Vierteln mit vereinsamten Bretonen gefüllten Café in Montparnasse das ewige Dröhnen der Stimmen seiner Heimat vernahm. Ein Mann hatte von Pont-l’Abbé gesprochen, und so geschah es, dass der Ururgroßvater Le Guern, geboren im Jahre 1832 in Locmaria, Joss’ Kopf entstieg, sich an die Bar lehnte und »Salut« zu ihm sagte. »Salut«, erwiderte Joss.
»Erinnerst du dich an mich?«, fragte der Alte.
»Jaja«, brummte Joss. »Ich war noch nicht geboren, als du gestorben bist, und hab nicht geweint.«
»Sag mal, Söhnchen, könntest du aufhören, Blödsinn zu faseln, wenn ich dich schon mal besuchen komme? Wie alt bist du?«
»Fünfzig.«
»Das Leben hat’s nicht gut mit dir gemeint. Siehst älter aus.«
»Ich kann auf deine Bemerkungen verzichten, ich hab dich nicht um Rat gefragt. Und du sahst auch nicht besonders gut aus.«
»Pass auf, wie du mit mir sprichst, Junge. Du weißt, wie es ist, wenn ich mich aufrege.«
»Jaja, das haben alle gewusst. Vor allem deine Frau, die du ihr Leben lang vermöbelt hast.«
»Na ja«, erwiderte der Alte und verzog das Gesicht, »so war halt das Jahrhundert. Das wurde von einem verlangt.«
»Das Jahrhundert, leck mich doch. Du warst es, der es so wollte. Du hast ihr ein Auge eingeschlagen.«
»Sag mal, wir werden doch nicht noch zwei Jahrhunderte über das Auge reden?«
»Doch. Ist ein gutes Beispiel.«
»Ausgerechnet du kommst mir mit Beispielen, Joss? Der Joss, der auf den Kais von Le Guilvinec einen Mann fast zu Tode getreten hat? Oder irre ich mich?«
»Erstens war das keine Frau und zweitens nicht mal ein Mann. Es war ein Geldsack, dem es scheißegal war, ob die anderen verreckten, Hauptsache, seine Kasse stimmte.«
»Jaja, ich weiß. Du hattest nicht unrecht. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum du mich herbestellt hast, Söhnchen, oder?«
»Ich hab’s dir schon gesagt. Ich hab dich nicht herbestellt.«
»Du bist ein sturer Hund. Hast Glück, dass du ganz nach mir kommst, sonst hätt ich dir längst eine verpasst. Kapier endlich, dass ich nur hier bin, weil du mich herbestellt hast, so ist das, und nicht anders. Übrigens gehe ich nicht in solche Kneipen, ich mag die Musik nicht.«
»Gut«, meinte Joss und gab sich geschlagen. »Soll ich dir einen ausgeben?«
»Wenn du den Arm noch hochbringst. Ich muss sagen, du hast schon ganz schön einen sitzen.«
»Behalt’s für dich, Alter.«
Der Vorfahr zuckte mit den Achseln. Er hatte schon ganz andere Sachen erlebt, und diese Rotznase würde ihn nicht auf die Palme bringen. Aber ein Le Guern, der Klasse hatte, dieser Joss, da konnte man nichts sagen.
»Du hast also keine Frau und keine Kohle?«, fuhr der Alte fort und stürzte seinen Chouchen hinunter.
»Du triffst den Nagel auf den Kopf«, antwortete Joss. »Zu deiner Zeit warst du nicht so helle, nach allem, was man sich so erzählt.«
»Das kommt, weil ich ein Gespenst bin. Wenn man tot ist, weiß man Sachen, die man vorher nicht gewusst hat.«
»Sag bloß«, erwiderte Joss und winkte lasch in Richtung Kellner.
»Was die Frauen angeht, hätte sich’s nicht gelohnt, mich um Rat zu fragen, da kenn ich mich nicht so gut aus.«
»Das hab ich fast vermutet.«
»Aber das mit der Arbeit ist kein Hexenwerk, mein Junge. Mach einfach das, was deine Familie gemacht hat. Im Spulenwerk hattest du nichts verloren, das war ein Fehler. Außerdem, denk dran, man darf den Dingen nicht trauen. Mit Tauwerk geht’s noch, aber Trommeln und Draht … Von Korken will ich schon gar nicht reden, da sucht man besser gleich das Weite.«
»Ich weiß«, sagte Joss.
»Man muss seine Begabungen nutzen. Mach’s wie die Familie.«
»Ich kann nicht mehr Seemann sein«, entgegnete Joss gereizt. »Ich bin unerwünscht.«
»Wer spricht denn von Seemann? Es gibt doch noch mehr im Leben als Fische, Herr im Himmel, das fehlte noch. War ich etwa Seemann?«
Joss leerte sein Glas und konzentrierte sich auf die Frage.
»Nein«, sagte er nach einer Weile. »Du warst der Ausrufer. Von Concarneau bis Quimper warst du der Nachrichtenausrufer.«
»Jaa, mein Junge, und darauf bin ich stolz. ›Ar Bannour‹ war ich, der ›Ausrufer‹. Es gab keinen Besseren an der Südküste als mich. Jeden Tag, den Gott schuf, ist Ar Bannour in ein neues Dorf gegangen und hat mittags die Nachrichten ausgerufen. Und ich kann dir sagen, dass da eine Menge Leute standen, die seit Tagesanbruch auf mich warteten. Siebenunddreißig Dörfer hatte ich in meinem Gebiet, ist das nichts, na? Ganz schön viele Leute, wie? Eine Menge Leute, die Verbindung zum Rest der Welt hatten. Und zwar wie? Dank der Nachrichten. Und dank wem? Dank mir, Ar Bannour, dem besten Nachrichtensammler des Finistère. Meine Stimme schallte von der Kirche bis zum Waschhaus, und um Worte war ich nie verlegen. Jeder reckte den Kopf, um mich zu hören. Meine Stimme brachte die Welt, das Leben, und das war was anderes als Fische, das kannst du mir glauben.«
»Jaja«, sagte Joss, während er sich nun selbst aus der Flasche nachschenkte, die auf der Theke stand.
»Das Zweite Kaiserreich, das habe ich ausgerufen. Bis nach Nantes bin ich gegangen, um Neuigkeiten zu erfahren, bin dann mit ihnen zurückgeritten, und immer noch waren sie so frisch wie Ebbe und Flut. Die Dritte Republik habe ich über alle Strände ausgerufen, das Spektakel hättest du sehen sollen. Ganz zu schweigen von den lokalen Ereignissen: Hochzeiten, Todesfälle, Streitigkeiten, Fundsachen, abhandengekommene Kinder, zu beschlagende Hufe, ich war es, der all das verbreitete. Von Dorf zu Dorf gab man mir Nachrichten mit, die ich zu verlesen hatte. Die Liebeserklärung von dem Mädchen aus Penmarch an einen Jungen aus Sainte-Marine, ich erinnere mich noch genau. Ein Skandal, der sich gewaschen hatte, und danach ein Mord.«
»Du hättest dich zurückhalten können.«
»Mensch, ich wurde fürs Vorlesen bezahlt. Wenn ich nicht vorgelesen hätte, hätte ich die Kunden bestohlen, und die Le Guerns sind vielleicht eine rohe Sippe, aber keine Gauner. Die Dramen, Liebesgeschichten und Eifersüchteleien dieser Fischer waren nicht meine Angelegenheiten. Ich hatte genug damit zu tun, mich um meine eigene Familie zu kümmern. Einmal im Monat bin ich im Dorf vorbeigekommen, um die Bälger zu sehen, in die Messe zu gehen und mir einen hinter die Binde zu gießen.«
Joss seufzte in sein Glas.
»Und um Geld dazulassen«, ergänzte der Ururgroßvater mit fester Stimme. »Eine Frau und acht Bälger, die fressen einem die Haare vom Kopf. Aber glaub mir, Ar Bannour hat sich immer um sie gekümmert.«
»Mit Ohrfeigen?«
»Mit Moneten, Dummkopf.«
»Das hat so viel eingebracht?«
»Soviel du wolltest. Wenn es irgendetwas gibt, das auf der Welt immer geht, dann sind es Nachrichten, und wenn es einen Durst gibt, der nie gestillt wird, dann ist es die menschliche Neugier. Wenn du Ausrufer bist, gibst du der ganzen Menschheit die Brust. Und du kannst sicher sein, dass die Milch nie ausgeht und es immer genügend Münder gibt. Aber wenn du so viel säufst, Söhnchen, kannst du nie Ausrufer werden. Das ist ein Beruf, der einen klaren Kopf erfordert.«
»Ich will dich nicht enttäuschen, Großvater«, sagte Joss kopfschüttelnd, »aber ›Ausrufer‹ ist heutzutage kein Beruf mehr. Würdest nicht mal mehr jemand finden, der das Wort kapiert. ›Schuster‹ schon, aber ›Ausrufer‹, das steht nicht mal im Wörterbuch. Ich weiß nicht, ob du dich seit deinem Tod auf dem Laufenden gehalten hast, aber die Welt hier hat sich ganz schön verändert. Man muss niemandem mehr auf dem Kirchplatz die Ohren vollschreien, alle lesen Zeitung, haben Radio und Fernsehen. Und wenn du in Loc Tudy ins Internet gehst, erfährst du, ob in Bombay jemand gegen ’nen Baum gepisst hat. Denk mal drüber nach.«
»Hältst du mich für einen alten Idioten?«
»Ich klär dich bloß auf. Jetzt bin ich dran.«
»Dir entgleitet das Ruder, armer Joss. Geh wieder auf Kurs. Hast nicht viel verstanden von dem, was ich dir gesagt habe.«
Joss richtete seinen leeren Blick auf die stattliche Gestalt des Ururgroßvaters, der von seinem Barhocker herunterstieg. Ar Bannour war für seine Zeit groß gewesen. Und es stimmte, er selbst hatte Ähnlichkeit mit diesem Grobian.
»Der Ausrufer«, sagte der Ahn mit Nachdruck und schlug mit der Hand auf die Theke, »ist das Leben. Und sag mir nicht, dass niemand mehr versteht, was das Wort bedeutet, und auch nicht, dass es in keinem Wörterbuch mehr steht, oder du sagst damit, dass die Le Guerns aus der Art geschlagen sind und es nicht mehr verdienen, es auszurufen, das Leben!«
»Armer alter Idiot«, brummte Joss, als er seinem Urahn hinterhersah. »Armer alter Schwätzer.«
Er stellte sein Glas auf die Theke und grölte ihm nach:
»Ich hab dich nicht um Rat gefragt, damit das klar ist!«
»Jetzt reicht’s aber«, rief der Kellner und packte ihn am Arm. »Seien Sie vernünftig, Sie stören die anderen Gäste.«
»Ich scheiß auf die Gäste!«, brüllte Joss und klammerte sich an die Theke.
Dann, so erinnerte sich Joss, hatten ihn zwei Typen, die kleiner waren als er, aus der Bar d’Artimon hinausbefördert, und er war gut hundert Meter die Fahrbahn entlanggewankt. Neun Stunden später war er in einem Hauseingang aufgewacht, mehr als zehn Metrostationen von der Bar entfernt. Gegen Mittag hatte er sich in sein Zimmer geschleppt, die Hände um seinen berstenden Schädel gepresst und dann bis zum nächsten Morgen um sechs Uhr geschlafen. Unter Schmerzen hatte er die Augen aufgeschlagen, die schmutzige Decke seines Zimmers angestarrt und voller Starrsinn gemurmelt:
»Armer alter Idiot.«
Sieben Jahre war es nun her, dass Joss nach einigen schwierigen Monaten der Einarbeitung – den richtigen Ton treffen, der eigenen Stimme Natürlichkeit verleihen, den Standort aussuchen, die Rubriken bestimmen, Stammkunden gewinnen, die Preise festlegen – den veralteten Beruf des »Ausrufers« ergriffen hatte. Ar Bannour. Mit seiner Urne hatte er verschiedene Stellen in einem Umkreis von siebenhundert Metern um die Gare Montparnasse abgeklappert, von der er sich nicht zu weit entfernen wollte – »für alle Fälle«, wie er sagte –, und sich schließlich vor zwei Jahren an der Ecke Edgar-Quinet-Delambre niedergelassen. Dort zog er Marktgänger und Anwohner an, gewann die Büroangestellten, die sich mit den diskreten Stammkunden der Rue de la Gaîté mischten, und erwischte en passant noch einen Teil der aus der Gare Montparnasse strömenden Menschenmenge. Kleine, dichtgedrängte Gruppen sammelten sich um ihn und hörten sich die Neuigkeiten an, gewiss weniger zahlreich als jene, die sich um den Urahn Le Guern geschart hatten, aber man musste in Betracht ziehen, dass Joss täglich seines Amtes waltete, und das dreimal.
Dafür kam in der Urne eine recht stattliche Anzahl von Nachrichten zusammen, durchschnittlich um die sechzig pro Tag – morgens viel mehr als abends, da die Nacht heimliche Briefeinwürfe begünstigte –, jede in einem verschlossenen Umschlag und mit einem Fünf-Francs-Stück versehen. Fünf Francs, um die eigenen Gedanken, die eigene Annonce, die eigene Suchanzeige hören zu können, die man dem Wind von Paris anvertraute, das war nicht zu teuer. Joss hatte es am Anfang mit einem Billigtarif versucht, aber die Leute mochten es nicht, wenn man ihre Worte für einen Franc verschleuderte. Das entweihte ihre Opfergabe. Der Preis kam sowohl den Gebern als auch dem Empfänger entgegen, und so strich Joss monatlich seine neuntausend Francs netto ein, die Sonntage inbegriffen.
Der alte Ar Bannour hatte recht gehabt: An Material hatte es nie gemangelt, das musste Joss während eines Saufabends in der Bar d’Artimon zugeben. »Vollgestopft mit Sachen, die sie loswerden wollen, die Menschen, ich hab’s dir doch gesagt«, hatte der Vorfahr erklärt, sichtlich zufrieden darüber, dass der Kleine das Geschäft wiederaufgenommen hatte. »Vollgestopft wie alte Strohmatratzen. Vollgestopft mit Dingen, die sie zu sagen haben, und auch solchen, die man nicht sagt. Du, du sammelst alles ein und erweist der Menschheit damit einen Dienst. Du bist so was wie der Entlüftungshahn. Aber aufgepasst, Söhnchen, so ganz ohne ist das nicht. Beim Wühlen in der Tiefe wirst du klares Wasser hochpumpen, aber genauso gut auch Scheiße. Pass auf deinen Arsch auf, die Menschen haben nicht nur Schönes im Kopf.«
Der Vorfahr hatte recht. Am Boden der Urne fand sich Sagbares und Nicht-Sagbares. »Unsagbares«, hatte der Gelehrte – der Alte, der neben Damas’ Laden eine Art Hotel führte – verbessert. Nachdem Joss den Kasten geleert hatte, begann er zwei Stapel aufzutürmen, den Stapel des Sagbaren und den des Nicht-Sagbaren. Gewöhnlich floss das Sagbare auf natürlichem Wege ab, das heißt durch den Mund der Menschen, als kleiner Bach oder als dröhnender Strom, was verhinderte, dass die Menschen unter dem Druck der angehäuften Wörter explodierten. Denn im Unterschied zur Strohmatratze kam beim Menschen jeden Tag neues Material hinzu, wodurch die Frage des Ablassens geradezu lebenswichtig wurde. Von diesem Sagbaren gelangte ein trivialer Teil bis in die Urne zu den Rubriken VERKAUFEN, KAUFEN, SUCHE, LIEBE, DIVERSEÄUSSERUNGEN, TECHNIK, wobei Joss die Zahl der Anzeigen der letzten Rubrik begrenzte und sie mit sechs Francs berechnete, als Entschädigung für den Verdruss, den sie ihm beim Vorlesen bereiteten.
Was der Ausrufer aber vor allem entdeckt hatte, war die ungeahnte Menge an Unsagbarem. Ungeahnt, weil in der Strohmatratze keine Öffnung vorgesehen war für das Ablassen dieser Wortmasse. Etwa weil die in ihr steckende Gewalt oder Dreistigkeit die Grenzen des Zulässigen überschritt, oder, im Gegenteil, weil sie nicht zu einem Grad allgemeiner Wichtigkeit emporsteigen konnte, der ihr Dasein gerechtfertigt hätte. Diese maßlosen wie auch die kümmerlichen Worte waren zu einem Leben in völliger Abgeschlossenheit verdammt, im Füllmaterial versteckt, unfähig, einen Ausgang zu finden, im Schatten, in der Schande und im Schweigen dahinlebend. Und doch starben sie nicht einfach ab, das hatte der Ausrufer in sieben Jahren Erntetätigkeit begriffen. Sie häuften sich an, überlagerten sich gegenseitig, verbitterten im Laufe ihrer Maulwurfsexistenz und sahen dabei wutschäumend dem aufreizenden Kommen und Gehen der flüssigen und zugelassenen Worte zu. Mit der Urne, die mit einem schmalen, tags wie nachts geöffneten Schlitz von zwölf Zentimeter Länge versehen war, hatte der Ausrufer eine Bresche geschlagen, durch die die Gefangenen wie ein Schwarm Heuschrecken entkamen. Es verging kein Morgen, an dem er nicht Unsagbares vom Boden seines Kastens schöpfte, Standpauken, Beschimpfungen, Verzweiflung, Verleumdungen, Denunziationen, Drohungen, blanken Irrsinn. Unsagbares, das mitunter so armselig, so hoffnungslos schwach war, dass man Mühe hatte, den Satz zu Ende zu lesen. Manchmal so verschachtelt, dass man den Sinn nicht zu fassen bekam. Bisweilen so zäh, dass einem schier das Blatt aus der Hand fiel. Und manchmal so hasserfüllt, so zerstörerisch, dass der Ausrufer es beiseitelegte.
Denn der Ausrufer sortierte aus.
Obwohl er ein pflichtbewusster Mensch und darauf bedacht war, den am stärksten bedrängten Ausschuss des menschlichen Denkens dem Nichts zu entreißen und das erlösende Werk, das der Vorfahr begonnen hatte, fortzusetzen, nahm der Ausrufer für sich das Recht in Anspruch, auszusondern, was er selbst nicht über die Lippen brachte. Die nicht vorgelesenen Mitteilungen konnten zusammen mit dem Fünf-Francs-Stück wieder abgeholt werden, denn – und das hatte ihm der Vorfahr eingetrichtert – die Le Guerns waren keine Gauner. Jedes Mal, wenn Joss ausrief, breitete er den Tagesausschuss auf seinem Kasten aus, der ihm als Podest diente. Es war immer etwas dabei. Alles, was Frauen aufs Korn nahm, alles, was Schwarze, Braune, Gelbe und Schwule zum Teufel wünschte, wanderte in den Ausschuss. Instinktiv ahnte Joss, dass er durchaus als Frau, Schwarzer oder Schwuler hätte geboren werden können und dass die Zensur, die er ausübte, keine Großmut war, sondern schlicht ein Überlebensreflex.
Einmal im Jahr, während der Flaute zwischen dem 11. und dem 16. August, brachte Joss die Urne ins Trockendock, um sie auszubessern, abzuschleifen und ihr einen neuen Anstrich zu verpassen – hellblau über der Wasserlinie, ultramarinblau darunter, den Schriftzug Le Vent de Norois in Schwarz auf der Vorderseite, in großen, säuberlich geschriebenen Lettern, die Geschäftszeiten auf Backbord und die Preise sowie Weitere diesbezügliche Bedingungen auf Steuerbord. Diesen Ausdruck hatte er bei seiner Verhaftung und dann bei seiner Verurteilung oft gehört und als Andenken mitgenommen. Joss dachte, die Wendung »diesbezüglich« verleihe dem Beruf des Ausrufers etwas Seriöses, auch wenn der Gelehrte aus dem Hotel was daran auszusetzen hatte. Ein Typ, bei dem er nicht recht wusste, was er von ihm halten sollte, dieser Hervé Decambrais. Ein Adliger, ohne jeden Zweifel, jemand, der wirklich Stil hatte, aber finanziell derartig heruntergekommen, dass er die vier Zimmer seiner ersten Etage untervermieten und seine bescheidenen Einkünfte durch den Verkauf von Häkeldeckchen und den Vertrieb von küchenpsychologischen Ratschlägen aufbessern musste. Er selbst lebte eingegraben in zwei Zimmern im Erdgeschoss, umgeben von Bücherstapeln, die ihm immer mehr Platz wegnahmen. Und auch wenn Hervé Decambrais Tausende von Wörtern verschlungen hatte, fürchtete Joss nicht, dass er daran ersticken würde, denn der aristokratische Pinkel redete ziemlich viel. Er verschlang und spie den ganzen Tag Wörter, wie eine richtige Pumpe, mit komplizierten Wendungen, die man nicht immer verstand. Damas begriff auch nicht alles, was irgendwie beruhigend war, aber Damas war nicht gerade eine Leuchte.
Als Joss den Inhalt seiner Urne auf den Tisch schüttete und sich anschickte, das Sagbare vom Unsagbaren zu trennen, verharrte seine Hand auf einem großen, dicken Umschlag in gebrochenem Weiß. Zum ersten Mal fragte er sich, ob nicht der Gelehrte der Verfasser dieser großzügigen Botschaften war – im Umschlag steckten immer zwanzig Francs –, die er seit drei Wochen erhielt, die unangenehmsten, die er in den sieben Jahren je vorgelesen hatte. Joss riss den Umschlag auf, der Ahn blickte ihm über die Schulter. »Pass auf deinen Arsch auf, Joss, die Menschen haben nicht nur Schönes im Kopf.«
»Schnauze«, erwiderte Joss.
Er faltete das Blatt auseinander und las mit leiser Stimme:
»Und dann, wenn Schlangen, Fledermäuse, Dachse und all die anderen Tiere, die in den Tiefen unterirdischer Gänge hausen, in Massen auf die Felder strömen und ihren angestammten Lebensraum verlassen; wenn Obst und Gemüse zu faulen beginnt und von Würmern befallen wird (…)«
Auf der Suche nach einer Fortsetzung drehte Joss das Blatt um, aber der Text brach an der Stelle ab. Er schüttelte den Kopf. Er hatte schon viele verstörte Worte ans Tageslicht befördert, aber dieser Typ war rekordverdächtig.
»Bescheuert«, brummte er. »Reich und bescheuert.«
Er legte das Blatt wieder auf den Tisch und öffnete rasch die übrigen Umschläge.
3
Hervé Decambrais erschien ein paar Minuten vor dem Beginn des Halb-neun-Ausrufens. Er lehnte sich an den Türrahmen und wartete auf das Erscheinen des Bretonen. Seine Beziehung zu dem Fischer war von Schweigen und Feindseligkeit geprägt. Decambrais gelang es nicht herauszufinden, wieso. Er neigte dazu, die Verantwortung dafür dem ungeschliffenen, wie aus Granit gemeißelten und wahrscheinlich gewalttätigen Burschen zuzuschieben, der vor zwei Jahren mit seiner Kiste, seiner albernen Urne und seiner Ausruferei, mit der er der Öffentlichkeit dreimal am Tag eine Tonne kümmerliche Scheiße vor die Füße warf, aufgetaucht war und die empfindliche Ordnung seines Lebens durcheinandergebracht hatte. Anfangs hatte er dem keine Bedeutung beigemessen, er war überzeugt davon, dass der Kerl keine Woche durchhalten würde. Aber die Sache mit dem Ausrufen hatte bemerkenswert gut funktioniert, der Bretone hatte seine Kundschaft fest vertäut und hatte sozusagen Tag für Tag volles Haus, wirklich eine Belästigung.
Um nichts in der Welt hätte Decambrais auf das Schauspiel dieser Belästigung verzichtet, und um nichts in der Welt hätte er das zugegeben. Jeden Morgen nahm er daher mit einem Buch in der Hand seinen Platz ein, hörte dem Ausrufer mit gesenktem Blick zu und blätterte dabei die Seiten um, wobei er in seiner Lektüre nicht eine Zeile weiterkam. Zwischen zwei Rubriken warf Joss Le Guern ihm manchmal einen kurzen Blick zu. Decambrais mochte diesen kurzen Blick aus blauen Augen nicht. Es schien ihm, als wolle der Ausrufer sich seiner Anwesenheit vergewissern, als stelle er sich vor, auch ihn mit der Zeit an der Angel zu haben wie einen gewöhnlichen Fisch. Denn der Bretone hatte nichts anderes getan, als seine rohen Fischerreflexe auf die Stadt anzuwenden und wie ein wirklich professioneller Fänger die Schwärme der Passanten in seinen Netzen zu fangen, als handele es sich um Kabeljau. Passanten, Fische – das war ein und dasselbe in seinem runden Kopf: Er nahm sie aus, um ein Geschäft zu machen.
Aber Decambrais hatte es gepackt, und er kannte die menschliche Seele zu gut, um das nicht zu wissen. Nur das Buch, das er in der Hand hielt, unterschied ihn noch von den anderen Zuhörern auf dem Platz. Wäre es nicht angemessener, das verdammte Buch wegzulegen und dreimal am Tag dazu zu stehen, dass er nichts war als ein Fisch? Also ein Besiegter, ein von dem albernen Ruf der Straße mitgerissener Homme de lettre?
Joss Le Guern hatte sich an diesem Morgen ein wenig verspätet, was höchst ungewöhnlich war, und aus den Augenwinkeln beobachtete Decambrais, wie der Fischer herbeieilte und die leere Urne solide am Stamm der Platane befestigte, diese Urne in schreiendem Blau mit dem anmaßenden Namen Le Vent de Norois II. Decambrais fragte sich, ob der Fischer noch ganz richtig im Kopf war. Er hätte gern gewusst, ob Le Guern auf diese Weise wohl seinen ganzen Besitz benannt hatte, ob seine Stühle, sein Tisch einen Namen trugen. Dann sah er zu, wie Joss sein schweres Podest mit seinen Hafenarbeiterhänden umdrehte, es ebenso leichthändig auf den Bürgersteig stellte, wie er mit einem Vogel umgegangen wäre, mit einem großen, energischen Schritt hinaufstieg, als ginge er an Bord, und die Blätter aus seiner Matrosenbluse zog. Etwa dreißig Personen warteten geduldig, darunter Lizbeth, immer treu auf ihrem Posten, die Hände an den Hüften.
Lizbeth bewohnte bei ihm das Zimmer Nr. 3, und statt Miete zu zahlen, trug sie dazu bei, dass seine kleine inoffizielle Pension reibungslos funktionierte. Eine entscheidende, strahlende, unersetzbare Hilfe. Decambrais lebte in steter Furcht vor dem Tag, an dem ihm jemand seine herrliche Lizbeth klauen würde. Irgendwann würde dies unweigerlich geschehen. Lizbeth war groß, dick und schwarz und von Weitem zu sehen. Es bestand daher keinerlei Hoffnung, sie vor den Augen der Welt zu verbergen. Umso weniger, als Lizbeth kein diskretes Temperament hatte, laut redete und großzügig ihre Meinung zu allem und jedem verbreitete. Das Gravierendste dabei war, dass Lizbeths Lächeln, das glücklicherweise nicht häufig auf ihrem Gesicht erschien, ein kaum zu unterdrückendes Bedürfnis auslöste, sich in ihre Arme zu werfen, sich gegen ihren dicken Busen zu drücken und sich dort für immer häuslich einzurichten. Sie war zweiunddreißig Jahre alt, und eines Tages würde er sie verlieren. Einstweilen machte Lizbeth dem Ausrufer Vorhaltungen.
»Du bist heute spät dran, Joss«, sagte sie mit zurückgebogenem Oberkörper, den Kopf zu ihm emporgereckt.
»Ich weiß, Lizbeth«, keuchte der Ausrufer außer Atem. »Das liegt am Kaffeesatz.«
Lizbeth war mit zwölf Jahren dem Schwarzenghetto von Detroit entrissen und gleich nach ihrer Ankunft in der französischen Hauptstadt in ein Bordell gesteckt worden, wo sie vierzehn Jahre lang auf dem Straßenstrich der Rue de la Gaîté Französisch gelernt hatte. Bis zu dem Tag, an dem alle Peep-Shows des Viertels sie wegen ihrer Korpulenz vor die Tür gesetzt hatten. Zehn Nächte hatte sie bereits auf einer Bank auf dem Platz verbracht, als Decambrais an einem kalten, regnerischen Abend beschlossen hatte, sie dort aufzusuchen. Von den vier Zimmern, die er im Obergeschoss seines alten Hauses vermietete, war eines frei. Er hatte es ihr angeboten. Lizbeth hatte eingewilligt, sich, kaum war sie im Zimmer, ausgezogen, mit im Nacken verschränkten Armen, den Blick zur Decke gerichtet, auf den Teppich gelegt und darauf gewartet, dass der Alte der Aufforderung nachkam.
»Das ist ein Missverständnis«, hatte Decambrais gemurmelt und ihr ihre Kleider hingestreckt. »Ich habe nichts anderes zum Bezahlen«, hatte Lizbeth geantwortet und sich mit übereinandergeschlagenen Beinen aufgerichtet. »Ich komme mit dem Haushalt, dem Abendessen für die Pensionsgäste, den Einkäufen, dem Servieren hier nicht mehr zurecht«, hatte Decambrais, den Blick starr auf den Teppich geheftet, gesagt. »Helfen Sie mir ein bisschen, und ich überlasse Ihnen das Zimmer.« Lizbeth hatte gelächelt, und Decambrais hätte sich beinahe an ihren Busen geworfen. Aber er fand sich alt, und er war der Ansicht, die Frau habe ein Recht auf Ruhe. Diese Ruhe hatte Lizbeth sich genommen: Sechs Jahre war sie jetzt da, und er wusste von keiner Liebschaft. Lizbeth erholte sich, und er betete darum, dass das noch ein bisschen andauern möge.
Das Ausrufen hatte begonnen, und eine Anzeige folgte auf die nächste. Decambrais merkte, dass er den Anfang verpasst hatte, der Bretone war bereits bei Anzeige Nr. 5. Das war das System. Man merkte sich die Nummer, die einen interessierte, und wandte sich an den Ausrufer »wegen weiterer diesbezüglicher« Einzelheiten. Decambrais fragte sich, wo er diesen Gendarmerieausdruck wohl aufgeschnappt haben mochte.
»Fünf«, rief Joss. »Verkaufe einen Wurf Katzen, drei Kater, zwei Katzen. Sechs: Diejenigen, die gegenüber von Haus Nr. 36 mit ihrer Urwaldmusik die ganze Nacht Radau machen, werden gebeten, damit aufzuhören. Manche Leute möchten schlafen. Sieben: Tischlereiarbeiten aller Art, Restaurierung alter Möbel, bestes Ergebnis, Abholung und Lieferung. Acht: Strom- und Gaswerke sollen sich zum Teufel scheren. Neun: Die Kammerjäger sind die reinsten Abzocker: Hinterher gibt es genauso viele Kakerlaken wie vorher, aber dafür wollen sie sechshundert Francs. Zehn: Ich liebe dich, Hélène. Ich warte heute Abend auf dich im ›Chat qui danse‹. Bernard. Elf: Schon wieder ein verregneter Sommer, und jetzt ist schon September. Zwölf: An den Fleischer am Platz: Das Fleisch gestern war zäh, und das zum dritten Mal diese Woche. Dreizehn: Jean-Christophe, komm zurück. Vierzehn: Bullen gleich korrupt gleich Dreckskerle. Fünfzehn: Verkaufe Äpfel und Birnen aus dem Garten, aromatisch, saftig.«
Decambrais warf Lizbeth einen Blick zu, die sich die Zahl 15 notierte. Seitdem es den Ausrufer gab, fand man ausgezeichnete Ware zu moderaten Preisen, was sich als vorteilhaft für das Abendessen der Pensionsgäste erwies. Decambrais hatte ein Blatt Papier zwischen die Seiten seines Buches gesteckt und wartete, einen Bleistift in der Hand. Seit einiger Zeit, drei Wochen vielleicht, deklamierte der Ausrufer ungewöhnliche Texte, die ihn nicht stärker zu irritieren schienen als der Verkauf von Äpfeln oder Autos. Diese außergewöhnlichen, raffinierten, absurden oder bedrohlichen Botschaften tauchten jetzt regelmäßig in der Morgenausgabe auf. Vor zwei Tagen hatte Decambrais sich entschlossen, sie sich unauffällig zu notieren. Sein vier Zentimeter langer Bleistift verschwand vollständig in seiner Hand.
Der Ausrufer begann gerade mit der Wetterberichtpause. Er verkündete den Wetterbericht, indem er von seinem Podest aus mit emporgestreckter Nase den Himmel studierte, und endete dann mit einem Seewetterbericht, der für alle Umstehenden absolut nutzlos war. Aber niemand, nicht einmal Lizbeth, wäre auf den Gedanken gekommen, ihm zu sagen, er könne seine Rubrik einpacken. Man hörte zu, wie in der Kirche.
»Unwirtliches Septemberwetter«, erklärte der Ausrufer, das Gesicht zum Himmel gewandt. »Aufklaren nicht vor sechzehn Uhr zu erwarten, abends etwas besser, wer ausgehen will, kann das tun, nehmen Sie dennoch was Warmes zum Drüberziehen mit, frischer Wind, nachlassend, dann heiter. Seewetterbericht, Nordatlantik, allgemeine Wetterlage heute und weitere Entwicklung: Hochdruckgebiet 1030 südwestlich Irland, mit sich verstärkendem Hochdruckrücken über dem Kanal. Sektor Cap Finistère, Ost bis Nordost, fünf bis sechs im Norden, sechs bis sieben im Süden. Bewegte See, örtlich stark, West bis Nordwest.«
Decambrais wusste, dass der Seewetterbericht seine Zeit dauerte. Er drehte sein Blatt um, um die beiden Annoncen auf der Rückseite zu lesen, die er an den Tagen zuvor notiert hatte:
Zu Fuß unterwegs mit meinem kleinen Diener (den ich nicht zu Hause zu lassen wage, denn bei meiner Frau faulenzt er stets), um mich dafür zu entschuldigen, dass ich nicht zum Diner bei (…) gegangen bin, die, wie ich sehr wohl merke, verärgert ist, weil ich ihr nicht die Möglichkeit verschafft habe, wohlfeil ihre Einkäufe für das große Festmahl zu Ehren der Ernennung ihres Mannes zum Lektor zu erledigen, aber das ist mir egal.
Decambrais runzelte die Stirn und kramte erneut in seinem Gedächtnis. Er war überzeugt, dass es sich bei dem Text um ein Zitat handelte und er es irgendwo, irgendwann in seinem Leben schon einmal gelesen hatte. Wo? Wann? Er sah sich die nächste Botschaft an, die vom Vortag:Zu derlei Zeichen gehöret eine außergewöhnliche Fülle kleiner Tiere, die aus Fäulnis erstehen, wie es Flöhe, Fliegen, Frösche, Kröten, Gewürm, Ratten und dergleichen sind, welcherlei Gethier große Zersetzung bezeugt, sey sie in der Luft, sey sie in der Feuchtigkeit der Erde.
Der Seemann war beim Vorlesen mehrfach gestolpert, hatte »Get-hier« gesagt und das Verb »sej« ausgesprochen. Decambrais hatte den Auszug einem Text aus dem 17. Jahrhundert zugeordnet, war sich jedoch nicht ganz sicher.
Zitate eines Verrückten, eines Besessenen, das war das Wahrscheinlichste. Oder eines Oberlehrers. Oder eines Machtlosen, der danach trachtete, sich Macht zu verschaffen, indem er unverständliche Botschaften verbreitete, sich genüsslich über das Gewöhnliche erhob und dabei dem Mann von der Straße dessen krasse Unbildung demonstrierte. In diesem Falle hörte er ganz sicher zu, stand in der kleinen Menge, um sich an den stumpfsinnigen Gesichtsausdrücken zu weiden, die die gelehrten Botschaften hervorriefen, welche auch der Ausrufer nur mit Mühe las.
Decambrais klopfte mit dem Stift auf das Blatt. Selbst unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, blieben Absicht und Persönlichkeit des Verfassers für ihn im Dunkeln. Sosehr die Anzeige Nr. 14 vom Vortag, Leckt mich doch am Arsch, Ihr Schweinebande, die in ähnlicher Form wohl schon tausendmal gehört worden war, mit ihrer kurzen, summarischen Wut den Vorzug der Klarheit hatte, so sehr sträubten sich die gewundenen Botschaften des Oberlehrers gegen jede Entschlüsselung. Er musste seine Sammlung vergrößern, um zu verstehen, er musste sie Morgen für Morgen hören. Vielleicht war es ja ganz einfach das, was der Verfasser sich wünschte: dass man jeden Tag an seinen Lippen hing.
Der Seewetterbericht war kryptisch zu Ende gegangen, und mit seiner schönen Stimme, die bis an die andere Seite der Kreuzung trug, nahm der Ausrufer die Litanei wieder auf. Er beendete gerade seine Rubrik Sieben Tage in der Welt, in der er auf die ihm eigene Weise die internationalen Nachrichten des Tages in Form goss. Decambrais schnappte die letzten Sätze auf: In China hat keiner was zu lachen, und als ob nichts wäre, regiert dort noch immer der Prügelstock. In Afrika steht’s nicht zum Besten, heute nicht mehr als gestern. Die Chance, dass es sich morgen bessert, ist nicht groß, da sich niemand für die Afrikaner den Arsch aufreißt. Jetzt machte der Ausrufer mit Anzeige 16 weiter, in der ein elektrischer Flipper aus dem Jahr 1965 zum Verkauf angeboten wurde, verziert mit barbusigen Frauen und in einwandfreiem Zustand. Gespannt wartete Decambrais, den Bleistift fest in der Hand. Und die Anzeige kam, deutlich zu identifizieren unter all den Ich liebe dich, ich verkaufe, leckt mich doch und ich kaufe. Decambrais glaubte zu bemerken, dass der Fischer eine halbe Sekunde zögerte, bevor er sich daranmachte. Sodass man sich fragen konnte, ob der Bretone den Eindringling nicht selbst bemerkt hatte.
»Neunzehn«, verkündete Joss. »Und dann, wenn Schlangen, Fledermäuse, Dachse und all die anderen Tiere, die in den Tiefen unterirdischer Gänge hausen, in Massen auf die Felder strömen …«
Decambrais kritzelte rasch auf sein Blatt. Immer diese Geschichten mit Getier, diese alten Geschichten mit diesem fiesen Getier. Nachdenklich las er den ganzen Text noch einmal, während der Seemann das Ausrufen mit der traditionellen Rubrik Blätter aus der Geschichte Frankreichs für alle beendete, die unweigerlich mit dem Bericht eines historischen Schiffbruchs schloss. Möglich, dass dieser Le Guern eines Tages Schiffbruch erlitten hatte. Auch möglich, dass das Schiff Le Vent de Norois hieß. Ganz sicher hatte der Kopf des Bretonen dabei ein Leck bekommen, genau wie der alte Kahn. Dieser so gesund und entschlossen wirkende Mann war ganz tief innen verrückt, er klammerte sich an seine Obsessionen wie an treibende Bojen. Also genau wie er selbst, Decambrais, der weder gesund noch entschlossen wirkte.
»Ville de Cambrai«, erklärte Joss. »15. September 1883. Französischer Dampfer, 1400 Tonnen. Kommt von Dunkerque, auf dem Weg nach Lorient, beladen mit Eisenbahnschienen. Vor Basse Gouach läuft er auf Grund. Explosion des Dampfkessels, ein Passagier stirbt. Besatzung 21 Mann, gerettet.«
Joss Le Guern brauchte kein Zeichen zu geben, um sein Publikum auseinanderzutreiben. Jeder wusste, dass das Ausrufen mit dem Bericht über den Schiffbruch beendet war. Dieser Bericht wurde so sehr herbeigesehnt, dass sich manche angewöhnt hatten, Wetten auf den Ausgang des Dramas abzuschließen. Die Rechnungen wurden dann im Café gegenüber beglichen oder im Büro, je nachdem, ob man auf »alle gerettet«, »alle verloren« oder »weder noch« gewettet hatte. Joss mochte diese Art, aus einer Tragödie Geld zu schlagen, nicht besonders, aber er wusste auch, dass das Leben nun einmal auf Ruinen zu erblühen pflegt und dass das auch gut so ist.
Er sprang von seinem Podest herunter und begegnete dem Blick von Decambrais, der sein Buch wieder einsteckte. Als hätte Joss nicht gewusst, dass er kam, um dem Ausrufen zuzuhören. Dieser alte Heuchler, dieser alte Langweiler, der nicht zugeben wollte, dass ein armer bretonischer Fischer ihm seine Langeweile vertrieb. Wenn der nur wüsste, Decambrais, was er in seiner Morgenlieferung gefunden hatte: Hervé Decambrais fabriziert seine Häkeldeckchen selbst, Hervé Decambrais ist eine Schwuchtel. Nach kurzem Zögern hatte Joss die Botschaft zum Ausschuss getan. Jetzt waren sie zwei, mit Lizbeth zusammen vielleicht drei, die wussten, dass Decambrais heimlich den Beruf der Spitzenklöpplerin ausübte. In gewisser Weise machte die Nachricht ihm den Mann weniger unsympathisch. Vielleicht, weil er seinen Vater so viele Jahre stundenlang die Netze hatte flicken sehen.
Joss sammelte den Ausschuss auf, lud sich die Kiste auf die Schulter, und Damas half ihm, sie im Hinterzimmer zu verstauen. Der Kaffee war heiß, die beiden Tassen standen bereit, wie jeden Morgen nach dem Ausrufen.
»Von der 19 habe ich nichts verstanden«, sagte Damas und setzte sich auf einen hohen Schemel. »Die Geschichte mit den Schlangen. Der Satz ist nicht mal fertig.«
Damas war ein junger, stämmiger, eher hübscher Kerl, sehr freigebig, aber nicht sehr helle. In seinen Augen lag immer eine Art Benommenheit, die ihm einen leeren Blick verlieh. Zu viel Sanftmut oder zu viel Dummheit, Joss konnte sich nicht entscheiden. Damas’ Blick richtete sich nie auf einen bestimmten Punkt, selbst wenn er mit einem redete. Er driftete weg, war unbestimmt, wie Watte, wie ein Nebel, und nicht zu greifen.
»Ein Bekloppter«, kommentierte Joss. »Such nicht lange.«
»Ich suche nicht«, erwiderte Damas.
»Sag, hast du meinen Wetterbericht gehört?«
»Hm, ja.«
»Hast du gehört, dass der Sommer vorbei ist? Meinst du nicht, dass du dich so erkältest?«
Damas trug Shorts und eine Leinenweste auf dem nackten Oberkörper.
»Schon o. k.«, sagte er und sah an sich herunter. »Das muss so sein.«
»Was nützt es dir, deine Muskeln zu zeigen?«
Damas stürzte seinen Kaffee in einem Zug hinunter.
»Das ist hier kein Geschäft für Spitzendeckchen«, antwortete er. »Das ist Roll-Rider. Ich verkaufe Bretter, Surfbretter, Body-Boards, Inline-Skates und Mountainbikes. Das ist gute Werbung für den Laden«, fügte er hinzu und deutete mit dem Daumen auf seinen Oberkörper.
»Wie kommst du auf Spitzendeckchen?«, fragte Joss, plötzlich misstrauisch.
»Weil Decambrais welche verkauft. Und er ist alt und ganz dürr.«
»Weißt du, wo er seine Deckchen herbekommt?«
»Hm, ja. Von einem Großhändler in Rouen. Decambrais ist kein Idiot. Er hat mir eine kostenlose Beratung gegeben.«
»Bist du aus eigenem Antrieb zu ihm gegangen?«
»Na und? ›Berater in Lebensfragen‹ steht doch wohl auf seinem Schild, oder? Ist doch wohl keine Schande, über so was zu reden, Joss.«
»Auf dem Schild steht auch ›40 Francs die halbe Stunde. Jede angefangene Viertelstunde wird berechnet‹. Das ist viel Geld für Hochstapelei, Damas. Was weiß der Alte von Lebensfragen? Er ist nicht mal irgendwann zur See gefahren.«
»Das ist keine Hochstapelei, Joss. Willst du den Beweis? ›Du zeigst deinen Körper nicht wegen dem Geschäft, sondern wegen dir selbst, Damas‹, hat er gesagt. ›Zieh dir was an und versuch, Vertrauen zu haben, ein Ratschlag unter Freunden. Dann bist du genauso schön, siehst aber nicht aus wie ein Idiot.‹ Was sagst du dazu, Joss?«
»Zugegeben, das ist klug«, räumte Joss ein. »Und warum ziehst du dich nicht an?«
»Weil ich tue, was mir gefällt. Nur hat Lizbeth Angst, dass ich mir den Tod hole, und Marie-Belle auch. In fünf Tagen gebe ich mir einen Ruck und zieh mir wieder was an.«
»Gut«, sagte Joss. »Denn von Westen her braut sich ganz schön was zusammen.«
»Decambrais?«
»Was ist mit Decambrais?«
»Kannst du ihn nicht ausstehen?«
»Umgekehrt, Damas. Decambrais ist es, der mich nicht riechen kann.«
»Schade«, sagte Damas, während er die Tassen wegräumte. »Anscheinend ist nämlich eines seiner Zimmer frei geworden. Das wäre gut für dich gewesen. Zwei Schritte von deiner Arbeit, im Warmen, die Wäsche gewaschen und jeden Abend das Essen auf dem Tisch.«
»Verdammt«, bemerkte Joss.
»Ganz richtig. Aber du kannst die Bude nicht nehmen. Da du ihn nicht ausstehen kannst.«
»Nein«, sagte Joss. »Ich kann sie nicht nehmen.«
»Das ist blöd.«
»Sehr blöd.«
»Außerdem ist da noch Lizbeth. Noch ein verdammter Vorzug.«
»Ein gewaltiger Vorzug.«
»Ganz genau. Aber du kannst nicht mieten. Da du ihn nicht ausstehen kannst.«
»Umgekehrt, Damas. Er ist es, der mich nicht riechen kann.«
»Was das Zimmer angeht, kommt das aufs Gleiche raus. Du kannst nicht.«
»Ich kann nicht.«
»Manchmal laufen die Dinge eben nicht so, wie sie sollen. Bist du sicher, dass du nicht kannst?«
Joss’ Kiefermuskeln spannten sich.
»Sicher, Damas. So sicher, dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen.«
Joss verließ den Laden, um ins Café gegenüber zu gehen, Le Viking. Nicht dass Normannen und Bretonen je gut miteinander ausgekommen wären, nicht dass ihre Schiffe in den aneinandergrenzenden Meeren nicht aneinandergeraten wären, aber Joss wusste auch, dass es nur einer Kleinigkeit bedurft hätte, und er wäre auf normannischem Territorium geboren worden. Bertin, der Wirt, ein großer Mann mit rotblondem Haar, hohen Wangenknochen und hellen Augen, servierte einen Calvados, der einzigartig auf der Welt war und im Ruf stand, einem ewige Jugend zu verleihen, indem er einen nicht direkt ins Grab beförderte, sondern das Innere ordentlich aufpeitschte. Angeblich kamen die Äpfel vom eigenen Feld, und dort auf dem Land starben die Stiere erst mit hundert Jahren und waren noch immer feurig. Was für Äpfel das gab, konnte man sich vorstellen.
»Na, geht’s dir heute Morgen nicht gut?«, fragte Bertin besorgt, als er ihm den Calvados hinstellte.
»Ach, nichts. Nur manchmal laufen die Dinge eben nicht so, wie sie sollen«, erklärte Joss. »Würdest du sagen, dass Decambrais mich nicht riechen kann?«
»Nein«, erwiderte Bertin voller normannischer Vorsicht. »Ich würde sagen, er hält dich für einen Rohling.«
»Wo ist da der Unterschied?«
»Sagen wir, im Lauf der Zeit ist da was zu machen.«
»Im Lauf der Zeit, im Lauf der Zeit, das sagt ihr Normannen doch immer. Alle fünf Jahre ein Wort, wenn man Glück hat. Wenn alle es so machen würden wie ihr, würde die Zivilisation nicht gerade schnell vorankommen.«
»Vielleicht käme sie besser voran.«
»Im Lauf der Zeit! Aber im Lauf von wie viel Zeit, Bertin? Das ist die Frage.«
»Nicht lang. Etwa zehn Jahre.«
»Dann ist die Sache erledigt.«
»War es dringend? Wolltest du ihn um Rat fragen?«
»Das fehlte gerade noch. Ich wollte seine Bude.«
»Du tätest gut dran, zu ihm zu gehen, ich glaube, er hat einen Interessenten. Er zögert, weil der Typ verrückt nach Lizbeth ist.«
»Warum soll ich zu ihm gehen, Bertin? Der alte Angeber hält mich für einen Rohling.«
»Das muss man verstehen, Joss. Er ist nie zur See gefahren. Übrigens, bist du etwa kein Rohling?«
»Ich habe nie das Gegenteil behauptet.«
»Siehst du. Decambrais kennt sich aus. Sag, Joss, hast du deine Anzeige 19 verstanden?«
»Nein.«
»Ich fand sie speziell, genauso speziell wie die anderen in den letzten Tagen.«
»Sehr speziell. Ich mag diese Anzeigen nicht.«
»Warum liest du sie dann vor?«
»Weil sie bezahlt sind, und zwar gut bezahlt. Und wir Le Guerns sind vielleicht Rohlinge, aber noch lange keine Gauner.«
4
»Ich frage mich«, sagte Kommissar Adamsberg, »ob ich durch mein ständiges Bulle-Sein nicht langsam zum Bullen werde.«
»Das haben Sie schon mal gesagt«, bemerkte Danglard, der das künftige Ordnungssystem seines Metallschranks plante.
Danglard hatte erklärtermaßen die Absicht, auf einer durchdachten Grundlage zu beginnen. Adamsberg, der keinerlei Absicht hatte, hatte seine Akten auf den Stühlen neben seinem Schreibtisch verteilt.
»Wie denken Sie darüber?«
»Dass das nach fünfundzwanzig Berufsjahren vielleicht eine gute Sache wäre.«
Adamsberg steckte die Hände in die Taschen und lehnte sich mit dem Rücken an die kürzlich gestrichene Wand, während er seinen Blick ziellos durch die neuen Räume schweifen ließ, in denen er vor nicht ganz einem Monat Fuß gefasst hatte. Neue Räume, neues Einsatzgebiet, Strafverfolgungsbrigade der Polizeipräfektur von Paris, Referat Delikte am Menschen. Schluss mit Einbrüchen, Handtaschendiebstählen, Tätlichkeiten, bewaffneten Typen, entwaffneten Typen, aggressiv oder nicht, und mit kiloweise diesbezüglichem Papierkram verbunden. »Diesbezüglich«, das hatte er sich schon zweimal selbst sagen hören in letzter Zeit. Das machte das ständige Bulle-Sein.
Nicht dass die Kilos von diesbezüglichem Papierkram ihn nicht hierher oder anderswohin verfolgen würden. Aber hier genau wie anderswo würde er auf Menschen stoßen, die Papier mochten. Als er in jungen Jahren die Pyrenäen verlassen hatte, hatte er entdeckt, dass es solche Menschen gab, und er hatte großen Respekt, ein bisschen Trauer und gewaltige Dankbarkeit für sie empfunden. Er selbst mochte vor allem Gehen, Träumen und Tun, und er wusste, dass zahlreiche Kollegen ihn daher mit ein wenig Respekt und sehr viel Trauer betrachtet hatten. »Das Papier«, so hatte ihm einmal ein eifriger Kerl erklärt, »das Aufsetzen von Schriftstücken, das Protokoll stehen am Beginn jeglicher Idee. Kein Papier, keine Idee. Das Wort treibt die Idee in die Höhe, wie der Humus die Erbse emporwachsen lässt. Ein Vorgang ohne Papier – und schon stirbt eine Erbse mehr auf der Welt.«
Gut, seitdem er Bulle war, hatte er vermutlich ganzen LKWs voller Erbsen den Tod gebracht. Aber am Ende seines Umherschlenderns hatte er oft gespürt, wie irritierende Gedanken an die Oberfläche drangen. Gedanken, die zweifellos eher Algenbündeln glichen als Erbsen, aber Pflanzliches blieb Pflanzliches, und Idee blieb Idee, und niemand fragte einen, wenn man sie einmal formuliert hatte, ob man sie auf einem bestellten Feld gepflückt oder in einem Schlammloch aufgelesen hatte. So weit, so gut, es war unzweifelhaft, dass sein Stellvertreter Danglard, der Papier in allen Formen liebte, von der höchsten bis zur bescheidensten – in Bündeln, in Büchern, in Rollen, in Blättern, von Inkunabeln bis zum Wischpapier –, ein Mann war, der einem Qualitätserbsen lieferte. Danglard war ein konzentrierter Mann, der nachdachte, ohne zu laufen, ein ängstlicher Mensch mit weichlichem Körper, der schrieb und dabei trank und der, allein unter Zuhilfenahme seiner Trägheit, seines Biers, seines abgekauten Bleistifts und seiner etwas müden Neugier Ideen in Marschordnung und von ganz anderer Art als die seinen hervorbrachte.
An dieser Front hatten sie sich oft gegenübergestanden: Danglard, der allein die aus überlegendem Denken hervorgegangene Idee für schätzenswert und jede Art formloser Intuition für suspekt hielt, und Adamsberg, der gar nichts für etwas hielt und nicht versuchte, das eine vom anderen zu unterscheiden. Als er zur Strafverfolgungsbrigade versetzt worden war, hatte Adamsberg darauf bestanden, den ausdauernden, präzisen Geist von Oberleutnant Danglard, der zum Hauptmann befördert worden war, mitzunehmen.
An diesem Ort würde Danglards präzises Denken genau wie Adamsbergs intuitives Umherschweifen nicht mehr um eingeschlagene Scheiben und Handtaschenraube kreisen. Sie würden sich auf ein einziges Ziel konzentrieren: die Aufklärung von Kapitalverbrechen. Nicht die kleinste Scheibe mehr, um einen vom Albtraum der mordenden Menschheit abzulenken. Nicht die kleinste Handtasche mit Schlüsseln, Adressbuch und Liebesbrief, die einen die belebende Luft nebensächlicher Delikte atmen ließ, worauf man dann die junge Frau mit einem sauberen Taschentuch zur Tür geleitete.
Nein. Kapitalverbrechen. Delikte am Menschen.
Diese schneidende Definition ihres neuen Einsatzgebietes verletzte wie eine Rasierklinge. Sehr gut, er hatte es so gewollt und außerdem etwa dreißig Kriminalfälle hinter sich, die er unter reichlicher Zuhilfenahme von Träumereien, Spaziergängen und zur Oberfläche aufsteigender Algen entwirrt hatte. Man hatte ihn hier an die Front der Mörder platziert, auf diesen Weg des Schreckens, auf dem er sich entgegen aller Erwartung als teuflisch gut erwies – »teuflisch« war ein von Danglard gebrauchter Ausdruck, um die Unwegsamkeit der geistigen Pfade Adamsbergs zu beschreiben.
Da waren sie nun, alle beide, an dieser Front, mit sechsundzwanzig Mitarbeitern. »Ich frage mich«, fuhr Adamsberg fort, während er langsam mit der Hand über den feuchten Putz fuhr, »ob mit uns dasselbe passieren kann wie mit den Felsen am Ufer des Meeres.«
»Das heißt?«, fragte Danglard ein wenig ungeduldig.
Adamsberg hatte schon immer langsam geredet und sich viel Zeit genommen, Wichtiges wie auch Lächerliches zu formulieren, wobei er unterwegs das Ziel bisweilen aus den Augen verlor, und Danglard ertrug diese Vorgehensweise nur schwer.