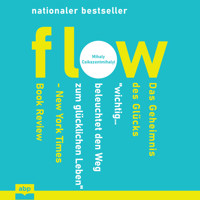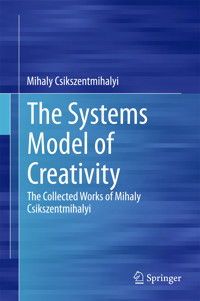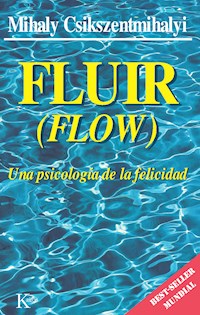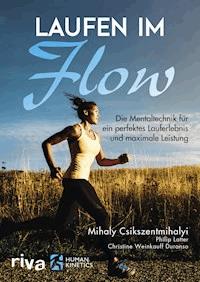Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Im Flow sein – ein mentaler Zustand völliger Vertiefung, der uns Raum und Zeit vergessen lässt. Mit sich so im Einklang entsteht eine tiefe Verbundenheit zum Leben. In der Kindheit haben wir diesen Zustand oft im Spiel erlebt, dann im kreativen Schaffen oder auch in der Arbeit. Aber wie lässt er sich aktiv generieren, was braucht es dazu? Im Gespräch mit Ingeborg Szöllösi erklärt der weltbekannte Autor anschaulich, wie Flow entsteht und wie wir Bedingungen dafür im Alltag schaffen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mihaly Csikszentmihalyi
Flow – der Weg zum Glück
»Mr. Flow« über einen Zustand, der unser Leben verändert
Herausgegeben von Ingeborg Szöllösi
Neuausgabe
Titel der Originalausgabe: »Flow – der Weg zum Glück
Der Entdecker des Flow-Prinzips erklärt seine Lebensphilosophie«
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2006
ISBN: 978-3-451-28923-1
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung und Umschlagmotiv:
Sabine Hanel, Gestaltungssaal, Rohrdorf
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN Print 978-3-451-03472-5
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83460-8
Inhalt
Vorwort
Einführung: Alles fließt
Das Leben in Bewegung
Arbeit, Spiel und Lebensfreude
Flow als Kompass der Zukunft
Die Schattenseiten des Flows
Flow und Psychotherapie
Flow in der Familie und Schule
Überall Flow
Flow im Alter
Glücklich leben und sterben
Über den Autor und die Herausgeberin
»Soll die menschliche Evolution weitergehen,
müssen wir auf die eine oder andere Weise lernen,
uns an unserem Leben intensiver zu freuen.«
Vorwort
Lassen Sie uns kurz ein gemeinsames Gedankenexperiment ausprobieren! Ich lade Sie ein, sich bewusst an eine Flow-Erfahrung zu erinnern. Lesen Sie die folgenden Fragen, lassen Sie diese auf sich wirken – versuchen Sie, zur Ruhe zu kommen und sich für alles zu öffnen, was nun passiert: Gedanken, innere Bilder und Körperempfindungen.
»Wann waren Sie das letzte Mal so tief in einer Aufgabe versunken, dass Sie gänzlich in dieser Aufgabe aufgingen? Ja so sehr, dass die Umwelt um Sie herum immer leiser wurde, Zeit keine Rolle mehr spielte und Sie und Ihre Aufgabe eins miteinander wurden?«
Schließen Sie Ihre Augen und spüren nach, welche Erinnerungen in Ihnen aufsteigen und wie Sie sich in diesem Moment fühlten.
Vielleicht ist Ihnen direkt eine Erfahrung eingefallen, sei es beim Joggen, beim Spielen eines Instruments oder während der Gartenarbeit. Ich erlebe solche Momente unter anderem, wenn ich podcaste und mit meiner Co-Moderatorin dann im flow bin.
Dank Mihaly Csikszentmihalyi haben wir diesen Begriff und können durch seine Forschungen und umfangreiche Studien zum Flow-Erleben erfahren, wie wir in diesen magischen Zustand kommen. Die Aufgabe darf uns weder überfordern, noch sollten wir uns langweilen.
Flow ist in aller Munde – und hat eine ungebrochene Anziehungskraft. Gerade in einer Zeit, in der uns Social Media und technische Gadgets permanent ablenken, fühlen sich Menschen zunehmend einsam und unglücklich. Die Sehnsucht nach Innehalten und Sinnhaftigkeit ist dadurch besonders groß.
Falls Ihnen beim Gedankenexperiment vorhin keine Erfahrung eingefallen ist oder es einfach schon zu lange her ist, kann ich Sie beruhigen: Sie halten genau die richtige Lektüre in Ihren Händen. Im Gespräch mit Ingeborg Szöllösi erklärt uns Mr. Flow, wie wir in verschiedenen Lebensbereichen die Bedingungen für Flow, und somit mehr Glück und Lebensqualität, erreichen können. Dieses Buch schenkt uns so viele einzigartige Einblicke hinter die Kulissen: Erkenntnisse und Weisheiten aus Csikszentmihalyis außerordentlichem Leben und Denken.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich vom Zauber des Flows anstecken lassen.
Main Huong Nguyen
Einführung Alles fließt
Wenn es für mich einen Nikolaus gäbe, auf dessen Besuch ich mich alljährlich freuen würde, dann würde er so aussehen und sich so verhalten wie Mihaly Csikszentmihalyi. Ein gutmütiger Mann mit grauen Haaren und grauem Bart, mit roten Wangen und einem neugierig in die Welt schauenden Blick, ein Mann, der durch seine Geschichten jedes Familienleben zu bereichern vermag, der privat und beruflich herauszufinden versucht, wie Eltern und Kinder zueinanderfinden und miteinander glücklich werden können.
Mit seinen Geschichten hat er mich reich beschenkt, als ich ihn Ende August in seinem Sommerhaus in einer abgeschiedenen Gegend Montanas (USA) besuchte. Wie ein Nikolaus Kinder beschenkt – er ist für sie da, hört ihnen aufmerksam zu und erzählt ihnen Geschichten!
Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb Mihaly Csikszentmihalyi in meiner Erinnerung immer als mein persönlicher Nikolaus auftauchen wird: Alles an ihm strahlt so etwas wie Heimat aus – vielleicht weil der Ort, aus dem seine Vorfahren stammen, sich nicht weit weg von meinem Geburtsort befindet. Vielleicht weil uns unser osteuropäischer Akzent verbindet – obwohl wir beide längst nicht mehr in Osteuropa leben, haftet er uns beiden an. Und vielleicht weil wir beide einen Namen tragen, über den die meisten Menschen hier im Westen stolpern müssen. Doch klangen nicht nur seine Worte anheimelnd, seine ganze Art, einen wildfremden Menschen zu empfangen, war mir vertraut.
Ich kam um die Mittagszeit bei ihm an, er hieß mich mit einer heißen Suppe willkommen – nach einer so langen Reise gibt’s nichts Besseres! Wir löffelten beide unsere Suppe im Stillen vor uns hin, und dann fing Mihály an zu erzählen. Vor einigen Tagen sei eine Freundin auf Besuch gewesen. Sie wollte alleine in der Gegend spazierengehen, doch musste sie ihren Spaziergang jäh abbrechen, denn hinter dem ersten Busch kam ein kleiner Bär hervor und pflanzte sich vor ihr auf: »Also, wenn du hier in der Gegend spazierengehen willst, musst du wachsam sein. Die kleinen Bären sind zwar nicht gefährlich, doch die Mutter Bärin umso mehr. Und man muss davon ausgehen, dass die sich nicht lange Zeit lässt und sogleich zur Stelle ist.«
Am besten, man schleiche sich gleich davon. Aber wie? Indem man einfach ganz langsam, ohne die Bärin und ihr Bärchen aus dem Auge zu lassen, nach hinten gehe. Ganz behutsam, ganz langsam – denn drehe man sich brüsk um und renne in Panik davon, habe man sehr schlechte Karten. Da werde man sehr schnell von der Bärin eingeholt und nicht unbedingt sanft angepackt. Erst wenn man sich einige Meter entfernt habe, solle man sich umdrehen und dann vielleicht etwas flotter Richtung Haus zurückgehen.
Ach, so ist es hier in Montana! Damit hatte ich gar nicht gerechnet – nein, ganz und gar nicht. Ich war so sehr auf die Gespräche, die ich in den acht Tagen mit Mihaly führen sollte, fixiert, dass ich mich mit den äußeren Rahmenbedingungen meiner Reise nicht beschäftigt hatte. Es könnte also gefährlich werden hier in dieser gebirgigen Gegend.
»Dann gibt es in unserer unmittelbaren Nähe auch Klapperschlangen, aber die erkennt man rechtzeitig an ihrem Zischen. Trotzdem sollte man, wenn man dies Geräusch vernimmt, ganz behutsam weitergehen, um ja nicht auf sie zu treten.« Schlangen – also, wenn ich eine Phobie habe, dann ist es gewiss eine Schlangenphobie. Mit Spinnen und Mäusen komme ich gut klar, aber mit Schlangen – nein, das wäre eine äußerst unerfreuliche Begegnung, dann doch lieber mit einem Bären, na ja – lieber mit einem abenteuerlustigen Bärchen, das allein die Gegend erkunden möchte, so wie ich …
Ich sah mich schon jeden Abend ein Gebet an einen für die Montanaer Zeit erfundenen Gott aussprechen, es möge bitte statt der Klapperschlange doch lieber nur ein Bärchen – oder noch besser: ein Reh – meinen Weg kreuzen.
»Gibt es sonst noch Tiere, vor denen man sich in Acht nehmen muss?« Und ich stellte die Frage souverän lächelnd, weil ich dachte, Mihaly wäre am Ende seiner Mahnrede angekommen.
»Ja klar, es gibt hier auch Pumas! Eines Tages saß einer hier auf diesem Ast und ließ es sich in der Nachmittagssonne gutgehen.« Mihaly wies auf den Ast eines Baumes, der sich just vor der Fensterfront seines riesengroßen Wohnzimmers befand. Pumas – dass die auch nicht ganz harmlos sind, wusste ich. Was bleibt einem denn in so einer Situation zu wünschen übrig? »Eternal vigilance!« – »Ewige Wachsamkeit ist der Preis unserer Freiheit«, ein Spruch von Thomas Jefferson, den Mihaly oft und gerne zitiert. Der Spruch sollte meinen ganzen Aufenthalt in Montana begleiten. Um mich frei zu fühlen und zu bewegen in der »Höhle der Bären, Klapperschlangen, Pumas« Montanas, musste ich mir diesen Spruch hinter die Ohren schreiben und wachsam sein.
Doch schon nach unserem ersten Gesprächstag war mir klar, dass das ewige Wachsam-sein eine Lebenseinstellung ist, die nicht nur mir augenblicks in dieser Gegend angebracht erschien. Diese Einstellung sollte uns alle unser ganzes Leben lang begleiten. Mihaly Csikszentmihalyi sieht in der Wachsamkeit den Garant für unsere Freiheit, das heißt für unseren wachen spielerischen Umgang mit allem, was uns umgibt. Freiheit hat für ihn nichts mit Gnade zu tun – einem Geschenk, das vom Himmel fällt und uns Dauerglück auf Erden beschert –, sondern Freiheit ist eine Lebenshaltung, die Ängste überwinden und Weltoffenheit entstehen lässt, die wir kraft unserer eigenen Fähigkeiten erlangen können. Wir finden diesen segensreichen Zustand nicht einfach in uns vor, wir müssen zu ihm hinfinden. Und auf dem Weg zu einem freien und glücklichen Leben ist die Wachsamkeit unser zuverlässigster Begleiter.
Du kannst noch so erfolgreich sein und meinen, deinen Lebensmittelpunkt gefunden zu haben, wenn dir dabei aber der Tanz um diesen Mittelpunkt herum weniger bedeutet als der Mittelpunkt selbst, dann wirst du dich sehr schnell wie ein Panther gefangen in seinem Käfig fühlen – es gibt dann »hinter tausend Stäben keine Welt« mehr für dich. Es gibt nur den festen Punkt, die vermeintliche Mitte, aber keinen kraftvollen Lebenstanz. Und dann stellt sich die Frage: Wenn du alles erreicht hast, wenn du überzeugt bist, angekommen zu sein – was dann? Was macht dich dann noch glücklich? Der Mittelpunkt? Der eine feste Punkt, den du allein zu fokussieren verstehst? – Nein, was dich glücklich machen könnte, ist zurückzufinden zu deinem ursprünglichen Tanz – deinem spielerischen Bezug zur Welt. Und um dies herauszufinden, wann wir uns von unserem Lebenstanz, der uns frei und glücklich macht, immer weiter entfernen, dazu braucht es: Wachsamkeit.
Für Mihaly Csikszentmihalyi ist es »nach wie vor wesentlich, offen zu bleiben – ich möchte nicht als Charakterdarsteller enden, wie das so schön im Theater heißt, wenn du nur eine ganz bestimmte Rolle spielen kannst. Natürlich ist das im Theater eine großartige Sache, eine Rolle exzellent spielen zu können, aber im Leben vereinsamt man und rostet ein, wenn man nur eine einzige Rolle spielen kann. Dann bist du irgendwann der Gefangene deiner Welt, die du dir geschaffen hast – und kannst mit der Wirklichkeit nicht mehr spielerisch umgehen. Es wird ringsherum alles dermaßen real, dass es keine Änderungs- und Befreiungsversuche mehr geben kann.« Diese Worte aus dem Mund eines Menschen zu hören, den alle mit einem knappen, aber prägnanten Begriff in Verbindung bringen – flow –, den viele sogar »Mr. Flow« nennen, das ist schon erstaunlich. Denn man würde meinen, »flow« sei der Mittelpunkt, um den Mr. Flow rotiert. Aber Mr. Flow – und davon legt dieses Buch Zeugnis ab – beansprucht nicht diesen festen Begriff für sich, Mr. Flow beansprucht den Lebenstanz für sich, der ihn stets für Veränderungen offenhält. Er ist bereit, das Neue anzugehen – heute, morgen, übermorgen … Denn niemand ist so durchdrungen wie er von dem Gedanken, dass alles fließt. Panta rhei!
Ingeborg Szöllösi
Das Leben in Bewegung
»Das Leben ist eine Frau, welche tanzt« schreibt Valéry in »Die Seele und der Tanz«; Nietzsche formuliert im »Zarathustra«: »Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde.« Der Tanz als Metapher für ein ekstatisches Leben – könnten Sie Ihr Leben auch so betrachten?
Ich habe eine sehr einfache und elementare Art, mich den Dingen des Lebens anzunähern. Ein ekstatisches Leben zu führen, heißt für mich also nicht, ständig etwas Außergewöhnliches zu erleben, sondern es heißt schlichtweg, sein individuelles Leben gestalten, und das wiederum heißt, stets zu entscheiden, worauf ich meine Aufmerksamkeit richten, worauf ich mich in meinem Tun fokussieren möchte. Für mich ist Ekstase kein übernatürliches mystisches oder metaphysisches Erlebnis – Ekstase hat für mich etwas mit meinem ganz persönlichen Alltag zu tun, mit all den vielen Aktivitäten, die ich im Lauf eines Tages verrichte, die sich spontan einstellen und die ich genauso spontan zulasse – diese Aktivitäten befinden sich also außerhalb eines abgesteckten Rahmens meiner Lebensroutine, sie sind nicht berechenbar.
Viele Menschen meinen, sie würden so etwas wie ein festes Ticket besitzen, das ihnen niemand entziehen kann und das ihnen immer Einlass in »die« Realität gewährt – mit diesem Ticket fühlen sie sich sicher und wissen in jedem Augenblick, was es zu tun gilt: Jetzt ist es Zeit, in die Arbeit zu gehen oder das Mittagessen einzunehmen oder die Steuern zu zahlen – für viele ist dies die einzige Realität, die sie haben und zulassen können, es gibt nichts Unvorhergesehenes, nichts außerhalb dieses geregelten Ablaufs. Tagein, tagaus läuft dasselbe Uhrwerk ab und niemand traut sich daran zu rütteln, denn es ist schließlich nützlich – es »bringt« ihnen etwas, nämlich ein sicheres und bequemes Leben. Und trotzdem gibt es genauso viele Menschen, die ohne dieses Ticket durchs Leben ziehen und mit großer Leidenschaft unnützen Aktivitäten nachgehen – »unnütz«, weil sie für die anderen, jene mit dem Ticket, keinen Sinn haben. Sie sammeln uralte seltene Marken, gehen fischen und stehen stundenlang im eiskalten Wasser eines Gebirgsflusses, oftmals ohne einen einzigen Fisch nach Hause zu bringen, und tun es trotzdem immer wieder …
Scheinbar bringen einem diese Tätigkeiten nichts Nützliches ein – selbstverständlich nicht, wenn man die Realität als geregeltes Uhrwerk betrachtet. Aber auf subjektiver Ebene tut sich, während du mit diesen angeblich »unnützen Dingen« beschäftigt bist, sehr viel: Diese ganz einfachen Aktivitäten können dich in denselben ekstatischen Zustand versetzen, den die Yogis und Zen-Buddhisten während ihrer Meditation erfahren. Ob die Aktivitäten nun nützlich oder nutzlos, alltäglich oder abgehoben sind – spielt keine Rolle: Wenn es dir gelingt, dich zu fokussieren, kann sich deine routinierte Alltagsrealität, die jeder für unausweichlich und gegeben ansieht, wann immer in eine ganz andere verwandeln – in eine ekstatische.
Vielleicht in eine tänzerisch-leichte Realität, sodass wir ausrufen könnten, das Leben sei ein »Tanz um eine Mitte« (R. M. Rilke)?
Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Mittelpunkt im Leben eines Menschen geben muss, damit das Leben sich in einen Tanz um dieses eine Zentrum verwandelt. Ich meine, der Mittelpunkt ist nicht wesentlich, wesentlich ist der Tanz – wie ich mich im Leben bewege, wie ich Dinge anpacke, wie und worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke. Wollte ich nun doch einen Mittelpunkt in meinem Leben ausmachen, dann wäre der sehr weit gefasst – er wäre für mich der Gedanke, dass ich und wir alle in einem Universum leben, das uns Zeichen gibt, die wir zwar verstehen, aber an denen wir auch genauso vorbeileben können. Für mich ist es schön zu glauben, dass es ein System gibt, das uns alle trägt und verbindet: dass ich im Bewusstsein dessen handle, dass das, was ich jetzt tue, Folgen und Konsequenzen haben kann, dass ich, wenn ich etwas Gutes tue, auch etwas Gutes damit bewirke oder beitrage, dass sich eine schlimme Situation verbessert, dass durch mein Tun nicht noch mehr Spannungen und Konflikte in der Welt entstehen … Natürlich werde ich nie alles verstehen können, was in der Welt passiert – es gibt in ihr so viele Mysterien. Aber ich versuche, an diesem System, von dem ich mich getragen fühle, teilzuhaben und es weiterzubringen. Und ich hoffe, dass wir Generation für Generation immer besser verstehen, wie unser Universum zusammengefügt ist, damit wir endlich mit ihm und nicht immer gegen es arbeiten. Das ist herausfordernd, interessant, freudvoll!
Das könnten auch die Worte eines Mystikers bei der Betrachtung des Weltgeschehens sein: sich als Teil eines größeren Ganzen fühlen. Sie aber sind Wissenschaftler und halten sich, soweit ich weiß, für nicht religiös?!
Nein, ich bin nicht religiös. Ich sehe in den Religionen den ersten Versuch, unsere merkwürdige Realität, die seltsamen Beziehungen zwischen den Menschen untereinander und ihren Bezug zur Welt verstehen und regeln zu wollen. Mit dem Mysterium des Kosmos umzugehen – darin haben die Religionen viel Großes geleistet: Die ethischen Konzepte der meisten Religionen sind sehr fortgeschritten und ihre Betrachtungen über das Leben sind so beschaffen, dass sie auch der einfache Mann verstehen kann – sie sind so elementar, dass sie jedem einleuchten und eine Hilfe im alltäglichen Verhalten sein können. Für viele Menschen waren die Religionen lange Zeit so etwas wie eine Richtlinie – der Einzelne wusste, wie er sich seinem Nächsten und der Natur gegenüber zu verhalten hat.
Als einen ersten Versuch, unsere Welt zu verstehen und den Menschen anhand eines konkreten Leitfadens ein besseres Leben zu bescheren, nehme ich Religionen also sehr ernst – sie haben einen wichtigen Beitrag zur Kultur geleistet, der tatsächlich mehr als 2000 Jahre wirksam war. Doch meine ich, dass die Religionen unter dem Institutionalisierungszwang aufgehört haben, sich weiterzuentwicklen und zu wachsen. Und damit haben sie ihre ursprüngliche Offenheit eingebüßt.
Vielleicht könnten Kunst und Dichtung an ihrer statt einspringen …
Auch Kunst und Dichtung bieten einem viel Hilfreiches fürs konkrete alltägliche Leben an – selbstverständlich! Aber ich meine, dass auch sie meines Erachtens die Wirklichkeit oft zu mystifizierend und zu einseitig deuten. Da wird zum Beispiel plötzlich etwas von einem Kunsthistoriker als besonders »tief« und »als noch nie dagewesen« beschrieben, was für mich aber zu keinem wirklich »tiefen« Erlebnis führt. – Ich selbst fühle mich deshalb bei der Wissenschaft sehr viel besser aufgehoben, was nicht heißen soll, dass die Wissenschaftler keine Probleme haben und imstande sind, alle Fragen zu beantworten. Im Gegenteil – gerade das ist mir in diesem Bereich sympathisch, dass Wissenschaftler immer sehr viele Fragen haben, die sie vorerst nicht beantworten können und offen lassen müssen. Darin zeigt sich für mich ihre Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und vor allem – aufgeschlossen zu bleiben.
Für mich als Wissenschaftler ist daher nicht der feste, eingefrorene Mittelpunkt, sondern der »Tanz« selber im Leben wichtig – damit meine ich, dass der Wissenschaftler beweglich bleiben muss. Durch die Fixierung auf einen Mittelpunkt büßt man nämlich immer die Offenheit für die sich stets verändernde Welt ein – das sieht man ja am Beispiel der institutionalisierten Religionen. In der Wissenschaft ist der »Tanz«, das heißt die Aktivität selbst, der Motor und impulsgebende Faktor für alles andere – wir wollen neu verstehen lernen, immer aus jeweils anderen Perspektiven Dinge betrachten, unfruchtbare Theorien verwerfen und uns auf die Suche nach anderen begeben, die wir dann später vielleicht auch verwerfen … Es ist ein nie enden wollender Prozess – das ist das Schöne daran!
Und es klingt so, als wäre es auch ein nie enden wollendes Spiel?! Doch sind wir gewöhnt, viel eher vom »Ernst des Lebens« zu sprechen als vom »Spiel des Lebens«, obwohl aus dem Spiel Freiheit und Offenheit erwachsen …
Das rührt wohl daher, dass wir im Spiel immer nur etwas Frivoles und Leichtfertiges sehen. Doch ist das ein Irrtum, denn ein Spiel ist kein Zustand, der uns über Anarchie und Chaos ein Gefühl der Freiheit beschert, sondern im Gegenteil – und das kennen alle Kulturen und Zivilisationen: Das Gefühl der spielerischen Freiheit stellt sich erst ein, wenn man ein bestimmtes Set an Regeln einhält. Wenn du Fußball spielst und den Ball gewaltsam an dich reißt und wegläufst, hast du vom Charakter dieses Spieles nichts verstanden und du wirst es nie wirklich genießen. Wenn du hingegen die Regeln beachtest – z. B. die Regel, den Ball nicht mit den Händen zu berühren, dann wirst du erstaunliche Fähigkeiten in dir entdecken und entwickeln, wie du im Umgang mit dem Ball nur deine Beine und Füße einsetzen kannst. Du folgst also freiwillig einer Regel und wirst dabei in den Genuss einer dich voll und ganz erfüllenden Erfahrung kommen – du staunst über deine Fähigkeiten, mit immer neuen Schwierigkeiten umgehen zu können und sie zu überwinden. Und das erfüllt dich mit Glück.
Also hat das Spiel etwas durch und durch Ernsthaftes an sich? Wie gelingt es uns dann aber, den Widerspruch zwischen Spiel und Ernst aufzuheben?
Ein Spiel ist die symbolische Darstellung einer Realität, in der immer Regeln existieren, die es zu befolgen gilt und die man ernst zu nehmen hat – allerdings lässt man sich aufs Spiel freiwillig ein und befolgt die Regeln freiwillig, aber in allem Ernst. Denn erst durch den Ernst kann man Lust und Spaß am Spiel entdecken. Das Gefühl, frei zu sein, dies oder jenes zu spielen, ist wesentlich. Um dann aber deine Fähigkeiten und Fertigkeiten wirklich herauszufordern, lässt du dich auf die Regeln ein und erfährst dadurch das Spielerische am Spiel: Es ist nicht die Wirklichkeit da draußen, sondern eine, die du dir allein oder mit anderen erschaffst – und das geht nur über bestimmte Regeln.
Zum Beispiel wenn du einen Felsen hochkletterst – Klettern war eine der ersten spielerischen Tätigkeiten, die ich erforscht, aber auch selbst praktiziert habe –, musst du nolens-volens Regeln befolgen, sonst kannst du dich sehr schnell tödlich verletzen. Indem du gewisse Regeln befolgst, wirst du nun individuelle Fertigkeiten in dir entwickeln und spüren, wozu du in aller Freiheit fähig bist, aber nicht wahllos und willkürlich, sondern indem du im Rahmen der gegebenen Spielregeln improvisierst.
Das Spiel ist kein billiger Zeitvertreib – die Olympischen Spiele waren ein hochseriöses, religiöses und sportliches Unternehmen. Sie zeigen auch heute noch exemplarisch, wozu der Mensch fähig ist. Menschen sind zu enorm viel fähig – einige, die mit einem kleinen Boot von Australien nach Argentinien segeln, habe ich z. B. eine Zeit lang intensiv studiert. Diese Menschen geraten in fürchterliche Stürme, aber keine noch so widerlichen Umstände können sie abschrecken und davon abhalten: Sie machen diese Segeltour immer wieder aufs Neue. Dabei halten sie strenge Regeln ein, aber jedes Mal erleben sie sich in der jeweiligen konkreten Situation neu – ihren Charakter, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Aber nicht nur sich selbst entdecken sie immer wieder aufs Neue, auch die Welt, die sie umgibt. Solche Erfahrungen haben unsere Evolution vorangetrieben – so hat Kolumbus Amerika ohne Kompass entdeckt: Er wollte etwas tun, was niemand zuvor getan hat, er wollte eine Grenze überschreiten, und das ist ihm gelungen. Klar hatten es einige seiner Leute nur aufs Gold abgesehen, aber viele sind tatsächlich losgezogen, um sich selbst zu entdecken …
Um noch ein Beispiel aus der Kulturgeschichte zu nennen: In der viktorianischen Ära nannten die Engländer ihre Kolonialherrschaft »das große Spiel«. Das kann man in Rudyard Kiplings Roman »Kim« nachlesen. Warum sahen sie das auf diese Weise? Weil ihnen das Leben in England zu ernst geworden war, das heißt: zu eingefahren und eingerostet. In Indien, in ihrer Kolonie hingegen, wurden sie aufgefordert, etwas ganz anderes zu machen – sich auf etwas ganz anderes einzulassen und ein neues kulturelles und politisches System zu entwickeln, das sie nicht mehr so ernst nehmen mussten – selbstverständlich sind auch hier wie im Falle von Kolumbus’ Entdeckung der »Neuen Welt« sehr viele negative Bewegungen losgetreten worden. Aber was an diesen Beispielen für uns im Zusammenhang des Lebens als Spiel wesentlich bleibt, ist, dass etwas Neues und Frisches immer aus unserem Spieltrieb heraus entsteht und dass sich diese Erfahrung als etwas sehr Befreiendes darstellt. Aber das eine muss man dabei immer mit in Erwägung ziehen: Das Gefühl der Freiheit stellt sich ein, gerade weil man gewisse Regeln befolgt.
Wir haben uns daran gewöhnt, zwischen Leben und Spiel eine strikte Grenzlinie zu ziehen – warum wohl?
Wenn das Leben zum Spiel wird, haben viele Menschen Angst davor, dass sie zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit gehen müssen, und das ist für die meisten unvorstellbar. Denn dass man freudig und gerne zur Arbeit geht oder den familiären Verpflichtungen gerne nachgeht oder den Ort, an dem man lebt, wirklich liebt und nicht dauernd anderswo sein möchte, das würde einen natürlichen, spielerischen Zugang zum Leben eröffnen. Doch wenn das alles nicht der Fall ist und man alles pflichtgemäß, aber ungern verrichtet, dann muss man sich regelrecht suggerieren, dass das Leben eben ernst ist und nur ernst. Fürs Spielerische ist kein Raum vorgesehen, man kann sich allerhöchstens einige wenige dafür vorgesehene ungefährliche Oasen einrichten – man gestattet sich zum Beispiel etwas mehr Alkohol auf einer exotischen Kreuzfahrt.
Auch Wissenschaftler und Forscher vergessen gerne das Spielerische am Leben zugunsten einer Realität, die sie als Modell begreifen; konkret und banal ausgedrückt: Für einen Chemiker ist das H20-Molekül »Wasser« – das heißt, er erlebt das Wasser nicht, er erforscht es. Wie sind Sie selber als Forscher damit umgegangen, um möglichst nah dran am spielerischen Leben und an den anderen Menschen zu bleiben?
Das ist natürlich eine der großen Gefahren, wenn du in eine Tätigkeit mit Leib und Seele involviert bist – egal ob als Forscher oder Dichter, Segler oder Bergsteiger, Tänzer oder Yogi. Es besteht die Gefahr des Reduktionismus, dass du das, was du gerade tust, als die ganze Realität betrachtest und dabei vergisst, dass es im Grunde eine von dir durch eine spielerische Initiative erschaffene Realität ist. Viele sind in so einem Fall regelrecht dazu verurteilt, nur das eine zu tun. Und ich lasse wirklich keine Gelegenheit aus, um zu betonen, wie wichtig es für uns alle ist, ein Stück weit Dilletanten oder Amateure zu bleiben, statt nur noch eine einzige Sache perfekt vollführen zu können und ausschließlich an ihr Interesse zu haben. Die meisten beurteilen einen Dilletanten abschätzig: »Oh, das ist nur ein Dilletant!«, statt darin auch eine verborgene Chance zu sehen, die man nicht hat, wenn man sich nur einem einzigen Beruf verschreibt und von sich stolz sagen kann: »Ich bin der größte Forscher und ich werde bis an mein Lebensende nichts anderes tun als forschen!« Der Verlust ist sehr groß, wenn man nur von einer einzigen Idee absorbiert und besessen ist: Man verliert den spielerischleichten Umgang mit der Welt. Das, was der Forscher dann erforscht, ist für ihn die Realität, was anderes gibt es nicht mehr – und das ist dann kein Spiel mehr!