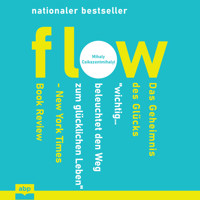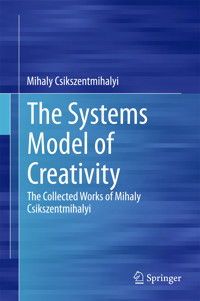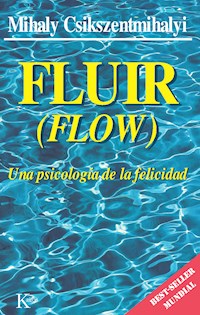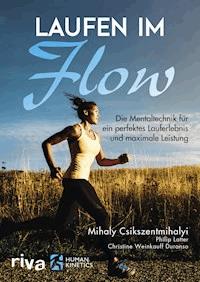14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Mihaly Csikszentmihalyi beantwortet in diesem Buch die Fragen, wo und wie Kreativität entsteht und wie es jedem Einzelnen gelingen kann, seine ganz persönliche Inspirationsquelle zu entdecken und zu fördern. Es erschließt sich Ihnen die interessante Welt der »kreativen Köpfe«, damit auch Sie in Zukunft – beruflich und privat – von Ihrer schöpferischen Kraft profitieren und Ideenlosigkeit und innere Blockaden überwinden können. Die Grundlage bilden zahlreiche Interviews mit Kreativen aus allen möglichen Berufen, mit allen möglichen Berufungen. Eines der überraschendsten Ergebnisse seiner Analyse ist, daß die Frage: Was ist Kreativität? durch die Frage: Wo entsteht Kreativität? ersetzt werden muß. Jeder Kreative entwickelt sich in einem bestimmten Kontext, zu dem vielerlei gehört, vom Zimmer, in dem man aufwuchs, von den Freunden, mit denen man sich umgibt, bis zu den Förderern, die in manchen Lebensabschnitten notwendig sind. Flow bezeichnet einen Zustand des Glücksgefühls, in den Menschen geraten, wenn sie gänzlich in einer Beschäftigung »aufgehen«. Entgegen ersten Erwartungen erreichen wir diesen Zustand nahezu euphorischer Stimmung meistens nicht beim Nichtstun oder im Urlaub, sondern wenn wir uns intensiv der Arbeit oder einer schwierigen Aufgabe widmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 852
Ähnliche
Mihaly Csikszentmihalyi
FLOW und Kreativität
Wie Sie Ihre Grenzen überwindenund das Unmögliche schaffen
Aus dem Amerikanischen vonMaren Klostermann
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett‐Cotta
www.klett‐cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
„Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention“ im Verlag HarperCollinsPublishers, New York
© 1996 by Mihaly Csikszentmihalyi
Für die deutsche Ausgabe
© 1997 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Datenkonvertierung: le‐tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978‐3‐608‐94822‐6
E‐Book: ISBN 978‐3‐608‐10687‐9
Dieses E‐Book entspricht der 1. Auflage 2014 der Printausgabe
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d‐nb.de abrufbar.
Inhalt
Danksagung
1 Der äußere Rahmen
Teil I Der kreative Prozeß
2 Wo ist Kreativität?
3 Die kreative Persönlichkeit
4 Die kreative Arbeit
5 Der Flow der Kreativität
6 Eine kreative Umwelt
Teil II Die Lebensgeschichten
7 Die frühen Jahre
8 Die Lebensmitte
9 Kreatives Altern
Teil III Domänen der Kreativität
10 Die Domäne des Wortes
11 Die Domäne des Lebens
12 Die Domäne der Zukunft
13 Die Schaffung von Kultur
14 Die Förderung der persönlichen Kreativität
Anhang A:Kurzbiographien der Personen, die für diese Studie interviewt wurden
Anhang B:Interviewprotokoll für die Studie
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Register
Danksagung
Die Idee zu diesem Buch entstand in einem Gespräch mit Larry Cremin, damals Präsident der Spencer Foundation. Wir waren beide der Ansicht, daß es wichtig wäre, die Kreativität im Sinne eines lebenslangen Entwicklungs- und Entfaltungsprozesses zu erforschen, und daß es keine systematischen Studien über kreative Persönlichkeiten des Zeitgeschehens gab. Die Spencer Foundation finanzierte daraufhin mit ihrem gewohnten Weitblick ein vierjähriges Forschungsprojekt, das dazu beitragen sollte, diese Lücke in unserem Verständnis zu schließen. Ohne diese Förderung wäre es unmöglich gewesen, die umfangreiche Arbeit der Sammlung, Transkription und Analyse der ausführlichen Interviews zu bewältigen.
Der andere Beitrag, ohne den dieses Buch nie hätte geschrieben werden können, ist die Unterstützung der einundneunzig Menschen, auf deren Interviews dieses Buch aufbaut. Alle sind außergewöhnlich beschäftigt, und ihre Zeit ist buchstäblich unschätzbar – ich bin ihnen daher zutiefst dankbar dafür, daß sie sich für diese zeitraubenden Interviews zur Verfügung gestellt haben. Es ist wirklich sehr schwierig, meine Dankbarkeit für ihre Hilfe in Worte zu fassen; ich kann nur hoffen, daß ihnen das Ergebnis gefällt und ihre Mühe wert war.
Zahlreiche Studenten haben mir bei diesem Projekt geholfen und ihre kreativen Beiträge geleistet. Einige haben Artikel über das Projekt für Fachzeitschriften geschrieben oder mir als Ko-Autoren zur Seite gestanden. Besonders wichtig waren vier meiner Studenten, die das Projekt von Anfang an begleitet haben: Kevin Rathunde, Keith Sawyer, Jeanne Nakamura und Carol Mockros.
Während wir die Daten sammelten und analysierten, haben mir viele Forscherkollegen, deren Fachgebiet die Kreativität ist, mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ich möchte an dieser Stelle zumindest Howard Gardner, David Feldman, Howard Gruber, Istvan Magyari-Beck, Vera John-Steiner, Dean Simonton, Robert Sternberg und Mark Runco nennen – sie alle haben, ob bewußt oder unbewußt, zur Entstehung der in diesem Buch vorgestellten Ideen beigetragen.
Einige Kollegen haben mir bei den ersten Entwürfen des Manuskripts geholfen. Mein besonderer Dank gilt meinem alten Freund Howard Gardner von der Harvard University. Seine Kommentare haben wie immer genau ins Schwarze getroffen. William Damon von der Brown University hat mehrere exzellente Vorschläge für die Gliederung des Materials gemacht. Ich danke auch Benö Csapó von der Universität von Szeged, Ungarn, der Anregungen aus einem anderen kulturellen Blickwinkel in die Arbeit einbrachte.
Drei Kapitel dieses Buches habe ich geschrieben, als ich im italienischen Zentrum der Rockefeller Stiftung in Bellagio zu Gast war. Die übrigen Kapitel habe ich mit Hilfe eines Stipendiums der John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (Nr. 8900078) und einer Förderung durch die National Science Foundation (Nr. SBR-9022192) am Fachbereich für Verhaltenswissenschaften in Palo Alto fertiggestellt. Ich danke ihnen, daß sie mir die Möglichkeit gaben, mich ohne die üblichen Störungen – und in so herrlicher Umgebung – auf das Manuskript zu konzentrieren.
Isabella Selega, die sich vor dreißig Jahren glücklicherweise bereit erklärte, mich zu heiraten, hat in den späteren Phasen die Korrekturarbeiten und viele andere wichtige Details überwacht. Das gleiche hat sie 1965 getan, als ich meine Doktorarbeit über dasselbe Thema schrieb. Es läßt sich kaum in Worte fassen, wieviel ich ihr verdanke, aber alles, was ich in den dazwischenliegenden Jahren erreicht habe, wäre ohne sie nicht denkbar.
Keine der Schwächen dieses Buches sollte irgendeiner der hier genannten Personen außer mir selbst angelastet werden. Doch für alles, was gut daran ist, möchte ich ihnen aus tiefstem Herzen danken.
1 Der äußere Rahmen
Dieses Buch befaßt sich mit dem Thema Kreativität und stützt sich dabei auf die Lebensgeschichten von Personen des Zeitgeschehens, die den kreativen Prozeß aus erster Hand kennen. Ich beschreibe zunächst, was Kreativität ist, gebe dann einen Überblick über die Lebens- und Arbeitsgewohnheiten kreativer Menschen und befasse mich schließlich mit der Frage, wie man das Beispiel dieser kreativen Menschen für die eigene Lebensgestaltung nutzen kann. Dieses Buch bietet keine einfachen Lösungen und geht einigen ungewohnten Gedanken nach. Die wahre Geschichte der Kreativität ist schwieriger und weniger erforscht, als viele oberflächlich optimistische Berichte uns glauben machen wollen. So möchte ich zum Beispiel zeigen, daß eine Idee oder ein Produkt, das die Bezeichnung »kreativ« verdient, aus dem Zusammenwirken vieler Einflüsse und nicht nur aus der Genialität des einzelnen erwächst. Es ist leichter, Kreativität durch eine Veränderung äußerer Bedingungen zu fördern als durch den Versuch, das Individuum zu kreativerem Denken anzuregen. Und eine wahrhaft kreative Errungenschaft ist so gut wie nie das Ergebnis einer schlagartigen Erkenntnis, eines plötzlich aufflackernden Lichts in der Dunkelheit, sondern das Resultat jahrelanger harter Arbeit.
Kreativität ist aus mehreren Gründen eine zentrale Sinnquelle in unserem Leben. Erstens sind die meisten interessanten, bedeutsamen und menschlichen Phänomene ein Ergebnis der Kreativität. Wir teilen 98 Prozent unserer genetischen Ausstattung mit den Schimpansen. Was uns von ihnen unterscheidet – Sprache, Wertvorstellungen, künstlerische Ausdrucksformen, Wissenschaft und Technik –, ist die Folge individueller Erfindungen, die anerkannt, belohnt und durch Lernen weitergegeben wurden. Ohne Kreativität wäre es in der Tat äußerst schwierig, den Menschen vom Affen zu unterscheiden.
Zweitens ist die Kreativität so faszinierend, weil sie uns aus dem Alltag heraushebt, weil sie uns das Gefühl gibt, intensiver zu leben als sonst. Die Aufregung des Malers an seiner Staffelei oder der Wissenschaftlerin in ihrem Labor kommt dem Ideal eines erfüllten Lebens sehr nahe, das wir uns alle erträumen und so selten erreichen. Das tiefe Gefühl, Teil von etwas zu sein, das größer ist als man selbst, kann man außer durch die Kreativität wahrscheinlich nur durch Sex, Sport, Musik oder religiöse Ekstase erreichen – doch diese Erfahrungen sind flüchtig und hinterlassen keine bleibenden Spuren. Aber die Kreativität hinterläßt darüber hinaus ein Ergebnis, das zum Reichtum und zur Komplexität des Lebens in der Zukunft beiträgt.
Ein Auszug aus einem der Interviews, auf denen dieses Buch basiert, vermittelt vielleicht eine etwas konkretere Vorstellung von der Freude und den gleichzeitigen Risiken und Schwierigkeiten, die mit einer kreativen Unternehmung verbunden sind. Die Sprecherin ist Vera Rubin, eine Astronomin, die unsere Kenntnisse über die Dynamik von Galaxien enorm erweitert hat. Sie beschreibt ihre jüngste Entdeckung – daß die Sterne einer Galaxie nicht alle in dieselbe Richtung rotieren; die Sterne derselben galaktischen Ebene können sich auf ihren Umlaufbahnen entweder im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn bewegen. Wie bei vielen Entdeckungen gilt auch für diese, daß sie nicht geplant war. Sie ergab sich aus der zufälligen Betrachtung zweier Spektralanalysen, die im Abstand von einem Jahr von derselben Galaxie gemacht wurden. Als Vera Rubin die schwachen Spektrallinien verglich, die auf die Position der Sterne verweisen, fiel ihr auf, daß einige Sterne sich zwischenzeitlich in die eine und andere in die entgegengesetzte Richtung bewegt hatten. Rubin hatte das Glück, zu der ersten Generation von Astronomen zu gehören, die Zugang zu derart klaren Spektralanalysen von erdnahen Galaxien hatte – einige Jahre zuvor wären die Details nicht erkennbar gewesen. Aber sie konnte diesen glücklichen Zufall nur nutzen, weil sie sich seit vielen Jahren intensiv mit den kleinen Details der Sternenbewegungen beschäftigt hatte. Die Entdeckung war möglich, weil die Astronomin Galaxien um ihrer selbst willen interessant fand, nicht weil sie eine Theorie beweisen oder sich einen Namen machen wollte. Hier ist ihre Geschichte:
Für den Forscherberuf braucht man eine Menge Mut. Das mag merkwürdig klingen, aber es stimmt tatsächlich. Ich meine, man investiert einen enormen Teil von sich selbst, von seinem Leben und seiner Zeit, und es ist gut möglich, daß nichts dabei herauskommt. Man kann fünf Jahre an einem Problem arbeiten und geht vielleicht von völlig falschen Voraussetzungen aus. Oder jemand macht genau in dem Moment, in dem man seine Arbeit abschließt, eine Entdeckung, die alles über den Haufen wirft. Das kommt wirklich sehr oft vor. Ich hatte sicher Glück. Als ich mich für diese Laufbahn entschied, nahm ich an, daß meine Aufgabe als Astronomin, als Beobachterin in erster Linie darin bestand, viele nützliche Daten zusammenzutragen. So wie ich es sah, hatte ich einfach die Aufgabe, wertvolle Informationen für die astronomische Gelehrtenwelt zu sammeln, aber in den meisten Fällen war es weit mehr als das. Ich wäre nicht enttäuscht, wenn das schon alles wäre. Aber es ist immer schön, etwas Neues zu entdecken. In diesem Frühjahr habe ich gerade etwas Faszinierendes beobachtet, und ich weiß noch ganz genau, wieviel Spaß mir das gemacht hat.
Gemeinsam mit einem jungen Doktoranden arbeitete ich an einer Studie über Galaxien im Virgo-Haufen. Das ist einer der größten Galaxienhaufen in unserer Nähe. Bei der Untersuchung dieser nahegelegenen Sternhaufen ist mir klar geworden, daß ich es tatsächlich ungeheuer genieße, etwas über die besonderen Einzelheiten jeder einzelnen Galaxie zu erfahren.
Mit anderen Worten, ich habe mich fast mehr für ihre kleinen Besonderheiten interessiert als für alles andere, weil diese Sternsysteme in unserer unmittelbaren Nachbarschaft liegen – jedenfalls nach kosmischen Maßstäben. Es war das erste Mal, daß ich ein großes Auswahlmuster von Galaxien hatte, die alle nah genug waren, so daß ich viele kleine Details erkennen konnte. Ich habe festgestellt, daß sich in der Nähe der galaktischen Zentren sehr viele merkwürdige Dinge abspielten – da gab es sehr schnelle Rotationen, kleine galaktische Scheiben, alle möglichen aufregenden Details –, und irgendwie bin ich regelrecht süchtig nach diesen kleinen interessanten Einzelheiten geworden. Nachdem ich sie also alle untersucht und gemessen hatte, stand ich etwas ratlos vor der Flut von faszinierenden Daten, die ich gesammelt hatte. Ich wußte nicht genau, wie ich nun weiter vorgehen sollte, bis mir klar wurde, daß einige Galaxien aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen will, interessanter waren als andere. Also beschloß ich, zunächst die Sternsysteme mit den spannendsten Eigenschaften im Zentrum zu beschreiben (was nichts mit dem eigentlichen Anlaß für das Forschungsprojekt zu tun hatte). Ich erkannte, daß es zwanzig oder dreißig Galaxien gab, die besonders aufregend waren, und wählte vierzehn davon aus. Über diese vierzehn interessanten Sternsysteme wollte ich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Sie alle zeichnen sich durch sehr schnell rotierende Kerne, eine Menge Gas und andere faszinierende Merkmale aus.
Also, eine Galaxie war ganz besonders faszinierend. Ich machte 1989 ein erstes Spektrum davon und dann ein weiteres 1990. Ich hatte also zwei Spektren von diesen Objekten, und das erste Mal gemessen habe ich sie wohl erst 1990 oder ‘91. Zuerst verstand ich nicht ganz, warum diese Galaxie so faszinierend war, aber sie unterschied sich von allem, was ich bis dahin gesehen hatte. Wissen Sie, in einer Galaxie oder in einem Spiralnebel oder einer Scheibengalaxie kreisen alle Sterne auf einer Ebene um das Zentrum. Ich kam zu dem Schluß, daß sich in dieser Galaxie einige Sterne in entgegengesetzte Richtungen bewegten. Einige drehten sich im Uhrzeigersinn, andere entgegen dem Uhrzeigersinn. Aber ich hatte nur zwei Spektren, und eines war nicht besonders gut, also wußte ich nicht genau, ob ich es glauben sollte oder nicht. Ich meine, ich fühlte mich hin- und hergerissen. In der einen Minute wollte ich meinem Urteil vertrauen und meine Beobachtung festhalten, dann dachte ich wieder, die Spektren sind nicht gut. Also zeigte ich sie meinen Kollegen, und einige glaubten es und konnten zwei Linien erkennen und andere wieder nicht, so daß ich schließlich schon überlegte, ob die Sterne mir vielleicht einen Streich spielen wollten. Da die Anmeldefrist für die Benutzung der Hauptteleskope im Jahr 1991 bereits abgelaufen war, beschloß ich, im Frühjahr 1992 ein weiteres Spektrum zu erstellen. Aber dann kam mir eine Idee. Es gab da einige ganz sonderbare Dinge auf dem Spektrum und plötzlich ... ich weiß auch nicht ... monatelang hatte ich versucht zu begreifen, was ich da vor mir sah. Zum Nachdenken gehe ich in das andere Zimmer. Ich sitze da vor einem ziemlich exotischen Fernsehschirm neben einem Computer, aber er gibt die Spektralbilder sehr präzise wieder, und ich kann damit herumprobieren. Eines Tages wollte ich dann unbedingt begreifen, was es mit dieser Komplexität auf sich hatte; ich machte einige Zeichnungen auf einem Blatt Papier, und auf einmal habe ich alles verstanden. Ich kann es nicht anders beschreiben. Alles stand plötzlich ganz klar vor mir. Ich weiß nicht, warum ich nicht schon zwei Jahre früher darauf gekommen bin.
Und dann, im Frühjahr, ging es an die Teleskope. Ich bat einen meiner Kollegen, die Beobachtung mit mir zusammen durchzuführen. Wir beide arbeiten hin und wieder zusammen. Drei Nächte hatten wir zur Verfügung. In zwei Nächten konnten wir das Teleskop überhaupt nicht einsetzen; die dritte Nacht war auch nicht viel besser, aber wir kriegten ein paar Daten zusammen. Wir bekamen genug über diese Galaxie zusammen, um die These zu erhärten. Aber im Grunde spielte es keine große Rolle mehr, weil ich zu diesem Zeitpunkt bereits wußte, daß wir richtig vermutet hatten.
Das ist also die Geschichte. Und es macht Spaß, Riesenspaß, auf etwas Neues zu stoßen. In diesem Frühjahr mußte ich einen Vortrag in Harvard halten, und natürlich brachte ich diese Sache mit ein. Meine Entdeckung wurde dann tatsächlich zwei Tage später von Astronomen bestätigt, die über Spektren von dieser Galaxie verfügten, sie aber bisher noch nicht ausgewertet hatten.
Dieser Bericht drängt in knappen Worten viele Jahre mühsame Arbeit, Zweifel und Rückschläge zusammen. Wenn alles gut läuft, macht der Erfolg die Plackerei wett. In Erinnerung bleiben die Höhepunkte: die brennende Neugier, das Staunen angesichts eines Geheimnisses, das kurz vor seiner Enthüllung steht, die Freude, auf eine Lösung zu stoßen, die eine unerwartete Ordnung sichtbar macht. Mühsame Rechenarbeit vieler Jahre wird durch eine bahnbrechende neue Erkenntnis gerechtfertigt. Aber auch ohne krönenden Erfolg erfüllt eine gut getane Arbeit kreative Menschen mit Freude. Das Lernen ist um seiner selbst willen lohnend, auch wenn es nicht in einer öffentlich anerkannten Entdeckung gipfelt. Wie und warum das so ist, gehört zu den wichtigsten Fragen, denen ich in diesem Buch nachgehe.
Evolution in Biologie und Kultur
Kreativität galt für den größten Teil der Menschheitsgeschichte als Privileg höherer Wesen. Jede Religion hat ihre Schöpfungsmythen, wonach ein Gott oder mehrere Götter den Himmel, die Erde und den Ozean erschufen. Irgendwann im Verlauf dieser schöpferischen Tätigkeit formten sie auch Männer und Frauen – schwächliche, hilflose Gebilde, die dem Zorn der Götter schutzlos ausgeliefert waren. Erst vor ganz kurzer Zeit in der Geschichte der menschlichen Spezies wendete sich das Blatt: Jetzt galten Frauen und Männer als die eigentlichen Schöpfer und die Götter als Ausgeburten ihrer Phantasie. Ob diese Entwicklung vor zweieinhalb Jahrtausenden in Griechenland oder China ihren Anfang nahm oder zweitausend Jahre später in Florenz, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Das Entscheidende ist, daß sich diese Einstellung erst vor relativ kurzer Zeit in der Millionen Jahre alten Geschichte dieser Spezies herausbildete.
Wir änderten also unsere Ansichten über die Beziehung zwischen Göttern und Menschen. Man kann leicht nachvollziehen, warum es zu dieser Entwicklung kam. Als die ersten Schöpfungsmythen entstanden, waren die Menschen in der Tat hilflose Wesen, die auf Gedeih und Verderb der Kälte, dem Hunger, wilden Tieren und ihren eigenen Artgenossen ausgeliefert waren. Sie hatten keine Vorstellung davon, wie sie die ungeheuren Kräfte, die sie in ihrer Umwelt wahrnahmen, erklären sollten – den Auf- und Untergang der Sonne, die Bewegungen der Sterne, die wechselnden Jahreszeiten. Ihre Sehnsucht nach einem festen Halt in dieser rätselvollen Welt war von einer ehrfürchtigen Scheu durchdrungen. Dann, anfangs langsam, aber schließlich immer rascher in den letzten tausend Jahren, fingen wir an zu begreifen, wie alles funktioniert – Mikroben und Planeten, Blutkreislauf und Meeresgezeiten –, und plötzlich schien der Mensch alles andere als hilflos. Große Maschinen wurden gebaut, Energien nutzbar gemacht, das Angesicht der Erde durch menschliche Fähigkeiten und Begierden völlig verwandelt. Es ist nicht überraschend, daß wir auf dem vermeintlichen Gipfel unserer Evolution den Titel des Schöpfers für uns selbst in Anspruch nahmen.
Ob dieser Rollenwechsel der menschlichen Spezies nützen oder ihren Untergang bewirken wird, bleibt abzuwarten. Es wäre hilfreich, wenn wir die ungeheure Verantwortung, die mit dieser neuen Rolle verbunden ist, erkennen würden. Die alten Götter wie Schiwa oder Jehova waren sowohl Schöpfer als auch Zerstörer. Das Universum überdauerte in dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen ihrer Gnade und ihrem Zorn. Heute entscheiden unsere eigenen widersprüchlichen Neigungen darüber, ob unsere Welt sich in einen blühenden Garten oder in eine trostlose Wüste verwandeln wird. Die Wüste wird wahrscheinlich den Sieg davontragen, wenn wir unsere neu gewonnene Macht weiterhin blind mißbrauchen und das zerstörerische Potential verkennen, das mit unserer Verwalterrolle verbunden ist.
Auch wenn wir nicht voraussehen können, zu welchen Ergebnissen unsere Kreativität letztendlich führen wird – unser Bestreben, die Welt nach unserem Willen zu gestalten und zu den mächtigsten Geschöpfen dieses Planeten zu werden, die über das Schicksal jeder Form von Leben entscheiden –, können wir doch zumindest versuchen, besser zu verstehen, was diese Kraft ist und wie sie funktioniert. Denn was auch geschieht, die Zukunft ist heute untrennbar mit der menschlichen Kreativität verknüpft. Das Ergebnis wird zu einem großen Teil von unseren Träumen bestimmt werden und von den Anstrengungen, die wir unternehmen, um diese Träume wahr zu machen.
Dieses Buch ist der Versuch einer Synthese von dreißig Jahren Forschung zum Leben und Werk von kreativen Menschen. Es möchte den rätselhaften Prozeß verständlicher machen, durch den Männer und Frauen neue Ideen und Werke hervorbringen. Meine Forschungsarbeit auf diesem Gebiet hat mich davon überzeugt, daß man die Kreativität nicht begreifen kann, wenn man nur den einzelnen Menschen betrachtet, von dem sie auszugehen scheint. So wie das Krachen eines umstürzenden Baumes ungehört verhallt, wenn niemand da ist, um es zu hören, so gehen auch kreative Ideen unbemerkt unter, wenn sie nicht von einem empfänglichen Publikum wahrgenommen und umgesetzt werden. Und ob der individuell erhobene Anspruch auf Kreativität berechtigt ist, können nur kompetente Andere entscheiden.
So gesehen entsteht Kreativität aus der Interaktion dreier Elemente, die gemeinsam ein System bilden: einer Kultur, die symbolische Regeln umfaßt, einer Einzelperson, die etwas Neues in diese symbolische Domäne einbringt, und einem Feld von Experten, die diese Innovation anerkennen und bestätigen. Alle drei Elemente sind notwendig, damit es zu einer kreativen Idee, Arbeit oder Entdeckung kommen kann. Vera Rubins Schilderung ihrer astronomischen Entdeckung ist zum Beispiel unvorstellbar ohne den Zugang zum gewaltigen Fundus an Informationen, die seit Jahrhunderten über Himmelsbewegungen gesammelt wurden, ohne Zugang zu den Institutionen, die heute im Besitz der Riesenteleskope sind, und ohne die anfängliche Skepsis und spätere Unterstützung anderer Astronomen. Meiner Ansicht nach sind dies keine zufälligen Begleiterscheinungen der individuellen Schöpfungskraft, sondern wesentliche Bestandteile des kreativen Prozesses, von gleichrangiger Bedeutung wie die Beiträge des einzelnen. Deshalb widme ich in diesem Buch der Domäne und dem Feld fast genausoviel Aufmerksamkeit wie der kreativen Einzelpersönlichkeit.
Kreativität ist das kulturelle Gegenstück zum genetischen Veränderungsprozeß, der die biologische Evolution bewirkt. Bei diesem Prozeß, der sich unterhalb der Schwelle unserer bewußten Wahrnehmung vollzieht, kommt es zu zufälligen Veränderungen in der Zusammensetzung unserer Chromosomen. Diese Variationen führen dazu, daß plötzlich ein Kind mit einem neuen körperlichen Merkmal geboren wird. Wenn dieses Merkmal eine Verbesserung gegenüber dem bisher Bestehenden darstellt, hat es gute Aussichten, auch an die Nachfahren des Kindes vererbt zu werden. Die meisten dieser neuen Merkmale tragen nicht dazu bei, unsere Überlebenschancen zu erhöhen, und sind dann nach einigen Generationen wieder verschwunden. Aber die wenigen, die sich als Verbesserungen erweisen, werden beibehalten, und sie bilden die Grundlage der biologischen Evolution.
In der kulturellen Evolution gibt es keine Mechanismen, die genauso wirken wie Gene und Chromosomen. Eine neue Idee oder eine Erfindung wird nicht automatisch an die nächste Generation vererbt. Das Wissen, wie man das Feuer, das Rad oder die Atomenergie nutzt, wird nicht als genetische Information an die Kinder weitergegeben, die nach solchen Entdeckungen zur Welt kommen. Jedes Kind muß dieses Wissen aufs neue erwerben. Die Rolle der Gene in der biologischen Evolution wird in der kulturellen Evolution von Memen übernommen, das heißt von Informationseinheiten, die wir erlernen müssen, um den Fortbestand der Kultur zu sichern. Sprachen, Zahlen, Theorien, Lieder, Rezepte, Gesetze und Wertvorstellungen sind allesamt Meme, die wir an unsere Kinder weitergeben und dadurch lebendig erhalten. Diese Meme sind es, die ein kreativer Mensch verändert, und wenn genügend einflußreiche Personen diese Veränderung für eine Verbesserung halten, wird sie zu einem Teil der Kultur.
Wenn man die Kreativität verstehen will, reicht es deshalb nicht aus, die Einzelpersönlichkeiten zu untersuchen, die den Hauptanteil an einer neuen Idee oder Erfindung zu haben scheinen. Der Beitrag des einzelnen ist zwar wichtig und notwendig, aber nur ein einzelnes Glied in einer Kette, eine einzelne Phase eines Prozesses. Die Behauptung, daß Thomas Edison die Elektrizität entdeckt habe oder Albert Einstein die Relativität, ist eine angenehme Vereinfachung. Sie befriedigt unser uraltes Bedürfnis nach eingängigen Geschichten mit übermenschlichen Helden. Aber die Entdeckungen von Edison oder Einstein wären undenkbar ohne das zuvor gesammelte Wissen, ohne das intellektuelle und soziale Netzwerk, das ihr Denken stimulierte, und ohne die gesellschaftlichen Mechanismen, die ihre Innovationen bewerteten und verbreiteten. Zu behaupten, Einstein sei der Erfinder der Relativitätstheorie, ist so, als wollte man sagen, daß der Funke für das Feuer verantwortlich sei. Der Funke ist notwendig, aber ohne Luft und Brennmaterial würde es keine Flamme geben.
Dieses Buch handelt nicht von den originellen Weisheiten, die Kinder häufig von sich geben, oder von der Kreativität, die wir alle kennen, einfach weil wir einen Verstand haben und ihn gelegentlich benutzen. Es befaßt sich nicht mit großartigen Ideen für todsichere Geschäfte, mit neuen Zubereitungsmethoden für gefüllte Artischocken oder originellen Dekorationsvorschlägen für eine häusliche Party. Das sind Beispiele für die »kleine« Kreativität, die ein wichtiger Bestandteil des Alltags ist und die wir ohne Zweifel fördern sollten. Aber dazu ist es notwendig, zunächst die »große« Kreativität zu verstehen – und das ist das Ziel dieses Buches.
Aufmerksamkeit und Kreativität
Kreativität oder zumindest die Form von Kreativität, mit der sich dieses Buch befaßt, ist der Prozeß, durch den eine symbolische Domäne der Kultur verändert wird. Neue Lieder, neue Ideen, neue Maschinen sind Ausdrucksformen der Kreativität. Aber weil diese Veränderungen nicht automatisch vor sich gehen wie in der biologischen Evolution, ist es notwendig, den Preis zu berücksichtigen, den wir für die Kreativität zahlen müssen. Es kostet Mühe und Anstrengung, Traditionen zu verändern. Meme müssen zum Beispiel erlernt werden, bevor sie verändert werden können: Ein Musiker muß sich in musikalischen Traditionen auskennen, das Notensystem beherrschen und lernen, ein Instrument zu spielen, bevor er daran denken kann, eine neue Symphonie zu schreiben. Bevor ein Erfinder das Design eines Flugzeugs verbessern kann, muß er sich mit der Physik und Aerodynamik vertraut machen und wissen, warum Vögel nicht vom Himmel fallen.
Wenn wir etwas lernen wollen, müssen wir den zu erlernenden Informationen Aufmerksamkeit schenken. Und die Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource: Wir können immer nur eine begrenzte Menge an Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt verarbeiten. Diese Menge läßt sich nicht präzise bestimmen, aber es ist zum Beispiel klar, daß wir nicht gleichzeitig Physik und Musik lernen können. Wir haben auch Mühe, etwas Neues zu lernen, wenn wir mit anderen notwendigen Aufgaben beschäftigt sind, die ebenfalls Aufmerksamkeit verlangen, wie Duschen, Anziehen, das Frühstück vorbereiten, Autofahren, mit dem Ehemann reden usw. Ein Großteil unseres begrenzten Aufmerksamkeitsvorrats wird für Aufgaben verwendet, die unser tägliches Überleben sichern. Von der ohnehin begrenzten Menge an Aufmerksamkeit, die uns im Leben zur Verfügung steht, bleibt alles in allem nur ein Bruchteil für das Erlernen einer symbolischen Domäne wie der Musik oder Physik übrig.
Aus diesen einfachen Prämissen ergeben sich einige wichtige Konsequenzen. Kreative Entwicklungen in einer bestimmten Domäne sind nur möglich, wenn ein Überschuß an Aufmerksamkeit vorhanden ist. Deshalb waren solche Zentren der Kreativität wie Athen im fünften Jahrhundert vor Christus, Florenz im fünfzehnten Jahrhundert oder Paris im neunzehnten Jahrhundert allesamt Orte, an denen ein relativ hoher materieller Wohlstand dem einzelnen erlaubte, über das Überlebensnotwendige hinaus zu lernen und zu experimentieren. Außerdem liegen Zentren der Kreativität offenbar häufig an den Schnittstellen verschiedener Kulturen, wo Überzeugungen, Lebensweisen und Erkenntnisse zusammentreffen und dem einzelnen die Möglichkeit geben, neue Ideenkombinationen leichter wahrzunehmen. In uniformen, starren Kulturen muß man mehr Aufmerksamkeit investieren, um neue Denkweisen hervorzubringen. Mit anderen Worten, Kreativität entfaltet sich am ehesten an Orten, wo neue Ideen weniger wahrnehmbare Anstrengungen erfordern.
Je weiter eine Kultur voranschreitet, desto schwieriger wird es, mehr als einen einzelnen Wissensbereich zu beherrschen. Niemand weiß, wer tatsächlich der letzte Renaissance-Mensch war, aber kurz nach Leonardo da Vinci wurde es unmöglich, genug über alle Künste und Wissenschaften zu lernen, um ein Experte in mehr als einem kleinen Teilbereich zu sein. Domänen sind in Unterdomänen aufgespalten worden, und ein Mathematiker, der die Algebra meisterhaft beherrscht, weiß vielleicht nur wenig über die Zahlentheorie, Kombinatorik oder Topologie – und vice versa. Während ein typischer Künstler früherer Jahrhunderte Maler, Bildhauer, Goldschmied und Architekt in einem war, werden all diese Spezialfertigkeiten heute von verschiedenen Personen erworben.
Daraus folgt, daß ein spezialisiertes Wissen dem generalisierten Wissen vorgezogen wird, je weiter die Kultur voranschreitet. Das läßt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Stellen Sie sich drei Personen vor – eine, die Musik studiert, eine, die Physik studiert, und eine, die beides studiert. Bei ansonsten gleichen Voraussetzungen wird die Person, die sowohl Musik als auch Physik studiert, ihre Aufmerksamkeit zwischen diesen beiden symbolischen Domänen aufspalten müssen, während die beiden anderen ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen einzigen Bereich konzentrieren können. Folglich werden die beiden spezialisierten Individuen ein detaillierteres Wissen in ihrer Domäne erwerben, und ihre Fachkenntnis wird der des Generalisten vorgezogen werden. Mit der Zeit übernehmen die Spezialisten zwangsläufig die Führung und Kontrolle der verschiedenen kulturellen Institutionen.
Natürlich ist diese Tendenz zur Spezialisierung nicht nur etwas Gutes. Sie kann leicht zu einer kulturellen Fragmentierung führen, wie die Bibel am Beispiel des Turmbaus zu Babel beschreibt. Eine Fülle von Beispielen in diesem Buch deutet zudem darauf hin, daß zur Kreativität im allgemeinen ein grenzüberschreitendes Element gehört; so kann ein Chemiker, der die Quantentheorie aus der Physik übernimmt und sie auf Molekülverbindungen anwendet, einen substantielleren Beitrag zur Chemie leisten, als sein Kollege, der sich ausschließlich innerhalb der Grenzen der Chemie bewegt. Gleichzeitig sollte man jedoch bedenken, daß angesichts der begrenzten Aufmerksamkeit, die uns zur Verfügung steht, und angesichts der stetig wachsenden Informationsflut in den einzelnen Domänen eine Spezialisierung unvermeidlich scheint. Dieser Trend mag umkehrbar sein, aber nur wenn wir uns bewußt um eine Alternative bemühen: Wenn wir diese Entwicklung sich selbst überlassen, wird sie sich zweifellos verstärken.
Eine weitere Konsequenz der begrenzten Aufmerksamkeit ist, daß kreative Menschen häufig als Sonderlinge gelten – oder gar als arrogant, selbstsüchtig und rücksichtslos. Man sollte allerdings nicht vergessen, daß dies keine angeborenen Eigenschaften von kreativen Personen sind, sondern Merkmale, die wir ihnen aufgrund unserer Wahrnehmung unterstellen. Wenn wir einen Menschen kennenlernen, der möglicherweise herzensgut und freundlich ist, aber seine gesamte Konzentration auf die Physik oder Mathematik richtet und deshalb einfach keine Aufmerksamkeit übrig hat, um sich unseren Namen zu merken, auf unsere Gefühle einzugehen oder die Wünsche Dritter in Betracht zu ziehen, empfinden wir sein Verhalten als »unsensibel«, »egoistisch« und »rücksichtslos«. Es ist jedoch praktisch unmöglich, ein so umfassendes Verständnis von einer Domäne zu gewinnen, daß man sie verändern kann, ohne seine gesamte Aufmerksamkeit darauf zu konzentrieren und dadurch arrogant, selbstsüchtig oder rücksichtslos auf jene zu wirken, die meinen, ein Anrecht auf die Aufmerksamkeit der kreativen Person zu haben.
Tatsächlich sind kreative Menschen normalerweise weder einseitig spezialisiert noch egoistisch. Häufig ist das Gegenteil der Fall. Sie stellen leidenschaftlich gern Verbindungen zu angrenzenden Wissensgebieten her. Sie sind – im Prinzip – fürsorglich und einfühlsam. Aber die Anforderungen ihrer Tätigkeit treiben sie unweigerlich zur Spezialisierung und Selbstsucht. Von den vielen Paradoxen der Kreativität ist dieses vielleicht am schwersten zu vermeiden.
Was bringt eine Erforschung der Kreativität?
Vor allem aus zwei Gründen erscheint es lohnend, das Leben von kreativen Menschen und den Kontext ihrer Errungenschaften zu untersuchen. Der erste liegt auf der Hand: Die Ergebnisse der Kreativität bereichern die Kultur und verbessern dadurch indirekt unser aller Lebensqualität. Aber dieses Wissen bietet auch die Möglichkeit zu direkten Verbesserungen, weil wir daraus lernen können, wie wir unser eigenes Leben interessanter und produktiver gestalten. Im letzten Kapitel dieses Buches fasse ich zusammen, wie man die Erkenntnisse dieser Studie für die Bereicherung des ganz normalen Alltagslebens nutzen kann.
Manche Leute sind der Ansicht, ein Studium der Kreativität stelle eine elitäre Ablenkung von den wirklich drängenden Problemen dar, mit denen wir konfrontiert werden. Wir sollten uns mit aller Kraft auf die Bekämpfung der Überbevölkerung, der Armut oder des Bildungsdefizits konzentrieren. Nach dieser Auffassung ist die Beschäftigung mit der Kreativität ein überflüssiger Luxus. Aber in gewisser Weise ist dies eine sehr kurzsichtige Position. Erstens werden neue, umsetzbare Lösungen für die Armut oder Überbevölkerung nicht wie durch ein Wunder aus dem Nichts entstehen. Wir können die Probleme nur lösen, wenn wir ihnen sehr viel Aufmerksamkeit widmen und uns kreativ damit auseinandersetzen. Zweitens reicht es nicht aus, die Fehler zu korrigieren, wenn man eine bessere Welt schaffen will. Man braucht auch ein positives Ziel, das zum Weitermachen motiviert. Die Kreativität ist eine solche Motivationsquelle: Sie bietet eines der aufregendsten Lebensmodelle. Psychologen haben viel über das Denken und Fühlen gesunder Menschen herausgefunden, indem sie die pathologischen Fälle untersuchten. Die Beispiele von hirngeschädigten Patienten, Neurotikern oder Straftätern haben einen Vergleichsmaßstab geboten, der normale Funktionsweisen verständlicher machte. Aber wir haben wenig vom anderen Ende der Skala gelernt, von Menschen, die sich in einem positiven Sinn vom Durchschnitt abheben. Wenn wir jedoch herausfinden möchten, was in unserem eigenen Leben vielleicht fehlt, sollten wir die Erfahrungen von Menschen untersuchen, die ein glückliches und erfülltes Leben führen. Das ist einer der Hauptgründe für dieses Buch: die Erforschung einer Lebensweise, die mehr Befriedigung verspricht als die meisten gängigen Modelle.
Jeder Mensch wird mit zwei widersprüchlichen Instruktionsprogrammen geboren: einer konservativen Tendenz, die auf dem Selbsterhaltungstrieb, der instinktiven Neigung zur Selbstverherrlichung und zum Energiesparen beruht, und einer expansiven Tendenz, die mit instinktivem Forscherdrang, einer angeborenen Abenteuerlust und Risikofreude verbunden ist – zu dieser Kategorie gehört die Neugier, die zur Kreativität führt. Beide Programme sind notwendig. Aber während die erste Tendenz wenig Ermutigung oder Unterstützung von außen braucht, um das Verhalten zu motivieren, kann die zweite Tendenz verkümmern, wenn sie nicht gefördert wird. Wenn es zu wenig Anreize für die Neugier gibt, wenn der Risikobereitschaft und dem Forschungsdrang zu viele Hindernisse im Weg stehen, wird die Neigung zu einem kreativen Verhalten leicht erstickt.
Man könnte vermuten, die Kreativität gehöre in Anbetracht ihrer Bedeutung zu unseren obersten Prioritäten. Und tatsächlich werden zahllose Lippenbekenntnisse zur Kreativität abgelegt. Aber wenn man die Realität betrachtet, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die wissenschaftliche Grundlagenforschung wird zugunsten sofortiger praktischer Anwendungsmöglichkeiten auf ein Minimum reduziert. Die Künste werden zunehmend als überflüssige Luxusartikel betrachtet, die ihre Daseinsberechtigung im anonymen Massenmarkt beweisen müssen. In den Unternehmen schreitet der Personalabbau rapide voran, und ein Firmenchef nach dem anderen erklärt, daß dies nicht das Zeitalter der Erfinder, sondern der Buchhalter sei, nicht das Klima für Aufbau und Risikobereitschaft, sondern für Kosteneinsparungen. In Wirklichkeit erfordert der verschärfte globale Wettbewerb genau die gegenteilige Strategie.
Und was für die Wissenschaft, die Kunst und die Wirtschaft gilt, das gilt auch für die Bildung. Wenn die Budgets schrumpfen und die Leistungskriterien ins Wanken geraten, entscheiden sich mehr und mehr Schulen für die Streichung der »Extras« – worunter normalerweise die künstlerischen Fächer sowie Aktivitäten außerhalb des Lehrplans verstanden werden – und konzentrieren sich verstärkt auf die sogenannten Grundlagenfächer. Daran wäre nichts auszusetzen, wenn Lesen, Schreiben und Rechnen so unterrichtet würden, daß sie Originalität und kreatives Denken fördern. Leider ist das selten der Fall. Schüler empfinden die Grundlagenfächer im allgemeinen als bedrohlich oder langweilig. Eine Möglichkeit zur geistigen Kreativität finden sie nur bei der Schülerzeitung, in der Theater-AG oder im Schulchor. Wenn die nächste Generation den künftigen Herausforderungen mit Tatkraft und Selbstvertrauen begegnen soll, müssen wir ihr schöpferisches Potential genauso fördern wie ihr Fachwissen.
Wie die Studie durchgeführt wurde
Zwischen 1990 und 1995 habe ich gemeinsam mit meinen Studenten an der University of Chicago Interviews mit einer Gruppe von einundneunzig außergewöhnlichen Persönlichkeiten durchgeführt und auf Video aufgezeichnet. Die Tiefenanalyse dieser Interviews veranschaulicht, was kreative Menschen auszeichnet, wie der kreative Prozeß verläuft und welche äußeren Bedingungen die Entstehung von schöpferischen Ideen fördern oder behindern.
Wir hatten drei Hauptkriterien für die Auswahl der Interviewpartner: Die Person mußte einen bedeutenden Beitrag zu einer wichtigen Domäne geleistet haben – zu Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Politik oder zum Wohl der Menschheit im allgemeinen. Sie mußte nach wie vor aktiv in dieser (oder einer anderen) Domäne tätig sein und das sechzigste Lebensjahr vollendet haben (in einigen Fällen haben wir, wenn die Umstände es rechtfertigten, auch etwas jüngere Personen befragt). Eine Liste der Interviewpartner findet sich in Anhang A.
Der Auswahlprozeß war mühsam und langwierig. Ich hatte die Absicht, eine gleich große Anzahl von Männern und Frauen zu befragen, die die Kriterien erfüllten. Außerdem sollte die Studie ein möglichst breites Spektrum gesellschaftlicher Herkunft widerspiegeln. Mit diesen Kriterien im Hinterkopf fing ich an, Listen von Personen zusammenzustellen, die den Anforderungen gerecht wurden. Bei der Auswahl ließ ich mich ausführlich von Kollegen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen beraten. Nach einer Weile schlugen auch die graduierten Studenten, die an dem Projekt teilnahmen, neue Namen vor; weitere Hinweise erhielten wir durch eine Art »Schneeballsystem« von den Interviewpartnern, die jeweils weitere Teilnehmer vorschlugen.
Wenn das Forschungsteam übereinkam, daß die Leistungen eines vorgeschlagenen Kandidaten ihn für die Auswahl qualifizierten, baten wir ihn schriftlich um seine Teilnahme und erläuterten die Studie. Wenn wir nach drei Wochen keine Antwort erhalten hatten, wiederholten wir unsere Bitte und versuchten dann, die Person telefonisch zu erreichen. Von den 275 Personen, die wir zunächst ansprachen, lehnte etwa ein Drittel ab, genauso viele Personen stimmten einer Teilnahme zu, und ein Viertel antwortete nicht oder konnte nicht ausfindig gemacht werden. Unter den Personen, die die Einladung annahmen, befanden sich viele, die weithin für ihre Kreativität anerkannt waren. Die Interviewpartner teilten sich vierzehn Nobelpreise (vier in Physik, vier in Chemie, zwei in Literatur, zwei in Physiologie und Medizin sowie ein Friedensnobelpreis und ein Wirtschaftsnobelpreis). Die Mehrzahl der übrigen Teilnehmer konnte auf nicht minder hohe Ehrungen verweisen, auch wenn diese weniger bekannt waren.
Einige lehnten aus gesundheitlichen Gründen ab, viele aus Zeitgründen. Die Sekretärin des Schriftstellers Saul Bellow schrieb: »Mr. Bellow hat mir mitgeteilt, daß er in seiner zweiten Lebenshälfte unter anderem deshalb kreativ bleibt, weil er sich nicht gestattet, ein Gegenstand von ›Studien‹ anderer Leute zu sein. Jedenfalls ist er im Moment auf Sommerurlaub.« Der Fotograf Richard Avedon sandte uns eine kurze handschriftliche Notiz: »Sorry – keine Zeit!« Die Sekretärin des Komponisten György Ligeti schrieb:
Er ist kreativ und – deshalb – total überarbeitet. Es ist eben jener kreative Prozeß, den Sie untersuchen möchten, der ihm leider nicht die Zeit läßt, an Ihrer Studie teilzunehmen. Er bedauert, daß er Ihren Brief nicht persönlich beantworten kann, weil er gerade intensiv am Abschluß eines Violinkonzerts arbeitet, dessen Premiere für diesen Herbst geplant ist, und bittet um Ihr Verständnis.
Mr. Ligeti hat mich außerdem gebeten, Ihnen mitzuteilen, daß er Ihr Projekt äußerst interessant findet und sehr gespannt auf die Ergebnisse ist.
Einige kamen unserer Bitte nicht nach, weil sie das Studium der Kreativität für Zeitverschwendung hielten. Der Dichter und Romancier Czeslaw Milosz schrieb: »Ich stehe einer Erforschung der Kreativität sehr skeptisch gegenüber und möchte mich Interviews zu diesem Thema nicht aussetzen. Ich glaube, daß fast allen Erörterungen der ›Kreativität‹ einige methodische Irrtümer zugrunde liegen.« Der Schriftsteller Norman Mailer antwortete: »Es tut mir leid, aber ich gebe grundsätzlich keine Interviews über den Arbeitsprozeß. Hier gilt Heisenbergs Unschärferelation.« Peter Drucker, der Managementexperte und Professor für orientalische Kunst, entschuldigte sich mit folgenden Worten:
Ich fühle mich sehr geehrt und geschmeichelt durch Ihren freundlichen Brief vom 14. Februar, denn ich bin seit vielen Jahren ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit und habe viel daraus gelernt. Aber ich fürchte, lieber Professor Czikszentmihalyi, daß ich Sie enttäuschen muß. Ich kann Ihre Fragen unmöglich beantworten. Man sagt mir, daß ich kreativ sei, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet ... ich arbeite einfach unverdrossen vor mich hin.
... Ich hoffe, Sie halten mich nicht für anmaßend oder unhöflich, wenn ich sage, daß eines der Geheimnisse der Produktivität (an die ich im Gegensatz zur Kreativität glaube) darin besteht, einen sehr großen Papierkorb zu besitzen, in dem alle Anfragen wie die Ihrigen landen – nach meiner Erfahrung bedeutet Produktivität, daß man nichts tut, um die Arbeit anderer zu unterstützen, sondern seine gesamte Zeit darauf verwendet, die Arbeit zu tun und gut zu tun, für die der liebe Gott einen geschaffen hat.
Der Grad der Akzeptanz variierte auch je nach Fachgebiet. Mehr als die Hälfte der Naturwissenschaftler stimmte unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Zeit einer Teilnahme zu. Künstler, Schriftsteller und Musiker neigten dagegen dazu, unsere Briefe nicht zu beantworten oder die Anfrage abzulehnen – ein knappes Drittel nahm die Einladung an. Es wäre interessant, die Ursachen für diese unterschiedliche Verteilung zu erforschen.
Derselbe Prozentsatz von Frauen und Männern stimmte einer Teilnahme zu, aber da in bestimmten Bereichen kreative Frauen mit einem großen Bekanntheitsgrad unterrepräsentiert sind, waren wir nicht in der Lage, das angestrebte Geschlechterverhältnis von 50 zu 50 herzustellen. Statt dessen beträgt das Verhältnis etwa 70 zu 30 zugunsten der Männer.
Normalerweise muß man in der psychologischen Forschung sicherstellen, daß die untersuchten Personen »repräsentativ« für die betreffende »Population« sind – in diesem Fall für die Population kreativer Personen. Ist die Auswahl nicht repräsentativ, kann man keine allgemeinen Aussagen über die Bevölkerung treffen. Aber in diesem Fall versuche ich gar nicht erst, irgendwelche Verallgemeinerungen über kreative Personen anzustellen. Was ich gelegentlich versuche, ist, einige weit verbreitete Annahmen zu widerlegen. Das Widerlegen einer Hypothese ist in der Wissenschaft leichter, als sie zu bestätigen: Ein einziges Gegenbeispiel reicht aus, um eine Verallgemeinerung zu widerlegen, aber selbst alle Beispielfälle der Welt reichen für einen definitiven Nachweis nicht aus. Wenn ich nur einen einzigen weißen Raben finde, habe ich die Behauptung widerlegt, daß alle Raben schwarz sind. Aber selbst wenn ich auf Millionen schwarzer Raben verweisen kann, habe ich nicht definitiv bewiesen, daß alle Raben schwarz sind. Irgendwo könnte sich immer noch ein weißer Rabe verstecken. Derselbe Mangel an Symmetrie zwischen dem, was als Widerlegung und dem, was als Nachweis betrachtet wird, gilt selbst für die hehren Gesetze der Physik.
Für die Zwecke dieses Buchs reicht die Widerlegungsstrategie völlig aus. Die Informationen, die wir gesammelt haben, könnten zum Beispiel nicht beweisen, daß alle kreativen Personen eine glückliche Kindheit hatten, auch wenn alle Befragten erklärt hätten, daß ihre Kindheit glücklich war. Ein einziges unglückliches Kind kann diese Hypothese widerlegen – so wie ein einziges glückliches Kind die gegenteilige Hypothese widerlegen würde, daß jeder kreative Mensch eine unglückliche Kindheit hatte. Die relativ kleine Auswahl – oder ihr mangelnder repräsentativer Charakter – ist also kein wirkliches Hindernis, um solide Schlüsse aus den Daten zu ziehen.
Es stimmt, daß in den Sozialwissenschaften Behauptungen normalerweise weder richtig noch falsch sind, sondern nur die statistische Überlegenheit einer Hypothese über eine andere belegen. Wir würden sagen, daß die Zahl der schwarzen Raben die der weißen Raben um ein so Vielfaches übersteigt, daß es kein bloßer Zufall sein kann. Daraus ziehen wir den Schluß, daß »Raben in der Regel schwarz sind«, und schätzen uns glücklich, eine solche Aussage treffen zu können. In diesem Buch bediene ich mich nicht der Statistik, um die vorgestellten Vergleiche zu überprüfen, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens scheint mir die Fähigkeit, einige tief verwurzelte Vorurteile über die Kreativität zu widerlegen, ausreichend, und hier bewegen wir uns auf sicherem Boden. Zweitens widersprechen die Merkmale dieser einzigartigen Probandengruppe den meisten Annahmen, auf denen statistische Tests normalerweise aufbauen. Drittens gibt es keine sinnvolle Kontrollgruppe, mit der wir die aufgedeckten Muster vergleichen könnten.
Mit einigen wenigen Ausnahmen wurden die Interviews in den Arbeitsräumen oder in der Wohnung der Befragten durchgeführt. Die Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet und dann wortwörtlich niedergeschrieben. Sie dauerten im allgemeinen zwei Stunden, einige etwas kürzer und einige etwas länger. Im Hinblick auf die Informationen über diese Probandengruppe bildeten die Interviews allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Interviewpartner haben Bücher und Artikel geschrieben, einige auch Autobiographien oder andere Werke, die zusätzliche Informationen lieferten. Tatsächlich hat jede Person eine derart umfassende schriftliche Fährte hinterlassen, daß man mehrere Leben bräuchte, um alle Spuren zu verfolgen. Das Material ist jedoch äußerst nützlich, um das Verständnis für die Einzelperson und ihr Leben abzurunden.
Unser Interviewschema umfaßte mehrere allgemeine Fragen, die wir nach Möglichkeit jedem Teilnehmer stellten (eine Kopie dieser Fragen findet sich in Anhang B). Aber wir haben nicht unbedingt versucht, sie jedesmal in derselben Reihenfolge zu stellen, auch haben wir nicht jedesmal genau die gleiche Formulierung verwendet. Für mich war das Wichtigste, daß das Interview einem normalen Gespräch so nah wie möglich kam. Natürlich haben beide Methoden ihre Vor- und Nachteile. Ich hatte jedoch das Gefühl, daß es kränkend und daher kontraproduktiv wäre, den Interviewpartnern eine mechanische Abfolge von Fragen aufzuzwingen. Weil mir sehr viel an ehrlichen und nachdenklichen Antworten lag, ließ ich dem Gespräch bei Themen, die mich interessierten, freien Lauf, anstatt es in eine feste Form zu pressen. Daß die Interviews so lebendig und vielfältig ausfielen, ist nicht zuletzt auch der exzellenten Arbeit der mitwirkenden Studenten zu verdanken.
Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, stellte mich die Fülle des Materials vor die Qual der Wahl. Tausende von Seiten verlangten nach Aufmerksamkeit, aber ich konnte nur einem winzigen Bruchteil des Materials gerecht werden. Die Entscheidung war oft schmerzlich – so viele wundervolle Schilderungen mußten gestrichen oder stark gekürzt werden. Die Interviews, die ich ausführlich zitiere, stammen nicht unbedingt von den berühmtesten und nicht einmal von den kreativsten Personen. Vielmehr habe ich diejenigen Auszüge gewählt, die ein mir wichtig erscheinendes theoretisches Thema am deutlichsten veranschaulichen. Insofern ist die Auswahl subjektiv. Aber ich bin zuversichtlich, daß ich den Sinn der einzelnen Aussagen und den Konsens der Gesamtgruppe nicht verzerrt habe.
Auch wenn die Stimme einiger Befragter nicht durch ein wörtliches Zitat wiedergegeben wird, hat der Inhalt ihrer Aussagen Eingang in die Verallgemeinerungen gefunden, die gelegentlich in Wort oder Zahl auftauchen. Zudem hoffe ich, daß meine Studenten, ich selbst oder andere Wissenschaftler das reiche Material, die hier leider gekürzt werden mußte, eines Tages vollständig erschließen werden.
Zu schön, um wahr zu sein?
Im Gegensatz zur gängigen Vorstellung vom kreativen Individuum ergeben die Interviews ein optimistisches und positives Bild von der Kreativität und von der kreativen Persönlichkeit. Anstatt zu argwöhnen, daß es sich bei den Berichten um eigennützige Erfindungen handelt, nehme ich die Worte für bare Münze – vorausgesetzt, sie werden nicht durch andere bekannte Fakten über die Person oder innere Widersprüche in den Äußerungen widerlegt.
Viele Sozialwissenschaftler in den letzten hundert Jahren haben es sich allerdings zur Aufgabe gemacht, Heuchelei, Eigeninteresse und Selbsttäuschung aufzudecken, die bestimmten menschlichen Verhaltensweisen zugrunde liegen und vor Ende des neunzehnten Jahrhunderts nie wissenschaftlich hinterfragt wurden. Große Dichter wie Dante oder Chaucer waren natürlich aufs Innigste mit den Schwächen der menschlichen Natur vertraut. Aber erst als Freud die Möglichkeit der Verdrängung beschrieb, Marx die Macht eines falschen Bewußtseins aufdeckte und Soziobiologen nachwiesen, wie viele unserer Handlungen das Ergebnis selektiver Zwänge sind, konnten wir systematisch erforschen, warum unsere Selbstbeschreibungen häufig sehr irreführend sind.
Leider wurden die ungeheuer wichtigen Erkenntnisse, die wir Freud und anderen großen Denkern verdanken, durch die wahllose Anwendung ihrer Ideen auf praktisch jeden Aspekt des menschlichen Verhaltens bis zu einem gewissen Grade zunichte gemacht. Das Ergebnis ist, um mit Hannah Arendt zu sprechen, daß unsere Disziplin Gefahr läuft, zu einem »Entlarvungs-Unternehmen« zu entarten, das eher auf Ideologien denn auf Beweisen beruht. Wer sich auf das Studium der menschlichen Natur einläßt, lernt als erstes, dem äußeren Schein grundsätzlich zu mißtrauen – nicht im Sinne einer vernünftigen, methodischen Vorsichtsmaßnahme, die jeder gute Wissenschaftler begrüßen würde, sondern im Sinne des unumstößlichen Dogmas, daß man nichts unbesehen glauben darf. Ich kann mir vorstellen, was einige spitzfindige Kollegen mit der folgenden Erklärung anfangen würden, die eine der von uns befragten Personen abgab: »Ich bin seit vierundvierzig Jahren mit einem Mann verheiratet, den ich anbete. Er ist Arzt. Wir haben vier Kinder, die alle promoviert haben und alle sehr glücklich sind.«
Die gelehrten Professoren würden wahrscheinlich ein feines, ironisches Lächeln aufsetzen und in diesen Einlassungen den Versuch sehen, ein unglückliches Familienleben zu leugnen. Andere würden die Äußerung dahingehend deuten, daß die Sprecherin ihr Publikum beeindrucken will. Wieder andere würden den optimistischen Ausbruch der Person als erzählerisches Stilmittel deuten, das sich aus dem Kontext des Interviews ergab, nicht weil es wortwörtlich wahr ist, sondern weil Gespräche ihrer eigenen Logik und ihrer eigenen Wahrheit folgen. Oder sie würden es als Ausdruck einer bürgerlichen Ideologie betrachten, wonach der akademische Titel und ein angenehmer Mittelklasse-Status mit Glück gleichgesetzt werden.
Aber was wäre, wenn diese Frau tatsächlich allem Anschein nach seit vierundvierzig Jahren glücklich verheiratet ist und trotz ihres vollgestopften Terminkalenders als renommierte Wissenschaftlerin vier Kinder großgezogen hat, die selbst wieder einen anspruchsvollen Beruf gewählt haben? Wenn es tatsächlich Beweise dafür gibt, daß sie ihre Freizeit größtenteils zu Hause oder auf Reisen mit ihrem Mann verbringt, daß ihre Kinder zufrieden mit ihrem Leben wirken, die Mutter häufig besuchen und regelmäßigen Kontakt zu den Eltern halten? Sollten wir uns nicht erweichen lassen und – wie widerstrebend auch immer – einräumen, daß die Absicht und Bedeutung der Passage eher dem entspricht, was die Sprecherin sagen wollte, als den alternativen Auslegungen, die ich den imaginären Kritikern zugeschrieben habe?
Lassen Sie mich aus einem anderen Interview zitieren, das ebenfalls den für diese Berichte typischen Optimismus illustriert. Diese Passage stammt von der Bildhauerin Nina Holton, verheiratet mit einem bekannten (und ebenfalls kreativen) Wissenschaftler:
Ich mag den Ausdruck: »Es läßt die Seele singen«, und ich benutze ihn recht häufig. Draußen vor unserem Haus auf dem Kap wächst dieses hohe Gras, und ich sehe es an und sage: »Das Gras singt. Ich kann es singen hören.« Da ist eine Art innerer Freude, die nach außen drängt, verstehen Sie? Es ist ein Ausdruck der Freude. Ich spüre sie. Ich freue mich einfach, daß ich lebendig bin, daß ich einen Mann habe, den ich liebe, ein Leben, das ich genieße, und eine Arbeit, die mich glücklich macht, und das läßt meine Seele singen. Und ich hoffe, daß jeder dieses Gefühl in sich kennt. Ich bin dankbar, daß meiner Seele so häufig nach Singen zumute ist.
Meine Arbeit ist sehr wichtig für mich und gibt mir große Befriedigung. Und ich kann mit meinem Mann über alles sprechen. Wenn wir uns abends zusammensetzen und darüber reden, was wir tagsüber getan haben, wenn er zum Beispiel erzählt, daß er eine neue Idee bei der Arbeit hatte, entdecken wir immer wieder Gemeinsamkeiten. Nicht immer, aber doch häufig. Das ist ein starkes Band zwischen uns. Er nimmt sehr viel Anteil an dem, was ich tue, und deshalb ist er in gewisser Weise in meine Welt eingebunden. Er fotografiert meine Arbeiten, und er ist ungeheuer interessiert an meiner Produktion. Ich kann alles mit ihm besprechen. Es ist nicht so, als würde ich im Verborgenen arbeiten. Ich kann immer zu ihm kommen und mir einen Rat holen. Ich nehme den Rat vielleicht nicht an, aber die Möglichkeit ist immer da. Es ist eine wirkliche Bereicherung meines Lebens.
Auch hier könnte eine zynische Deutung den Leser zu einer Schlußfolgerung führen wie: »Sicher wäre es ganz nett, wenn berufstätige Ehepartner glücklich und gleichzeitig kreativ sein könnten, aber es ist ja wohl allgemein bekannt, daß jeder, der etwas wirklich Neues und Bedeutendes erschaffen will, insbesondere in der Kunst, elend und unglücklich und der Welt überdrüssig sein muß. Folglich sind diese Personen höchstens für eine kleine Minderheit der kreativen Bevölkerung repräsentativ, oder man kann ihre Worte nicht für bare Münze nehmen, auch wenn alle äußeren Anzeichen dafür sprechen, daß die Schilderung zutreffend ist.«
Ich behaupte nicht, daß alle kreativen Personen gutsituiert und glücklich sind. In einigen Interviews gab es durchaus Hinweise auf familiäre Sorgen, berufliche Eifersüchtelein oder vereitelte Karrierewünsche. Zudem ist es wahrscheinlich, daß schon die Auswahl der Personen eine Tendenz zum Positiven enthielt. Die Konzentration auf Menschen über Sechzig schließt solche aus, die vielleicht risikoreicher gelebt haben und deshalb früh gestorben sind. Einige Personen, die wir um ihre Teilnahme baten, die jedoch nicht geantwortet oder abgelehnt haben, sind möglicherweise weniger glücklich oder weniger angepaßt als diejenigen, die einem Interview zustimmten. Zwei oder drei Personen, die zunächst zugesagt hatten, wurden nach der Festsetzung des Gesprächstermins so unsicher und verzagt, daß sie baten, die Verabredung wieder rückgängig zu machen. Die Personen, die schließlich an der Studie teilnahmen, sind also eher körperlich und seelisch besonders stabil.
Nach Jahren intensiver Gespräche und Studien bin ich allerdings auch zu dem Schluß gekommen, daß das verbreitete Klischee vom leidenden Genie größtenteils ein Märchen ist, das von der Romantik hervorgebracht und durch vereinzelte und – hoffentlich – atypische historische Perioden gefördert wurde. Mit anderen Worten, wenn Dostojewski und Tolstoi ein Übermaß an Leiden zeigten, lag es weniger an den Anforderungen ihrer kreativen Tätigkeit als an den persönlichen Leiden, die durch die unstabilen Bedingungen der maroden russischen Gesellschaft ausgelöst wurden. Wenn so viele amerikanische Dichter und Dramatiker Selbstmord begingen oder als Alkohol- und Drogensüchtige endeten, war die Ursache nicht die Kreativität, sondern eine Kunstszene, die viel versprach, wenig Belohnungen bereithielt und neun von zehn Künstlern vernachlässigte, wenn nicht gänzlich ignorierte.
Aufgrund dieser Überlegungen finde ich es realistischer, wenn auch schwieriger, mit offener Skepsis an diese Interviews heranzugehen und die für diese Probandengruppe typische Tendenz zum Positiven zu berücksichtigen ebenso wie die menschliche Neigung zur Verschleierung und Beschönigung der Realität. Gleichzeitig bin ich jedoch bereit, ein positives Szenario zu akzeptieren, wenn es gerechtfertigt scheint. Ich glaube, es lohnt sich, dieses Risiko einzugehen, denn ich teile die Ansicht des kanadischen Schriftstellers Robertson Davies:
Pessimismus ist ein sehr leichter Ausweg, wenn man bedenkt, was das Leben wirklich ist, weil der Pessimismus eine kurzsichtige Lebensanschauung ist. Wenn man beobachtet, was heute in der Welt geschieht und was bereits alles geschehen ist, seit man geboren wurde, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß das Leben aus einem ungeheuer komplexen Wirwarr von Problemen und Krankheiten der einen oder anderen Art besteht. Wenn man jedoch ein paar Millionen Jahre zurückblickt, erkennt man, daß wir seit dem Tag, als die erste abenteuerlustige Amöbe aus dem Schlamm kroch, phantastische Fortschritte gemacht haben. Wenn man in großen Zeiträumen denkt, ist mir unbegreiflich, wie man die Zukunft des Menschen oder die Zukunft der Welt pessimistisch beurteilen kann. Man kann eine kurzsichtige Position einnehmen und das Leben für ein einziges Chaos halten, für nichts als Lug und Betrug, und natürlich fühlt man sich dann miserabel. Ich finde es äußerst belustigend, daß einige meiner Kollegen, insbesondere aus dem Bereich der Literaturkritik, behaupten, die pessimistische, die tragische Auffassung sei der einzige wahre Schlüssel zum Leben – was ich für ausgemachten Unsinn halte. Es ist viel leichter, tragisch als komisch zu sein. Ich kenne Menschen, die sich an eine tragische Lebensanschauung klammern und sich dahinter verschanzen. Sie finden einfach alles entsetzlich und grauenvoll, und das ist furchtbar leicht. Wenn man sich um eine etwas ausgewogenere Sicht der Dinge bemüht, offenbart sich die ganze überraschende Vielfalt von komischen, mehrdeutigen und ironischen Aspekten des Lebens. Und diese umfassende Sichtweise halte ich für das Entscheidende bei einem Schriftsteller. Einen todtraurigen Roman zu schreiben ist relativ einfach.
Die Kritik von Davies gilt nicht nur für den literarischen Bereich, sondern weit darüber hinaus. Auch für die Kreativität könnte man mühelos Erklärungen finden, die ausschließlich bloßstellen, entlarven, herabsetzen, auseinanderpflücken und rationalisieren, was kreative Menschen tun, während man die echte Freude und Erfüllung, die sie im Leben finden, überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Aber ein solcher Ansatz macht uns blind für die wichtigste Botschaft, die kreative Menschen vermitteln: Wie man Sinn und Freude im Chaos der Existenz findet.
Ich habe dieses Buch jedoch nicht geschrieben, um eine vorgefaßte Meinung zu beweisen. Die Erkenntnisse, die ich hier vorführe, basieren auf Fakten. Es sind weder meine eigenen recycelten Vorurteile noch die irgendeiner anderen Person. Es sind die Stimmen jener außergewöhnlichen Menschen, die in diesem Buch zu Wort kommen und ihre Geschichte von der Entfaltung der Kreativität erzählen. Wovon diese Geschichte handelt, läßt sich nicht auf glatte Definitionen oder oberflächliche Techniken reduzieren. Aber in der lebendigen Komplexität dieser Geschichte offenbart sich das reiche Potential des menschlichen Geistes. Nachdem ich einige Themen eingeführt habe, die in den folgenden Kapiteln entwickelt werden, ist es nun an der Zeit, mit der Vorstellung zu beginnen.
Teil I
Der kreative Prozeß
2 Wo ist Kreativität?
Die Antwort ist schnell gegeben: Kreativität ist eine Form von geistiger Aktivität, ein Erkenntnisvorgang, der in den Köpfen einiger außergewöhnlicher Menschen stattfindet. Aber diese spontane Vermutung ist irreführend. Wenn wir unter Kreativität eine Idee oder eine Handlung verstehen, die neu und wertvoll ist, dann können wir die Beurteilung des einzelnen nicht als Maßstab für die Existenz der Kreativität akzeptieren. Man kann unmöglich wissen, ob ein Gedanke neu ist, es sei denn, man zieht gewisse Vergleichsmaßstäbe heran, und ob er wertvoll ist, hängt von der Einschätzung der Gemeinschaft ab. Insofern findet Kreativität nicht im Kopf des Individuums statt, sondern in der Interaktion zwischen dem individuellen Denken und einem soziokulturellen Kontext. Sie ist eher ein systemisches denn ein individuelles Phänomen. Ich möchte das anhand einiger Beispiele illustrieren.
Während meines Studiums jobbte ich einige Jahre lang als Lektor für ein Verlagshaus in Chicago. Mindestens einmal in der Woche brachte die Post ein Manuskript von einem unbekannten Autor, der behauptete, irgendeine bahnbrechende Entdeckung gemacht zu haben. So wurde vielleicht ein Achthundert-Seiten-Wälzer eingereicht, in dem anhand einer minutiösen Textanalyse der Odyssee dargelegt wurde, warum Odysseus entgegen der allgemeinen Auffassung keineswegs im Mittelmeerraum gesegelt sei. Eine genaue Analyse der Landmarken, der zurückgelegten Entfernungen und der von Homer beschriebenen Sternbilder ergab vielmehr ohne jeden Zweifel, jedenfalls nach den Berechnungen des Autors, daß Odysseus in Wirklichkeit vor der Küste Floridas gekreuzt war.
Ein anderer hoffnungsvoller Autor lieferte vielleicht eine Bauanleitung für fliegende Untertassen mit äußerst präzisen Blaupausen – die sich bei genauerer Betrachtung als kopierte Gebrauchsanleitungen für ein Haushaltsgerät entpuppten. Was das Lesen dieser Manuskripte so deprimierend machte, war die Tatsache, daß die Autoren tatsächlich überzeugt waren, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht zu haben, die nur deshalb nicht anerkannt wurde, weil sich solche Philister wie ich und die Lektoren aller anderen Verlagshäuser gegen sie verschworen hatten.
Vor einigen Jahren versetzte die Nachricht, daß es zwei Chemikern gelungen sei, eine Kaltschmelzung im Labor zu erreichen, die wissenschaftliche Welt in helle Aufregung. Falls sich diese Meldung bestätigen sollte, so bedeutete es, daß etwas Ähnliches wie das Perpetuum Mobile – einer der ältesten Träume der Menschheit – kurz vor seiner Verwirklichung stand. Nach einigen Monaten, in denen Laboratorien auf der ganzen Welt hektisch versuchten, die ersten Ergebnisse zu replizieren – einige mit scheinbarem Erfolg, die meisten ohne Erfolg –, wurde immer deutlicher, daß die Experimente, auf denen die Thesen basierten, fehlerhaft waren. Die gelehrte Welt wandte sich peinlich berührt von den beiden Forschern ab, die sie vorschnell als kreativste Entdecker des Jahrhunderts gefeiert hatte. Nach allem, was man hört, hielten die beiden Chemiker jedoch eisern daran fest, daß sie im Recht seien und eifersüchtige Kollegen ihren Ruf ruiniert hätten.
Jacob Rabinow, selbst Erfinder, aber auch Gutachter von Erfindungen beim National Bureau of Standards in Washington, kennt viele solcher Geschichten über Menschen, die überzeugt sind, das Perpetuum Mobile erfunden zu haben:
Ich kenne viele Erfinder, die etwas austüfteln, das nicht funktionieren kann, das theoretisch unmöglich ist. Aber sie verbringen drei Jahre mit der Entwicklung eines Motors, der nicht mit Elektrizität, sondern mit Magneten betrieben wird. Man erklärt ihnen, daß es nicht funktionieren kann. Es verstößt gegen das zweite Gesetz der Thermodynamik. Und sie entgegnen: »Ich pfeife auf Ihre blöden Regierungsgesetze!«
Wer hat recht – das Individuum, das an seine Kreativität glaubt, oder das gesellschaftliche Umfeld, das diese Kreativität leugnet? Wenn wir Partei für den einzelnen ergreifen, wird die Kreativität zu einem subjektiven Phänomen. In diesem Fall gehört zur Kreativität nicht mehr als die innere Gewißheit, daß mein Tun oder Denken neu und wertvoll ist. An dieser Definition von Kreativität ist nichts auszusetzen, solange man erkennt, daß dies nicht alles ist, was der Begriff ursprünglich umfaßte – nämlich etwas wahrhaft Neues zu erschaffen, das als so wertvoll gilt, daß es der Kultur hinzugefügt wird. Wenn man andererseits zu dem Schluß kommt, daß eine Bestätigung des Umfelds erforderlich ist, bevor etwas als kreativ bezeichnet werden kann, muß die Definition mehr umfassen als das Individuum. Wichtig ist, ob die innere Gewißheit durch die entsprechenden Experten – wie die Lektoren im Fall der exzentrischen Manuskripte – bestätigt wird. Es gibt keinen Mittelweg; man kann nicht sagen, daß in einigen Fällen die innere Überzeugung ausreicht, während in anderen Fällen die äußere Bestätigung notwendig ist. Ein derart lockerer Kompromiß läßt zu viele Schlupflöcher und macht es unmöglich, sich darauf zu verständigen, was kreativ ist und was nicht.
Das Problem ist, daß der Begriff »Kreativität«, wie er meist verwendet wird, zu weit gefaßt ist. Er bezieht sich auf sehr unterschiedliche Phänomene, was zu vielerlei Mißverständnissen führt. Um etwas mehr Klarheit in die Sache zu bringen, unterscheide ich mindestens drei unterschiedliche Phänomene, die man zu Recht mit dieser Bezeichnung belegen kann.
Im alltäglichen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff häufig auf Personen, die ungewöhnliche Ideen äußern, die interessant und anregend sind – kurzum auf Leute, die ungewöhnlich klug erscheinen. Ein brillanter Plauderer, ein Mensch mit vielfältigen Interessen und einem scharfen Verstand könnte in diesem Sinne als kreativ bezeichnet werden. Solange diese Personen nicht auch etwas von bleibendem Wert erschaffen, bezeichne ich sie als brillant und nicht als kreativ; sie kommen in diesem Buch nur am Rande vor.
Zum zweiten kann man den Begriff auf Personen anwenden, die die Welt auf ungewöhnliche und originelle Weise erleben. Diese Personen entwickeln neue Perspektiven, gelangen zu tiefen Einsichten und machen möglicherweise wichtige Entdeckungen, von denen nur sie selbst wissen. Ich bezeichne solche Menschen als persönlich kreativ und versuche, ihnen möglichst viel Aufmerksamkeit zu schenken (insbesondere in Kapitel 14, das sich mit dieser Thematik befaßt). Aber die subjektive Natur dieser Form von Kreativität macht es schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, gleichgültig wie bedeutsam die Erfahrung für den einzelnen sein mag.
Schließlich werden mit dem Begriff kreativ auch Einzelpersonen wie Leonardo, Edison, Picasso oder Einstein belegt, die unsere Kultur auf einem wichtigen Gebiet verändert haben. Diese Personen bezeichne ich ohne jede Einschränkung als kreativ. Weil ihre Errungenschaften per definitionem öffentlich sind, ist es leichter, über sie zu schreiben, und die Personen, die an meiner Studie teilgenommen haben, fallen in diese Kategorie.
Der Unterschied zwischen diesen drei Bedeutungen ist nicht nur eine Frage der Abstufung. Die letztgenannte Form der Kreativität ist nicht einfach eine Weiterentwicklung der ersten beiden. Es handelt sich tatsächlich um unterschiedliche Arten von Kreativität, die relativ unabhängig voneinander bestehen. So geschieht es zum Beispiel häufig, daß Personen, die vor brillanten Eigenschaften nur so sprühen und allseits als außerordentlich kreativ gelten, nichts von bleibendem Wert, keinerlei Spuren ihrer Existenz hinterlassen – außer vielleicht in der Erinnerung derer, die sie kannten. Andererseits haben einige Menschen, die unsere Geschichte am nachhaltigsten geprägt haben, überhaupt nichts Originelles oder Brillantes an sich gehabt und wirkten abgesehen von den Errungenschaften, die sie der Nachwelt hinterließen, nicht sonderlich beeindruckend.