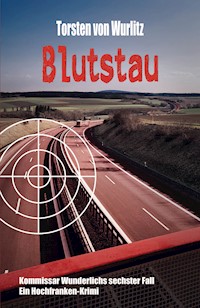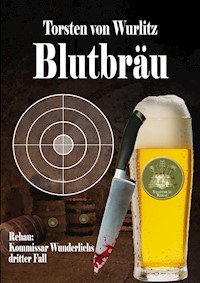Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Burg Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Kommissar Wunderlich das Verbrechen an der Schwesnitz entdeckt, ahnt noch niemand, dass die Spur direkt in den Rehauer Stadtrat und von dort weiter auf den höchsten Turm der Welt führen wird. Gemeinsam mit seinem Schulfreund und Hobbyermittler, dem Rehauer Bürgermeister Edmund Angermann, entwirrt er ein Geflecht aus Liebe und Sucht, Korruption und Naturschutz – eine Verschwörung, in der die Existenz von Rehaus größter Kostbarkeit auf dem Spiel steht und die die ganze Stadt dramatisch in Atem hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog. 3
Kapitel 1. 4
Kapitel 2. 6
Kapitel 3. 8
Kapitel 4. 10
Kapitel 5. 12
Kapitel 6. 14
Kapitel 7. 15
Kapitel 8. 18
Kapitel 9. 20
Kapitel 10. 22
Kapitel 11. 24
Kapitel 12. 26
Kapitel 13. 27
Kapitel 14. 30
Kapitel 15. 33
Kapitel 16. 36
Kapitel 17. 38
Kapitel 18. 41
Kapitel 19. 45
Kapitel 20. 47
Kapitel 21. 48
Kapitel 22. 51
Kapitel 23. 53
Kapitel 24. 56
Kapitel 25. 58
Kapitel 26. 60
Kapitel 27. 61
Kapitel 28. 64
Kapitel 29. 65
Kapitel 30. 66
Kapitel 31. 68
Kapitel 32. 71
Kapitel 33. 74
Kapitel 34. 77
Kapitel 35. 81
Kapitel 36. 83
Kapitel 37. 85
Kapitel 38. 88
Kapitel 39. 90
Kapitel 40. 93
Kapitel 41. 95
Kapitel 42. 98
Kapitel 43. 100
Kapitel 44. 103
Kapitel 45. 105
Kapitel 46. 109
Kapitel 47. 110
Kapitel 48. 113
Kapitel 49. 115
Kapitel 50. 119
Kapitel 51. 120
Kapitel 52. 124
Kapitel 53. 126
Kapitel 54. 127
Kapitel 55. 129
Kapitel 56. 131
Kapitel 57. 132
Kapitel 58. 134
Kapitel 59. 136
Kapitel 60. 140
Kapitel 61. 142
Kapitel 62. 145
Kapitel 63. 148
Kapitel 64. 150
Kapitel 65. 152
Kapitel 66. 154
Kapitel 67. 156
Kapitel 68. 158
Kapitel 69. 160
Kapitel 70. 161
Kapitel 71. 163
Kapitel 72. 164
Kapitel 73. 166
Kapitel 74. 168
Kapitel 75. 170
Kapitel 76. 172
Kapitel 77. 173
Kapitel 78. 175
Kapitel 79. 179
Danksagung. 182
Zum Autor. 183
Prolog
Sie war ein Kleinod, dessen Gegenwart nur noch wenigen Flecken in Europa geschenkt war: majestätisch trotz ihrer unscheinbaren Lebensweise. Begehrt von Perlenjägern, die man durch Geheimhaltung ihres genauen Lebensreviers abzuhalten suchte. Zu viel versprechend, weil sie tatsächlich so gut wie niemals Perlen enthielt. Ein anderes Versprechen eindrucksvoll erfüllend, nämlich dass der Schutz der Natur zu einer Artenvielfalt voller wunderschöner Besonderheiten führte. Unendlich gemächlich im Wachstum und, wenn man sie ließ, so alt wie eine Schildkröte.
Die Stadt Rehau in Oberfranken gehörte zu den Glücklichen. Der nordöstlichste Teil Bayerns zählte zu jenen, die die Flussperlmuschel besitzen durften, ein zerbrechliches und liebenswertes Schmuckstück – harmlos, unauffällig und doch so wertvoll.
„Erstaunlich, dass so ein Ding einen Menschen töten kann“, sinnierte er.
„Es war ja nicht die Muschel“, wandte Ulrike ein.
„Dann eben ihr Zwillingsbruder“, präzisierte Wunderlich seine Aussage.
„Wie auch immer – Hauptsache, wir leben alle noch und die ganze Stadt ist noch da“, ergänzte Angermann.
„Alle?“, fragte er. „Und die ganze Stadt?“
Die Erinnerung an das Verbrechen verblasste bereits. Dabei war es gerade erst vier Wochen her.
Kapitel 1
Es war verschwunden!
Wunderlich fielen fast die Augen aus seinem hochfränkischen Gesicht. Er hatte zwar gleich gewusst, dass hier irgendetwas absolut nicht stimmte. Nur war er beim besten Willen nicht darauf gekommen, was. Gerade noch war er ganz in Gedanken in der Trogenauer Dorfwirtschaft beim Kochkäs’ gewesen, der nach seiner Meinung zu den zehn besten Gerichten der Welt zählte, jedenfalls, wenn er hier im Dreiländereck Bayern-Sachsen-Böhmen gemacht wurde. Zur Verdauung war er nun ganz entspannt auf einem seiner Sonntagabend-Spaziergänge durch seine Heimatstadt. Er genoss das wie weniges sonst, jetzt, da er wieder zurück war. Nachdem er den Berg von der Straße herabgekommen war, die nach Hof führte, hatte er die Gleise überquert, einen Schwenk nach rechts und gleich darauf am Bahnhof wieder nach links Richtung Innenstadt getan. Dann war er stehen geblieben, hatte sich nach Westen gewandt und lange der untergehenden Sonne nachgesehen, die sich tiefrot an diesem wunderschönen, ruhigen und milden Septemberabend hinter den Gebäuden des voll im Saft stehenden Konzerns verabschiedete. Das Areal von PolyWorld war, ebenso wie die Licht&Faser AG am anderen Ortsende, ein Wahrzeichen dafür, dass die Stadt Rehau und ihre zehntausend Einwohner ziemlich gut davongekommen waren beim industriellen Wandel, mit dem sich die gesamte Region auseinandersetzen musste.
Wunderlichs persönliches Wahrzeichen dafür, dass in Rehau etwas los war, war freilich die Tatsache, dass die Kripo der Kreisstadt Hof vor einiger Zeit eine Außenstelle hierher verlagert hatte. Nicht, dass die „Industriestadt im Grünen“, wie sie sich zu Recht nennen durfte, unsicher gewesen oder gar von Kapitalverbrechen heimgesucht worden wäre. Auslöser war vielmehr das Projekt „Ihr Kommissar vor Ort“ der Staatsregierung, bei dem einzelne Beamte der Bürgernähe wegen bei einer Polizeidienststelle in kleineren Städten stationiert wurden. Diese neueste Idee der bayerischen Strukturpolitik freute ihn am meisten, denn Kriminalhauptkommissar Wunderlich konnte seither direkt von seiner Heimatstadt aus ermitteln.
Und tat dies prompt in diesem Augenblick – denn irgendetwas stimmte hier nicht. Beim besten Willen nicht. Sein auf Harmonie und Perfektionismus eingenordeter Instinkt war unerbittlich. Er hatte die Lücke förmlich gespürt. Nur wo?
Er wandte sich vom Sonnenuntergang zurück nach links und blickte weiter entlang der Gartenstraße, auf der er seine Runde durch die Stadt eigentlich fortsetzen wollte. Zu seiner Linken stand die Stadtbank, das größte und altehrwürdigste Institut am Ort, hinter ihm der Bahnhof, vor ihm die Luitpold-Brücke über die Schwesnitz, wo Perlenbach und Höllbach sich zu Rehaus Stadtflüsschen vereinten. Sein Blick folgte weiter geradeaus dem Lauf des Perlenbachs flussaufwärts in Richtung Süden und streifte links den Maxplatz und das Stadtzentrum ebenso wie das Denkmal des früheren bayerischen Ministerpräsidenten, der seit dem 17. November 1992 über das westliche Ende des Platzes wachte. Seine Blicke – die von Wunderlich, nicht die von Strauß – gingen über die Kreuzung, an der einst – da war er längst geboren, und er war nun gerade Anfang vierzig – unter großer öffentlicher Anteilnahme Rehaus erste Verkehrsampeln aufgestellt worden waren, und verloren sich dann noch fast bis hinauf zur „Fränkischen Krone“, dem besten Haus am Platz, jedoch ohne die Lücke im Suchbild zu entdecken. Dann steuerten sie zurück zur Brücke und hielten kurz vorher linker Hand am Wehr an, dessen Stauklappe einen pittoresken Wasserstand des Perlenbachs erst möglich machte. Auf der anderen Straßenseite genau gegenüber stand das sogenannte „Viehhändler-Denkmal“, die Bronzeplastik eines Mannes mit einem Schwein unter dem Arm und einem Rind an seiner Seite, alle zusammen auf einem fast eine Tonne schweren Granitblock. Es erinnerte an einen Berufsstand, der von Ende des achtzehnten Jahrhunderts an auf teilweise langen, beschwerlichen Handelswegen einen enormen Beitrag zur wirtschaftlichen Blüte der Stadt geleistet hatte.
Das heißt – es hätte dort stehen müssen.
Wunderlich rieb sich wie vom Donner gerührt die Augen. Einmal. Zweimal. Das konnte nicht sein. Das Denkmal gehörte genau zehn Meter links neben die Brücke. Es musste dort sein. Erst beim dritten Mal vergeblichen Hinsehens gestand er es sich endlich ein. Er sah es nicht. Das also war der Fehler im Bild.
„Iech glaab, iech bie aweng bsuffn“, führte er ein kurzes, aber lautes Selbstgespräch in seiner Muttersprache, nicht ohne sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe stand. Er fragte sich, ob ihm der Wirt vom Gasthof „Weißes Ross“, wo er nach dem Essen noch schnell mit dem Bürgermeister auf einen Schoppen Frankenwein zusammengesessen war, statt eines leichten Rieslings einen schweren Gewürztraminer mit 14 Prozent Alkohol eingeschenkt hatte. Versehentlich. Oder auch absichtlich. Sie versuchten ja immer, ihn wegen seiner Weinvorliebe zu foppen, nachdem seine Abneigung gegen Bier für einen Oberfranken, einen aus dem Land der kühlen Bierkeller also, gelinde gesagt ungewöhnlich war. Er fühlte sich aber vollkommen nüchtern, und so näherte er sich, noch immer an seinen Sinnen zweifelnd, der Stelle, an der nach allen Gesetzen der Logik und der Kenntnisse seines Geburtsortes das bewusste Steintrumm hätte stehen sollen. Aber es war nicht da.
Wunderlich war ein fantasievoller Mensch. Berufskrankheit. „Alberner Scherz, wahrscheinlich mit einem getürkten Transparent und einer versteckten Kamera“, ging es ihm durch den Kopf. Er streckte zielsicher die Arme aus. Aber seine Finger ertasteten nichts. Das Monument regionaler Agrarökonomie war wirklich nicht an seinem Platz.
Er fühlte sich ein wenig wie in dem Film, in dem jemand in ein Auto stieg, das eine Zeitmaschine war, und sich dann in der Eile verfuhr. Das Denkmal hatte ja nicht immer hier gestanden, sondern erst seit ziemlich genau zwanzig Jahren. Vielleicht hatte er einen Tag erwischt, der früher … Gerade als er überlegte, ob er noch einmal auf die gestrige Ausgabe des „Frankenblattes“, seiner geschätzten Tageszeitung, blicken und das Datum kontrollieren sollte, fiel ihm auf, dass allein durch das Fehlen des Denkmals sein Gefühl, irgendetwas sei anders als sonst, noch nicht vollständig erklärt war.
Die Schwesnitz hörte sich ziemlich merkwürdig an.
Das gleichmäßige Rauschen, das an dieser Stelle üblicherweise vom Grummeln des zwar gezähmten, aber doch vorhandenen Wehres hinter Wunderlich verstärkt wurde, hatte einer viel dumpferen Klangfärbung Platz gemacht. Als ob das liebliche Plätschern von Rehaus Hauptgewässer von etwas geschluckt würde. Vom Aufprall auf etwas Größeres. Etwas deutlich Größeres. Einen sehr großen – Stein?
Jetzt verstand Wunderlich endgültig. Augenblicklich riss er seinen Kopf herum in Richtung Wasser. Und da lag es. Im Fluss, direkt unter der Brücke, von der es gestürzt war.
Vielmehr: gestürzt worden war. Das stand fest. Obwohl es eintausend Kilogramm wog.
Aber das war noch nicht alles.
Wunderlich hatte in seinen ersten zwanzig Lebensjahren alle Facetten dieser ganz besonderen Stadt in sich aufgenommen: bürgerlichen Gemeinsinn und tiefen politischen Zwist, die Sackgassen des Eisernen Vorhangs und den Jahrhundertstau bei dessen Fall, die herrlichen milden Sommer und die als sibirisch diffamierten Winter. Rehau war eine Wundertüte im meist besten Sinn – aber niemals hätte er je für möglich gehalten, dass das in seiner Stadt passieren könnte, was er nun vor sich sah.
Ganz abgesehen davon, dass er nicht ahnen konnte, wie nahe die Stadt am Abgrund stand.
Kapitel 2
Einige Zeit zuvor.
Beierlein war genervt. Einmal mehr hatten sie vom „schnatterkalten Hof“ gesprochen. Es war ein milder, sonniger Märztag. Hier herrschte schönster Frühling, aber die Marsmenschen im fernen München hinderte das nicht, im landesweiten Radiosender die Kreisstadt Hochfrankens als „bayerisch Sibirien“ zu verspotten. Ungefähr seit König Ludwigs Zeiten ging das nun schon so. Er war fest davon überzeugt, dass keiner von denen jemals die A93 hochgekommen war. Vermutlich wussten sie noch nicht einmal, dass die Autobahn seit mehr als zehn Jahren fertig gebaut war.
„Ihr mit eurem Föhn-Brummschädel, ihr seid doch nur neidisch“, murmelte er, während er auf seinen Tiefgaragen-Parkplatz im Amtsgebäude rangierte.
Beierlein war einer der engagiertesten Mitarbeiter in der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Hof. Ein Bestandteil des Landratsamtes also, was ihm naturgemäß nicht gerade die Spannung eines Arbeitstages von James Bond einbrachte. Heute allerdings sollte alles anders werden.
Er war kaum aus dem Lift gestiegen, als er seinen Chef traf. Der machte wie so oft bei ihren Begegnungen eine etwas zwiespältige Miene, was Beierlein jedes Mal wunderte, da Hopperdietz an sich eine vorbildliche Mitarbeiterführung praktizierte. Was Beierlein über sich selbst nicht wusste: Er war ein überaus eifriger, wissbegieriger Mensch, der uneingeschränkt Freude verursacht hätte, wäre er nicht mit der betrüblichen Eigenschaft ausgestattet gewesen, sein Engagement in Form neugescheiten Daherredens in breitestem Mittelfränkisch kundzutun. Zu allem Überfluss tat er dies in der Überzeugung, dass nicht einmal die Detonation einer Atombombe in der Kölner Innenstadt wichtiger wäre als das, was er jeweils gerade zu sagen hatte. Das konnte anstrengend sein, auch für gelassene Chefs wie Hopperdietz, einen gutmütigen, eins neunzig großen Kerl wie ein Schrank, an dessen breiter Brust ansonsten alles abprallte. Aber der Ausdruck in Hopperdietz’ kantigem Gesicht sollte sich gleich drastisch aufhellen.
„Chef, ich hab’ heute Material dabei, da schmeißen Sie sich weg, hehehe!“
Beierlein war mit sich selbst eigentlich ein ernsthafter Mensch. Seine Kommunikation nach außen aber war bisweilen ein Desaster: An manchen Tagen pflegte er ungefähr jeden dritten Satz mit einem Grinsen oder, viel schlimmer, einem albernen Kichern zu beenden, das jedem Pennäler unangefochten den Titel „Klassenclown“ eingebracht hätte. Er wirkte einfach nicht erwachsen an solchen Tagen. Dummerweise wusste niemand, nach welcher Gesetzmäßigkeit sie auftraten, aber heute war wieder so ein Tag.
„Sie können sich doch sicher noch dunkel an unsere kleinen Schätzchen kurz vor der tschechischen Grenze erinnern.“
Beierlein hatte wieder einmal schneller gesprochen als gedacht. Sein Chef war für einen ernsthaften, stets konstruktiven Umgangston bekannt. Anzügliche Zwischentöne prallten an ihm ab, und Halbseidenes duldete er in seiner Behörde schon gar nicht. Die Mitarbeiter fanden das gut an Hopperdietz, es unterstrich die Seriosität ihrer Arbeit. Nur Beierlein musste sich manchmal etwas bremsen.
„Ich mein’ natürlich die Flussperlmuschel, hehehe“, schob er daher ungefragt nach, als er der Miene seines Chefs gewahr wurde. „Wir haben doch neulich die jährliche Zählung vornehmen lassen in den Gewässern von Rehau.“
„Sicher, ich erinnere mich gut. Ich habe das Projekt ja seinerzeit selbst in Auftrag gegeben.“
„Allmächt, das müssen Sie sich mal vorstellen: Binnen zwei Jahren haben die Dinger um fast fuffzich Prozent zugelegt! Überall in Perlenbach, Höllbach und Schwesnitz liegen sie plötzlich wieder! Keine Rede mehr davon, dass der Heinersgrund das letzte Refugium ist.“
Hopperdietz sah sich die Tabellen und Diagramme an. Sie zeigten überdeutlich, dass auf der gesamten Länge von der tschechischen Grenze, wo die Quellen von Höllbach und Perlenbach sich befanden, bis nach Wurlitz, dem westlichen Ende des Stadtgebiets, durch das die Schwesnitz floss, das unter Naturschutz stehende Kleinod innerhalb von vierundzwanzig Monaten förmlich ins Kraut geschossen war. Ein zufriedenes Lächeln überzog sein Gesicht. Er nahm einen genüsslichen Schluck aus der Kaffeetasse in seiner rechten Hand, während er sich gleichzeitig Notizen machte. Freudig erregt las er die Zahlen wieder und wieder.
„Sehr schön, Beierlein, sehr schön. Was habe ich Ihnen gesagt – unsere jahrelange Arbeit trägt Früchte. Bereiten Sie gleich eine Pressekonferenz vor. Rehau wird sich freuen.“
Beierlein tat wie ihm geheißen. Er war äußerst erleichtert. Er hatte weiß Gott genügend andere Sorgen. Das Geld anzunehmen, das der andere ihm geboten hatte, war mit seinem Gewissen absolut unvereinbar gewesen. Er wollte ein grundehrlicher Mensch sein. Und niemand wusste, wo seine Entscheidung, seine Schwäche, sein Überschreiten der Grenze zwischen Gut und Böse am Ende womöglich hinführen würde. Aber ihre Existenz stand vor dem Abgrund. Den Schulden würden sie nicht entkommen. Was hätte er tun sollen?
Kapitel 3
„ULI“. Das war alles, was sie bis jetzt von ihm gefunden hatten. Wunderlich stand auf der Schwesnitzbrücke und betrachtete nachdenklich den verblichenen Zettel. Er hatte Zeit genug dazu, denn ansonsten war von dem Toten nicht viel übrig: Wenn man von einem Granitblock erschlagen 24 Stunden lang in einem Fluss lag, war das nicht gerade so, als wäre man wie Lenin einbalsamiert und in einem Mausoleum aufbewahrt worden. Lenin? Wie kam Wunderlich jetzt auf Lenin? Nichts lag gerade ferner als die Albernheiten seiner revolutionären Jugendzeit hier in der Stadt, jetzt, da Edmund Angermann neben ihm auftauchte.
Schreckensbleich war eigentlich nicht die typische Gesichtsfarbe des Bürgermeisters der Stadt Rehau. Der Mann, mit dem Wunderlich schon zur Schule gegangen war und mit dem ihn von Kindesbeinen an eine Freundschaft verband, hatte üblicherweise gesunde rote Wangen. Er sorgte sich äußerst aktiv um die Belange seiner Zehntausend-Einwohner-Gemeinde, manchmal bis über die Haarspitzen hinaus motiviert. Nicht selten saß er ab fünf Uhr morgens im Rathaus. Trotz zweier kleiner Kinder war er ein fanatischer Frühaufsteher. Aber das hier war auch für einen, der täglich die Probleme des Bürgeralltages lösen musste, des Guten zu viel. Und die Blässe in Angermanns Gesicht wirkte noch etwas gespenstischer dadurch, dass im Umkreis von zweihundert Metern alles in ein pulsierendes Blaulicht getaucht wurde.
„Die Spurensicherung meint, man hat ihn wohl letzte Nacht zuerst betäubt, in den Fluss geworfen, dann mit einem Flaschenzug das Viehhändlerdenkmal aus der Verankerung gerissen und das schließlich präzise auf ihn abgeworfen. Es wird vermutet, dass es zwischen Mitternacht und drei Uhr früh passiert ist.“
„Wer ist er?“, murmelte Angermann, noch immer verschreckt und ziemlich geistesabwesend.
„Des wiss’ mer nohnich. Man hat den Granitstein grodoo auf sein Gesicht obifall’n lassen.“
Wunderlich hatte in München studiert und war erst vor zwei Jahren, kurz nach seinem 40. Geburtstag, zurück nach Hof zur Kripo gekommen. Er beherrschte sowohl Altbairisch als auch Hochfränkisch jeweils verhandlungssicher in Wort und Schrift. Aber manchmal verband er auch beides – und daran hätte man ihn wohl unter Tausenden erkannt.
„Wir haben jedenfalls nichts bei ihm gefunden. Nur dieser Zettel hier lag am Ufer.“
„U L I. Hm.“ In Angermann begann es zu rattern. Das ging bei ihm schnell, denn Wunderlichs bester Freund war nicht nur Bürgermeister, sondern auch Hobby-Kriminalist. Der gesunde Menschenverstand, den er im Hauptberuf gern benutzte, kam ihm bei seiner Freizeitbeschäftigung sehr entgegen. Jahrelang hatten sich die beiden stets über Wunderlichs Fälle ausgetauscht, als dieser in München ermittelte, während Angermann per E-Mail Kontakt hielt und sich über Wunderlichs ungelöste Fragen den Kopf zerbrach. Mehr als einmal hatte er so zur Aufklärung von Mord und Totschlag beigetragen. Je kniffliger die Tätersuche, desto besser. Insofern standen sie, wenn man so wollte, nun vor ihrem ersten gemeinsamen Fall.
„Nehmen wir an, der Tote kommt hier aus Rehau“, fing Angermann laut zu denken an, aber noch ehe Wunderlich etwas beitragen konnte, stutzte der Stadtchef und bemerkte etwas anderes.
„Das ist doch seltsam. Das U steht weit oben links und das LI im Grunde eine Zeile tiefer und weiter rechts.“
Wunderlich registrierte das erst jetzt, da Angermann ihn darauf hinwies. Sein Amateurkollege war wirklich hilfreich wie ein Profi, und das, obwohl er stark mit Frösteln beschäftigt war. Es war inzwischen 20 Uhr und damit allmählich dunkel und herbstlich frisch geworden. Wunderlich störte der Temperaturabfall nicht im Geringsten. Im Gegensatz zu Angermann hatte er die Tatsache, dass er hier aufgewachsen war, erfolgreich in sein Körperempfinden übertragen können: Er fror praktisch nie. So stand er noch immer im T-Shirt an der Schwesnitzbrücke und hätte ebenso gut ein Eis essen können. Anstatt sich mit der Kühle zu beschäftigen, dachte er über Angermanns unschätzbare Unterstützung nach. Er wünschte, er könnte dieselbe Leistung auch umgekehrt abliefern. Aber selbst wenn er damals vor seinem Weggang das Stadtratsmandat nicht ganz knapp verpasst hätte und den begehrten Spruch „Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern“ anlässlich seiner Vereidigung hätte vortragen können, so hätten sie doch seinerzeit unterschiedlichen politischen Lagern angehört.
„Stimmt“, holte er sich zu dem Mordfall und dem Zettel zurück. „Was mag das bedeuten?“ Sie kamen beide nicht darauf.
„Hast du mal auf die Rückseite geschaut?“ Angermann hatte den Gedanken zur selben Zeit wie der Kommissar. Sie drehten den Fetzen Papier um.
„7444.“
„Autokennzeichen?“ Angermann gab den ersten Tipp ab.
„Der Landkreis Hof hat nur dreistellige Nummern.“ Wunderlich reagierte schnell. Der zweite Tipp kam von ihm. „Telefonnummer?“
Angermann tippte die Nummer in die Telefonbuch-App seines Smartphones. Er wurde noch blasser.
„Ach du grüne Neune!“
„Was ist? Hast du einen Treffer?“
„Treffer und versenkt“, murmelte Angermann gedankenverloren.
„Jetzt sag schon!“
„Es ist die Nummer von Uli Wolk.“
Eine halbe Minute herrschte Schweigen zwischen den beiden.
„Wenn es nicht so übel wäre, würde ich jetzt sagen: Siehst du, deswegen bin ich der Kommissar und du nur der Bürgermeister“, kommentierte Wunderlich das Ergebnis trocken, bevor beide die Tatsache zu verarbeiten begannen, dass der Name von Rehaus Oppositionsführer, der im Stadtrat einen genauso guten Job machte wie der Bürgermeister, bei einem Mordopfer zu finden war.
Kapitel 4
Der Heinersgrund war eine von Birken gesäumte Flussaue unweit des Rehauer Ortsteils Heinersberg, durch die sich der Perlenbach ebenso schlängelte wie die beschauliche, eingleisige, aber immerhin stündlich befahrene Bahnlinie von der Kreisstadt Hof nach der Porzellanstadt Selb. Fast anderthalb Kilometer zog sich die unberührt wirkende Senke vom Ortsschild der Stadt unterhalb des funkelnagelneuen Baugebiets „Am Schild II“ vorbei nach Heinersberg. Ein durch und durch idyllischer Flecken, wenn man sich die Autobahn 93 von Regensburg nach Hof wegdachte, die seit Anfang des 21. Jahrhunderts keine 200 Meter vom Bach entfernt verlief und den Weiler mitten durchschnitt.
Der Flussperlmuschel war der Lärm der A93 egal. Sie war genau richtig hier im Dreiländereck Bayern-Sachsen-Böhmen, wo sie in kalk- und nährstoffarmen Fließgewässern, die von einem Mittelgebirge wie dem Fichtelgebirge zur Verfügung gestellt wurden, ihre bevorzugten Bedingungen vorfand. Es gab nur ein Problem dabei: Sie lebte gefährlich. Das 65 Millionen Jahre alte Tier war überall dort, wo man es auf der Nordhalbkugel zwischen Westrussland und Nordamerika noch finden konnte, vom Aussterben bedroht. Die Jungmuscheln waren darauf angewiesen, sich die ersten fünf Jahre versteckt im sauberen Kies des Flussbetts anzusiedeln, was nur in Gewässern wie dem Perlenbach gelang, die nicht verschmutzt oder durch Algenwachstum verschlammt waren. 64.999.920 Jahre lang ging es der Flussperlmuschel so blendend, dass sie Bäche dieser Art in mehreren Lagen übereinander zu bewohnen pflegte. Binnen der letzten achtzig Jahre hingegen hatte der Mensch dafür gesorgt, dass sich in Gewässern wie dem Perlenbach nur noch wenige hundert Exemplare verloren oder die Muscheln schon ganz verschwunden waren.
Beierlein sah dies seit heute anders. Es war der 2. April und er stand vor den Redakteuren von Frankenblatt, Thüringer Tag, Sächsischer Zeitung, Süddeutschen Nachrichten und Frankfurter Rundblick. Auch Hochfranken-TV war in die Hofer Behörde gekommen. Er und sein Chef gaben eine Presseerklärung ab.
„Die Maßnahmen der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Hof, um die Ansiedlung der Flussperlmuschel im Raum Rehau zu fördern, waren ein voller Erfolg“, begann Hopperdietz, „und wir sind unheimlich stolz und glücklich.“
„Was für Maßnahmen waren das?“, wurde der Reigen der Journalistenfragen eröffnet.
„Nun, wir haben ja schon seit 30 Jahren durch den Ausweis von Schutzgebieten und durch bauliche Maßnahmen für eine verringerte Zufuhr von Abwässern in die Flüsse gesorgt“, fuhr Beierlein mit dem fachlichen Teil fort. „Besonders wichtig für die Flussperlmuschel ist aber auch ein möglichst geringer Eintrag von Nährstoffen und Feinschlamm in den Bachlauf. Außerdem sollte das Gewässer möglichst kühl sein. An diesen Punkten haben wir nun massiv nachgelegt: Wir haben dem Perlenbach gezielt und in großem Umfang Wasser mit diesen Eigenschaften zugeführt.“
„Und wie haben Sie das gemacht – und über welchen Zeitraum ging das?“
„Das Projekt hat in etwa zwei Jahre in Anspruch genommen. Wir haben riesige Wassermengen aus dem Hofer Untreusee entsprechend aufbereitet und mit Tankfahrzeugen an die bayerisch-tschechische Grenze gebracht, wo es den einzelnen Zuflüssen des Perlenbachs zugefügt wurde. Auf dem gleichen Weg haben wir unsere Kollegen der Tschechischen Naturschutzbehörde auch unterstützt, den neuen Stausee gleich hinter Asch zu befüllen, der durch einen konstanten Abfluss in den Perlenbach dafür sorgt, dass der Strom an gutem Wasser nie abreißt.“
„Tankfahrzeuge? Tagein, tagaus in den Dörfern hier im Hinterland?!“
Beierlein war auf die Frage vorbereitet, einschließlich des leicht beleidigten Untertons, der wohl sagen sollte: „Was fällt Ihnen ein, dass wir das nicht mitbekommen haben?“ Er grinste nur überlegen aus seinem rundlichen Gesicht, das samt Knollennase und spärlichem Haupthaar formvollendet zu seinem etwas untersetzten Enddreißiger-Körper passte.
„Das war völlig geräuschlos. Für dieses Projekt waren die europaweit ersten zehn Tanklaster mit komplettem Elektro-Antrieb im Einsatz.“
Ein anerkennendes Raunen ging durch den Raum.
„Billig war das Ganze aber nicht, oder?“
„Die EU fördert im Rahmen ihres Flora-Fauna-Habitat-Konzepts solche Maßnahmen mit nicht unerheblichen Beträgen“, erläuterte Hopperdietz. „Naturschutz spielt in Europa eine immer größere Rolle, und das ist auch gut so.“
„Abgesehen davon haben wir mit einem namhaften Maschinenbauer aus Rehau zusammengearbeitet, der auch E-Fahrzeuge vertreibt“, ergänzte Beierlein. „Dadurch haben wir die LKWs schnell, unbürokratisch und ohne unnötige Zusatzkosten erhalten. Die Industriezweige in Rehau sind weit fortschrittlicher, als mancher glaubt.“
„Wie geht es jetzt weiter?“
„Das Projekt Wassereintrag ist vorerst abgeschlossen. Wir haben Daten aus den letzten 24 Monaten gesammelt und werden dies nun für längere Zeit fortführen. Die Flussperlmuschel ist ein gemächlicher Zeitgenosse – sie wächst sehr langsam. Wir konnten also zunächst nur die Zunahme an Jungmuscheln beobachten, die durch unser Projekt ihr fünftes Lebensjahr unbeschadet erreicht haben und wieder aus dem Kiesbett der Bäche zum Vorschein gekommen sind. Wir gehen davon aus, nun über Jahre weiter wachsende Bestände zu sehen.“
„Was ist Ihre Botschaft an die Bevölkerung?“
„Angesichts dieses Erfolges sehen wir einmal mehr, welch wunderbaren Reichtum die Natur uns schenken kann, wenn wir sie schützen. Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an diesem Prinzip aktiv zu beteiligen und in Haushalt, Beruf und Freizeit rücksichtsvoll mit allen Ressourcen umzugehen. Es lohnt sich, nicht nur für die Natur, sondern auch für Sie selbst. Die Welt wird schöner sein.“
Das war Beierleins große Schlussansprache, die von Hopperdietz mit einem fortdauernden Nicken begleitet und am Ende mit einem anerkennend hochgereckten Daumen gewürdigt wurde. Die Presseleute verabschiedeten sich und bedankten sich für die spektakulären und fachkundigen Informationen. Beierlein und Hopperdietz reichten sich die Hand: Sie hatten nach zwei Jahren gemeinsam etwas ganz Großes erreicht.
So schien es.
Kapitel 5
Am nächsten Morgen um neun begannen Wunderlichs Ermittlungen. Ulrich Wolk, Vorsitzender der „Bürger für Rehau“ und einer der fünf Stadträte seiner Fraktion, wohnte in Schönlind, einem Dorf knapp sieben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, in dem es durch den Ackerbau noch immer so viele Scheunen wie Einwohner gab, auch wenn die Rinder auf der Weide inzwischen einer Alpaka-Zucht Platz gemacht hatten.
Wunderlich fuhr vor und klingelte an Wolks Haustür. Er kannte Wolk schon seit zwanzig Jahren und war per Du mit ihm.
Heute allerdings war die Begegnung kurz, aber heftig.
Wolk öffnete nach dem zweiten Klingeln die Tür, noch schlaftrunken. Er war offenkundig übernächtigt, weshalb es zwei Sekunden dauerte, bis er Wunderlich erkannte, und weitere fünf, bis er sich bewusst wurde, dass die Polizei vor ihm stand. In diesen sieben Sekunden hatte Wunderlich Folgendes gesagt:
„Morgen, Uli, du, ich hätt amol a Frooch …“
Diese seine Frage konnte der Kommissar allerdings dann nicht mehr stellen. Wolk machte auf dem Absatz kehrt, im Wenden die Haustür vor Wunderlichs Nase zuschlagend, und rauschte quer durch sein Wohnzimmer direkt in die Doppelgarage. Obwohl er auf dem Weg über einen Garderobenständer stolperte, diesen umriss und im Fallen beim merkwürdigen Versuch, sich an einer sehr teuren Selber Porzellanvase festzuhalten, selbige in tausend Stücke zerlegte, war er schneller bei seinem Mofa, als Wunderlich außen um das Gebäude herumlaufen konnte.
Den Zündschlüssel hatte er nach seiner nächtlichen Rückkehr geistesgegenwärtig – oder vielleicht doch eher zufällig – in seiner Hosentasche gelassen, was ihm nun eine Menge Zeit ersparte. Er drehte ihn im Schloss um und raste los. Sein Ziel war das Nachbardorf Neuhausen. Dort würde er die Grenze nach Tschechien überqueren und auf der alten Allee nach Asch flüchten. In der Partnerstadt Rehaus war er sicher. Die tschechische Justiz war bekannt dafür, eine Straftat, wie er sie begangen hatte, bedeutend nachlässiger zu verfolgen als in Deutschland. Er würde eine Weile dort bleiben, bis ihm die Sache nicht mehr nachzuweisen war. Irgendwie würde er schon davonkommen.
Wolk hatte natürlich versucht, eine Abkürzung zu nehmen, die man mit einem zweispurigen Streifenwagen nicht hätte befahren können. Was er in seiner Übermüdung jedoch nicht begriffen hatte, war, dass Wunderlich wie fast immer mit seinem Rennrad vorgefahren war.
Der Kommissar war passionierter Radsportler und unternahm seine Ermittlungen, so oft es ging, mit seinem Sportgerät. Schönlind war da eine Kaffeefahrt. Er liebte es, in seiner Freizeit das Fichtelgebirge und den Frankenwald von links nach rechts und von oben nach unten zu durchqueren, bis zwischen dem Wurmloh-Pass bei Nagel und dem 1051 Meter hohen Gipfelpunkt der Schneebergstraße keine Höhe mehr übrig war, die er nicht unter seinen zwei Reifen gehabt hatte. Er war das, was man im Radsport gerne eine Bergziege nannte. Was bedeutete, dass man, wenn gerade einmal kein ernsthafter Berg auf der Strecke lag, gemeinhin ziemlich schnell unterwegs war.
Das Dorf Neuhausen lag direkt an der Grenzlinie. Schon wenn man die Straße von Rehau entlangkam, fuhr man vor dem Ortseingang für gut anderthalb Kilometer durch den Wald direkt an weiß-blauen Grenzpfählen entlang. Hätte man linksseitig der Straße geparkt und wäre ausgestiegen, um zum Beispiel ein dringendes Bedürfnis zu verrichten, man hätte augenblicklich Tschechien betreten. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs war das ein einigermaßen beklemmendes Gefühl gewesen. Fünf Jahre Haft in einem CSSR-Gefängnis wegen Urinierens? Man hatte seinerzeit als Bundesbürger die wildesten Fantasien, was auf einen zugekommen wäre. Nun ja, dies war seit fast 25 Jahren vorbei. Passierte man also den Ortseingang Neuhausens, so führte einen die Straße durch eine Rechtskurve zunächst einige Meter von der Grenze weg, um dann erneut einen Bogen nach links zu schlagen, etwa 250 Meter lang kerzengeradeaus direkt auf den Schlagbaum zuzulaufen und dort zu enden. Dahinter begann der Spazierweg nach Asch.
In dieser letzten Linkskurve vor der Grenze hatte Wunderlich den Flüchtigen auf dessen knatterndem Mofa eingeholt. Es war eine Sprintankunft, die jeden zwielichtigen südeuropäischen Sportmediziner in höchste Verzückung versetzt hätte. Das Alte Zollhaus, das ausgangs der Kurve auf der linken Seite stand und das einzige Gebäude auf dem Viertelkilometer war, wäre als Pressetribüne wohl mehrfach ausgebucht gewesen.
Wolk war völlig perplex. Panik machte sich in ihm breit. Er überlegte fieberhaft, wie er den Kommissar abschütteln konnte. In den letzten 48 Stunden war er so weit gegangen, dass es auf den Versuch, einen Polizisten zu Fall zu bringen, auch nicht mehr ankam. Reißnägel streuen oder das rückwärtige Maschinengewehr ausfahren waren zwei seiner durchdachten Optionen – unglücklicherweise verfügte sein Fahrzeug über keines dieser beiden Features.
Also entschied er sich für Gasgeben bis zum Äußersten. Jeder Tour-de-France-Reporter hätte an dem, was folgte, seine wahre Freude gehabt: Wolk hastete in der langen Geraden auf den Schlagbaum zu – Wunderlich flog aus der Linkskurve von hinten heran. Er ging in den Wiegetritt über und holte das Letzte aus sich heraus. Mit einem Tempo von 50 bis 60 und einem Puls von knapp 200 sprintete er an das Hinterrad des Mofas heran. Nur noch Meter bis zur Demarkationslinie! Wunderlich musste sofort aus dem Windschatten gehen. Wolk versuchte, ihn mit einem Ellenbogencheck abzudrängen – nur musste er dazu kurz vom Gas. Das war die Millisekunde, die dem Polizisten zum Sieg verhalf: In einem Fotofinish überquerte er als Erster die weiße Linie, schubste seinen Kontrahenten nach hinten weg und konnte noch während seiner eigenen Vollbremsung sehen, wie dieser sich mitsamt Mofa unsanft auf die Straße legte.
Einen Meter auf deutscher Seite.
„So, lieber Uli, du kommst jetzt erst mal mit“, keuchte Wunderlich, als sein Pulsschlag wieder im zweistelligen Bereich war.
Kapitel 6
Die Zahl war schon wieder größer geworden. Rechts neben dem Minuszeichen folgten fünf Ziffern, keine davon besonders niedrig. Vor drei Monaten waren es noch vier gewesen. In spätestens sechs Monaten würden es sechs sein.
„Dann ist es vorbei“, war der nächste Gedanke beim Blick auf den Kontoauszug der Stadtbank. „Dann kann ich mich ebenso gut umbringen.“
Der Blick ging zurück zu dem Tag, an dem alles angefangen hatte.
„O Gott, wie ich diesen Tag verfluche. Wäre ich doch nie hingegangen. Und vor allem: Warum nur bin ich dann geblieben? Es war doch klar, dass der Tscheche nicht mehr auftauchen würde.“
Eine Mischung aus Sarkasmus und Selbstmitleid machte sich als Nächstes breit.
„Alles Mögliche hätte mich treffen können. Es gibt so vieles, dem man verfallen könnte. Aber ausgerechnet dem? Ausgerechnet ich? Was für ein zynischer Volltreffer!“
Dann schlug der Gedanke einen 180-Grad-Haken und raste in die Zukunft.
„Es wird immer so weitergehen. Ich werde davon nie mehr loskommen. Egal, wie oft es schiefgeht – ich werde es wieder und wieder und immer wieder tun. Alles wird vernichtet werden – meine Familie, mein Beruf, meine Wohnung, mein Leben.“
Draußen blühten die Osterglocken, aber drinnen war die Stimmung verzweifelt. Es blieb nur eine Schlussfolgerung.
„Ich habe wohl nichts mehr zu verlieren.“
Kapitel 7
Der frühe Herbst war eine wunderbare Zeit in Hochfranken. Während sie am Alpenrand oft mit heftigen Wärmegewittern und Dauerregen zu kämpfen hatten, gab es hier oben in den Landkreisen Hof und Wunsiedel meist eine stabile Hochdruckwetterlage. Es war nicht zu kalt und nicht zu warm und oft den ganzen Tag einfach nur sonnig. Die ganze Region präsentierte sich wie das Leben selbst in seiner schönsten Form: ruhig, mild und friedlich. Die Luft roch unverbraucht und transportierte den Duft der umliegenden Felder über die sanft geschwungenen Hügel hinweg in die Stadt hinein. Es gab keine rush hour wie in den Ballungsgebieten, und selbst tagsüber besiegte das Zwitschern der Vögel das bisschen Verkehrsrauschen ohne jede Mühe. Dieser Landstrich konnte es problemlos mit der Toskana aufnehmen. Es war wie ein schöner Traum.
Schöne Träume der besonderen Art begleiteten heuer jedoch vor allem die Fußballer des 2. FC Rehau. Der Aufstieg in die Bayernliga im Frühsommer war eine Sensation gewesen. Der Club war ja erst zwei Jahre zuvor aus dem 1. FC Rehau hervorgegangen, welcher seinerseits kurz vorher aus der Fusion zweier Fußballabteilungen entstanden war, die sich Jahrzehnte – wenn nicht Jahrhunderte, wer wusste das schon so genau – in einem zyklischen Wechsel aus Zusammenhalt, gesundem Wettbewerb und alberner Hassliebe befunden hatten. Deswegen machte sich auch bald nach dem Zusammenschluss bei einigen schon wieder ein Murren und Knurren breit, und ein Grüppchen besonders Frustrierter beschloss dann die Abspaltung des 2. FC, der von den Anhängern des anderen Clubs mit „Spalter“ betitelt wurde und mit mäßigem sportlichem Erfolg startete.
Dann aber war Mackert aufgekreuzt. Georg Mackert, den sie hier alle nur „Gerch“ nannten, hatte Geld wie Dagobert Duck. Er war der geborene, zudem just in Rehau geborene Unternehmer und als solcher zu einer Zeit ins Windpark-Geschäft eingestiegen, als man in Oberfranken Windräder noch für diese netten Kinderspielzeuge aus dünnem Plastik hielt, die Erstklässler gerne als Dekoration auf ihre Zuckertüten bekamen oder als Fahrradschmuck umherfuhren. Inzwischen konnte er sich rühmen, dass weniger als hundert seiner Zehn-Megawatt-Masten ein ganzes Atomkraftwerk ersetzten. Das war für Oberfrankens Bevölkerung zwar wenig greifbar, da es hier weit und breit kein Atomkraftwerk gab. Aber es klang hervorragend und brachte ihm höchsten Respekt ein. Zumal er von sich selbst oft und gerne verkündete, er sei der zweitgrößte Steuerzahler in dieser Stadt“. Und zudem ein leuchtender Vertreter der Spezies „A Hund is er scho“. Von da an war es irgendwann nur noch ein kurzer Weg zu der Erkenntnis, dass der Besitz eines Fußballclubs doch recht schmückend wäre.
So wurde Gerch Mackert Chef des 2. FC Rehau. Und war gerade dabei, neue Spieler einzukaufen.
Er war an diesem Montagnachmittag auf dem Weg zum Flughafen „Hof – Günther Beckstein“, um seinen neuesten Einkauf abzuholen. Das war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert: zum einen deshalb, weil buchstäblich im letzten Moment der Rehauer Industriegigant PolyWorld beschlossen hatte, den angeblich vor der Schließung stehenden Flugplatz als Prestigeobjekt umzufunktionieren. Man war es wohl leid gewesen, dass bei der Verkehrs-Infrastruktur ständig „unprofitabel“ mit „nicht notwendig“ verwechselt wurde und hatte angekündigt, Hof-Plauen mit so viel Geld zu subventionieren, wie nötig war, um alle deutschen Großstädte mit Direktflügen anzubinden. „Glauben Sie mir, es wird genug sein – unbegrenzt“, hatte der CEO auf kritische Nachfragen der Wirtschaftspresse beruhigt. „Notfalls werden wir das Geld drucken.“ Das war ja ohnehin in Mode gekommen in Europa, und ein Großteil der Bevölkerung hatte es aufgegeben, daran Anstoß zu nehmen. Was auch daran lag, dass Wirtschaftsexperten mit dem Kalauer „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“ stets zum Ausdruck brachten, man könne sowieso nie vorher sagen, wie gut oder schlecht irgendeine Sache ausgehen würde.
Zum zweiten bemerkenswert war der Airport wegen der Namensgebung. Der frühere bayerische Ministerpräsident erfreute sich ja nach wie vor bester Gesundheit. Aber da er der erste Franke an der Landesspitze Bayerns seit fünfundvierzig Jahren gewesen war, wollte man endlich einmal dem Nationalstolz freien Lauf lassen. Dies war ja leider nicht oft möglich – selbst das Hissen des fränkischen Rechens auf den Rathäusern der Region, einmal, nur ein einziges Mal jährlich, am Tag der Franken, hatte schon mehrfach an den Rand einer Staatskrise geführt. Und seit der Erhebung der Bürger im unterfränkischen Grenzstädtchen Ermershausen gegen ihre Eingemeindung ins benachbarte und doch fremde Maroldsweisach 1978 wusste man, dass die Staatsmacht in München nicht sehr geduldig mit separatistischen Träumen jenseits des Mains umging. Nun also der Flughafen – allein schon aus Trotz.
Noch bemerkenswerter waren allerdings nach Mackerts Meinung die Ankunftsdaten seines Passagiers: Landebahn Nord, Terminal 1, Gate 4. Es war nicht öffentlich bekannt, aber man sollte vielleicht erwähnen, dass Gerch Mackert sich ebenfalls mit einem achtstelligen Betrag an der Auferstehung des Landeplatzes beteiligt hatte. Nur so, in Anerkenntnis seiner eigenen Unsterblichkeit. Und auch, weil er es satt hatte, dass immer derselbe Journalist einer überregionalen Tageszeitung offenbar riesigen Spaß daran hatte, die Region systematisch herunterzuschreiben, indem er den Hofer Flughafen so negativ darstellte, wie es mit blühender Fantasie gerade noch ging. Was Mackert – ebenso wie dem überwiegenden Rest der hiesigen Einwohnerschaft – eher ein „Geht’s noch?“ entlockte. Nicht zuletzt wegen der achttausend Privat- und Firmenmaschinen, die auf dem angeblich verwaisten Airport jährlich starteten und landeten.
Jetzt aber reute es ihn doch fast ein bisschen. „Terminal 1, Gate 4? Jetzt übertreiben sie“, dachte er bei sich, als er auf der Bundesstraße 15 in Richtung Hof fuhr.
Dann war es vorbei mit der Ruhe.
Ein heftiger Knall riss ihn aus seinen Gedanken. Doch noch ehe er darüber erschrecken konnte, brach sein Wagen aus. Er wusste nicht, wie ihm geschah – was seinem rechten Hinterreifen, der praktisch nicht mehr vorhanden war, ebenso ging. Mit 120 Sachen kamen sie einem hier auf der langen Geraden zwischen dem vierspurigen Ausgang aus Hof und der A93 entgegen. Und er raste auf diesen Gegenverkehr zu! Es ging um Sekundenbruchteile. Er bremste und riss das Steuer herum, so fest er konnte, aber das brachte den Wagen nur in eine noch instabilere Lage. Er musste weg von der Straße! Aber wie? Mehr instinktiv als bewusst – obwohl er die Strecke tausend Mal gefahren war – nahm er das rettende gelbe Schild wahr: die Ausfahrt nach Kautendorf! In den kleinen Rehauer Ortsteil, in dem wie in manch anderem die Landwirtschaft noch das Sagen hatte, schlitterte man direkt auf der Rampe, die hier nach oben führte. Sehr direkt sogar. Das Dorf begann gleichsam an der Anschlussstelle. Es war Mackerts Nothalt. Hochkonzentriert peilte er die Rampe an, jetzt hieß es einfach drauflosfahren, alles oder nichts. Wie ein Pfeil schoss die schwere Limousine die Ausfahrt nach oben, allmählich ihre tödliche Geschwindigkeit verlangsamend. Oben angekommen riss Mackert erneut das Steuer scharf nach rechts, um nicht kerzengerade über die kreuzende Kreisstraße in den Graben zu fliegen. Den letzten zwanzig Stundenkilometern galt es nun noch zu entkommen – und mit quietschenden Bremsen blieb Mackerts Geschoss endlich kurz hinter der Ausfahrt mitten in der Wiese stehen.
Keine fünf Meter vor der ersten Scheune linker Hand der Hauptstraße.
Gerch Mackert war Unternehmer. Mit seinen fünfzig Jahren hatte er auf den Golfplätzen und an den Konferenztischen dieser Welt bereits alles erlebt, was es an schwierigen Verhandlungen, schmutzigen Intrigen und geheimen Deals zu erleben gab. Zugleich mit Trinkfestigkeit und einem Wohlstandsbauch hatte sich bei ihm dadurch eine enorme Gelassenheit und Selbstsicherheit entwickelt. Kurz: Mackert war nicht der Typ, der sich allzu lange von Zwischenfällen wie einem geplatzten Reifen beeindrucken ließ. Keine fünfzehn Minuten später rollte sein Fahrer mit der Ersatz-Limousine an, der Abschleppdienst war vorgefahren und die Verkehrspolizei nahm auf Mackerts Wunsch – niemand schlug dem zweitgrößten Steuerzahler der Stadt einen solchen ab – den Hergang der Sache auf.
Das war aber noch gar nichts gegen die Person, die sodann, als Mackert mit seinem Chauffeur am Flughafen eingetroffen war, der Linienmaschine aus Mailand entstieg und nach kurzer Suche zielstrebig auf das Schild „Sig. Spirelli“ zuging.
„Raschid und ich haben offenbar nicht zu viel bezahlt“, konstatierte Gerch beeindruckt.
Vielleicht wäre er nicht ganz so cool geblieben, hätte er gewusst, dass heute bei Weitem der harmloseste Tag war, der ihm im Lauf der Woche blühen würde.
Kapitel 8
Frank war zutiefst besorgt. Nein, das traf es nicht. Er musste es sich eingestehen: Er war verängstigt. Es war eine richtige, gründliche Existenzangst. Und diese Angst hatte einen Namen.
„Hallo, Schatz!“
Er rief den Satz in die Weite des Hauses, wie immer, wenn er nach Hause kam, und versuchte dabei wie immer optimistisch zu wirken. Aber wie so häufig hatte er kein Glück: „Schatz“ war nicht zu Hause.
Susanne hatte sich in den letzten Monaten auf ebenso merkwürdige wie deutliche Weise verändert. Plötzlich legte sie Wert darauf, sich abends lange mit Freundinnen zu treffen, die er nicht kannte. Ihre Arbeitszeiten hatten sich weit in den Abend hinein ausgedehnt. Zugleich war sie fahrig geworden, unbeherrscht und – er zuckte innerlich zurück bei seinem Urteil – regelrecht nachlässig den Kindern gegenüber. Fast hätte er glauben können, es stecke ein anderer dahinter. Aber sie wirkte unglücklich und getrieben, und so war man im Allgemeinen wohl kaum drauf, wenn man eine Affäre hatte und demzufolge frisch verliebt war. So viel konnte sogar er sich ausmalen. Wie auch immer, ob sie nun die Nase voll hatte vom Familienleben, mit beruflichen Schwierigkeiten kämpfte oder ernsthaft erkrankt war: Es entwickelte sich zu einer Bedrohung für ihn und die Kinder, das spürte er.
Sein Ältester riss ihn aus seinen Gedanken. „Du, Papa, guck mal, eine geheime Botschaft!“
„Hä?“ Er sah seinen Filius verdutzt an. „Was hast du denn da?“
Es war irgendein Stück Plastik, das auf den ersten Blick aussah wie weggeworfener Verpackungsmüll.
„DENWAN – was bedeutet das, Papa?“
Frank verstand nur Bahnhof, obwohl selbiger gut 300 Meter entfernt war und noch die Stadtbank dazwischen lag. Sein Sohn überreichte ihm das Fundstück.
„DENWAN“ – er starrte auf das Gekritzel und wurde sogleich enorm wütend.
„Diese Saukerle! Genügt es ihnen nicht, ihren Müll überall hinzuwerfen? Müssen sie ihn auch noch beschriften?!“ Frank war außer sich. Erst vor wenigen Tagen waren in diesem Frühjahr endlich wieder einmal gute Nachrichten in Sachen Naturschutz verkündet worden. Die Rehauer Presse hatte über die Erholung der Flussperlmuschel berichtet, über die Erfolge des Hofer Landratsamtes. Und nun wurde die Freude schon wieder durch einen anderen Eingriff in die Natur getrübt.
Frank war durch und durch ein Naturbursche. Schon seit Langem war er stolzes Mitglied des Fichtelgebirgsvereins, einer honorigen Gruppierung von Naturfreunden, die sich über sämtliche Landkreise erstreckte, welche das besagte Mittelgebirge berührten: Hof, Wunsiedel, Bayreuth und selbst das in der Oberpfalz, also quasi dem Ausland, gelegene Tirschenreuth. Zu den zahlreichen Verdiensten des „FGV“ gehörte es, das Fichtelgebirge zur wohl bestbeschilderten Wanderregion Deutschlands gemacht zu haben. Über die Gipfel zog sich der Höhenweg, die Seen verband der Seenweg, am Ostrand zog sich der Ostweg, am Westrand der Westweg hinab, durch die Mitte der Mittelweg, und die vier Quellen, die das Gebirge berühmt machten, Main, Saale, Fichtelnaab und Eger – ihnen widmete sich der Quellenweg. Zu diesen „Bundesstraßen“ kamen natürlich Dutzende nachgeordneter Wege. Jeder von ihnen hatte sein eigenes unverwechselbares Logo, und es gab keine hundert Meter Wanderweg, keine Kreuzung und keinen Gipfel, wo es nicht an einem Baumstamm oder sogar an einem Holzwegweiser mit Kilometerangaben prangte. „Schneeberg 4,7 km auf H“ für Höhenweg – so lief das im Fichtelgebirge. Wer sich hier verirrte, der würde auch in St. Anton am Arlberg die nächste blaue Piste nicht finden oder in Paris den Eiffelturm. Kurz: Es war technisch nicht möglich.
Auch die Turmdienste auf dem Kornberg waren stets Sache des FGV gewesen und Frank war mit Begeisterung dabei. Er freute sich, wenn die Dinge im hiesigen Naturpark ihre Ordnung hatten. Und konnte zornig werden, wenn sie in Unordnung gerieten.
Er überlegte, welcher Volldepp sich in dieser Stadt hinter dem Künstlernamen Denwan verstecken könnte. Er meinte, das Kürzel schon einmal auf einem der Graffiti an der früheren Bahnhofskneipe mit dem geringfügig übertriebenen Namen „Gleis 13“ gesehen zu haben. Aber ganz sicher war er sich auch nicht.
„Wo hast du es denn her?“, fragte er seinen Nachwuchs.
„Hab ich am Fluss gefunden.“
Auch das half leider nicht weiter. Als könne er noch etwas mehr aus den wenigen Buchstaben erfahren, betrachtete er sie mit durchdringendem Blick. Irgendetwas war tatsächlich komisch daran, aber er bekam den Gedanken nicht richtig zu fassen. So starrte er nur grübelnd abwechselnd die Buchstaben an und ins Leere und murmelte:
„DE-N-WAN, wenn ich den kriege!“
Sein Wunsch sollte sich schon bald erfüllen. Aber die Begegnung würde eine dramatische Überraschung werden.
Zumal er sich auch in seiner Frau getäuscht hatte. Susannes Problem war nicht eines von den dreien, an die er gedacht hatte.
Es waren alle drei auf einmal.
Kapitel 9
„Was sollte das?“, fragte Wunderlich seinen Konkurrenten im Sprintfinale von Neuhausen, nachdem man diesen aus dem Streifenwagen ausgeladen, in die Polizeistation neben dem Rehauer Jahnstadion gebracht und ihm die Handschellen abgenommen hatte. Der Kommissar mochte diese Momente nicht. Erstens, weil er ein auf Harmonie bedachter Charakter war und ungern Leute verhörte, die er gut kannte und eigentlich für anständige Menschen hielt. Zweitens aber, und das wog noch viel schwerer, weil er dazu jedes Mal per Handy seine Kollegen mit dem Auto bestellen und damit einräumen musste, dass Polizeiarbeit nicht alleine mit einem Drahtesel zu bewältigen war.
Ulrich Wolk druckste zunächst nur herum.
„Du weißt doch, wie schwierig die politische Arbeit als Oppositionsführer ist“, begann er.
„Und?“
„Der Freitag war ein harter Tag im Stadtrat, und die drei Kollegen meiner Fraktion und ich hatten das dringende Bedürfnis, danach am Wochenende etwas auszuspannen.“
„Und das war so schlimm, dass du vor der Polizei flüchten musst?“
„Na ja, wenn man bis fünf Uhr in der Früh in ‚Hases Bierkeller’ durchmacht und der Alkotest zwei Komma null Promille anzeigt …“
Bayerische Kommunalpolitiker waren dazu übergegangen, die in Frankreich vorgeschriebenen Einmal-Alkoholtestgeräte für Autofahrer standardmäßig zu nutzen. In einem Land, wo man zum Allerhöchsten betete, er möge doch die Grundstoffe des Bieres erhalten, war das sicherer. Wunderlich liebte Bayern, aber diesen Aspekt der Gottesfürchtigkeit fand er absurd.
Hases Bierkeller war im Stadtteil Fichtig in der südlichen Rehauer Innenstadt.
„Du bist mit zwei Promille vom Fichtig bis nach Schönlind gefahren?!“
„Scho.“
„Ich verstehe immer noch nicht, warum du dann vor mir davongeprescht bist.“
„Na, du bist gut. Was ist mit dem Restalkohol? Du wolltest mich doch blasen lassen. Und dann wär’s vorbei gewesen. Blutentnahme, den Wert zurückgerechnet und dann ist der Lappen fort.“
„Deswegen bin ich nicht zu dir gekommen.“