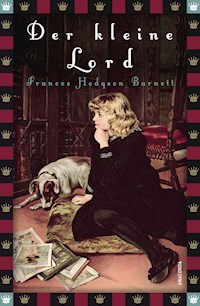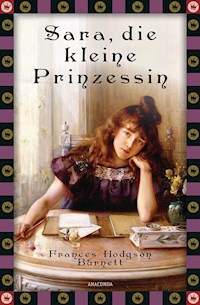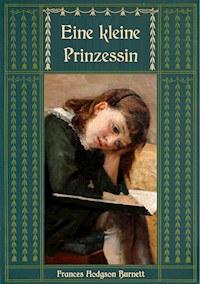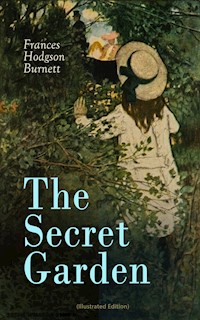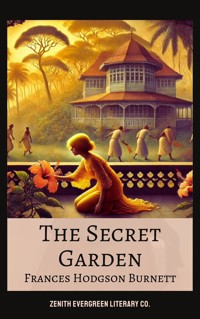Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Sprache: Deutsch
Der kleine Cedric lebt mit seiner Mutter in bescheidenen Verhältnissen in New York, als er erfährt, dass er der Erbe eines englischen Adelstitels ist. Während andere Verwandte seinen Anspruch anfechten, muss er allein in das prächtige Schloss seines Großvaters ziehen, während seine Mutter im Dorf wohnen soll. Mit seiner offenen Art und seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute in jedem Menschen gewinnt er schnell die Herzen der Bediensteten. Selbst der stolze Earl of Dorincourt kann sich der Wärme und dem Charme seines Enkels nicht lange verschließen. In einer von aristokratischen Traditionen geprägten Welt zeigt Frances Hodgson Burnetts "Der kleine Lord", wie ein Kind mit Mitgefühl und Würde die Menschen um sich herum verwandelt. Zwischen den altehrwürdigen Mauern des englischen Herrenhauses entfaltet sich eine berührende Geschichte über die Fähigkeit, über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg Herzen zu öffnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frances Hodgson Burnett
Der kleine Lord
Ungekürzte Roman-Ausgabe
Copyright © 2024 Novelaris Verlag
1. Auflage
ISBN: 978-3-68931-148-3
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel: Eine große Überraschung
Zweites Kapitel: Cedrics Freunde
Drittes Kapitel: Abschied von der Heimat
Viertes Kapitel: In England
Fünftes Kapitel: Im Schloss
Sechstes Kapitel: Der Graf und sein Erbe
Siebentes Kapitel: In der Kirche
Achtes Kapitel: Reiten lernen
Neuntes Kapitel: Schwere Sorgen
Zehntes Kapitel: Amerika in Ängsten
Elftes Kapitel: Die Nebenbuhler
Zwölftes Kapitel: Der Retter in der Not
Dreizehntes Kapitel: Unliebsame Überraschungen
Cover
Table of Contents
Text
Erstes Kapitel: Eine große Überraschung
Cedric selbst wusste kein Sterbenswörtchen davon, nie war etwas Derartiges in seiner Gegenwart auch nur erwähnt worden. Dass sein Papa ein Engländer gewesen war, wusste er, weil seine Mama ihm das gesagt hatte, aber dann war dieser Papa gestorben, als er noch ganz klein war, und ihm war von ihm nicht viel mehr in Erinnerung geblieben, als dass er eine hohe Gestalt und blaue Augen und einen langen, schönen Schnurrbart gehabt und dass es herrlich gewesen war, auf seinen Schultern in der Stube herumzureiten. Nach des Vaters Tod hatte Cedric dann die Entdeckung gemacht, dass es am allerbesten sei, mit der Mama gar nicht von ihm zu sprechen. Als der Papa erkrankte, war Cedric fortgebracht worden, und als er wieder nach Hause kam, war alles vorüber gewesen, und seine Mutter, die auch eine schwere Krankheit durchgemacht hatte, fing gerade erst wieder an, in ihrem Lehnstuhl am Fenster zu sitzen; allerdings war sie bleich und mager und all die lustigen Grübchen waren aus ihrem hübschen Gesicht verschwunden; die Augen sahen so groß aus und so traurig, und ihr Kleid war ganz schwarz.
„Sternchen“, sagte Cedric – so hatte sein Papa sie immer genannt, und der kleine Junge machte es ihm nach – „Sternchen, geht’s Papa besser?“
Er fühlte, wie ihr Arm zitterte, wandte plötzlich sein lockiges Köpfchen und sah ihr ins Gesicht, und als er sie so ansah, war’s ihm, als ob er selbst bald zu weinen anfangen müsse.
„Sternchen,“ fragte er noch einmal, „geht es Papa gut?“
Dann gab ihm sein kleines zärtliches Herz plötzlich ein, beide Arme um den Hals der Mutter zu schlingen und sie wieder und wieder zu küssen und seine weiche, warme Wange fest an die ihrige zu schmiegen, und sie drückte ihr Gesicht an seine Schulter und hielt ihn umschlungen, als ob sie ihn nie mehr von sich lassen wollte, und weinte bitterlich.
„Ja, es geht ihm gut,“ schluchzte sie; „ihm geht es gut, aber wir – wir haben nichts mehr auf der Welt als einander. Keine Menschenseele sonst.“
So klein er war, hatte er doch begriffen, dass sein großer, schöner, junger Papa nicht mehr wiederkommen werde, dass er tot sei, wie er es von anderen Leuten auch schon hatte sagen hören, obwohl er nicht recht wusste, was das für ein seltsames Ding war, das so viel Herzleid in seinem Gefolge hatte, und weil sein Mütterchen immer weinte, wenn er vom Papa sprach, kam er ganz in aller Stille auf den Gedanken, dass es besser sei, nicht von ihm zu sprechen, und allmählich fand er auch, dass es besser sei, sie nicht ganz ruhig dasitzen und zum Fenster hinaus oder ins Feuer starren zu lassen. Bekannte hatten er und seine Mama nicht viele, und man konnte ihr Leben sehr einsam nennen, obgleich Cedric davon keine Ahnung hatte, bis er älter wurde und man ihm dann sagte, weshalb sie keine Besuche erhielten. Er erfuhr dann, dass seine Mama eine Waise war und ganz allein in der Welt gestanden hatte, ehe sie Papas Frau geworden. Sie war sehr hübsch und hatte als Gesellschafterin bei einer reichen alten Frau gelebt, die nicht gütig gegen sie gewesen war. Eines Tages hatte Kapitän Cedric Errol, der Besuch bei der Dame machte, sie die Treppe hinauseilen sehen mit schweren dicken Tränentropfen an den langen Wimpern, und dabei hatte sie so unschuldig und traurig und wunderlieblich ausgesehen, dass der Kapitän es nicht mehr hatte vergessen können. Dann waren mancherlei merkwürdige Dinge geschehen, sie hatten einander kennen gelernt und hatten sich sehr lieb und wurden schließlich Mann und Frau, obwohl diese Heirat ihnen die Missbilligung verschiedener Personen zuzog. Am meisten erzürnt darüber war der Vater des Kapitäns, der in England lebte und ein sehr reicher und vornehmer Herr von leidenschaftlicher Gemütsart und einer heftigen Voreingenommenheit gegen Amerika und die Amerikaner war. Kapitän Cedric war der dritte Sohn und hatte also für sein Teil wenig Aussichten auf die äußerst bedeutenden Güter und Titel seines Hauses.
Die Natur verteilt ihre Güter jedoch nicht nach dem Erstgeburtsrecht, und es kommt vor, dass dritte Söhne Dinge besitzen, die den beiden älteren versagt sind. Cedric Errol hatte ein hübsches Gesicht, eine kräftige, schlanke, elastische Gestalt, ein helles Lachen und eine weiche, fröhliche Stimme; er war tapfer, freimütig und hatte das beste Herz von der Welt, und es war, als ob ihm ein Zauber verliehen sei, der alle Menschen zu ihm zog und an ihn fesselte. Bei seinen älteren Brüdern war dem nicht so; der eine wie der andere war weder hübsch noch begabt, noch gutherzig. Als Knaben in der Schule zu Eton machten sie sich sehr unbeliebt; auf der Universität betrieben sie keinerlei Studien, vergeudeten Zeit und Geld und gewannen wenige Freunde. Was der Vater an ihnen erlebte, waren Enttäuschungen und Demütigungen; der Erbe seines edlen Namens machte demselben keine Ehre und versprach, nichts zu werden, als ein selbstbezogener, verschwenderischer unbedeutender Mensch ohne jegliche ritterliche Tugend. Es war sehr bitter für den alten Herrn, dass der Sohn, welcher die unbedeutende Stellung des Jüngsten einnahm und nur ein sehr mäßiges Vermögen erhalten konnte, alles besaß, was an Talent, Liebenswürdigkeit, Kraft und äußerer Erscheinung in seiner Familie zu entdecken war.
Zuweilen hasste er den frischen jungen Gesellen beinahe, der sich unterfing, all’ die guten Dinge zu besitzen, die doch mit Fug und Recht zu dem großen Titel und dem herrlichen Besitztum gehört hätten, und doch hing sein stolzes, eigenwilliges altes Herz insgeheim unendlich an seinem Jüngsten. In einem derartigen Anfall von Gereiztheit war’s, dass er ihn auf eine Reise nach Amerika geschickt hatte; Cedric sollte ihm eine Zeit lang aus den Augen kommen, damit er nicht durch den immerwährenden Vergleich sich über das Treiben der beiden Ältesten, die ihm gerade damals wieder viel zu schaffen machten, noch mehr aufzuregen brauchte.
Aber kaum war der Sohn ein halbes Jahr fort, als der alte Herr Sehnsucht nach ihm empfand und ihm den Befehl zur Heimkehr sandte. Dieser Brief kreuzte sich mit einem des jungen Mannes, in dem dieser dem Vater von seiner Liebe zu der hübschen Amerikanerin und seiner Absicht, dieselbe zu heiraten, erzählte, was den Grafen in fürchterliche Wut versetzte. Wie entsetzlich seine Zornesausbrüche auch sein Leben lang gewesen waren, so schrankenlos hatte er noch nie getobt, wie nach dem Erhalt von Kapitän Cedrics Brief, und sein Kammerdiener, der eben im Zimmer war, machte sich auf einen Schlaganfall gefasst. Eine Stunde lang raste er wie ein wildes Tier, dann setzte er sich hin und schrieb an seinen Sohn. Er verbot ihm, je wieder den Fuß in die Nähe seiner alten Heimat zu setzen oder an Vater und Brüder ein Wort zu schreiben; er könne leben, wie es ihm behage, und sterben, wo es ihm gefällig sei, von seiner Familie sei er für alle Zeiten geschieden und Hilfe oder Unterstützung habe er von Seiten seines Vaters nie und nimmer zu rechnen.
Der Kapitän war tief betrübt über diesen Brief. Er hing an England und er liebte das schöne Heim, in dem er geboren war; er hatte sogar den übellaunischen, despotischen Vater lieb und hatte dessen Kümmernisse im Stillen immer mitempfunden, aber er war sich vollkommen klar, dass er von nun an nichts mehr von ihm zu erwarten hatte. Erst wusste er kaum, was anfangen, denn er war ja nicht zur Arbeit erzogen und hatte keine Ahnung von Geschäften, dafür aber Mut und Entschlossenheit; er gab seine Stellung in der englischen Armee auf, fand, nach mancher Mühsal, Beschäftigung in New York und heiratete. Der Unterschied zwischen seinem einstigen und jetzigen Leben war groß, allein er war jung und glücklich und hoffte, bei harter Arbeit eine Zukunft zu haben. Er bewohnte ein kleines Häuschen in einer ruhigen abgelegenen Straße, und dort kam sein Junge zur Welt und alles war einfach und bescheiden, aber fröhlich und freundlich, so dass er es nie einen Moment bereute, die hübsche Gesellschafterin der reichen alten Dame geheiratet zu haben, einzig, weil sie ein süßes Geschöpf war und ihn lieb hatte und er sie. Sie war aber auch wirklich und wahrhaftig ein süßes Geschöpf, und ihr kleiner Junge glich Mutter und Vater, und wenn er auch in einem armseligen, weltentlegenen Häuschen geboren war, schien es doch nie ein glücklicheres Kind auf der Welt gegeben zu haben. In erster Linie war er allezeit gesund und munter, machte also keinerlei Sorge und Mühe, dann hatte er so ein liebes, reines Gemüt und war so ein herziger kleiner Mensch, dass jedermann Freude an ihm haben musste, und zu dem allen war er so schön, dass man ihn immerfort anstaunen musste wie ein wunderbares Bild. Statt als ein kahlköpfiges Baby auf der Bildfläche zu erscheinen, hielt er seinen Einzug als Weltbürger mit einer Fülle weichen, seidigen, golden schimmernden Haares, das sich nach sechs Monaten in leichten Locken um sein Köpfchen krauste; er hatte große braune Augen, lange Wimpern und ein herziges kleines Gesicht, ferner so kräftige Glieder, dass er mit neun Monaten plötzlich auf seinen kerzengeraden strammen Beinchen zu wandeln anfing, und dabei war er ein so gesittetes Baby, dass es eine Lust war, seine Bekanntschaft zu machen. Er schien davon auszugehen, dass jeder Mensch sein Freund sei, und sprach jemand mit ihm, wenn er in seinem Kinderwagen auf der Straße war, so pflegte er den Unbekannten erst ganz ernsthaft aus seinen braunen Augen anzuschauen, worauf dann sofort ein sonniges Lächeln folgte. Daher kam es denn auch, dass in der ganzen Nachbarschaft keine Menschenseele war – nicht einmal der Spezereihändler an der Ecke, und der war anerkannt der gröbste Mensch unter Gottes Sonne – die nicht eine Freude daran gehabt hätte, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen, und mit jedem Monat, den er älter wurde, ward er hübscher und lebendiger.
Als er groß genug war, mit seiner Kinderfrau auszugehen in einem kurzen, weißen Röckchen, mit einem großen, weißen Hut auf dem lockigen Haar, erregte er allgemeines Aufsehen, und die Wärterin hatte der Mama die längsten Geschichten zu erzählen von Damen, die ihre Wagen hatten anhalten lassen und ausgestiegen waren, um mit ihm zu sprechen, und die ganz entzückt gewesen waren, als er in seiner harmlosen, unbefangenen Art mit ihnen geplaudert hatte, als ob er sie von jeher gekannt. Diese seltsam unbefangene Art und Weise, mit jedermann Freundschaft zu schließen, gab ihm einen ganz eigenartigen Reiz. Er war eine offene, rückhaltlos vertrauende Natur, und sein warmes kleines Herz wollte, dass es allen so wohl zu Mute sein solle, wie ihm selbst, das war’s, was ihn die Empfindungen derer, die um ihn waren, so merkwürdig schnell verstehen ließ. Vielleicht hatte sich dieser Zug auch mehr entwickelt, weil er immer mit Vater und Mutter lebte, die liebevoll, gütig und voll echter Herzensbildung waren; nie hörte er zu Hause ein unhöfliches oder raues Wort: von jeher wurde er mit Liebe und Zärtlichkeit behandelt und umgeben, und so strömte sein Kinderherz auch von Liebe und Wärme für andere über. Immer hatte er sein Mütterchen mit süßen Schmeichelnamen nennen hören, und deshalb sprach auch er nie anders mit ihr und von ihr; immer hatte er gesehen, dass sein Papa sie ängstlich behütete und für sie sorgte, und so lernte auch er ganz von selbst für sie sorgen. Und als er nun wusste, dass sein Papa nicht wiederkommen werde, und sah, wie traurig sie war, da entstand unbewusst in seinem kleinen Herzen das Gefühl, dass er nun alles tun müsse, um sie glücklich zu machen. Er war ja noch ein kleines Kind, aber dies Gefühl lebte in ihm, wenn er auf ihre Knie kletterte und sie küsste und sein lockiges Köpfchen an ihre Wange drückte, oder wenn er ihr sein Spielzeug und seine Bilderbücher zum Ansehen brachte oder sich schweigend und regungslos neben sie kauerte, wenn sie auf dem Sofa lag.
Er war noch nicht alt genug, um andere Trostmittel zu finden, aber er tat sein Bestes, und er selbst hatte keine Vorstellung davon, wie wohl sein stilles Tun dem armen, vereinsamten Herzen tat.
„O Mary!“ hörte er seine Mama einmal zu der alten Dienerin sagen, „ich bin überzeugt, er will mir auf seine Weise helfen und mich trösten. Zuweilen sieht er mich an mit großen, verwunderten Augen voll tiefster Liebe, als ob ich ihm im Innersten leidtäte, und dann kommt er und streichelt mich oder zeigt mir etwas. Er ist so merkwürdig reif; ich bin überzeugt, er denkt so weit.“
Als er heranwuchs, hatte er eine Menge wunderlicher Einfälle, die höchst ergötzlich waren, und wusste seine Mama so gut zu unterhalten, dass sie gar nicht nach anderer Gesellschaft verlangte; sie gingen miteinander spazieren und schwatzten und spielten zusammen. Er war noch ein ganz kleiner Bursche, als er lesen lernte, und hernach lag er abends auf dem Teppich vor dem Kamin und las vor – Kindergeschichten, zuweilen auch große Bücher, wie erwachsene Leute sie lesen, und hier und da sogar die Zeitung, und dabei hörte Mary in ihrer Küche Mrs. Errol manchmal hell auflachen über seine wunderlichen Bemerkungen: „Und, meiner Seel’,“ sagte Mary zu dem Spezereihändler, „so verstockt könnte keiner sein, dass er nicht lachen müsste über unsern Jungen, wenn er so altklug schwatzt. In der Nacht, wo der neue Präsident ernannt worden ist, kommt der Jung’ zu mir in die Küche’, stellt sich vors Feuer, die Händchen in den kleinen Taschen, wie ein Bild, sag’ ich Ihnen, und mit so einer feierlichen Mien’ wie ein Richter im Talar. Und dann sagt er zu mir: ›Mary,‹ sagt er, ›die Wahl ‘tressiert miss sehr,‹ sagt er. ›Iß bin ‘Publikaner und Sternchen auch. Bist du auch ‘Publikaner, Mary?‹ ›Tut mir leid,‹ sag’ ich, ›aber ich bin just ein wenig von der andern Partei.‹ Da sieht er mich an, dass es einem ganz durch Mark und Bein geht, und sagt: ›Mary,‹ sagt er, ›die rißten ja das Land zu Grund.‹ Und seither ist kein Tag vergangen, wo er mir nicht zugeredet hat, zur andern Partei zu gehen.“
Mary war sehr entzückt von „unserm Jungen“ und sehr stolz auf ihn; sie war schon im Hause gewesen, als er zur Welt kam, und seit seines Vaters Tode war sie Köchin, Hausmädchen und Kinderfrau in einer Person. Sie war stolz auf den kräftigen, beweglichen, kleinen Kerl und sein nettes Benehmen, ganz besonders aber auf sein schimmerndes Haar, das in die Stirn hereingeschnitten war und in leichten Pagenlocken auf seine Schulter fiel. Um seine kleinen Anzüge machen zu helfen, war ihr früh und spät keine Mühe zu viel.
„‘Ristokratisch, hm?“ pflegte sie zu sagen. „Du lieber Gott, den Jungen auf der Fifth Avenue möcht’ ich sehen, der so dreinschaut, seine Beine so setzt! Jeder Mensch, Mann und Weib und Kind, alles schaut ihm nach, wenn er den schwarzen Samtanzug anhat, den wir ihm aus meiner Frau ihrem alten Kleide zurecht gemacht haben, wenn er den Kopf so aufwirft und sein Lockenhaar fliegt! Akkurat wie ein junger Lord sieht er aus.“
Cedric hatte keine Ahnung davon, dass er wie ein junger Lord aussah, er wusste auch durchaus nicht, was ein Lord war. Der vornehmste unter seinen Freunden war der Spezereihändler an der Ecke – der grobe Mann, der gegen ihn nie grob war. Er nannte sich Mr. Hobbs und war in Cedrics Augen sehr reich und eine höchst bedeutende Persönlichkeit, die er über die Maßen bewunderte; er hatte ja so viele Dinge in seinem Laden – Pflaumen und Feigen und Apfelsinen und Biskuits – und er hatte ein Pferd und einen Wagen. Cedric mochte auch den Milchmann, den Bäcker und die Apfelfrau wohl leiden, aber Mr. Hobbs war doch obenan in seinem Herzen, und er stand auf so vertrautem Fuße mit ihm, dass er ihn jeden Tag besuchte und oft lange bei ihm saß, um die Tagesereignisse zu besprechen. Es war ganz merkwürdig, wieviel die beiden immer zu schwatzen hatten, über alles Mögliche. Der 4. Juli namentlich war ein Thema, über welches ihnen das Gespräch nie ausging. Mr. Hobbs hatte eine sehr geringe Meinung von den Engländern und er erzählte ihm die ganze Geschichte der Losreißung, wobei die Schändlichkeit des Feindes und die Tapferkeit der Aufständischen durch schlagende Beispiele beleuchtet wurden, schließlich trug er ihm noch einzelne Teile der Unabhängigkeitserklärung wörtlich vor. Cedric war dann so aufgeregt, dass seine Augen leuchteten, seine Wangen glühten und all seine Locken eine wirre Masse waren; zu Hause konnte er die Mahlzeit kaum erwarten, um seiner Mama alles Gehörte wiederzugeben, und so war es entschieden Mr. Hobbs, dem er sein erstes Interesse für Politik zu danken hatte. Mr. Hobbs war auch ein eifriger Zeitungsleser, und daher erfuhr Cedric so ziemlich alles, was in Washington vor sich ging, und wusste immer, ob der Präsident seine Schuldigkeit tat oder nicht. Und bei der letzten Präsidentenwahl waren beide sehr erregt gewesen und ohne Mr. Hobbs und Cedric wäre das Land womöglich aus den Fugen gegangen. Cedric wurde dann auch zu einem Fackelzug mitgenommen, und mancher Fackelträger erinnerte sich nachher noch des untersetzten Mannes an dem Laternenpfahl mit dem blonden Knaben auf der Schulter, der so energisch sein Mützchen geschwungen und sein Hurra gerufen hatte.
Nicht lange nach dieser Wahl war es – Cedric war nun zwischen sieben und acht Jahren alt – dass das seltsame Ereignis eintrat, welches sein Leben so ganz und gar umgestaltete. Merkwürdig war, dass er gerade an dem Tage mit seinem Freunde über England und die Königin gesprochen hatte, wobei Mr. Hobbs sich sehr hart über die Aristokratie geäußert und namentlich mit den britischen Grafen und Marquis streng ins Gericht gegangen war. Es war ein sehr heiterer Morgen, und Cedric war, nachdem er mit ein paar Kameraden Soldaten gespielt hatte, zu Mr. Hobbs gegangen, um sich auszuruhen, und hatte denselben in entrüsteter Betrachtung der „London Illustrated News“ gefunden, die eine Hofzeremonie wiedergab.
„Ha,“ sagte er, „auf die Art treiben sie’s nun, aber sie werden’s schon eingetränkt kriegen eines schönen Tages, wenn die sich aufrichten, die sie jetzt mit Füßen treten, und das ganze Gelichter übern Haufen werfen – Herzöge und Grafen und all den Plunder! Das bleibt nicht aus; sie sollen sich nur vorsehen.“
Cedric saß wie gewöhnlich rittlings auf dem Comptoirstuhl, den Hut aus der Stirn gerückt, die Händchen in den Taschen, ganz Ohr.
„Haben Sie viele Marquis gekannt, Mr. Hobbs?“ fragte er ernsthaft. „Oder viele Grafen?“
„Nein,“ erwiderte Mr. Hobbs mit Entrüstung, „ganz und gar nicht. Aber ich möchte wohl mal so einen hier in meiner Bude klein kriegen, dem wollte ich’s klar machen, dass ich keine Räuber und Tyrannen auf meinen Biskuitkasten sitzen und bei mir herumlungern lassen will.“
Dies Bewusstsein erhabenen Bürgerstolzes erfüllte ihn mit großer Befriedigung, und er wischte sich die Stirn mit einem siegreichen Herrscherblick auf seine Kisten.
„Vielleicht sind sie nur Grafen, weil sie es eben nicht besser wissen,“ bemerkte Cedric, in dessen kleinem Herzen ein gewisses Mitgefühl für die Unglücklichen aufstieg.
„Weil sie’s nicht besser wissen!“ sagte Mr. Hobbs. „Da bist du ganz auf dem Holzwege, sie bilden sich ja noch Wunder was darauf ein, die Kuckucksbrut!“
Mitten in dieser Unterhaltung erschien Mary. Cedric nahm erst an, sie werde irgendeinen kleinen Bedarf für den Haushalt holen, dem war aber nicht so; sie sah sehr aufgeregt aus und war so bleich, wie man es bei ihrem Teint kaum für möglich gehalten hätte.
„Komm heim, Liebling,“ sagte sie, „die Mama will’s haben.“
Cedric glitt von seinem erhabenen Sitze herunter.
„Soll ich mit der Mama ausgehen, Mary?“ fragte er. „Guten Tag, Mr. Hobbs. Ich komme ein andermal.“
„Was ist denn geschehen, Mary?“ forschte er unterwegs. „Ist’s die Hitze?“
„Nein, nein,“ sagte Mary, „Gott, was bei uns für Geschichten passieren!“
„Hat denn Sternchen Kopfweh von der Sonne?“ fragte der kleine Mann, nach und nach ängstlich werdend.
Das war’s aber auch nicht. Als sie das Haus erreicht hatten, stand ein Wagen davor und im Wohnzimmer war jemand bei Mama; Mary zog ihn eilends die Treppe hinauf, steckte ihn in sein bestes Gewand, den weißen Flanellanzug mit der roten Schärpe, und bürstete seine Haare glatt.
„Ein Lord!“ sprach sie dabei vor sich hin. „Lord war’s ja doch! Ach, und die Verwandtschaft. Hol sie der Kuckuck! Lord und Graf, jawohl, umso schlimmer!“
Das war wirklich alles sehr seltsam, allein er wusste ja ganz gewiss, dass seine Mama ihm alles erklären würde, und so ließ er Mary ungestört ihren Gedanken nachhängen. Als er umgekleidet war, lief er die Treppe hinunter und geradeswegs ins Wohnzimmer. Ein großer, magerer alter Herr mit einem scharfgeschnittenen Gesichte saß im Lehnstuhl, seine Mama stand daneben, sie war sehr blass, und er bemerkte auf den ersten Blick, dass sie Tränen in den Augen hatte.
„O Ceddie!“ rief sie, ihrem kleinen Jungen entgegeneilend und ihn scheu und erregt ans Herz drückend. „Ceddie, mein Herzenskind!“
Der große alte Herr stand auf und sah den Knaben scharf an, wobei er sein spitzes Kinn mit der fleischlosen Hand rieb. Der Eindruck schien ihn übrigens zu befriedigen.
„So so,“ sprach er langsam, „das ist also der kleine Lord Fauntleroy.“
Zweites Kapitel: Cedrics Freunde
In der Woche, die nun folgte, gab es wohl keinen erstaunteren und verblüffteren kleinen Jungen als Cedric; die ganze Woche war aber auch höchst seltsam und unwahrscheinlich. Erstens einmal war die Geschichte, die seine Mama ihm erzählte, eine ganz wunderliche, und er musste sie zwei- oder dreimal hören, bis er sie verstand, was aber Mr. Hobbs davon halten würde, darüber war er sich auch dann noch nicht klar. Die Geschichte fing mit Grafen an, sein Großvater, den er nie gesehen hatte, war ein solcher, und sein ältester Onkel wäre dann später ein Graf geworden, wenn er nicht durch einen Sturz vom Pferde getötet worden wäre, nach einem Tode hätte dann sein zweiter Onkel Graf werden sollen, der war aber in Rom ganz plötzlich am Fieber gestorben. Nun wäre es schließlich an seinem eignen Papa gewesen, den Titel zu bekommen, da aber alle tot waren und niemand übrig, kam es zu guter Letzt darauf hinaus, dass er nach seines Großvaters Tode der Graf und Erbe werden würde – und jetzt für den Augenblick war er Lord Fauntleroy.
Als er dies zuerst erfuhr, ward er ganz bleich.
„O Sternchen!“ sagte er, „ich möchte lieber kein Graf sein. Keiner von den andern Jungen ist ein Graf. Kann ich nicht keiner sein?“
Die Sache schien sich jedoch nicht umgehen zu lassen, und als er abends mit seinem Mütterchen am Fenster saß und in die armselige Straße hinausblickte, sprachen sie lange und eingehend darüber. Cedric saß auf seiner Fußbank, das eine Bein übergeschlagen, wie es seine Lieblingsstellung war, und sein kleines Gesicht war ein wenig verstört und ganz rot vor lauter Nachdenken. Sein Großvater wollte, dass er nach England kommen solle, und hatte deshalb den alten Herrn geschickt.
„Ich weiß, dass dein Papa sich darüber freuen würde,“ sagte seine Mama, die traurigen Augen dem Fenster zugewendet. „Sein Herz hing sehr an seiner Heimat, und dann sind dabei auch noch viele Dinge zu bedenken, die du noch nicht verstehen kannst, mein Kind. Ich würde eine sehr selbstsüchtige Mama sein, wenn ich dich nicht reisen ließe – das wirst du alles begreifen, wenn du erst erwachsen bist.“
Cedric schüttelte wehmütig das Köpfchen. „Es tut mir so leid, wenn ich von Mr. Hobbs fort muss,“ sagte er. „Ich habe Angst, er wird mich vermissen und er wird mir sehr fehlen – er und all die andern.“
Als Mr. Havisham, welcher der langjährige Sachwalter des Grafen Dorincourt war, und der die Mission hatte, Lord Fauntleroy nach England zu bringen, am nächsten Tage wiederkam, erfuhr Cedric sehr viel Neues, allein es war ihm gar nicht sehr tröstlich, zu erfahren, dass er dereinst ein sehr reicher Mann sein und hier ein Schloss und dort ein Schloss, große Parks, Bergwerke und Ländereien und viele Dienerschaft besitzen werde. Er war sehr bekümmert im Gedanken an seinen Freund, Mr. Hobbs, und bald nach dem Frühstück suchte er ihn voll Herzensangst in seinem Laden auf.
Er fand ihn die Zeitung lesend und trat ihm mit ernster Miene gegenüber: er wusste ja, dass das, was ihm widerfahren, für Mr. Hobbs ein herber Schlag sein musste, und er hatte sich’s unterwegs genau überlegt, wie er ihm die Sache beibringen wollte.
„Hallo!“ sagte Mr. Hobbs. „‘Morgen!“
„Guten Morgen,“ sagte Cedric. Er kletterte nicht wie sonst auf seinen hohen Stuhl, sondern setzte sich auf einen Biskuitkasten und schlug die Beine übereinander und schwieg so lange, bis Mr. Hobbs fragend über sein Zeitungsblatt hinüber nach ihm hinschielte.
„Hallo!“ sagte er noch einmal.
Cedric fasste sich ein Herz.
„Mr. Hobbs,“ begann er, „wissen Sie noch, von was wir gestern Vormittag gesprochen haben?“
„Hm, ja, von England dächt’ ich.“
„Freilich, aber gerade als Mary hereinkam, wissen Sie das noch?“
Mr. Hobbs rieb sich den Hinterkopf.
„Wir diskurrierten über die Königin und die ›‘Ristokraten‹.“
„Ja,“ sagte Cedric zögernd, „und, und über die Grafen; wissen Sie noch?“
„Jawohl,“ erwiderte Mr. Hobbs, „die kamen schlecht weg dabei, wie sich’s gehört!“
Cedric ward rot bis unter sein lockiges Stirnhaar, in solcher Verlegenheit hatte er sich im Leben noch nie befunden und dabei ängstigte ihn das Gefühl, dass die Sache auch für Mr. Hobbs nicht ohne Verlegenheit ablaufen werde.
„Ja, und Sie sagten,“ fuhr er fort, „dass Sie keinen von den ‘Ristokraten auf Ihren Biskuitkisten herumsitzen lassen würden.“
„Das will ich meinen!“ bestätigte Mr. Hobbs seinen Ausspruch mit Überzeugung. „Soll nur ‘mal einer kommen, dem werd’ ich’s zeigen.“
„Mr. Hobbs,“ sagte Cedric schüchtern, „es sitzt aber einer auf dieser Kiste!“
Um ein Haar wäre Mr. Hobbs vom Stuhle gefallen.
„Was?“ rief er.
„Ja,“ erklärte Cedric in gebührender Demut, „ich bin einer oder werde wenigstens später einer werden. Ich will Sie nicht hintergehen.“
Mr. Hobbs sah ganz alteriert aus; er erhob sich plötzlich und sah nach dem Thermometer.
„Muss wohl so was wie ein Sonnenstich sein,“ erklärte er, seinen kleinen Freund scharf ins Auge fassend. „Die Hitze ist auch danach! Hast du Schmerzen? Seit wann fühlst du den Zustand?“
Er legte seine breite Hand auf des Knaben Haupt, und dieser war mehr denn je in Verlegenheit.
„Danke, danke,“ sagte Cedric, „ich bin ganz wohl und in meinem Kopfe ist alles in Ordnung, Es tut mir ja so leid, aber alles, was ich Ihnen gesagt habe, ist wahr, Mr. Hobbs; deshalb hat mich ja Mary gestern geholt, und Mr. Havisham hat meiner Mama alles gesagt und er ist ein Advokat.“
Mr. Hobbs sank in seinen Sessel und trocknete sich die Stirn mit seinem Taschentuch.
„Einer von uns beiden hat den Sonnenstich!“ rief er.
„Nein,“ versetzte Cedric, „sicher nicht. Wir müssen uns eben drein finden, Mr. Hobbs. Mein Großpapa hat Mr. Havisham den ganzen Weg von England herübergeschickt, um uns das alles zu sagen.“
Mr. Hobbs starrte ganz bestürzt in das unschuldige, ernsthafte, kleine Gesicht vor ihm.
„Wer ist dein Großvater?“ fragte er endlich.
Cedric griff in seine Tasche und zog mit großer Sorgfalt einen kleinen Papierstreifen hervor, auf welchem in großen, unbeholfenen Buchstaben etwas geschrieben stand.
„Ich habe mir’s nicht recht merken können, deshalb hab’ ich’s aufgeschrieben,“ sagte er und las langsam: „John Artur Molyneux Errol Graf Dorincourt! So heißt er und er wohnt in einem Schloss – in ein paar Schlössern, glaub’ ich. Und mein Papa, der gestorben ist, war sein jüngster Sohn; und ich wäre kein Graf geworden und kein Lord, wenn mein Papa nicht gestorben wäre, und mein Papa wäre auch kein Graf geworden, wenn seine beiden Brüder nicht gestorben wären. Aber die sind alle tot, und ist gar keiner da außer mir – kein Junge – deshalb muss ich der Graf werden, und mein Großpapa hat jemand geschickt, der mich nach England abholen soll.“