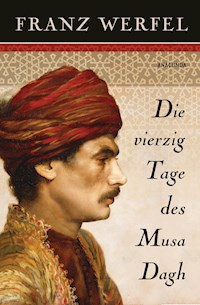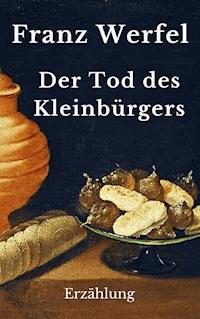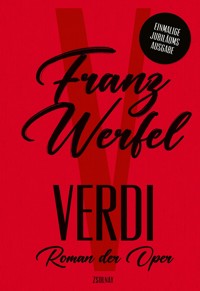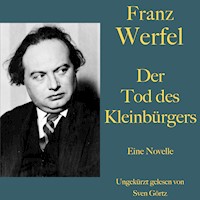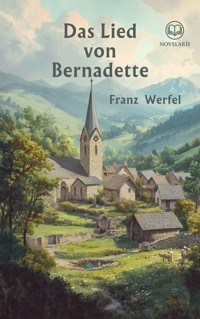
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bernadette Soubirous, ein einfaches Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen, wird in Franz Werfels „Das Lied von Bernadette“ zum Mittelpunkt eines der außergewöhnlichsten Phänomene der Geschichte. Als sie von einer geheimnisvollen Erscheinung berichtet, die sie als "die Dame" bezeichnet, gerät sie ins Kreuzfeuer von Skeptikern, Gläubigen und staatlicher Obrigkeit. Doch trotz aller Widerstände bleibt Bernadette standhaft und wird zum Symbol für Glauben und Hoffnung. Der Roman beleuchtet den Konflikt zwischen spiritueller Wahrheit und gesellschaftlichem Druck. Während Bernadette mit ihren Visionen das Leben vieler Menschen verändert, werden die zentralen Fragen unserer Existenz gestellt: Was bedeutet Glaube in einer skeptischen Welt? Was ist das Wesen von Wundern? Und wie gehen wir mit dem Unbegreiflichen um? Das Wunder von Lourdes, das Bernadette erlebte, bleibt bis heute eine Inspiration für Millionen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 789
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Werfel
Das Lied von Bernadette
Copyright © 2024 Novelaris Verlag
ISBN: 978-3-68931-105-6
Inhaltsverzeichnis
ERSTE REIHE: Wiedererweckung des 11. Februar 1858
Ein persönliches Vorwort
Kapitel Eins. Im Cachot
Kapitel Zwei. Massabielle, ein verrufener Ort
Kapitel Drei. Bernadette weiß nichts von der Heiligen Dreifaltigkeit
Kapitel Vier. Café Progrès
Kapitel Fünf. Kein Reisig mehr
Kapitel Sechs. Das Wut- und Wehgeheul des Gave
Kapitel Sieben. Die Dame
Kapitel Acht. Die Fremdheit der Welt
Kapitel Neun. Frau Soubirous gerät außer sich
Kapitel Zehn. Bernadette darf nicht träumen
ZWEITE REIHE: Wollen Sie mir die Güte erweisen
Kapitel Elf. Ein Stein saust nieder
Kapitel Zwölf. Die ersten Worte
Kapitel Dreizehn. Boten der Wissenschaft
Kapitel Vierzehn. Eine geheime Beratung, die unterbrochen wird
Kapitel Fünfzehn. Die Kriegserklärung
Kapitel Sechzehn. Die Dame und die Gendarmerie
Kapitel Siebzehn. J. B. Estrade kommt von der Grotte
Kapitel Achtzehn. Dechant Peyramale fordert ein Rosenwunder
Kapitel Neunzehn. Anstatt des Wunders ein Ärgernis
Kapitel Zwanzig. Wetterleuchten
DRITTE REIHE: Die Quelle
Kapitel Einundzwanzig. Der Tag nach dem Ärgernis
Kapitel Zweiundzwanzig. Der Tausch der Rosenkränze oder: Sie liebt mich
Kapitel Dreiundzwanzig. Ein Louisdor und eine Ohrfeige
Kapitel Vierundzwanzig. Das Kind Bouhouhorts
Kapitel Fünfundzwanzig. Du spielst mit dem Feuer, o Bernadette
Kapitel Sechsundzwanzig. Nachbeben oder Äffen des Mirakels
Kapitel Siebenundzwanzig. Das Feuer spielt mit dir, o Bernadette
Kapitel Achtundzwanzig. A. Lacadé wagt einen Staatsstreich
Kapitel Neunundzwanzig. Ein Bischof ermißt die Folgen
Kapitel Dreißig. Der Abschied aller Abschiede
VIERTE REIHE: Die Schatten der Gnade
Kapitel Einunddreißig. Sœur Marie Thérèse verläßt die Stadt
Kapitel Zweiunddreißig. Der Psychiater greift in den Kampf ein
Kapitel Dreiunddreißig. Digitus Dei oder der Bischof gibt der Dame eine Chance
Kapitel Vierunddreißig. Eine Analyse und zwei Majestätsbeleidigungen
Kapitel Fünfunddreißig. Die Dame besiegt den Kaiser
Kapitel Sechsunddreißig. Bernadette unter den Weisen
Kapitel Siebenunddreißig. Eine letzte Versuchung
Kapitel Achtunddreißig. Die weiße Rose
Kapitel Neununddreißig. Die Novizenmeisterin
Kapitel Vierzig. Das ist meine Stunde noch nicht
FÜNFTE REIHE: Das Verdienst des Leidens
Kapitel Einundvierzig. Feenhände
Kapitel Zweiundvierzig. Viel Besuch auf einmal
Kapitel Dreiundvierzig. Das Zeichen
Kapitel Vierundvierzig. Nicht für mich fließt diese Quelle
Kapitel Fünfundvierzig. Der Teufel bedrängt Bernadette
Kapitel Sechsundvierzig. Die Hölle des Fleisches
Kapitel Siebenundvierzig. Der Blitz von Lourdes
Kapitel Achtundvierzig. Ich habe nicht geliebt
Kapitel Neunundvierzig. Ich liebe
Kapitel Fünfzig. Das fünfzigste Ave
Cover
Table of Contents
List of illustrations
Text
ERSTE REIHE: Wiedererweckung des 11. Februar 1858
Ein persönliches Vorwort
In den letzten Junitagen des Jahres 1940, nach dem Zusammenbruch Frankreichs, kamen wir auf der Flucht von unserem damaligen Wohnort im Süden des Landes nach Lourdes. Wir, meine Frau und ich, hatten gehofft, noch rechtzeitig über die spanische Grenze nach Portugal entweichen zu können. Da jedoch sämtliche Konsuln einmütig die notwendigen Visa verweigerten, blieb uns nichts anderes übrig, als in derselben Nacht, da die Grenzstadt Hendaye von den deutschen Truppen besetzt wurde, unter großen Schwierigkeiten ins Innere Frankreichs zu flüchten. Die Départements der Pyrenäen waren zu einem phantastischen Heerlager des Chaos geworden. Die Millionen dieser seltsamen Völkerwanderung irrten auf den Landstraßen umher und verstopften die Städte und Dörfer: Franzosen, Belgier, Holländer, Polen, Tschechen, Österreicher, exilierte Deutsche und dazwischen die Soldaten der geschlagenen Armeen. Nur höchst notdürftig konnte man seinen Hunger stillen. Obdach aber gab es überhaupt keines mehr. Wer irgendeinen gepolsterten Stuhl eroberte, um die Nacht darauf zu verbringen, wurde viel beneidet. In endlosen Reihen standen die mit Hausrat, Matratzen, Betten hochbeladenen Autos der Flüchtlinge unbeweglich, denn Treibstoff war nicht mehr vorhanden. In Pau hörten wir von einer dort ansässigen Familie, Lourdes sei der einzige Ort, wo ein vom Glück Begünstigter vielleicht noch Unterkunft finden könne. Da die berühmte Stadt nur dreißig Kilometer entfernt lag, so riet man uns, den Versuch zu wagen und an ihre Pforten zu pochen. Wir gehorchten diesem Rat und fanden endlich Herberge.
Auf diese Weise führte mich die Vorsehung nach Lourdes, von dessen Wundergeschichte ich bis dahin nur die oberflächlichste Kenntnis besaß. Wir verbargen uns mehrere Wochen in der Pyrenäenstadt.
Es war eine angstvolle Zeit. Es war aber zugleich auch eine hochbedeutsame Zeit für mich, denn ich lernte kennen die wundersame Geschichte des Mädchens Bernadette Soubirous und die wundersamen Tatsachen der Heilungen von Lourdes. Eines Tages in meiner großen Bedrängnis legte ich ein Gelübde ab. Werde ich herausgeführt aus dieser verzweifelten Lage und darf die rettende Küste Amerikas erreichen – so gelobte ich –, dann will ich als erstes vor jeder anderen Arbeit das Lied von Bernadette singen, so gut ich es kann.
Dieses Buch ist ein erfülltes Gelübde. Ein epischer Gesang kann in unserer Epoche nur die Form eines Romans annehmen. »Das Lied von Bernadette« ist ein Roman, aber keine Fiktion. Der misstrauische Leser wird angesichts der hier dargestellten Ereignisse mit größerem Recht als sonst bei geschichtlichen Epen die Frage stellen: »Was ist wahr? Was ist erfunden?« Ich gebe zur Antwort: All jene denkwürdigen Begebenheiten, die den Inhalt dieses Buches bilden, haben sich in Wirklichkeit ereignet. Da ihr Anbeginn nicht mehr als achtzig Jahre zurückliegt, spielen sie im hellsten Licht der Geschichte, und ihre Wahrheit ist von Freund und Feind und von kühlen Beobachtern in getreuen Zeugnissen erhärtet. Meine Erzählung verändert nichts an dieser Wahrheit.
Nur dort wurde das Recht der dichterischen Freiheit in Anspruch genommen, wo das Kunstwerk gewisse chronologische Zusammendrängungen erforderte, und wo es galt, den Lebensfunken aus dem Stoff zu schlagen.
Ich habe es gewagt, das Lied von Bernadette zu singen, obwohl ich kein Katholik bin, sondern Jude. Den Mut zu diesem Unternehmen gab mir ein weit älteres und viel unbewussteres Gelübde. Schon in den Tagen, da ich meine ersten Verse schrieb, hatte ich mir zugeschworen, immer und überall durch meine Schriften zu verherrlichen das göttliche Geheimnis und die menschliche Heiligkeit – des Zeitalters ungeachtet, das sich mit Spott, Ingrimm und Gleichgültigkeit abkehrt von diesen letzten Werten unseres Lebens.
Los Angeles, im Mai 1941
Franz Werfel
Kapitel Eins. Im Cachot
François Soubirous erhebt sich in der Finsternis. Es ist Punkt sechs. Seine silberne Uhr, Hochzeitsgeschenk der klugen Schwägerin Bernarde Casterot, besitzt er längst nicht mehr. Die Quittung der städtischen Pfandleihanstalt über sie und über einige andere magere Schätze ist bereits seit voriger Herber verfallen. Soubirous weiß, es ist Punkt sechs, obwohl die Glocken der Pfarrkirche von Saint Pierre noch nicht zur Frühmesse geläutet haben. Arme Leute haben die Zeit im Gefühl. Sie wissen auch ohne Zifferblatt und Glockenton, was die Uhr geschlagen hat. Arme Leute haben immer Angst, zu spät zu kommen.
Der Mann tastet nach seinen Holzpantinen, behält sie aber in der Hand, um keinen Lärm zu machen. Bloßfüßig steht er auf dem eiskalten Steinboden und lauscht den vielfältigen Atemzügen seiner schlafenden Familie, einer sonderbaren Musik, die ihm das Herz bedrängt. Sechs Menschen teilen den Raum. Er und Louise haben immerhin ihr gutes Hochzeitsbett behalten, diesen Zeugen eines hoffnungsvollen Anbeginns. Die beiden halbwüchsigen Mädchen aber, Bernadette und Marie müssen auf einem sehr harten Lager schlafen. Die zwei Jüngsten schließlich, Jean Marie und Justin, hat die Mutter auf einem Strohsack gebettet, der tagsüber eingerollt wird.
François Soubirous, der sich noch immer nicht von seinem Platz rührt, wirft einen Blick nach dem offenen Herd. Es ist eigentlich kein rechter Herd, sondern eine grobe Feuerstelle, die der Steinmetz André Sajou, der Eigentümer dieser prächtigen Wohnung, für seine Mieter improvisiert hat. Unter der Asche glimmen und knacken noch ein paar der frischen Äste, die zu feucht waren, um zu verbrennen. Manchmal zuckt ein blasser Schein auf. Der Mann aber hat nicht die Energie, den Rest des Feuers aufzuschüren. Er wendet das Aug zu den Fenstern, hinter denen die Nacht zu ergrauen beginnt. Da verwandelt sich sein tiefes Missbehagen in eine zornige Bitterkeit. Ein Fluch sitzt ihm auf den Lippen. Soubirous ist ein sonderbarer Mann. Mehr als die elende Stube ärgern ihn diese beiden vergitterten Fenster, eines größer, das andre kleiner, die zwei niederträchtig schielenden Augen, die auf den engen, dreckigen Hof des Cachots hinausschauen, wo der Misthaufen der ganzen Gegend duftet. Man war schließlich kein Landstreicher, kein Lumpensammler, sondern ein freier, regelrechter Müller, ein Mühlenbesitzer, auf seine Art nichts andres, als es Monsieur de Lafite ist mit seinem großen Sägewerk.
Die Boly-Mühle unterm Château Fort hatte sich sehen lassen können weit und breit. Auch die Escobé-Mühle in Arcizac-les-Angles war gar nicht übel. Mit der alten Bandeau-Mühle konnte zwar niemand Ehren einheimsen, aber eine Mühle war sie schließlich doch. Ist er, der gute Müller Soubirous, vielleicht Schuld daran, dass der rädertreibende Lapaca-Bach seit Jahren ausgetrocknet ist, dass die Getreidepreise steigen, dass die Arbeitslosigkeit wächst? Daran ist der liebe Gott schuld, der Kaiser, der Präfekt oder der Teufel weiß wer, nicht aber der brave François Soubirous, wenn der Mensch auch gern einmal ein Glas trinkt und im Wirtshaus die Karten mischt. Mag er, Soubirous, aber schuld sein oder nicht, was hilft’s, man wohnt nun im Cachot. Und der Cachot in der Rue des Petites Fossées ist gar kein Wohnhaus, sondern der ehemalige Stadtarrest. Die Wände schwitzen vor Feuchtigkeit. Der Schwamm sitzt zwischen den Ritzen. Alles Holz wirft sich. Das Brot verschimmelt schnell. Im Sommer brät man hier, im Winter erfriert man. Deshalb hat Monsieur Lacadé, Maire von Lourdes, vor einigen Jahren angeordnet, dass der Cachot aufgelassen werde und dass man die Vagabunden und Übeltäter im Torgebäude des Baous-Tores unterbringe, wegen der besseren Gesundheitsverhältnisse, ausdrücklich. Für die Familie Soubirous sind die Gesundheitsverhältnisse im Cachot gut genug. Man merkt’s, denkt der ehemalige Müller, die Bernadette hat wieder die halbe Nacht gefaucht und gepfiffen. Da beginnt er sich selbst so jämmerlich leid zu tun, dass er fest entschlossen ist, zurück ins Bett zu kriechen und weiterzuschlafen.
Es kommt nicht zu dieser feigen Waffenstreckung, denn inzwischen hat Mutter Soubirous sich erhoben. Sie ist eine Frau von fünf- oder sechsunddreißig, die aussieht wie fünfzig. Sofort macht sie sich übers Feuer, scheucht die Funken aus der Asche, häuft qualmendes Stroh, Späne und ein paar trockene Äste darauf und hängt schließlich den kupfernen Wasserkessel über die neue Flamme. Soubirous betrachtet großartig und düster diese wortlose Tätigkeit seines Weibes. Auch er sagt nichts. Ein Tag fängt wieder an, mit seinen Lasten und Enttäuschungen. Ein Tag, wie er gestern war und wie er morgen sein wird. Jetzt läuten die blechernen Glocken der Pfarrkirche. Man entgeht dem Tag nicht.
François Soubirous hat nur eine einzige Sehnsucht: einen brennenden Schnaps in seinen öden Magen zu bekommen. Die Flasche mit dem Kräuterteufel aber hält Mutter Soubirous unter Verschluss. Er bringt’s nicht über sich, den leidenschaftlichen Wunsch auszusprechen, denn der Kräuterteufel ist ein Streitpunkt zwischen den Eheleuten. Eine Weile zögert er noch, dann tritt er in die Pantinen:
»Ich geh jetzt, Louise«, brummt er gedämpft.
»Hast du etwas Bestimmtes vor, Soubirous?« fragt sie.
»Man hat mir Verschiedenes angetragen«, meint er dunkel. Es ist täglich dasselbe Zwiegespräch. Seine Würde erlaubt es Soubirous nicht, sich selbst und dem Weibe die ganze klägliche Wahrheit einzugestehen. Die Frau macht einen hoffnungsvollen Schritt vom Herde weg:
»Bei Lafite vielleicht? Im Sägewerk?«
»Ah, Lafite«, spottet er. »Wer denkt an Lafite? Aber ich werde mit Maisongrosse sprechen und mit Cazenave, dem Postmeister, weißt du …«
»Maisongrosse, Cazenave …« Sie wiederholt enttäuscht diese Namen und arbeitet wieder. Er setzt die Baskenmütze auf. Seine Bewegungen sind langsam und unsicher. Plötzlich dreht sich die Frau um:
»Ich habe darüber nachgedacht, Soubirous. Wir sollten Bernadette weggeben von hier«, flüstert sie.
»Was heißt das, weggeben von hier?«
Soubirous hat gerade den schweren Riegel an der Tür zurückgeschoben. Es ist eine Gefängnistür. Jedes Mal, wenn er sie öffnet, fällt ihm die schlimmste Zeit seines Lebens ein, jene vier Wochen im Vorjahr, die er als ein Unschuldiger in Untersuchungshaft verbringen musste. Seine Hand fällt herab. Er hört das Gewisper der Frau:
»Zu ihrer Tante Bernarde, mein ich. Oder noch besser aufs Dorf nach Bartrès. Die Laguès würde sie sicher wieder aufnehmen. Und sie hat draußen gute Luft und Ziegenmilch und Honig aufs Weizenbrot, und sie ist doch so gern auf dem Dorf, und das bisschen Arbeit schadet ihr nichts …«
François Soubirous fühlt wieder die Bitterkeit in sich aufsteigen. Obgleich er Louisens gute Gründe einsieht, begehrt er auf. Er hat eine Schwäche für große Worte und Gebärden. Vermutlich stammt ein Teil der Soubirous aus dem Spanierland. »Ich bin also wirklich ein Bettler«, knirscht er. »Meine Kinder verhungern. Ich muss sie zu fremden Leuten …«
»Du solltest vernünftig sein, Soubirous«, unterbricht ihn die Frau, da er zu laut gesprochen hat. Sie sieht ihn an, wie er dasteht, mit gesenktem Kopf, verzweifelt, würdevoll und willensschwach. Da nimmt sie die Flasche aus dem Schrank und schenkt ihm ein Gläschen ein.
»Kein schlechter Einfall von dir«, sagt er täppisch und stürzt das Brennende hinunter. Seine Seele schreit nach einem zweiten Glas. Er beherrscht sich aber und geht. Im Bette, wo die beiden Schwestern schlafen, liegt Bernadette, die ältere, da, mit offenen, stillen, dunklen Augen.
Kapitel Zwei. Massabielle, ein verrufener Ort
Die Rue des Petites Fossées ist eine der schmalen Gassen, die den Burgfelsen von Lourdes umlagern. Sie steigt winkelzügig an, ehe sie in den Stadtplatz Marcadale mündet. Es ist hell geworden. Man sieht aber dennoch nur wenige Schritte weit. Der Himmel hängt tief herab. Ein Vorhang, gewirkt aus Regen und dicken Schneeflocken, schlägt Soubirous ins Gesicht. Die Welt ist leer und stumpf. Nur die Clairons der Dragonereskadron auf dem Kastell und in der Nemours-Kaserne unterbrechen mit ihren morgendlich spritzigen Signalen die Öde. Obwohl hier unten im Gave-Tal der Schnee nicht liegenbleibt, dringt die eisige Kälte in sonderbaren Stößen bis in die Knochen. Es ist der Anhauch der Pyrenäen, die hinter den Wolken lauern, die schneidende Botschaft der gedrängten Kristallhäupter, vom Pic du Midi bis zum furchtbaren Dämon Vignemal, dort zwischen Frankreich und Spanien.
Die Hände Soubirous’ sind rot und klamm, seine unrasierten Backen nass, die Augen brennen ihm. Dennoch steht er vor dem Bäckerladen Maisongrosse lange Zeit unentschlossen, ehe er eintritt. Er weiß, es ist vergeblich. Während des vorjährigen Karnevals hat ihn Maisongrosse hie und da als Austräger beschäftigt. Im Fasching geben die Brüderschaften und Innungen ihre Feste. Da ist zum Beispiel der große Ball der Schneider und Näherinnen, welche die heilige Lucia verehren. Der Ball findet im Hotel der Postmeisterei statt, und die Firma Maisongrosse liefert das Gebäck, vom Brot angefangen bis zu den feinen Cremetorten und Krapfen. Bei dieser Gelegenheit hatte Soubirous damals die ansehnliche Summe von hundert Sous verdient und überdies seinen Kindern eine Tüte voll Bäckereien mit nach Hause gebracht.
Er fasst sich ein Herz. Er tritt in den Laden. Der mütterliche Duft des warmen Brotes umhüllt ihn, betäubt ihn. Ganz weinerlich wird ihm zumute. Der dicke Bäcker steht inmitten des Raums, die weiße Schürze um den gewaltigen Bauch, und kommandiert seine zwei Gehilfen, die schweißübergossen die schwarzen Blechplatten mit den frischen Brötchen aus dem Backofen ziehen.
»Könnt ich Ihnen heut vielleicht behilflich sein mit irgendwas, Monsieur Maisongrosse?« fragt Soubirous leichthin. Seine Hand greift dabei in einen der offenen Säcke und lässt wollüstig das Weizenmehl durch die erfahrenen Müllerfinger gleiten. Der Dicke würdigt ihn keines Blickes. Er hat eine kropfige Stimme:
»Was für einen Tag haben wir heut, mon vieux?« knurrt er.
»Donnerstag, Ihnen zu dienen, jeudi gras …«
»Und wieviel Tage haben wir noch bis zu Aschermittwoch?« forscht Maisongrosse weiter, wie ein verschlagener Schulmeister.
»Sechs Tage sind’s wohl noch, Monsieur«, zögert der Müller.
»Da habt Ihr’s«, triumphiert der Dicke, als habe er eine Wette gewonnen. »Sechs Tage, dann ist dieser ganze lausige Karneval zu Ende. Und die Vereine bestellen sowieso nichts mehr bei mir, sondern bei Rouy. Mit der guten alten Zeit ist es Wasser. Man geht zum Pâttissier und nicht zum Boulanger. Und wenn das Geschäft schon im Fasching so aussieht, da könnt Ihr Euch ausrechnen, was die Fastenzeit bringen wird. Noch heute werfe ich einen von diesen Nichtsnutzen da hinaus …«
François Soubirous überlegt, ob er den Bäcker rundheraus um ein Brot bitten soll. Lange würgt er an einem Wort. Er hat aber den Mut nicht. Nicht einmal zum Betteln tauge ich, geht’s ihm durch den Kopf. Wie ein unzufriedener Kunde rückt er ein wenig an seiner Mütze und verlässt den Laden.
Um zur Postmeisterei zu gelangen, muss er nun den Platz überqueren. Cazenave steht schon höchst persönlich inmitten seiner Gespanne und Wagen auf dem großen Hof. Als ehemaliger Sergeant des Trainregiments in Pau ist er ein Frühaufsteher. Seine Dienstzeit liegt lange zurück, damals regierte noch der fette Bürgerkönig. Cazenave hört es nicht ungern, wenn man ihn nachträglich avancieren lässt und als Offizier anspricht. Er trägt zu jeder Tageszeit hohe Stiefel, blankgewichst, und eine Reitgerte, mit welcher er die Stiefelschäfte martialisch bearbeitet. Im violett angelaufenen Gesicht trägt er den schraubenförmig gedrehten Knebelbart des Kaisers, sorgfältig schwarz gefärbt. Cazenave ist demgemäß überzeugter Bonapartist, worunter er eine Parteigesinnung versteht, in der sich »La France« und »Gloire« auf »Progrès« reimen. Seitdem man eine Bahnlinie von Toulouse über Tarbes und Pau nach Biarritz gebaut hat – der Kaiser und zumal die Kaiserin Eugénie halten sich oft in Biarritz auf –, gehen die Geschäfte des Posthalters zu Lourdes noch glänzender als früher. Jeder Vergnügungsreisende und Kurgast, der die Pyrenäenbäder besuchen will, ist gezwungen, bei Cazenave haltzumachen. Cazenave ist Herr über alle »Gelegenheiten«, die teuer oder billig, bequem oder unbequem die Erholungsbedürftigen nach Argelès, Cauterets, Gavarnie und Luchon bringen. Jetzt ist es freilich noch sehr weit bis zur Saison. Mit welchen Lockmitteln man diese verlängern und den Fremdenverkehr heben könnte, das bildet einen unerschöpflichen Diskussionsstoff zwischen Cazenave und dem ehrgeizigen Bürgermeister von Lourdes, Monsieur Adolphe Lacadé. – Soubirous hat in seiner Jugend vierzehn Tage beim Militär gedient, länger hat man ihn nicht behalten. Er deutet also, so gut er kann, soldatische Haltung an und tritt hin vor Cazenave:
»Guten Morgen, Herr Postmeister! Wäre eine kleine Arbeit für mich da?«
Cazenave bläst die Backen auf und stößt missbilligend die Luft aus.
»Ah, du bist es wieder, Soubirous? Wirst du denn nie auf gleich kommen, Sapristi? Man muss seinen Platz ausfüllen. Keinem von uns wird etwas geschenkt …«
»Gott meint es nicht gut mit mir, Monsieur … Ich habe kein Glück seit Jahren …«
»Unser Glück kommt von Gott, es ist möglich. Unser Unglück kommt von uns selbst, mein Freund …«
Die Reitpeitsche pfeift bekräftigend zu dieser Maxime. Soubirous senkt den Blick:
»Meine Kinder können gewiss nichts für ihr Unglück.«
Der Postmeister ruft dem Pferdeknecht Doutreloux einen Befehl zu. Soubirous strafft sich noch einmal:
»Vielleicht gibt es doch etwas … mon capitaine …«
Cazenave wird sogleich wohlwollender:
»Ich helfe einem alten Krieger immer gern … Heut aber gibt es wirklich nichts …«
Es ist deutlich wahrzunehmen, wie des Müllers Körper schwer wird. Er wendet sich langsam zum Gehen. Da ruft ihn Cazenave zurück:
»Halt, mein Lieber! Zwanzig Sous könntest du dir schließlich verdienen. Es ist keine reinliche Arbeit freilich. Die Mutter Oberin des Hospitals verlangt, dass man allerlei Unrat wegführt und verbrennt vor der Stadt. Verbandzeug, Charpie von Operationen, Wäsche von ansteckend Kranken und ähnliche Geschichten. Spann dort den Braunen vor den kleinen Leiterwagen, wenn du magst … Zwanzig Sous!«
»Können es nicht dreißig sein, mon capitaine?«
Cazenave gibt darauf keine Antwort mehr.
Soubirous tut, wie man ihm geheißen. Er spannt den klapprigen Braunen, das schlechteste Ross der Postmeisterei, vor den kleinen Leiterwagen. Die Fuhre holpert zum Hospital, das von den Klosterschwestern der heiligen Gildarde zu Nevers geleitet wird, denselben, die auch in der Schule unterrichten. Der Concierge des Krankenhauses hat die drei Kisten mit dem Unrat schon bereitgestellt. Sie sind nicht schwer, stinken aber wie die Pest nach dem Elend allen Fleisches. Die Männer laden sie auf den Wagen.
»Gib acht, Soubirous«, warnt der Concierge, ein medizinischer Fachmann. »Da steckt der Satan der Infektion drin. Bring’s weit hinaus, bis nach Massabielle, verbrenn’s und schmeiß die Asche in den Gave!«
Das Regnen und Stöbern hat aufgehört. Der Wagen knattert über schlechtes Pflaster. Das Hospital der Schwestern von Nevers liegt am nördlichen Stadteingang, dort wo die Nationalstraßen von Pau und Tarbes einander kreuzen. Soubirous muss sein Gefährt die steile Rue Basse hinabbremsen, um Lourdes durch das westliche Tor Baous zu verlassen. Als er die alte Römerbrücke, den Pont Vieux, überschritten hat, lockert sich endlich seine erstarrte Hand. Er lässt den Braunen auf dem Karrenweg, der das Flussufer entlangführt, gleichgültig dahintrotten. Hier macht der Gave ein scharfes Knie. Tausendstimmig aufbegehrend rauscht das uralte Berggewässer, als sei es durch die beinahe rechtwinklige Wendung überanstrengt und geärgert. Riesige Granitblöcke stellen sich dem zornigen Flusslauf überall in den Weg. Soubirous hört dem Gave nicht zu. Er hat nicht nein gesagt, der Postmeister, ganz bestimmt wird er mir die dreißig Sous ausbezahlen. Vier Brote kaufe ich, acht Sous, aber nicht bei Maisongrosse, meiner Treu, nicht bei Maisongrosse. Ein halbes Pfund Schafkäse kaufe ich, der ist nahrhaft, macht zusammen mit dem Brot vierzehn Sous. Zwei Liter Wein dazu, macht vierundzwanzig Sous. Dann ein paar Würfel Zucker, damit die Kinder etwas Süßes und Starkes in den Wein haben … Ach was, am besten, ich gebe die dreißig Sous gleich der Louise. Sie soll’s einteilen. Dann brauch ich nichts zu verrechnen. Für mich behalt ich keinen Knopf. Das gelob ich heilig …
Trotz der Aussicht auf die dreißig Sous – ein unerwartetes Himmelsgeschenk – wird es Soubirous immer dumpfer und schwerer ums Herz. Er spürt seinen Hunger als eine Art Übelkeit, die durch den Gestank der jammervollen Ladung hinter dem Kutschbock abscheulich verschärft wird. Die Fahrt geht vorbei am Besitztum des Herrn de Lafite, des sagenhaft reichen Mannes von Lourdes, der ebenso wie Soubirous als einfacher Müller begonnen hat, ehe er vom verwunschenen Glück zur schwindelnden Höhe emporgehoben wurde. Das ausgedehnte Grundstück liegt auf der sogenannten Chalet-Insel, die durch den Gave-Bogen und die Sehne des Savy-Bachs gebildet wird, der sich einige Schritte jenseits des Felsens Massabielle in den Fluss ergießt. Das Besitztum besteht aus dem Herrenhaus im Stil Heinrichs IV. mit vielen Türmchen und Erkerchen, aus dem Park, aus weiten Wiesenflächen und dem imposanten Sägewerk. In Lourdes wird diese Sägemühle mit Ehrfurcht »die Fabrik« genannt. Sie ist weitläufig gebaut, und ein prächtiger Staudamm sammelt die Kräfte des schmächtigen Mühlbachs zu ungeahnten Leistungen. Es gibt außerdem noch eine kleine, alte Mühle an diesem Bach. Soubirous kann sie jetzt von seinem Kutschbock sehen. Sie gehört Antoine Nicolau und seiner Mutter. Er beneidet diesen Nicolau hundertmal mehr als den ganzen Herrn de Lafite mitsamt seinem Schloss, seiner Fabrik und seinen Equipagen. Das Allzugroße flößt keinem Neid ein. Mit Nicolau aber kann er sich messen. Ist er vielleicht schlechter als Nicolau? Er ist vermutlich besser als Nicolau. Älter und erfahrener ist er sicher. Der unbegreifliche Himmel hat es eben so eingerichtet, dass die Besseren auf dem trockenen sitzen und die Schlechteren auf der Türschwelle der Savy-Mühle gelassen den Radschaufeln zuschauen dürfen, wie sie sich drehen und drehen. Soubirous versetzt dem Gaul einen Peitschenhieb über die knochige Kruppe, dass er einen Sprung macht und zu traben beginnt. Der Weg verliert sich im rostigen Heidegras. Die schönen Silberpappeln Herrn de Lafites liegen weit zurück. Die Chalet-Insel wird öde. Nur wilder Buchs und ein paar Haselnußstauden wachsen hier. Die beiden Striche von Erlengebüsch, die den Gave rechter Hand, den Savy-Bach linker Hand einsäumen, eilen aufeinander zu.
Am linken Ufer der beiden Wasserläufe erhebt sich die felsige Anhöhe der Montagne des Espélugues. Es ist ein unbedeutender, niedriger Rücken, dieser »Spelunkenberg« oder »Höhlenberg«. Wenn man sich vornehmer ausdrücken will, kann man ihn auch Berg der Grotten nennen. In sein Gefelse hat die Natur nämlich ein paar Grotten eingesprengt. Die größte unter ihnen hat Soubirous nun vor Augen, die Grotte Massabielle. Sie ist ein vielleicht zwanzig Schritt breites, zwölf Schritt tiefes Loch in der Kalkwand, einem Backofen nicht unähnlich. Nackt, feucht, angefüllt mit dem Geröll des Gave, dessen geringstes Hochwasser sie stets überschwemmt, bietet sie keinen erfreulichen Anblick. Zwischen dem Gerölle wächst ein wenig Farnkraut und Huflattich. Ein einziger magerer Dornstrauch klammert sich auf halber Höhe der Grotte etwa an den Felsen. Es ist eine wilde Rose, die einen ovalen oder spitzbogenförmigen Ausschnitt umarmt, eine schmale Pforte gleichsam, die in eine steinige Nebenkammer der Grotte führt. Man könnte fast meinen, diese Pforte oder dieses gotische Fenster sei in unbekannter Zeit von primitiver Menschenhand in den Fels gehauen worden. Die Höhle Massabielle ist nicht sehr beliebt beim Volke von Lourdes und bei den Bauern der Nachbardörfer im Tale Batsuguère. Die alten Weiber wissen von allerlei Schauer- und Geistergeschichten zu erzählen, die sich dort begeben haben. Wenn Fischer, Hirten, Holzsammlerinnen aus dem nahen Saillet-Wäldchen, vom Gewitter überrascht, in Massabielle Zuflucht suchen, so pflegen sie ein Kreuz zu schlagen.
François Soubirous ist kein altes Weib, sondern ein vom Leben geprüfter Mann, den Schauergeschichten nicht besonders schrecken. Auf der Landzunge zwischen Gave und Savy-Bach hat er sein Gefährt angehalten. Er klettert vom Bock und überlegt, wo und wie er seinen Auftrag am schnellsten erfüllen könne. Vielleicht wäre es gut, die Fuhre durch den seichten Bach zu lenken und den Spitalsunrat in der Grotte zu verbrennen, wo das Zeug schneller Feuer fängt als draußen in der Luft. Soubirous zögert. Der alte, morsche Wagen könnte durch die spitzen Steine im Bach Schaden nehmen.
François ist kein Mann der raschen Entscheidungen. Er kratzt sich den Kopf, als sein Ohr auf ein dumpfes Gegrunze aufmerksam wird, in das sich raue Laute mischen. Dort, das ist Leyrisse, der Schweinehirt. Er kommt ans Ufer gerannt, während sich seine schwarzen Säue in dem kleinen Morast zwischen Massabielle und dem Gemeindeforst wälzen. Auch Leyrisse ist ein von Gott geschlagener Mann. Soubirous verachtet ihn nicht wenig. Denn erstens ist Leyrisse ein Kretin, zweitens hat er einen Wolfsrachen, bellt und heult daher, wenn er redet, und drittens hütet er die Schweine der ganzen Gegend, was der gelernte Müller Soubirous für ungefähr die niedrigste Profession auf Erden hält. Leyrisse ist ein kleiner, stämmiger Bursche mit einem allzu großen Rotkopf auf dem Blähhals. Seine Gestalt ist von Kopf bis Fuß in Felle gewickelt. Er gleicht einem fest verschnürten Paket. (Schuldirektor Clarens meint, der Urmensch der Pyrenäen müsse ausgesehen haben wie Leyrisse.) Erregte Zeichen macht er zu Soubirous hin. Der Sauhirt ist immer erregt, wie all jene Unglücklichen, die sich durch eine Sprachstörung nur schwer verständlich machen können. Der Müller winkt ihn zu sich. Leyrisse durchwatet den Bach mit großen Schritten, als sei kein Wasser darin. Sein zottiger Hund folgt ihm, nicht minder erregt als der Herr.
»He, Leyrisse«, ruft Soubirous dem Hirten zu. »Willst du mir helfen?«
Leyrisse ist ein gutmütiges Wesen, dessen größter Ehrgeiz darin besteht, wo es nur kann, seine Brauchbarkeit und Lebenstüchtigkeit zu beweisen. Mit starken Armen hebt er die Kisten vom Wagen und trägt sie, wie Soubirous befiehlt, zur äußersten Spitze der Landzunge, wo er ihren Inhalt auf den Boden stürzt. Es erhebt sich eine übelriechende Pyramide aus blutiger Watte, eitrigen Verbandwickeln, schmutzigen Leinwandfetzen. Der Müller, an die reinlichste Arbeit gewöhnt und leicht von Ekel heimgesucht, zündet sich eine Pfeife an, um ein besseres Arom in die Nase zu bekommen. Er bildet sich ein, unter dem Unrat unaussprechliche Dinge erkannt zu haben, einen abgeschnittenen menschlichen Finger zum Beispiel. Rasch wirft er Leyrisse sein Päckchen mit den Schwefelhölzern zu, damit er den Haufen in Brand setze. Es ist schrecklich kalt geworden. Windstille herrscht. Der leicht entzündliche Graus lodert sofort auf. Hirt und Hund freuen sich, umtanzen das seltsame Opfer, dessen Qualm, vom Himmel günstig angenommen, kerzengerade emporsteigt.
Soubirous hat sich auf einen Stein niedergelassen, schweigt, sieht zu. Nach einer Weile setzt sich der gute Sauhirt an seine Seite. Er zieht ein Schwarzbrot aus dem Proviantbeutel und ein Stück Speck. Er schneidet von beiden zwei gleiche Portionen ab. Mit belfernder Liebenswürdigkeit bietet er Soubirous seinen Teil an. Dieser greift mit Heißhunger nach der würzigen Speise, der ersten dieses Tages. Schnell aber beherrscht er sich und beginnt langsam nachdenklich zu kauen, wie es sich für einen ehrsamen Mühlenbesitzer ziemt, der so hoch über dem Schweinehüter und Dorfkretin steht. Die Augen starr aufs Feuer gerichtet, das seine Nahrung blitzschnell verzehrt, murmelt er:
»Wenn man nur eine Schaufel hätte hier …«
Kaum hört der dienstwillige Leyrisse das Wort Schaufel, als er schon aufspringt, durch das Bachwasser läuft, als wäre es keins, und aus der Grotte zwei Spaten herüberbringt. Arbeiter, die gegen die Hochfluten des Gave eine Mauer aufführten, mögen sie dort gelassen haben. Inzwischen hat das Feuer jene gräulichen Reste fleischlicher Qualen zu Asche gebrannt. Es kostet die beiden Männer nicht viel Mühe, den Aschenhaufen und was sonst vom verkohlten Zunder übrigbleibt, in den Gave zu schaufeln, der auch diese Gabe mit seinem cholerischen Temperament zum Flusse Adour und durch ihn in den Ozean führt.
Es ist noch lange nicht elf Uhr, als François Soubirous, diesmal nicht mehr mit leerem Magen und hoffnungsloser Seele, vor Cazenave steht.
»Ihr Befehl ist ausgeführt, mon capitaine!«
Nach längerem Handel und mehreren, immer strammer wiederholten »mon capitaine«‘s hält er schließlich fünfundzwanzig Sous in Händen. An der Ecke der Rue des Petites Fossées ist Soubirous noch immer bereit, den vollen Betrag an Louise abzuführen. Doch schon vor dem Estaminet Vater Babous tritt ihn der Versucher an, dem er, der Mühen des heutigen Vormittags eingedenk, nur einen erschöpften Widerstand entgegensetzt. Zwanzig Sous, ein rundes Silberstück, war der ausgesetzte Preis für seine Arbeit. Die fünf großen Kupferstücke sind ein Überpreis. Wo steht es geschrieben, dass ein guter Familienvater, der sich für die Seinen in der Winterkälte plagt wie selten einer, diese elenden fünf Sous, dieses Sündengeld nicht für sich selbst verwenden dürfe? Vater Babou begehrt für einen Achtelliter seines Selbstgebrannten Kräuterteufels nicht mehr als zwei Sous. Soubirous findet das äußerst preiswert. Er hält sich aber bei Vater Babou nicht länger auf, als man braucht, um einen einzigen Kräuterteufel zu leeren.
Im Cachot schlägt ihm ein angenehmer Dunst entgegen. Kein »Milloc« heute, kein Maisbrei, dem Himmel sei Dank! Maman bereitet eine Zwiebelsuppe. Diese Weiber sind nicht kleinzukriegen, denkt er. Sie schaffen immer wieder etwas her. Weiß Gott, vielleicht hilft ihnen der Rosenkranz, den sie stets in der Schürzentasche tragen. Soubirous macht sich zuerst längere Zeit in der Stube gleichgültig zu schaffen, ehe er seinem Weibe die Silbermünze überreicht, gelassen, als wäre das nur ein geringer Vorschuss auf die Louisdors, die er morgen zu erwarten habe.
»Du bist ein tüchtiger Bursche, Soubirous«, sagt sie nicht ohne anerkennendes Mitleid, und auch er ist überzeugt davon, dass er heut mit dem Leben ganz gut fertig geworden ist. Dann stellt sie einen Teller Zwiebelsuppe vor ihn auf den Tisch. Er löffelt, wie es seine Art ist, mit nachdenklicher Strenge. Sie sieht ihm zu und seufzt.
»Wo sind die Kinder?« fragt er, nachdem er sein Mahl beendet hat.
»Die Mädchen müssen gleich aus der Schule kommen, und Justin und Jean Marie spielen unten …«
»Die Kleinen sollten nicht auf der Straße spielen«, bemerkt der ehemalige Müller mit standesbewusstem Tadel. Da sich Louise in keine Diskussionen über diesen Ehrenpunkt einlässt, erhebt sich Soubirous, gähnt, stöhnt, reckt und streckt sich:
»Ich bin tüchtig durchgefroren nach alledem, am besten, man geht zu Bett. Man hat sich’s verdient …«
Die Soubirous schlägt die Bettdecke zurück. Er tritt aus den Pantinen, wirft sich hin und zieht die Decke bis an die Nase. Wenn man auch bettelarm ist und ungerecht behandelt vom Schicksal, manchmal tut einem das Leben doch köstlich wohl, insbesondere nach getaner Pflicht. Soubirous fühlt Sättigung, steigende Wärme und eine ausgesprochene Zufriedenheit mit sich selbst, die ihn in einen raschen Schlaf hinübergeleitet.
Kapitel Drei. Bernadette weiß nichts von der Heiligen Dreifaltigkeit
Hinterm Lehrertisch sitzt Sœur Marie Thérèse Vauzous, eine der Klosterfrauen von Nevers, die an das Hospital und die ihm angeschlossene Mädchenschule in Lourdes abgeordnet sind. Sœur Marie Thérèse ist noch jung, und sie könnte für schön gelten, wenn ihr Mund nicht allzu schmal und ihre hellblauen Augen nicht allzu eingesunken wären. Die Blässe des feingeformten Gesichtes wirkt unter dem schneeweißen Haubenvorstoß krankhaft gelblich. Die langgefiederten Hände deuten auf ausgezeichnete Herkunft. Wenn man aber näher hinsieht, so sind diese adligen Hände rot und aufgesprungen. Was die erbarmungslosen Zeichen der Strenge und Abtötung anbetrifft, so bietet die Nonne Vauzous zweifellos das Bild einer mittelalterlichen Heiligen dar. Der Katechet von Lourdes, Abbé Pomian, der ein feiner Spötter ist, sagt von ihr: »Die gute Sœur Marie Thérèse ist weniger eine Braut als eine Amazone Christi.« Er kennt die Klassenlehrerin Vauzous ziemlich genau, da sie ihm als Gehilfin beim Religionsunterricht der Mädchen zugeteilt ist. (Die seelsorgerliche Pflicht führt den Kaplan Pomian viel in den Dörfern und Märkten des Kantons umher, so dass er oft tagelang von Lourdes abwesend ist. Er selbst pflegt sich dann einen Commis Voyageur Gottes zu nennen. Sein Oberer, der Dechant Peyramale, verabscheut dergleichen witzige Aperçus.) Marie Thérèse Vauzous bereitet die Kinder unter Pomians Leitung zur Erstkommunion vor, die im Frühjahr stattfindet.
Vor der Lehrerin steht ein Mädchen. Es ist ziemlich klein für sein Alter. Das runde Gesicht ist sehr kindlich, während der schmächtige Körper bereits die Frühreife der südländischen Rasse erkennen lässt. Das Mädchen ist in einen bäuerlichen Kittel gekleidet. An den Füßen trägt es Pantinen. Aber alle Kinder, und nicht nur die Kinder, tragen hier Holzschuhe bis auf die wenigen, die aus den sogenannten besseren Kreisen stammen. Die braunen Augen des Mädchens halten dem Blick der Klosterfrau ruhig stand. Ihr eigener Blick ist frei, abwesend und beinahe apathisch. Etwas in diesem Blick macht Sœur Marie Thérèse unruhig:
»Und weißt du wirklich nichts über die Heilige Dreifaltigkeit, liebes Kind?«
Das Mädchen wendet den Blick noch immer nicht von der Lehrerin und antwortet unbefangen mit einer hellen Stimme:
»Nein, ma Sœur, ich weiß nichts darüber …«
»Und du hast niemals etwas davon gehört?«
Das Mädchen denkt lange nach, ehe es sagt:
»Möglich, dass ich was davon gehört hab …«
Die Nonne klappt ihr Buch zu. Ein wirkliches Leiden tritt auf ihre Züge:
»Jetzt weiß ich nicht, mein Kind, soll ich dich für dreist halten, für gleichgültig oder nur für dumm …«
Ohne den Kopf zu senken, entgegnet Bernadette, als ob sie das nichts anginge:
»Ich bin dumm, ma Sœur … In Bartrès haben sie gesagt, dass ich keinen Kopf zum Lernen hab …«
»Also, wie ich’s gefürchtet hab«, seufzt die Lehrerin. »Du bist frech, Bernadette Soubirous …«
Die Vauzous geht auf und ab vor den Bänken. Sie muss, eingedenk ihrer Pflicht als geistliche Person, einen heftigen Unwillen niederkämpfen. Währenddessen beginnen die achtzig oder neunzig Mädchen der Klasse unruhig zu rutschen und immer lauter zu plappern.
»Ruhe«, befiehlt die Lehrerin. »Unter was für ein Volk bin ich geraten? Ihr seid Heiden, ärger und unwissender als Heiden …«
Eines der Mädchen meldet sich, mit der Hand fuchtelnd:
»Bist du nicht auch eine Soubirous?« fragt die Nonne, die erst vor einigen Wochen die Klasse übernommen hat und noch nicht alle Gesichter mit den dazu gehörenden Namen in Einklang bringen kann.
»Jawohl, ma Sœur. Ich bin die Marie Soubirous … Ich wollte nur sagen, dass Bernadette, dass meine Schwester immer krank ist …«
»Du bist eigentlich danach nicht gefragt worden, Marie Soubirous«, rügt die Lehrerin, der dieser schwesterliche Beistand als eine Art Aufruhr erscheint. Mit christlicher Milde allein kann man eine Horde von neunzig Proletariermädchen nicht in Zucht halten. Die Vauzous versteht es aber sehr gut, sich Respekt zu verschaffen.
»Krank ist deine Schwester?« fragt sie. »Was für eine Krankheit?«
»Athma heißt es, oder so …«
»Du meinst wohl Asthma …«
»Jawohl, ma Sœur, Asthma! Der Doktor Dozous hat das gesagt. Sie kann nicht atmen, oft …«
Marie ahmt drastisch einen Anfall von Schweratmigkeit nach. Es ist ein Gaudium für die Klasse. Die Lehrerin schneidet mit einer Handbewegung das übertriebene Gelächter ab:
»Asthma hindert niemanden am Lernen und an der Frömmigkeit.« Sœur Marie Thérèse runzelt die Augenbrauen und überblickt die Klasse:
»Kann mir eine von euch Antwort geben auf meine Frage?«
In der ersten Bank fährt ein Mädel hoch. Es hat schwarze Wuschelhaare, begehrliche Augen und einen aufgeschürzten Mund.
»Nun, Jeanne Abadie«, nickt die Lehrerin. Es ist der Name, den sie am öftesten nennt. Jeanne Abadie lässt flink ihr Licht leuchten:
»Die Heilige Dreifaltigkeit, das ist einfach der Herrgott …«
Das durchgearbeitete Gesicht der Nonne verzieht sich zu einem Lächeln:
»Nun, so einfach ist es nicht, meine Liebe … Aber du hast wenigstens eine blasse Ahnung …«
In diesem Augenblick erhebt sich die ganze Klasse, um dem Abbé Pomian, der in den Schulraum getreten ist, die Ehrenbezeigung zu leisten. Der junge Geistliche, einer der drei Kapläne des Dechanten Peyramale, macht seinem Namen Pomian Ehre. Er hat pralle rote Apfelbäckchen und scherzhaft schmunzelnde Augen.
»Ein kleiner Prozess, ma Sœur?« fragt er beim Anblick der armen Sünderin, die noch immer vor den Bänken steht.
»Ich muss leider Klage führen über Bernadette Soubirous, Herr Abbé«, sagt die Lehrerin. »Sie ist nicht nur sehr unwissend, sondern gibt auch kecke Antworten.«
Bernadette macht eine Bewegung mit dem Kopf, als wolle sie etwas richtigstellen. Abbé Pomians stark behaarte Hand dreht ihr das Gesicht zum Licht:
»Wie alt bist du, Bernadette?«
»Vierzehn Jahre schon vorüber«, antwortet die helle Stimme des Mädchens.
»Sie ist die Älteste in der Klasse und die Unreifste«, flüstert die Vauzous dem Kaplan zu. Er aber schenkt ihr keine Aufmerksamkeit, sondern wendet sich wieder an Bernadette:
»Kannst du mir sagen, ma petite, an welchem Tag und in welchem Jahr du geboren bist?«
»O ja, das kann ich dem Herrn Abbé schon sagen. Ich bin geboren am siebenten Januar 1844 …«
»Da siehst du’s also, Bernadette. Du bist gar nicht so dumm und kannst ganz verständig antworten … Weißt du vielleicht auch, auf welche Oktave dein Geburtstag fällt oder, damit du mich besser verstehst, welches Fest feiern wir am Tage vor deinem Geburtstag? Erinnerst du dich? Es ist ja nicht lange her …« Bernadette sieht den Kaplan mit derselben sonderbaren Mischung von Festigkeit und Apathie an, welche Sœur Marie Thérèse vorhin in Harnisch gebracht hat.
»Nein, daran erinnere ich mich nicht«, gibt sie zur Antwort und lässt ihren Blick nicht fallen.
»Macht nichts«, lächelt Pomian. »Dann will ich es dir und den andern sagen. Am sechsten Januar feiern wir das Dreikönigsfest. Da bringen die Heiligen Drei Könige aus Morgenland wunderbare Geschenke dem Christkind in den Stall von Bethlehem. Gold und Purpur und Weihrauch. Hast du die Krippe in der Kirche gesehen, Bernadette, wo auch die Heiligen Drei Könige abgebildet sind?«
Bernadette Soubirous wird lebhaft. Eine leichte Röte fliegt ihr übers Gesicht.
»O ja, die Krippe habe ich gesehen«, ruft sie entzückt. »All die schönen Figuren, und ganz wie wirkliche Leute, die Heilige Familie und der Ochs und der Esel und die drei Könige mit Krönchen und goldenen Stecken, o ja, die habe ich gesehen …« Die großen Augen des Mädchens werden selbst ganz golden von der Kraft des Bildes, das es in sich wachruft.
»Somit wüssten wir also etwas über die Heiligen Drei Könige … Merk dir’s, Bernadette, und nimm dich zusammen, denn du bist schon eine erwachsene Person.«
Abbé Pomian zwinkert der Lehrerin listig zu, hat er ihr doch eine Unterweisung in der rechten Pädagogik erteilt. Dann wendet er sich zur ganzen Klasse:
»Der siebente Januar ist ein wichtiger Festtag für Frankreich. Da wurde jemand geboren, der das Vaterland aus der tiefsten Schande gerettet hat. Das geschah genau vor 446 Jahren. Denkt nach, Kinder, ehe ihr antwortet!«
Sofort triumphiert irgendwo eine schrille Stimme:
»Der Kaiser Napoleon Bonaparte!«
Sœur Marie Thérèse Vauzous presst die Hände gegen ihren Unterleib, als sei sie das Opfer einer jähen Kolik. Einige Mädchen meinen, es sei nun eine gute Gelegenheit herauszuwiehern wie die Wilden. Der Abbé aber bewahrt seinen heiteren Ernst:
»Nein, liebe Kinder, der Kaiser Napoleon Bonaparte wurde viel, viel später geboren …«
Und er geht zur Tafel und schreibt mit großen Fibelbuchstaben, denn viele der Mädchen sind noch nicht über die Anfangsgründe des Lesens und Schreibens hinaus:
»Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans, geboren am 7. Januar 1412 in Domrémy.«
Während der Chor der Schülerinnen in dumpfem Durcheinander diese Schrift zu entziffern beginnt, läutet die Schulglocke. Es ist elf Uhr. Bernadette Soubirous steht noch immer vor der ersten Bankreihe im leeren Raum der Prüfung. Die Nonne Marie Thérèse Vauzous richtet sich hoch auf. Ihr stolzes Gesicht wirkt im matten Februarlicht sehr leidend:
»Durch dich sind wir im Katechismus nicht weitergekommen, liebe Soubirous«, sagt sie sehr leise, so dass nur Bernadette sie hören kann. »Überleg’s dir einmal, ob du das wert bist …«
Kapitel Vier. Café Progrès
Auf dem Stadtplatz Marcadale, wo zumeist sich das öffentliche Leben von Lourdes abspielt, liegt zwischen den beiden großen Speisehäusern das Café Français. Es ist nicht weit entfernt von der Haltestelle der Postomnibusse, von dem wichtigsten Einfallspunkt der großen Welt in die kleine Welt des Pyrenäenstädtchens. Der Cafétier, Monsieur Duran, hat unter erheblichem Kostenaufwand das Lokal im vorigen Jahre neu eingerichtet. Roter Plüsch, Marmortische, Spiegelscheiben, ein riesiger Kachelofen, der einem zinnengekrönten römischen Wachtturm gleicht. Dank dieser Festung von einem Ofen ist das Café Français der bestgeheizte Raum von Lourdes. Herr Duran aber sorgt nicht nur für Wärme, er sorgt auch für Licht. Er hat eine neuartige Form der Beleuchtung eingeführt. Starke, grünbeschirmte, dauerhaft strahlende Petroleumlampen, die, an waageförmigen Stangen befestigt, von der Decke herabhängen und ihren weißlich heimeligen Schein über die Marmortische gießen. Der Cafétier ist überzeugt davon, dass in dem neuerungstollen Paris, das jeder modernen Erfindung atemlos nachläuft, nur sehr wenige Gaststätten mit solchem Lichte gesegnet sind. Duran ist im Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute kein besonders sparsamer Mann. Er lässt sein Licht auch am Tage leuchten, wenn es nötig ist, wie zum Beispiel heute, da die Winterdämmerung nicht weichen will. Er geht in seiner Großmut noch weiter. Nicht beim materiellen Lichte lässt er es bewenden. Er ist bestrebt, geistiges Licht zu verbreiten. Zu diesem Zwecke hängen an den Kleiderrechen, wohleingerahmt, eine Menge der großen Pariser Zeitungen, deren Abonnementsspesen der Inhaber des Café Français nicht scheut. »Le Siècle« ist vorhanden, »L’Ère Impériale«, »Le Journal des Débats«, »La Revue des Deux Mondes«, »La Petite République«. Jawohl, auch diese »Petite République«, ein höchst revolutionäres Blatt, gegen den Kaiser und seine Regierung gerichtet, eine kampflustige Gazette, hinter der, wie jedermann weiß, Louis Blanc in Person steht, der sozialistische Gottseibeiuns. Dass »Le Lavedan«, das Wochenblatt von Lourdes, aufliegt, muss nicht eigens erwähnt werden. Die Redaktion hat mit Herrn Duran ein beiderseits günstiges Abkommen getroffen, demzufolge jeden Donnerstag vier Exemplare des frischen »Lavedan« auf den Marmortischen zu liegen haben. Im Hinblick auf all diese Bemühungen um die geistige Verpflegung seines Gästekreises ist es zu verstehen, dass Durans ehrgeiziges Café Français von manchen Leuten auch »Café Progrès« genannt wird.
Zweimal des Tages hat das Lokal ganz großen Zuspruch. Das ist um elf Uhr herum, zur Stunde des Apéritifs, und dann am Nachmittag um vier, wenn die Büros des Landgerichtes schließen. Die Beamten dieser Behörde sind treue Stammgäste des Café Français. Der französische Staat verfolgt bei der Dislozierung seiner Ämter ein eigensinniges Prinzip. Die Préfecture des Départements befindet sich in Tarbes. Demgemäß sollte die Sous-Préfecture in der nächstwichtigen Kantonalstadt ihren Sitz haben, in Lourdes. Aber nein, diese hohe Behörde ist in dem winzigen Argelès untergebracht, wo sie und das Oberkommando der Gendarmerie vom Blutkreislauf der Verwaltung so ziemlich abgeschlossen sind. Der Grund für diese Verbannung bleibt unerfindlich. Lourdes ist darüber mit Recht gekränkt. Lourdes muss besänftigt werden. Man macht es also zum Sitz einer hohen Gerichtsinstanz, die von Rechts wegen nach Tarbes gehört. So kommt es, dass Monsieur Duran zu seinen Gästen zählt Pougat, einen regelrechten Landgerichtspräsidenten, mehrere Richter, den kaiserlichen Staatsanwalt Dutour, eine Anzahl von Verwaltungsbeamten, Rechtsanwälten und Gerichtsschreibern.
Zur Stunde ist noch keiner dieser Herren erschienen. Am runden Tisch in der Ecke sitzt Monsieur Hyacinthe de Lafite allein. Monsieur de Lafite ist nicht Monsieur de Lafite in Person, sondern ein unbegüterter Vetter des reichen Mannes. Ihm ist ein Turmzimmer im Château eingeräumt, das zu beziehen ihm freisteht. Die Familie de Lafite ist sehr oft auf Reisen. Umso mehr macht in letzter Zeit Herr Hyacinthe von seiner Zuflucht Gebrauch. Dieses Lourdes ist für einen leeren Beutel die reinste Klinik, und Paris, das nicht unterscheiden kann zwischen echt und unecht, möge der Teufel holen! Wer kann in Paris arbeiten? Journalisten, Huren und Seelenverkäufer.
Man sieht Hyacinthe de Lafite auf den ersten Blick an, dass etwas Besonderes in ihm steckt. Er trägt sich mit einem Stich ins Altväterische. Die üppig geschlungene Plastronkrawatte zum Beispiel erinnert an Alfred de Musset. Das aus der abgeeckten Stirn zurückgestrichene Haar erinnert an Victor Hugo. Obwohl de Lafite das vierzigste Jahr noch lange nicht erreicht hat, ist dieses Haar schon grau meliert. Man war einmal fast befreundet mit Victor Hugo, das heißt, dieser Gigant hat sich vor langen Jahren einmal zu einer angenehmen Bemerkung über de Lafite herabgelassen. Man hat damals mitgewirkt in der Hernani-Schlacht der Comédie Française. Man hat zu jenen Auserwählten gehört, die rote Westen trugen. Man kennt übrigens außer Hugo, der längst im Exil ist, auch noch den alten Lamartine und den jungen Théophile Gautier und viele andere und will nichts mehr wissen von dieser ganzen überheblichen Gesellschaft.
Lourdes scheint der rechte Ort zu sein, um an den Busen einer etwas gewalttätigen Natur zu flüchten und, unbekümmert um die verletzenden Wertungen der Pariser Salons und Cafés, ein langatmiges Werk zu frönen. Hyacinthe de Lafite wälzt in seinem Haupte den tollkühnen Plan, die romantische Schule, der er sich selbst zugehörig fühlt, mit dem Klassizismus zu versöhnen. Unbegrenzte Phantasie in strenger Form, das ist seine Parole. Er arbeitet an einer Tragödie »Die Gründung von Tarbes«. Den Stoff verdankt er seinem Freunde, dem Schuldirektor Clarens, der ein emsiger Sagenforscher ist und im »Lavedan« die Rubrik »Loredanische Altertümer« redigiert. Es handelt sich in den genannten Werken um eine äthiopische Königin namens Tarbis, die zu einem biblischen Helden in Liebe erglüht, von diesem abgewiesen wird und nach Westen in die Länder der Pyrenäen flüchtet, um ihren Schmerz zu vergessen. Hier kommt sie, befreit von den düsteren Göttern des Orients, in Berührung mit den heiteren Gottheiten des Abendlands, die ihr die Qual vom Herzen zaubern. Als ihre Priesterin erbaut sie Tarbes.
Kein schlechter Stoff, wie man sieht, und voll von sinnbildlichen Anspielungen. Der Dichter schreibt ihn in puren Alexandrinern, eine verwegene Kampfansage gegen den Shakespearismus Victor Hugos. Auch ist er eisern entschlossen, als Nachfahre Racines, an der dramatischen Einheit von Ort und Zeit festzuhalten. Bedauernswert ist es nur, dass er nach mehr als zweijähriger Arbeit über das vierzigste Alexandrinerpaar noch nicht hinausgekommen ist. Hingegen bringt der heutige »Lavedan« einen Artikel von ihm, in dem er seine literarischen Stilprinzipien darlegt. Die Redaktion hatte sich lange gewehrt, diesen Artikel zu veröffentlichen, indem sie ins Treffen führte: »Das ist nichts für unsere Analphabeten.«
Der »Lavedan« liegt vor Lafite auf dem Tisch. Er ist heute Morgen pünktlich erschienen. Das geschieht nicht allzu häufig. Meist erscheint dieses fortschrittliche Wochenblatt zwei und drei Tage nach dem festgesetzten Termin. Abbé Pomian pflegt deshalb zu sagen: »Ein merkwürdiger Fortschritt das, der immer zu spät kommt.«
Der befreundete Gegner Victor Hugos brennt darauf, dass sein Artikel gelesen werde. Insbesondere ist ihm daran gelegen, dass der Philolog und Humanist Clarens sich ehemöglichst in ihn vertiefe. Es stehen drei Sätze über Racine darin, die man auf der Zunge zergehen lassen muss. Clarens aber, der soeben auftaucht, ist so tief in seine eigene fixe Idee verfangen, dass er dem neuen »Lavedan« und dem Autor Lafite keine Aufmerksamkeit zollt. Es ist die alte Tragik solcher schöngeistigen Beziehungen. Der Gelehrte hat einen tellergroßen, abgeplatteten Stein mitgeschleppt, den er jetzt vorsichtig aus einem Tuch knüpft. Eigensüchtig schiebt er ihn dem Schriftsteller unter die Augen und drängt ihm eine Lupe auf:
»Da sehen Sie nur, mein Freund, was ich für einen Fund gemacht habe. Raten Sie, wo? Ah, Sie werden es nicht erraten. Auf dem Spelunkenberg, in einer der Grotten, mitten unter dem Geröll lag dieser Stein und hat mich geradezu angerufen. Betrachten Sie ihn gut! Mit der Lupe! Sie erkennen das Stadtwappen von Lourdes, nicht wahr! Es unterscheidet sich im Stil wesentlich von der heutigen Form. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es auf das frühe sechzehnte Jahrhundert zurückgeht. Über den Türmen der Burg schwebt der Adler mit dem Fisch im Schnabel. Die Türme aber zeigen, anders wie im gegenwärtigen Wappen, die reinste maurische Architektur. Mirambelle – ich brauche Sie nicht zu belehren – war der mittelalterliche Name unsrer Stadt. Miriam-Bell. Miriam ist die maurische Form von Maria. Die Forelle, die der Adler im Schnabel trägt, ist nichts andres als Ichthys, das Christuszeichen, das über die frisch für Maria eroberte Burg abgeworfen wird. Sie sehen wie überall im Lande das marianische Prinzip …«
Lafite unterbricht ihn, weil er sich ärgert, aus blankem Widerspruchsgeist:
»Ich bin durchaus nicht Ihrer Ansicht, mein Freund. Meines Dafürhaltens gehen alle diese heraldischen Tiersymbole auf vorchristliche Zeiten zurück.«
»Aber Sie werden doch nicht leugnen, mein Freund«, wendet der alte Clarens ein, »dass selbst der Gave in seinem Namen ein Ave umschließt.«
Der Dichter leugnet es rundweg. Wie alle Geister seiner Art lässt er sich von der Improvisation auf einen ihn selbst überraschenden Weg verlocken, nur um recht bald an das Ziel zu gelangen, das einzig ihn beschäftigt:
»Als Philologe wissen Sie besser als ich, mein Freund, dass der Buchstabe Gamma in manchen Sprachen zum Jota hinüber metastasiert und umgekehrt. Warum soll der Gave nicht nach dem biblischen Jahwe benannt sein, den meine Königin Tarbis nach ihrer unglücklichen Erfahrung mit dem Hebräer ins Land gebracht hat? Wenn Sie mein Werk lesen oder zumindest den heutigen Aufsatz …«
Weiter kommt er nicht. Das feinsinnige Gespräch muss abgebrochen werden. Es hat elf geschlagen. Die Stunde des Apéritifs ist da. Nacheinander erscheinen sie alle, die zur Intelligenz und Notabilität von Lourdes gehören. Unterhaltungen freilich wie die soeben stattgehabte kann man mit all diesen Anwälten, Offizieren, Beamten, Ärzten nicht führen. Ihr Sinn ist dem nutzfreien Humanismus nicht gerade hold. Zuerst kommt Doktor Dozous, der Stadtarzt, eine vielbeschäftigte Seele. Immer auf dem Sprung, immer zwischen zwei ›Fällen‹, die seiner bedürfen, lässt er sich’s zu dieser Stunde nicht nehmen, unter anderen angesehenen Männern ein Glas Portwein oder Malvasier zu leeren. Es gibt Ärzte genug in Lourdes. Da ist der Doktor Peyrus, der Doktor Vergez, der Doktor Lacrampe, der Doktor Balencie. Dennoch ist der Stadtarzt Dozous überzeugt davon, dass die ganze Last der hiesigen medizinischen Wissenschaft auf seinen etwas zu hohen Schultern liegt. Noch nicht ist erloschen in seiner Seele die leidenschaftliche Neugier des Naturforschers. Deshalb unterhält er neben seinem vollgemessenen Tagespensum eine rege ärztliche Korrespondenz, um in der Provinz nicht wissenschaftlich zu verbauern. Wie mag der große Charcot, wie der berühmte Voisin, Leiter der Salpêtrière in Paris, erschrecken, wenn er einen der langen Briefe des Stadtarztes von Lourdes unter seiner Post findet, diese wissbegierigen Fragebogen, die zu beantworten eine gute Stunde fordert.
»Ich werde die Herren nur drei Minuten stören«, sagt Dozous. Es ist sein täglicher Gruß. Er nimmt auf dem Rande eines Sessels Platz, ohne Hut und Mantel abzulegen, was im Hinblick auf den Feuerofen Durans und die prophylaktische Praxis ein bemerkenswerter Fehlgriff ist. Jetzt greift er nach dem ›Lavedan‹, schiebt die Brille in die Stirn und beginnt das Blättchen durchzuschmökern. Wie sehr sich Hyacinthe de Lafite auch in den Anblick des Lesenden vertieft, er nimmt auf der Miene des Doktors kein günstiges Anzeichen wahr, dass sein Artikel bemerkt wird. Inzwischen ist Monsieur Jean Baptiste Estrade, der Steuerverwalter von Lourdes, zu dem Tisch gestoßen. Dieser Mann mit dem dunklen Spitzbart und dem schwermütigen Blick besitzt in den Augen des Schriftstellers einige Vorzüge. Er redet wenig, aber hört vortrefflich. Er scheint geistigen Erkenntnissen und Formulierungen nicht ganz verschlossen zu sein. Der Arzt hat gleichgültig die Zeitschrift dem Steuerverwalter in die Hand gespielt. Nun blättert Estrade sie mit zerstreuten Fingern durch. Als er gerade die Seite erreicht hat, wo Lafites Aufsatz prangt, muss er aber den ›Lavedan‹ hinlegen, denn alle Herren erheben sich. Es geschieht nicht alle Tage, dass der Herr Bürgermeister in Person die Tafelrunde beehrt.
Die gewichtige Figur A. Lacadés schiebt sich, nach allen Seiten grüßend, leutselig heran. Man sieht es dem Maire von Lourdes an, dass er die längste Zeit seines Lebens nicht mit Unrecht der ›schöne Lacadé‹ hieß. Angesichts seines Bauches, der Backentaschen und Augensäcke kann niemand mehr von Schönheit sprechen, dafür umso nachdrücklicher von einer gut geölten, ja geschmeidigen Würde, wie sie bei politisch begabten Korpulenten nicht selten ist. Er hat sich, obwohl aus der engsten bäuerlichen Armut des Landes Bigorre stammend, glänzend in seine öffentliche Rolle eingelebt. Als er das erste Mal zum Bürgermeister von Lourdes gewählt wurde, das war um 1848 herum, sagten ihm böse Zungen nach, er sei ein ausgemachter Jakobiner. Heute ist er ein bewährter Anhänger des kaiserlichen Regimes. Wer ändert seine Anschauungen nicht mit der reifenden Zeit? Lacadé geht immer schwarz gekleidet, als sei er unablässig bereit, sich von seinen zeremoniellen Pflichten überraschen zu lassen. Er hat weite, fast majestätische Bewegungen. Seine Stimme ist herablassend. Wenn er spricht, so scheint es stets, dass er anspricht. Auch die beiden staatlichen Funktionäre, die mit ihm eingetreten sind, begönnert er. Dies ist Vital Dutour, Procureur Impérial, ziemlich jung, glatzköpfig, ehrgeizig und zu Tode gelangweilt. Der andere ist der Polizeikommissär Jacomet, ein Mann Anfang Vierzig, mit schweren Händen und jenem unheilverkündenden Blick, der nun einmal auch bei harmlosen Leuten zum Kriminalistenberuf gehört.
Der Bürgermeister schüttelt allen die Hände, lässt seine Jovialität spielen. Der Cafétier Duran stürzt herbei, nimmt die Bestellungen entgegen und bringt nach einer Weile das Tablett mit den Getränken eigenhändig:
»Ah, Messieurs! Leider sind die Zeitungen aus Paris heute nicht eingetroffen! Welch ein Kreuz mit unserer Post!«
»Bah, die Pariser Zeitungen«, spottet jemand. »Im Februar ist die Politik ebenso finster wie das Wetter …«
Der kleine Duran beeilt sich zu versichern:
»Wenn aber die Herren die gestrige Nummer des ›Mémorial des Pyrénées‹ oder den ›Intéret Public‹ von Tarbes zu sehen wünschen … Und ›Le Lavedan‹ ist erschienen, pünktlich, liegt auf …« Er neigt sich ein wenig zu Lacadés Ohr:
»Und ein Artikelchen ist drin, Monsieur le Maire, ein feines, sauberes Stück Arbeit …«
Lafite horcht auf. Der Cafétier spitzt genussvoll die Lippen:
»Das Artikelchen werden sich die diversen Soutanen hier nicht hinter den Spiegel stecken … Noch einen Malvasier, Monsieur le Maire?«
Lacadé erhebt einen seherischen Blick und eine füllige Stimme:
»Ich kann Ihnen und uns allen eine bessere Post versprechen, mein lieber Duran. Großes wird für unser armes Lourdes geschehen. Auf meine unaufhörlichen Vorstellungen hin erwägt man hohen Ortes einen Anschluss an das Netz der Eisenbahn … Ich hoffe, die Herren sind alle Lokalpatrioten, gleich mir. Nicht wahr, Monsieur le Procureur?«
Vital Dutour erwidert mit trockener Höflichkeit:
»Wir vom Gericht sind wie die Vagabunden. Heute sind wir hier, morgen versetzt man uns anderswohin. Unser Lokalpatriotismus kann nicht recht warm werden …«
»Gleichviel, der Bahnanschluss kommt«, weissagt Lacadé.
Das Gesicht Durans leuchtet auf. Ihm fällt eine der goldenen Wortprägungen ein, die er in der Zeitung gelesen hat. Da er so viel Geld für sie ausgibt, fühlt sich der Cafétier auch verpflichtet, all diese Blätter bis in die Nacht hinein zu studieren. Ein mühsames Werk, das den ungeübten Augen schadet, der gebildeten Ausdrucksweise aber förderlich ist. Er spricht:
»Verkehrsmittel und Schulbildung, das sind die beiden Grundpfeiler der sich höher entwickelnden Menschheit …«
»Bravo, Duran«, nickt Lacadé. »Besonders das mit den Verkehrsmitteln! Schau einmal an, da liefert mir dieser alte Kellner eine tadellose Wendung für eine Festrede. Ich muss sie mir merken.« Das Lob des Bürgermeisters beflügelt Duran. Er hebt etwas steif die rechte Hand, wie es Dilettanten tun, die Theater spielen:
»Wenn die Entfernung zwischen den Menschen geringer, ihr Wortschatz aber größer sein wird, dann schwinden Aberglauben, Fanatismus, Intoleranz, Krieg und Tyrannei, dann wird vielleicht schon die nächste Generation oder spätestens das nächste Jahrhundert Zeuge des Goldenen Zeitalters sein …«
»Woher haben Sie das, mein Freund?« staunt Lacadé misstrauisch.
»Das ist halt so meine bescheidene Ansicht, Monsieur le Maire …«
»Ich schätze weder die Verkehrsmittel noch auch die Schulbildung so hoch ein wie Freund Duran«, sagt plötzlich Lafite, der seine Missstimmung kaum beherrschen kann.
»Oho«, lacht Dutour. »Ein Dichter aus Paris wird doch kein Reaktionär sein.«
»Ich bin weder Reaktionär noch Revolutionär. Ich bin ein unabhängiger Geist. Als solcher aber sehe ich in der Höherentwicklung der breiten Massen durchaus nicht den Sinn der Menschheit.«
»Vorsichtig, mein Freund, vorsichtig«, mahnt der Humanist Clarens.
»Und was wäre dieser Sinn?« fragt J. B. Estrade nachdenklich vor sich hin. Hyacinthe de Lafite nimmt mit grundloser, aber fühlbarer Erbitterung das Wort:
»Wenn die Menschheit überhaupt einen Zweck besitzt, so nur diesen einzigen, das Genie hervorzubringen, das außerordentliche Wesen. Dies ist meine Überzeugung. Die Massen mögen leben, leiden und sterben dafür, dass von Zeit zu Zeit ein Homer entstehe, ein Raffael, ein Voltaire, ein Rossini, ein Chateaubriand und meinetwegen ein Victor Hugo …«
»Traurig«, sagt Estrade, »traurig für uns andere unbedeutende Erdenwürmer, gar nichts Besseres sein zu dürfen als der schmerzhafte Umweg zu diesen glänzenden Resultaten …«
»Es ist die Philosophie eines Dichters«, erklärt Lacadé nachsichtig und unaufmerksam. »Da wir aber einen Dichter in unserer Stadt haben, so sollte er etwas für Lourdes tun. Auf, Herr de Lafite, schreiben Sie in der Pariser Presse, schreiben Sie über unsre Naturschönheiten, über unsre Aussichtspunkte, über die Pibeste, den Pic de Ger und den überwältigenden Anblick der Pyrenäen. Schreiben Sie über die städtischen Einrichtungen, über das trauliche Leben, das unser feuriges Völkchen in all seiner Bedürfnislosigkeit führt. Schreiben Sie über dieses prächtige Café Français! Schreiben Sie über was Sie wollen! Rufen Sie aber Paris und damit der ganzen Welt zu: Warum lasset ihr Hochmütigen Lourdes beiseite liegen, wenn ihr nach Cauterets und Gavarnie in die Bäder fahrt? Auch wir sind bereit, euch würdig zu empfangen mit guten Unterkünften und erstklassiger Küche … Ich frage mich übrigens sehr lange Zeit schon, meine Herren, warum Cauterets und Gavarnie, diese elenden Nester, bevorzugt sein sollen? Die Thermalbäder? Die Mineralquellen? Nun, wenn es einige Meilen von uns, in Gavarnie und Cauterets, Heilquellen gibt, warum dann nicht in Lourdes? Es ist ein einfaches Rechenexempel. Wir müssen nur diese Heilquellen entdecken. Wir müssen sie nur aus dem Felsen schlagen. Jawohl, das ist meine feste Absicht! Ich habe schon mehrere Relationen an Baron Massy, den Präfekten, abgesandt. Bessere Straßen, bessere Post, höhere Aufwendungen. Wir werden den Strom des Geldes und der Zivilisation nach Lourdes leiten …«
Der Bürgermeister hat zum Apéritif eine glänzende Rede gehalten, das muss er sich selbst zugestehen. Die pathetische Wärme, die ihn erfüllt, gibt ihm das Bewusstsein, ein Stadtvater sondergleichen zu sein. Wie verwaist wird Lourdes nach seinem Tode dastehen! Er schlürft zufrieden die Neige seines Malvasiers. Knapp danach bricht man auf. Die Frauen warten daheim mit dem Déjeuner.
In seine Pelerine gewickelt, geht Hyacinthe de Lafite einsam die Rue Basse entlang. Ihn durchdringt keine pathetische Wärme, sondern schneidende Kälte außen und innen. Plötzlich bleibt er stehen und starrt die schmutzigen Häuser an, die seinen trostlosen Blick trostlos erwidern. Zum Teufel, was suche ich hier? Auf den Boulevard des Italiens gehöre ich und in die Rue du Faubourg Saint Honoré. Warum lebe ich in diesem dreckigen Nest? Während er weitergeht, gibt er sich die Antwort: Ich lebe in diesem dreckigen Nest, weil ich selbst ein dreckiger Hund bin, dem man einen Knochen zuwirft, der arme Verwandte, der für die Mildherzigkeit dieser aufgeblasenen Provinzfamilie dankbar zu sein hat. Ich habe ein warmes Zimmer und ausgezeichnetes Futter und kann am Tag kaum fünf Sous anbringen. Mein Umgang sind die kleinen Leute des Café Français, für die ich ein verschlossenes Buch bin. Nicht zu Gott gehöre ich und nicht zu den Menschen. Wahrhaftig, der höhere Geist ist in dieser Welt der arme Verwandte par excellence.
Kapitel Fünf. Kein Reisig mehr
Noch ehe Bernadette und Marie aus der Schule heimgekommen sind, tauchen die beiden Kleinen im Cachot zum Mittagessen auf. Das ältere der Brüderchen, Jean Marie, macht ein verwegen schlaues Gesicht, als hätte er ein Abenteuer siegreich bestanden. Das hat er auch. Nach der letzten Vormittagsmesse, die der Dechant Peyramale meist selbst zu lesen pflegt, ist die Pfarrkirche fast immer menschenleer. Um diese Zeit schlich sich der siebenjährige Jean Marie in die kleine Seitennische, wo das Madonnenbild steht, das in Lourdes von den Frauen sehr verehrt wird. Dort brennen auf einem eisernen Rost vor der Muttergottes viele geweihte Kerzen. Jean Marie hat ein paar Klumpen des geschmolzenen Wachses zusammengekratzt und bringt sie nun treuherzig der Mutter nach Hause:
»Maman, mach Lichter draus … Oder vielleicht kannst du auch damit kochen, ich hab’s gekostet …«
»Praoubo de jou«, ruft die Soubirous, »ich arme Frau …«