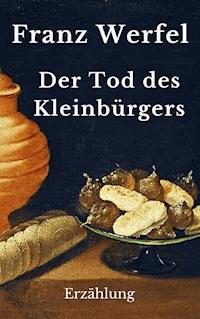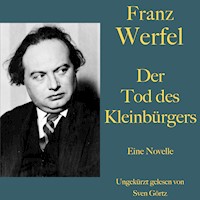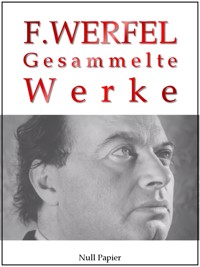
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Werfels Popularität beruhte vor allem auf seinen erzählenden Werken und Theaterstücken, über die er selbst aber seine Lyrik setzte. Mit seiner Schrift »Verdi. Roman der Oper« (1924) wurde Werfel zu einem Auslöser der deutschen Verdi-Renaissance. Neben seinen Lyrik-Bänden und seinen Novellen dürfte der zur Zeit der Veröffentlichung äußerst umstrittene Roman »Die vierzig Tage des Musa Dagh« über den Völkermord an den Armeniern sein bekanntestes Werk sein. - Stern der Ungeborenen - Der veruntreute Himmel - Die Geschwister von Neapel - Die vierzig Tage des Musa Dagh - Verdi - Das Lied von Bernadette - Der Abituriententag - Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig - Eine blaßblaue Frauenschrift - Das Trauerhaus - Die Entfremdung - Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick - Der Tod des Kleinbürgers - Die wahre Geschichte vom wiederhergestellten Kreuz - Geheimnis eines Menschen - Géza de Varsany - Kleine Verhältnisse - Weißenstein, der Weltverbesserer - Ballade von Wahn und Tod - Jacobowsky und der Oberst Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 6387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Werfel
Franz Werfel
Gesammelte Werke
Franz Werfel
Franz Werfel
Gesammelte Werke
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Jürgen Schulze 2. Auflage, ISBN 978-3-954187-73-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Franz Werfel
Romane
Stern der Ungeborenen
Der veruntreute Himmel
Die Geschwister von Neapel
Die vierzig Tage des Musa Dagh
Verdi
Das Lied von Bernadette
Der Abituriententag
Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig
Eine blaßblaue Frauenschrift
Novellen
Das Trauerhaus
Die Entfremdung
Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick
Der Tod des Kleinbürgers
Die wahre Geschichte vom wiederhergestellten Kreuz
Geheimnis eines Menschen
Géza de Varsany
Kleine Verhältnisse
Weißenstein, der Weltverbesserer
Lyrik
Ballade von Wahn und Tod
Ballade von einer Schuld
Ballade von Nachtwandel
Ballade von zwei Türen
Kleine Ballade an die Schwester
Gesang der Memnons-Säule
Novembergesang
Dezembergesang
Fragment der Eurydike
Der Ruf
Verlust
Vergessen
An eine Lerche
Trinklied
Der Gerichtsherr
Der Tempel
Das Gebet Mosis
Absalom
Eintritt
Das Café der Leeren
Die Leidenschaftlichen
Engel
Antlitz vorüberwehend
Die Schwestern von Bozen
Frauen
Verwundeter Storch
Gesang des Traumbergs
Gesang von Gefangenen
Gärtner und Tor
Gewaltige Mutter
Gedächtnis der Sünde
Gesang eines verdammten an die seligen Geprüften der Erde
Gesang einer Frau
Anblick der Wahrheit
Lied
Nun ist in mir ein Tod
Gesang
Lied nach einem Tage
Benennung
Auch ich einfach
Das letzte Wort
Ehrgeiz
Eitelkeit
Faulheit
Zweifel
Schein
Trägheit des Herzens
Schuld
Spur
Spiegel
Morpheus senex
Tiefes Erwachen
Schauder
Vision
Müdigkeit
Vergängnis
Notwendigkeit
Verheissung
Völker
Geistige Freude
Schönheit
Phänomen
Prooemium
Der Vorwurf
Warnung und Lehre
Der Mächtige
Der Nichtige
Der Fluch
Das Unrechte
All-Wirkung
Weiß und schwarz
Unmut
Unwandelbar
Schicksal
Die Feuerpaten
Die Meister
An die Sibylle Mara
Dämonen
Die Lerche
Die Vollkommenen
Lobpreisung
Die Widersacher
An die Dichter
Geheimnis
Unwichtig
Was ein jeder sogleich nachsprechen soll
Mein eigener Henker bin ich
Sein und Treiben
Gestörtes Gleichgewicht ist die Welt
Der weinende Zerstörer
Liebe
Der reine Mensch
Stufenleiter
Vorspruch
Erwachen
Zerfall
Aus meiner Tiefe
An den Richter
Gebet um Reinheit
Gebet gegen Worte
Pfingstelegie
Einem Denker
Gebet
Der Feind
Hölle
Verwüstung
Trübsinn
Gesetz des Bogens
Schrei
Bekenntnis
Die Vermaledeiung der Erde
Verfluchung
Der Dichter
Der Ritt
Wir nicht
Geburt
Gesang der Begrabenen
Das Licht und das Schweigen
Ein Gesang von Toten
Widmung
Die Unverlassene
Die Alternde
Als mich dein Wandeln an den Tod verzückte
Die Stimme der Geliebten
Noch tanzet Bronislawa
Einer Chansonette
Ahnung Beatricens
Ein Sonntags-Lied
Das Unvergängliche
Lesbierinnen
Drama
Jacobowsky und der Oberst
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Franz Werfel
Franz Viktor Werfel (1890-1945) war ein österreichischer Schriftsteller jüdischer Herkunft. Neben seinen Lyrik-Bänden und seinen Novellen dürfte der zur Zeit der Veröffentlichung äußerst umstrittene Roman »Die vierzig Tage des Musa Dagh« über den Völkermord an den Armeniern sein bekanntestes Werk sein.
Er wurde 1890 in Prag als Sohn eines wohlhabenden Handschuhfabrikanten geboren. Die Familie gehörte dem deutsch-böhmischen Judentum an.
Bereits 1908 erfolgten erste Gedicht-Veröffentlichungen. Von 1912 bis 1915 war er Lektor beim Kurt Wolff Verlag in Leipzig. Während des Ersten Weltkrieges kämpfte er an der ostgalizischen Front, 1917 wurde er ins Wiener Kriegspressequartier versetzt.
Werfel war ein Wortführer des lyrischen Expressionismus. In den 1920er und -30er Jahren avancierte er zu einem der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren. Er traf Rainer Maria Rilke und befreundete sich mit Karl Kraus, mit dem er sich später überwarf. Werfel pflegte auch enge Kontakte zu den Schriftstellern Max Brod, Franz Kafka und Willy Haas.
Werfels Popularität beruhte vor allem auf seinen erzählenden Werken und Theaterstücken, über die er selbst aber seine Lyrik setzte. Mit seiner Schrift »Verdi. Roman der Oper« (1924) wurde Werfel zu einem Auslöser der deutschen Verdi-Renaissance.
Viele Jahre lebte der Autor in Wien und schloss dort Bekanntschaft mit Alma Mahler, der Witwe von Gustav Mahler, die damals noch mit Walter Gropius verheiratet war. Noch während ihrer Ehe mit Gropius brachte Alma Mahler den mutmaßlichen Sohn Werfels (Martin Carl Johannes) zur Welt, der aber bereits ein Jahr später starb. 1929, neun Jahre nach der Scheidung von Gropius, heirateten Franz Werfel und Alma Mahler
Werfel wurde 1934 aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen, dies geschah auf Betreiben Gottfried Benns. Ursache dafür war Werfels Roman »Die vierzig Tage des Musa Dagh«, der 1934 mit Hinweis auf die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verboten wurde.
Werfel floh vor der nationalsozialistischen Herrschaft. Wie viele schreibende Zeitgenossen aus dem deutschsprachigen Raum (Zweig, Roth, Mann) landete Werfel über mehre Stationen in der Diaspora: 1938 emigrierte er nach Frankreich, 1940 über Spanien in die USA. 1941 wurde Werfel amerikanischer Staatsbürger. Seine letzten Jahre verbrachte er in Hollywood, wo 1943 sein Roman »Das Lied von Bernadette« mit großem Erfolg verfilmt wurde.
Romane
Stern der Ungeborenen
Ein Reiseroman
1946
Erstes Kapitel
Worin sich ein Vorwort verbirgt, das, wie so oft, nur eine Ausrede ist.
Dies hier ist ein erstes Kapitel, welches verhindern soll, daß vorliegendes Werkchen mit einem Zweiten Kapitel beginne. Dem Entschlusse, auf das Anfangsblatt eines Romans setzen zu lassen: »Zweites Kapitel« stand nichts andres im Wege als der Ordnungssinn des Verlegers, die bekannte Entdeckerlust des lesenden Publikums an faustdicken Druckfehlern und endlich die Originalitätssucht des Verfassers, der befürchtete, irgendein Kollege aus der foppfreudigen Epoche der Romantik habe gewiß schon einmal eines seiner verwilderten Werke mit dem Zweiten Kapitel eröffnet. Fangen wir darum mit dem Ersten Kapitel an, so überflüssig dasselbe für den Gang der Handlung oder, genauer gesagt, Forschung auch sein mag. Da es sich um eine Art von Reisebericht handelt, fühle ich die Verpflichtung, den Helden, oder bescheidener, den Mittelpunkt der hier geschilderten Begebenheiten vorzustellen. Es ist einmal die Schwäche dieser literarischen Form, daß ihr das Auge, das sieht, das Ohr, das hört, der Geist, der begreift, die Stimme, die berichtet, das Ich, das in viele Abenteuer verwickelt wird, den Mittelpunkt bilden, um den sich alles im wörtlichen Sinne »dreht«. Dieser Mittelpunkt, der aufrichtigerweise F.W. benannt ist, bin leider ich selbst. Ich hätte es aus angeborener Unlust, in Schwierigkeiten zu geraten, lieber vermieden, auf diesen Blättern ich selbst zu sein, aber es war nicht nur der natürliche, sondern der einzige Weg, und ich konnte leider keinen »Er« finden, der mir zulänglicherweise die Last des »Ich« abgenommen hätte. So ist also das Ich in dieser Geschichte ebensowenig ein trügerisches, romanhaftes, angenommenes, fiktives Ich wie diese Geschichte selbst eine bloße Ausgeburt spekulierender Einbildungskraft ist. Sie hat sich mir, wie ich gestehen muß, wider Willen begeben. Ohne vorher im geringsten benachrichtigt oder ausgerüstet zu sein, wurde ich, gegen alle sonstige Gepflogenheit als Forschungsreisender ausgesandt, eines Nachts. Was ich erlebte, habe ich wirklich erlebt. Ich bin gerne bereit, mit jedem philosophisch gewandten Leser eine ehrliche Diskussion über dieses Wörtchen »wirklich« abzuführen, und ich maße mir an, auf jeden Fall recht zu behalten.
Während ich dies niederschreibe, lebe ich noch immer und schon wieder. Genau in dem Raume zwischen diesem »Noch immer« und »Schon wieder« liegt die Welt meiner Entdeckungsreise oder Forscherfahrt, die ich als Unwissender, ja als widerstrebender Tourist begann, um sie, wie ich hoffe, als scharfer Beobachter mit einigen neuen und sicheren Erkenntnissen im Sack zu beenden. Es wäre zweifellos ein Fehler des Lesers, das Buch schon in diesem Stadium ärgerlich zuzuklappen. »Noch immer« und »Schon wieder«, das sind so die Dunkelheiten und Rätsel eines Ersten Kapitels, welches das Zweite Kapitel bereits zu lösen haben wird.
Um allen groben Mißverständnissen vorzubeugen: ich bin durchaus kein Meisterträumer. Ich träume nicht lebhafter als andere Leute. Ich pflege am Morgen zumeist meine Träume vergessen zu haben. Oft bleiben freilich, als Strandgut der Nacht, in der grauen Frühe ein paar merkwürdige Bilder und Szenen zurück. Da gibt es zum Beispiel einen Hund, der mit mir in verständigen Worten spricht. Eine leuchtende Braut im Brautschleier, die ich nie gesehen habe, tritt mit ausgebreiteten Armen an mein Bett. Ein Mann mit Vollbart und blauer Schürze, den man den »Arbeiter« nennt, setzt Wasserkünste in Gang, die jedoch nicht aus Wasser, sondern aus absonderlichen Lichtstrahlen bestehen. Oder ich sehe mit unbeschreiblicher Deutlichkeit greise Männer, die anstatt zu sterben immer kleiner werden, immer winziger, und zuletzt als menschenförmige Rübchen in der Erde stecken. Solche Bilder und Szenen sind –– wenn das Gedächtnis sie nicht ausstößt –– wie eigenwillige Keime, die sich im Geiste während des Tageslebens wachsend weiterentwickeln, willst du oder willst du nicht. Selten, und doch ein paarmal im Leben geschieht es, daß diese selbständigen, vom erfinderischen Willen unabhängigen Gesichte während einer einzigen Nacht oder sogar in mehreren Nächten nacheinander logische Ketten und epische Reihen bilden, und man muß dann schon ein braver Tropf sein, um nicht angeschauert zu werden von den sinnvollen Spielen, die unsre Seele hinter unserm Rücken aufführt, als wäre sie nicht ein beschränktes Ich, sondern ein grenzenloses All.
Es gibt nur zwei Wege, um ein Historiker der Zukunft zu werden: wissenschaftliche Folgerung und Traumdeuterei oder Wahrsagerei. Die wissenschaftliche Folgerung dürfte sich durch wissenschaftliche Folgerung von der Erkenntnis der Zukunft selbst ausschließen. Die Wissenschaft nämlich muß stets auf der Hut sein, aus sich eine Närrin zu machen. Sie bringt es höchstens zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Traumdeuterei und Weissagung hingegen haben den unschätzbaren Vorteil, auf eine uralte Praxis zurückzublicken, die der unanzweifelbaren Überlieferung gemäß namhafte Erfolge aufzuweisen hat. Die prophetischen Erkenntnisarten müssen es nur verstehen, um echt zu sein, die Schleier des Gleichnisses zu tragen und die Schatten des Geheimnisses zu werfen.
Strenge Augen sehn mich schon längere Zeit an. Sie werden immer strenger, und jetzt sprechen sie sogar:
»Sie sind ein Mann in ziemlich reifem Alter. Sie haben wahrhaftig nicht so viel Zeit mehr, um auf unnütze Reisen zu gehn. Wie lange noch wollen Sie Ihren kurzen Arbeitstag vergeuden? Wissen Sie nicht, was heute in dieser Welt geschieht? Waren Sie nicht selbst ein Verfolgter und ein Opfer? Sind Sie’s nicht noch immer? Hören Sie nicht das Brausen der Bomber, das Knattern der schweren Maschinengewehre, das den Erdball einhüllt, ein Nessushemd dieses unseligen Sternchens, aus Explosionen gewoben? Hören Sie nicht, schlimmer als diesen Lärm, das letzte Aufstöhnen der zu Tode Getroffenen, an tausend Orten und zu jeder Stunde? Hören Sie nicht, schlimmer als dieses letzte Aufstöhnen, den Marterschrei und das Verröcheln der Millionen, die zuerst entehrt und dann gefoltert und dann massakriert werden? Ist es nicht Ihre Pflicht und Schuldigkeit, keinen Augenblick wegzusehn und fortzuhören von dieser ungeheuren Wirklichkeit, die das tollste Visionengewimmel eines träumenden Qualdämons an Phantastik ins Nichts zurückwirft und dabei doch schlußgerecht ist wie eine mathematische Ableitung? Welche höhere Aufgabe hätten Sie als diese, den Marterschrei und das Geröchel der Gefolterten festzuhalten und erstarren zu lassen im geprägten Wort, für die kurze Zeitspanne wenigstens, in der Erlebnis und Ausdruck einer Generation der kommenden verständlich bleibt?«
Ich kann nichts anderes tun, oh, ihr gestrengen Augen, als die meinigen vor euch niederzuschlagen. Ich beichte und bekenne: meine Zeit ist kurz, und ich vergeude sie gewissenlos. Nicht vergessen habe ich, daß auch ich ein Verfolgter bin. Nicht so taub bin ich geworden, um nicht zu hören das Brausen der Bomber, das Knattern der schweren Maschinengewehre, das letzte Aufstöhnen der zu Tode Getroffenen, den Marterschrei und das Verröcheln der Entehrten, der Gefolterten, Massakrierten. Die ungeheuerliche Wirklichkeit, dieses Visionengewimmel eines träumenden Qualdämons hält mich gepackt an der Kehle bei Tag und bei Nacht, im Stehen und Gehen, auf der Straße und im Zimmer, während der Arbeit und Erholung. Ja, ja, ich versäume meine Pflicht. Aber dieses ungeheuerliche Geschehn läßt mir nicht einmal Luft genug, um den Marterschrei als Echo nachzuächzen.
Zu meiner Entlastung habe ich nur anzuführen, was den Leser als eine unvermittelte Banalität erschrecken mag: Schon hatte ich einen mächtigen Stoß schönen glatten Papiers gekauft. Schon hatte ich mich hingesetzt und auf das oberste Blatt des mächtigen Stoßes, der für zwei Bände hinreichen mochte, mit runder sorgfältiger Schrift die Worte gemalt: »Erstes Kapitel«, welches die Geschichte einleiten sollte, die den Entehrten, Gefolterten und Massakrierten einmal geweiht sein wird, wenn es Gott will. Leider aber war die Feder nichts wert. Es ist jetzt so schwer, die richtigen Federn zu bekommen. Selbst die besten Füllfedern sind steif und hart und widerspenstig und zu spitz und wollen nicht recht in Schwung kommen. Das lesende Publikum weiß glücklicherweise nur wenig von der Werkstatt des Schriftstellers. Ein wahrer Schriftsteller, das sollte ein Mann sein, der mit der empfindlichsten, nervigsten Hand schreibt und nicht auf tote Tasten klopft. Ein solcher Mann gerade aber bedarf gewisser begeisternder Schreibutensilien. Eine gute Feder vor allem, weich und geschmeidig, der zartesten, zweifelndsten Haar- und der entschlossensten Schattenstriche fähig, sie wirft das Satzbild aufs Papier wie eine Meisterzeichnung. Eine gute Feder –– und dies soll kein Scherz sein –– ist schon der halbe Gedanke. Ich ging also aus, um eine gute Feder zu suchen. Ich fand nur eine leidliche. Die Jagd aber nahm mehrere Tage in Anspruch. In der Nacht des letzten dieser Tage aber unterlief mir das, was ich hier die »Aussendung auf eine Forschungsreise« nennen will. Das Material, das ich von dieser Reise in meinem Geiste heimbrachte, war groß, größer als selbst eine umfangreichere Schrift, als diese es zu werden droht, verraten könnte.
Ich hatte nun meine Wahl zu treffen. Vor mir lag das weiße Blatt, auf dem in großen Lettern gemalt stand: »Erstes Kapitel«, und sonst nichts. Diese befehlshaberischen zwei Worte schienen mit Recht zu fordern, daß ihnen die Geschichte unsrer ungeheuerlichen Wirklichkeit nachrücke in Reih und Glied. Ich aber schauderte zurück: Wird diese ungeheuerliche Wirklichkeit nicht wirklicher werden von Tag zu Tag und am wirklichsten und wahrsten vielleicht dann, wenn sie nicht mehr ist? Die Wirklichkeit meiner Reiseerlebnisse hingegen ist aus einem anderen Zeug gesponnen. Sie pflegt meist zu zergehen beim ersten Hahnenschrei oder Hupenruf, und auch das beste Gedächtnis bietet keine Gewähr dafür, daß sie ihm nicht entschlüpfe, plötzlich und auf Nimmerwiedersehn. Eile tut daher not.
Und so beschloß ich denn, unter jenes »Erste Kapitel«, das noch immer auf die Geschichte unsrer ungeheuerlichen Wirklichkeit wartet, das obige hier einzuschwärzen. Es ist ein abergläubischer Trick. Ich habe mir nichts weggeschrieben. Ich habe meine Aufgabe nicht preisgegeben. Jenes »Erste Kapitel«, das eine Last ohnegleichen tragen soll, steht leer ... Denn dieses hier, wiederhole ich zum Schluß unter allgemeiner Zustimmung, ist keines. Sondern das Zweite Kapitel übernimmt das Erste Kapitel.
Zweites Kapitel
Worin ich meinem Freund B.H. begegne, der mich darauf aufmerksam macht, daß ich unsichtbar bin.
»Wie, bist du nicht tot, B.H.?«, fragte ich meinen ältesten und besten Freund und streichelte seine Hand, glücklich, ihn wiederzusehen. Es fiel mir ein Stein vom Herzen bei dieser Begegnung nach so vielen Jahren. Ich hatte B.H. gegenüber ein schlechtes Gewissen. Er war von der großen Flucht vor den Nazis nach Indien verschlagen worden, weit in den Norden, an die tibetanische Grenze, irgendwohin in die Nähe von Darjeeling, wo der Krieg jeder Verbindung zwischen uns ein Ende setzte. Wer weiß, vielleicht hätte ich doch versuchen sollen, ihm noch einmal einen Brief zu schreiben oder mich an das Rote Kreuz zu wenden, um ihm zu helfen. Obwohl ich keinen Beweis dafür hatte, war es für mich ausgemacht, daß er zugrunde gegangen sein mußte ... B.H. lächelte, wobei sein großer Kopf mit den schwarzen Haaren und dunklen schönen Augen ein wenig zitterte, ja beinahe wackelte, wie es schon in unsrer gemeinsamen Schulzeit seine Art war, wenn es ihm gelang, eine überlegene Bemerkung zu machen.
»Ich bin nicht tot«, zwinkerte B.H. »Ich lebe, wie du siehst, aus vollen Lungen. Hingegen bist du tot, F.W., und länger, viel länger, als du dich überhaupt erinnern kannst ...«
»Wieso bin ich tot, B.H.?«, fragte ich, von seiner Offenheit verletzt, die mir taktlos erschien, obwohl ich mir doch vorhin denselben Verstoß hatte zuschulden kommen lassen.
B.H. sah mich lange und ernst an, ehe er sich zur Frage entschloß:
»Kannst du mich sehen, F.W.?«
»Natürlich kann ich dich sehen. Wie machst du es, daß du mit Fünfzig noch immer wie mit Fünfundzwanzig ausschaust ...? Nein, auch das ist noch übertrieben. Du siehst genau so aus wie am Tag unserer Abirurientenprüfung ...«
»Ich bin nach der augenblicklich gültigen Lebenszeitrechnung Hundertundsieben«, nickte er sachlich, »aber wie steht es mit dir, F.W.? Kannst du zum Beispiel dich selbst sehen?«
Ich sah an mir herab. Ich konnte mich nicht sehen. Ein kurzer galvanischer Schreck durchzuckte mich. Ich war unsichtbar. Unsichtbar für andere, das ist wohl beklemmend genug. Aber unsichtbar für mich selbst? Ich versuchte, meine aufgescheuchten Gedanken und Empfindungen zusammenzuraffen. Zuerst erkannte ich mit Verwunderung, daß ich mich wohlfühlte, sogar ausnehmend wohl, viel wohler jedenfalls als vorhin (wann, vorhin?), ehe ich –– vermutlich aus einem von diesem Orte schon sehr entfernten Tor tretend –– auf eine unbekannte Straße geraten war, um plötzlich meinem alten Freunde B.H. zu begegnen. Ich bin nicht sicher übrigens, ob ich von einer Straße zu reden das Recht habe. Es war gebahnter Boden, zweifellos, der sich gleichmäßig nach allen Seiten hin zum Horizont erstreckte, ohne rechts und links von Böschungen oder Straßengräben begrenzt zu sein. Unter meinen Füßen wuchs ein kurzer trockener Rasen, der den Schritt erstaunlich förderte und das Gehen zu einem neuartigen Vergnügen machte. Dieser Rasen bestand aus wohlgepflegtem Gras. Das Gras aber hatte die leiseste grünliche Tönung, die letzte Spur von Chlorophyll verloren. Es wuchs zum Teil weiß, zum Teil eisengrau auf dem glatten Erdboden, wie das Haar auf dem Schädel eines zwar noch tüchtigen, aber schon ergreisenden Mannes. Ich verwende die Phrase »unter meinen Füßen« nicht aus einem stilistischen Versehen, wie mancher Leser wohl schon angenommen hat. Obwohl ich unsichtbar war für andere und sogar für mich selbst, so besaß ich doch Hände und Füße und den ganzen Leib, an den ich so sehr gewöhnt war. Gewiß, ich war unsichtbar, aber durchaus nicht körperlos. Zwar, wenn ich mit meinen braven alten Händen mich abtastete, griff ich ins Nichts. In diesem Nichts aber fühlte ich mein Herz schlagen, regelmäßiger und ruhiger als sonst, meine Lungen dehnten sich aus und zogen sich zusammen, ich schaute, hörte, roch und schmeckte. Mein jugendfrisches Wohlbefinden schien damit zusammenzuhängen, daß all diese Funktionen der Sinne sich nicht, wie sonst, durch eine schwere und stellenweise schon verbrauchte Materie durcharbeiten mußten. Um einen banalen und nur halb zutreffenden Vergleich zu verwenden, ich fühlte mich leicht und beweglich, wie etwa ein dicker Mann sich nach einer streng durchgeführten Entfettungskur zu fühlen wünscht. Hatte B.H. recht, war’s wirklich die strenge, die trefflich geglückte Entfettungskur des Todes, die ich so prächtig überstanden hatte? Ich bezweifelte diese Möglichkeit keineswegs. Dennoch aber schämte ich mich in diesem Augenblick, ich weiß nicht warum. Ich schämte mich nicht nur um meiner selbst willen, sondern auch um B.H.s willen. Es war eine Scham, ähnlich derjenigen, nackt zu sein, und zwar über alle Vorstellungen und Begriffe nackt. Um mir selbst, und vielleicht auch B.H. aus der Verlegenheit herauszuhelfen, brummte ich:
»Was man manchmal für Unsinn zusammenträumt ...«
B.H. schüttelte ziemlich ironisch den Kopf:
»Man hat recht kindische Theorien damals verzapft über solche Dinge«, meinte er.
»Sprichst du etwa von Freuds Traumdeutung, B.H.?«
Er sah mich angestrengt an, als verstünde er mich nicht:
»Wer? Freud? Leid? Wie soll ich mich an alle diese Namen erinnern aus den Anfängen der Menschheit?«, sagte er etwas geringschätzig.
»Anfänge der Menschheit?«, fragte ich und fühlte genau, wie eine gekränkte Leidenschaftlichkeit meine Stimme färbte, die tönend aus meinem unsichtbaren Munde und nicht minder unsichtbaren Innern drang. »Anfänge der Menschheit? Waren es etwa die Anfänge der Menschheit, lieber B.H., als wir gemeinsam Shakespeare und Goethe lasen und über Dostojewski und Nietzsche, über Pascal und Kierkegaard diskutierten auf den Parkwegen des Belvederes? Erinnerst du dich nicht, es ist ja so kurz her, es war gestern, oder vielleicht heute früh, denn du siehst ja aus wie ein Abiturient. Und dann rückten wir ein in die Armee des Ersten Weltkriegs, du und ich, und später schrieben wir einander Briefe und begegneten uns immer wieder, denn die geistige Freundschaft der ersten Jugend ist ein starkes Band für männliche Herzen. Und du wurdest B.H. und ich wurde F.W., und dann kamen die Nazis, und ich sah dich noch einmal an der Küste unsres geliebten Mittelmeers. Du warst auf dem Wege nach Indien. Welch ein schwermütiger Abschied war das für mich! Ich ahnte, wir würden uns nie mehr wiedersehn, denn der Zweite Weltkrieg wartete bereits am Parktor des schönsten südfranzösischen Sommers. Wir beide haben Schweres erlebt, du in einem Camp an der Grenze Tibets und ich auf meiner Flucht aus Europa. Du bist, so fürchtete ich, in Indien umgekommen. Vielleicht aber haben dich die tibetanischen Mönche gelehrt, wie man ewig weiterlebt trotz allem! Ich hingegen lebe augenblicklich in California. Es mag jedoch sein, daß ich in California nur begraben bin, denn du hast mich ja von meiner schrecklichen Unsichtbarkeit überzeugt ... Ach, wie blutig ernst und nah ist das alles! Ich kann deine Ironie von den ›Anfängen der Menschheit‹ nicht verstehn ...«
»Die Situation von uns beiden, lieber F.W.«, unterbrach er mich, »ist grundverschieden. Du bewahrst all diese Erinnerungen von den Anfängen der Menschheit so lebendig in dir auf, weil du inzwischen nicht wieder drangekommen bist ...«
»Drangekommen?«, schnappte ich ein. »Was soll dieser infantile Ausdruck? Du hast dir ja den Jargon unsrer Schülerjahre recht gut gemerkt. Drankommen? Meinst du damit, vom Lehrer zur Prüfung aufgerufen werden ...?«
»Sehr richtig, F.W.«, nickte er mit einem gewissen Stolz: »Und ich bin gerade dran, das will sagen: ich lebe ...«
Ich beschloß zu schweigen, obwohl es mir recht schwer fiel. Kraft meiner Unsichtbarkeit nämlich, oder besser, meiner durchsichtigen, unantastbaren und schwerelosen Körperlichkeit, kreisten meine Gedanken in heftigen Stromschnellen, und ich verstand und erkannte so manches in neuartig durchdringender Weise. Mein Geist funktionierte im Sinne einer höchst polyphonen Orchesterpartitur. Eine Reihe von Erkenntnissen entwickelte sich wie ein musikalisches Stimmengefüge nebeneinander, untereinander, und bildete doch eine sinnvolle Einheit, deren ich völlig inneward. Also doch, dachte es in mir, B.H.s Aufenthalt in Tibet hat ihn entscheidend beeinflußt. Er hat sich zweifellos der orthodoxesten Form der Reinkarnationslehre angeschlossen, und mehr als das, der Reinkarnation selbst. Das meint er unter »Drankommen«. Muß ich mich deshalb von B.H. abwenden und ihn Knall und Fall verlassen? Widerspricht die Doktrin und gar die Praxis der Wiedergeburt meinem eigenen Unsterblichkeitsglauben? Nein, entschied ich, ohne zu zögern. Fürs erste ist mein Unsterblichkeitsglaube ja kein Glaube mehr, sondern ein handfest bewiesenes Phänomen. Den schlagenden Beweis bilde ich selbst in meiner gegenwärtig unsichtbaren und doch lebendigen Verfassung ... Ich bin, wie mir mein bester Freund ohne höfliche Umschweife auf den Kopf zugesagt hat, längst abgeschieden und wahrscheinlich auf dem Forest Lawn begraben, sofern derselbe nicht schon seit Urväterzeiten aufgelassen und der Ausbeutung von Erdöl übergeben worden ist. Und trotzdem bin ich ganz passabel beisammen und denke und fühle sogar mit erhöhter Lebhaftigkeit. Descartes’ »Cogito, ergo sum« gilt, Gott sei es gedankt, auch für mich nach dem Tode. Welch ein moralischer Triumph über das »Sum, ergo cogito« meiner materialistischen Widersacher, dieses stumpfen Intellektuellenpacks. Was aber die Reinkarnation anbetrifft, war es nicht erst gestern nachmittag, daß mich eine jähe Erleuchtung überfiel? Der Ort freilich, wo der Blitz dieser geistigen Inspiration in mich einschlug, galt mir nicht als besonders philosophisch: ein Drugstore am Wilshire Boulevard. Ich vergaß, meinen Kaffee auszutrinken. Wie war das nur? Wie ist das nur? ... Jedes Ich ist unsterblich, aber nicht jedes Ich ist ein ganzes Ich. Wie in der materiellen Welt, zum Beispiel in der Welt der Rosen, sich ein und dieselbe Blüte von Zeit zu Zeit auf das genaueste wiederholen muß, so auch in der Welt der Menschen, körperlich, seelisch, geistig. Der Formenschatz der Natur ist beschränkt, und nicht anders der Formenschatz der Menschheit. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Seelen, von ausgesprochenen Egos, die viel kleiner ist als die Anzahl der Namen, die diese Egos im Laufe ihrer Verwandlungen tragen. So ein Ich erscheint wie ein mehr oder weniger erfolgreiches Buch in verschiedenen Auflagen und Ausgaben, doch jedesmal unter verändertem Titel. Wenn Gott am Jüngsten Tage, wie es geschrieben steht, die Seelen zählen wird, so wird er eben nicht dreihundertsiebzig Quinquillionen, sondern nur siebenhunderttausend bis siebzig Milliarden Seelen zählen, je weniger desto besser und würdiger. Jedes Ich wird am Ende der Zeit ein dicker Strauß von Verkörperungen sein, eine Art staubumhüllter Wanderstamm, der durch die Wüste der Äonen zog ... Immerhin ist es verwunderlich, daß der B.H. der Gegenwart dem B.H. aus den Anfängen der Menschheit so bis aufs Haar ähnlich sieht. Ich fühlte einen leichten Schwindel mein Bewußtsein bedrängen und unterbrach daher den Strom dieser Gedanken. Lange ließ ich meinen Blick auf B.H. ruhen, ohne zu bedenken, daß dieser Blick ihm nichts sagen konnte. Nun, dachte ich, dunste nur, mein Lieber! Ich rede kein Wort mehr. Das alles macht mich müde.
B.H. trat näher auf mich zu. In seinem Lächeln war kein Vorwurf:
»Wir sind eingeladen, F.W.«, sagte er und machte einen Versuch, mich auf die Schulter zu klopfen, die doch für ihn nicht vorhanden sein konnte.
»Eingeladen?«, fragte ich ängstlich. Doch dann hörte ich meinen eigenen, abgespannten Seufzer:
»Tu, was du willst ... Ich muß ja mit allem einverstanden sein.«
Diese meine Worte klangen ziemlich jämmerlich. Sie verschafften mir aber die Erleichterung, die ein Tourist empfindet, wenn er die Einteilung seines Tages in die Hände eines bewährten Reisemarschalls legt.
Drittes Kapitel
Worin ich am Schluß ein neuartiges Mittel der Fortbewegung kennen lerne.
Nach diesem Gespräch, das mir sehr kurz erschien, begann ich die Gegend, wo wir uns befanden, schärfer ins unsichtbare, aber sehende Auge zu fassen. Ohne Zweifel, wenn auch sonderbarerweise, hatten B.H. und ich, zwei Städter durch und durch, einander auf dem flachen Lande begegnet. Es war das flachste Land, das ich je erblickt, und es schien zu alledem auch noch ein ganz unbewohntes Land zu sein. Nicht die geringste Andeutung einer städtischen oder dörflichen Siedlung, so weit die Sehkraft reichte. Keine Baulichkeit irgendwelcher Art hob sich von der glatten Ebene ab, keine Tankstelle nah oder fern, kein Wasserrad, ja nicht einmal eine jener großen Reklametafeln, wie sie sonst selbst die einsamsten Wüstenstrecken flankieren. Die Empfindung aber, auf einer Straße zu stehn, konnte ich trotz der unbeschränkten und unparzellierten Ödigkeit ringsum nicht loswerden. Der dichte, wundersam kurz gehaltene, eisengraue Graswuchs, der den Erdboden ununterbrochen bedeckte, konnte nur auf menschliche Pflanzung und Pflege zurückzuführen sein. Der ganze Umkreis, von Horizont zu Horizont, war gewissermaßen Landstraße, eine Straße, anstatt mit Asphalt, mit diesem trauerfarbenen Teppich für Lustwandelnde belegt, eine Straße ohne die leiseste Erinnerung an einen Verkehr und dennoch so, als sei sie irgendeinmal von einem schier unermeßlichen Verkehr verlassen worden, damals, als tausend Reihen von Blitzgefährten nebeneinander in beiden schnurgeraden Richtungen hin und zurück rasten. Erst allgemach erkannte ich, daß die Glätte und Ödigkeit der Gegend nicht so ununterbrochen war, wie ich zuerst vermutet hatte. In großen Abständen offenbarten sich meinem Auge, das sich der völligen Unvertrautheit dieser Welt erst langsam anpassen mußte, größere Baumgruppen, oder richtiger Baumhaufen, denn so dicht waren sie gesetzt, daß sie keine Lücken und Scharten aufwiesen und widernatürlich kompakt wirkten. Diese Bäume –– es brauchte einige Zeit, ehe ich in ihnen Bäume erkannte –– waren alle gleichartig und ziemlich niedrig. Ihre starren Kronen wurden von ledrigem und beinahe schwarzem Laub gebildet, aus welchem große wächserne Blüten hervorleuchteten, deren gelblichem Weiß verschiedene Andeutungen von Farbe zugemischt waren. Ich hatte ähnliche Gewächse nie gesehn. Es fiel mir sofort auf, daß diese Baumhaufen, sofern sie irgendein Leben überwölbten, ein zartes und wehleidiges Leben hüten mußten.
Der Himmel war wolkenlos und glich in seiner tiefblauen Vereinsamung dieser grauen Erde hier unter seinem Bogen. Vermutlich war die Tageszeit ziemlich fortgeschritten, denn der Sonnenball, der mir etwas röter erschien, als ich ihn in Erinnerung hatte, warf schiefe, aber grelle Strahlen und erzeugte eine Temperatur, die man kalte Hitze oder heiße Kälte hätte nennen können. Obwohl mich das Bedürfnis nach dunklen Brillengläsern erfaßte, fror mich zunehmend, trotz meiner unsichtbaren Körperverfassung.
Ich sah B.H. fragend an, vielleicht sogar ungeduldig. Sofort erriet er meine Gedanken. Er hatte eine Art, meine Gedanken zu erraten, die mir sehr unbehaglich war. War das Tibet, fragte ich mich, oder sollte es die Errungenschaft einer Menschheit sein, die sich längst nicht mehr in ihren Anfängen befand? Zu dem verlegenen Nacktheitsgefühl meiner Unsichtbarkeit trat somit die furchtsame Scham hinzu, mein Denken, Wünschen, Planen, meine Zustimmung, meine Ablehnung, meine Zweifel und meine Kritik nicht völlig verbergen zu können.
»Unser Rendezvous«, sagte er, ohne meine Frage abzuwarten, »spielt sich in California ab.«
»Wie das, B.H.?«, gab ich zurück, ohne eine Anwandlung raschen Ärgers verwinden zu können. »California kenne ich. Dort hab’ ich gelebt. Dort lebe ich vielleicht noch immer, trotz deiner merkwürdigen Theorie über mich und mein Totsein (übrigens erinnere ich mich nicht, dir ein Rendezvous gegeben zu haben). Hättest du mir gesagt, wir befänden uns hier im Mittelwesten des Kontinents, dort wo einst die endlosen Prärien sich dehnten, ich hätte dir ohne weiteres geglaubt. Aber California kenne ich ziemlich gut. Man nennt es mit Fug und Recht paradiesisch, obwohl gewisse Snobs mißbilligende Bemerkungen über diesen schönen Erdenfleck zu machen pflegen und sogar behaupten, sie zögen das platte Florida der abwechslungsreichen Westküste vor. Diese Snobs schelten California eine mit künstlicher Üppigkeit überzogene Wüste, deren geschminkte Rosen, Bougainvillas, Poinsettias und sonstige Blumen nicht duften, deren Früchte und Gemüse nicht schmecken und deren Menschen schöngewachsen, aber gewissermaßen lemurisch sind. Das mag damit zusammenhängen, daß California, noch lange vor den uns beiden so vertrauten Anfängen der Menschheit, zu dem teilweise versunkenen Kontinent Lemuria gehörte. Davon hat sich eine Erinnerung erhalten. Die Lemuren scheinen ein schattenhafter, unernster Stamm gewesen zu sein, übertünchte Gräber, mit einem Wort, Schauspieler, die der Welt allerlei Gefälschtes und Gefärbtes vorgaukelten, das ernster Prüfung nicht standhielt. Es gibt einen zeitgenössischen Ausdruck für dieses Ur-Lemurische, das Wort ›phony‹, und so rümpfen die Snobs heute (ich meine mein eigenes Heute oder Gestern) ihre Nase über California hauptsächlich deshalb, weil dort in einer berühmten Stadt jene Filme, jene photographischen Phantasiegeschichten hergestellt werden, welche ihre Zeit erobert haben, obwohl oder gerade weil sie lemurisch sind. Aber vielleicht weißt du und deine gegenwärtige Menschheit gar nicht mehr, was das ist, ein Film?«
B.H. schüttelte langsam den Kopf und sah mich aufrichtig an:
»Nein, das wissen wir wirklich nicht.«
»Gleichviel, B.H.«, fuhr ich fort, leicht verwundert über meine eigene erregte Beredsamkeit. »Dieses California ist zumeist ein bergiges Land. Gegen Osten erheben sich die gewaltigen, schneebedeckten Sierren, die vielleicht noch keines Menschen Fuß erklomm. Aber auch im Westen, wo der Pazifische Ozean die Küsten benagt, gibt es überall Berge und Hügel, und wären’s auch nur Sandhaufen aus verwittertem, zerbröckeltem Urgestein. Dazwischen ziehn die breiten Täler hin, mit unendlichen Obstkulturen bepflanzt, Orangen, Limonen, Grapefruits, immer ist Blütezeit, daß einem Hören und Sehen vergeht von dem Duft. Und selbst die Wüsten blühen im April rosa und violett mit ihren hundertfältigen Kakteen. Wo immer man steht und geht, blauen die Berge in der Ferne. Hier aber ...«
»Du vergißt«, unterbrach mich B.H., »daß du einige längere Erdepochen versäumt hast.« (Es klang nach »unentschuldigt versäumter Schulzeit«.) »Inzwischen sind die meisten Erhebungen der Erdoberfläche eingeebnet worden, teils durch die ordnungsgemäß geologische Entwicklung des Planeten, teils durch den Zweckwillen seiner Bewohner und teils durch jenes grandios entscheidende Ereignis, von dem ich vorläufig noch schweigen will, um dich nicht allzusehr zu erschrecken ... Berge aber gibt es nur mehr außerhalb der Kulturzone ...«
Dagegen ließ sich freilich nichts mehr einwenden. Nur um zu nörgeln, brummte ich noch:
»Das alles ist so monoton ... Ich wünschte mir eine Stadt hierher.«
»Wir sind in einer Stadt«, meinte mein Freund gutmütig und freute sich dieser Pointe, ehe er nach einer Weile erklärend hinzufügte: »Wir sind in einer Stadt, wofern du unter diesem Worte eine zusammenhängende Siedlung verstehst. Alles was du siehst, ist Stadt. California ist der Name einer Stadt. Sie geht nach einigen hundert Meilen Weges in Städte über, die anders heißen, obwohl die Grenzen zwischen diesen Städten abstrakter, ja rein geistiger Natur sind, denn der ganze bewohnte Globus ist eine einzige Stadt.«
»Nun gut, nenn es Stadt«, sagte ich, mehr müde als friedfertig, »obwohl ich jetzt mit Heimweh an die Türme und Tore unsrer mittelalterlichen Heimatstadt denken muß, an ihre Hochburg, den Hradschin, und an ihre gotischen und barocken Paläste ... Wie? Und hierher bin ich eingeladen? Hast du mir nicht vorher verraten, daß ich hierher eingeladen bin, oder sollte ich’s nur geträumt haben?«
Seine Stimme wurde ein wenig feierlich:
»Du bist mehr als eingeladen. Man hat dich zitiert ...«
Meine Unsichtbarkeit kam zweifellos meiner Intelligenz und schnellen Auffassung zu Hilfe. Ich verstand sofort. Man hat mich zitiert. Wen »zitiert« man? Die Geister der Verstorbenen. Ich selbst war, ohne ein Gefühl besonderer Unheimlichkeit, ein solcher Geist. Und wer zitiert uns? Die Spiritisten, als da zumeist sind alte, jumperstrickende Damen, pensionierte Generale des Friedensstandes, ausrangierte höhere Staatsbeamte und so weiter. Wer kennt nicht diese leichtgläubige Gesellschaft um ein hopsendes Tischchen?
»Also so weit habt ihr es gebracht«, fuhr ich unziemend auf, »daß ihr diese Fingerübungen der Ärmsten im Geiste aus den Anfängen der Menschheit repetiert und die Intelligenzen der Toten zitiert? Plato, Napoleon, Jack the Ripper und Madame Pompadour? Wie? Ist das ausdenkbar? Und ich, ich muß es mir gefallen lassen, eine Materialisation zu sein, obwohl selbst das eine Übertreibung ist, denn ich bin ja nicht einmal ein ektoplastisches Phänomen, sondern schlechthin unsichtbar und nur als Bewußtsein vorhanden.«
B.H. blieb ruhig und ernst:
»Manches, was dir noch viel unausdenkbarer erschiene, würdest du es kennen, wir haben’s längst verworfen; einiges aber haben wir gerettet und fortentwickelt, was du verachtet hast zu deiner Zeit.«
»Zu meiner Zeit? War’s nicht auch deine Zeit, B.H.?«
»Gewiß, F.W., es war unter anderen Zeiten auch meine Zeit.«
Bitter drang es aus mir hervor:
»Und warum hast du mich zitieren lassen, gerade mich?«
Erst nach einem langem Schweigen fragte er mich zur Antwort:
»Hast du nicht in den letzten Tagen viel an mich denken müssen, F.W.?«
»Jedenfalls scheine ich nur durch dich in diese Verlegenheit gekommen zu sein, mich hier zu befinden.«
»Nein, man hat allgemein deinem Namen zugestimmt«, wehrte er rasch ab.
Mich aber durchschauerte es eitel bei diesen Worten, vom unsichtbaren Scheitel zur unsichtbaren Sohle. Wie, nach fünfzig-, sechzig-, ja vielleicht hunderttausend Jahren kennt man noch meinen Namen? Berge sind eingeebnet, Meere sind ausgetrocknet, die Gravitation der Sonne scheint abgeschwächt, vermutlich ist ihr die Erde ferner gerückt, wie diese grellen, aber matten Strahlen beweisen, unter denen selbst ein Gespenst wie ich friert. Vielleicht sind auch die Tage länger geworden und mit ihnen das menschliche Leben. Trotz dieser Verwandlung jedoch über alle Maße und Begriffe, kennt man noch meinen Namen, den Namen eines Menschen, dessen ganzes verdienstloses Verdienst es ist, zwischen endlosen Perioden von Dumpfheit und Faulheit in ein paar kurzen aufgeputschten Stunden eine Anzahl von nackten Seiten Papiers mit Worten angefüllt zu haben, gereimten und ungereimten. B.H. erriet natürlich meine überheblichen Gedanken ohne Verzug.
»Nein, nein, mein Lieber, das ist es nicht«, lachte er, beinahe boshaft. »Für solcherlei hat man fast gar kein Verständnis mehr. Ich habe deinen Namen einfach aus dem Alphabet gestochen, ›durch Zufall‹, würde man damals gesagt haben, in den dunklen Anfängen der Menschheit. Dein Name gefiel allen Hausgenossen recht wohl, und sie meinten einhellig, F.W. soll unser Hochzeitsgast sein, und er soll einen Blick tun aus seiner primitiven Zeit in unsere fortgeschrittene Zeit. Und wir wollen uns durch ihn von der körnigen Kraft jenes urtümlichen Weltalters anwehen lassen, von dem wir nur so wenig wissen ... Das ist alles! Und deshalb hat man dich zitiert.«
»So, so, da bin ich nun plötzlich ein Hochzeitsgast und eine Art Darwinscher Affe«, murmelte ich vor mich hin, während ich blitzschnell meine außergewöhnliche Lage überschlug. Ich bin gestorben vor mindestens sechzig- bis hunderttausend Jahren oder noch mehr, jedenfalls vor einem geradezu astronomischen Zeitraum. Das Interregnum zwischen meinem Tod und dem jetzigen Augenblick habe ich nicht ganz bewußtlos zugebracht. Das abgelebte Leben in mir wirkte so stark nach, daß die schier unendliche Pause mir nicht länger und wichtiger erscheint als eine kurze Nacht. In dieser kurzen Nacht freilich scheint mich einiges betroffen zu haben, das sich noch nicht ganz zum Lichte durchgerungen hat. Währenddessen aber hat mein Freund B.H., von tibetanischen Mönchen trainiert, eine oder mehrere Wiedergeburten durchmessen, der fixe Kerl. Und jetzt gerade nimmt er neuerdings teil an einer fortgeschrittenen Epoche der Menschheit, wo man mit hundertsieben Jahren einem Studenten von 1910 gleicht. Er ist es, der mich dank dem technisch hochentwickelten Spiritismus dieser Läufte hat ins Leben zitieren lassen, wenn auch nicht ins richtige Leben (noch war ich von meinem Reiseerlebnis nicht weit genug fortgerissen, um nicht zu zweifeln, ob dies das richtige Leben sei.) Was tut’s? Ich sollte weniger empfindlich und cholerisch sein. Mein unsichtbarer Zustand, wenn auch mit wahrem Leben nicht zu vergleichen, erspart mir andererseits die Fährnisse, Risiken und Sinnesverdunklungen einer Existenz, die mit sich selbst identisch ist. Ich darf meine Neugier frei schweifen lassen. Eine ähnliche Gelegenheit bietet sich selten wieder. So dachte ich. Laut aber rief ich aus:
»Worauf warten wir noch, B.H.? Gehn wir vielleicht zu Fuß zu dieser Hochzeit?«
»Ja«, nickte er, »natürlich gehn wir zu Fuß, wir haben ja nur vierhundert Meilen Wegs.«
Ich hatte mich sicher verhört. Darum drehte ich mich um meine eigene unsichtbare Achse, nach allen Seiten Ausschau haltend.
»Wo ist dein Auto? Wo ist der nächste Parkplatz? Ich nehme an, daß heutzutage jeder Säugling seinen eigenen Kraftkinderwagen besitzt, der von der Mutter, die zu Hause wirtschaftet, mittels Kurzwellen sicher durch den tödlich dichtesten Verkehr gelenkt wird. Das war ja beinahe zu meiner Zeit schon erreicht.«
»Meinst du unter Auto und Kraftwagen etwas, das auf Rädern gerollt wird?«, fragte der Wiedergeborene, und Anstrengung des Denkens und ein leichter Abscheu lag um seinen jugendlichen Mund. Ich suchte Fassung zu bewahren:
»Hör einmal, B.H., du behauptest, wir befinden uns hier inmitten einer Stadt, einer zusammenhängenden Siedlung. Was für eine Stadt aber ist das, die einer noch nicht entdeckten oder schon wieder verlassenen Urlandschaft gleicht in ihrer Pontischen Trostlosigkeit? Erinnerst du dich nicht aus deinen verschiedenen Reinkarnationen, was eine moderne Großstadt ist oder war? Hast du vergessen die zehntausend schnittigen, lautlos gleitenden Gefährte, die von den roten Stoplichtern wie Brandungen gestaut, von den grünen entlassen werden wie glänzende Stromschnellen? Und die langsam sich weiter schiebende Lava der gierig erregten Menge vor den riesigen Spiegelscheiben der Schaufenster, die stets aufs neue die ermüdete Sinnlichkeit aufstacheln zu erfüllbar-unerfüllbarem Wunschleben? Und in der Nacht die kreisenden, jagenden, zuckenden Figuren des Neonlichts zu unsern Häupten? Was rede ich da? Ich komme mir vor, als wäre ich in die reaktionärste Leere verschlagen, ja, meiner Treu, in eine ausgestorbene Welt des unfaßbarsten Rückschritts! Ist es möglich, daß die Technik, an deren früher Wiege wir standen, der wir eine Unendlichkeit von Zukunft und Wohltat zubilligten, ganz und gar verloren und vertan sei binnen sechzig- bis hunderttausend Jahren?«
Der alte Freund lächelte nachsichtig zu meinen Worten.
»Es hat weit weniger bedurft«, sagte er, »als solch einer Zeitspanne, um das auszuschalten, was du vermutlich mit dem heute verloren gegangenen Begriff Technik ausdrücken willst, obwohl gerade während dieser Zeitspanne jenes ungeheure Ereignis eintrat, das allein schon genügt hätte, das geschichtliche Gedächtnis der Menschheit auszulöschen. Dieses Gedächtnis aber ist nicht ausgelöscht worden, sondern nur ein bißchen verwischt, was die Zeiten vor dem Ereignis betrifft. Zum Beweise des Gesagten möge dir dienen, daß wir noch immer die Jahre, wie in den Anfängen der Menschheit, von Christi Geburt her rechnen. Die Technik aber, wenn ich mich recht erinnere, ein primitiver Greuel, zusammengesetzt aus Massenmord, Benzingestank, elektrischer Hochspannung, Atomzertrümmerung, leerer, langsamer Geschwindigkeit und entnervender Bequemlichkeitssucht, unsereins könnte sie nicht mehr ertragen, ohne ernstlich zu erkranken. Wer zum Beispiel würde sich in eines jener plumpen Rädervehikel setzen dürfen –– man bewahrt einige davon noch auf –– ohne einer Nervenkrise ausgesetzt zu sein ...«
Er hielt inne und sah mich zögernd an. Ich bemerkte, recht eigentlich zum erstenmale, daß B.H. eine alte Felduniform trug und Wickelgamaschen an den Beinen hatte. Bei näherem Hinschauen aber war’s nur die Nachahmung, die Kopie einer alten Felduniform, und zwar in einem mir unbekannten, überaus feinen, silbergrauen Schleierstoff.
»Ich will dich nicht beleidigen, F.W.«, fuhr er fort, »die Menschen haben ihre Kräfte immer angestrengt und ausgedehnt bis an die Grenzen, die ihnen ihre Zeit setzte. Auch wir verwenden selbstverständlich technische Hilfsmittel, wenn du willst. Nur ist unsre Technik lautlos, bescheiden und nicht physikalischer oder chemischer, sondern mentaler Art. Sieh dir zum Beispiel dieses Instrument an, das jeder Zeitgenosse bei sich trägt. Es erspart unsern Eingeweiden, die ihre Ruhelage nicht verändern sollen, jegliches Abenteuer auf rollenden Rädern. Es erspart uns sogar das Abenteuer von Raketen-Luftreisen der primitiven Zeit, jene Reiseart, die dem Sauerstoffhaushalt menschlicher Herzen und Lungen einst so übel zusetzte, daß gewisse Generationen es nicht über fünfzig Jahre Lebensalter bringen konnten. All die Generationen, die durch die Luft hin und zurück eilten, um zu kaufen und zu verkaufen, mußten den frühen raschen Herztod hinnehmen wie ein Naturgesetz. Diese Schädigungen hat gottlob die Menschheit überwunden, ich vermag dir gar nicht zu sagen, seit wie vielen Jahrzehntausenden! Die Historiker sind sich nicht einig über den genauen Zeitpunkt, wann die materielle Reiseart von der mathematisch-mentalen Reiseart abgelöst worden ist. Daß sich dieser Zeitpunkt aber im dunkelgrauesten Altertum verliert, darüber herrscht kein Zweifel ...«
»Mathematisch-mentale Reiseart?«, fragte ich bestürzt.
»Diese Sache«, tröstete er mich, »beruht auf einer urtümlich simplen Einsicht von der Relativität aller bewegten Punkte des Kosmos im Verhältnis zueinander. Simpel wie alles Große ist diese Sache, und man sieht geradezu den braven, namenlosen Handwerksmann mit glattem, schlichtem Weißhaar vor sich, der in mythischer Vorzeit die Relativitätstheorie ausgesonnen hat. Kurz gefaßt: wir bewegen uns, wenn wir reisen, nicht auf das Ziel zu, sondern wir bewegen das Ziel auf uns zu.«
Während dieser Erklärungen hielt er mir ein Ding unter die Nase, das größer war als eine Taschenuhr und kleiner als ein Barometer, also ungefähr einem bescheidenen Kompaß glich. Da ich auf B.H.s abgebissene Fingernägel starrte, wurde ich nicht sogleich gewahr, daß ich Instrumente gleich diesem längst schon gesehen hatte. Es schien mir eines jener Geduldspiele aus meinem Kindheitsbesitz zu sein, bei denen man durch geschicktes Manövrieren bunte Kügelchen in die dazu bestimmten Löchlein praktizieren mußte.
»Ich verstehe nichts von Mathematik«, sagte ich ausweichend, während ich das alte Spielzeug betrachtete, staunend und von unsagbar schwermütigen Empfindungen bewegt.
»Die Mathematik ist nur ein Hilfsmittel«, beruhigte mich B.H. »Sie ist eine tautologische Operation, die ein Zeichen einem anderen gleichsetzt, um durch solche Gleichsetzungen zu unbekannten Resultaten vorzudringen. Auf der Leiter der Gleichsetzungen läßt es sich freilich getrost herumklettern, wie du sehr bald selbst erfahren wirst.«
Und indem er mit stumpfem Zeigefinger auf das glasbedeckte Zifferblatt des Geduldspiels hinwies:
»Siehst du hier die beiden konzentrischen Kreise der kleinen Löchlein? Der äußere gehört der Mathematik an. Da müssen die blaßblauen Kügelchen hinein. Hier! Da du unsichtbar bist, kannst du gewiß auch ohne Brille diese Diamantschrift lesen ...«
Und ich las ohne Brille und ohne Mühe: »›Galaktischer Zeitpunkt‹ –– ›Planetarer Zeitpunkt‹ –– ›Kontinentaler Zeitpunkt‹ –– ›Örtlicher Zeitpunkt‹ –– ›Galaktischer Raumpunkt‹ –– ›Planetarer Raumpunkt‹ –– ›Kontinentaler Raumpunkt‹ –– ›Örtlicher Raumpunkt‹ –– ›Genaue Winkelneigung des Lichtstrahls‹.«
»So, da wären wir«, sagte B.H., während er mit jungenhafter Freude an seiner Überlegenheit die blaßblauen Kügelchen in die Löchlein hineinbalancierte, welche die obigen Beschriftungen zeigten. Die Geschicklichkeit, mit welcher er das Geduldspiel beherrschte, war mir geradezu unfaßlich.
»Ich verstehe nichts davon«, stieß ich hervor, »und ich will auch nichts davon verstehen.«
Unbeirrt von meinem Widerstand, setzte er seine Belehrung fort, mit dem Fingernagel den innern Kreis auf dem Zifferblatt des Instrumentes nachziehend:
»Siehst du, hier? Viel wichtiger als der mathematisch-astronomische ist der mentale Zirkel. Verzeih, den Begriff ›mental‹ könntest du vielleicht mißverstehen. Es wird damit nicht eine bloße Tätigkeit des Intellekts gemeint; als mental bezeichnen wir jede Seelenregung, jede Emotion, die vom Lichte des Bewußtseins reingewaschen und somit vergeistigt wird ... Warum bist du unaufmerksam? Strengt es dich an, zuzuhören ...? Hier, lies mit mir die Termini über den Löchlein, in die ich jetzt die hellen grünen Kügelchen einrollen lasse: ›Willensrichtung‹ –– ›Veränderungsdrang‹ –– ›Zielsicherheit‹ –– ›Mutmaßliche Dauer der Ungeduld‹ –– ›Mutmaßliche Dauer der Geduld‹.«
»Halt, B.H.«, unterbrach ich ihn, ernstlich verwirrt. »Ich bin eingeladen oder ›zitiert‹, was viel ärger ist, bei wildfremden Leuten. Ich weiß nicht, wie und wer diese Leute sind, wie sie heißen, und wie sie leben. Ich kenne nicht ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche, ihr Zeitalter, das von dem meinigen, den Anfängen der Menschheit, vielleicht hundertzwölftausenddreihundertfünfundzwanzig Jahre getrennt ist. Du hast dich durch mehrere Wiedergeburten durchgeschlagen und davon ein Savoir Vivre behalten, mit dem du in jeder Gesellschaft weiterkommst. Weißt du denn, wie mir zumute ist, einem von Natur schüchternen und verlegenen Menschen, der schon im Jahre 1930 nur mit Schweißtropfen auf der Stirn ein fremdes Wohnzimmer betrat? Wie soll ich mich benehmen? Wie soll ich mich verhalten? Der einzige Vorteil, der meinen Nerven zugute kommt, ist der, daß ich unsichtbar bin. Du kannst mich nicht so mir nichts dir nichts der Friktion einer solchen Begegnung aussetzen, nach einer vollen Ewigkeit der Entwöhnung ...«
»Da habe du keine Sorge«, lächelte er gütig. »Deine Schüchternheit, deine Verlegenheit entstammt ja nur einer menschenfresserischen Zivilisation, einer auf götzendienerischen Tabus errichteten Gesellschaft, wo oben und unten, groß und klein, reich und arm, schön und häßlich durch tödliche Abgründe voneinander getrennt lebten! Ich verspreche dir, du wirst den freundlichsten, den hübschesten, den taktvollsten Leuten bei der Hochzeitsgesellschaft begegnen, in wenigen Minuten ... Siehst du, es fehlt nur mehr das letzte hellgrüne Kügelchen für das Löchlein, über welchem die Worte stehn: ›Scharf eingestellter Wunsch.‹«
»Hab’ doch ein Einsehn, B.H.«, bat ich, »ehe es zu spät ist. Du kannst mich doch nicht ohne alle Informationen und Ratschläge hineinschneien lassen in diese Welt! Vielleicht wäre es am klügsten, das Ganze jetzt noch rückgängig zu machen. Bitte, bitte, hilf mir! Vielleicht kannst du mich verschwinden lassen. Du weißt, ich bin stolz. Ich möchte mich nicht gern blamieren.«
So peinlich dieses Bekenntnis für einen Reiseschriftsteller auch sein mag, in diesem Augenblick war meine Eitelkeit, mein Hochmut und meine Angst größer als meine Neugier und die gebotene journalistische Abenteuerlust. B.H. aber kümmerte sich nicht um mich, sondern hatte jetzt einige Mühe, das letzte Kügelchen ins letzte Löchlein zu bringen und damit das Ziel auf uns zu bewegen.
»Sei nur nicht nervös«, sagte er, ohne aufzuschauen, »du wirst gar nichts spüren ... Heute abend wirst du noch dein eigenes Instrument besitzen.«
Und er faßte mich mit seiner freien Hand unter, so daß wir eine Einheit bildeten.
Als das Kügelchen endlich in das Löchlein des »Scharf eingestellten Wunsches« sprang, gab es einen kleinen, angenehmen Knacks, nicht ein Zehntel so deutlich wie der leichte elektrische Schlag, den man an klaren Wintertagen in New York erhält, wenn einem jemand die Hand reicht. Ich erwartete nun, die Ferne werde lautlos aber rapid unserm festen Standort entgegenstürzen. Nichts dergleichen geschah. Man mußte schon einen scharfen Beobachtungssinn besitzen, um unmittelbar zu erkennen, daß sich Zahl, Lage und Anordnung der großen Baumhaufen ringsum auf der endlos öden Ebene ohne Übergang verändert hatten. Einer dieser dichten Baumbestände lag nun keine fünfzehn Schritte von uns entfernt. Blaß leuchteten die wächsernen Blüten mit ihren vagen Farbandeutungen von den regungslosen Zweigen im schwarzen, ledernen Laub. Wir waren am Ziel, oder genauer, das Ziel war an uns. Wir begannen, unsre Beine zu bewegen, B.H. seine sichtbaren, ich meine unsichtbaren. Es war ein merkwürdiges Vergnügen, auf diesem grauhaarigen Rasenteppich auszuschreiten, mit dem der ganze gealterte Erdball belegt zu sein schien.
Plötzlich konnte ich mich nicht länger beherrschen, blieb stehn und schrie B.H. an:
»Ich gehe keinen Schritt weiter, ehe du mir nicht sagst, was du unter dem ›ungeheuern Ereignis‹ verstehst, mit dem du mich nicht erschrecken willst ...«
Viertes Kapitel
Worin ich die geforderte Belehrung empfange, das Haus der Hochzeiter betrete und dem Kreis erscheine, der mich zitiert hat.
»Es war ein ganz gewöhnlicher Tag«, begann B.H., »ein Wochentag ...«
Er unterbrach sich und blickte mit gerunzelter Stirn auf den wundervoll gepflegten, eisengrauen Rasen hinaus, der ganz unverständlichermaßen die glatte Erde bedeckte, von Horizont zu Horizont. Ich spürte, daß es meinem Freunde eine ganz beträchtliche Selbstüberwindung kostete, über »das Ereignis« zu sprechen. Um ihm die Sache zu erleichtern, schaltete ich immer wieder Fragen ein. Zum Beispiel folgende:
»Und du warst an diesem ganz gewöhnlichen Tage wieder einmal am Leben, B.H., wie?«
»So genau kann ich das nicht immer sagen, F.W.«, erwiderte er streng. »Merk dir’s! Manchmal nämlich vermischt sich in meinem Bewußtsein die eigene persönliche Erfahrung mit dem allgemeinen historischen Wissen. Das Ereignis aber bleibt meine eigene Erfahrung, obwohl es der größte allgemeine Eindruck ist, welchen die Menschheit jemals hatte. Du weißt ja selbst, daß große Eindrücke und schwere Wunden erst nach und nach fühlbar werden, und daß die Erinnerung den Augenblick der Verwundung oft auszustoßen trachtet. Es war jedenfalls ein Tag wie jeder andere Tag ...«
»Verzeih, B.H.«, unterbrach ich ihn neuerdings, »könntest du vielleicht das Datum dieses alltäglichen Wochentags näher bestimmen?«
»Wenn dir mit einem Datum gedient ist«, zuckte er die Achseln, »bitte schön. Es war ein überaus bewölkter Freitag. Und sonst, was jedes Kind seit undenklichen Zeiten weiß, war’s ein dreizehnter November ...«
»Daß es heutzutage noch einen bewölkten Alltag oder gar einen echten grauen Novemberdreizehnten geben könnte, das scheint mir sehr zweifelhaft«, sagte ich, indem ich die seltsam trockene Luft einschnupperte und zum nackten, unbeschützten Blau des Himmels aufblickte.
»Das hast du ganz richtig erkannt, F.W.«, lobte mich mein Freund. »Wolken sind eine große Köstlichkeit, die wir astromentalen Menschen hoch verehren ...«
»Aber zu einem echten dreizehnten November gehört eine Großstadt«, schloß ich, nicht ohne Starrsinn.
»Mein Gott, du stehst doch auf dem Boden einer Großstadt«, erklärte B.H., leise enerviert.
»Ich nehme an«, mokierte ich mich, »daß deine Großstadt an jenem dreizehnten November sich anders präsentiert hat.«
»Das ist doch selbstverständlich, F.W.«, wies der Wiedergeborene meinen leichten Spott zurück. »Natürlich hat sie anders ausgesehen und hat hundert Jahre vorher und hundert Jahre nachher wieder ganz anders ausgesehen. Der Weg ist lang, mein Lieber, den ich komme. Damals, am dreizehnten November, gab es entweder noch oder schon wieder Häuser über der Erde. Das Mentelobol freilich war noch nicht bekannt. Wir bewegten nicht das Ziel auf uns zu, sondern uns auf das Ziel zu, mit enormer und höchst ungesunder Geschwindigkeit. Du hättest deine Freude gehabt an jener Großstadt. Man trat durch die labyrinthischsten Passagen auf die Straße hinaus. Es gab noch den fröhlichsten Unterschied zwischen Trottoir und Fahrbahn. Es gab dichten Verkehr. Oben flogen die Gyroplane. Ihre Geschwindigkeit machte sie so unsichtbar, wie du es zum Beispiel jetzt bist, F.W. Unten stauten sich Frauen und Männer und Kinder vor den mächtigen Schaufenstern, hinter welchen Tag und Nacht die glänzendsten Revuen und Operetten von großen Künstlern aufgeführt wurden. Sogar an den lieben Milchmann erinnere ich mich noch, dessen Wägelchen mit den Schlittenschellen von einem Hund gezogen wurde. Jene Zeit war halt ziemlich zurückgeblieben.«
»Und es regnete«, versuchte ich B.H. aufs Thema zurückzubringen.
»Nein, es regnete nicht«, sagte er versonnen, »es nieselte nicht einmal, es war nur sehr dunkel. Nachher stellten die Journalisten eine Weltuntergangsstimmung fest, die vorher geherrscht habe. Ich und niemand von meinem Kreis hatte das geringste davon bemerkt. Freilich, das darf ich nicht vergessen: die furchtbare Aufregung der Vögel fiel selbst den naturblinden Großstädtern auf.«
»Und wann begann das mit der Aufregung der Vögel?«
»Es soll kurz nach Mitternacht begonnen haben. Durch einen seltenen Zufall verbrachte ich jene Nacht auf den dreizehnten zu Hause. Millionen von Vögeln fielen in die Großstadt ein, von der ich spreche. Bitte, frag nicht nach ihrem Namen. Ich weiß ihn absolut nicht mehr. Nach den Vögeln darfst du fragen, selbstverständlich. Alle Arten waren darunter, die es damals gab, große und kleine. Von Kondoren, Geiern, Habichten, Kormoranen herunter bis zu Schwalben, Meisen und Spatzen. Mehr Namen von Vögeln sind mir nicht mehr geläufig. Die flachen Dächer, Dachgärten, Schau- und Wohntürme, Balustraden, Antennen, Feinmetallgerüste zum Empfange kosmischer Wellen und Strahlen, die Anlagen der Fernsubstanzzerstörer, all das war schwarz, pechschwarz von großen und kleinen Vögeln, die dicht nebeneinander hockten und ein gewaltiges Klagegeschrei und Gezwitscher erhoben, das sich nicht beschreiben läßt. Es war ein einziger, scharfgezackter Wehelaut, der unter den tiefhängenden Wolken vibrierte ...«
»Und das nennst du einen ordinären Alltag«, schüttelte ich den Kopf.
»Er war es«, nickte B.H., »ein ganz ordinärer Wochentag, ein Freitag, ein dreizehnter November wieder einmal. Die ersten Extrablätter berichteten die Sache mit den Vögeln bereits um zwei Uhr morgens ebenso wie die verschiedenen wellenversendenden Agenzien. Den Uranographen, den du vermutlich bald kennen lernen wirst, gab’s damals noch nicht. Wir durchliefen gerade eine stark rationalistische Epoche, und das Vertrauen in die Wissenschaft war unbedingter, als du es je erlebt hast, F.W. Die gelehrten Institute nahmen die Angelegenheit noch mitten in der Nacht in die Hand. Um vier Uhr früh war das Phänomen geprüft, analysiert und erklärt. Es hing zusammen mit irgendwelchen elektromagnetischen Unregelmäßigkeiten, die zum Entstehen ganzer Ketten von Kugelblitzen in den untern Schichten der Atmosphäre geführt hatten.«
»Immer weniger Alltag, mein Bester«, fiel ich ein und spürte genau, wie ich mit den Schultern zuckte, obwohl sie unsichtbar waren.
»Glaub mir, F.W., bis auf das Vogelgeschrei war’s der banalste Freitag, den du dir denken kannst. Und wie lange braucht eine richtige Metropole, um über das extremste Geschrei zur Tagesordnung überzugehen? Zwei, drei Stunden. Um elf Uhr dreißig hatte sich die Welt bereits daran gewöhnt, und die Schlagzeilen der Mittagszeitungen beschäftigten sich wieder mit den Eheaffären eines weltberühmten Ventriloquisten ...«
»Und um elf Uhr fünfundfünfzig?«, fragte ich.
»Da begann ich gerade mein Gesicht einzuseifen«, erwiderte B.H., voll Nachdenklichkeit. »Um diese Zeit erhob sich damals der arbeitende Kulturmensch. Dies ist nämlich eine meiner gesichertsten Erfahrungen im Laufe so mancher Wiedergeburten: Je fortgeschrittener die Menschheit, um so später steht sie auf.«
»Und um zwölf Uhr zwanzig?«, fragte ich hartnäckig weiter.
»Um zwölf Uhr vierundvierzig«, sagte er und machte eine längere Pause, ehe er fortfuhr, »um zwölf Uhr vierundvierzig verließ ich meinen komfortablen Lebensraum, um einer Einladung zum Frühstück Folge zu leisten. Es ist übrigens durchaus unwahr, daß wir damals, wie ein geschichtsschreibender Witzbold es formulierte, in überaus praktischen ›Wohnsärgen‹ lebten, die sich nach unserm Hinschied mechanisch verkapselten und selbsttätig in die Erde versenkten. All das ist Schwindel. Unsere Lebensräume waren wohl recht klein, aber angenehm wie ein elastischer Handschuh. Längst waren die Zeiten vorüber, wo der Mensch um seinen Platz an der Sonne, und noch mehr um seinen Platz im Schatten zu kämpfen hatte ...«
»Jetzt ist es mindestens zwölf Uhr fünfzig Minuten, B.H.«, drängte ich ungeduldig, denn ich fühlte, wie er mir auf Seitenwegen entwischen wollte. »Du bist aus deinem Lebensraum, aus deinem Haus getreten. Ich fürchte, du wirst zu spät zum Lunch kommen ...«
»Ich werde überhaupt nicht zu diesem Lunch kommen, F.W.«, lächelte er träumerisch. »Ich werde gerade noch unseren städtischen Park in der nächsten Nähe erreichen. Du weißt, daß ich immer die Fortbewegung per pedes apostolorum geschätzt habe. Meine Absicht war’s auch diesmal, zu den Freunden, die mich eingeladen hatten, ganz gemächlich hinzubummeln. Ich kam freilich nicht weit ...«
»Weil inzwischen das Ereignis eintrat?«, trieb ich ihn vorwärts. Er sah sonderbar verstört durch mich hindurch. Die Erinnerung schien ihn noch immer zu verwirren.
»Wie kann man«, fragte er ins Leere, das ich war, »von etwas, was keine oder fast keine Zeit in Anspruch nimmt, leichtfertig sagen, es trete ein?«
»Fast keine Zeit ist immerhin so gut wie jede andere Zeit«, erklärte ich. »Das Ereignis währte demnach den Bruchteil einer Sekunde, B.H.? Vielleicht kannst du diesen Bruchteil in Zahlen ausdrücken ...«
»Und ob ich’s kann«, entgegnete er und schrieb in die Luft sehr geschwind eine beträchtliche Reihe von Nullen, an deren Ende er energisch einen Einser setzte.
»Ich verstehe nichts davon«, erwog ich, »aber ich denke, ein Bruchteil von solcher Winzigkeit kann ja gar nicht sinnlich wahrgenommen werden.«
»Gar nicht sinnlich wahrgenommen werden«, wiederholte er beinahe höhnisch. »Ich sage dir, wir alle glaubten, das Ereignis habe Ewigkeiten gedauert. Während es stattfand, waren wir wie aus der Zeit geworfen. Hinter der schweren, dicken Wolkenwand des dreizehnten Novembers flammte plötzlich vom Aufgang zum Niedergang das Empyreum auf, der Feuerhimmel, von dem die Menschen einst geglaubt hatten, daß er hinter allen anderen Himmeln liege. Wie soll ich dir das Ungeheuerliche schildern, es gab nichts mehr, keine Stadt, keine Häuser, keinen Park, keine Allee, keinen Baum, kein Ich, kein Du, es gab nur Licht, ein Licht aber, gegen das alles bekannte Licht die schmutzigste Dämmerung war ...«
»Ich habe immer gefürchtet«, murmelte ich erschüttert, »die Sonne könne einmal eine Herzattacke oder einen Wahnsinnsanfall bekommen ...«
»Nenn’ es, wie du willst«, sagte er. »An jenem Freitag, dem dreizehnten November, drohte die Sonne mit sich selbst durchzugehn. Man kennt das ja von anderen Lichtgestirnen, die urplötzlich explodieren, das heißt zur millionenfachen Größe ihrer selbst anwachsen. Ich weiß nicht, ob wir in unserer gemeinsamen Gymnasialzeit schon etwas von der Novabildung gelernt haben, oder ob das erst eine viel spätere Entdeckung war. Das Große aber an unserer Sonne ist, daß sie zugleich, als sie mit sich durchging, sich selbst beherrschte und sich selbst in der Gewalt behielt. So kam es nur zu dem großen Ereignis der ›Transparenz‹ und nicht zur Vernichtung. Das Ereignis überschritt die Grenze des Geistigen kaum. Und doch, wir haben den Jüngsten Tag erlebt ...«
»Wie furchtbar muß es gewesen sein«, hörte ich mich murmeln, »wie furchtbar.«
»Furchtbar!«, rief er aus. »Es war herrlich, unausdrückbar herrlich! Wäre die Kürze des Augenblicks nur um eine fehlende Null länger gewesen, alles wäre vorbei für immer. Hätte irgendein Wesen auf Erden während der ›Transparenz‹ ein brennendes Streichholz in der Hand gehalten, die Atmosphäre hätte sich entzündet und wäre wie eine Flammenfahne in den Raum verpufft. Warum? Weil der Sauerstoff der Luft vor und nach der Transparenz einige Sekunden lang ums Dreifache vermehrt war. Aber es gab eben keine Streichhölzchen mehr auf Erden, kein offenes Feuer und nicht einmal Lavaströme. Da sind heute noch Gelehrte, die behaupten, die Vermehrung des Sauerstoffes in der Atmosphäre sei die Ursache der göttlichen Begeisterung, der unaussprechlichen Ekstase gewesen, die mich und alles andere, das lebte, in jenem Bruchteil von Zeit erfüllte ...«
»Wie soll ich mir vorstellen«, wunderte ich mich, »daß in einem solchen Bruchteil von Zeit sich überhaupt eine Empfindung entwickeln kann, B.H.?«
»Du kannst dir diesen Bruchteil ähnlich vorstellen, F.W., wie etwa die Steigerung in einem niemals erdachten Symphoniesatz. Ach Gott, das alles ist ein Blödsinn, und du kannst dir gar nichts vorstellen. Versuche aber trotzdem dir vorzustellen, du hättest bisher nur als Figur auf einem Bilde gelebt, und plötzlich brichst du leibhaftig und dreidimensional aus der Leinwand. Stell dir vor, das, was du bisher für dein Leben genommen hast, sei nichts als ein Krampf, eine verkümmernde Kontraktur aller Muskeln, und mit einem Schlage bist du von diesem Krampf erlöst und in der richtigen Haltung. So ungefähr empfanden wir das Leben während der Transparenz ... Oh, du hast viel verschlafen, F.W.«
»Ich habe mir nicht gewünscht, geweckt zu werden«, erwiderte ich ebenso unlogisch wie pikiert.
»Fühlst du dich wirklich so unwohl in deinem Mantel aus Durchsichtigkeit?«, fragte er, und ich merkte, daß ich ihn gekränkt hatte.
»Wenn ich deinen klaren Bericht überdenke, B.H.«, lenkte ich ein, »so hat es sich weniger um ein astronomisches Ereignis gehandelt, das unrettbar zum Untergang geführt hätte, als um ein unendlich kurzfristiges Schwanken in der Sonnennatur zwischen Dauer und Vernichtung, zwischen Fortstrahlen und Zusammenflammen, um einen Augenblick auf des Messers Schneide gleichsam, der sich in der Lichterscheinung ausdrückte, die du oder die Wissenschaft ›Transparenz‹ nennt. Ich verstehe die Begeisterung, die Ekstase des Jüngsten Tages und der Welterlösung, die diese Transparenz auslöste. Sonst aber scheint sie ergebnislos und ohne Folgen vorübergegangen zu sein ...«
»Sie hatte Folgen«, fiel er mir ins Wort, »die Transparenz verlief nicht nur wie ein Schauspiel ...«
»Aber keine physikalischen und chemischen Folgen«, warf ich ein, »bis auf die augenblickliche Vermehrung des atmosphärischen Sauerstoffs ...«
»Irrtum«, sagte B.H., »das Ereignis hatte eine Menge von physikalischen Folgen. Daß einige Millionen Menschen während der Transparenz starben, ist nicht so wichtig. Aber sieh nach oben, F.W., und du wirst die Folgen sehen, oder richtiger, nicht sehen ...«