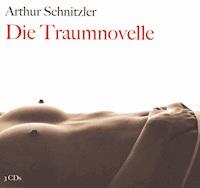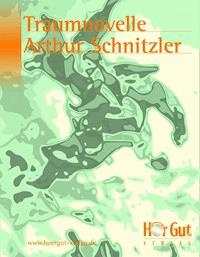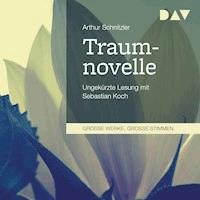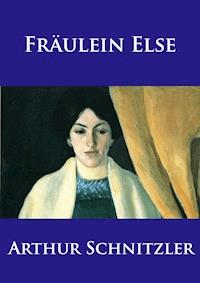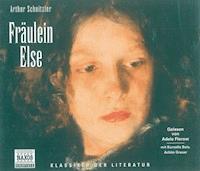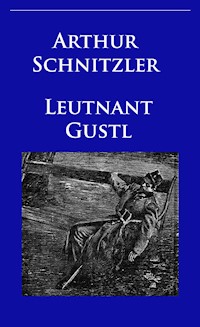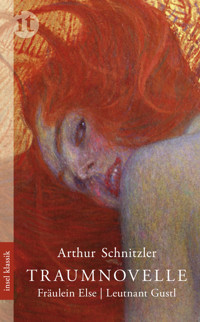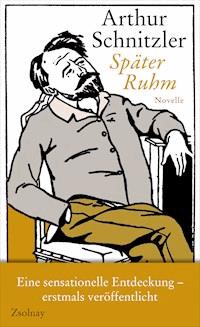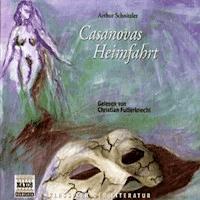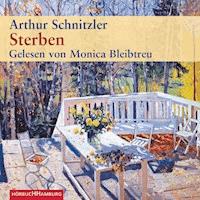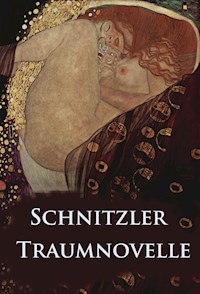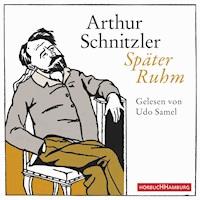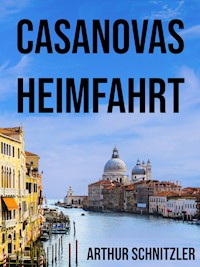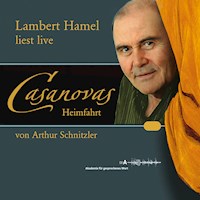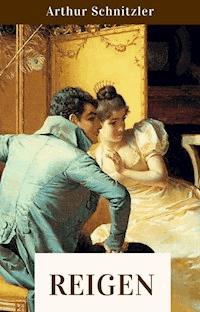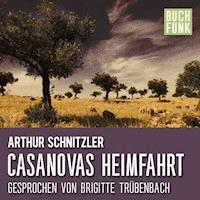Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dieser Erzählung von 1913 widmet sich Schnitzler seinem Lebens-Thema: dem Ausleben sexueller Bedürfnisse in einer rigiden Gesellschaft. Nach fünf Jahren sexueller Abstinenz gibt die Witwe Beate Heinold dem Drängen eines jugendlichen Verehrers nach, vermag aber nicht die durch eigene Erwartungshaltung und gesellschaftliche Normen ausgelösten Konflikte zu lösen. Auch noch einhundert Jahre später besitzt dieses Thema frappierende Aktualität ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arthur Schnitzler
Frau Beate und ihr Sohn
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Impressum neobooks
Erstes Kapitel
Es war ihr, als hätte sie ein Geräusch aus dem Nebenzimmer gehört. Sie sah von ihrem angefangenen Briefe auf, erhob sich, ging ein paar leise Schritte zur angelehnten Türe hin und blickte zuerst durch die Spalte in den benachbarten Raum, wo bei geschlossenen Läden ihr Sohn, anscheinend ruhig schlafend, auf dem Diwan lag. Dann erst trat sie näher heran und konnte nun beobachten, wie Hugos Brust in gleichmäßig starkem Knabenatem sich hob und senkte. Der weiche, etwas zerdrückte Hemdkragen stand über dem Halse offen, im übrigen aber war Hugo völlig angekleidet, sogar die Füße steckten in den genagelten Schuhen, die er hier auf dem Lande immer zu tragen pflegte. Offenbar hatte er sich in der Schwüle des Nachmittags nur für kurze Zeit hinlegen wollen, um bald, wovon die aufgeschlagenen Bücher und Hefte Zeugnis gaben, das Studium von neuem aufzunehmen. Jetzt warf er den Kopf nach der Seite, als wollte er erwachen; doch er reckte sich nur ein paarmal und schlief weiter. Aber die Augen der Mutter, die sich indes an den Dämmerton des Zimmers gewöhnt hatten, konnten nicht länger übersehen, daß der seltsam wie schmerzhaft gespannte Zug um die Lippen des Siebzehnjährigen, der ihr im Lauf der letzten Tage immer wieder aufgefallen war, auch im Antlitz des Schlafenden sich nicht lösen wollte. Beate schüttelte seufzend den Kopf, begab sich in ihr Zimmer zurück, schloß die Türe hinter sich leise ab und blickte auf den angefangenen Brief nieder, den fortzusetzen sie keine Neigung mehr fühlte. Doktor Teichmann, an den er gerichtet sein sollte, war ja doch nicht der Mann, dem gegenüber sie sich rückhaltlosaussprechen durfte; sie, die heute schon das allzu freundliche Lächeln bereute, mit dem sie ihn vor ihrer Abreise vom Kupeefenster aus zum Abschied gegrüßt hatte. Denn gerade in diesen Sommerwochen auf dem Lande, wo die Erinnerung an den vor fünf Jahren hingeschiedenen Gatten stets mit besonderer Lebendigkeit in ihr wach wurde, wies sie die noch nicht ausgesprochene, aber zweifellos zu erwartende Werbung des Advokaten gleich andern Zukunftsgedanken ähnlicher Art innerlich weit von sich; und sie sagte sich, daß sie von ihrer Sorge um Hugo zu dem Menschen am wenigsten reden konnte, der darin nicht so sehr einen Beweis des Vertrauens als ein bewußtes Zeichen der Ermutigung hätte sehen müssen. So zerriß sie den angefangenen Brief und trat unschlüssig ans Fenster.
Die Berglinien des jenseitigen Ufers verschwammen in zitternden Luftkreisen. Von unten, aus dem See, blitzte ihr, tausendfach zersplittert, das Sonnenbild entgegen, und sie rettete ihre geblendeten Augen mit einem fliehenden Blick über das schmale Wiesenufer, die staubatmende Landstraße, die blinkenden Villendächer und ein regungsloses Ährenfeld in das Grün ihres Gartens. Auf der weißen Bank unter dem Fenster ließ sie Blicke und Gedanken ruhen. Sie dachte daran, wie oft ihr Gatte hier gesessen war, über einer Rolle brütend, -- oder auch eingeschlummert, insbesondere, wenn die Lüfte so sommerträg über der Landschaft ruhten wie heute wieder. Dann hatte Beate sich wohl über die Brüstung gebeugt und mit zärtlichen Fingern das grauschwarze Kraushaar angerührt und darin gewühlt, bis Ferdinand, bald erwacht, aber zuerst in verstelltem Weiterschlummer die Liebkosung duldend, langsam sich wandte und zu ihr aufschaute, mit seinen hellen Kinderaugen, die an fernen, doch nie zu vergessenden Märchenabenden so wundersam heldenhaft und todesschwer zu blicken vermochten. Doch daran wollte, ja sollte sie gar nicht denken; gewiß nicht mit Seufzern, wie sie nun unwillkürlich auf ihren Lippen vergingen. Denn Ferdinand selbst -- in entschwundenen Tagen hatte er sich's von ihr zuschwören lassen -- wünschte sein Andenken nicht anders geweiht als durch heiteres Erinnern, ja durch ein unbekümmertes Ergreifen neuen Glücks. Und Beate dachte: Ist es nicht zum Erschauern, wie man vom Furchtbarsten in blühender Zeit zu sprechen vermag, scherzend und leicht, als drohe dergleichen andern nur und könnte einem selber gar nicht widerfahren! Und dann kommt es wirklich, und man faßt es nicht, und nimmt es doch hin; und die Zeit geht weiter, und man lebt; man schläft im gleichen Bette, das man einst mit dem Geliebten teilte, trinkt aus demselben Glas, das er mit seinen Lippen berührte, pflückt unter dem gleichen Tannenschatten Erdbeeren, wo man sie mit einem auflas, der niemals wieder pflücken wird; und hat nicht Tod noch Leben je ganz begriffen.
Auf dieser Bank draußen hatte sie manchmal an Ferdinands Seite gesessen, indes der Bub, von der Eltern zärtlichem Blick umfangen und gefolgt, mit Ball oder Reifen durch den Garten getollt war. Und so sehr sie es mit ihrem Verstande wußte, daß der Hugo, der da drin im Nebenzimmer, mit jenem neuen schmerzlich gespannten Zug um die Lippen, auf dem Diwan schlief, dasselbe Menschenkind war, das vor wenig Jahren noch im Garten gespielt hatte; -- mit ihrem Gefühl vermochte sie auch das nicht zu fassen, so wenig wie daß Ferdinand tot sein sollte, wahrhafter tot als Hamlet, als Cyrano, als der königliche Richard, in deren Masken sie ihn so oft hatte sterben sehen. Aber vielleicht blieb dies ihr nur deshalb für alle Zeit unbegreiflich, weil zwischen so blühendem Dasein und so dunklem Tod nicht etwa Wochen des Leidens und der Angst verstrichen waren; gesund und wohlgemut war Ferdinand eines Tages vom Hause zu irgendeinem Gastspiel weggefahren, und in der Stunde drauf, von dem Bahnhof, in dessen Halle ihn der Schlag gerührt, hatte man ihn als toten Mann wieder heimgebracht.
Während Beate diesen Erinnerungen nachhing, fühlte sie immerfort, wie irgend etwas anderes gespenstisch quälend und gleichsam auf Erlösung wartend, in ihrer Seele hin und her ging. Erst nach einigem Besinnen ward ihr bewußt, daß der letztbegonnene Satz ihres unvollendeten Briefes, in dem sie von Hugo erzählen wollte, ihr keine Ruhe ließ, und daß sie sich entschließen mußte, den zu Ende zu denken. Sie war sich klar darüber, daß sich in Hugo irgend etwas vorbereitete oder vollzog, was sie längst erwartet und was sie doch nie für möglich gehalten hatte. In früheren Jahren, als er noch ein Kind war, hatte sie gern den Gedanken gehegt, ihm später einmal nicht nur Mutter, sondern auch Freundin und Vertraute zu bedeuten; und noch bis in die letzte Zeit, da er ihr zugleich mit seinen kleinen Schulsünden auch die ersten knabenhaften Verliebtheiten zu beichten kam, durfte sie sich einbilden, daß ihr so seltenes Mutterglück beschieden sein könnte. Hatte er sie nicht die rührend-kindischen Verse lesen lassen, die er der kleinen Elise Weber, der Schwester eines Schulkollegen, gewidmet, und die diese selbst niemals zu Gesichte bekommen hatte? Und im vergangenen Winter erst, hatte er der Mutter nicht gestanden, daß ein kleines Fräulein, dessen Namen er ritterlich verschwieg, ihn in der Tanzstunde während eines Walzers auf die Wange geküßt hatte? Und im letzten Frühjahr, hatte er ihr nicht, verstört beinahe, von zwei Buben aus seiner Klasse berichtet, die in fragwürdiger Gesellschaft einen Abend im Prater verbracht und sich gerühmt hätten, erst des Morgens um drei wieder nach Hause gekommen zu sein? So hatte Beate zu hoffen gewagt, daß Hugo sie auch zur Vertrauten ernsterer Empfindungen und Erlebnisse erwählen, und sie imstande sein würde, ihn durch Zuspruch und Rat vor mancher Trübsal und Gefahr der Jünglingsjahre zu bewahren. Nun aber erwies sich, daß all dies nur Träume eines verwöhnten Mutterherzens gewesen waren; denn da die erste seelische Bedrängnis ihn anfiel, zeigte Hugo sich fremd und verschlossen, und die Mutter stand solchem ihr neuen Wesen scheu und ratlos gegenüber.
Sie zuckte zusammen. Denn im ersten Windhauch des späten Nachmittags, gleich einer höhnischen Bestätigung ihrer Seelenangst, sah sie in der Tiefe unten von dem Giebel der lichten Villa am See die verhaßte weiße Fahne wehen. Frech gezackt, der zudringlich lockende Gruß einer Verworfenen an den Knaben, den sie verderben wollte, flatterte sie zur Höhe auf. Unwillkürlich wie drohend erhob Beate die Hand; dann aber trat sie rasch ins Zimmer zurück, in einem unbezwinglichen Drang, ihren Sohn zu sehen und sich mit ihm auszusprechen. Sie legte ihr Ohr an die Verbindungstüre, um ihn nicht etwa aus gutem Schlummer aufzustören; und wirklich war ihr, als hörte sie wie früher seinen ruhigen starken Knabenatem gehen. Vorsichtig öffnete sie nun die Türe mit der Absicht, Hugos Erwachen abzuwarten und dann, neben ihm am Diwan sitzend, in mütterlicher Zärtlichkeit sein Geheimnis zu erfragen. Aber erschrocken gewahrte sie, daß das Zimmer leer war. Hugo war nicht mehr da. Er war fortgegangen, ohne wie sonst der Mutter Adieu zu sagen und sich den gewohnten Kuß auf die Stirne zu holen; -- offenbar aus Scheu vor der Frage, die er seit Tagen auf ihren Lippen sich hatte vorbereiten gesehen und die sie, nun erst wußte sie's, heute, jetzt, in dieser Viertelstunde an ihn gerichtet hätte. So weit also war er, so entrückt ihr durch seine Unruhe, durch seine Wünsche allein. Das hatte aus ihm der erste Händedruck jener Frau gemacht, neulich auf der Landungsbrücke; das ihr Blick, der ihn gestern von der Galerie der Schwimmanstalt aus lächelnd gegrüßt hatte, da sein lichter Knabenleib aus den Wellen emporgetaucht kam. Freilich, -- er war siebzehn vorüber; und niemals hatte die Mutter sich eingebildet, daß er sich aufbewahren würde für eine, die ihm bestimmt wäre, vom Anbeginn aller Tage, und die ihm begegnen würde, jung und rein wie er selbst. Nur dies eine ersehnte sie für ihn: daß er nicht mit Ekel aus seinem ersten Rausch erwachte, mit seiner duftenden Jugend nicht der Lust einer Frau zum Opfer fiele, die ihren halbvergangenen Bühnenruhm nur einer schillernden Dirnenhaftigkeit verdankte und deren Wandel und Ruf auch in ihrer späten Ehe keine Änderung erfahren hatten.
Beate saß auf Hugos Diwan im halbdunklen Zimmer, mit geschlossenen Augen, den Kopf in die Hände gestützt, und überlegte. Wo mochte Hugo sein? Bei der Baronin am Ende? Das war undenkbar. So rasch konnten diese Dinge sich nicht vollziehen. Aber, bestand überhaupt noch eine Möglichkeit, den geliebten Buben vor einem so kläglichen Abenteuer zu bewahren? Sie fürchtete, nein. Denn sie ahnte ja: wie Hugo die Züge seines Vaters trug, so rann auch dessen Blut in ihm, das dunkle Blut jener Menschen aus einer andern, gleichsam gesetzlosen Welt, die als Knaben schon von männlich-düsteren Leidenschaften durchglüht werden und denen noch in reifen Jahren Kinderträume aus den Augen schimmern. Das Blut des Vaters nur? Rann das ihre etwa träger? Durfte sie sich das heute einbilden, einfach darum, weil seit dem Tode des Gatten keine Versuchung an sie herangetreten war? Und weil sie niemals einem andern gehört hatte, war darum minder wahr, was sie dem Gatten einstmals gestanden: daß er nur darum ihr ganzes Leben als Einziger erfüllt hatte, weil in den tiefen Nächten, da ihr sein Antlitz verdämmerte, er ihr immer wieder einen andern, einen neuen bedeutete, -- weil sie in seinen Armen des königlichen Richard Geliebte war und Cyranos und Hamlets und all der andern, die er spielte: die Geliebte von Helden und Bösewichtern, Gesegneten und Gezeichneten, spiegelklaren und rätselvollen Menschen? Ja, hatte sie nicht, halb unbewußt, nur darum schon als junges Mädchen den großen Schauspieler sich zum Gatten gewünscht, weil eine Verbindung mit ihm ihr die einzige Möglichkeit bot, den ehrbaren Lebensweg zu gehen, der ihr nach ihrer bürgerlichen Erziehung vorgezeichnet schien, und doch zugleich das abenteuerlich-wilde Dasein zu führen, nach dem sie in verborgenen Träumen sich sehnte? Und sie erinnerte sich, wie sie sich Ferdinand, nicht nur gegen den Willen ihrer Eltern, deren frommer Bürgersinn den leisen Schauder vor dem Komödianten auch nach vollzogener Heirat nie ganz verwinden konnte, sondern auch gegen einen viel bedenklicheren Feind zu erobern verstanden hatte. Zur Zeit, als sie Ferdinand kennenlernte, stand er in stadtbekannten Beziehungen zu einer nicht mehr jungen, reichen Witwe, die den jungen Schauspieler in seinen Anfängen vielfach gefördert, ja öfters seine Schulden bezahlt haben sollte, und von der loszureißen es ihm, wie es hieß, nun an der nötigen Willenskraft fehlte. Damals hatte Beate den romantischen Entschluß gefaßt, den herrlichen Mann aus so unwürdigen Banden zu befreien: und in Worten, wie sie nur das Bewußtsein einer niemals wiederkehrenden Stunde einzugeben vermag, von der alternden Geliebten Ferdinands die Lösung eines Verhältnisses gefordert, das an seiner inneren Unwahrheit doch über kurz oder lang, und dann vielleicht zu spät für das Heil des großen Künstlers und der Kunst zusammenbrechen müßte. Wohl erfuhr sie damals eine spöttisch-verletzende Abweisung, an der sie lange trug, und es dauerte noch ein volles Jahr bis zu Ferdinands endgültiger Befreiung; aber daß jene Unterredung den ersten Anlaß hierzu bedeutet, daran hätte Beate nicht zweifeln können, auch wenn ihr Gatte nicht selbst, immer wieder, auch vor Leuten, die es nicht im geringsten kümmerte, die Geschichte mit heiterem Stolz zum besten gegeben hätte.
Beate ließ die Hände von den Augen sinken und erhob sich in plötzlicher Erregung vom Diwan. Wohl lagen bald zwanzig Jahre zwischen jenem törichtkühnen Schritt und heute; aber war sie seither eine andere geworden? War in ihr heute nicht die gleiche Zielbewußtheit und der gleiche Mut? Durfte sie sich heute nicht mehr zutrauen, das Schicksal eines Menschen, der ihr teuer war, nach ihrem Sinn zu lenken? War sie die Frau, die stumm warten mußte, bis ihres Sohnes junges Leben beschmutzt und für immer zerstört war, statt, wie einst vor jene andere, heute vor die Baronin hinzutreten, die am Ende doch auch eine Frau war und es irgendwo, wenn auch im verstecktesten Winkel ihrer Seele, verstehen mußte, was es bedeutete, Mutter zu sein? Und dieses Einfalles wie einer Erleuchtung froh, trat sie zum Fenster, öffnete die Läden, und in neuer Hoffnung nahm sie das Bild der lieben Landschaft wie einen Gruß der Verheißung in sich auf. Doch sie fühlte, daß es darauf ankam, den kühnen Entschluß noch mit dem Selbstvertrauen des ersten Augenblicks zur Tat zu machen; ohne weiteres Zögern begab sie sich daher in ihr Schlafzimmer und klingelte dem Mädchen, das ihr beim Ankleiden heute mit besonderer Sorgfalt behilflich sein mußte. Sobald dies zu ihrer Zufriedenheit besorgt war, setzte sie ihren breitkrempigen Panamahut mit dem schmalen schwarzen Band auf das dunkelblonde, dichtgewellte Haar, wählte aus dem Blumenglas, das auf dem Nachtkästchen stand, von den drei roten Rosen, die sie heut Morgen vom Stock geschnitten, die frischeste, steckte sie in den weißen Ledergürtel, nahm ihren schlanken Bergstock in die Hand und verließ das Haus. Sie fühlte sich froh, jung und ihrer Sache gewiß.
Als sie vor die Türe trat, stand das Ehepaar Arbesbacher vorn am Gartengitter, er in Lodenjoppe und Lederhose, eben im Begriff, den Taster zu drücken, sie in einem dunkelgeblümten Kattunkleid, das im Verhältnis zu den etwas verhärmten, aber noch jugendlichen Zügen einen allzu matronenhaften Zuschnitt zeigte.
»Küß die Hand, gnä' Frau,« rief der Baumeister, lüftete den grünen Hut mit dem Gamsbart und behielt ihn in der Hand, so daß der weiße Kopf eine Weile unbedeckt blieb. »Wir wollen Sie grad abholen« -- und auf ihren fragenden Blick -- »haben Sie denn vergessen, gnä' Frau? heut ist ja Donnerstag, Tarockpartie beim Direktor.«
»Ja richtig«, sagte Beate, sich erinnernd.
»Grad sind wir dem Herrn Sohn begegnet«, bemerkte die Baumeisterin, und über die verblühten Züge zog ein müdes Lächeln.
»Mit zwei dicken Büchern ist er da hinauf«, ergänzte der Baumeister und deutete gegen den Pfad, der über die sonnige Wiese zum Walde aufwärts führte ... »Ein fleißiger Jüngling.«
Beate lächelte mit einem Ausdruck unverhältnismäßiger Glückseligkeit. »Im nächsten Jahr hat er Matura«, sagte sie.
»Nein, wie schön die Frau heut wieder aussieht!« äußerte die Baumeisterin ganz unvermittelt in einem Ton, der vor Bewunderung beinahe demütig wurde.
»Na, wie wird uns denn zumut sein, Frau Beatelinde,« sagte der Baumeister, »wenn wir so plötzlich einen erwachsenen Sohn haben, der auf die Universität geht, sich duelliert und den Weibern die Köpf' verdreht?«
»Aber hast denn du dich duelliert?« warf seine Gattin ein.
»Na, so hab' ich mich halt herumgeschlagen, 's kommt aufs selbe heraus. Blutige Köpf gibt's so und so!«
Sie spazierten den Weg hin, der oberhalb der Ortschaft, mit dem Blick über den See hin, zur Villa des Bankdirektors Welponer führte.
»Ja, ich geh' da mit Ihnen so weiter,« sagte Beate, »aber eigentlich müßte ich noch in den Ort hinunter ... nämlich auf die Post, wegen eines Paketes, das vor acht Tagen in Wien aufgegeben worden und noch immer nicht da ist. Noch dazu per Eilgut«, setzte sie so ungehalten hinzu, als glaubte sie selbst an die Geschichte, die sie plötzlich erfunden hatte, sie wußte selbst nicht warum.
»Vielleicht kommt's mit dem Zug, Ihr Packerl«, sagte die Baumeisterin und wies nach unten, wo die kleine Eisenbahn eben pfauchend und wichtigtuerisch hinter dem Felsen hervorkam und mitten durch das Wiesenland dem etwas erhöhten Bahnhof zufuhr. Zu allen Fenstern steckten Reisende die Köpfe heraus, und der Baumeister schwenkte seinen Hut.
»Was hast denn?« sagte seine Frau.
»Es werden ja jedenfalls Bekannte dabei sein, und man ist doch ein höflicher Mann.«