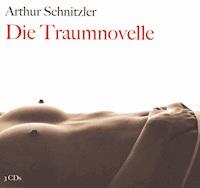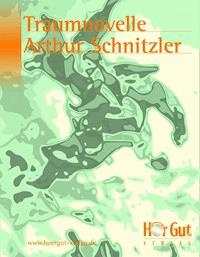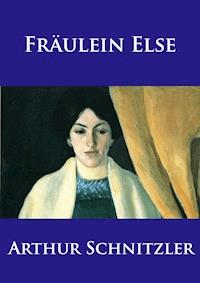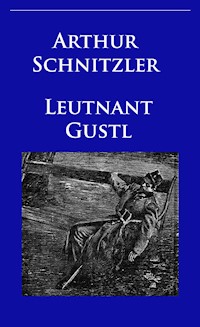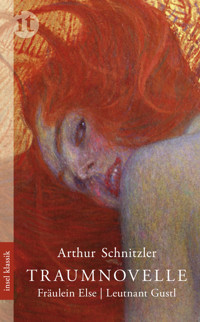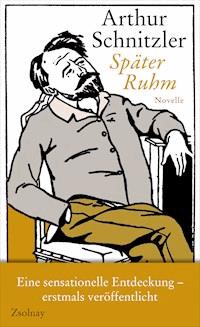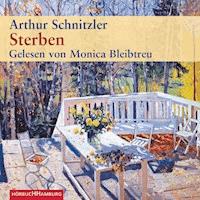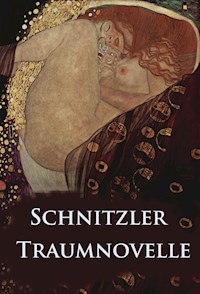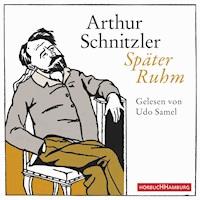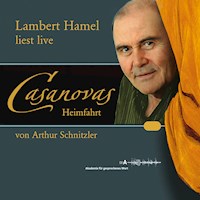Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Frauengeschichten: Irrfahrten durch die Abgründe der Seele" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen Arthur Schnitzler (1862-1931) war ein österreichischer Erzähler und Dramatiker. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne. Schnitzler schrieb Dramen und Prosa, in denen er das Augenmerk vor allem auf die psychischen Vorgänge seiner Figuren lenkt. Gleichzeitig mit dem Einblick in das Innenleben der Schnitzlerschen Figuren bekommt der Leser auch ein Bild von der Gesellschaft, die diese Gestalten und ihr Seelenleben prägt. Die Handlung der Werke Schnitzlers spielt meist im Wien der Jahrhundertwende. Viele seiner Erzählungen und Dramen leben nicht zuletzt vom Lokalkolorit. Ihre handelnden Personen sind typische Gestalten der damaligen Wiener Gesellschaft: Offiziere und Ärzte, Künstler und Journalisten, Schauspieler und leichtlebige Dandys, und nicht zuletzt das süße Mädel aus der Vorstadt, das zu so etwas wie einem Erkennungszeichen für Schnitzler wurde sowie simultan für seine Gegner zu einem Stempel, mit dem sie Schnitzler als einseitig abqualifizieren wollten. Es geht Schnitzler meist nicht um die Darstellung krankhafter seelischer Zustände, sondern um die Vorgänge im Inneren gewöhnlicher, durchschnittlicher Menschen mit ihren gewöhnlichen Lebenslügen, zu denen eine Gesellschaft voll von ungeschriebenen Verboten und Vorschriften, sexuellen Tabus und Ehrenkodices besonders die schwächeren unter ihren Bürgern herausfordert. Inhalt: Die Braut Komödiantinnen Die Toten schweigen Die Fremde Die griechische Tänzerin Die Hirtenflöte Das Tagebuch der Redengenda Frau Beate und ihr Sohn Fräulein Else Frau Bertha Garlan Therese
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1170
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauengeschichten: Irrfahrten durch die Abgründe der Seele
Die griechische Tänzerin + Komödiantinnen + Fräulein Else + Die Fremde + Die Hirtenflöte + Die Toten schweigen + Die Braut + Das Tagebuch der Redengenda + Frau Bertha Garlan + Therese und mehr
Inhaltsverzeichnis
Die Braut
Inhaltsverzeichnis
Studie
Auf einem Maskenball lernte ich sie kennen, nach Mitternacht. Ihre klugen und ruhigen Augen hatten mir gefallen und das dunkelblaue Kleid, das sie trug. Sie war nicht maskiert und machte durchaus kein Hehl aus ihrer wahren Person. Sie gehörte zur Kategorie der aufrichtigen Dirnen und hatte selbst in dem Maskentrubel, der alle Frauen so sehr dazu reizt, durchaus kein Bedürfnis, Komödie zu spielen. Das erfrischte mich, da ich mich von all den trivialen Faschingslügen, die mich umschwirrten. recht ermüdet und angewidert fühlte.
Sie war ungewöhnlich intelligent, man hörte es ihren Reden und sah es ihren Bewegungen an, daß sie aus besseren Kreisen herkam. Bei ihr lag die Frage besonders nahe, die man so oft an Weiber ihrer Art stellt, um schließlich immer dieselbe abgedroschene Geschichte zu hören, wie es denn eigentlich dahin mit ihnen gekommen. Von dieser aber mit den klugen Augen vermutete ich etwas anderes zu vernehmen, und darum blieb ich mit ihr zusammen.
Es ging gegen Morgen zu, als wir, vom Champagner ein wenig angeduselt, einen Wagen nahmen und in den Prater fuhren. Es war im März, eine merkwürdig linde Nacht. Momente lang hatte ich das Gefühl, als wenn da ein Wesen an meiner Seite lehnte, das ich schon lange, lange kannte und sehr lieb hätte. Mir war sehr wohl neben ihr, und geraume Zeit sprachen wir gar nichts. Ich konnte mich nicht entschließen, sie schlechthin als das Weib zu nehmen, das den Abschluß einer lustigen Nacht bedeutet, ich wollte sie kennenlernen. Von ihrem Leben wollte ich wissen, von ihrer Jugend, von den Männern, die sie geliebt, bevor sie sich entschloß, alle zu lieben, die sie wollten.
Hier gab es ein Schicksal zu entdecken, und endlich, wie wir schon weit unten im Prater waren, nach langem Schweigen, fragte ich sie. Sie ließ sich nicht lange um eine Antwort bitten. Freilich hab’ ich nun die Worte, mit denen sie mir schlicht und bereitwillig ihr Bekenntnis ablegte, vergessen, aber die Geschichte selbst steht mir eigentlich klarer vor Augen als in der Stunde, da ich sie vernahm. Übergänge haben sich für mich gefunden, Lücken, welche sie im Erzählen ließ, habe ich unbewußt im Bedenken, im Erinnern ausgefüllt.
Sie war aus einer guten Familie, aus einer sehr geachteten und bekannten, behauptete sie sogar, und man hatte sie zu Hause streng erzogen. Aber ihre Sinne erwachten früh und in heftigem Verlangen. In den einsamen Nächten ihrer frühreifen Mädchenzeit hatte sie viele Qualen zu überstehen, und ein seltsamer Vorsatz bildete sich in ihr, aus unklaren Wünschen zu immer festerer Gestaltung. Sie wollte warten, bis sich der Gatte gefunden, denn das mußte sie wohl, dann aber, wenn die Gefahr vorüber, wollte sie sich freimütig den ursprünglichen und wilden Trieben ihrer Natur, wollte sich jedem hinschleudern, der ihr gefiel… Männerschönheit und Männerstärke genießen, wo sie sich bot.
Mit siebzehn Jahren verlobte sie sich, und nun kam in ihrem Leben eine kurze Zeit, über die sie sich in fast sentimentalen Worten ausließ. Da fand ich jene merkwürdige Stelle in ihrem Herzen, die man auch in den Verworfensten entdeckt – das Heimweh nach der Unschuld. Denn es gibt ja auch ein Heimweh für die Heimatlosen, und vielleicht empfinden die es am schmerzlichsten von allen. Daß man eine Heimat überhaupt hat, ist schon ein wenig Trost, der aber fehlt den andern.
Nun aber geschah etwas Seltsames. Sie begann den Bräutigam, der ihr anfangs nur Mittel zum Zwecke bedeutet hatte, ernstlich zu lieben. Anfangs wollte sie sich’s selbst nicht glauben; aber sie mußte es endlich, denn wie anders war es zu erklären, daß sie sich plötzlich ihrer früheren Vorsätze zu schämen anfing – so heftig und schmerzlich, wie vielleicht keine Sünderin der Tat sich der Vergangenheit zu schämen vermag –, daß sie bereute? Sie wollte ihm eine brave Gattin werden, treu und ergeben. Sie wurde ruhiger. Ihre Empfindungen bekamen einen eigentümlichen Hauch von Frieden und Keuschheit, und sie liebte ihn tief. Ein paar Monate, oder waren es nur Wochen, ich weiß es nicht mehr – dauerte dieser Zustand an. Der Tag der Hochzeit rückte näher. Da regte sich allmählich wieder die alte Raserei in ihr. Vielleicht lag da ein besonderer Grund vor, über den sie sich selbst nicht klar war, vielleicht war es nur der natürliche Gang, und die kurze Periode der Beruhigung nahm ihr Ende, weil das eben in dem Temperament des Mädchens lag. Es kam in einer entsetzlichen Weise über sie. Zehnmal war sie daran – nicht sich ihrem Verlobten hinzugeben – nein… ihn zu nehmen, selbst zu nehmen, mit sich zu ziehen in das dunkle Zimmer neben dem Salon – oder dorthin in die Nische – oder dort… Aber die Umstände fügten es nicht, sie war nie allein mit ihm. Vielleicht auch verließ sie der Mut, wenn die Gelegenheit kam, und bald begann sie auch wieder zu merken, wie ihre Glut ins Allgemeine ging, wie er eigentlich nicht mehr der Geliebte war. Ja, sie wollte ihn – freilich – aber auch den – und jenen – und jenen – und alle. Sie fühlte, daß es unabänderlich vorbei war mit ihrer einen, ach, mit ihrer Liebe überhaupt. Es war wieder Trieb geworden, wütender, durstiger Trieb, der den Mann wollte, einfach den Mann, nicht ihn, den einen! Etwas war dennoch von ihrer tiefen Neigung zurückgeblieben: sie war dem Mann, der sie unendlich Hohes hatte empfinden lassen, der sie aus der Dumpfheit fiebernden Verlangens für einige Zeit zur schönen Heiterkeit der Liebe hinaufgehoben hatte, diesem Mann war sie etwas schuldig geworden. Wahrheit!… Es wühlte in ihr, es ließ sie nicht ruhn. Sie mußte sich ihm entdecken. Sie wußte, was es für ein Ende nehmen mußte. Darum wünschte sie ihn von Schmach und Gram frei zu erhalten. Sie war nicht geschaffen zum braven Weib, aber sie wollte auch nicht das seine werden, den sie vielleicht schon nach der ersten Nacht hätte betrügen müssen – und der sie dann – das schwebte ihr wohl auch dunkel vor – am nächsten Tage davongejagt hätte. Der Gedanke, daß er ihr am Ende genügen, daß mit seinem Besitz ihr Wahnsinn gemildert, gestillt sein könnte, war ihr zu einer kindischen Erinnerung geworden, aber gestehen wollte sie’s ihm, ihm sagen: Ich bin nicht geschaffen, deine brave Hausfrau zu werden, laß mich frei.
Die Zeit rückte vor. Die ruhigen und festen Grenzen ihrer Liebe zu dem einen vermischten sich mehr und mehr und flossen auseinander zu den zitternden Linien einer schmerzlichen, ungestillten, kaum mehr zu zügelnden Sehnsucht nach dem Manne.
Und eines Abends – sie schilderte mir die Stimmung jenes Abends mit frappierender Kraft, wie sie nur das sichere Bewußtsein von der Bedeutsamkeit eines Erlebnisses besitzt –, eines Abends, im Hause ihrer Eltern, im Salon, der in das Halbdunkel von matten, farbigen Lampen getaucht war, während sie mit ihm an dem offenen Fenster stand, das auf eine reiche und helle Straße hinausführte, da gestand sie’s ihm ein. Alles. Die brennenden Wünsche ihrer kaum erwachten Jugend, die kurze Zeit ihrer stillen erwachenden Glückseligkeit und endlich das rasche Untergehen dieses Traumes. Er war wie erstarrt. Nie hatte er Ähnliches in dem braven Mädchen aus gutem Hause vermutet, das er mit der freudigen Zustimmung seiner Eltern zur Frau nehmen wollte und in dem er wahrscheinlich auch das zu finden hoffte, was wir ja alle von unserem künftigen Weibe erwarten: den wundersamen, heiligen, tugendhaften Kontrast zu der tollen Leidenschaftlichkeit unserer Jugendliebeleien… Er versuchte ihr zu widersprechen. Er wollte ihr klarmachen, daß sie sich über sich selber täusche, daß sie ein natürliches und im Grunde schönes Verlangen heruntersetze und entweihe, weil sie sich in ihrer stolzen Jungfräulichkeit desselben schäme. Es war vergebens. Je eindringlicher er sie über ihren Zustand beruhigen wollte, mit um so heftigeren und deutlicheren und frecheren Worten ließ sie ihn in das Zittern und Glühen ihrer tiefsten Seele schauen. Und sie erklärte ihm, daß sie ihr Wort zurücknehme, ihm das seine zurückgebe. Sie flehte ihn an, daß er sie ihrem Schicksal überlassen und in dieses Haus nicht mehr wiederkehren sollte. Was ihr eigenes Los anbelangt, so stand ihr Plan fest. Morgen noch, vielleicht heute nacht auf und davon, mit einem Male verschwunden aus dem Kreise der Ihren, weg von allen diesen Menschen, die ruhig und zufrieden und gesund waren und zu denen sie nicht gehörte, fort von hier und toll hinausgejubelt in ein Leben ungezügelter Lust, für das sie nun einmal bestimmt war, in das sie hineinmußte, wenn sie nicht verrückt werden, wenn sie nicht zugrunde gehen sollte.
Wie er, der Bräutigam, sie so reden hörte, mußte sie ihm wohl von wilderer und flammenderer Schönheit erschienen sein als je. Und der klagende Ausdruck seiner Augen wandelte sich allmählich in den Glanz bebenden Begehrens, das heftiger und heftiger daraus hervorbrach.
Er stand dicht neben ihr, und eben noch bittend, beschwörend, hatte er ihre beiden Hände gefaßt – und noch klangen ihr seine gramvollen Worte ins Ohr: sie mißverstehe sich selbst, und er verzeihe ihr alles, und sie solle nur bei ihm bleiben; da mit einem Male wurde der Druck seiner Hände fester, heißer, und das Zittern der Verzweiflung in seiner Stimme ward zum Zittern des Verlangens, und seine Worte klangen anders mit einem Male, ganz anders, bis es ihr endlich frech, schrill, brutal an ihr Ohr klang, das er mit seinen Lippen berührte: wenn es schon sein muß, wenn du schon fort willst, wenn du schon die brave Hausfrau nicht sein kannst, wenn du allen gehören willst, die dich wollen, so gehöre doch zuerst mir, der dich will wie kein anderer, mir, den du geliebt hast, mir… mir… mir…, der dich anbetet.
Da aber fuhr sie zurück, und mit Ekel stieß sie ihn fort und entriß ihm ihre Hände.
Er begriff anfangs nicht, versuchte noch ungeschickt und flehend ihr klarzumachen, daß es ja nun das Gescheiteste wäre, was sie tun könnte. Ihr aber war dieser Mann, den sie so sehr geliebt hatte, mit einem Male der einzige geworden, den sie nicht mehr lieben konnte, den sie haßte, der sie anwiderte. Der Hauch, der von seinem Munde kam, die trockenen heißen Hände, das weit offene starre Auge, seine Stimme, die etwas Klirrendes und Weinendes hatte, all das ward ihr innerhalb eines Augenblickes so unsagbar unerträglich, daß sie von ihm fort mußte, rasch, zu einem anderen, zu dem anderen, zu irgendwem, der ein Mann und nicht er war. Und noch in derselben Nacht verließ sie das Haus ihrer Eltern, in derselben Nacht irrte sie durch die schwülen Straßen der Stadt, in derselben Nacht noch trug sie sich irgendeinem auf der Straße an, der eben vor ihr her spazierte und dessen Gang leicht und vergnügt war und den sie früher nie gesehen hatte. Und der nahm sie und jagte sie wieder fort, und das war ihr erster Liebhaber!
Sie schwieg, nachdem sie mir das gesagt, ohne daß sie Näheres über diesen Mann mitgeteilt hätte. Ich war neugierig geworden und wollte mehr wissen. Wer er war, ob sie ihn geliebt, ob sie ihm nachgeweint, was sie empfunden, als er sie nahm, und wie ihr war, als sie das erste Mal verlassen wurde. Da aber sah sie mich mit großen Augen an. Und dann, als wäre das etwas ganz Selbstverständliches, in einem Tone der Bestimmtheit, der mir jetzt noch im Ohr klingt, sagte sie: »Das ist ja vollkommen gleichgültig.« Ich verstand sie nicht gleich, aber wie ich sie nun eine Weile anschaute, dieses Antlitz mit dem ruhigen Ausdruck der Glücklichen, welche ihren wahren Beruf gefunden, unbekümmert um die Meinung der anderen, da fiel es mit einem Mal hell in meine Seele, und ich konnte begreifen, was sie gemeint. Ja, es war gleichgültig, wer jener Mann gewesen, mit dem sie die erste Nacht durchlebt, gleichgültig, wer nach ihm gekommen, und gleichgültig war es auch, ob ich oder ein anderer da neben ihr im Wagen lehnte. Nicht weil sie das war, was wir so leichthin eine Verworfene nennen. Denn haben wir’s nicht alle an den Frauen, von denen wir wahrhaftig geliebt wurden, schaudernd und in stummer Verzweiflung hundertmal erlebt, wie wir im Moment der Erfüllung für sie verlorengingen, wir, mit der ganzen Majestät unseres Ich, und wie unsere gleichgültige Persönlichkeit nur mehr das allmächtige Gesetz bedeutete, zu dessen zufälligen Vertretern wir bestellt waren.
Und wenn sie aus ihrem höchsten Rausch langsam erwachen, sehen wir nicht, wie sie mit einem unheimlichen Staunen uns ansehen, nein, wie sie uns wiedersehen, um sich an uns zu erinnern, weil wir gerade in dem Momente ihrer herrlichsten Entzückung mit allen unsern höchst eigenen Eigenschaften, mit unserem Geist und unserer Schönheit, mit all den Tugenden und all den Lastern, womit wir sie gewannen, so unbeschreiblich überflüssig geworden sind, gegenüber dem ewigen Prinzip, das in der Maske eines Individuums erscheinen muß, um walten zu dürfen: denn der kurze und bewußtlose Augenblick, in welchem die Natur ihren Zweck durchzusetzen weiß, braucht nur den Mann und das Weib, und wenn wir auch sein Vorher und Nachher so erfindungsreich von den tausend Lichtern unserer Individualität umtanzen lassen – sie löschen doch alle aus, wenn uns die dumpfe Nacht der Erfüllung umfängt.
Komödiantinnen
Inhaltsverzeichnis
Helene
Er ging in seinem Zimmer auf und ab ... in dem kleinen Zimmer mit einem Fenster, durch das nicht viel Licht hereinkonnte, weil die dunkelgrünen Vorhänge zu beiden Seiten herunterwallten. Und nun war die Dämmerung da; das Zimmer lag fast im Dunkel, nur der gelbliche Plato-Kopf auf dem Ofen glänzte ein wenig und die weißen Wachskerzen, die auf dem Klavier standen. Er dachte darüber nach, ob er alle die Empfindungen, die jetzt in ihm waren, einfach Glück nennen durfte. Nein, Glück nicht. Es war zu viel Sehnsucht in ihnen und zu viel Ungewißheit. Aber jene Stunde gestern, das war doch wohl Glück gewesen. Wenn er diesen einzigen langen Kuß, auf den dann kein Wort mehr gefolgt war, mit dem sie ihn allein zurückgelassen hatte, als wäre jeder Laut Entweihung, wenn er den mit irgend was vergleichen wollte, so mußte er an eine Zeit zurückdenken, wo er fast noch ein Knabe war; an stille Spaziergänge mit einem blonden Mädel auf einsamem Waldweg und an das Ausruhen auf den Bänken, wo er ihr dann die Wangen und die Haare streichelte ... Ja, etwas Keusches und Süßes war das gewesen, und alle Glut, die in ihrem Geständnis lag, und alle Leidenschaft, mit der sie ihn zum Abschied an sich gedrückt, und selbst der dumpfe Rausch, in dem sie ihn zurückgelassen – in alledem war etwas, was ihn an jene Stimmung der ersten Liebe erinnerte mit ihren zitternden Wünschen, die keine Erfüllung kennen.
Und dabei in dem letzten »morgen«, das von ihren Lippen gehaucht kam, wie sie schon in der Tür stand, war doch so viel ängstliche Abwehr gewesen und ein so willenloses Versprechen. Daß sie heute kommen würde, wußte er. Es lag keine lange Zeit vor ihnen, in wenigen Tagen mußte sie ja weg, nach Deutschland, an ein kleines Hoftheater, wo sie ihre künstlerische Laufbahn beginnen sollte. Und er suchte in seinem Innern nach dem tiefen Schmerz, den das eigentlich in ihm hätte erregen müssen, aber er fand keinen. Vielleicht war das eben das Schöne, daß die ganze Geschichte sich nicht so ins Ferne und Angstvolle verlor, sondern daß das Ende klar und bestimmt vor ihm lag. Daß sie ihn so lange warten ließ, war ihm fast angenehm, sie mußte kommen, wenn es ganz dunkel geworden war und die Kerzen dort am Klavier brannten. Er zündete sie an, er ließ die Rouleaux herunter und entfernte auch die stählerne Kette, durch welche die grünen Vorhänge zusammengehalten waren. Nun rauschten sie in schweren Falten auseinander. Da öffnete sich die Tür. In einem glatten, dunklen Kleid stand sie da und sagte mit ihrer ruhigen Stimme: »Guten Abend.«
Er trat ihr entgegen, lächelnd, ohne die Erregung zu verspüren, die er selbst erwartet hatte. Er war nur sehr zufrieden. Sie reichte ihm die Hand und trat ein, dann strich sie den blaßroten Schleier zurück und nahm aus dem hellen, flachen Strohhut die lange Nadel, die mitten durch ihre hohe Frisur gesteckt war. Schleier, Hut und Nadel legte sie aufs Klavier. Es kam nur ein mattes Licht von den Kerzen, das aber doch in allen Ecken schimmerte. Sie setzte sich auf den runden Sessel vor dem Klavier und stützte den einen Arm auf den Deckel, während sie die andere Hand über die Augen legte.
Er stand vor ihr. Es war unmöglich, jetzt etwas zu sagen. Sie nahm plötzlich die Hand von den Augen und wandte den Kopf nach aufwärts, so daß sie einander voll ansahen. Sie lächelten beide. Er beugte sich ein wenig zu ihr nieder. Wie er aber die Lippen ihren Augen näherte, wehrte sie ab und sagte: »Nein.« Da sank er vor ihr nieder, nahm ihre Hände und küßte sie ... Mit einem Male stand sie auf, so rasch, daß er ihr kaum folgen konnte. Sie trat zum Fenster hin, zwischen die Vorhänge und ließ ihre Finger mit den Falten spielen. »Nun möchte ich doch wieder Ihre Stimme hören«, sagte sie.
»Was soll ich Ihnen jetzt sagen?« erwiderte er.
»Es ist nicht gut, Richard, wenn Sie nicht reden ... Ich bitte Sie, erzählen Sie mir doch ... Was haben Sie heute den ganzen Tag gemacht? Wo sind Sie gestern abend noch gewesen? Haben Sie an mich gedacht?«
»Ob ich an Sie gedacht habe?« rief er aus. »Hätt' ich was anderes ...«, und er hielt inne. Er hatte eine Scheu vor den Worten, die alle sagen und die man allen sagt. Es war ganz gut, daß sie ihn nach dem gestrigen Abend und nach dem Tag gefragt. Er fing an ihr zu erzählen, wie er gestern noch allein da in dem Fauteuil vor dem Schreibtisch gesessen, und wie er endlich, spät, seine Wohnung verlassen und durch die Straßen spaziert sei, in denen der Dunst des schwülen Augustabends lag.
»Ich bin auch in die Gasse gekommen, in der Sie wohnen, aber die Fenster waren dunkel. Es war freilich schon spät, elf oder zwölf. Ich mußte dorthin. Ja, nach der Luft, in der Sie atmen, Helene, habe ich mich gesehnt, und denken Sie, sogar die unheimlich heimliche Idee hat nicht gefehlt, daß Sie fühlen müssen, wenn ich in Ihrer Nähe bin, und daß es Sie glücklich macht.«
»Daß es mich glücklich macht«, wiederholte sie halblaut und kühl.
Er war näher zu ihr getreten.
»Warum sollte es mich glücklich machen, ich liebe Sie nicht, Richard«, sagte sie plötzlich ganz schroff.
Er hielt betroffen ein.
Sie schüttelte einige Male ganz ruhig den Kopf. »Ich liebe Sie nicht, durchaus nicht.«
Er schaute ihr ins Gesicht. »Und gestern abend?«
»Ich habe Sie auch gestern nicht geliebt. Ich habe einfach ein wenig Komödie gespielt.«
Richard lachte.
»Ich muß Sie vielleicht um Verzeihung bitten, lieber Freund, aber gerade Sie sind der Mann, der mich begreifen wird.«
Richard trat zuerst einen Schritt auf sie zu, dann entfernte er sich und ging hin und her. Dann setzte er sich vor den Schreibtisch hin und stützte die Hand darauf.
»Wollen Sie nicht lieber, daß ich jetzt gehe?« fragte Helene.
»Ich möchte doch Ihre Aufklärung hören«, erwiderte Richard, ohne sie anzusehen. »Warum diese Komödie, nur aus Liebe zum Komödienspielen?«
»Gewissermaßen«, entgegnete Helene ruhig.
»So?«
»Nicht wahr, Sie verstehen mich. Ich wollte wissen, ob es mir gelingen kann, etwas glaubwürdig darzustellen, wovon ich gar nichts empfinde. Ich wollte ...«
Richard unterbrach sie. »Das ist schon manchen Frauen gelungen, ohne daß sie große Künstlerinnen gewesen wären.«
»Das glaube ich nicht! Eine Ahnung von dem, was sie sagen, empfinden sie doch. Und wenn sie nicht gerade denjenigen lieben, dem sie es versichern, so haben sie doch irgendeine Erinnerung oder eine Hoffnung in der Seele, welche sie begeistert. Oder es ist wenigstens Liebessehnsucht in ihnen. Mir fehlt das alles.«
»Sie wissen das ganz bestimmt?«
»Ja, ich bin über zwanzig Jahre alt. Man hat mir schon oft von Liebe gesprochen und mich darum angefleht, Sie können sich das denken, aber bis heute begreife ich nicht, was das heißt, in Versuchung kommen ...«
»Und das soll ich alles glauben?«
»Das steht bei Ihnen. Aber bedenken Sie, daß ich keinen Grund habe, Ihnen die Unwahrheit zu sagen.«
»Vielleicht beliebt es Ihnen, wieder Komödie zu spielen.«
»Daraus würde folgen, daß ich gestern die Wahrheit sprach – daß ich Sie also liebe?«
»Nicht gerade das. Sie haben sich gestern hinreißen lassen, und Sie sind darauf gekommen, daß Sie sich selbst getäuscht haben.«
»Ah! Und nun schäme ich mich wohl, das einzugestehen.«
»Das wäre wohl möglich! Denn ich begreife nicht ganz, was Sie veranlaßt hätte, gerade mich, als ... Opfer Ihres Talentes auszuerwählen?«
»Gerade Sie mußten es sein, ja, gerade Sie! Es gibt keinen, der mißtrauischer ist als Sie.«
»Daß man geliebt wird, glaubt man doch immer wieder!«
»Wenn das so ist, dann bin ich freilich mit Unrecht auf meine Kunst stolz gewesen. Aber ich erinnere mich an alles, was Sie mir aus Ihrem Leben erzählt haben. Ich wußte, daß Sie sich abgewöhnt hätten, uns Frauen zu glauben. Einmal haben Sie mir sogar gesagt, daß Sie in jedem Worte, das eine Frau zu Ihnen spricht, die Lüge herausspüren.«
»Das habe ich mir eben eingebildet.«
»Aber ich versichre Ihnen, wenn Ihnen eine andere von Liebe sprach, so war es noch immer tausendfach wahrer, als wenn ich es tat. Wenn Sie schon bei den anderen die Lüge gemerkt haben, so hätten Sie bei mir, nach dem ersten Worte, zusammenschauern oder lachen müssen.«
Richard stand auf. »Und haben Sie keinen Augenblick überlegt, daß Sie mich ... daß dieses Spiel ... haben Sie nicht überlegt, daß Sie ...«
Er konnte nicht weitersprechen.
»Daß ich Ihnen vielleicht wehtun könnte? meinen Sie? – Nun, das konnte ich nicht vermeiden. Und wenn ich aufrichtig sein soll, ich habe kaum daran gedacht. Wie mich einmal der Gedanke erfaßt hatte, meine Rolle zu spielen, konnten solche Regungen doch keinen Einfluß mehr haben.«
Sie stand unbeweglich da, während sie sprach, und spielte noch immer mit den Falten des Vorhangs, den sie zwischen den Händen hin und her gleiten ließ. Zuweilen schaute sie ihn mit einem klaren Blicke an, der nur langsam von ihm weg in die Ecke des Zimmers ging.
»Sie haben also nicht daran gedacht, daß eine solche neue Erfahrung ...«
»Nein, man hat Sie ja so oft getäuscht.«
»Aber so völlig, ohne jede Regung ...«
»Ja«, rief sie beinahe freudig aus, »ohne jede Regung. Und Sie meinten, mein ganzes Wesen sei voll von dieser Liebe zu Ihnen.«
»Warum kamen Sie heute?« fiel er heftig ein.
»Das mußte ich doch. Wie hätte ich denn erfahren sollen, ob ich gut gespielt habe?«
»Nun, haben Sie nicht gestern bemerkt, daß ich Ihnen glaubte?«
»Ich war der Meinung, allerdings. Aber ich war nicht sicher genug. Daß Sie heute nacht vor meinen Fenstern auf und ab gegangen sind, hab' ich nicht gewußt. Ich hätte auch denken können, daß Ihre Zweifel schon begannen, nachdem ich Sie verlassen. Das quälte mich sehr. Vielleicht hätten Sie mich mit mißtrauischen Fragen, verzagt, mit Zweifeln an meiner Liebe empfangen.«
»Und was wäre in diesem Falle gewesen? Sie hätten versucht, mich zu beruhigen, Ihre Rolle womöglich weiter gespielt.«
»Ach nein, ich hätte mich eben mit einem Achtungserfolg begnügen müssen. Und dann, es wäre keine Zeit mehr dazu gewesen, denn ich reise schon morgen ab.«
»Ah?«
»Ja, ein Telegramm des Direktors beruft mich früher hin, als ich erwartete.«
»Also morgen ... es ist eigentlich erfreulich für mich, daß Ihnen die Möglichkeit genommen wurde, weiterzuspielen.«
»Ich hätte es keineswegs getan.«
»Wer weiß. Das eine darf ich Sie wohl fragen: Wann kam Ihnen eigentlich die Idee zu Ihrer Komödie? War das schon, bevor Sie das erste Mal ihren Fuß über meine Schwelle setzten?«
»Nein.«
»Und warum kamen Sie überhaupt? Warum kamen Sie zu mir?«
»Sie wissen es ja. Sie haben mir Schumann und Chopin vorgespielt, Sie haben sehr gescheite Dinge mit mir geredet.«
»Man kommt doch nicht zu einem jungen Mann, um sich Schumann und Chopin vorspielen zu lassen.«
»Warum denn nicht? Was hat es denn für eine Gefahr, da Sie mir stets vollkommen gleichgültig gewesen sind?«
»Aber die Idee muß Ihnen früher gekommen sein. Ihr Liebesgeständnis hat mich durchaus nicht überrascht. Seit Tagen schon drängte alles dazu, es kam ja nicht plötzlich.«
»Das scheint Ihnen heute so. Gestern hätte es Sie durchaus nicht befremdet, wenn ich Ihnen einfach beim Kommen gesagt hätte: Lieber Freund, ich will Ihnen nur adieu sagen, ich reise ab, bleiben Sie mir gewogen. Ist es nicht so? Warum ich mir eine solche Mühe geben muß, Ihnen das auseinanderzusetzen?! Sie können es heute gar nicht fassen, daß ich Sie nicht liebe, nachdem Sie vor einigen Tagen noch nicht an Liebe geglaubt haben.«
»Nun also, Sie haben großartig gespielt! Sind Sie nun zufrieden?«
»Noch nicht ganz, ich muß noch eines von Ihnen hören, daß Sie sich nicht verletzt fühlen.«
»Sie verlangen nicht wenig.«
»Sie müssen mich verstehen, wenn Sie ein Künstler sind. Ich bin nun einmal nicht wie andere. Sie ahnen nicht, wie es mich manchmal selbst schaudert, so einsam durch eine ganz fremde Welt zu gehen. Was hab' ich schon alles gesehen, was hat man mir schon erzählt! Daß alle diese Freuden und Schmerzen existieren, welche das Wesen der Liebe ausmachen, muß ich wohl glauben. – Ich sehe es rings um mich, und es scheint auch, daß alle die Komödien, in welchen ich auftreten werde, nicht viel anderes enthalten. Mir ist das alles, alles fremd. Alle Fähigkeit des Empfindens ist in der Leidenschaft für meine Kunst abgeschlossen. Ich muß spielen, Komödie spielen, immer, überall. Ich habe stets dieses Bedürfnis, besonders dort, wo andere ein großes Glück oder ein tiefes Weh empfänden. Ich suche überall Gelegenheit zu einer Rolle.«
»Und Sie haben schon oft eine ähnliche gespielt wie gestern abend bei mir?«
»Unbewußt, früher einmal. Ich war kokett, aber meine Koketterie ging eben nicht wie bei anderen jungen Mädchen aus einem unklaren Verlangen nach Liebe hervor, sondern eben wieder nur aus dem Vergnügen, eine Rolle zu spielen. Die anderen übertreiben doch eigentlich nur ein Gefühl, das sich in ihnen zu regen beginnt. Ich aber mußte in solchen Fällen stets aus dem Nichts schaffen.«
»Aber so vollendet wie gestern haben Sie noch nie gespielt? Und so weit sind Sie noch nie in der Ausgestaltung Ihrer Rolle gekommen? Ich frage nur: warum?«
»Ich sagte es Ihnen ja schon. Gerade einen Menschen wie Sie brauchte ich dazu, einen, der nur sehr schwer zu überzeugen ist und den ich dann auch wirklich in Ruhe fragen durfte, wie er mit meiner Leistung zufrieden war.«
»Vielleicht irren Sie sich. Vielleicht haben Sie nur deshalb besser gespielt und weiter gespielt als sonst, weil sich zu dem, was Sie erfanden, etwas Echtes beigesellte, ohne daß Sie es ahnten.«
»Nichts! ... Nichts ... Nichts! ... Seien Sie doch nicht so eitel.«
»Nun, dann, meine Liebe, bedaure ich nur, daß Sie nicht den Mut hatten – ganz bis zu Ende zu spielen.«
Helene zuckte unmerklich zusammen. Dann aber lächelte sie und reichte ihm die Hand. »Ich bin mit meinem kleinen Triumphe ganz zufrieden, und nun lassen Sie mich gehen. Auf Wiedersehen will ich Ihnen nicht sagen, denn Ihre Sympathie für mich ist nun wohl vorbei. Leben Sie wohl.« Sie nahm Hut und Schleier vom Klavier.
»Und nun bedenken Sie nur«, setzte sie fort, während sie die Nadel durch den Hut steckte, »wenn Sie mich nun liebten! Wenn wir von einander Abschied nehmen müßten auf immer vielleicht, wenn Sie ein angebetetes Wesen in die Fremde ziehen ließen, für das Sie zittern müßten! So scheiden wir lächelnd, und das ist doch eigentlich viel schöner.«
»Wenn Sie es wünschen, Helene, so will ich lächeln.«
Sie reichte ihm nochmals die Hand. »Wenn Sie es jetzt nicht tun, so wird es in ein paar Stunden oder morgen geschehen. Daß Sie mich verstehen werden, sobald Ihr erster Zorn dahin ist, daran kann ich nicht zweifeln. Die Liebe soll sehr eigensinnig sein und rücksichtslos. Warum sollte Sie's wundernehmen, daß auch die Kunst in dieser närrischen Weise geliebt werden kann, von einer, die andere Liebe nicht kennt. Nicht wahr? Und nun ... leben Sie wohl.«
Er antwortete nicht, nickte mit dem Kopfe und blieb mitten im Zimmer stehen. Sie war an der Tür. Da wandte sie sich noch einmal um, als hätte sie noch etwas zu sagen. Sie ging aber wortlos, und er war allein.
Sie eilte rasch die Treppe hinunter und war gleich auf der Straße, ging rasch bis zur Ecke, wo sie in die Nebengasse einbog, so daß sie von seinem Fenster aus nicht mehr gesehen werden konnte. Hier blieb sie eine Weile stehen und atmete tief auf. Dann aber eilte sie weiter, mit schnellen Schritten und mit immer schnelleren, als ob sie fliehen wollte.
Fritzi
Im Ballanzug sitze ich vor meinem Schreibtisch. Ich muß doch noch in den alten Blättern herumstöbern, bevor ich zu Weißenbergs gehe, wo ich sie wiedersehen soll. Wie viele Blätter liegen nun schon da, und die ersten fangen an gelb zu werden, vergilbt, würde ich sagen, wenn ich ein Romantiker wäre. Wie wenig man doch die Bedeutung der einzelnen Dinge abschätzen kann zur Zeit, da man sie erlebt und aufnotiert. Da finde ich Abenteuer in breiten Sätzen und großen Worten verzeichnet, an welche ich mich kaum mehr erinnern kann. Als wären es Geschichten von fremden Menschen. Und dann wieder Andeutungen, kurze Bemerkungen, die niemand anderer verstehen könnte als ich, der sie selbst niedergeschrieben – und aus einer kleinen Bemerkung blüht mir wieder die ganze Zeit mit ihrem Duft entgegen, und alle Einzelheiten werden jung und lebendig. Ich habe um acht Jahre zurückgeblättert, denn gerade auf jene Winterabende kam es mir an. Nur ein paar Mal steht der Name Fritzi in den alten Blättern. Einmal ganz einfach »Fritzi«. Und ein zweites Mal »Fritzi reizendes Grisettenköpferl, klagende und lachende Augen«. Und selbst jener Dezemberabend, an welchem ich sie zum letzten Mal sah, weil ich tags darauf die Stadt verlassen mußte, ist mit zwei Zeilen abgetan: »Fritzi ... Abschied ... der rote Schein am Himmel ... jagende Leute ... wie sie davonflog ...« Und wie ist das alles in mir wach und klar, obwohl ich doch eigentlich alle die Jahre über recht wenig an sie gedacht habe. Es mag ja auch sein, daß ich damals vor acht Jahren die Verpflichtung gefühlt hätte, mehr über sie in diese Blätter einzuschreiben, wenn mir nur eine Ahnung gekommen wäre, daß in dieser kleinen Konservatoristin eine große Künstlerin steckt, die heute dem ganzen Wiener Publikum den Kopf verdreht. Wie solche Geschichten manchmal zu Ende gehen oder eigentlich abreißen! Und wo man nur diese Erinnerungen bewahrt, um die man sich jahrelang nicht kümmert und die man dann nach geraumer Zeit so blank, so licht, so unverändert wiederfindet, als hätte sie der Hauch täglichen Gedenkens frisch erhalten. Nun träum' ich das ganze Erlebnis von der Sekunde seines Beginnens wieder vor mich hin, bis zu jenem letzten Abend, der so merkwürdig endete. Es ist mir, als sähe ich auch die ganze glutrote Beleuchtung wieder, unter der die Stadt stand. Es muß wohl elf Uhr gewesen sein, als wir aus dem Haustor traten. Die Nacht war kalt. Fritzi schmiegte sich an mich, frierend und zärtlich. Kaum waren wir aus der engen Gasse, in der ich wohnte, in die Währingerstraße gekommen, so merkten wir, daß etwas Ungewöhnliches vorgehen müsse. Es waren mehr Menschen auf der Straße als gewöhnlich, die rasch immer in einer Richtung gegen den Ring sich bewegten. Und nun sahen wir den glutroten Schein am Himmel. Die Leute riefen: Es brennt, es brennt! »Komm schnell«, sagte Fritzi. Und wieder rannten Leute an uns vorbei, und sie schrien: Das Ringtheater brennt. »Wie?« fragte Fritzi. Und wieder andere rannten an uns vorbei und sagten: Das Ringtheater brennt! Plötzlich schrie Fritzi auf wie eine Wahnsinnige. Sie ließ meinen Arm los und blieb einen Moment stehen, dann schaute sie zum Himmel auf, der immer dunkelroter wurde. Sie fuhr zusammen, als würde ihr etwas Entsetzliches klar, und dann stürzte sie fort, ohne sich nur nach mir umzuwenden. Ich versuchte sie einzuholen, aber ich hatte sie sofort in der Menschenmenge, die immer beträchtlicher anwuchs, verloren. Ich muß gestehen, daß mich das im ganzen und großen wenig aufregte, ich weiß sogar noch, daß ich, nachdem ich ein paar Mal »Fritzi, Fritzi« gerufen, ganz ruhig vor mich hin sagte: hysterische Person. Dann kam mir auch der tröstliche Gedanke, daß durch dieses plötzliche Davonstürmen etwas sehr Peinliches und Rührendes vermieden worden war, nämlich der Abschied in der Nähe ihrer Wohnung, der vielleicht einer auf ewig sein sollte. Ich ging damals noch die halbe Nacht spazieren; eine Weile stand ich auch vor dem brennenden Theater. Am Morgen darauf reiste ich ab. An Fritzi habe ich ein paar Zeilen von München aus gesandt, ich erhielt aber keine Antwort. Und das sind nun acht Jahre. Unterdessen ist die kleine Fritzi eine große Sängerin geworden, und in einer halben Stunde werd' ich sie wiedersehen. – – –
Später: Ja, ich habe Fritzi wieder gesehen und wieder gehört und wieder gesprochen. Sie stand im Gespräch mit zwei Herren vor dem großen Wandspiegel des Salons, als ich eintrat. Sie erkannte mich gleich, als ich sie begrüßte, und streckte mir freundlich und harmlos die Hand entgegen. Nur in ihrem Lächeln lag es wie eine Erinnerung. »Wir haben uns lange nicht gesehen«, meinte sie. Ich hatte das Gefühl meiner Wichtigkeit sofort verloren, aber ich fühlte mich ganz wohl dabei. Ich forderte Fritzi auf, beim Souper meine Nachbarin zu sein. »Schade, daß Sie nicht früher gekommen sind«, erwiderte sie, »man hat sich so um mich gerissen, daß ich Ihnen höchstens schief vis-à-vis sitzen kann. Meine rechte Seite, meine linke Seite und sogar mein gerades vis-à-vis habe ich schon vergeben.«
So kam es also, daß ich ihr schief vis-à-vis saß. Um zu ihr hinüberzuschauen, mußten sich meine Augen um einen großen Aufsatz mit Trauben, Nüssen und Pfirsichen sozusagen herumschlängeln. Ich hatte übrigens eine sehr gescheite Nachbarin, mit der ich bald in ein vergnügtes Plaudern kam. Es war die Flegendorfer. Und so geschah es, daß mir bereits beim Braten die unsägliche Lächerlichkeit sämtlicher Anwesenden außer mir und Frau Flegendorfer über jeden Zweifel klar war. Es war sehr amüsant. Das Stimmengewirr um den reichbesetzten Tisch mit seinen trefflichen Weinen wurde immer lauter und lebhafter, und bald war die Creme- und Champagnerstimmung da. Da ereignete sich etwas Sonderbares. Aus all den Leuten heraus, als begänne sie jetzt erst zu sprechen, hörte ich plötzlich die Stimme Fritzis, und zwei Worte klangen an mein Ohr: »die Flammen ...«
Offenbar hatte sie diese Worte auch lauter gesprochen als die andern, denn die nächsten verklangen wieder im Lärm. Aber schon nach ein paar Sekunden konnte ich ihre Stimme wieder so deutlich vernehmen, daß ich Silbe für Silbe verstand. Und nun merkte ich auch, daß es Fritzi war, welche das Gespräch beherrschte. Sie hatte die allgemeine Aufmerksamkeit erzwungen, alle hörten ihr zu. Und zu ihr wandten sich alle Blicke. Ich kam allerdings erst im Laufe einiger Sekunden zu dieser Betrachtung, denn im Anfang war ich in einer Weise frappiert ...
»Die Flammen schlugen in den Zuschauerraum«, sagte sie. »Ich hatte eigentlich im ersten Augenblicke durchaus nicht die Empfindung einer fürchterlichen Gefahr, sondern, daran erinnere ich mich noch ganz genau, ich sagte zu mir selbst: Wie groß, wie herrlich schön.«
»Wovon erzählt sie denn da?« fragte ich leise die Flegendorfer.
»Nun«, erwiderte diese, »es ist ihre bekannte Geschichte, auf die sie reist. Sie kann in keine Gesellschaft gehen, wo sie sie nicht zum besten gibt. Sie macht es übrigens famos, hören Sie nur.«
Ich hörte, es war wirklich erschütternd:
»Mir war es«, sagte sie, »als wären diese Flammen nichts Feindseliges, nichts was mich bedrohte. Ich starrte hinein mit Interesse, vielleicht mit Begeisterung, gewiß nicht mit Furcht. Da plötzlich fühlte ich mich gestoßen, nein, nicht gestoßen, gehoben, und um mich herum war ein schauerlicher, ungeheurer Lärm, als stürzte alles zusammen; und es heulte wie ein Sturm durch den Raum, und vor die rote Glut legte sich grauer, dunkler Rauch. Plötzlich kam ein gewaltiger Ruck nach einer bestimmten Richtung. Mit einem Mal war es dunkel, und ich konnte mich nicht rühren. Um mich herum wurde geflucht und gejammert. Ja, auch ich schrie mit einem Male auf, ich weiß, daß ich ein paar Sekunden lang schrie und dabei kaum begriff, warum. Und plötzlich spürte ich an meinem Halse Nägel, Krallen. Irgendwer klammerte sich an mich. Es wurde an meinem Halskragen gerissen, meine Taille wurde mir einfach vom Leibe gezerrt.«
»Dazu«, flüsterte mir Frau Flegendorfer zu, »hat damals noch das Ringtheater abbrennen müssen.«
»Pst«, machte ich, denn ich war gespannt, atemlos gespannt.
Fritzi erzählte weiter. Sie erzählte, wie sie in einer ganz rätselhaften Weise gestoßen, geschoben, gehoben, über dunkle Gänge, über dunkle Stiegen ins Freie auf die Straße gekommen war.
»Ich war wie gebannt«, sagte sie, »konnte nicht fort. Ich hatte die Empfindung: Hier mußt du stehenbleiben, bis alles vorbei ist. Ich war ruhiger als alle Menschen, die da herumstanden, und daß ich selbst da drinnen in dem brennenden Hause gewesen sein sollte, das war mir wie ein dumpfer Traum. Plötzlich aber fuhr es mir durch den Kopf, was mir unbegreiflicherweise noch keine Sekunde lang zum Bewußtsein gekommen war: Um Gottes willen, meine Mutter! Ich hatte ihr ja gesagt, daß ich ins Ringtheater gehen wolle, wie ich ja zu jener Zeit als blutige Anfängerin fast jeden Abend ins Theater ging. Es war schon damals meine Leidenschaft.«
Bei dieser Stelle ihres Berichtes wurde ich verlegen. Wir sind doch besser, wir Männer!
Fritzi erzählte weiter. »Ich ging, ich lief, nein, ich stürzte nach Hause. Und nun denken Sie! Als ich nach Hause kam, war es bereits elf Uhr, mehr als drei Stunden war ich vor dem Theater gestanden, ohne nur ein Bewußtsein davon zu haben, daß die Zeit verging. So stelle ich mir eigentlich den Wahnsinn vor. Das Wiedersehen mit meiner Mutter kann ich Ihnen kaum schildern. Ich weiß nur eines, der Augenblick, da wir uns wieder in den Armen lagen, wird mir unvergeßlich bleiben, unvergeßlich!«
Man war gerührt, als Fritzi geendet hatte. Einige Herren standen auf, traten mit den gefüllten Gläsern auf sie zu und stießen mit ihr an. Jetzt trafen sich unsere Blicke. Einen Moment lang starrte sie mich ganz gedankenlos an, dann aber glitt ein ganz sonderbares Lächeln über ihre Züge – ach, ein Lächeln, das ich noch so gut kannte. Sie nahm ihr Glas und ließ es mit dem meinen zusammenklingen.
»Auf Ihre wunderbare Rettung«, rief ich aus und leerte mein Glas. Gleich nach dem Souper trat sie auf mich zu und reichte mir beide Hände, als wollte sie mich um Entschuldigung bitten. »Es scheint also wirklich«, sagte sie, »daß Sie es waren.«
»Es scheint so?« entgegnete ich ein wenig befremdet.
»Nun«, sagte sie, »ich habe es immer geahnt, daß sich die Geschichte nicht genau so zugetragen hat, wie ich sie erzähle, aber ich habe schon angefangen an sie zu glauben – und wären Sie mir um ein paar Jahre später wieder begegnet, so hätten Sie mich kaum mehr überzeugen können; denn mir ist heute, als hätte ich sie wirklich erlebt. Ich habe die Geschichte so oft erzählen müssen, den Verwandten und dann den Kollegen, den Kolleginnen und allen möglichen Leuten, daß sie schon beinahe wahr, jedenfalls aber berühmt geworden ist.«
»Da sehen Sie, Fritzi«, sagte ich, »ein wie ungerechtes Ding der Ruhm eigentlich ist. Der ihn am meisten verdient, an dem geht er vorüber.«
»Wieso?« fragte sie.
»Nun, ich denke doch«, erwiderte ich ihr, »wenn ihn einer verdient, so bin ich's, Fritzi« – und ich neigte mich näher zu ihr, ganz nah zu ihrem Ohr –, »ich, Fritzi, dein Lebensretter.«
Die Toten schweigen
Inhaltsverzeichnis
Er ertrug es nicht länger, ruhig im Wagen zu sitzen; er stieg aus und ging auf und ab. Es war schon dunkel; die wenigen Laternenlichter in dieser stillen, abseits liegenden Straße flackerten, vom Winde bewegt, hin und her. Es hatte aufgehört zu regnen; die Trottoirs waren beinahe trocken; aber die ungepflasterten Fahrstraßen waren noch feucht, und an einzelnen Stellen hatten sich kleine Tümpel gebildet.
Es ist sonderbar, dachte Franz, wie man sich hier, hundert Schritte von der Praterstraße, in irgendeine ungarische Kleinstadt versetzt glauben kann. Immerhin – sicher dürfte man hier wenigstens sein; hier wird sie keinen ihrer gefürchteten Bekannten treffen.
Er sah auf die Uhr… Sieben – und schon völlige Nacht. Der Herbst ist diesmal früh da. Und der verdammte Sturm.
Er stellte den Kragen in die Höhe und ging rascher auf und ab. Die Laternenfenster klirrten. »Noch eine halbe Stunde«, sagte er zu sich, »dann kann ich gehen. Ah – ich wollte beinahe, es wäre so weit.« Er blieb an der Ecke stehen; hier hatte er einen Ausblick auf beide Straßen, von denen aus sie kommen könnte.
Ja, heute wird sie kommen, dachte er, während er seinen Hut festhielt, der wegzufliegen drohte. – Freitag – Sitzung des Professorenkollegiums – da wagt sie sich fort und kann sogar länger ausbleiben… Er hörte das Geklingel der Pferdebahn; jetzt begann auch die Glocke von der nahen Nepomukkirche zu läuten. Die Straße wurde belebter. Es kamen mehr Menschen an ihm vorüber: meist, wie ihm schien, Bedienstete aus den Geschäften, die um sieben geschlossen wurden. Alle gingen rasch und waren mit dem Sturm, der das Gehen erschwerte, in einer Art von Kampf begriffen. Niemand beachtete ihn; nur ein paar Ladenmädel blickten mit leichter Neugier zu ihm auf. – Plötzlich sah er eine bekannte Gestalt rasch herankommen. Er eilte ihr entgegen. Ohne Wagen? dachte er. Ist sie’s?
Sie war es; als sie seiner gewahr wurde, beschleunigte sie ihre Schritte.
»Du kommst zu Fuß?« sagte er.
»Ich hab’ den Wagen schon beim Karltheater fortgeschickt. Ich glaube, ich bin schon einmal mit demselben Kutscher gefahren.«
Ein Herr ging an ihnen vorüber und betrachtete die Dame flüchtig. Der junge Mann fixierte ihn scharf, beinahe drohend; der Herr ging rasch weiter. Die Dame sah ihm nach. »Wer war’s?« fragte sie ängstlich.
»Ich kenne ihn nicht. Hier gibt es keine Bekannten, sei ganz ruhig. – Aber jetzt komm rasch; wir wollen einsteigen.«
»Ist das dein Wagen?«
»Ja.« –
»Ein offener?«
»Vor einer Stunde war es noch so schön.«
Sie eilten hin; die junge Frau stieg ein.
»Kutscher«, rief der junge Mann.
»Wo ist er denn?« fragte die junge Frau.
Franz schaute rings umher. »Das ist unglaublich«, rief er, »der Kerl ist nicht zu sehen.«
»Um Gotteswillen!« rief sie leise.
»Wart’ einen Augenblick, Kind; er ist sicher da.«
Der junge Mann öffnete die Tür zu dem kleinen Wirtshause; an einem Tisch mit ein paar anderen Leuten saß der Kutscher; jetzt stand er rasch auf.
»Gleich, gnä’ Herr«, sagte er und trank stehend sein Glas Wein aus.
»Was fällt Ihnen denn ein?«
»Bitt’ schön, Euer Gnaden; i bin schon wieder da.«
Er eilte ein wenig schwankend zu den Pferden. »Wohin fahr’n mer denn, Euer Gnaden?«
»Prater – Lusthaus.«
Der junge Mann stieg ein. Die junge Frau lehnte ganz versteckt, beinahe zusammengekauert, in der Ecke unter dem aufgestellten Dach.
Franz faßte ihre beiden Hände. Sie blieb regungslos. – »Willst du mir nicht wenigstens guten Abend sagen?«
»Ich bitt’ dich; laß mich nur einen Moment, ich bin noch ganz atemlos.«
Der junge Mann lehnte sich in seine Ecke. Beide schwiegen eine Weile. Der Wagen war in die Praterstraße eingebogen, fuhr an dem Tegetthoff-Monument vorüber, und nach wenigen Sekunden flog er die breite, dunkle Praterallee hin. Jetzt umschlang Emma plötzlich mit beiden Armen den Geliebten. Er schob leise den Schleier zurück, der ihn noch von ihren Lippen trennte, und küßte sie.
»Bin ich endlich bei dir!« sagte sie.
»Weißt du denn, wie lang wir uns nicht gesehen haben?« rief er aus.
»Seit Sonntag.«
»Ja, und da auch nur von weitem.«
»Wieso? Du warst ja bei uns.«
»Nun ja… bei euch. Ah, das geht so nicht fort. Zu euch komm’ ich überhaupt nie wieder. Aber was hast du denn?«
»Es ist ein Wagen an uns vorbeigefahren.«
»Liebes Kind, die Leute, die heute im Prater spazierenfahren, kümmern sich wahrhaftig nicht um uns.«
»Das glaub’ ich schon. Aber zufällig kann einer hereinschaun.«
»Es ist unmöglich, jemanden zu erkennen.«
»Ich bitt’ dich, fahren wir woanders hin.«
»Wie du willst.«
Er rief dem Kutscher, der aber nicht zu hören schien. Da beugte er sich vor und berührte ihn mit der Hand. Der Kutscher wandte sich um.
»Sie sollen umkehren. Und warum hauen Sie denn so auf die Pferde ein? Wir haben ja gar keine Eile, hören Sie! Wir fahren in die… wissen Sie, die Allee, die zur Reichsbrücke führt.
»Auf die Reichsstraßen?«
»Ja, aber rasen Sie nicht so, das hat ja gar keinen Sinn.«
»Bitt’ schön, gnä’ Herr, der Sturm, der macht die Rösser so wild.«
»Ah freilich, der Sturm.« Franz setzte sich wieder.
Der Kutscher wandte die Pferde. Sie fuhren zurück.
»Warum hab’ ich dich gestern nicht gesehen?« fragte sie.
»Wie hätt’ ich denn können?«
»Ich dachte, du warst auch bei meiner Schwester geladen.«
»Ach so.«
»Warum warst du nicht dort?«
»Weil ich es nicht vertragen kann, mit dir unter anderen Leuten zusammenzusein. Nein, nie wieder.«
Sie zuckte die Achseln.
»Wo sind wir denn?« fragte sie dann.
Sie fuhren unter der Eisenbahnbrücke in die Reichsstraße ein.
»Da geht’s zur großen Donau«, sagte Franz, »wir sind auf dem Weg zur Reichsbrücke. Hier gibt es keine Bekannten!« setzte er spöttisch hinzu.
»Der Wagen schüttelt entsetzlich.«
»Ja, jetzt sind wir wieder auf Pflaster.«
»Warum fährt er so im Zickzack?«
»Es scheint dir so.«
Aber er fand selbst, daß der Wagen sie heftiger als nötig hin und her warf. Er wollte nichts davon sagen, um sie nicht noch ängstlicher zu machen.
»Ich habe heute viel und ernst mit dir zu reden, Emma.«
»Da mußt du bald anfangen, denn um neun muß ich zu Hause sein.«
»In zwei Worten kann alles entschieden sein.«
»Gott, was ist denn das?«… schrie sie auf. Der Wagen war in ein Pferdebahngeleise geraten und machte jetzt, als der Kutscher herauswenden wollte, eine so scharfe Biegung, daß er fast zu stürzen drohte. Franz packte den Kutscher beim Mantel. »Halten Sie«, rief er ihm zu. »Sie sind ja betrunken.«
Der Kutscher brachte die Pferde zum Stehen. »Aber gnä’ Herr…«
»Komm, Emma, steigen wir hier aus.«
»Wo sind wir?«
»Schon an der Brücke. Es ist auch jetzt nicht mehr gar so stürmisch. Gehen wir ein Stückchen. Man kann während des Fahrens nicht ordentlich reden.«
Emma zog den Schleier herunter und folgte.
»Nicht stürmisch nennst du das?« rief sie aus, als ihr gleich beim Aussteigen ein Windstoß entgegenfuhr.
Er nahm ihren Arm. »Nachfahren«, rief er dem Kutscher zu.
Sie spazierten vorwärts. So lange die Brücke allmählich anstieg, sprachen sie nichts, und als sie beide das Wasser unter sich rauschen hörten, blieben sie eine Weile stehen. Tiefes Dunkel war um sie. Der breite Strom dehnte sich grau und in unbestimmten Grenzen hin, in der Ferne sahen sie rote Lichter, die über dem Wasser zu schweben schienen und sich darin spiegelten. Von dem Ufer her, das die beiden eben verlassen hatten, senkten sich zitternde Lichtstreifen ins Wasser; jenseits war es, als verlöre sich der Strom in die schwarzen Auen. Jetzt schien ein ferneres Donnern zu ertönen, das immer näher kam; unwillkürlich sahen sie beide nach der Stelle, wo die roten Lichter schimmerten; Bahnzüge mit hellen Fenstern rollten zwischen eisernen Bogen hin, die plötzlich aus der Nacht hervorzuwachsen und gleich wieder zu versinken schienen. Der Donner verlor sich allmählich, es wurde still; nur der Wind kam in plötzlichen Stößen.
Nach langem Schweigen sagte Franz: »Wir sollten fort.«
»Freilich«, erwiderte Emma leise.
»Wir sollten fort«, sagte Franz lebhaft, »ganz fort, mein’ ich…«
»Es geht ja nicht.«
»Weil wir feig sind, Emma; darum geht es nicht.«
»Und mein Kind?«
»Er würde es dir lassen, ich bin fest überzeugt.«
»Und wie?« fragte sie leise… »Davonlaufen bei Nacht und Nebel?«
»Nein, durchaus nicht. Du hast nichts zu tun, als ihm einfach zu sagen, daß du nicht länger bei ihm leben kannst, weil du einem andern gehörst.«
»Bist du bei Sinnen, Franz?«
»Wenn du willst, erspar’ ich dir auch das, – ich sag’ es ihm selber.«
»Das wirst du nicht tun, Franz.«
Er versuchte, sie anzusehen; aber in der Dunkelheit konnte er nicht mehr bemerken, als daß sie den Kopf erhoben und zu ihm gewandt hatte.
Er schwieg eine Weile. Dann sagte er ruhig: »Hab’ keine Angst, ich werde es nicht tun.«
Sie näherten sich dem andern Ufer.
»Hörst du nichts?« sagte sie. »Was ist das?«
»Es kommt von drüben«, sagte er.
Langsam rasselte es aus dem Dunkel hervor; ein kleines rotes Licht schwebte ihnen entgegen; bald sahen sie, daß es von einer kleinen Laterne kam, die an der vorderen Deichsel eines Landwagens befestigt war; aber sie konnten nicht sehen, ob der Wagen beladen war und ob Menschen mitfuhren. Gleich dahinter kamen noch zwei gleiche Wagen. Auf dem letzten konnten sie einen Mann in Bauerntracht gewahren, der eben seine Pfeife anzündete. Die Wagen fuhren vorbei. Dann hörten sie wieder nichts als das dumpfe Geräusch des Fiakers, der zwanzig Schritte hinter ihnen langsam weiterrollte. Jetzt senkte sich die Brücke leicht gegen das andere Ufer. Sie sahen, wie die Straße vor ihnen zwischen Bäumen ins Finstere weiterlief. Rechts und links von ihnen lagen in der Tiefe die Auen; sie sahen wie in Abgründe hinein. Nach langem Schweigen sagte Franz plötzlich: »Also das letztemal…«
»Was?« fragte Emma in besorgtem Ton.
»– Daß wir zusammen sind. Bleib’ bei ihm. Ich sag’ dir Adieu.«
»Sprichst du im Ernst?«
»Vollkommen.«
»Siehst du, daß du es bist, der uns immer die paar Stunden verdirbt, die wir haben; nicht ich!«
»Ja, ja, du hast recht«, sagte Franz. »Komm, fahren wir zurück.«
Sie nahm seinen Arm fester. »Nein«, sagte sie zärtlich, »jetzt will ich nicht. Ich laß’ mich nicht so fortschicken.«
Sie zog ihn zu sich herab und küßte ihn lang. »Wohin kämen wir«, fragte sie dann, »wenn wir hier immer weiterführen?«
»Da geht’s direkt nach Prag, mein Kind.«
»So weit nicht«, sagte sie lächelnd, »aber noch ein bißchen weiter da hinaus, wenn du willst.« Sie wies ins Dunkle.
»He, Kutscher!« rief Franz. Der hörte nichts.
Franz schrie: »Halten Sie doch!«
Der Wagen fuhr immer weiter. Franz lief ihm nach. Jetzt sah er, daß der Kutscher schlief. Durch heftiges Anschreien weckte ihn Franz auf. »Wir fahren noch ein kleines Stück weiter – die gerade Straße – verstehen Sie mich?«
»Is’ schon gut, gnä’ Herr…«
Emma stieg ein; nach ihr Franz. Der Kutscher hieb mit der Peitsche drein; wie rasend flogen die Pferde über die aufgeweichte Straße hin. Aber die beiden im Wagen hielten einander fest umarmt, während der Wagen sie hin-und herwarf.
»Ist das nicht auch ganz schön«, flüsterte Emma ganz nahe an seinem Munde.
In diesem Augenblick war ihr, als flöge der Wagen plötzlich in die Höhe – sie fühlte sich fortgeschleudert, wollte sich an etwas klammern, griff ins Leere: es schien ihr, als drehe sie sich mit rasender Geschwindigkeit im Kreise herum, so daß sie die Augen schließen mußte – und plötzlich fühlte sie sich auf dem Boden liegen, und eine ungeheure schwere Stille brach herein, als wenn sie fern von aller Welt und völlig einsam wäre. Dann hörte sie verschiedenes durcheinander: Geräusch von Pferdehufen, die ganz in ihrer Nähe auf dem Boden schlugen, ein leises Wimmern; aber sehen konnte sie nichts. Jetzt faßte sie eine tolle Angst; sie schrie; ihre Angst ward noch größer, denn sie hörte ihr Schreien nicht. Sie wußte plötzlich ganz genau, was geschehen war: der Wagen war an irgend etwas gestoßen, wohl an einen der Meilensteine, hatte umgeworfen, und sie waren herausgestürzt. Wo ist er? war ihr nächster Gedanke. Sie rief seinen Namen. Und sie hörte sich rufen, ganz leise zwar, aber sie hörte sich. Es kam keine Antwort. Sie versuchte, sich zu erheben. Es gelang ihr soweit, daß sie auf den Boden zu sitzen kam, und als sie mit den Händen ausgriff, fühlte sie einen menschlichen Körper neben sich. Und nun konnte sie auch die Dunkelheit mit ihrem Auge durchdringen. Franz lag neben ihr, völlig regungslos. Sie berührte mit der ausgestreckten Hand sein Gesicht, sie fühlte etwas Feuchtes und Warmes darüberfließen. Ihr Atem stockte. Blut…? Was war da geschehen? Franz war verwundet und bewußtlos. Und der Kutscher – wo war er denn? Sie rief nach ihm. Keine Antwort. Noch immer saß sie auf dem Boden. Mir ist nichts geschehen, dachte sie, obwohl sie Schmerzen in allen Gliedern fühlte. Was tu’ ich nur, was tu’ ich nur… es ist doch nicht möglich, daß mir gar nichts geschehen ist. »Franz!« rief sie. Eine Stimme antwortete ganz in der Nähe: »Wo sind S’ denn, gnä’ Fräul’n, wo ist der gnä’ Herr? Es ist doch nix g’schehn? Warten S’, Fräulein, – i zünd’ nur die Latern’ an, daß wir was sehn, i weiß net, was die Krampen heut hab’n. Ich bin net Schuld, meiner Seel’… in ein’ Schoderhaufen sein s’ hinein, die verflixten Rösser.«
Emma hatte sich, trotzdem ihr alle Glieder weh taten, vollkommen aufgerichtet, und daß dem Kutscher nichts geschehen war, machte sie ein wenig ruhiger. Sie hörte, wie der Mann die Laternenklappe öffnete und Streichhölzchen anrieb. Angstvoll wartete sie auf das Licht. Sie wagte es nicht, Franz noch einmal zu berühren, der vor ihr auf dem Boden lag; sie dachte: wenn man nichts sieht, scheint alles furchtbarer; er hat gewiß die Augen offen… es wird nichts sein.
Ein Lichtschimmer kam von der Seite. Sie sah plötzlich den Wagen, der aber zu ihrer Verwunderung nicht auf dem Boden lag, sondern nur schief gegen den Straßengraben zu gestellt war, als wäre ein Rad gebrochen. Die Pferde standen vollkommen still. Das Licht näherte sich; sie sah den Schein allmählich über einen Meilenstein, über den Schotterhaufen in den Graben gleiten; dann kroch er auf die Füße Franzens, glitt über seinen Körper, beleuchtete sein Gesicht und blieb darauf ruhen. Der Kutscher hatte die Laterne auf den Boden gestellt; gerade neben den Kopf des Liegenden. Emma ließ sich auf die Knie nieder, und es war ihr, als hörte ihr Herz zu schlagen auf, wie sie das Gesicht erblickte. Es war blaß; die Augen halb offen, so daß sie nur das Weiße von ihnen sah. Von der rechten Schläfe rieselte langsam ein Streifen Blut über die Wange und verlor sich unter dem Kragen am Halse. In die Unterlippe waren die Zähne gebissen. »Es ist ja nicht möglich!« sagte Emma vor sich hin.
Auch der Kutscher war niedergekniet und starrte das Gesicht an. Dann packte er mit beiden Händen den Kopf und hob ihn in die Höhe. »Was machen Sie?« schrie Emma mit erstickter Stimme, und erschrak vor diesem Kopf, der sich selbständig aufzurichten schien.
»Gnä’ Fräul’n, mir scheint, da ist ein großes Malheur gescheh’n.«
»Es ist nicht wahr«, sagte Emma. »Es kann nicht sein. Ist denn Ihnen was geschehen? Und mir…«
Der Kutscher ließ den Kopf des Regungslosen wieder langsam sinken; – in den Schoß Emmas, die zitterte. »Wenn nur wer käm’… wenn nur die Bauersleut’ eine Viertelstund’ später daher’kommen wären…«
»Was sollen wir denn machen?« sagte Emma mit bebenden Lippen.
»Ja, Fräu’n, wenn der Wagen net brochen wär’… aber so, wie er jetzt zug’richt ist… Wir müssen halt weg, bis wer kommt.« Er redete noch weiter, ohne daß Emma seine Worte auffaßte; aber währenddem war es ihr, als käme sie zur Besinnung, und sie wußte, was zu tun war.
»Wie weit ist’s bis zu den nächsten Häusern?« fragte sie.
»Das ist nimmer weit, Fräul’n, da ist ja gleich das Franz Josefsland… Wir müßten die Häuser sehen, wenn’s licht wär’, in fünf Minuten müßte man dort sein.«
»Gehen Sie hin. Ich bleibe da, holen Sie Leute.«
»Ja, Fräul’n, ich glaub’ schier, es ist gescheiter, ich bleib mit Ihnen da – es kann ja nicht so lang dauern, bis wer kommt, es ist ja schließlich die Reichsstraße, und –«
»Da wird’s zu spät, da kann’s zu spät werden. Wir brauchen einen Doktor.«
Der Kutscher sah auf das Gesicht des Regungslosen, dann schaute er kopfschüttelnd Emma an.
»Das können Sie nicht wissen«, – rief Emma, »und ich auch nicht.«
»Ja, Fräul’n… aber wo find’ i denn ein’ Doktor im Franz Josefsland?«
»So soll von dort jemand in die Stadt und –«
»Fräul’n, wissen’s was! I denk mir, die werden dort vielleicht ein Telephon haben. Da könnten wir um die Rettungsgesellschaft telephonieren.«
»Ja, das ist das Beste! Gehen Sie nur, laufen Sie, um Himmelswillen! Und Leute bringen Sie mit… Und… bitt’ Sie, gehen Sie nur, was tun Sie denn noch da?«
Der Kutscher schaute in das blasse Gesicht, das nun auf Emmas Schoß ruhte. »Rettungsgesellschaft, Doktor, wird nimmer viel nützen.«
»Gehen Sie! Um Gotteswillen! Gehen Sie!«
»I geh’ schon – daß S’ nur nicht Angst kriegen, Fräul’n, da in der Finstern.« Und er eilte rasch über die Straße fort. »I kann nix dafür, meiner Seel«, murmelte er vor sich hin. »Ist auch eine Idee, mitten in der Nacht auf die Reichsstraßen…«
Emma war mit dem Regungslosen allein auf der dunklen Straße. Was jetzt? dachte sie. Es ist doch nicht möglich… das ging ihr immer wieder durch den Kopf… es ist ja nicht möglich. – Es war ihr plötzlich, als hörte sie neben sich atmen. Sie beugte sich herab zu den blassen Lippen. Nein, von da kam kein Hauch. Das Blut an Schläfe und Wangen schien getrocknet zu sein. Sie starrte die Augen an; die gebrochenen Augen, und bebte zusammen. Ja warum glaube ich es denn nicht – es ist ja gewiß… das ist der Tod! Und es durchschauerte sie. Sie fühlte nur mehr: ein Toter. Ich und ein Toter, der Tote auf meinem Schoß. Und mit zitternden Händen rückte sie den Kopf weg, so daß er wieder auf den Boden zu liegen kam. Und jetzt erst kam ein Gefühl entsetzlicher Verlassenheit über sie. Warum hatte sie den Kutscher weggeschickt? Was für ein Unsinn! Was soll sie denn da auf der Landstraße mit dem toten Manne allein anfangen? Wenn Leute kommen… Ja, was soll sie denn tun, wenn Leute kommen? Wie lang wird sie hier warten müssen? Und sie sah wieder den Toten an. Ich bin nicht allein mit ihm, fiel ihr ein. Das Licht ist ja da. Und es kam ihr vor, als wäre dieses Licht etwas Liebes und Freundliches, dem sie danken müßte. Es war mehr Leben in dieser kleinen Flamme, als in der ganzen weiten Nacht um sie; ja, es war ihr fast, als sei ihr dieses Licht ein Schutz gegen den blassen fürchterlichen Mann, der neben ihr auf dem Boden lag… Und sie sah in das Licht so lang, bis ihr die Augen flimmerten, bis es zu tanzen begann. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, als wenn sie erwachte. Sie sprang auf! Das geht ja nicht, das ist ja unmöglich, man darf mich doch nicht hier mit ihm finden… Es war ihr, als sähe sie sich jetzt selbst auf der Straße stehen, zu ihren Füßen den Toten und das Licht; und sie sah sich, als ragte sie in sonderbarer Größe in die Dunkelheit hinein. Worauf wart’ ich, dachte sie, und ihre Gedanken jagten… Worauf wart’ ich? auf die Leute? – Was brauchen mich denn die? Die Leute werden kommen und fragen… und ich… was tu’ ich denn hier? Alle werden fragen, wer ich bin. Was soll ich ihnen antworten, Nichts. Kein Wort werd’ ich reden, wenn sie kommen, schweigen werd’ ich. Kein Wort… sie können mich ja nicht zwingen.
Stimmen kamen von weitem.
Schon? dachte sie. Sie lauschte angstvoll. Die Stimmen kamen von der Brücke her. Das konnten also nicht die Leute sein, die der Kutscher geholt hatte. Aber wer immer sie waren – jedenfalls werden sie das Licht bemerken – und das durfte nicht sein, dann war sie entdeckt.