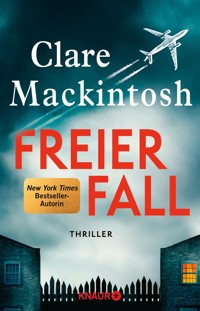
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Flug 79 ist bereit zum Boarding – sind Sie bereit für eine schlaflose Nacht? Im schlafraubenden Locked-Room-Psychothriller »Freier Fall« wird eine Mutter vor die Wahl gestellt, Hunderte Leben zu retten – oder das eine, das ihr alles bedeutet. Was als Party für die Medien geplant war, wird zum Alptraum: In London startet der erste Nonstop-Flug nach Sydney, vollbesetzt mit etlichen Prominenten und Journalisten. Flugbegleiterin Mina bedient die anspruchsvollen Gäste in der Business Class. Dabei versucht sie, weder an die Probleme mit ihrer 5-jährigen Adoptivtochter Sophia zu denken, noch an ihre auseinanderbrechende Ehe. Doch dann drückt jemand Mina einen Zettel in die Hand. Die Botschaft ist ebenso grausam wie unmissverständlich: Wenn Flug 79 dank Minas Hilfe sein Ziel nie erreicht, wird Sophia leben – andernfalls ist sie tot. Die Flugzeit beträgt 20 Stunden: zu viel oder zu wenig Zeit für eine Entscheidung über Hunderte Leben? Filmreife Mischung aus Psycho-Spannung, Locked-Room-Mystery und Katastrophen-Thriller Die britische Bestseller-Autorin Clare Mackintosh überrascht auch in ihrem Psychothriller »Freier Fall« mit einem absolut unvorhersehbaren Twist. Entdecken Sie Clare Mackintoshs explosive Krimi-Reihe aus Wales um das ungleiche Ermittler-Duo Ffion Morgan und Leo Brady (sie Waliserin und weiß, er Engländer und schwarz): - Die letzte Party - Spiel der Lügner - Die Toten der Anderen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Clare Mackintosh
Freier Fall
Thriller
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was als Party für die Medien geplant war, wird zum Alptraum: In London startet der erste Non-Stop-Flug nach Sydney, vollbesetzt mit etlichen Prominenten und Journalisten.
Flugbegleiterin Mina bedient die anspruchsvollen Gäste in der Business Class. Dabei versucht sie, weder an die Probleme mit ihrer 5-jährigen Adoptivtochter Sophia zu denken, noch an ihre auseinanderbrechende Ehe. Doch dann drückt jemand Mina einen Zettel in die Hand. Die Botschaft ist ebenso grausam wie unmissverständlich: Wenn Flug 79 dank Minas Hilfe sein Ziel nie erreicht, wird Sophia leben – andernfalls ist sie tot.
Die Flugzeit beträgt 20 Stunden: zu viel oder zu wenig Zeit für eine Entscheidung über Hunderte Leben?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
NOTRUFPROTOKOLL
PROLOG
TEIL EINS
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
TEIL ZWEI
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
FÜNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
SIEBENUNDVIERZIG
ACHTUNDVIERZIG
NEUNUNDVIERZIG
FÜNFZIG
EINUNDFÜNFZIG
ZWEIUNDFÜNFZIG
EPILOG
ANMERKUNGEN DER AUTORIN
DANKSAGUNG
Für Sheila Crowley
ZENTRALE: Welchen Notfall haben Sie?
ANRUFER: Ich bin in der Nähe vom Flughafen … Und ich sehe … Oh, mein Gott!
ZENTRALE: Können Sie mir bitte genau sagen, wo Sie sind?
ANRUFER: Am Flughafen. Hier ist ein Flugzeug … das steht auf dem Kopf. Es kommt zu schnell runter. Oh, mein Gott, oh, mein Gott!
ZENTRALE: Hilfe ist unterwegs.
ANRUFER: Aber das ist zu spät. Es ist [unverständlich]. Es stürzt ab! Es stürzt ab …
ZENTRALE: Können Sie bestätigen, dass Sie in sicherer Entfernung sind?
ANRUFER: [unverständlich]
ZENTRALE: Ist mit Ihnen alles in Ordnung?
ANRUFER: Es ist abgestürzt. Es ist wirklich abgestürzt. Oh, mein Gott, es brennt …
ZENTRALE: Die Feuerwehr ist in weniger als einer Minute da. Krankenwagen auch. Ist jemand bei Ihnen?
ANRUFER: Die ganze Maschine qualmt – es ist [unverständlich]. O Gott, etwas ist explodiert – es ist wie ein riesiger Feuerball …
ZENTRALE: Die Feuerwehr ist jetzt vor Ort.
ANRUFER: Ich kann kaum noch die Maschine sehen, nur Rauch und Flammen. Es ist zu spät. Zu spät! Da kommt keiner lebend raus.
PROLOG
Nicht rennen, sonst fällst du.
Vorbei am Park, den Hügel hinauf. Warten auf das grüne Männchen, noch nicht, noch nicht …
Jetzt!
Katze im Fenster. Wie eine Statue. Nur die äußerste Schwanzspitze bewegt sich. Zuck, zuck, zuck.
Noch eine Straße überqueren. Kein grünes Männchen und keine Schülerlotsin. Die muss doch hier sein …
Sieh nach rechts, links, wieder rechts. Noch nicht, noch nicht …
Jetzt!
Nicht rennen, sonst fällst du.
Briefkasten, Laternenpfahl, Bushaltestelle, Bank.
Große Schule – nicht meine Schule. Noch nicht.
Buchhandlung, leerer Laden, der Makler, wo Häuser verkauft werden.
Jetzt der Schlachter, wo Vögel am Hals im Fenster aufgehängt sind. Ich kneife die Augen zu, damit ich nicht sehe, wie sie mich anstarren.
Tot. Alle tot.
TEIL EINS
EINS
08:30 Uhr | MINA
Hör auf, sonst fällst du.«
Eine Woche lang hat es geschneit, und der Schnee ist über Nacht immer zu Eis gefroren. Jeden Tag lauert die Gefahr morgens unter einer neuen Puderschicht. Alle paar Meter rutsche ich in meinen Stiefeln fast aus, und mein Bauch verkrampft sich, wappnet sich für einen Sturz. Wir kommen langsam voran, und ich ärgere mich, dass ich nicht daran gedacht habe, Sophia einfach auf dem Schlitten mitzunehmen.
Widerwillig öffnet sie die Augen und dreht den Kopf eulengleich weg von den Läden, um das Gesicht in meinem Ärmel zu vergraben. Ich drücke ihre Hand in dem Fausthandschuh. Sie hasst die Vögel im Schlachterfenster, deren schimmerndes Halsgefieder in einem grausamen Kontrast zu ihren toten Augen steht.
Ich kann sie auch nicht leiden.
Adam sagt, ich hätte diese Phobie an sie weitergegeben wie eine nicht enden wollende Erkältung oder ein Schmuckstück, das sie gar nicht will.
»Wo hat sie es denn dann her?«, fragte er, als ich widersprach. Dabei wies er mit ausladender Geste auf eine unsichtbare Menschenmenge, als würde deren Schweigen seine Behauptung untermauern. »Von mir jedenfalls nicht.«
Natürlich nicht. Adam hat keine Schwächen.
»Sainsbury’s«, sagt Sophia jetzt und blickt zurück zu den Läden, nun, da wir an den toten Vögeln vorbei sind. Sie kann immer noch kein »S« oder »R« sprechen, weshalb es sich so niedlich anhört, dass mir das Herz übergeht. Momente wie diese sind mir heilig, machen alles andere wett.
Ihr Atem bildet winzige Nebelwolken. »Jett Huhladen. Jett de-e-e-e-e …« Sie zieht das Wort in die Länge, hält es so lange zurück, bis wir so weit sind. »… Obt und Gemüdeladen«, sagt sie schließlich, als wir auf der Höhe des Geschäfts sind. Obt und Gemüde. Gott, wie ich die Kleine liebe! Wirklich.
Das Ritual hatte im Sommer vor dem Schulbeginn angefangen, als Sophia vor Aufregung und Nervosität übersprudelte und ihr mit jedem Atemzug Fragen aus dem Mund purzelten. Wie wären ihre Lehrer? Wo würde sie ihre Jacke aufhängen? Würde es Pflaster geben, wenn sie sich das Knie aufschürfte? Und wie kommen wir noch mal da hin? Ich lief immer wieder den Weg mit ihr ab: den Hügel hinauf, über die erste Straße, dann die zweite, dann in die Hauptstraße. Vorbei an der Bushaltestelle der Mittelschule, dann an der Ladenzeile mit der Buchhandlung, dem leeren Laden, dem Makler und schließlich dem Schlachter vorbei. Um die Ecke zu Sainsbury’s. Zum Schuhladen, dem Obst- und Gemüseladen, an der Polizeiwache vorbei, weiter nach oben, an der Kirche vorbei, und dann sind wir da, sagte ich ihr.
Mit Sophia muss man Geduld haben, was Adam schwerfällt. Man muss ihr Sachen immer und immer wieder sagen. Ihr versichern, dass sich nichts geändert hat und nicht ändern wird.
An ihrem ersten Tag im September hatten Adam und ich sie gemeinsam hingebracht. Wir nahmen jeder eine Hand von ihr, schaukelten sie zwischen uns, als wären wir immer noch eine richtige Familie, und ich war froh, eine Entschuldigung für die Tränen zu haben, die mir in den Augen brannten.
»Sie wird losziehen, ohne sich noch mal zu euch umzudrehen. Ihr werdet schon sehen«, sagte Tante Mo, als sie meinen Gesichtsausdruck bei unserem Aufbruch bemerkte. Eigentlich ist sie keine Tante, aber »Mrs Watt« ist zu förmlich für eine Nachbarin, die heiße Schokolade macht und sich Geburtstage merkt.
Ich hatte mir ein Lächeln für Mo abgerungen. »Ich weiß. Bekloppt, oder?«
Bekloppt ist es auch, sich zu wünschen, Adam würde noch bei uns wohnen. Bekloppt ist es zu denken, der Tag wäre irgendwas anderes gewesen als ein Rollenspiel um Sophias willen.
Mo hatte sich lächelnd zu Sophia gebeugt. »Viel Spaß, Süße!«
»Mein Kleid kratzt.« Die Worte kamen mit einer Schnute heraus, die Mo ignorierte.
»Das ist schön, Liebes.«
Mo hat ihr Hörgerät oft nicht drin, um Batterie zu sparen. Wenn ich zu ihr gehe, muss ich mich ins Blumenbeet vor ihrem Wohnzimmerfenster stellen und winken, bis sie mich bemerkt. Du hättest doch klingeln können!, sagt sie immer, als hätte ich das nicht seit zehn Minuten getan.
»Was kommt als Nächstes?«, fragte ich Sophia an jenem ersten Tag, als wir am Gemüsemann vorbei waren und sich ihre Angst von ihren Fingern in meine übertrug.
»Polizei!«, rief sie triumphierend. »Daddys Wache.«
Es ist nicht die Wache, auf der Adam arbeitet, aber das spielt für Sophia keine Rolle. Jeder Streifenwagen ist Daddys Auto, jeder Uniformierte ist Daddys Freund.
»Und dann den Berg rauf.«
Sie hatte sich alles gemerkt. Am nächsten Tag ergänzte sie weitere Einzelheiten – Dinge, die ich nicht gesehen oder bemerkt hatte. Eine Katze auf einem Fenstersims, eine Telefonzelle, eine Mülltonne. Die Begleitkommentare wurden zu einem festen Bestandteil ihres Tages, so wichtig wie das Anziehen der Schuluniform in der richtigen Reihenfolge (von oben nach unten) oder der Flamingostand beim Zähneputzen, bei dem sie die Beine mit den Seiten wechselte. Je nach Tagesform fand ich diese Rituale bezaubernd oder wollte schreien. Das ist Elternsein in Kurzfassung.
Der Schulanfang hatte das Ende eines Kapitels und den Beginn eines neuen markiert, und wir hatten uns auf den Übergang vorbereitet, indem wir Sophia im letzten Jahr für drei Tage die Woche in die Vorschule schickten. Die übrige Zeit verbrachte sie mit mir, Adam oder Katya, dem stillen, hübschen Au-pair, das mit passendem Gepäck und ohne ein Wort Englisch angekommen war. Katya verbrachte die Mittwochnachmittage an der Sprachenschule und stockte ihren Lohn an den Wochenenden auf, indem sie Regale im Supermarkt auffüllte. Nach sechs Monaten erklärte sie uns zur nettesten Familie der Welt und bat, noch ein Jahr bleiben zu dürfen. Ich fragte mich laut, ob es einen festen Freund gab, und Katyas Erröten legte nahe, dass ich recht hatte, auch wenn sie nicht verraten wollte, wer es war.
Ich war begeistert – und erleichtert. Adams und meine Arbeitszeiten machten es unmöglich, uns allein auf eine Kindertagesstätte zu verlassen, und wir hätten uns niemals die Nannys leisten können, die viele meiner Kollegen einstellten. Ich hatte mich gesorgt, dass eine Fremde im Haus stören würde, doch Katya verbrachte ihre Zeit meistens in ihrem Zimmer, wo sie mit Freunden zu Hause skypte. Sie zog es auch vor, allein zu essen, obwohl wir sie immer wieder einluden, sich zu uns zu setzen; und sie machte sich im Haus nützlich, wischte den Boden oder sortierte die Wäsche, auch wenn ich ihr sagte, dass sie das nicht muss. »Du bist hier, um mit Sophia zu helfen und Englisch zu lernen.«
»Es macht mir nichts aus«, antwortete sie. »Ich helfe gern.«
Eines Tages kam ich nach Hause und fand mehrere Sockenpaare von Adam auf unserem Bett, die Fersen, die er immerzu durchlief, säuberlich gestopft.
»Wo hast du das denn gelernt?« Ich konnte gerade mal einen Knopf annähen oder einen Saum kürzen – und das auch nur ungeschickt. Stopfen hingegen war echtes Hausfrauenterritorium, und Katya war nicht mal fünfundzwanzig.
Sie zuckte mit den Schultern, als wäre es nichts. »Meine Mutter hat mich gelehrt.«
»Ich weiß wirklich nicht, was wir ohne dich tun würden.«
Ich konnte zusätzliche Schichten bei der Arbeit übernehmen, weil ich wusste, dass Katya da war, um Sophia zur Schule zu bringen oder abzuholen, und Sophia betete sie an, was wahrlich keine Selbstverständlichkeit war. Katya hatte die Geduld, endlos mit ihr Verstecken zu spielen, und Sophia fand im Laufe der Zeit immer raffiniertere Verstecke.
»Eins, zwei, drei, ich komme!«, rief Katya laut, jedes neu erlernte Wort sorgfältig ausgesprochen, bevor sie durchs Haus schlich und nach ihrem Schützling suchte. »Im Schuhschrank? Nein … Wie wäre es hinter der Badezimmertür?«
»Das klingt nicht sehr sicher«, sagte ich, als Sophia die Treppe heruntergestürmt kam und mir triumphierend erzählte, dass Katya sie nicht gefunden hatte, weil sie sich auf einem Regal im Wäscheschrank versteckt hatte. »Ich möchte nicht, dass du dich irgendwo versteckst, wo du feststecken könntest.« Sophia hatte mich erbost angesehen und war zurück zu Katya gelaufen, um weiterzuspielen. Ich ließ es gut sein. Mein Vater hielt Adam und mir vor, wir wären übervorsichtig, und zwar ebenso oft, wie ich ihn bat, nicht so laissez faire zu sein.
»Sie wird fallen«, sagte ich und konnte kaum hinsehen, wenn er Sophia überredete, auf Bäume zu klettern oder über wacklige Steine einen Bach zu überqueren.
»So lernt man fliegen.«
Ich wusste, dass er recht hatte, und kämpfte gegen den Drang an, Sophia wie ein Baby zu behandeln. Außerdem sah ich ja, dass sie abenteuerlustig war und das Gefühl liebte, wie ein »großes Mädchen« behandelt zu werden. Katya erkannte es sofort, und die beiden waren sich schnell sehr nahe. Sophias Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen – besonders, was Menschen betrifft –, entwickelt sich erst noch. Umso froher war ich, dass Katya bleiben wollte. Mir graute davor, wie sich ihr Weggang auswirken würde.
Der erfolgte abrupt im Juni, nur Wochen nachdem sie gefragt hatte, ob sie bleiben dürfe. Wochen, in denen ich mich zu entspannen begonnen hatte. Ihr Gesicht war tränenfleckig, als sie eilig packte und Sachen in ihren Koffer stopfte, die noch klamm vom Trockner waren. Hatte es mit dem Freund zu tun? Sie wollte mich nicht ansehen. Hatte ich irgendwas falsch gemacht?
»Ich gehe jetzt«, war alles, was sie sagte.
»Bitte, Katya, was es auch ist, lass uns darüber reden.«
Da zögerte sie, und ich bemerkte ihren Blick zu Adam. Sie wirkte wütend und verletzt, und ich drehte mich gerade noch rechtzeitig um, dass ich ihn den Kopf schütteln sah. Eine stumme Anweisung.
»Was ist los?« Ich schaute die beiden abwechselnd an.
Adam hatte mal gescherzt, sollte es zwischen Katya und mir zum Streit kommen, wäre er gezwungen, für die jüngere Frau Partei zu ergreifen. »Ein gutes Au-pair ist nicht so leicht zu ersetzen«, sagte er.
»Sehr witzig.«
»Erzähl mir nicht, du würdest es nicht genauso machen.«
Ich hatte eine Grimasse geschnitten. »Ertappt.«
»Also?«, fragte ich. Sie hatten sich gestritten – das war offensichtlich –, aber weshalb? Sophia war ihre alleinige Gemeinsamkeit, es sei denn, man zählte die Krimiserien mit, die Adam liebte und ich hasste. Sie waren das Einzige, was Katya an einem Samstagabend aus ihrem Zimmer locken konnte. War ich nicht bei der Arbeit, ging ich in der Zeit laufen und kehrte nach zehn Kilometern zurück, wenn schon der Abspann zu sehen war und die beiden sich über die Folge unterhielten.
Nur stritt sich niemand wegen Krimiserien.
»Frag ihn«, antwortete Katya wütend. Es war das erste Mal, dass ich sie anders als fröhlich erlebte. Draußen wurde gehupt – ihr Taxi zum Flughafen –, und nun sah sie mich an. »Du bist eine nette Frau. Du verdienst solchen Mist nicht.«
Etwas in mir zersplitterte wie ein winziger Riss am Rande eines gefrorenen Sees. Ich wollte zurückspringen, damit das Eis heil bleibt, aber es war zu spät.
Knack.
Sobald sie weg war, wandte ich mich zu Adam um. »Also?«
»Was also?« Er drehte es so hin, als wäre meine Frage – meine schiere Anwesenheit – das eigentliche Ärgernis. Als wäre es meine Schuld.
Ich konzentrierte mich auf den Blick zwischen den beiden, auf Katyas gerötete Augen und die angedeutete Warnung. Du verdienst solchen Mist nicht.
»Ich bin nicht blöd, Adam. Was ist los?«
»Womit?« Wieder dieses leichte Schnalzen, bevor er sprach. Es sollte mir zu verstehen geben, dass er mit anderen, wesentlicheren Dingen befasst war und ich ihn zurück zu Irrelevantem nötigte.
»Mit Katya«, antwortete ich so, wie manche Leute mit Ausländern sprechen. Mir war, als wäre ich in das Leben von jemand anderem gestolpert. Dies war ein Gespräch, das ich nie zuvor führen musste oder geglaubt hätte, je führen zu müssen.
Er drehte sich um und beschäftigte sich mit etwas, das nicht getan werden musste. Ich sah seinen vor Schuld geröteten Hals. Die Wahrheit schlich sich in meinen Kopf wie die Antwort zu einem Kreuzworträtsel, nachdem die Zeitung längst weggeworfen war. Und mein Mund formte Worte, die ich nicht aussprechen wollte.
»Du hast mit ihr geschlafen.«
Adam fuhr herum. »Nein! Gott, nein! Himmel, Mina, das denkst du?«
Jede Faser von mir wollte ihm glauben. Er hatte mir nie einen Anlass gegeben, an ihm zu zweifeln. Er liebte mich. Ich liebte ihn. Es war schwer, mit ruhiger Stimme zu sprechen. »Was erwartest du, das ich denke? Irgendwas ist da zwischen euch, eindeutig.«
»Sie hat die Knetmasse in der ganzen Küche verteilt. Ich habe was gesagt, und sie hat es persönlich genommen. Mehr nicht.«
Ich starrte sein gerötetes Gesicht an, das förmlich »Lüge« schrie. »Du hättest dir wenigstens eine plausible Ausrede ausdenken können.« Dass er sich keine Mühe gab, eine gute Geschichte zu erfinden, tat fast so sehr weh wie die Lüge selbst. Bedeutete ich ihm so wenig?
Katyas Abreise trieb einen Keil in unsere Familie. Sophia war wütend und drückte ihre Trauer um die plötzlich verlorene Freundin aus, indem sie Spielzeug zerschlug und Bilder zerriss. Sie gab mir die Schuld, weil ich diejenige war, die es ihr sagte, und es bedurfte meines gesamten Vorrats an Anstand, ihr nicht zu erzählen, dass Adam schuld war. Er und ich umkreisten einander: Ich wütend und verbittert; er wortkarg und voller gekünsteltem Groll, der bewirken sollte, dass ich an mir selbst zweifelte. Ich blieb standhaft. War Katya das Kreuzworträtsel, hatte ich es jetzt gelöst und sah, dass die Hinweise kein bisschen kryptisch gewesen waren. Seit Monaten war Adam ausweichend, was seine freien Tage anging, und nahm auf einmal sogar sein Handy mit ins Bad, wenn er duschte. Ich war dumm gewesen, es nicht eher zu begreifen.
»Den Berg rauf«, sagt Sophia jetzt. »Dann die Kirche, und …«
Zu spät greife ich ihre Hand fester. Sophias Finger entgleiten mir, als ihre Füße unter ihr wegrutschen und sie mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlägt. Zunächst reißt sie die Augen weit auf vor Schreck, dann verengt sie sie, während sie bewertet, wie sehr sie sich wehgetan hat, wie erschrocken sie ist und wie verlegen. Ich verkürze diesen Ablauf, indem ich meine Tasche fallen lasse und sie hochhebe, wobei ich in meiner Eile einen Mann anstoße, der uns entgegenkommt.
»Hoppala!«, sage ich im Ton einer versierten Nanny.
Sophia sieht mich an. Ihre Unterlippe bebt, und mit ihren dunklen Augen versucht sie, in meinen zu erkennen, wie schlimm ihr Sturz war. Ich lächle, um ihr zu signalisieren, dass es nichts war, und suche am Himmel nach Wolkenfiguren.
»Siehst du den Hund? Der steht auf den Hinterbeinen – siehst du? Da ist sein Kopf. Und da sein Schwanz.«
Sie wird nicht weinen. Sophia weint nie. Stattdessen wird sie wütend, brüllt unartikuliert und gibt mir die Schuld. Immer mir. Oder sie rennt auf die Straße, um etwas zu beweisen, das nur sie versteht. Dass ich sie liebe? Dass ich sie nicht liebe?
Sie folgt meinem Blick. Ein Flugzeug durchschneidet die Wolken, die so dicht aussehen, als könnten sie es stoppen.
»747«, sagt Sophia.
Ich atme auf. Die Ablenkung hat gewirkt. »Nein, es ist ein A380. Kein Hubbel vorn, siehst du?« Ich setzte sie behutsam ab, und sie zeigt mir ihren vom Schnee durchnässten Handschuh.
»Arme Sophia. Guck mal, da ist die Kirche. Was kommt als Nächstes?«
»D-die Schule.«
»Dann sind wir fast da«, sage ich mit einem strahlenden Lächeln, unter das ich das Unheil kehre. Meine Tasche – oder vielmehr Sophias Tasche – ist umgekippt, und der Inhalt hat sich auf das Pflaster ergossen. Ich stopfe ihre Wechselsachen wieder hinein und hole die Wasserflasche, die über die Steine kullert und im Sekundentakt mal den Namen meiner Tochter zeigt, mal nicht.
»Ist das deiner?«
Der Mann, den ich angerempelt habe, hält Sophia etwas hin. Es ist der Elefant, dessen Rüssel von fünf Jahren Liebe ganz eingedrückt und blank ist.
»Gib mir den wieder!«, brüllt Sophia, wobei sie aber gleichzeitig einen Schritt zurückweicht und sich hinter mir versteckt.
»Es tut mir sehr leid.«
»Schon gut.« Den Mann scheint die Unhöflichkeit meiner Tochter nicht zu stören. Ich darf mich nicht für sie entschuldigen. Es widerspricht dem, was sie empfindet, und sie braucht in diesem Moment Unterstützung. Dennoch ist es schwer, den Mund zu halten, wenn Leute die Augenbrauen hochziehen und sichtlich erschrocken sind, dass man seinem Kind keine Manieren beibringt. Ich nehme den Elefanten, und Sophia reißt ihn mir sofort aus der Hand, um ihr Gesicht darin zu vergraben.
Das Stofftier stammt aus dem Haus, in dem Sophia die ersten vier Monate ihres Lebens verbracht hat. Er ist das Einzige, was ihr aus jener Zeit geblieben ist, auch wenn keiner weiß, ob er tatsächlich Sophias war oder nur an dem Tag gegriffen wurde, als sie in die Notunterkunft kam. So oder so sind die beiden heute unzertrennlich.
Sie hält den Elefanten beim Rüssel, bis wir in der Schule sind, wo sie Miss Jessop ihre nassen Handschuhe zeigt und ich Sophias Jacke aufhänge und Mütze und Schal in ihre Tasche stecke. Es ist der 17. Dezember, und in der Schule herrscht kribbelnde Vorweihnachtsstimmung. Watte-Schneemänner tanzen über Bastelpapierbogen an Pinnwänden, und mehrere Lehrerinnen tragen weihnachtliche Ohrringe, sodass ihre Ohrläppchen Blinksignale abgeben, die festlich sein könnten oder ein Alarm. Der Fliesenboden ist nass von Schneeklumpen, die am Eingang nicht vollständig abgeklopft wurden und sich bis zu den Garderobenhaken verteilt haben.
Ich bringe Miss Jessop Sophias Brotdose, während ich weiter den Inhalt ihrer Tasche durchgehe. Katya hatte die Tasche jeden Abend ausgeleert, klebrige Fingerabdrücke weggewischt und diskret die weniger gelungenen Kunstwerke im Papiermüll verschwinden lassen. Genauso will ich es auch halten, aber dann hänge ich mir nachmittags die Tasche über die Schulter und denke nicht mehr dran, bis wir am nächsten Morgen zur Schule gehen.
»Alles bereit für Weihnachten?« Sophias Lehrerin ist eine zierliche Frau mit glatter Haut, was bedeutet, dass sie Mitte zwanzig sein muss oder dreißig, wobei sie sich dann gut gehalten hätte. Ich denke an all die teuren Gesichtswässer, die ich mir über die Jahre in Duty-free-Läden gekauft habe, all die Hautpflege, die ich mit besten Absichten angefangen hatte, um doch wieder bei Feuchttüchern zu landen. Ich wette, Miss Jessop macht Tiefenreinigungen und benutzt regelmäßig Feuchtigkeitscremes.
»Einigermaßen.«
An Sophias Ersatzpulli hängt ein Eisklumpen, und drum herum ist der Stoff nass und kalt. Ich schüttle ihn aus, bevor ich mich wieder der fruchtlosen Suche zwischen Teilen von Eierpappen und leeren Saftpackungen zuwende. »Ich kann ihren Epi-Pen nicht finden. Haben Sie noch den, den ich Ihnen gegeben hatte?«
»Ja, keine Sorge. Der ist im Medizinschrank, mit Sophias Namen drauf.«
»Meine Haargummis sind die falsche Farbe!«, verkündet Sophia.
Miss Jessop bückt sich, um sich Sophias Zöpfe anzusehen, von denen einer mit einem roten und der andere mit einem blauen Gummi gebunden ist. »Das sind sehr hübsche Haargummis.«
»Für die Schule habe ich aber immer zwei blaue!«
»Tja, mir gefallen diese sehr gut.« Miss Jessop sieht wieder zu mir, und ich staune über ihre berufstypische Fähigkeit, immer das letzte Wort zu haben. Meine Haargummi-Diskussion mit Sophia hatte das gesamte Frühstück und einen Großteil unseres Schulwegs über angedauert. »Und vergessen Sie bitte nicht, dass morgen unser Weihnachtsessen ist, also braucht Sophia da keine Brotdose mitzubringen.«
»Alles klar. Morgen holt unsere Babysitterin sie ab. Becca. Ich glaube, Sie kennen sie schon.«
»Nicht Mr Holbrook?«
Für einen Moment halte ich ihren Blick und frage mich, ob sich hinter diesem Lächeln noch etwas anderes verbirgt. Enttäuschung? Schuld? Doch ihr Gesichtsausdruck wirkt harmlos, und ich sehe weg, während ich Sophias klammen Pulli neu falte. Verfluchter Adam, dass er mich zu der Sorte paranoider Ehefrau gemacht hat, die mir immer leidtut!
»Er war nicht sicher, ob er rechtzeitig von der Arbeit wegkommt, deshalb ist es sicherer, wenn die Babysitterin Sophia abholt.«
»Wohin geht es für Sie heute?«
»Nach Sydney.«
»In einer Boeing 777«, sagt Sophia. »Mit 353 Passagieren. Es dauert zwanzig Stunden hin, und dann müssen sie wieder zurückkommen, was noch mal zwanzig Stunden dauert, aber erst mal schlafen sie in einem Hotel.«
»Hui, wie aufregend! Bleiben Sie lange weg?«
»Fünf Tage. Rechtzeitig zu Weihnachten bin ich wieder zurück.«
»Die haben vier Piloten, weil es so weit ist, aber die müssen nicht alle auf einmal fliegen. Sie wechseln sich ab.«
Sophia hat alle Einzelheiten zu allen Flugzeugen gelernt, in denen ich fliege. Es gibt eine Führung durch eine 747 auf YouTube, die sie hundertmal gesehen haben muss. Sie kennt das Video in- und auswendig, bewegt die Lippen zum Text des Erzählers. Eine eindrucksvolle Party-Nummer.
»Manchmal finde ich es etwas unheimlich«, sagte ich zu meinem Dad und lächelte bei der Erinnerung. Adam und ich hatten kürzlich entdeckt, dass Sophia nicht, wie wir dachten, die Texte aus ihren Lieblingsbüchern auswendig nachsprach, sondern sie las. Da war sie drei Jahre alt.
Dad hatte gelacht. Er nahm seine Brille ab und putzte sie mit seinem Hemdsaum. »Habt euch nicht so. Sie ist ein aufgewecktes Mädchen. Zu Großem bestimmt.« Seine Augen glänzten, und ich musste heftig blinzeln. Er vermisste Mum genauso sehr wie ich, aber ich fragte mich auch, ob er sich erinnerte, dass sie mal dasselbe über mich gesagt hatten.
Der Psychologe schloss, dass Sophia Hyperlexie hat, was die erste positive Diagnose in einem Meer von Abkürzungen und negativen Schlagworten war. Bindungsstörung. Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Pathologische Verweigerung. Das alles steht nicht auf den Adoptionsplakaten.
Adam und ich hatten ein paar Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Wir hätten weitermachen können, aber mir wurde der Stress schon zu viel, und ich merkte, wie ich allmählich zu der Frau wurde. Der Frau, die genau weiß, wann sie ihren Eisprung hat, die »Baby Showers« von Freundinnen meidet und ihre sämtlichen Ersparnisse für künstliche Befruchtung ausgibt.
»Wie viel kostet das?«
Ich war irgendwo über dem Atlantik und spie all meine Sorgen – na ja, einige – gegenüber einer Kollegin aus, mit der ich an dem Tag arbeitete. Sian war mütterlich sanft, und wir tauschten Lebensgeschichten aus, bevor das Fahrwerk eingeklappt war.
»Tausende.«
»Könnten deine Eltern dir aushelfen?«
Ich erzählte ihr nichts von Mum. Das war noch zu frisch. Und was eine Kreditanfrage bei Dad betraf, nach allem, was geschehen war … Ich schüttelte den Kopf und lenkte das Gespräch in eine andere Richtung. »Es ist nicht nur das Geld. Ich würde irgendwann total besessen sein, das weiß ich. Bin ich schon. Ich wünsche mir Kinder, aber ich will über diesen Wunsch nicht durchdrehen.«
»Na dann, viel Glück dabei.« Sian schnaubte. »Ich habe vier und bin mit jedem ein bisschen mehr gaga geworden.«
Wir wurden für eine Adoption in Betracht gezogen. Es dauerte eine Weile, weil wir ganz klar gesagt hatten, dass wir ein Kind unter einem Jahr wollten. Adams Arbeit bei der Polizei hatte ihn mit einigen der schlimmsten Produkte des Pflegesystems in Berührung gebracht, und wir glaubten beide nicht, dass wir mit solch einem Kind umgehen könnten. Ein Baby wäre einfacher, dachten wir.
Sophia wurde uns angeboten, als sie vier Monate alt war. Die fünf vorherigen Kinder ihrer Mutter waren ebenfalls als Säuglinge wegen gefährlicher Vernachlässigung in Obhut genommen worden. Die behördlichen Abläufe waren sehr träge, und die Monate, in denen sie bei einer Pflegefamilie war und wir auf sie warten mussten, nahmen kein Ende. Wir mussten dem Sozialdienst zeigen, dass wir vorbereitet waren, wurden aber gleichzeitig von Aberglauben gepackt. Adam stellte die größten Verrenkungen an, um einen Bogen um Leitern zu machen, und achtete darauf, dass schwarze Katzen seinen Weg nur von der richtigen Seite her kreuzten. Unser Kompromiss bestand darin, in Sophias frisch gestrichenem Zimmer alles bereitzustellen, was wir brauchten, jedoch nichts auszupacken, falls etwas schiefging und wir alles wieder zurückbringen müssten.
Der offizielle Bescheid kam, als Sophia zehn Monate alt war, und Adam raste mit dem Wagen voller Papp- und Plastikverpackungen zum Recyclinghof. Endlich hatten wir unsere Familie. In Filmen wollen sie einen glauben machen, das sei das Happy End. Wie sich herausgestellt hat, muss man sich dafür ein bisschen mehr anstrengen.
Nun läuft Sophia mit ihren Freundinnen weg, und ich beobachte sie durch das Glas. Sogar jetzt noch gibt es einige Kinder, die beim Abschied morgens weinen. Ich frage mich, ob ihre Eltern Sophia sehen und denken, die glückliche Mum, so wie ich die Kinder beobachte, die sich an ihre Mütter klammern, und dasselbe denke.
Zu Hause lege ich eine Nachricht für Becca hin, die Oberstufenschülerin, die hin und wieder auf Sophia aufpasst. Ich stelle eine Lasagne zum Auftauen heraus, falls Adam nicht rechtzeitig zum Abendessen zurück ist, und lege ein sauberes Handtuch ins Gästezimmer, obwohl mein Mann weiß, wo der Wäscheschrank ist. Es ist schwer, sich solche Dinge abzugewöhnen, nachdem man zehn Jahre lang für jemanden gesorgt hat.
»Warum kann ich nicht in unserem Bett schlafen?«, hatte er das erste Mal gefragt.
Ich sprach leise, und das nicht nur wegen Sophie. Ich wollte keinen von uns noch mehr verletzen, als wir es ohnehin schon waren. »Weil es nicht mehr unser Bett ist, Adam.« Das war es seit dem Tag nicht mehr, an dem Katya ging.
»Warum bist du so?«
»Wie?«
»So kalt. Als würden wir uns kaum kennen.« Er verzog das Gesicht. »Ich liebe dich, Mina.«
Ich öffnete den Mund, um zu erwidern, dass ich nicht mehr so empfand, aber das brachte ich nicht über die Lippen.
Natürlich haben wir es mit Paartherapie versucht. Um Sophias willen, wenn schon nicht für uns. Ihre Bindungsprobleme saßen tief, eine körperliche Erinnerung an die Monate, in denen sie weinte und niemand sie trösten kam. Was würde eine Trennung bei ihr auslösen? Sophia war es gewohnt, dass Adam abends und nachts arbeitete und ich manchmal über Tage weg war. Doch wir kamen immer zurück.
Bei der Therapie war Adam bestenfalls einsilbig und so ausweichend wie zu Hause auch. Im Juli erklärte er sich bereit auszuziehen.
»Ich brauche Zeit«, hatte ich ihm gesagt.
»Wie viel Zeit?«
Das konnte ich nicht sagen. Ich wusste es nicht. Er zögerte vor den Koffern, die wie eine russische Puppe einer in dem anderen steckten. Optimistisch wählte er den kleinsten. Die Personalabteilung besorgte ihm ein Zimmer in einem Haus mit drei Polizeirekruten, die sich voller Enthusiasmus und billigem Bier mit ihren neuen Erlebnissen in Uniform überboten. »Da kann ich Sophia nicht mit hinnehmen«, sagte Adam. »Das wäre nicht gut für sie.«
Also richtete ich ihm das Gästezimmer her, und wenn ich bei der Arbeit bin, schläft Adam hier. Für wen von uns beiden es schlimmer ist, ist schwer zu sagen.
Ich ziehe mir meine Uniform an und überprüfe meinen Koffer. Der heutige Flug ist eine große Nummer. Den letzten Nonstop-Flug von London nach Sydney gab es 1989 – eine Werbeaktion mit zwanzig Leuten an Bord. Reguläre Linienflüge waren bisher nicht möglich. Es hat Jahre gedauert, eine Maschine zu entwickeln, die diese Entfernung bei voller Auslastung bewältigt.
Ich lege Sophia eine Nachricht aufs Bett: ein mit Filzstift gemaltes Herz, unter dem Hab dich lieb, Mummy steht. Das mache ich jedes Mal, wenn ich fliege, seit sie lesen kann.
»Hast du meine Nachricht gefunden?«, habe ich sie einmal bei einem Video-Anruf gefragt, bei dem ich ihr Gute Nacht sagen wollte. Ich habe vergessen, wo ich war, doch die Sonne stand noch hoch am Himmel, und beim Anblick der frisch gebadeten Sophia bekam ich Heimweh.
»Was für eine Nachricht?«
»Auf deinem Bett. Ich habe sie auf dein Kissen gelegt, wie immer.« Das Heimweh machte mich unfair, denn ich wollte, dass Sophia sagte, sie würde mich vermissen, weil ich sie vermisste.
»Bye, Mummy. Katya und ich bauen eine Höhle.« Das Bild wackelte, und ich sah die Decke in der Küche. Ich beendete das Gespräch, bevor Katya Mitleid mit mir haben konnte.
Auf dem Weg zum Flughafen schalte ich Radio 2 ein, aber meine Schuldgefühle übertönen es fast.
»Leute müssen arbeiten«, sagte ich mir laut. »So ist es nun mal.«
Ich hatte Adam gesagt, dass der Dienstplan geändert wurde und ich versucht hatte zu tauschen. Doch jetzt wäre ich fünf Tage fort, und was sollte man da machen? Job war Job.
Es war gelogen.
ZWEI
09:00 Uhr | ADAM
Der Boss will dich sehen.«
Ätzende Säure brennt in meinem Bauch, als ich mich bemühe, normal zu wirken. Haben diese fünf Worte jemals Gutes verheißen?
»Ah, in Ordnung.« Ich sitze an meinem Schreibtisch. Meine Hände sind plötzlich zu groß, zu ungeschickt, als stünde ich vor einem riesigen Publikum, nicht nur vor Wei, der mich neugierig ansieht.
»Im Moment ist der DCI noch bei ihr.«
»Danke.« Stirnrunzelnd blicke ich auf den Monitor und gehe die Papiere auf meinem Schreibtisch durch, als würde ich etwas suchen. Ich muss einen Bericht zu einem Raub für die Staatsanwaltschaft fertig machen, Aussagen zu einer schweren Körperverletzung aufnehmen, die auf einen Mord hinauslaufen könnte, falls das Opfer nicht durchkommt. Das ist die Arbeit, auf die ich mich konzentrieren muss. Stattdessen schwitze ich in meinen Kragen und frage mich, ob es das war. Ob es das Ende ist. Ich spüre, dass Wei mich ansieht, und frage mich, ob er schon weiß, warum Butler mich sprechen will.
Weiche Schneeflocken landen draußen auf dem Fenstersims. Drinnen wandert ein ignorierter Anruf von einem leeren Schreibtisch zum nächsten, bis sich jemand erbarmt und rangeht. Ich finde die Akte zur schweren Körperverletzung und überfliege die Zeugenliste. Hiermit könnte ich den ganzen Tag draußen unterwegs sein, und wenn ich deshalb eine Nachricht vom DI verpasse, dann habe ich eben Aussagen aufgenommen oder mit der Opferbetreuung telefoniert. Ich stopfe die Akte in meinen Rucksack und stehe auf.
»Sie wollen hoffentlich zu mir.«
Ihre Stimme ist beinahe angenehm, aber das beruhigt mich null. Ich habe genug Police Officers gesehen, die mit einem Lächeln in Detective Inspector Naomi Butlers Büro gingen und eine halbe Stunde später mit einer gegengezeichneten Abmahnung in der geballten Faust wieder herauskamen.
»Eigentlich muss ich …«
»Es dauert nicht lange.«
Butler gibt mir keine Chance zu widersprechen. Sie geht voraus aus dem CID-Büro und den Korridor hinunter zu ihrem, sodass mir keine andere Wahl bleibt, als ihr zu folgen. Sie trägt weiße Converse zu einer Nadelstreifenhose und einer grauen Seidenbluse, die von einem Leomustergürtel gerafft wird. Ein winziger Silberring steckt oben in ihrem einen Ohr. Ich trotte hinter ihr her wie ein Kind auf dem Weg zum Schuldirektor und liste im Geiste alle Gründe auf, die sie haben könnte, mich sprechen zu wollen. Am Ende gibt es nur einen, der wirklich zählt. Den, der mich alles kosten kann.
Als Naomi Butler ihren Posten übernahm, rückte sie den schweren Schreibtisch vom Fenster weg, sodass sie mit dem Gesicht zu der Glastür sitzt, die sie nun hinter mir schließt. Wohl oder übel muss ich mit dem Rücken zum Korridor Platz nehmen. Zweifellos wird Wei in den nächsten Sekunden einen Vorwand finden, am Büro vorbeizugehen, um mit einem Blick nach drinnen abzuschätzen, was mir blüht. Ich setze mich gerader hin. Die Haltung verrät eine Menge, und ich kann darauf verzichten, dass Wei zurückläuft und den anderen im Büro berichtet, ich hätte ganz klein beim Boss gesessen.
»Wie läuft es?« Butler lächelt, doch ihr Blick ist hart. Er fixiert mich auf eine Art, dass es fast wehtut, und ich muss blinzeln, um den Kontakt zu brechen. Ein Punkt für Butler. Die Bikerjacke, die sie bei jedem Wetter anhat, hängt auf ihrer Stuhllehne, und als sie sich zurücklehnt, knarzt das Leder mürrisch. Auf ihrem Schreibtisch steht ein Polizeiradio, das auf den hiesigen Kanal eingestellt ist. Es heißt, dass sie es nie ausschaltet, nicht mal zu Hause, und bei jedem Einsatz aufkreuzt, der ihr Interesse weckt.
»Bestens.«
»Wie ich höre, haben Sie einige private Probleme.«
»Keine, mit denen ich nicht fertigwerde.« Sie will mir doch wohl keine Beziehungsratschläge geben, oder? Ich blicke zu dem schmalen Streifen hellerer Haut an ihrem Ringfinger und frage mich, wer wen verlassen hat. Butler bemerkt es – selbstverständlich tut sie das –, und ihr Lächeln verschwindet.
»Haben Sie ein Diensthandy?«
Ich bin überrascht. Irgendwie ist es eine Frage, nur kennt sie die Antwort, also ist es lediglich ihr Einstieg.
»Ja.«
Sie liest meine Telefonnummer von ihrem Notizblock ab, und ich nicke. Mein Fluchtinstinkt ist so stark, dass ich die Sitzfläche zu beiden Seiten packe, um mich zu bremsen.
»Die Buchhaltung hat Ihre Telefonrechnung markiert.«
Drückende Stille tritt ein, und jeder wartet, dass der oder die andere sie füllt. Ich knicke zuerst ein. Selbst wenn man die Regeln kennt, ist es schwer, nicht mitzuspielen. Zwei zu null für Butler.
»Ist das so?«
»Sie ist auffällig höher als alle anderen in der Abteilung.«
Ich kann einen Schweißtropfen fühlen, der mir seitlich übers Gesicht läuft. Wenn ich ihn wegwische, sieht sie es. Ich drehe meinen Kopf ein wenig, merke jedoch, wie auf der anderen Seite das Gleiche passiert.
»Ich hatte dieses Überfallopfer, das nach Frankreich gezogen war.«
DI Butler nickt bedächtig. »Verstehe.«
Wieder Stille. Bisher habe ich Butler nie bei der Befragung eines Verdächtigen erlebt, doch sie steht im Ruf, gnadenlos zu sein, und jetzt gerade glaube ich es auch. Ihr Blick ist vollkommen hart, und mir fällt nichts ein, was ich tun könnte, das nicht defensiv oder schuldig wirkt. Mein Puls rast, und ein Muskel in meinem linken Augenwinkel zuckt. Natürlich entgeht es Butler nicht. Sie wird alles sehen und wissen, dass ich lüge.
Sie klappt ihren Notizblock zu und lehnt sich wieder zurück, als wollte sie sagen: Der heftige Teil ist vorbei – jetzt mal inoffiziell. Doch darauf falle ich nicht rein. Meine sämtlichen Muskeln sind angespannt, als kniete ich im Startblock, bereit loszustürmen. Ich denke an Mina auf dem Weg zur Arbeit, und sosehr ich auch wollte, dass sie nicht fliegt, bin ich froh, dass ich ihr erst in fünf Tagen wieder ins Gesicht sehen muss.
»Sie schicken mir noch einen Einzelnachweis der Gespräche«, sagt Butler. »Aber falls es irgendwas gibt, das Sie mir sagen wollen …«
Ich runzle die Stirn, als hätte ich keinen Schimmer, wovon sie redet.
»Denn Ihnen ist sicher bekannt, dass die Diensthandys nicht für Privatgespräche genutzt werden dürfen.«
»Selbstverständlich.«
»Na, dann ist ja gut.«
Ich verstehe den Wink und stehe auf. »Danke«, sage ich, obwohl ich nicht weiß, wofür. Für die Warnung, schätze ich. Für die Chance, meine Verteidigung vorzubereiten, auch wenn nicht mal die besten Anwälte eine Geschichte zusammenspinnen könnten, um mich hier rauszuholen.
Was mit Katya war, ist noch mein kleinstes Problem.
Sobald Butler die Gesprächsnachweise sieht, ist es vorbei.
DREI
10:00 Uhr | MINA
Als ich mich dem Flughafen nähere, verrät mir das Polizeiaufgebot, dass wieder eine Demonstration stattfindet. Die Bauarbeiten für das neue Rollfeld haben vor drei Monaten begonnen, und immer noch kreuzen Protestler nahe den Ankunftsterminals auf, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Größtenteils machen sie keine Schwierigkeiten, und obgleich ich es nie offiziell zugeben würde, stimme ich ihnen zu. Ich finde bloß, dass sie sich das falsche Ziel gesucht haben. Wir haben eine Welt geschaffen, in der wir fliegen müssen – daran ist nichts mehr zu ändern. Wäre es nicht besser, sich die Fabrikemissionen und die gigantischen Abfallmengen vorzunehmen?
Schuldbewusst denke ich an meine täglichen Feuchttücher und beschließe, meine Gesichtswässer wieder auszugraben. Ein Banner ist quer über die Straße gespannt. FELDER STATT FLUGZEUGE. Sie müssen es eben erst aufgehängt haben, denn um den Flughafen herum wimmelt es von Security. Die Polizei kann ihnen das Demonstrieren nicht verbieten, aber sie holen die Banner und Schilder so schnell runter, wie sie angebracht wurden. Es scheint eine ziemlich sinnlose Übung, wenn man bedenkt, dass jeder, der herfährt, entweder am Flughafen arbeitet oder ein Ticket hat, mit dem er irgendwo hinwill. Ein Banner wird die Leute nicht umstimmen.
Vor dem Kreisel werde ich langsamer und blicke nach links, wo eine Frau ein Plakat mit dem Foto eines verhungernden Eisbären in die Höhe hält. Als sie mich bemerkt, schwenkt sie das Plakat in meine Richtung und ruft etwas Unverständliches. Mein Herz rast, und ich strecke die Hand nach der Zentralverriegelung aus. Gleichzeitig rutscht mein Fuß vom Gas, weil ich es so eilig habe wegzukommen. Meine absurde Reaktion – auf eine Frau hinter einer Absperrung, noch dazu! – macht mich wütend auf sie alle. Vielleicht bleibe ich doch bei meinen verdammten Feuchttüchern, nur um die zu ärgern.
Auf dem Parkplatz verriegle ich den Wagen und ziehe meinen kleinen Koffer zum Shuttlebus. Normalerweise gehe ich zu Fuß zum Crewraum, aber das Pflaster ist glitschig von grauem Eis, und was zu Hause frischer Schnee war, ist hier Matsch. Ich kann es kaum erwarten, in Sydney zu landen und Sonnenschein zu sehen; dann werde ich mein Gepäck ins Hotel bringen und an den Strand gehen, um Schlaf nachzuholen.
Im Crewraum herrscht die unruhige Stimmung, die mit heißen Gerüchten oder neuen Dienstplänen einhergeht. Ich stelle mich für einen Kaffee an und umklammere den Plastikbecher mit beiden noch kalten Händen. Eine Frau in Zivil mustert mich.
»Sind Sie auf dem Sydney-Flug?«
»Ja.« Ich spüre, dass ich rot werde, und rechne halb mit Empörung. Sie sollten nicht hier sein …
Aber sie rümpft die Nase. »Lieber Sie als ich.«
Ich suche nach einem Namensschild, finde aber keines. Wer ist diese Frau? Sie könnte irgendwer sein, von einer Putzkraft bis hin zu einer Managerin. Selbst an normalen Tagen laufen Hunderte durch den Crewraum, und dies ist kein normaler Tag. Jeder will ein Teil von Flug 79 sein, Geschichte machen.
»Nach Santiago sind es vierzehn Stunden, und das ist nicht allzu schlimm.« Ich lächle höflich und hole mein Handy hervor, um zu signalisieren, dass wir hier fertig sind, aber sie ignoriert es. Jetzt kommt sie näher, zieht mich zu sich und senkt die Stimme, als könnten wir belauscht werden.
»Ich habe gehört, dass beim letzten Testflug etwas schiefgegangen ist.«
Ich lache. »Was reden Sie denn?«, frage ich lauter und weise jeden noch so kleinen Anflug von Furcht weit von mir.
»Ein Problem mit dem Flugzeug. Es wurde nur totgeschwiegen. Die haben die gesamte Crew gezwungen, eine Verschwiegenheitsverpflichtung zu unterschreiben und …«
»Hören Sie auf!« Ich bin zu neunundneunzig Prozent sicher, dass ich noch nie mit dieser Frau gearbeitet habe. Warum hat sie sich ausgerechnet mich von allen hier rausgepickt? Ich sehe mir ihr Gesicht an und versuche dahinterzukommen, woher sie ist. Personalabteilung vielleicht? Nicht vom Kundendienst, so viel steht schon mal fest – keiner würde je wieder in einen Flieger steigen. »Das ist Blödsinn«, erwidere ich streng. »Glauben Sie allen Ernstes, die würden eine neue Route anbieten, wenn sie sich nicht absolut sicher sind, dass alles stimmt?«
»Mussten sie. Sonst wäre Qantas ihnen zuvorgekommen – die arbeiten schon viel länger daran. Die Testflüge fanden nur mit wenigen Passagieren und ohne Gepäck statt. Wer weiß, was bei einer voll beladenen Maschine passiert …«
»Ich muss los.« Ich werfe meinen halb vollen Kaffeebecher in den Treteimer, und der Deckel kracht scheppernd herunter, als ich meinen Fuß vom Pedal nehme und weggehe. Blöde Kuh – es ist lächerlich, dass ich mich von ihr nervös machen lasse. Trotzdem spüre ich, wie Furcht meinen Brustkorb einengt. Vor zwei Tagen hatte die Times eine Pressemitteilung über den Wettlauf zwischen Qantas und World Airways veröffentlicht, sie allerdings ziemlich verzerrt. Wie schnell ist zu schnell? lautete die Schlagzeile über einem Artikel, der Pfusch und Einsparungen andeutete. Eine Stunde lang musste ich meinem Dad am Telefon versichern, dass ja, alles sicher ist, und, nein, sie würden kein Risiko eingehen.
»Ich könnte es nicht ertragen, wenn …«
»Dad, es ist vollkommen sicher. Alles ist doppelt und dreifach geprüft worden.«
»Ist es immer«, sagte er unheilschwanger, und ich war froh, dass er mein Gesicht nicht sehen konnte. Ich biss nicht an, denn ich wollte nicht darüber nachdenken.
Letztes Jahr hatten sie vierzig Mitarbeiter auf drei Testflüge geschickt, ihren Blutzuckerspiegel, die Sauerstoffsättigung und die Hirnaktivität gemessen. Der Kabinendruck war genau justiert worden, der Lärmpegel gedrosselt, und es gibt sogar spezielle Mahlzeiten, um den Jetlag zu mindern. Dieser Flug ist so sicher wie jeder andere.
»Viel Glück!«, ruft die Frau mir nach, doch ich blicke mich nicht um. Mit Glück hat es nichts zu tun.
Trotzdem ist mein Puls noch immer hoch, als ich wenige Minuten später ins Besprechungszimmer gehe. Es ist gerappelt voll, denn neben der Crew sind hier noch mehrere Anzugträger, von denen ich die meisten nicht erkenne.
»Ist das Dindar?«, frage ich den Steward neben mir, mit dem ich schon einmal geflogen bin. Ich sehe auf sein Namensschild. Erik.
»Ja, das ist Dindar. Er ist zum Jungfernflug hier.«
Logisch. Yusuf Dindar, der CEO der Airline, erscheint ausschließlich an Tagen wie heute, wenn ein großes Ereignis bedeutet, dass Fernsehkameras da sind und es reichlich Lob für die Männer (ja, es sind ausschließlich Männer) hinter World Airways zu ernten gilt. Das Wettrennen um den ersten Nonstop-Flug von London nach Sydney ist knapp gewesen, und in Dindars triumphierender Miene heute Morgen nehme ich einen Hauch von Erleichterung wahr, dass sie es als Erste geschafft haben. Er steht da und wartet, bis sämtliche Blicke auf ihn gerichtet sind.
»Heute machen wir Schlagzeilen!«
Alle applaudieren. Von hinten im Raum sind Jubelrufe zu hören, und Kameralichter blitzen. Inmitten der feierlichen Stimmung wird mir eiskalt.
Etwas ist schiefgegangen … ein Problem mit dem Flugzeug …
Mit einem Kopfschütteln verscheuche ich die Worte der Frau und applaudiere energisch mit den anderen. Wir machen Schlagzeilen. Von London nach Sydney in zwanzig Stunden. Nichts wird schiefgehen. Nichts wird schiefgehen, wiederhole ich wie ein Mantra gegen mein wachsendes Unbehagen.
Ich weiß, warum die Frau mich so verunsichert hat. Weil ich nicht hier sein sollte.
Die Personalabteilung hatte die Namen für die Crew ausgelost, allerdings konnte niemand sich entscheiden, ob wir in der Lotterie gewonnen oder den Kürzeren gezogen hatten. In der WhatsApp-Gruppe flogen die Nachrichten hin und her.
Was gehört?
Noch nicht.
Ich habe gehört, dass die E-Mails raus sind.
Ich will unbedingt dabei sein!!!
Und dann ein Bild: ein Screenshot von Ryans Handy. Glückwunsch! Sie wurden für den Jungfernflug London–Sydney am 17. Dezember ausgelost. Er hatte ein weinendes Emoji angehängt und Zwanzig besch… Stunden!
Ich hatte ihm privat geschrieben und angeboten, seinen Platz zu übernehmen. Warum, erzählte ich ihm nicht, und natürlich versuchte ich, nicht durchblicken zu lassen, wie viel es mir bedeutete. Und er verlangte im Tausch einen Flug nach Mexico City und einen Stapel Geschenkgutscheine, die ich zum Geburtstag bekommen hatte. Verrücktes Huhn!, folgerte er, und ich musste ihm zustimmen.
So kam es, dass ich jetzt hier bin. Die Frau, die sich den wichtigsten Flug in der jüngsten Geschichte erschlichen hat.
»Ich möchte die Piloten für diesen historischen Flug vorstellen«, sagt Dindar. Er winkt sie zu sich nach vorn. Es gibt ein wenig Unruhe, als alle Platz für sie machen. »Captain Louis Joubert und Co-Pilot Ben Knox; Captain Mike Carrivick und Co-Pilotin Francesca Wright.«
»Carrivick?«, frage ich Erik, als alle klatschen. »Der steht nicht auf der Crewliste, die ich bekommen habe.«
Erik zuckt mit den Schultern. »Wurde in letzter Minute eingewechselt. Ich kenne ihn nicht.«
Dindar redet weiter. »Es sind einige geladene Gäste an Bord.« Mit »geladen« meint er, dass sie nichts für den Flug bezahlen. Journalisten, einige Prominente und »Influencer«, die sechzehn Stunden des Flugs auf Instagram posten und die übrigen vier trinken werden. »Aber ich bitte Sie dringend, sie nicht anders zu behandeln als die zahlenden Kunden.«
Ja, klar. Die Journalisten mögen zum Spaß hier sein – geschenkter Businessclass-Flug nach Australien? Hier ist mein Pass! –, aber sie sind auch auf eine Story aus. Nach dem Motto »Daily Mail trifft auf TripAdvisor. Langstreckenflug und keine hypoallergenen Kissen – unfassbar!«
Sobald Dindar und die Anzugträger sich genug gratuliert haben, halten wir unser Briefing ab. Mike und Cesca übernehmen den Start und die ersten vier Stunden, dann machen sie Pause in den Schlafkabinen über dem Kabinendeck. Louis und Ben fliegen die nächsten sechs Stunden, bevor die Crew wieder wechselt. Was die Kabinencrew angeht, sind wir sechzehn Leute, aufgeteilt in zwei Schichten. Wenn wir nicht arbeiten, sind wir im Ruhebereich hinten in der Maschine und tun so, als wäre es normal, in einem fensterlosen Raum voller Fremder zu schlafen.
Eine Arbeitsmedizinerin kommt, um über die Gefahren der Übermüdung zu reden. Sie erinnert uns daran, genug zu trinken, und macht eine Atemübung vor, die uns helfen soll, in den Pausen möglichst viel Schlaf zu bekommen. Einige Leute lachen, und ein Steward gibt vor einzuschlafen.
»Verzeihung«, sagt er und schreckt mit einem Grinsen hoch. »Ich glaube, es funktioniert!«
Als wir paarweise hinter den Piloten her durch den Flughafen gehen, herrscht eine fiebrige Vorfreude, und ich empfinde einen kribbelnden Stolz, wie immer vor einem Flug. Unsere Uniform ist dunkelblau mit smaragdgrünen Akzenten an den Manschetten, den Säumen und den Revers. Auf der linken Brust tragen wir eine emaillierte Anstecknadel mit dem World-Airways-Logo, auf der rechten die mit unserem Vornamen. Unsere smaragdgrünen Halstücher stellen ausgebreitet eine Weltkarte dar. Nur heute tragen wir noch einen neuen Anstecker: Flug 79. Wir machen die Welt zu einem kleineren Ort.
Ein interner Fotograf knipst uns aus allen Winkeln, und ein Geraune von London–Sydney folgt uns zum Gate.
»Als wäre man auf dem roten Teppich!«, sagt jemand von der Crew.
Als würde man aufs Schafott gehen, denke ich. Ich werde dieses Gefühl nicht los – ein einziger fauler Apfel in einer Kiste voller guter –, dass etwas Schreckliches passieren wird.
Manche Menschen haben es bei jedem Flug, nehme ich an: diese Angst ganz tief im Bauch. Ich fand immer, dass es furchtbar sein muss, diese wundervollen Stunden in der Luft damit zu verbringen, dass man sich an die Armlehnen klammert, die Augen fest zukneift und sich Katastrophen ausmalt, zu denen es nicht kommt.
Ich nicht. Mir bedeutet Fliegen alles. Ein Triumph der Ingenieurskunst, nicht gegen die Natur, sondern mit ihr. Adam lacht, wenn ich über Flugzeuge doziere, aber was gibt es Schöneres als ein abhebender A320? Als Kind hatte ich gestöhnt, wenn Dad mich mit zum Flughafen schleppte, wo er am Grenzzaun stand und die Maschinen fotografierte. Ihm ging es um die Fotografie – er verbrachte genauso viele Stunden am Fluss, um das perfekte Bild von einem fliegenden Reiher zu bekommen –, doch ich fand es nach und nach immer spannender.
»Ich habe eine tolle Aufnahme von der 777.« Dann zeigte Dad mir das Display seiner Digitalkamera.
»Das war keine 777«, sagte ich. »Es war eine 747.«
Ich zeichnete für mein Leben gern und skizzierte die Nasenformen in meinem Notizbuch. Vor allem beschwerte ich mich nicht mehr, wenn Dad vorschlug, dass wir den Samstag am Flughafen verbringen. Wenn wir auf Besuch zu Verwandten flogen, interessierten mich weder die Filme an Bord noch die folienverpackten Mahlzeiten. Ich presste die Nase ans Fenster und beobachtete, wie sich das Querruder auf und ab bewegte, fühlte die sanften Reaktionen der Maschine. Ich habe es geliebt!
Deshalb ist dieses Flattern im Bauch, dieses unheimliche Gefühl von Angst beim An-Bord-Gehen, beunruhigend. Die Cockpittür steht offen, und alle vier Piloten drängen sich drinnen, um den Flug vorzubereiten. Mich überkommt ein kalter Schauer.
Erik bemerkt es. »Ist dir kalt? Das liegt an der Klimaanlage. Die stellen sie immer zu niedrig ein.«
»Nein, alles okay. War nur ein kalter Schauer.« Wieder fröstle ich und mache mich rasch an die Arbeit. Wie schon viele Male zuvor überprüfe ich die Kabinenausstattung, doch heute fühlt es sich anders an. Druck. Dichtungen. Sauerstoffzufuhr. Feuerlöscher. Sauerstoffmasken, Notfallsets … alles wichtig. Bei allem geht es um Leben oder Tod.
»Reiß dich zusammen, Holbrook«, murmle ich und bringe einen Karton Tonic Water von der Businessclass-Kabine zur Lounge, um beim Aufstocken der Bar zu helfen. Die Maschine ist maßgeschneidert, angeblich eigens designt, um den Komfort für Passagiere auf solch einer langen Strecke zu verbessern. Vorn ist eine Bordküche zwischen Cockpit und Kabine, dazu zwei Bäder und die Treppe zu den Ruheliegen – hinter einer Tür versteckt. Dann kommt die Businessclass, gefolgt von einer Privatlounge und einer Bar, die durch einen Vorhang vom Rest der Maschine abgetrennt ist, und zwei weitere Toiletten. Die Economyclass ist in zwei Hälften mit einer »Streckzone« dazwischen geteilt, und hinten sind noch Economy-Toiletten. Dreihundertdreiundfünfzig Passagiere insgesamt: Alle atmen dieselbe Luft von dem Moment an, in dem sich die Türen in London schließen, bis sie in Sydney wieder aufgehen.
Als Erstes kommen die Business-Passagiere an Bord, die bereits zur Bar und den Liegesesseln spähen, als wir die Tickets überprüfen und Mäntel annehmen, um sie in den Schrank bei der Bordküche zu hängen. Es sind zu viele Crewmitglieder an Bord, alle sechzehn in der Kabine, um die Passagiere zu begrüßen. Die Hälfte von ihnen verschwindet nach dem Start im Ruheraum, sodass nur noch Erik, Carmel und ich in der Businessclass bleiben, Hassan in der Bar und vier in der Economy. Doch jetzt, da alle unten sind, herrscht eine unterschwellige Atmosphäre von Wahnsinn in der Kabine. Zwanzig Stunden. Wo sonst verbringt man so viele Stunden eingesperrt mit Wildfremden? Im Gefängnis, schätze ich, und der Gedanke ist mir unheimlich.
In der Businessclass wird Champagner angeboten. Ich sehe einen Mann seinen herunterkippen, als handelte es sich um einen Kurzen, bevor er Carmel zuzwinkert, ihm nachzuschenken.
Zwanzig Stunden.
Die Problemfälle erkennt man sofort. Es ist etwas in ihrem Blick und in ihrem Verhalten, dieses Ich bin besser als du und werde dir das Leben schwer machen. Das sind allerdings nicht immer die Trinker (auch wenn Gratis-Champagner keine Hilfe ist), und bei diesem Typen fange ich keine miesen Schwingungen auf. Abwarten.
»Meine Damen und Herren, willkommen an Bord von Flug 79 von London nach Sydney.« Als dienstältestes Crewmitglied kommt mir die zweifelhafte Ehre zu, unsere Passagiere zu begrüßen. In meinem Skript ist nichts, was diesen Tag als besonders ausweist, trotzdem hebt Jubel an. »Bitte achten Sie darauf, dass alle Mobiltelefone und tragbaren elektronischen Geräte für den Start verstaut sind.«
Ich gehe in die Kabine und bemerke eine große Tasche zu Füßen einer Frau mit grau meliertem Haar und einem grünen Pullover.
»Darf ich die Tasche für Sie ins Gepäckfach oben legen?«
»Die brauche ich.«
»Wenn sie nicht oben ins Fach passt, muss ich sie vorn in den Schrank schließen, tut mir leid.«
Die Frau hebt ihre Tasche hoch und hält sie fest vor der Brust, als fürchte sie, ich könnte sie ihr entreißen. »Da sind all meine Sachen drin!«
Ich versuche, nicht zu seufzen. »Tut mir leid, aber hier kann sie nicht bleiben.«
Für einen Moment sehen wir uns an, jede entschlossen zu gewinnen. Dann gibt sie ein frustriertes Tza! von sich und fängt an, die Tasche auszupacken und Pullis, Bücher und Kosmetiktaschen auf die diversen Fächer um ihren Sitz herum zu verteilen. Ich nehme mir vor, ihren Platz nach der Landung gründlich zu überprüfen, falls sie irgendwas vergisst. Als sie fertig ist, entspannt sich ihre grimmige Miene. Sie blickt aus dem Fenster und trinkt ihren Champagner.
Auf die Pilotenansage hin – Cabin crew, prepare doors for departure and cross check – steigt die allgemeine Spannung. Die meisten Business-Passagiere haben schon in ihre Willkommensbeutel gesehen, und eine Frau hat sich sogar schon ihren »Flug 79«-Pyjama angezogen, sehr zur Belustigung der Mitreisenden. Es wird eine Videobotschaft von Dindar gezeigt, und danach kommen die Sicherheitshinweise, die alle ignorieren, weil sie noch nie gehört haben, dass irgendwer die brauchte. Carmel und ich sammeln die leeren Gläser ein.
»Immer mit der Ruhe, Schätzchen, da ist noch was drin.« Eine Frau mit blitzenden Augen grinst mir zu und nimmt ihr Glas von meinem Tablett zurück, um den allerletzten Schluck Champagner zu trinken. Ich erinnere mich von der Boardingliste an ihren Namen – eine Handvoll haben sich mir eingeprägt. Bis der Flug endet, werde ich die Namen aller sechsundfünfzig Passagiere in der Businessclass kennen.
»Haben Sie alles, was Sie brauchen, Lady Barrow?«
»Patricia, bitte. Na ja, eigentlich Pat. Schlicht die alte Pat.« Sie hat ein freches Lächeln – wie eine Großmutter, die den Kindern heimlich Schokolade zusteckt. »Der Titel ist ein alberner Jux von meinen Kindern.«
»Dann sind Sie keine Lady?«
»Oh, doch, bin ich. Ich herrsche über ganze zehn Quadratmeter schottischen Boden«, sagt sie überheblich und fängt an zu lachen, was ansteckend ist.
»Haben Sie Verwandte in Sydney?«
Ein Schatten huscht über ihr Gesicht – eine flüchtige Dunkelheit, die sie gleich wieder verbirgt, indem sie das Kinn reckt und erneut grinst. »Nein, ich bin ausgerissen.« Sie lacht über meinen verdutzten Gesichtsausdruck und seufzt. »Genau genommen sind sie sehr böse mit mir. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Richtige tue. Ich vermisse meine Hunde jetzt schon ganz schrecklich. Aber es ist das erste Jahr ohne meinen Mann, und …« Sie verstummt abrupt und atmet tief durch. »Tja, ich brauchte eine Veränderung.« Sie legt eine manikürte Hand auf meinen Arm. »Das Leben ist kurz, junge Frau. Vergeuden Sie es nicht.«
»Werde ich nicht.« Ich lächle, doch ihre Worte hallen in meinen Ohren, als ich weiter durch den Gang gehe. Das Leben ist kurz. Zu kurz. Sophia ist schon fünf, und die Tage rauschen dahin.
Ich erzähle allen, dass ich wieder arbeite, weil wir das Geld brauchen und weil Sophias Sozialarbeiterin gedacht hat, es würde ihr bei ihren Bindungsproblemen helfen. Beides ist wahr.
»Aber die hat sie doch, weil sie vernachlässigt wurde, oder?«, fragte Adam, als wir es besprachen. »Weil sich in ihren ersten Lebensmonaten quasi keiner um sie gekümmert hat.« Die Sozialarbeiterin nickte, aber Adam fuhr bereits fort und sprach seine Gedanken laut aus. »Wie soll es ihr da helfen, wenn Mina weggeht?«
Ich erinnere mich an die Angst, die ich bekam, mir könnte das kleine bisschen Freiheit genommen werden, das ich für mich sah.
»Weil Sophia lernen wird, dass Mina immer zurückkommt«, antwortete die Sozialarbeiterin. »Das ist der entscheidende Punkt.«
Also habe ich wieder angefangen zu arbeiten, und wir waren alle glücklicher. Adam, weil er sich keine Sorgen mehr ums Geld machen musste; Sophia begann zu verstehen, dass ich immer zu ihr zurückkam; ich, weil es hart war, Sophias Mutter zu sein – richtig hart –, und ich mal rausmusste. Ich brauchte eine Pause. Vor allem musste ich sie vermissen, um mich daran zu erinnern, wie sehr ich sie liebe.
Nachdem alles überprüft ist, warte ich auf die Ansage aus dem Cockpit – Cabin crew, take your seats for departure – und nehme auf dem Notsitz direkt am Fenster Platz. Die Motoren werden laut, dann fliegt der Asphalt immer schneller unter uns hinweg. Druck baut sich auf, bis man nicht mehr unterscheiden kann, ob man ihn hört oder fühlt. Mit einem winzigen Ruck verlässt das Fahrwerk den Boden. Ich stelle mir den Raum unter uns vor, wie die Nase der Maschine nach oben weist, als wir von der Startbahn abheben. Unglaublich schwer und unglaublich klobig für solch ein anmutiges, wunderschönes Manöver. Und dennoch funktioniert es irgendwie, und wir steigen auf, während die Piloten das Tempo erhöhen und wir immer höher fliegen. Der Himmel hat sich verdunkelt, denn Regenwolken hängen tief über dem Boden, sodass es eher wie Dämmerung als Mittag wirkt; Regen klatscht gegen die Fenster, bis wir zu hoch sind, als dass er uns noch erreicht.
Das »Pling« ertönt in zehntausend Fuß Höhe und hat den gleichen Effekt wie Pawlows Glocke. Überall bricht rege Betriebsamkeit aus. In 5J reckt eine zierliche Blondine den Hals, um nach unten zu sehen. Sie ist angespannt, und ich vermute, dass sie ein ängstlicher Fluggast ist. Dann jedoch schließt sie die Augen und lehnt sich mit einem versonnenen Lächeln zurück.
Wir sind unterwegs. Die Gurte sind gelöst, einige Passagiere sind aufgestanden, und schon wird nach Drinks geläutet. Jetzt ist es zu spät. Zu spät, noch irgendwas gegen die Stimme in meinem Kopf zu tun, die mich vor diesem Flug warnt. Es ist nur mein Gewissen, weiter nichts. Es sind meine Schuldgefühle, weil ich mir diesen Platz besorgt habe, anstatt zu Hause bei Sophia zu bleiben. Weil ich überhaupt hier bin, wo das Leben doch so anders hätte sein können.
Zu spät oder nicht, die Stimme bleibt.
Zwanzig Stunden. In zwanzig Stunden kann eine Menge passieren, sagt sie.
VIER
PASSAGIERIN5J
Mein Name ist Sandra Daniels, und als ich an Bord von Flug 79 ging, habe ich mein altes Leben hinter mir gelassen.
Wahrscheinlich wäre mir nicht mal eingefallen, in den Flieger zu steigen, wenn mein Mann nicht wäre. Es heißt, dass Opfer häuslicher Gewalt im Schnitt sechsmal gehen, bevor sie es endlich richtig schaffen. Ich bin nur einmal gegangen. Manchmal überlege ich, wie sich das auf den Durchschnitt auswirkt. Ich denke an die Frauen, die es achtmal versucht haben. Zehnmal. Zwanzigmal.
Ich bin einmal gegangen, ein einziges Mal, weil ich wusste, wenn ich es nicht richtig mache, findet er mich. Und wenn er mich findet, bringt er mich um.
Es heißt, dass Opfer im Schnitt fünfunddreißig Mal angegriffen werden, bevor sie die Polizei rufen. Ich frage mich, wie es sein muss, nur fünfunddreißig Mal geschlagen worden zu sein. Nicht, dass ich mitgezählt hätte (für Mathe war ich sowieso immer zu blöd), doch selbst ich weiß, dass zwei- bis dreimal pro Woche über vier Jahre hinweg viel mehr als fünfunddreißig ergibt. Obwohl sie vielleicht nur die heftigen Sachen meinen – gebrochene Knochen oder Schläge an den Kopf, nach denen man lauter verschwommene schwarze Sterne sieht. Nicht die Klapse, das Kneifen. Wahrscheinlich zählen die nicht. Typisch ich: übertreibe mal wieder.
Es war nicht ganz allein Henrys Schuld. Ich meine, mir ist klar, dass es falsch ist, jemanden zu schlagen – natürlich ist es das –, aber er hatte seinen Job verloren, und so was setzt einem Mann zu, nicht? Vom Einkommen seiner Frau abhängig zu sein; derjenige zu sein, von dem erwartet wird, dass er Essen kocht, das Klo putzt und auf den Handwerker für den Geschirrspüler wartet.





























