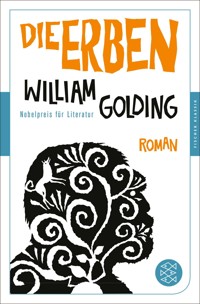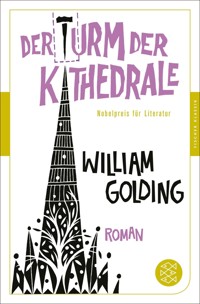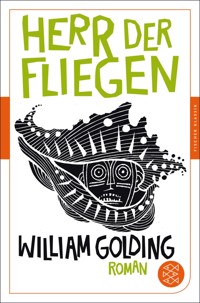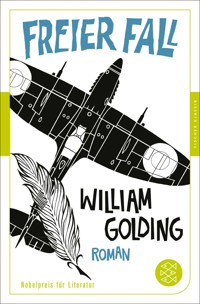
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Woher kommen wir? Wie frei sind wir? Sammy Mountjoy, ein bekannter Künstler, gerät im Zweiten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft und erinnert sich an sein Leben. An die Kindheit in einem Slum. An die erste, unglückliche Liebe. An das Leben als Künstler ... Schonungslos und erzählerisch brillant stellt sich Literaturnobelpreisträger William Golding der Frage, wie frei wir eigentlich sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
William Golding
Freier Fall
Roman
Biografie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1959 unter dem Titel »Free Fall« bei Faber & Faber Limited, London
© 1959 by William Golding
Für diese Ausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: kreuzerdesign|München Rosemarie Kreuzer
Coverabbildung: Neil Gower
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491378-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
1
Ich bin auf dem Marktplatz an Buden vorbeigekommen, wo Bücher, mit Eselsohren und verblichenen Einbänden, sich in einem weißen Lobgesang geöffnet hatten. Ich habe Leute gekannt, gekrönt mit einer doppelten Krone, die hielten in der einen Hand den Krummstab, in der anderen den Dreschflegel, die Macht und die Herrlichkeit. Ich habe begriffen, wie aus der Wunde ein Wunder wird, ich habe den Feuerfunken gespürt, wie er fiel, des Wunders voll und des heiligen Geistes. Meine jüngsten Vergangenheiten wandern mit. Sie halten Schritt, graue Gesichter, die mir über die Schulter spähen. Ich wohne auf dem Paradies-Hügel, zehn Minuten vom Bahnhof, dreißig Sekunden von den Kaufläden und der Kneipe. Und doch bin ich ein blutiger Laie, hin und her gerissen vom Irrationalen und Zusammenhanglosen, auf leidenschaftlicher Suche und von mir selbst verurteilt.
Wann verlor ich meine Freiheit? Denn es gab eine Zeit, da war ich frei. Ich hatte Macht, wählen zu können. Ursache und Wirkung funktionieren zwar nach statistischer Wahrscheinlichkeit, aber manchmal bewegen wir uns doch gewiss diesseits oder jenseits dieser Schwelle. Über Willensfreiheit kann man nicht streiten, man kann sie nur erleben, wie eine Farbe oder den Geschmack von Kartoffeln. Ich erinnere mich eines solchen Erlebnisses. Ich war noch sehr klein und ich saß auf dem steinernen Rand des Wasserbeckens mit dem Springbrunnen in der Mitte des Parks. Die Sonne schien hell, an den Hängen wuchsen rote und blaue Blumen, der Rasen war grün. Es gab keine Schuld, es gab nur das Plätschern und Spritzen des Springbrunnens in der Mitte. Ich hatte gebadet und getrunken, und nun saß ich auf dem warmen Steinrand und überlegte in Muße, was ich jetzt tun sollte. Diese kiesbestreuten Wege des Parks umgaben mich sternförmig: und ganz plötzlich wurde mir eine neue Erkenntnis zuteil. Ich konnte irgendeinen dieser Wege wählen, welchen ich wollte. Es gab nichts, was mich zu dem einen mehr verlockt hätte als zu dem anderen. Ich tanzte den einen entlang und freute mich an dem Kartoffelgeschmack. Ich war frei. Ich hatte gewählt.
Wie habe ich meine Freiheit verloren? Ich muss zurückgreifen und die ganze Geschichte erzählen. Es ist eine merkwürdige Geschichte, nicht so sehr was die äußeren Ereignisse betrifft – die sind gewöhnlich genug –, sondern in der Art, wie sie sich mir darstellen, der ich allein sie erzählen kann. Denn man kann die Zeit nicht hinlegen wie eine endlose Reihe Ziegelsteine. Mit der geraden Linie vom ersten Schluckauf bis zum letzten Seufzer ist nicht viel anzufangen. Zeit: man kann sie auf zweierlei Weise betrachten. Bei der einen nimmt man sie mühelos, so natürlich wie der Hering das Wasser, in dem er lebt. Bei der anderen erinnert man sich mit einem Gefühl für Faltungen und Windungen, wie der eine Tag einem näher liegt als der andere, weil er wichtiger ist; wie das eine Ereignis ein anderes spiegelt, oder wie alle drei Dinge, für sich genommen, Ausnahmen sind, die sich mit der geraden Linie durchaus nicht decken. Ich fange meine Geschichte mit jenem Tag im Park an, nicht weil ich so jung war, beinahe noch ein Baby, sondern weil Freiheit mir mehr und mehr zur Kostbarkeit geworden ist, so, wie ich auch den Kartoffelgeschmack immer seltener verspüre.
Ich habe alle Systeme an die Wand gehängt wie eine Reihe nutzloser Hüte. Sie passen eben nicht. Sie kommen von außerhalb, es sind Muster, die man mir anbietet, manche unansehnlich und manche von großer Schönheit. Aber ich habe genug von meinem Leben hinter mich gebracht, um ein System zu fordern, das zu allem passt, was ich kenne; und wo soll ich das finden? Und warum schreibe ich dies hier nieder? Ist es überhaupt ein System, nach dem ich suche? Dieser marxistische Hut in der Mitte der Reihe: hab ich jemals geglaubt, ich würde ihn ein ganzes Leben lang tragen? Was stimmt nicht an dem christlichen Barett, das ich kaum getragen habe? Nicks rationalistischer Hut hielt den Regen ab, er schien so wasserdicht wie ein Plattenharnisch, langweilig und anständig. Jetzt sieht er so klein aus und ziemlich albern, eine Melone wie andere Melonen auch, sehr steif, sehr vollständig, sehr unwissend. Da hängt ja auch eine Schülermütze. Ich habe sie einfach dahin gehängt, denn ich wusste noch nichts von den anderen Hüten, die ich zu ihr hängen würde, als ich glaubte, dass das Entscheidende geschah – die Entscheidung aus freiem Willen, die mich um meine Freiheit brachte.
Was soll ich mich überhaupt um Hüte kümmern? Ich bin ein Künstler. Ich kann tragen, was mir Spaß macht. Sie haben doch schon von mir gehört, von mir, Samuel Mountjoy. Ich hänge in der Tate-Galerie. Sie würden mir jeden Hut erlauben. Ich könnte auch ein Kannibale sein. Aber ich möchte als Privatmensch einen Hut tragen. Ich möchte verstehen. Die grauen Gesichter gucken mir über die Schulter. Nichts kann sie wegwischen oder verbannen. Meine Kunst, das ist nicht genug für mich. Zum Teufel mit meiner Kunst. Die Macht des Impulses holt mich aus einem tiefen Brunnen, nicht anders als der Zwang des Geschlechts, und andere Leute mögen meine Bilder mehr als ich, sie halten sie für bedeutender als ich. Im Grunde bin ich ein langweiliger Tropf. Ich würde lieber gut sein als klug.
Warum also schreibe ich dies hier nieder? Warum spaziere ich nicht um den Rasenplatz herum, immer rundum, meine Erinnerungen ordnend, bis sie einen Sinn ergeben, indem ich das wirre Gewebe der Zeit aufdrösele und wieder knüpfe? Ich könnte ja dieses und jenes Ereignis zusammenbringen, ich könnte Sprünge machen. Ich müsste für die Kurve des Rasenplatzes eine Formel finden und am nächsten Tag eine andere. Aber immer nur um den Rasen herum denken, das reicht nicht mehr aus. Das, um nur eins zu erwähnen, ist wie das Rechteck der Leinwand, eine begrenzte Fläche, wie erfinderisch man sie auch bemalt. Der Kopf kann mehr als das nicht fassen; Verstehen aber setzt einen Schwung voraus, der die ganze im Gedächtnis bewahrte Zeit umfasst und dann innehalten kann. Vielleicht kann ich, wenn ich meine Geschichte so, wie sie mir erscheint, niederschreibe, zurückgreifen und auswählen. Leben ist gleichsam nichts, weil es alles ist – es ist zu verwickelt und reichhaltig für ein Denken, das keine Unterstützung erfährt. Malen ist eine Verhaltensweise, etwas Erlesenes.
Es gibt noch einen anderen Grund. Wir sind stumm und blind, und doch müssen wir sehen und sprechen. Nicht das unrasierte Gesicht des Sammy Mountjoy, die vollen Lippen, die sich öffnen, damit seine Hand eine Zigarette herausnimmt, nicht die glatten, feuchten Muskeln innerhalb der runden Zahnreihen, nicht die Luftröhre, die Lungen, das Herz – das alles könnte man ansehen und anrühren, wenn man ihm ein Messer auf den Tisch legte. Die namenlose, unergründliche und unsichtbare Dunkelheit ist’s, die ihm in der Mitte sitzt, immer wach, immer etwas anderes als das, wofür man es hält, das denkt und fühlt, das hoffnungslos hofft zu verstehen und verstanden zu werden. Wenn wir einsam sind, so ist das nicht die Einsamkeit der Zelle oder des Ausgestoßenen; es ist die Einsamkeit jenes dunklen Etwas, das wie ein Atommeiler durch Reflektion sieht, mittels Fernsteuerung empfindet und nur Worte vernimmt, die ihm in einer fremden Sprache zugeleitet werden. Denn uns mitzuteilen, das ist unsere Leidenschaft und unsere Verzweiflung.
Wem eigentlich?
Ihnen?
Meine Dunkelheit tastet umher und greift mit ihren Zangen nach der Schreibmaschine. Ihre Dunkelheit streckt die Zangen aus und kriegt ein Buch zu fassen. Zwischen uns gibt es zwanzig Möglichkeiten des Austausches, des Filterns und Übertragens. Was wäre das für ein außergewöhnliches Zusammentreffen, wenn genau die Beschaffenheit, die durchsichtige Anmut ihrer Wange, die sehr lebendige Linie, die Rundung ihrer Stirn zwischen der Augenbraue und dem Haaransatz jenen Austausch überständen! Wie können Sie an meinem Schrecken in der verdunkelten Zelle teilhaben, wenn ich mich bloß seiner erinnern kann, ohne erneut von ihm ergriffen zu werden? Nein. Nicht mit Ihnen. Oder nur zum Teil mit Ihnen. Denn Sie waren nicht dabei.
Und wer sind Sie überhaupt? Sind Sie innen drin, haben Sie ein Korrektur-Exemplar? Bin ich eine Aufgabe, die man leisten soll? Treibe ich Sie zur Verzweiflung, indem ich Unzusammenhängendes in Unzusammenhängendes übersetze? Vielleicht haben Sie dieses Buch vor fünfzig Jahren auf einem Bücherkarren gefunden, und jetzt ist’s ein anderes. Das Licht eines Sterns erreicht uns erst in Millionen von Jahren, nachdem er erloschen ist, so sagt man wenigstens, und vielleicht ist es wahr. Was ist das schon für ein Weltall, worin unsere zentrale Dunkelheit ihr Gleichgewicht bewahren soll?
Es gibt noch diese Hoffnung: wenigstens bis zu einem gewissen Grade kann ich mich noch mitteilen, und das ist gewiss besser, als völlig blind und taub zu sein; und vielleicht finde ich so etwas wie einen Hut, den ich wirklich tragen kann. Nicht, dass ich einen vollkommenen Zusammenhang anstrebte. Unser Irrtum besteht darin, dass wir unsere Beschränkungen mit den Grenzen des Möglichen überhaupt verwechseln und das Universum mit einem rationalistischen Hut oder irgend einem anderen zudecken wollen. Aber vielleicht finde ich die Andeutungen eines Systems, das mich mit einschließt, mag es sich auch an den Rändern in Unwissenheit verlieren. Was Mitteilsamkeit betrifft, so sagt man ja: alles verstehen, heißt alles verzeihen. Trotzdem, wie kann jemand eine Beleidigung verzeihen, wenn er nicht beleidigt ist? Und was macht man, wenn die Verbindungslinien zu gerade diesem Anschluss tot sind?
Für manche meiner Bilder übernehme ich keine Verantwortung. Ich kann mich zwar darauf besinnen, wie ich war, als ich noch ein Kind war. Aber selbst wenn ich damals einen Mord begangen hätte, würde ich mich nicht mehr dafür verantwortlich fühlen. Auch hier gibt es eine Schwelle, jenseits derer das, was wir getan haben, von jemand anderem getan wurde. Und doch gab es mich. Vielleicht muss ich, um zu verstehen, auch auf die Bilder jener frühen Tage zurückkommen. Vielleicht, wenn ich meine Geschichte noch einmal durchlese, werde ich die Verbindung sehen zwischen dem kleinen Jungen, der so klar war wie Quellwasser, und dem Mann, der wie ein fauler Tümpel ist. Irgendwie wurde ja aus dem einen der andere.
Meinen Vater hab ich gar nicht gekannt und ich glaube, meine Mutter kannte ihn ebenso wenig. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich neige dazu anzunehmen, dass sie gar nicht wusste, wer er war – gesellschaftlich jedenfalls, wenn wir dem Wort nicht jeden brauchbaren Sinn nehmen wollen. Die Hälfte meiner unmittelbaren Vorfahren ist so unerkennbar, dass ich es selten der Mühe wert finde, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Ich existiere eben. Diese nikotingelben Finger über der Schreibmaschine, dieses Gewicht im Stuhl versichern mir, dass zwei Menschen zusammenkamen, und einer davon war Mama. Was würde der andere von mir denken? – möchte ich wissen. Welcher Feier Andenken bin ich wohl? Im Jahre 1917 gab es Siege und Niederlagen, es gab eine Revolution. Wenn man es bedenkt, was spielt es dann für eine Rolle, ob ein kleiner Bastard mehr oder weniger zur Welt kam? War dieser Andere ein Soldat, der später in Stücke gerissen wurde, oder lebt er noch und geht umher, entwickelt sich, vergisst? Er könnte eigentlich recht stolz auf mich sein und meinen zunehmenden Ruhm, wenn er’s wüsste. Vielleicht bin ich ihm sogar einmal begegnet, von Angesicht zu Angesicht, unerkennbar. Es gäbe kein Erkennen. Ich würde so wenig von ihm wissen wie der Wind, der in die Blätter eines Buchs auf einer Mauer im Obstgarten fährt, der unwissende Wind, der die Reihen schwarzer Zeilen ebenso wenig zu entziffern vermag, wie Fremde aus den Gesichtern von Fremden klug werden können.
Doch ich wurde nun einmal aufgezogen. Ich ticke. Ich existiere. Ich rage achtzehn Zoll über den schwarzen Zeilen, die Sie lesen, ich nehme Ihre Stelle ein, ich bin in einem Knochenbehälter eingeschlossen und versuche, mich auf dem weißen Papier zu befestigen. Die Zeilen bringen uns zusammen, und doch, bei aller Leidenschaft, haben wir nichts gemeinsam als das Gefühl, voneinander getrennt zu sein. Warum denke ich also an meinen Vater? Kommt es auf ihn an?
Aber Mama war anders. Sie hatte irgendein Geheimnis, das vielleicht den Kühen bekannt war, oder der Katze auf dem Bettvorleger, irgendeine Eigenschaft, die sie unabhängig machte von allem Verstehen. Kontakt zu haben, das genügte ihr. Das war ihr Leben. Mein Erfolg hätte ihr keinen Eindruck gemacht. Er hätte sie kalt gelassen. In meinem privaten Porträtalbum erscheint sie so in sich geschlossen und endgültig wie ein Schlusspunkt.
In gewissen Augenblicken, wenn es mir gerade einfiel, fragte ich sie nach meinem Papa, ohne besonders neugierig zu sein. Wenn ich darauf bestanden hätte, es zu erfahren, hätte sie vielleicht genaue Auskunft gegeben – aber wozu wäre das nötig gewesen? Der Lebensraum um ihre Schürze herum genügte mir ja vollauf. Es gab Jungen, die ihren Vater kannten, so wie es Jungen gab, die gewöhnt waren, Schuhe zu tragen. Es gab glänzendes Spielzeug, Autos, es gab Lokale, wo die Leute mit Anstand speisten; aber das waren nur Bilder an der Wand, das alles spielte sich draußen ab, so unerreichbar wie der Mars. Ein richtiger Vater wäre eine undenkbare Zugabe gewesen. Also erkundigte ich mich nach ihm am Abend, ehe die ›Sonne‹ aufmachte, oder noch viel später am Abend, wenn sie wieder schloss und Mama müde und abgespannt war. Ich hätte sie ebenso beiläufig darum bitten können, mir ein Märchen zu erzählen, und es ebenso wenig geglaubt.
»Was war mein Papi, Mama?«
Aus unser beider Gleichgültigkeit gegenüber bloßen physischen Tatsachen ergaben sich Antworten, die wechselten, wie Mamas Wachträume wechselten. Diese waren von der ›Sonne‹ beeinflusst und den flimmernden Bildern im Regal-Kino. Ich wusste, dass das Wachträume waren, und nahm sie als solche, weil ich selber mich mit Wachträumen beschäftigte. Nur die pedantischste Wahrheitsliebe hätte sie als Lügen verdammen können, wenn auch Mamas rudimentäres Moralempfinden ihr ein- oder zweimal Anlass gab, sie beinahe sofort abzuleugnen. Dementsprechend war mein Vater manchmal ein Soldat, er war ein hübscher Mann, ein Offizier; allerdings hatte Mama zu der Zeit, als sie mich empfing, das Stadium schon hinter sich, da sie von Offizieren und feinen Herren besucht wurde. Eines Abends, als sie vom Regal zurückkam, wo sie Bilder von Schlachtschiffen gesehen hatte, die vor der amerikanischen Küste mit Bomben belegt wurden, da war er in der Royal Air Force. Und was war es dann für eine Feierlichkeit – noch später in unserem gemeinsamen Leben? Was waren das für prunkvolle Pferde, gefiederte Helme und brüllende Menschenmengen? Später war es kein Geringerer als der Prinz von Wales.
Das war für mich eine so gewaltige Neuigkeit – die ich natürlich nicht glaubte –, dass die rote Glut hinter dem Gitter auf meiner Netzhaut haften blieb wie ein Nachbild. Wir glaubten beide nicht daran, aber die glitzernde Sage lag mitten auf dem schmutzigen Fußboden, und ich war dankbar dafür, weil sie die zaghaften Bemühungen meiner eigenen Phantasie weit überstieg. Aber fast schon, ehe sie die Sache so hinwarf, war Mama bereit, sie wieder an sich zu nehmen. Das Märchen war allzu enorm oder der Wachtraum zu intim-persönlich, um von einem anderen geteilt zu werden. Ich sah, wie ihre Augen im Schein der Kaminglut unsicher wurden, wie die schwache Pergamentfarbe ihres beleuchteten Gesichts sich änderte. Sie schnüffelte, kratzte sich die Nase, weinte ein bisschen, ein paar leichte Gin-Tränen, und sprach in den Kamin, wo eigentlich mehr Feuer hätte sein können: »Du weißt doch, dass ich was Blödes zusammenlüge, nicht wahr, mein Lieber?«
Ja, das wusste ich, ohne sie deswegen zu verurteilen, aber ich war trotzdem enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, als sei Weihnachten vorbei und es gäbe kein Flittergold mehr. Ich sah ein, dass es an der Zeit war, auf Mamas mutmaßlichen Liebhaber zurückzukommen. Der Prinz von Wales, ein Soldat, ein Flieger – aber Huren behaupten ja gern, Pfarrerstöchter zu sein, und schließlich blieb die Kirche, allem Geglitzer des Hoflebens zum Trotz, die Siegerin.
»Was war mein Papi, Mama?«
»Ein Pastor, sag ich dir doch in einem fort.«
Im Großen und Ganzen war das auch mein Lieblingsgedanke. Wir würden nichts gemein miteinander haben als unsere Trennung, aber wir sollten sie wenigstens anerkennen: und ich sollte hinter dem anderen Gesicht den Hemmklotz gewahren, den Teufel, die Verzweiflung, die verzerrten und verzweifelten Wahrnehmungen, die sich stündlich zu einem Glaubensbekenntnis zusammenbiegen, bis sie krumm gezogen sind wie die Füße von Chinesinnen. In meinen bitteren Augenblicken hab ich mir gedacht, dass ich dadurch mit guten Werken verbunden sei. Ich stelle mir dann gern vor, dass mein Vater nicht etwas tat, wofür er entweder eine Entschuldigung oder eine moralische Gleichgültigkeit aufbrachte. Meine Selbstachtung sähe es lieber, wenn er verzweifelt mit der Begehrlichkeit seines Fleisches zu ringen hatte. Soldaten lieben aus Tradition so: aus den Augen, aus dem Sinn; aber die Geistlichkeit, enthaltsam wie sie nun einmal ist, zölibatär, diese Pastoren, Pfarrer, Kirchenvorsteher und Priester – denen müsste ich eigentlich ein altes Ärgernis sein, das, zuerst für verzeihlich gehalten, jetzt aber wie eine rote Entzündung wirkt. In irgendeinem alten Pfarrhaus in Schottland oder England oder in einem Presbyterium oder einer Abtei müsste ich eigentlich aufplatzen, aufplatzen wie ein vergessener Abszess. Das sind doch Männer wie ich, wohl vertraut mit der Sünde. Einiges spricht dafür, dass ich damit zu tun habe.
Welche Richtung kommt dabei in Frage, möchte ich wissen? Erst vor ein oder zwei Tagen ging ich eine Seitenstraße hinunter, vorbei an verschiedenen Gotteshäusern, an der Kapelle, um die Ecke an der alten Kirche und dem riesigen Pfarrhaus. Zu welchem Bekenntnis soll mein beharrliches Sinnen und Spinnen sich wenden? Zur Hochkirche Englands, der Kirche des Kurators? Könnte mein Vater nicht ein Gentleman und später ein Geistlicher gewesen sein, ein Amateur wie ich? Selbst die Mönche laufen in Hosen herum, die unter ihren gutgeschnittenen Kutten hervorgucken. Sie erinnern mich an die Druiden vom Brown Willie oder von sonst wo, die Brillen tragen und in Autos daherkommen.[1] Oder soll ich lieber einen Römisch-Katholischen zum Vater wählen? Das ist doch eine richtige Kirche, auch wenn sie einem gründlich verhasst ist. Würde ein Bastard einen von ihnen nicht bloß am Ärmel, sondern auch am Herzen zupfen? Was die gewöhnlichen Sekten betrifft, die eben nichts als langweilig sektiererisch sind, die Halbgaren, die Splitterparteien, die Abendmahlstische und Tabernakel und Tempel – da bin ich wie Mama: gleichgültig. Er könnte ebenso gut ein Freimaurer oder Mitglied des Elk-Klubs sein.
»Was war mein Papi, Mama?«
Ich lüge. Ich betrüge mich selbst so gut wie Sie. Die Welt dieser Menschen ist auch die meine, die Welt der Sünde und der Erlösung, der Täuschung und der Überzeugung, der Liebe im Schmutz – ihr habt’s täglich genau mit dem zu tun, was mir in der Seele brennt. Ich bin einer von euch, ein heimgesuchter Mensch – heimgesucht durch was oder wen? Und das ist meine Klage: dass ich unter euch in intellektueller Freiheit gewandelt bin und ihr niemals versucht habt, mich davon wegzulocken, da ein Jahrhundert euch dazu verlockt hat und ihr an ehrliches Spiel glaubt, daran glaubt, dass man sich nichts anmaßt und schließlich kein Heiliger ist. Ihr habt denjenigen Freiheit zugebilligt, die nichts damit anfangen können und die das Juwel besudelt ließen mit Staub und Schmutz. Ich spreche eure Geheimsprache, die nicht die Sprache der anderen Menschen ist. Ich bin euer Bruder in beiderlei Sinn, und da Freiheit mein Fluch war, bewerfe ich euch mit Dreck, wie ich an einem Pickel kratzen könnte, der nicht aufgehen und töten wird.
»Was war mein Papi, Mama?«
Er braucht es ja gar nicht zu erfahren. Ich kenne den warmen Pulsschlag selbst gut und halte wenig von körperlicher Vaterschaft, wenn ich sie mit dem langsamen Wachstum vergleiche, das danach kommt. Wir besitzen ja Kinder nicht. Mein Vater war kein Mensch. Er war ein wie eine Kaulquappe gestalteter Fleck, unsichtbar dem bloßen Auge. Er hatte keinen Kopf und kein Herz. Er war spezialisiert und seelenlos wie ein lenkbares Geschoss.
Mama war ebenso wenig wie ich je berufsmäßig tätig. Wie die Mutter, so der Sohn. Wir sind im Grunde Amateure. Mama war nicht geschäftstüchtig und hatte auch nicht den Wunsch, eine erfolgreiche Laufbahn einzuschlagen. Sie war auch nicht etwa unmoralisch, denn das setzt eine Art Normalmaß voraus, von dem sie hätte abweichen können. Stand Mama über der Moral oder unter ihr, oder stand sie außerhalb? Heute würde man sie als nicht-normal einschätzen und ihr den Schutz angedeihen lassen, den sie gar nicht brauchte. Zu jener Zeit hätte man sie für schwachsinnig gehalten, hätte sie sich nicht in eine so unerschütterliche Gleichgültigkeit gehüllt. Sie setzte in der ›Sonne‹ kleine, aber für sie beträchtliche Summen auf Rennpferde, sie trank und ging in die Kinos. Wollte sie arbeiten, so nahm sie an, was sich gerade bot. Sie leistete Putzarbeit im Tagelohn, sie pflückte – wir pflückten Hopfen, sie wusch und fegte und wischte nachlässig Staub in öffentlichen Gebäuden, soweit sie von unserer Gasse leicht zu erreichen waren. Sexuelle Beziehungen hatte sie nicht, denn das bedeutet aseptischen Verkehr, eine lieblose, freudlose Verfeinerung der Lust, verbunden mit Empfängnisverhütung mit Hilfe der Gummipackung aus dem Badezimmer. Auf Liebe ließ sie sich nicht ein; denn das ist, soweit ich sehe, der leidenschaftliche Versuch, einander zu versichern, dass die sonst trennende Mauer niedergelegt ist. Mit dergleichen gab sie sich nicht ab. Hätte sie das getan, so hätte sie mir’s erzählt in einem ihrer hingenuschelten, weitschweifigen Selbstgespräche, mit den ausgedehnten Pausen, einverstanden mit der Tatsache, dass wir uns nun einmal nicht davor drücken können, hier zu sein. Sie war eben bloß ein Geschöpf. Sie lebte so vergnüglich wie eine Ammenzitze, hingegeben, hemmungslos lachend und seufzend. Ihr gelegentlicher Verkehr muss für sie das gewesen sein, was dem wirklichen Künstler seine Werke sind – sie sind sie selbst und weiter nichts. Es war nichts damit verbunden. Dergleichen spielte sich in Hintergassen oder auf Feldern ab, auf Kisten oder an Torpfosten und Pfeilern. Es war wie zumeist das Sexuelle in der Geschichte der Menschen: eine Angelegenheit der Natur, ohne Verschönerung durch Psychologie, Romantik oder Religion.
Mama war enorm dick. In ihrer Blütezeit muss sie ein dralles Mädchen gewesen sein, aber Appetit und ein Baby ließen sie aufgehen zu elefantenhaftem Umfang. Ich nehme an, dass sie früher recht anziehend war, denn ihre Augen, die jetzt in einem Gesicht, so aufgeschwemmt wie eine braune Semmel, steckten, waren noch groß und sanft. Ein Glanz ging von ihnen aus, der, als sie jung war, ihre ganze Gestalt verklärt haben muss. Manche Frauen können nicht nein sagen; aber meine Mama war mehr als diese einfältigen Geschöpfe, wie könnte sie sonst so das Ende des Tunnels ausfüllen? In diesen letzten paar Monaten habe ich versucht, sie in zwei Hände voll Ton einzufangen – ich meine nicht ihre äußere Erscheinung, sondern genauer: wie ich sie mir vorstelle, ihre riesige Masse, die mit ihrem bloßen Vorhandensein die Aussicht versperrt. Hinter ihr lag nichts mehr, nichts. Sie ist die warme Finsternis zwischen mir und dem kalten Licht. Sie ist das Ende des Tunnels – sie.
Und nun geht in meinem Kopf etwas vor sich. Ich möchte des Bildes habhaft werden, ehe die Wahrnehmung verschwindet. Mama, wie ich mich ihrer erinnere, breitet sich aus, sie löscht das Zimmer aus und das Haus, ihr breiter Bauch dehnt sich aus, sie sitzt in ihrer Selbstgewissheit und ihrem Gleichmut fester als auf einem Thron. Sie ist das Unbezweifelbare, das Nicht-Gute, das Nicht-Böse, nicht freundlich, nicht bitter. Sie wird im Hintergrunde eines langen Ganges sichtbar, den ich in die Zeit gebohrt habe.
Sie erregt Schrecken, aber nicht Furcht.
Sie ist nachlässig, aber sie beeinflusst nicht und beutet nicht aus.
Sie ist heftig, aber ohne Bosheit oder Grausamkeit.
Sie ist erwachsen, aber weder bevormundend noch herablassend.
Sie ist warm, aber ohne Besitz zu ergreifen.
Und vor allem: es gibt sie.
So also kann ich mich ihrer natürlich nur in Ton erinnern, in gewöhnlicher Erde, die vom Boden kommt, ich kann sie nicht festhalten, indem ich glatte Farben, die man in Läden kauft, in Strichen auf gestraffte Leinwand streiche, ich kann sie auch nicht in Worten umreißen, die zehntausend Jahre jünger sind als ihre dunkle Wärme. Wie kann man ein Zeitalter, eine Welt, eine Dimension beschreiben? Was davon mitteilbar ist, das sind die Dinge um sie herum, die man zusammensetzen und ausbreiten müsste, Mama in der Mitte, eine stumme Lücke. Aus der Flut der Erinnerung fische ich ein Stück Stoff heraus, grau mit einem Anflug von gelb. Die eine Ecke ist durchgerieben – oder, wie mir jetzt scheint, morsch geworden –, zerfranst, feuchte Fasern. Das Übrige ist irgendwo oben an meiner Mama befestigt, und ich schaukele mich daran weiter, mit den Fingern kralle ich mich darin fest, manchmal stolpernd und manchmal unsanft weggeschoben, ohne dass ein Wort gesprochen wird, von einer riesigen Hand, die von oben kommt. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, wie ich die Ecke ihrer Schürze zu fassen suchte und glücklich war, sie wiederzufinden.
Wir müssen damals in der Rotten Row gehaust haben, denn gewisse Richtungen waren schon so festgelegt wie die Punkte auf der Windrose. Unser Klo war über einen Haufen zerbrochener Ziegel und einen Wasserlauf zu erreichen, und eine hölzerne Tür öffnete sich auf einen breiten Sitz. Über unserem Zimmer lag noch ein Raum, wenn auch bestimmt kein Mieter ihn bewohnte. Vielleicht waren wir damals immerhin ein bisschen bemittelter, oder der Gin war billiger, auch die Zigaretten. Wir hatten eine Kommode als Toilettentisch, und der Kamin war voll von eisernen Schränkchen und Türen und Schüben, die man herausziehen konnte. Mama benutzte sie nie, sondern nur den kleinen Herd in der Mitte mit der heißen Metallplatte oben drauf. Wir hatten einen kleinen Fußteppich, einen Stuhl, einen kleinen Tisch aus dünnen Brettern und ein Bett. Mein Teil des Bettes lag nächst der Tür, und wenn Mama sich in ihren Teil legte, rutschte ich runter. Alle Häuser in unserer Reihe waren gleich, bis auf eins, und vor ihnen lief die mit Ziegeln gepflasterte Gasse mit der Rinne in der Mitte. In dieser Welt gab es Kinder aller Größen, Jungen, die mir Fußtritte versetzten oder Bonbons schenkten, Mädchen, die mich aufgriffen und zurückbrachten, wenn ich zu weit gekrabbelt war. Wir müssen sehr schmutzig gewesen sein. Ich habe einen guten und geübten Farbensinn, aber wenn ich an jene menschlichen Gesichter denke, so sehe ich sie nicht so sehr in Schattierungen von rot und weiß als von grau und braun. Mamas Gesicht, ihr Hals, ihre Arme – alles, was körperlich zu sehen war, war grau und braun. Die Schürze, die ich mir so deutlich vergegenwärtige, muss, wie ich jetzt erkenne, entsetzlich schmutzig gewesen sein. Mich selbst kann ich nicht sehen. In meiner Reichweite gab es keinen Spiegel, und wenn Mama je einen besessen hat, so muss er zur Zeit, als ich meiner selbst bewusst wurde, verschwunden gewesen sein. Was hätte Mama auch mit einem Spiegel anfangen sollen? Ich besinne mich, wie Wäsche auf Drähten sich blähte; ich besinne mich auf Seifenlauge, auf die unregelmäßigen Muster an der Mauer, die aus Schmutz bestanden haben müssen; aber wie Mama bin ich ein blinder Fleck in all dem Wahrgenommenen, ein Etwas in der Mitte, das nicht zu sehen ist. In der engen Welt der Rotten Row krabbelte und stolperte ich herum, leer wie eine Seifenblase, aber umgeben von einem Regenbogen von Farbe und Aufregung. Wir Kinder waren unterernährt und spärlich bekleidet. Zuerst ging ich barfuß zur Schule. Wir machten Lärm, wir kreischten, wir heulten, wir waren wie Tiere. Und doch erscheint mir diese Zeit wie ein Weihnachtsfest, mit all seinem Glanz und Geglitzer und seiner Wärme. Ich habe niemals Schmutz verabscheut. Mir erscheint all das Porzellan und Chrom, die Waschmittel, die Desodorants, dieser ganze Komplex von Sauberkeit, der sozusagen ganz Seife, ganz Hygiene ist, mir erscheint das alles unmenschlich und unverständlich. Es hat schon seinen Sinn zu sagen: in dem Augenblick, als wir aus unserem engen Loch hervorkamen und gewaschen wurden, war es auch aus mit dem Glück und der Sicherheit des Lebens.
Zweierlei Bilder aus unserem Slum sind mir geblieben. Das frühere zeigt das Innere, dessen ich mich erinnere, weil es damals eine andere Welt für mich überhaupt nicht gab. Der Ziegelweg mit der Gosse in der Mitte lief zwischen der Häuserreihe und der Reihe von Höfen, jeder mit einer Bude. An dem einen Ende, links von uns, befand sich ein hölzernes Gatter; am anderen war ein Durchgang zur Straße, die man nicht betrat. An diesem Ende lag die ›Sonne‹, ein altes und unübersichtliches Gebäude, dessen hintere Tür sich nach der Gasse öffnete. Hier konzentrierte sich das Leben der Erwachsenen, und hier reichte das letzte Haus in der Reihe über den Durchgang und beherbergte gegenüber die Kneipe, so dass es eine recht bedeutende und vorteilhafte Lage einnahm. Als ich alt genug war, solche Dinge zu bemerken, blickte ich mit den übrigen Leuten unserer Häuserreihe hinauf zu der guten Frau, die dort wohnte. Sie verfügte da droben über zwei Zimmer, sie gehörte zu der Kneipe wie der Mörtel zur Mauer, sie wirtschaftete für anständige Leute, und sie hatte Gardinen. Wenn ich Ihnen mehr von unserer Geographie erzählte und unsere Zustände so schildern wollte, wie man sie gemeinhin schildert, würde ich meine Erinnerungen verfälschen. Denn zunächst erinnere ich mich unserer Gasse nur als einer Welt, die auf der einen Seite von dem hölzernen Gatter und auf der anderen vom rechteckigen, verbotenen Durchgang zur Straße begrenzt wurde. Regen und Sonnenschein ergossen sich auf uns zwischen flatternden oder still hängenden Hemden. Es gab Pfosten mit Klampen daran und eine Anzahl einfacher Vorrichtungen, um die Wäsche da aufzuhängen, wo sie den Wind abfangen konnte. Es gab Katzen und es gab, wie mir vorkommt, eine Unmenge Leute. Ich besinne mich auf unsere Nachbarin, Mrs. Donovan, die verwelkt aussah, was man von Mama nicht behaupten konnte. Ich besinne mich, wie laut ihre Stimmen waren, die aus verkrampften Kehlen kamen, wenn die Damen miteinander zankten, wobei sie die Köpfe vorstießen. Ich besinne mich, wie so ein Streit ein ergebnisloses Ende nahm, indem beide Damen sich langsam seitwärts voneinander weg bewegten; keine von beiden hatte gesiegt, jede konnte nur noch einzelne Silben in vager Drohung ausstoßen, entrüstet und voller Abneigung:
»Na, also!«
»Ja!«
»Ja!«
»Ah!«
Das ist mir rätselhaft in Erinnerung geblieben, und zwar weil Mama nicht einfach gesiegt hatte. Gewöhnlich blieb sie die Siegerin. Die verwelkte Mrs. Donovan mit ihren drei Töchtern und vielen Sorgen war Mama in keiner Weise gewachsen. Bei einer Gelegenheit von apokalyptischer Großartigkeit gewann Mama nicht nur, sondern genoss einen Triumph. Ihre Stimme schien mit metallen widerhallendem Donner vom Himmel herabzudröhnen. Es lohnt sich, die Szene zu rekonstruieren.
Gegenüber jedem Hause, jenseits der ziegelgepflasterten Gasse mit der Rinne in der Mitte, lag je ein ummauerter Hof mit einem Eingang. Die Ziegelmauern waren ungefähr drei Fuß hoch. Auf jedem Hof stand links ein aufrechtes Rohr, und dahinter, auf der rückwärtigen Hälfte des Hofs, befand sich ein Schilderhäuschen, das mit einer hölzernen Tür verschlossen war. Diese Tür war mit einer Art Gitter versehen; wenn man sie öffnete, indem man einen hölzernen Riegel hochhob, sah man eine Kiste vor sich, die den ganzen Raum zwischen den Wänden ausfüllte und in der Mitte eine runde, abgewetzte Öffnung zeigte. Auf der Kiste lag meistens noch ein Stück Zeitung oder auf dem feuchten Fußboden ein ganzes zusammengeknautschtes Blatt. Unter der Reihe der Häuschen floss träge ein dunkles unterirdisches Rinnsal. Schloss man die Tür und ließ man den Riegel eines an der Seite hängenden Stücks Schnur fallen, dann konnte man da drinnen selbst als Bewohner der Rotten Row das Alleinsein genießen. Betrat jemand aus dem eigenen Hause den Hof – denn das sah man durch das Gitter – und hob er die Hand nach dem Riegel, dann rührte man sich nicht, sondern rief laut und unartikuliert, ohne Namen zu nennen oder richtige Worte zu gebrauchen, und die Hand zog sich zurück. Denn wir achteten auf unsere Lebensführung. Wir lebten nicht mehr einfach im Paradiese – was heißt, vorausgesetzt, der Besucher kam vom eigenen Hause. Andernfalls, wenn sie auf der Gasse umhergebummelt waren und sich geirrt hatten, dann konnte man so deutlich werden wie man wollte, man konnte sich in deftigsten Ausdrücken bewegen, neue Kombinationen in unserem Lebenskreis vorschlagen, den Besucher mit eingeschlossen, bis die Hauseingänge vor Lachen kreischten und alle die kleinen Bälger in der Gosse ebenfalls kreischten und tanzten.
Aber es gab Ausnahmen. In den zwanziger Jahren war der Fortschritt auch bei uns eingekehrt und hatte dem übrigen noch einen modernen Aberglauben hinzugefügt, so dass wir fest an eine mythische Herkunft von Toiletten glaubten. Rotten Row litt zuweilen an mehr als an Kopferkältungen.
Es muss an einem Tage im April gewesen sein. Welch anderer Monat konnte mir so viel Blau und Weiß schenken, so viel Sonne und Wind? Die Wäsche auf den Leinen hing horizontal und fröstelte, die Wolken, scharf umrissen, eilten dahin, die Sonne funkelte in den Spritzern der Seifenblasen in der Gosse, die abgetretenen Ziegel waren reingewaschen von einem Regenguss. Es war ein Wind, der Erwachsenen Kopfweh verursachte und Kinder zu tollem Übermut hinriss. Es war ein Tag kräftigen Gebrülls und der Balgereien, ein Tag, lichterloh brennend und unerträglich ohne Drama und Abenteuer. Irgendwas musste geschehen.
Ich spielte mit einer Streichholzschachtel in der Gosse. Ich war so klein, dass es mir nur natürlich war, zu hocken; trotzdem versetzte mir der Wind in unserer Gasse von der Seite einen Schubs, dass ich ebenso oft im Seifenwasser lag als draußen. Ein Abfluss war verstopft, so dass das Wasser sich über die Ziegel verbreitete und einen für mich passenden Ozean bildete. Und doch liegt mir nicht ein ganzer Zeitverlauf im Gedächtnis, sondern ein großer, apokalyptischer Augenblick. Mrs. Donovans Tochter Maggie, die so süß roch und runde, seidene Knie zeigte, prallte zurück vor dem Eingang zu unserem ummauerten Höfchen. Sie war so schnell und so weit zurückgewichen, dass sie mit einem hohen Absatz in meinem Ozean hängen blieb. Sie wollte sich gerade abwenden, die Arme wie in Abwehr erhoben. Auf ihr Gesicht kann ich mich nicht besinnen – es starrt wie hypnotisiert in eine andere Richtung. Die arme Mrs. Donovan, das liebe verwelkte Geschöpf, späht aus dem eigenen Klo mit der Miene eines Menschen, den man ungerechter Weise erwischt hat, und das alles erklären würde, wenn man ihm nur Zeit ließe – der aber weiß, in diesem furchtbaren Augenblick weiß, dass ihm keine Zeit mehr gelassen wird. Und aus unserem Klo, unserem eigenen privaten Klo mit dem warmen persönlichen Sitz kommt meine Mama.
Sie ist aus dem Verschlag gestürzt, die Tür ist gegen die Wand geprallt, und der Riegel hängt zerbrochen herunter. Meine Mama fasst Maggie ins Auge, einen Fuß quer vor dem andern, denn sie ist seitwärts aus dem schmalen Häuschen gekommen, mit gekrümmten Knien bückt sie sich in furchtbar drohender Haltung. Die Röcke sind ihr rund um die Hüften gewickelt, und den weiten, grauen Schlüpfer hält sie gerade über den Knien mit ihren beiden dunkelroten Händen fest. Ich sehe ihre Stimme, ein schartiges Etwas aus Scharlach und Bronze, in die Luft schmettern, bis es unter dem Himmel hängt, sieghaft und schreckenerregend:
»Du dreckige Hure! Schick deine Brut doch ins eigene Klo!«
Ich kann mich nicht darauf besinnen, dass irgendeine hoheitsvolle Macht an diejenige der Rotten Row heranreichte. Selbst als die Zwillinge Fred und Joe, die am anderen Ende der Gasse in der Nähe des hölzernen Gatters einen fragwürdigen Handel mit Altmaterial betrieben, von zwei giraffenartigen Polizisten weggeholt wurden, schmolz das Drama zur Niederlage zusammen. Wir sahen, wie einer der Polypen langsam die Gasse entlang schlenderte, und wir murrten, ich wusste nicht warum. Wir sahen Fred und Joe aus ihrem Hause herausstürzen und wie sie sich durch das hölzerne Gatter zwängten; aber auf der anderen Seite stand natürlich der zweite Polyp, dem sie geradeswegs in die Arme liefen. Sie waren klein, leicht mit je einer Hand zu packen. Sie wurden in Handfesseln durch die Gasse geführt, zwischen zwei dunkelblauen Pfeilern mit Silberpickeln oben drauf; der Polizeiwagen wartete auf sie. Wir schrien und murrten und gaben den dumpf wütenden Ruf von uns, der in der Rotten Row statt des höhnischen Buhuh! üblich war. Fred und Joe waren blass, trugen aber die Nase hoch. Die Polypen kamen, schnappten zu und gingen, unaufhaltsam wie Geburt und Tod. Es gab drei Fälle, in denen Rotten Row sich bedingungslos ergab: das Erscheinen eines neuen Erdenbürgers, des Polizeiautos, oder des langen Leichenwagens am Ende des Durchgangs. Irgendeine Art Hand stieß hinein in die Rotten Row und griff zu, da war eben nichts zu machen.
Wir waren eine Welt innerhalb einer Welt, und erst als erwachsenem Manne gelang mir die geistige Umwälzung, Rotten Row als ein Elendsviertel zu sehen. Die Gasse war zwar nur knapp vierzig Meter lang, und die Felder erstreckten sich bis an uns heran, aber wir waren ein Elendsviertel. Die meisten Leute stellen sich unter Slums Meilen voller Dreck im Eastend von London vor oder die windschiefen, schlecht gebauten Häuschen im Kohlenbezirk. Aber wir lebten mitten im Garten von England, und um uns blühten die Hopfenpflanzungen. Obgleich es auf der einen Seite Klinkervillen gab, Schulen, Speicher, Läden, Kirchen, gab es auf der anderen die würzigen Täler, in denen ich hinter meiner Mama herlief und nach den klebrigen Knospen langte. Aber damit bin ich schon außerhalb des Hauses und ich möchte noch eine Weile drin bleiben. Ich will die Ansichtspostkarten zurücklegen, auf denen tanzende Männer, von Flammen beleuchtet, zu sehen sind, und mich wieder unter dem Deckel verkriechen. Gewiss, es gab da Freudenfeuer, Ströme von Bier, Gesang, Zigeuner und eine heimlich zwischen den Bäumen errichtete Kneipe, ihr Strohdach wie einen Hut schief über die Augen gezogen. Aber man kehrte doch immer wieder in unser Slum zurück. Auch wir hatten eine Kneipe. Wir hockten dicht aufeinander. Jetzt, wo ich draußen bin in der kalten Welt, weit entfernt von der Möglichkeit, mein verheultes Gesicht dem Himmel zu zeigen, jetzt entdecke ich mit Überraschung, wie viele Leute was drum gäben, wenn sie auch in einem solchen Gedränge stecken könnten. Vielleicht wurde ich damals nicht betrogen, und wir hatten wirklich etwas. Wir waren eine Möglichkeit des Menschlichen, eine Lebensform, ein geschlossenes Ganzes.
Die Kneipe war unser Lebenszentrum. Da war ein beständiges Kommen und Gehen, die blasige braune Tür mit ihren beiden undurchsichtigen Glasscheiben ging in einem fort auf und zu. Der Messingknauf an der Tür war uneben und blank vom vielen Anfassen. Ich nehme an, dass der Ausschank einer Genehmigung bedurfte und zu gewissen Stunden verboten war, aber ich habe nie etwas davon bemerkt. Die Tür sah ich vom Fußboden aus, und in meiner Erinnerung scheint sie riesenhoch. Drinnen gab es einen Fußboden aus Ziegeln, ein paar Bänke und an der Theke in der Ecke zwei Stühle. Dies war die Plauderecke: warm und gemütlich, ein Platz für Erwachsene, wo es laut und geheimnisvoll herging. Später ging ich immer da hin, wenn ich meine Mama dringend haben wollte, und niemand hat mir je gesagt, meine Anwesenheit sei vom Gesetz nicht erlaubt. Zuerst ging ich da hin wegen unseres Mieters.
Unser Mieter wohnte im Oberstock, er benutzte unsern Herd, unsern Wasserhahn und unsern Lokus. Ich glaube, er war die tragische Figur, über die so viele Soziologen und Wirtschaftstheoretiker im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert so viele Bücher geschrieben haben. In meiner Vorstellung kann ich ihn unschwer wieder zum Leben erwecken. Zunächst: er war klein, selbst von meinem niedrigen Blickpunkt aus. Ich denke, er muss ein Überbleibsel von Handwerkertum gewesen sein, denn er war sauber und gewissermaßen was Besseres. Ein Klempner? Ein Zimmermann? Aber er war sehr alt – er war es immer gewesen, denn wer hätte sich ihn je anders vorstellen können? Er war ein gebrechliches Skelett, zusammengehalten von Haut und einem abgetragenen blauen Anzug. Er trug ein blaues Halstuch, das er innen in den Rockaufschlag stopfte: an seine Stiefel erinnere ich mich nicht mehr – vielleicht weil ich immer zu ihm aufblickte. Er hatte interessante Hände, an denen allerlei zu sehen war: Knoten und Adern und braune Flecken. Er trug immer einen weichen Hut, ob er in unserem Oberstock am Fenster saß oder die Gasse hinunter schlurfte oder aufs Klo ging, oder ob er in der ›Sonne‹ an der Theke saß. Besonders bemerkenswert an ihm war sein Schnurrbart, der abwärts hing und so weiß und weich zu sein schien wie Schwanengefieder. Er bedeckte seinen Mund und war sehr schön. Aber noch bemerkenswerter war sein Atem: er atmete so schnell und geräuschvoll wie ein Vogel, ein aus, ein aus, ein aus, in einem fort, tick tick, so zerbrechlich wie eine Uhr und ebenso eilig, als ob keine Zeit, keine Zeit für irgendetwas anderes zu verlieren wäre. Über seinem Schnurrbart, unter den hängenden Brauen zu beiden Seiten der scharfen Nase schauten seine Augen hervor, zerstreut und ängstlich. Mir kam es vor, als blicke er immer nach etwas, was nicht da war, etwas, das tieferes Interesse und Besorgnis erregte. Tick, tick, tick, in einem fort, in einem fort. Niemand kümmerte sich darum, ich nicht, Mama nicht, er war unser Mieter, und er hing nur noch an dem letzten Faden seines Lebens. Wenn ich abends schlafen ging oder morgens aufwachte, konnte ich ihn oben hören, durch die dünnen Dielenbretter, tick, tick, tick. Wenn man eine Frage an ihn richtete, antwortete er wie einer, der eben eine Meile in vier Minuten gelaufen ist, mit keuchendem Atem und nach Luft schnappend, in verzweifelter Not, am Leben zu bleiben, wie einer, der zum dritten Male in die Gerade einbiegt, rein raus rein raus rein raus. Ich fragte ihn einmal, als er dasaß und in den Herd hineinstierte. Ich wollte wissen, warum. Er gab mir keuchend eine Antwort, wie ein Schuldbewusster – er brachte gerade noch die Worte hervor und schnappte dann nach Luft wie einer, der eben noch eine fallende Tasse an seinem Fußgelenk auffängt, ehe sie in Stücke springt.
»Warze …«, nach Luft schnappen tick tick, »in mir –«, tick tick tick »Brust«. Keuchen und noch ein verzweifeltes Luftschnappen, um die leere Lunge zu füllen.
Ich habe ihn nie essen sehen, obgleich ich annehme, dass er gegessen haben muss. Aber wie? Er hatte ja keine Zeit. Wie viel Tage müssen vergehen, bis der Körper alles Fett und Fleisch, all den Brennstoff verbraucht hat? Wie lange kann sich der Geist an den Stiefelstrippen aufrecht erhalten, da er, wie es scheint, seinen Brennpunkt in den Augen hat? Tick, tick, tick, und obwohl er mit anderen in die ›Sonne‹ ging, konnte er gar nicht viel trinken, wenn überhaupt etwas, und zwar weil der Bausch, der über seinem Mund herabhing, so weiß war wie Schwanengefieder. Wie ich mich seiner erinnere und seines Atems, da fällt mir ein, dass er an Lungenkrebs litt; und mit einer gewissen trüben Belustigung bemerke ich, dass ich in diesem Augenblick bemüht bin, jene Vermutung, die sich auf keine Kenntnis stützt, in ein System hineinzubringen. Aber dann fällt mir ein, dass mir alle Systeme nacheinander zusammengebrochen sind, dass das Leben aufs Geratewohl verläuft und das Üble unbestraft bleibt. Warum soll ich jenen Mann, jenes Kind mit diesem Kopf und Herzen und Händen, wie sie jetzt sind, in Zusammenhang bringen? Ich kann mir sehr wohl ein wirkliches Vergehen aus jener Zeit ins Gedächtnis zurückrufen, denn ich habe einmal den alten Mann um zwei Pfennige bestohlen – ich kaufte mir Lakritze dafür, die ich heute noch leidenschaftlich gern mag –, und es ist nie herausgekommen. Aber das war eben eine Zeit schrecklicher und unverantwortlicher Unschuld. Ich müsste Literat sein, um meine Geschichte so zu gestalten, dass diese zwei Münzen mir schwer auf den Lidern gelegen hätten; in Wirklichkeit bin ich das längst losgeworden. Warum also schreibe ich eigentlich? Erwarte ich immer noch ein System? Was suche ich überhaupt?
Unser Bett unten stand in Reichweite der Kommode, unser Wecker stand nahe am Rand. Es war ein altes Modell, rund, auf drei kurzen Füßen, und er trug eine Glocke wie einen aufgespannten Regenschirm. Er klapperte Mama ins Erwachen, wenn sie am frühen Morgen im Dunkeln zur Aufwartung gehen musste. Meine schlafenden Ohren nahmen den Lärm wahr und träumten weiter. Manchmal, wenn die Nacht lang und heiß gewesen war, nahm Mama keine Notiz von dem Wecker oder grunzte nur und verkroch sich. Dann weckte die Uhr mich. Die ganze Nacht hatte sie getickt, hatte die Tollheit unterdrückt, zurückgehalten und aufgestaut; aber jetzt platzte die Spannung. Der Regenschirm wurde zum Kopf, die Uhr schlug sich wie irrsinnig an den Kopf, sie zitterte und tanzte auf der Kommode auf drei Beinen, bis sie den Punkt erreichte, an dem die Kommode aus Sympathie zu trommeln anfing, ganz Besessenheit und Aufregung. Dann weckte ich Mama und kam mir sehr tüchtig und tugendhaft vor, bis sie im Dunkeln aufstand wie ein Walfisch. Aber wenn ich in der Nacht aufwachte oder keinen Schlaf finden konnte, dann war immer die Uhr da und richtete sich nach meinen Empfindungen. Zuweilen und sehr oft war sie freundlich und mild; aber wenn ich, was selten vorkam, meine Anfälle nächtlichen Schreckens hatte, dann hatte auch die Uhr welche. Die Zeit war dann unerbittlich und eilte weiter, sie trieb unaufhaltsam auf den Punkt zu, an dem der Wahnsinn explodierte.

![El Señor de las Moscas [cómic] - William Golding - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/bf907a27690c6f8dd2413cea24d7670f/w200_u90.jpg)