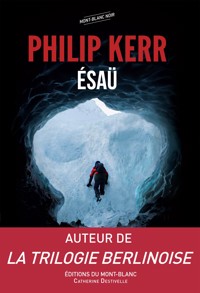9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
«Emil und die Detektive» wäre auch dann Friedrichs Lieblingsbuch, wenn der Autor Erich Kästner nicht zufällig sein Nachbar und Freund wäre. Seit er es gelesen hat, träumt er davon, selbst Detektiv zu werden. Mit seinen Freunden Albert und Viktoria – die so klug ist, dass sie nur «Doktor» genannt wird – hilft er bereits der Berliner Polizei dabei, im Tiergarten verlorene Gegenstände aufzuspüren. Sein älterer Bruder Rolf dagegen schließt sich den Nazis an und beteiligt sich begeistert an der Bücherverbrennung 1933. Friedrich muss mit ansehen, wie dort auch Kästners Bücher verbrannt werden. Und bald darauf setzt die Polizei die Kinder sogar darauf an, den Schriftsteller auszuspionieren! Als dann auch noch ein Mord geschieht, wird Friedrich schlagartig klar, dass die Zeit der Detektivspiele für immer vorbei ist. Ein spannendes Leseabenteuer von Bestsellerautor Philip Kerr – und eine Hommage an Erich Kästner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Philip Kerr
Friedrich der Große Detektiv
Über dieses Buch
«Emil und die Detektive» wäre auch dann Friedrichs Lieblingsbuch, wenn der Autor Erich Kästner nicht zufällig sein Nachbar und Freund wäre. Seit er es gelesen hat, träumt er davon, selbst Detektiv zu werden. Mit seinen Freunden Albert und Viktoria – die so klug ist, dass sie nur «Doktor» genannt wird – hilft er bereits der Berliner Polizei dabei, im Tiergarten verlorene Gegenstände aufzuspüren. Sein älterer Bruder Rolf dagegen schließt sich den Nazis an und beteiligt sich begeistert an der Bücherverbrennung 1933. Friedrich muss mit ansehen, wie dort auch Kästners Bücher verbrannt werden. Und bald darauf setzt die Polizei die Kinder sogar darauf an, den Schriftsteller auszuspionieren! Als dann auch noch ein Mord geschieht, wird Friedrich schlagartig klar, dass die Zeit der Detektivspiele für immer vorbei ist.
Ein spannendes Leseabenteuer von Bestsellerautor Philip Kerr – und eine Hommage an Erich Kästner.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Philip Kerr ist vielfach ausgezeichneter Autor von über dreißig Büchern, darunter die bekannte Kinderbuchreihe «Die Kinder des Dschinn». Für seine Krimiserie für Erwachsene gewann er gleich mehrere wichtige internationale Preise. Philip Kerr lebte bis zu seinem Tod in London. Mit seiner rein fiktiven Geschichte um die Figur Erich Kästners – die nichts mit den Geschichten Kästners zu tun hat und keine Fortschreibung von «Emil und die Detektive» darstellen soll – verbeugt sich Philip Kerr auf ganz persönliche Weise vor diesem Autor.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Copyright für die deutsche Übersetzung © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg Copyright © 2017 by No Rush Limited
Covergestaltung: any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverillustration: Regina Kehn
ISBN 978-3-7336-0803-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Mit Dank an C.S.
Prolog(Berlin 1945)
Es war ein sonniger, kalter Tag in Berlin. Hunderte von Flugzeugen flogen über den blauen Himmel und durchschnitten die Luft mit ihrem monotonen, metallischen Dröhnen. Ihre Motoren hinterließen lange Kondensstreifen, die aussahen wie Luftschlangen; doch für die beiden Männer am Boden waren sie kein schöner Anblick, denn es waren amerikanische B-17-Bomber, und ihre Ziele waren die Regierungsgebäude im Osten der deutschen Hauptstadt.
In der Ferne konnten die zwei Männer auch das klagende Geräusch der Sirenen hören, die sie aufforderten, schnellstmöglich den nächsten Luftschutzbunker aufzusuchen. Doch keiner von beiden hatte die Absicht, dieser Aufforderung nachzukommen. Sie kannten die Abläufe nur zu genau: Die B-17-Bomber griffen tagsüber an, weil sie bei Tageslicht spezielle Ziele ausmachen konnten; die British Royal Air Force kam nachts und zerbombte alles, was sie konnte.
Für den Moment glaubten die beiden Männer deshalb hier im Westen der Stadt, auf dem alten Friedhof von Wilmersdorf, relativ sicher zu sein. Außerdem hatte einer der Männer nur noch wenig Zeit, bevor er Berlin für immer verlassen würde, und er wollte noch das Grab eines alten Freundes besuchen, bevor die Russen die Stadt besetzten. Wer konnte schon sagen, was dann passieren würde? Der Mann fröstelte bei dem Gedanken in seinem Ledermantel und warf einen schnellen Blick auf seine Uhr. Seine Freunde warteten in einem Auto neben den Friedhofstoren. Sie wollten so schnell wie möglich abfahren und waren keineswegs begeistert gewesen, als er auf diesen kleinen Abstecher bestanden hatte.
«Es geht hier entlang», sagte der andere Mann. Er hatte nur noch einen Arm und eine schreckliche Narbe im Gesicht. Beides war der Lohn für seine Militärdienste beim Russlandfeldzug 1941. «In der alten Kapelle. Man muss natürlich ein bisschen suchen. Es ist wie überall in der Stadt – die Namen der Wege bedeuten nichts mehr. Schwer zu sagen, wo der eine Weg aufhört und der andere anfängt.»
Wie alle anderen Gebäude in Berlin war auch die Friedhofskapelle von Wilmersdorf beinahe ebenso schwer beschädigt wie der einarmige Mann, und sie mussten um Bombenkrater herumgehen und über zerbrochene Grabsteine steigen. Berlin war nur noch eine riesige Ruine; Deutschland hätte schon vor Monaten kapitulieren müssen, doch da das nicht geschehen war, schien die vollständige Zerstörung der Hauptstadt unausweichlich.
«Natürlich wird hier jetzt niemand mehr beerdigt», erklärte der einarmige Mann und lachte bitter. «Jedenfalls nicht absichtlich … wenn Sie wissen, was ich meine. Mich überrascht es jedenfalls nicht, dass es hier schon seit langem keine freien Grabstätten mehr gibt. Jetzt werden nur noch Urnen mit der Asche der Verstorbenen angenommen.»
«Ja, ich weiß», sagte der Mann im Ledermantel. «Ich bin hier früher oft gewesen. Damals kannte ich mich auf diesem Friedhof noch gut aus. Aber jetzt nicht mehr. Nicht, seitdem Berlin bombardiert wird.»
Der einarmige Mann sah nervös zum dröhnenden Himmel hinauf. «Wenn Sie mich fragen, dann werden wir bald alle hier enden. Dafür werden die Russen schon sorgen. Sie haben schon einen Arm von mir. Und ich schätze, es wird nicht lange dauern, bis sie sich den anderen holen.» Er lächelte über seinen eigenen Scherz, der wie so viele Scherze einen großen Teil Wahrheit enthielt. Denn es gab keinen Zweifel daran: Die anstehende Schlacht gegen die Russen würde bis zum letzten Mann geführt werden. So lauteten Adolf Hitlers Befehle. Wenn es nach ihm ging, würde Deutschland niemals kapitulieren. «Jedenfalls liegt er hier. Ich komme fast jeden Tag und besuche ihn.»
Sie hatten eine lange Mauer erreicht, die mit Hunderten von viereckigen Tafeln bedeckt war. Der einarmige Mann zog einen Lumpen aus seiner Manteltasche und wischte den Bombenstaub vom Stein. Die Luft war voll davon. Seit 1943 glich Berlin einer einzigen Baustelle. Manchmal lag so viel Staub in der Luft, dass man ihn schmecken konnte. «Dann putze ich ihn ein bisschen. Damit er hübsch aussieht.»
Der Mann im Ledermantel antwortete nicht. Auf jeder Tafel standen ein Name und ein paar Daten. Alles war schlicht und auf den Punkt. Die Tafeln glichen Büchern im Schaufenster einer Buchhandlung, dachte der Mann im Ledermantel, was nur passend schien, denn es war die Liebe zu Büchern gewesen, die ihn und seinen alten Freund zusammengebracht hatte; doch nun befand sich hinter jedem Namen eine Urne mit der Asche eines verstorbenen Menschen. Hier und da hing neben dem Namen und den beiden Daten auch eine kleine Metallvase an der Tafel, in die man eine Blume hineinstellen konnte, doch der Mann im Ledermantel hatte keine Blume mitgebracht. Er hätte auch nicht gewusst, wo er eine hätte auftreiben sollen. 1945 pflanzte niemand Blumen, wenn er stattdessen etwas zu essen anbauen konnte. In den Berliner Gärten wuchsen Lauch und Kartoffeln.
Stattdessen hatte er eine alte Lupe mitgebracht, die einen gerillten Holzgriff besaß und so groß war wie ein Soßentopf. Sie sah aus wie die Lupe eines Detektivs, um schwierige Fälle damit zu lösen. Der Tote hatte Detektivgeschichten geliebt. Das hatten sie beide.
Der Mann im Ledermantel steckte die Lupe in die Metallvase an der Tafel, als wäre es eine Blume, und trat dann einen Schritt zurück.
«Das ist ein wertvoller Gegenstand», meinte der einarmige Mann. «Ist bestimmt ein paar Reichsmark wert. Wollen Sie das wirklich hierlassen?»
«Ja. Das will ich.»
«Ich sag ja nur. Hier gibt es eine Menge Leute, die alles mitnehmen, um sich damit etwas zu essen zu kaufen. Keine richtigen Diebe. Aber die Not kann einen eben manchmal dazu bringen, selbst die Toten zu berauben. Nicht, dass ich das gutheiße. Aber manchmal … Die Toten stört es schließlich nicht, beraubt zu werden, stimmt’s?»
«Das ist nicht wichtig. Es geht darum, dass ich ihm diese Ehre erweise. Es geht um das, was diese Lupe ihm und mir bedeutet hat. Deshalb bin ich hier: um seinen Tod auf eine Weise zu ehren, die ihm gefallen hätte. Nicht mit irgendeiner dummen Medaille oder einem Orden, wie man sie Toten sonst verleiht, sondern mit etwas, das sein Leben feiert. Denn das ist alles, was zählt: das Leben.»
Erstes Kapitel(Berlin, 2. Dezember 1931) Friedrichs Weihnachtsfreude
Friedrich Kissel hielt das Alhambra-Lichtspielhaus für das schönste Kino der ganzen Stadt. Es war erst vor fünf Jahren fertiggestellt worden und ganz sicher das modernste und gemütlichste in Berlin: ein langes Backsteingebäude mit einem großen Vorbau, auf dessen Spitze eine Art goldener Krone saß. In Friedrichs Augen war das nur passend, denn das Kino war für ihn die Krönung der Unterhaltung. Gleich gefolgt von Büchern, wie Friedrich fand, und die Weltpremiere eines Films, der auf seinem absoluten Lieblingsbuch basierte, war wirklich etwas ganz Besonderes. Seit das Buch Emil und die Detektive 1929 herausgekommen war, hatte Friedrich es praktisch jeden Monat einmal gelesen – und das hieß zwanzig- oder dreißigmal insgesamt. Und er hatte vor, es ein weiteres Mal zu lesen, sobald er wieder zu Hause war und gemütlich in seinem Bett lag.
Das Buch war vermutlich eines der erfolgreichsten Kinderbücher in Deutschland. Und der Schriftsteller Erich Kästner war zufällig ein guter Freund von Friedrichs Vater, Ernst Kissel. Nicht nur das: Kästner war auch ein Nachbar der Familie. Die Kissels wohnten in einer großen Wohnung in der Roscherstraße 14 und Erich Kästner in einer kleineren in der Nummer 16. Doch die beiden Männer kannten sich noch aus einem anderen Grund: Friedrichs Vater war Kulturredakteur des großen Berliner Tageblatts, BT, für das Erich Kästner hin und wieder Artikel zu verschiedenen Themen beisteuerte. Als Emil und die Detektive herauskam, hatte Kästner seinem Freund Ernst Kissel ein signiertes Buch für Friedrich geschenkt. Friedrich war damals zehn Jahre alt gewesen und damit ein wenig jünger als die Hauptfigur der Geschichte. Und da das Buch zum großen Teil in Berlin spielte, nahm Kästner richtig an, dass Friedrich daran Spaß haben würde. Tatsächlich war das signierte Buch Friedrichs größter Schatz. Und genau das erzählte er dem Schriftsteller, als er ihn bei der Filmpremiere traf.
«Es ist nicht mein Lieblingsbuch, weil Sie es signiert haben», sagte Friedrich. «Es wäre auch sonst mein Lieblingsbuch gewesen. Aber durch Ihr Autogramm wird es noch besser.»
«Danke, Friedrich, das bedeutet mir sehr viel», antwortete Erich Kästner, der eine Menge Freunde zum Premierenabend eingeladen hatte. Die Eingangshalle war voller Menschen mit Gläsern in den Händen. Neben Kästner stand ein kleinerer, kahlköpfiger Mann mit hellen, wachen Augen. Er mochte in den Zwanzigern sein, war also etwas jünger als der Schriftsteller. «Ich hoffe, der Film gefällt dir. Aber falls nicht, dann beschwer dich bitte direkt bei diesem Mann hier und nicht bei mir. Er ist der Drehbuchautor und heißt Samuel Wilder, aber alle Welt nennt ihn Billy.»
«Er gefällt mir ganz bestimmt», sagte Friedrich. «Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Aber werden Sie noch eine Fortsetzung von Emil und die Detektive schreiben? Ich finde, das sollten Sie. Unbedingt. Bestimmt würden es viele Leute lesen. Aber Sie müssten sich damit beeilen, damit Ihre Leser nicht schon zu alt sind, bevor es erscheint.»
Friedrichs Mutter, die dem Gespräch ihres Sohnes mit Herrn Kästner zugehört hatte, runzelte die Stirn und schnalzte mit der Zunge.
«Sag du Herrn Kästner nicht, was er tun soll», sagte sie. «Ich bin sicher, er schreibt dann ein Buch, wenn er dazu bereit ist. Wenn er genug Inspiration bekommen hat.»
In ihrem Mund klang das Wort Inspiration wie ein Vormittagsimbiss.
«Schon gut, Sabine», sagte Kästner. «Ich halte nicht viel von Inspiration. Sie ist eine ziemlich glitschige Angelegenheit, die man nicht zu fassen kriegt. Und Friedrich hat recht. Ich sollte wirklich bald ein neues Buch über Emil schreiben. Morgen fange ich an. Vielleicht könnte Friedrich mich mal besuchen und mir mit ein paar Ideen aushelfen. Sag mir, Friedrich, was hat dir an diesem Buch so besonders gut gefallen?»
Friedrich musste einen Augenblick nachdenken. Es gab so viele Dinge, die er an dem Buch mochte, dass er nicht gleich wusste, womit er anfangen sollte. Er dachte an die Handlung, die Figuren und wie sich die Geschichte entwickelte, aber auch an den Humor … Schließlich wollte er Herrn Kästner nicht länger warten lassen und sagte: «Na, zum einen hat mir gefallen, dass Sie selbst in der Geschichte auftreten. Ich finde, das war sehr schlau von Ihnen. Und zum anderen gefällt mir, dass die Geschichte so kurz ist.»
Billy Wilder lachte laut auf, und Erich Kästner schmunzelte ebenfalls, zog dabei jedoch eine Augenbraue auf eine Weise in die Höhe, dass Friedrich ganz neidisch wurde. Es sah so ungemein klug aus.
«Du solltest später mal Kritiker werden», sagte Billy Wilder mit leichtem Akzent.
«Ach nein», meinte Friedrich. «Ich will Detektiv werden und für die Berliner Kriminalpolizei arbeiten im Polizeihauptquartier am Alexanderplatz. Seit ich Emil und die Detektive gelesen habe, will ich das. Die Bilder haben mir übrigens auch gut gefallen. Haben Sie die gemalt?»
Kästner lächelte wieder und richtete seine Fliege. «Nein. Aber du hast völlig recht. Die Bilder sind wirklich gut. Mir gefallen sie auch sehr.»
Er legte Friedrich eine Hand auf die Schulter und steuerte ihn auf einen dunkelhaarigen, gutaussehenden Mann auf der anderen Seite der Empfangshalle zu. «Ich zeige dir den talentierten Mann, aus dessen Feder sie stammen.»
Erich Kästner mochte Kinder und junge Leute, was vermutlich der Grund war, warum er Lehrer geworden war. Er war davon überzeugt, dass die Zukunft davon abhing, dass jedem Kind Freundlichkeit und Bildung zuteilwurden, ganz zu schweigen von Geduld. Er selbst hatte in Dresden keine gute Schulzeit erlebt und noch schlimmere Tage als junger Mann in der Armee: Ein besonders brutaler Ausbilder bei der Artillerie war dafür verantwortlich, dass er sich eine Herzschwäche zugezogen hatte. Und obwohl er mit seinem Schnurrbart älter wirkte, war Erich Kästner nur zwanzig Jahre älter als Friedrich.
«Walter», sagte er jetzt, «dies ist mein Nachbarsjunge Friedrich. Ihm gefallen deine Bilder. Friedrich, das hier ist Walter Trier. Er ist Künstler, was bedeutet, dass er überhaupt nichts ernst nimmt.»
Und damit ging er davon, um andere Gäste zu begrüßen, und überließ Friedrich der Unterhaltung mit Walter Trier.
«So, Friedrich», sagte Herr Trier. «Dir gefallen also meine Bilder, was?»
Friedrich nickte. «Ich habe noch nie einen Künstler kennengelernt», gestand er.
«Wer ist denn dein Lieblingsmaler?»
Friedrich dachte an das Bild, das in seinem Zimmer hing. Er hatte es vor Jahren von seinen Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen. «Albrecht Dürer, glaube ich. Er hat so ein Bild von einem Hasen gemalt, das mir gut gefällt. Ich habe zu Hause einen Druck davon und schaue es mir jeden Tag an.»
«Gute Wahl», sagte Walter Trier und nickte.
«Hängen Ihre Bilder im Museum?», wollte Friedrich wissen. «So wie die von Dürer?»
«Noch nicht», antwortete der Künstler. «Aber ich arbeite daran. Nächstes Jahr habe ich eine Ausstellung in meiner Heimatstadt Prag. Bis jetzt ist mein größtes Werk allerdings ein Wandbild.»
«Was ist ein Wandbild?»
«Ein Bild, das direkt auf eine Wand gemalt wurde. Im Foyer vom Kabarett der Komiker am Lehniner Platz.»
«Ist das dieses moderne Gebäude, das so ein bisschen aussieht wie der Kommandostand auf einem Kriegsschiff?»
«Genauso sieht es aus», nickte Herr Trier.
«Das ist ganz in der Nähe von meinem Zuhause», sagte Friedrich.
«Dann solltest du mal hingehen und es dir anschauen – mein Wandbild, meine ich. Wenn du sagst, dass ich dich geschickt habe, zeigt man es dir bestimmt.»
«Das mache ich», versprach Friedrich. «Und wenn es nur halb so gut ist wie die Bilder in Emil und die Detektive, dann ist es großartig.»
«Was gefällt dir eigentlich so an ihnen?», wollte Herr Trier wissen.
«Na ja, sie sind so schön einfach», antwortete Friedrich rundheraus.
Herr Trier lachte.
«Entschuldigung», beeilte sich Friedrich zu sagen. «Ich habe es gar nicht als Witz gemeint.»
«Nein, du hast ja recht. Einfach ist gut. Einfach ist sehr gut. Genau das sind sie, Friedrich. Und in der Kunst ist das alles.»
Zweites KapitelEmil und die Detektive
Friedrich hatte vorher noch nie einen Film gesehen, der auf einem Buch basierte, doch er fand, die Filmleute hatten ihre Arbeit ziemlich gut gemacht. Hätte er etwas kritisieren müssen, dann hätte er gesagt, dass der Film zu kurz war. Nach nur fünfundsiebzig Minuten – das hatte er an seiner neuen Armbanduhr abgelesen – war er zu Ende. Wenn es nach Friedrich gegangen wäre, hätte er mindestens noch eine Stunde dauern können.
In Emil und die Detektive geht es um einen Jungen namens Emil Tischbein, dem auf der Zugfahrt nach Berlin das Geld gestohlen wird, das ihm seine Mutter für seine Großmutter mitgegeben hatte. Der Dieb ist ein Zugpassagier – ein finsterer Mann namens Grundeis, mit steifem Kragen und einer Melone auf dem Kopf. Emil ist entschlossen, sich das Geld zurückzuholen, und er verbündet sich mit einer Gruppe cleverer Berliner Kinder, mit deren Hilfe er den Dieb schließlich überführt. Sie sind die Detektive in der Geschichte – Kinderdetektive –, und das macht die Sache für Friedrich so aufregend.
Friedrich fand, dass der Film dem Buch sehr nahekam. Besonders die Szene, in der Emil von Grundeis betäubt wurde, war sehr überzeugend. Sie erinnerte Friedrich an ein Mal, als er Fieber gehabt und nicht genau gewusst hatte, ob er träumte oder wach war. Friedrich fand auch den Schauspieler großartig, der die Rolle des Emil spielte. Interessant war ebenfalls, wie ähnlich der Dieb dem Vorsitzenden der NSDAP sah, einer der größten politischen Parteien in Deutschland. Der Dieb trug genau wie Adolf Hitler einen kleinen Schnauzbart, und während des Films hörte Friedrich, wie sich mehrere Leute im Publikum auf die Ähnlichkeit aufmerksam machten – auch seine Eltern. Friedrichs Vater flüsterte ihm zu, dies wäre vielleicht nicht so eine kluge Entscheidung gewesen, da die Nazis – wie man die Mitglieder der Partei nannte – sich oft mit Leuten prügelten, die anderer Meinung waren als sie, besonders mit den Kommunisten und den Sozialdemokraten. Zwischen ihnen gab es auf den Berliner Straßen ständig Zusammenstöße, und manchmal wurden auch Leute ernsthaft verletzt oder sogar getötet, selbst Polizisten. Meistens war dies im Osten der Stadt der Fall, am Bülowplatz, wo sich auch die Parteizentrale der Kommunisten befand. Doch Friedrich erinnerte sich noch gut an den vergangenen August, als die Nazis auf dem Kurfürstendamm gewütet hatten, und diese lange Straße lag ganz nahe an seinem Zuhause. In Friedrichs Augen waren die Kommunisten genauso schlimm wie die Nazis.
Nachdem der Film vorbei war, wurden im Foyer des Kinos erneut Getränke und Kleinigkeiten zum Essen gereicht, und Herr Wilder stellte Friedrich drei der jungen Schauspieler vor, die im Film mitgespielt hatten: Rolf Wenkhaus, Hans Schaufuß und Hans-Albrecht Löhr.
Rolf, der die Rolle des Emil Tischbein gespielt hatte, war ein paar Jahre älter als Friedrich. Friedrich mochte ihn sofort, besonders als der junge Schauspieler ihm gestand, dass er selbst von seinem Auftritt nicht besonders viel hielt und dass er schreckliche Angst vor Fritz Rasp gehabt hatte, dem Mann, der den Bösewicht Grundeis gespielt hatte. Rasp war schon in vielen Filmen der Bösewicht gewesen und galt als der unheimlichste Schauspieler im deutschen Kino. Er war ebenfalls bei der Premiere anwesend, und auch wenn er jetzt keinen Schnauzbart mehr trug, sah er immer noch recht finster aus.
Rolf erzählte Friedrich außerdem, das Beste an den Dreharbeiten sei das Essen gewesen, denn wenn man beim Film arbeitete, würde man immer gut mit Essen und Trinken versorgt.
«Ich hab noch nie im Leben so viele Würstchen gegessen», gestand er.
«Das hört sich wunderbar an», stimmte Friedrich zu.
«Dir hat der Film also gefallen?», fragte Rolf, der gern noch mehr Komplimente hören wollte.
«Ich finde ihn großartig.»
«Gut. Denn wenn ich erwachsen bin, will ich mal Schauspieler werden.»
«Aber du bist doch schon einer», wunderte sich Friedrich.
«Ich meine, ein richtiger Schauspieler. Jemand, der davon leben kann. Was ist mit dir? Was willst du mal werden, wenn du mit der Schule fertig bist?»
Friedrich wollte nicht zugeben, dass er später einmal Detektiv werden wollte. Vielleicht würde Rolf Wenkhaus dann glauben, er wäre nur wegen des Films auf diese Idee gekommen, und das hätte bestimmt peinlich gewirkt. Stattdessen sagte er, er wollte Rechtsanwalt werden, weil er wusste, dass viele Detektive auch erst einmal Jura studierten.
«Ich fasse es nicht, dass du Rolf heißt», sagte Friedrich weiter, um das Thema zu wechseln. «Mein älterer Bruder heißt auch so, und er kann mich nicht ausstehen. Nichts gefällt ihm mehr, als mir das Leben zur Hölle zu machen.»
«So sind Brüder wohl, schätze ich», sagte Rolf.
«Auf jeden Fall ist es gut, dass er nicht hier ist. Er hatte keine Lust, sich einen Kinderfilm anzusehen, hat er gesagt.»
«An einem Kinderfilm ist wohl nichts verkehrt, wenn es so ein guter Film ist wie dieser», sagte Friedrichs Vater, der kam, um seinen Sohn mit nach Hause zu nehmen. «Er beweist nur, dass deutsche Jungen genauso gut schauspielern können wie amerikanische.»
Auf dem Weg durchs Foyer begegneten sie noch einmal Walter Trier, der Friedrich daran erinnerte, sich unbedingt sein Wandbild anzusehen.
«Hier», sagte er und reichte Friedrich ein Blatt Papier mit einer Zeichnung darauf. Zu Friedrichs Erstaunen war es ein Porträt von ihm selbst, nur dass Teile davon übertrieben dargestellt waren, was ihm einen sehr komischen Ausdruck verlieh. Friedrich fand es wundervoll.
«Das ist eine Karikatur», erklärte Herr Trier. «Ich habe sie gemacht, als du dir den Film angesehen hast, darum hast du es nicht gemerkt. Sie gefällt dir wohl, hm?»
«Sie ist großartig», sagte Friedrich.
«Ich zeichne bloß, was da ist, und dann noch ein bisschen mehr. Ich schätze, du hast wohl einfach ein lustiges Gesicht. Ich sollte es wissen, bei meiner Nase.»
Dann gingen sie nach Hause.
Das Alhambra-Lichtspielhaus lag am Kurfürstendamm, Berlins schönster und vermutlich auch längster Straße, und damit nicht weit von der Wohnung der Kissels entfernt. Der Kurfürstendamm war immer voller Neonlichter und heller Schaufenster, doch so kurz vor Weihnachten schien Friedrich ganz Berlin wie verzaubert zu sein.
«Was bedeutet Alhambra eigentlich?», fragte er seinen Vater, denn er war von Natur aus neugierig und daher bestens dafür geeignet, später einmal Detektiv zu werden – manche Menschen haben es gut, weil sie wirklich für etwas berufen zu sein scheinen.
«Die Alhambra ist ein großer Palast in Spanien», erklärte sein Vater. «Dort haben König Ferdinand und Königin Isabella zum ersten Mal Christoph Kolumbus empfangen, als er sie um Unterstützung für seine Expedition nach Amerika bat.»
Manchmal klang Friedrichs Vater wie ein wandelndes Lexikon; sicher einer der Gründe, weshalb er ein so guter Journalist war. Dazu war er geradezu berufen.
«Ein Palast, ja?», sagte Friedrich. «Na, dann muss es aber wirklich ein toller Palast sein, um diese Alhambra hier in Berlin zu übertreffen. Und die Stadt muss auch eine richtig tolle Stadt sein, um unsere zu schlagen. Schaut bloß mal: Abends sieht Berlin aus wie Mamas Schmuckkasten – wie schwarzer Samt voller Rubine und Smaragde.»
«Schön wär’s», lachte seine Mutter.
«Ich glaube, Berlin ist die beste Stadt der Welt», sagte Friedrich und seufzte zufrieden. «Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ihr vielleicht?»
Drittes KapitelDas Kabarett der Komiker
Ein paar Tage nach Neujahr fing für Friedrich die Schule wieder an. Das Mommsen-Gymnasium lag ganz in der Nähe und war nach einem wichtigen deutschen Historiker namens Theodor Mommsen benannt. In der Eingangshalle der Schule hing ein Bild von ihm, auf dem er mit langen weißen Haaren und Brille zu sehen war. Leo und Albert, Friedrichs beste Freunde, fanden, er sähe darauf aus wie ein verrückter Professor. Was stimmte.
Friedrichs Lieblingslehrerin war Frau Weber. Sie dagegen bemühte sich sehr darum, keine Lieblingsschüler zu haben, doch wenn sie welche gehabt hätte, dann wären Friedrich und Leo sicherlich unter ihnen gewesen. Was nicht bedeutete, dass Friedrich ein Streber war. Keineswegs. Doch er strengte sich an und gab immer sein Bestes, und wenn es etwas gibt, was Lehrer mögen, dann ist es ein Schüler, der sein Bestes gibt. Leo dagegen war einfach schlau. Und das haben Lehrer am liebsten.
Frau Weber war eine gute Lehrerin. Sie übte ihren Beruf seit über dreißig Jahren aus, und das Mommsen-Gymnasium war ihr Leben. Am Morgen kam sie als Erste und fuhr abends als Letzte auf ihrem schwarzen Fahrrad nach Hause. Sie besaß außerdem Sinn für Humor, was bei Lehrern immerhin eine Seltenheit ist, besonders bei einer Witwe wie ihr. Wie so viele Frauen hatte sie ihren Mann im Großen Krieg verloren, doch sie sprach nie davon. Sie war immer streng, aber gerecht, und jeden Tag las sie ihrer Klasse zum Abschluss des Unterrichts ein Kapitel aus einem neuen Buch vor.
Einmal hatte sie Emil und die Detektive ausgesucht, und Friedrich war begeistert gewesen. Es war etwas ganz anderes, sein Lieblingsbuch vorgelesen zu bekommen, und dann noch von jemandem, der den Figuren im Buch so unterschiedliche Stimmen geben konnte.
Friedrich ging gern zur Schule. Und er war ein guter Schüler, beinahe der Klassenbeste. Aber er war auch gut im Sport, und hätte er sich selbst beschreiben sollen, hätte er sicher gesagt, dass er sich am liebsten in der Natur aufhielt. Er ging oft in den Tiergarten, den großen Park mitten in Berlin, wo er mit seinem Freund Albert und dessen Schwester Viktoria sowie manchmal auch mit Leo Detektiv spielte.
Wenn er allein war, stromerte Friedrich viel durch die Stadt. Er versuchte dabei, seine Beobachtungsgabe zu schulen, denn Beobachtung ist alles, wenn man ein guter Detektiv sein will. Daher kannte er die Straßen von Berlin auch wie seine Westentasche und ebenso die Linien der Straßenbahnen und Busse. Er wusste sogar, welche Plätze man besser mied – Viertel wie Neukölln und den Wedding zum Beispiel, wo der Streit zwischen den Nazis und den Kommunisten immer wieder aufflammte.
Einmal war er vor der Zentrale der Kommunistischen Partei am Bülowplatz Zeuge einer richtigen Straßenschlacht geworden, bei der viele Menschen verletzt worden waren. Vermutlich stand deswegen jetzt immer ein gepanzertes Fahrzeug dort. Bei einer anderen Gelegenheit hatte er einen Trauerzug für einen jungen Mann namens Horst Wessel beobachtet, der von den Kommunisten getötet worden war. Politik schien oft mit Gewalt einherzugehen. Friedrichs Vater sagte, diese beiden Parteien könnten sich noch nicht einmal darauf einigen, sich nicht zu einigen.
«Das ist das Problem mit diesem Land», sagte er. «Es gibt zu viele Menschen in Deutschland, die glauben, sie hätten ein Monopol auf die Wahrheit, obwohl sie eigentlich nichts anderes tun, als weitere Lügen zu verbreiten.»
Der Kurfürstendamm im Westen der Stadt war dagegen normalerweise sicher, und eines Januarnachmittags ging Friedrich nach der Schule mit seinem Freund Leo bis zum Lehniner Platz und weiter zum Kabarett der Komiker, um sich das Wandgemälde von Walter Trier anzusehen. Leo war ebenso begeistert von Emil und die Detektive wie Friedrich. Und Herrn Triers Illustrationen gefielen ihm am besten. Er interessierte sich daher sehr für das Wandgemälde, vor allem, weil er später einmal selbst Künstler werden wollte.
Im Gebäude konnten sie eine Jazzband proben hören, doch in der Eingangshalle schien niemand zu sein, und so stellten sich die beiden Jungen ehrfürchtig vor das Wandgemälde. Es war viel größer und lustiger, als sie gedacht hatten. Eigentlich waren es sogar zwei Wandgemälde. Auf einem saß ein Mann am Flügel, ein zweiter zupfte eine Harfe, ein dritter blies in eine Tuba, und ein vierter spielte Gitarre. Auf der gegenüberliegenden Wand war eine Art Dschungelszene zu sehen mit einem Känguru, einem jungen Hasen, einem Schimpansen, einem Panther und einem Zebra. Alles war sehr lebendig und farbenfroh und erinnerte Friedrich an Karikaturen.
«Ich verstehe schon, warum auf dem einen Bild eine Jazzband zu sehen ist», meinte Friedrich. «Aber ein Känguru würde sich wohl nie am selben Ort wie ein Zebra befinden. Oder wie ein Schimpanse.»
«Stimmt», gab Leo zu. «Das nennt man wohl künstlerische Freiheit.»
«Und was soll das bedeuten?»
«Das bedeutet, dass man im Namen der Kunst ruhig die Tatsachen verändern darf. Es ist in Ordnung, weil es Kunst ist, aber normales Lügen nicht.»
«Der Mann mit der Trompete und dem riesigen Schnauzbart sieht aus wie Hindenburg», sagte Friedrich.
Hindenburg war der Reichspräsident und ziemlich alt und dick.
Leo nickte zustimmend.
«Na, wen haben wir denn hier?», dröhnte die Stimme eines Mannes durch die Halle. «Bewundern wir die Kunst? Oder machen wir einen Schulausflug ins Irrenhaus?»
Friedrich und Leo drehten sich um und sahen einen großen Mann hinter sich stehen. Er trug einen doppelreihigen Nadelstreifenanzug und einen großen Hut und hielt einen Spazierstock in der Hand. Er hatte einen buschigen Bart und einen grauen, spitz zulaufenden Schnauzer, der aussah wie die Nadel von einem Kompass.
«Kinder, Kinder, das hier ist ein Kabarett und nicht die Nationalgalerie.»
«Wir kennen den Unterschied», sagte Leo.
«Wirklich? Und wen kennt ihr noch?»
«Ich kenne den Künstler, Walter Trier», sagte Friedrich. «Von ihm stammen die Bilder in unserem Lieblingsbuch Emil und die Detektive. Er hat gesagt, ich sollte mir sein Wandbild ansehen, wenn ich mal vorbeischaue.»
«Wenn du woran vorbeischaust?» Der Mann lächelte über seinen eigenen Scherz. Friedrich war nicht so sicher, ob er sich über sie lustig machte oder nicht – das wusste man nie so genau bei Erwachsenen –, darum wandte er sich zum Gehen. Leo folgte ihm.
«Wartet mal, Kinder. Ihr kennt also Walter Trier, ja?»