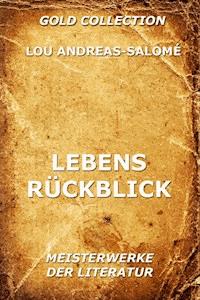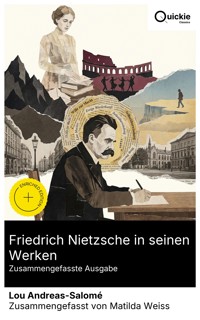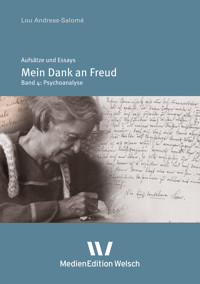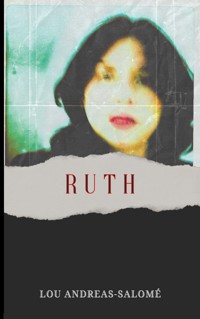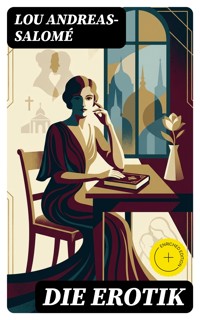1,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Mihi ipsi scripsi!« ruft Friedrich Nietzsche in seinen Briefen wiederholt nach Vollendung eines Werkes aus. Und gewiss hat es etwas zu bedeuten, wenn der erste lebende Stilist dies von sich selber sagt, er, dem es, wie keinem Zweiten, gelungen ist, für jeden seiner Gedanken, und noch für die feinste Schattirung darin, den erschöpfenden Ausdruck zu finden. Dem, der Nietzsches Schriften zu lesen weiss, ist es denn auch ein verrätherisches Wort: es deutet die Verborgenheit an, in welcher alle seine Gedanken stehen, die lebendige Hülle, die sie vielgestaltig umkleidet, es deutet an, dass er im Grunde nur für sich dachte, für sich schrieb, weil er nur sich selbst beschrieb, sein eignes Selbst in Gedanken umsetzte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
FRIEDRICH NIETZSCHE
IN SEINEN
WERKEN
VON
LOU ANDREAS-SALOMÉ.
MIT 2 BILDERN UND 3 FACSIMILIRTEN BRIEFEN NIETZSCHES.
ZWEITE AUFLAGE.
MOTTO:NIETZSCHES WAHLSPRUCH: »Increscunt animi, virescit volnere virtus.—« Furius Antias bei Gellius.
1911.
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383834342
Nicht Willens mich auseinanderzusetzen, weder mit dem inzwischen veröffentlichten Nachlaß Nietzsches, noch mit Andern über Nietzsche, lasse ich diese Schrift in unverändertem (anastatischem) Druck neu auflegen.
Lou Andreas-Salomé.
Friedrich Nietzsche
INHALTS-VERZEICHNISS.
Sein WesenSeine Wandlungen
F. Nietzsche. Zeichnung: Hans Olde.
Ein Brief Friedrich Nietzsches zum Vorwort.
(Gedruckter text.)
[Die »Bitte« in der »Fröhlichen Wissenschaft«, auf welche in dem vorstehend facsimilirten Briefe Bezug genommen ist, lautet:
»Ich kenne mancher Menschen Sinn Und weiss nicht, "Wer ich selber bin! Mein Auge ist mir viel zu nah— Ich bin nicht, was ich seh und sah. Ich wollte mir schon besser nützen, Könnt' ich mir selber ferner sitzen. Zwar nicht so ferne wie mein Feind! Zu fern sitzt schon der nächste Freund— Doch zwischen dem und mir die Mitte! Errathet ihr, um was ich bitte?« (Scherz, List und Rache 25.)]
I. ABSCHNITT
SEIN WESEN.
MOTTO: »Der Mensch mag sich noch so weit mit seiner Erkenntniss ausrecken, sich selber noch so objectiv Vorkommen: zuletzt trägt er doch Nichts davon, als seine eigene Biographie.« (Menschliches, Allzumenschliches I. 513.)
»Mihi ipsi scripsi!« ruft Friedrich Nietzsche in seinen Briefen wiederholt nach Vollendung eines Werkes aus. Und gewiss hat es etwas zu bedeuten, wenn der erste lebende Stilist dies von sich selber sagt, er, dem es, wie keinem Zweiten, gelungen ist, für jeden seiner Gedanken, und noch für die feinste Schattirung darin, den erschöpfenden Ausdruck zu finden. Dem, der Nietzsches Schriften zu lesen weiss, ist es denn auch ein verrätherisches Wort: es deutet die Verborgenheit an, in welcher alle seine Gedanken stehen, die lebendige Hülle, die sie vielgestaltig umkleidet, es deutet an, dass er im Grunde nur für sich dachte, für sich schrieb, weil er nur sich selbst beschrieb, sein eignes Selbst in Gedanken umsetzte.
Wenn es überhaupt die Aufgabe des Biographen ist, den Denker durch den Menschen zu erläutern, so gilt dies in ungewöhnlich hohem Masse für Nietzsche, denn bei keinem Andern fallen äusseres Geisteswerk und inneres Lebensbild so völlig in Eins zusammen. Auf ihn trifft es ganz besonders zu, was er in dem vorangestellten Briefe von den Philosophen überhaupt ausspricht: dass man ihre Systeme auf die Personalacten ihrer Urheber hin prüfen solle. Später hat er der gleichen Auffassung in den Worten Ausdruck gegeben: »Allmählig hat sich mir herausgestellt, was jede grosse Philosophie bisher war: nämlich das Selbstbekenntniss ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires.« (Jenseits von Gut und Böse 6.)
Dies war denn auch der leitende Gedanke in meinem in dem vorstehenden Briefe erwähnten Entwurf zu einer Charakteristik Nietzsches, den ich ihm im October 1882 vorlas und mit ihm durchsprach. Die Arbeit enthielt im Umriss den ersten Theil des vorliegenden Buches und einzelne Abschnitte des zweiten Theiles,—der Inhalt des dritten, das eigentliche »System Nietzsche« war damals noch nicht geboren. Im Laufe der Jahre erweiterte sich, im Anschlüsse an die rasch aufeinander folgenden Werke, jene Charakteristik immer mehr, und Einzelnes daraus ist bereits in besonderen Aufsätzen veröffentlicht worden.[1] Es handelte sich für mich ausschliesslich darum, die Hauptzüge von Nietzsches geistiger Eigenart zu schildern, aus denen allein seine Philosophie und ihre Entwicklung begriffen werden können. Zu diesem Zwecke beschränkte ich mich freiwillig sowohl nach der Seite der rein theoretischen Betrachtungsweise, als auch hinsichtlich der rein persönlichen Lebensbeschreibung. Beides durfte nicht zu weit geführt werden, wenn die Grundlinien seines Wesens deutlich hervortreten sollten. Wer Nietzsche auf seine Bedeutung als Theoretiker hin prüfen wollte, auf das, was etwa die zünftige Philosophie aus ihm zu lernen vermöchte, der würde sich enttäuscht abwenden, ohne zum Kern seiner Bedeutung vorzudringen. Denn der Werth seiner Gedanken liegt nicht in ihrer theoretischen Originalität, nicht in dem, was dialektisch begründet oder widerlegt werden kann, sondern durchaus in der intimen Gewalt, mit welcher hier eine Persönlichkeit zur Persönlichkeit redet,—in dem, was nach seinem eigenen Ausdruck wohl zu widerlegen, aber doch nicht »todtzumachen« ist. Wer andererseits von Nietzsches äusserem Erleben ausgehen wollte, um sein Inneres zu erfassen, der würde ebenfalls nur eine leere Schale in der Hand behalten, aus welcher der Geist entwichen ist. Denn man kann von Nietzsche sagen, dass er nach aussen hin eigentlich nichts erlebte:[2] all sein Erleben war ein so tief innerliches, dass es sich nur im Gespräch, von Mund zu Mund, und in den Gedanken seiner Werke kundthat. Die Summe von Monologen, aus denen im Wesentlichen seine vielbändigen Aphorismensammlungen bestehen, bilden ein einziges grosses Memoirenwerk, dem sein Geistesbild zu Grunde liegt. Dieses Bild ist es, das ich hier zu zeichnen versuche: das Gedanken-Erlebniss in seiner Bedeutung für Nietzsches Geisteswesen—das Selbstbekenntniss in seiner Philosophie.
Obgleich Nietzsche seit einigen Jahren häufiger genannt wird als irgend ein anderer Denker, obgleich viele Federn damit beschäftigt sind, theils Jünger für ihn zu werben, theils gegen ihn zu polemisiren, so ist er doch in den Grundzügen seiner geistigen Individualität nahezu unbekannt geblieben. Denn seitdem die kleine, zerstreute Schaar seiner Leser, die er stets besass, und die ihn wahrhaft zu lesen verstand, zu einer grossen Schaar von Anhängern angewachsen ist, seitdem weite Kreise sich seiner bemächtigt haben, ist ihm das Schicksal widerfahren, welches jedem Aphoristiker droht; einzelne seiner Ideen, aus dem Zusammenhang gelöst und dadurch beliebig deutbar, sind zu Stich- und Schlagworten ganzer Richtungen gemacht worden, erklingen im Kampf von Meinungen, im Streit von Parteien, denen er selbst völlig fern stand. Wohl verdankt er diesem Umstand seinen raschen Ruhm, den plötzlichen Lärm um seinen stillen Namen,—aber im Besten, durchaus Einzigartigen und Unvergleichlichen, das er zu geben hat, ist er dadurch vielleicht übersehen worden und unbeachtet geblieben,—ja in eine vielleicht noch tiefere Verborgenheit zurückgetreten als vorher. Viele feiern ihn zwar noch laut, mit der ganzen Naivetät gläubiger Kritiklosigkeit, doch gerade sie gemahnen unwillkürlich an sein bitteres Wort: Der Enttäuschte spricht: »Ich horchte auf Widerhall, und ich. hörte nur Lob—« (Jenseits von Gut und Böse 99). Kaum Einer von ihnen ist ihm wahrhaft nachgegangen,—fernab von den Andern und ihrem Tagesstreit und allein in der Ergriffenheit seines eigenen Innern; kaum Einer hat diesen einsamen, schwer ergründlichen, heimlichen und auch unheimlichen Geist begleitet, der Ungeheures zu tragen wähnte und an einem ungeheuren Wahn zusammenbrach.
Daher ist es, als stände er da inmitten derer, die ihn am meisten preisen, wie ein Fremdling und Einsiedler, dessen Fuss sich in ihren Kreis nur verirrte, und von dessen verhüllter Gestalt Keiner den Mantel gehoben,—ja, als stände er da mit der Klage seines »Zarathustra« auf den Lippen:
»Sie reden Alle von mir, wenn sie Abends ums Feuer sitzen, aber Niemand—denkt an mich! Dies ist die neue Stille, die ich lernte: ihr Lärm um mich breitet einen Mantel um meine Gedanken.«
Friedrich Wilhelm Nietzsche ist am 15. October 1844 als der einzige Sohn eines Predigers in Röcken bei Lützen geboren, von wo sein Vater später nach Naumburg versetzt wurde. Seine Schulbildung empfing er in der nahegelegenen Schulpforta und ging dann als Student der classischen Philologie an die Universität Bonn, wo damals der berühmte Philologe Ritschl lehrte. Er studirte fast ausschliesslich unter Ritschl, verkehrte auch persönlich viel mit ihm und folgte ihm im Herbst 1865 nach Leipzig. In seine Leipziger Studienzeit fällt Nietzsches erste persönliche Beziehung zu Richard Wagner, den er 1868 im Hause von dessen Schwester, der Frau Prof. Brockhaus, kennen lernte, nachdem er sich schon früher mit seinen Werken vertraut gemacht. Noch vor seiner Promotion berief 1869 die Universität Basel den 24jährigen Nietzsche auf den Lehrstuhl des Philologen Kiessling, der von dort an das Johanneum in Hamburg ging. Nietzsche erhielt erst eine ausserordentliche, kurz darauf eine ordentliche Professur für classische Philologie, und die Universität Leipzig verlieh ihm den Doctorgrad ohne vorhergehende Promotion. Neben seinen Universitätscollegien übernahm er den Unterricht des Griechischen in der dritten (höchsten) Classe des Baseler Pädagogiums,—einer Mittelanstalt zwischen Gymnasium und Universität,—an welcher noch andere Universitätsprofessoren, wie der Culturhistoriker Jacob Burckhardt und der Philologe Mähly, lehrten. Hier gewann er grossen Einfluss auf seine Schüler; sein seltnes Talent, junge Geister an sich zu fesseln und entwickelnd, anregend auf sie zu wirken, kam zu voller Geltung. Burckhardt sagte damals von ihm: einen solchen Lehrer habe Basel noch niemals besessen. Burckhardt gehörte zum engsten Freundeskreise Nietzsches, zu dem noch der Kirchenhistoriker Franz Overbeck und der Kantphilosoph Heinrich Romundt zählten. Mit den beiden Letztem wohnte Nietzsche zusammen in einem Hause, welches nach Veröffentlichung der »Unzeitgemässen Betrachtungen« in der Baseler Gesellschaft den Beinamen: »Die Gifthütte« erhielt. Gegen Schluss seines Baseler Aufenthalts lebte Nietzsche eine Zeit lang mit seiner einzigen, fast gleichaltrigen Schwester Elisabeth zusammen, die später seinen Jugendfreund Bernhard Förster heiratete und mit diesem nach Paraguay ging. 1870 machte Nietzsche den deutschfranzösischen Krieg als freiwilliger Krankenpfleger mit; nicht lange darauf traten die ersten drohenden Anzeichen eines Kopfleidens hervor, das sich in periodisch wiederkehrenden heftigen Schmerzen und Uebelkeiten äusserte. Will man Nietzsches eigenen, mündlichen Aeusserungen Glauben schenken, so war dieses Leiden erblicher Natur, und ist sein Vater demselben erlegen. Neujahr 1876 fühlte er sich bereits so köpf- und augenkrank, dass er sich im Pädagogium vertreten lassen musste, und von da ab verschlimmerte sich sein Zustand derartig, dass er mehrere Male dem Tode nahe war.
»Ein paar Mal den Pforten des Todes entwischt, aber fürchterlich gequält,—so lebe ich von Tag zu Tage; jeder Tag hat seine Krankengeschichte.« Mit diesen Worten schildert Nietzsche in einem Briefe an einen Freund die Leiden, unter welchen er ungefähr 15 Jahre zugebracht hat.
Umsonst verlebte er den Winter 1876-1877 in dem milden Klima von Sorrent, wo er sich in Gesellschaft einiger Freunde befand: von Rom war seine langjährige Freundin Malwida von Meysenbug (Verfasserin der bekannten »Memoiren einer Idealistin« und Anhängerin R. Wagners) zu ihm gekommen; von Westpreussen Dr. Paul Rée, mit dem ihn schon damals Freundschaft und Gleichheit der Bestrebungen-verband. Dem kleinen gemeinschaftlichen Hauswesen hatte sich auch noch ein junger brustkranker Baseler, Namens Brenner, zugesellt, der jedoch bald darauf starb. Als auch der Aufenthalt im Süden ohne günstige Wirkung auf seine Schmerzen blieb, gab Nietzsche 1878 seine Lehrthätigkeit am Pädagogium und 1879 seine Professur an der Universität endgiltig auf. Seitdem führte er nur noch ein Einsiedlerleben, theils in Italien—meistens in Genua—theils im Schweizer Gebirge, namentlich in dem kleinen Engadiner Dorfe Sils-Maria, unweit des Maloja-Passes.
Sein äusserer Lebenslauf erscheint damit abgeschlossen und gleichsam beendet, während sein Denkerleben erst jetzt recht eigentlich beginnt: so dass uns der Denker Nietzsche, mit dem wir uns zu beschäftigen haben, erst am Ausgang dieser Lebensereignisse vollkommen deutlich entgegentritt. Trotzdem werden wir auf alle Schicksalswendungen und Erlebnisse, die hier nur kurz skizzirt worden sind, bei Gelegenheit der verschiedenen Perioden seiner Geistesentwicklung noch ausführlicher zurückkommen müssen. Sein Leben und Schaffen zerfällt in der Hauptsache in drei ineinander übergreifende Perioden, die je ein Jahrzehnt umfassen:
Zehn Jahre, 1869-1879, dauerte Nietzsches Lehrthätigkeit in Basel; diese philologische Wirksamkeit fällt der Zeit nach fast völlig zusammen mit dem Jahrzehnt seiner Jüngerschaft Wagner gegenüber und mit der Veröffentlichung derjenigen Werke, welche von der Metaphysik Schopenhauers beeinflusst sind: sie währte von 1868 bis 1878, in welchem Jahre er zum Zeichen seiner philosophischen Sinnesänderung Wagner sein positivistisches Erstlingswerk: »Menschliches, Allzumenschliches« übersandte.
Seit dem Anfang der Siebzigerjahre bestand seine Verbindung mit Paul Rée, die im Herbst 1882 ihren Abschluss fand,—gleichzeitig mit der Vollendung der »Fröhlichen Wissenschaft«, des letzten derjenigen Werke Nietzsches, die noch auf positivistischer Grundlage ruhen.
Im Herbst 1882 fasste Nietzsche den Entschluss, sich zehn Jahre lang aller schriftstellerischen Thätigkeit zu enthalten. In dieser Zeit tiefsten Schweigens wollte er seine neue, dem Mystischen sich zuwendende Philosophie auf ihre Richtigkeit prüfen und dann 1892 als ihr Verkündiger auftreten. Diesen Vorsatz hat er nicht ausgeführt, sondern gerade in den Achtzigerjahren eine fast ununterbrochene Productivität entfaltet und ist dann noch vor Ablauf des von ihm angesetzten Jahrzehntes verstummt: 1889 setzte ein gewaltsamer Ausbruch seines Kopfleidens plötzlich aller weiteren Geistesarbeit ein Ziel.
Der Zeitraum aber zwischen der Niederlegung seiner Baseler Professur und dem Aufhören aller geistigen Thätigkeit überhaupt umfasst wiederum ein Jahrzehnt, die Zeit von 1879-1889. Seitdem lebt Nietzsche als Kranker, nach einem vorübergehenden Aufenthalt in der Anstalt von Professor Binswanger in Jena, bei seiner Mutter in Naumburg.
Die beiden diesem Buche beigegebenen Bilder zeigen Nietzsche inmitten dieser letzten zehn Leidensjahre. Und gewiss ist dies die Zeit gewesen, in welcher seine Physiognomie, sein ganzes Aeussere, am charakteristischesten ausgeprägt erschien: die Zeit, in welcher der Gesammtausdruck seines Wesens bereits völlig vom tief bewegten Innenleben durchdrungen war, und selbst noch in dem bezeichnend blieb, was er zurückhielt und verbarg. Ich möchte sagen: dieses Verborgene, die Ahnung einer verschwiegenen Einsamkeit,—das war der erste, starke Eindruck, durch den Nietzsches Erscheinung fesselte. Dem flüchtigen Beschauer bot sie nichts Auffallendes; der mittelgrosse Mann in seiner überaus einfachen, aber auch überaus sorgfältigen Kleidung, mit den ruhigen Zügen und dem schlicht zurückgestrichenen braunen Haar konnte leicht übersehen werden. Die feinen, höchst ausdrucksvollen Mundlinien wurden durch einen vornübergekämmten grossen Schnurrbart fast völlig verdeckt; er hatte ein leises Lachen, eine geräuschlose Art zu sprechen und einen vorsichtigen, nachdenklichen Gang, wobei er sich ein wenig in den Schultern beugte; man konnte sich schwer diese Gestalt inmitten einer Menschenmenge vorstellen,—sie trug das Gepräge des Abseitsstehens, des Alleinstehens. Unvergleichlich schön und edel geformt, so dass sie den Blick unwillkürlich auf sich zogen, waren an Nietzsche die Hände, von denen er selbst glaubte, dass sie seinen Geist verriethen,—eine darauf zielende Bemerkung findet sich in »Jenseits von Gut und Böse« (288): »Es giebt Menschen, welche auf eine unvermeidliche Weise Geist haben, sie mögen sich drehen und wenden, wie sie wollen, und die Hände vor die verrätherischen Augen halten —als ob die Hand kein Verräther wäre!—.«[3]
Wahrhaft verrätherisch sprachen auch die Augen. Halbblind, besassen sie dennoch nichts vom Spähenden, Blinzelnden, ungewollt Zudringlichen vieler Kurzsichtigen; vielmehr sahen sie aus wie Hüter und Bewahrer eigener Schätze, stummer Geheimnisse, die kein unberufener Blick streifen sollte. Das mangelhafte Sehen gab seinen Zügen eine ganz besondere Art von Zauber dadurch, dass sie, anstatt wechselnde, äussere Eindrücke wiederzuspiegeln, nur das Wiedergaben, was durch sein Inneres zog. In das Innere blickten diese Augen und zugleich,—weit über die nächsten Gegenstände hinweg,—in die Ferne, oder besser: in das Innere wie in eine Ferne. Denn im Grunde war seine ganze Denkerforschung nichts als ein Durchforschen der Menschenseele nach unentdeckten Welten, nach »ihren noch unausgetrunkenen Möglichkeiten« (Jenseits von Gut und Böse 45), die er sich rastlos schuf und umschuf. Wenn er sich einmal gab, wie er war, im Bann eines ihn erregenden Gesprächs zu Zweien, dann konnte in seine Augen ein ergreifendes Leuchten kommen und schwinden;—wenn er aber in finsterer Stimmung war, dann sprach die Einsamkeit düster, beinahe drohend aus ihnen, wie aus unheimlichen Tiefen,—aus jenen Tiefen, in denen er immer allein blieb, die er mit Niemandem theilen konnte, vor denen ihn selbst bisweilen Grauen erfasste,—und in die sein Geist zuletzt versank.
Einen ähnlichen Eindruck des Verborgenen und Verschwiegenen machte auch Nietzsches Benehmen. Im gewöhnlichen Leben war er von grosser Höflichkeit und einer fast weiblichen Milde, von einem stetigen, wohlwollenden Gleichmuth,—er hatte Freude an den vornehmen Formen im Umgang und hielt viel auf sie. Immer aber lag darin eine Freude an der Verkleidung,—Mantel und Maske für ein fast nie entblösstes Innenleben. Ich erinnere mich, dass, als ich Nietzsche zum ersten Male sprach,—es war an einem Frühlingstage in der Peterskirche zu Rom,—während der ersten Minuten das gesucht Formvolle an ihm mich frappirte und täuschte. Aber nicht lange täuschte es an diesem Einsamen, der seine Maske doch nur so ungewandt trug, wie Jemand, der aus Wüste und Gebirge kommt, den Rock der Allerweltsleute trägt; sehr bald tauchte die Frage auf, die er selbst in die Worte zusammengefasst hat: »Bei Allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt, kann man fragen: was soll es verbergen? Wovon soll es den Blick ablenken? Welches Vorurtheil soll es erregen? Und dann noch: bis wie weit geht die Feinheit dieser Verstellung? Und worin vergreift er sich dabei?«
Dieser Zug stellt nur die Kehrseite der Einsamkeit dar, aus welcher Nietzsches Innenleben ganz herausbegriffen werden muss,—einer sich stetig steigernden Selbstvereinsamung und Selbstbeziehung auf sich.
In dem Maasse, als sie zunimmt, wird alles nach Aussen gewandte Sein zum Schein,—zum blossen täuschenden Schleier, den die Einsamkeitstiefe nur um sich webt, um zeitweilig für Menschenaugen erkennbare Oberfläche zu werden. »Tiefdenkende Menschen kommen sich im Verkehr mit Andern als Komödianten vor, weil sie sich da, um verstanden zu werden, immer erst eine Oberfläche anheucheln müssen.« (Menschliches, Allzumenschliches II 232). Ja, man kann selbst Nietzsches Gedanken, sofern sie sich theoretisch aussprechen, noch mit zu dieser Oberfläche rechnen, hinter der, abgründig tief und stumm, das innere Erleben ruht, dem sie entstiegen sind. Sie gleichen einer »Haut, welche Etwas verräth, aber noch mehr verbirgt« (Jenseits von Gut und Böse 32); »denn«, sagt er »entweder verstecke man seine Meinungen, oder man verstecke sich hinter seine Meinungen« (Menschliches, Allzumenschliches II 338). Er findet eine schöne Bezeichnung für sich selbst, wenn er in diesem Sinne von den »Verborgenen unter den Mänteln des Lichts« redet (Jenseits von Gut und Böse 44),—von denen, die sich in ihre Gedankenklarheit verhüllen.
In jeder Periode seiner Geistesentwicklung finden wir daher Nietzsche in irgend einer Art und Form der Maskirung, und immer ist sie es, welche die jeweilige Entwicklungsstufe recht eigentlich charakterisirt. »Alles, was tief ist, liebt die Maske.... Jeder tiefe Geist braucht eine Maske: mehr noch, um jeden tiefen Geist wächst fortwährend eine Maske« (Jenseits von Gut und Böse 40).
»Wanderer, wer bist Du?... Ruhe Dich hier aus ... erhole Dich!... Was dient Dir zur Erholung?...« »Zur Erholung? Zur Erholung? Oh du Neugieriger, was sprichst du da! Aber gieb mir, ich bitte....« »Was? Was? sprich es aus!—»Eine Maske mehr! Eine zweite Maske!...« (Jenseits von Gut und Böse 278).
Und zwar wird es sich uns aufdrängen, dass in dem Grade, als seine Selbstvereinsamung und grüblerische Selbstbeziehung auf sich ausschliesslicher wird, auch die Bedeutung der jedesmaligen Verkleidung eine tiefere wird, und das wirkliche Wesen hinter seiner Aeusserungsform, das wirkliche Sein hinter dem vorgehaltenen Schein immer weniger sichtbar zurückweicht. Schon in »Der Wanderer und sein Schatten« (175) weist er auf die »Mediocrität als Maske« hin. »Die Mediocrität ist die glücklichste Maske, die der überlegene Geist tragen kann, weil sie die grosse Menge, das heisst die Mediocren, nicht an Maskirung denken lässt— und doch nimmt er sie gerade ihretwegen vor,—um sie nicht zu reizen, ja nicht selten aus Mitleid und Güte.« Von dieser Maske des Harmlosen an wechselt er sie bis zu der des Grauenhaften, die noch Grauenhafteres hinter sich verbirgt: »—bisweilen ist die Narrheit selbst die Maske für ein unseliges allzu gewisses Wissen.« (Jenseits von Gut und Böse 270),—und endlich bis zu einem täuschenden Lichtbild des göttlich Lachenden, das den Schmerz in Schönheit zu verklären strebt. So ist Nietzsche innerhalb seiner letzten philosophischen Mystik allmälig in jene letzte Einsamkeit versunken, in deren Stille wir ihm nicht mehr folgen können, die uns nur noch, wie Symbole und Wahrzeichen, seine lachenden Gedankenmasken und deren Deutung übrig lässt, während er für uns bereits zu dem geworden ist, als den er sich einmal in einem Briefe unterschreibt: »Der auf ewig Abhandengekommene.« (Brief vom 8. Juli 1881 aus Sils-Maria.)
Dieses innere Alleinsein, diese Einsamkeit ist in allen Wandlungen Nietzsches der unveränderliche Rahmen, aus welchem sein Bild uns anschaut. Mag er sich verkleidet haben, wie er will,—immer trägt er »die Einöde und den heiligen unbetretbaren Grenzbezirk mit sich, wohin er auch gehe«. (Der Wanderer und sein Schatten 387.) Und es drückt daher auch nur das Bedürfniss aus, dass das äussere Dasein seiner einsamen Innerlichkeit entsprechen möge, wenn er einem Freunde schreibt: (Am 31 October 1880 aus Italien.)
»Als Recept, sowie als natürliche Passion erscheint mir immer deutlicher die Einsamkeit und zwar die vollkommene,—und den Zustand, in dem wir unser Bestes schaffen können, muss man hersteilen und viele Opfer dafür bringen können.«
Den zwingenden Anlass aber, sein inneres Alleinsein so vollkommen wie möglich zu einem äusseren zu machen, bot ihm erst sein körperliches Leiden, welches ihn von den Menschen forttrieb und selbst den Verkehr mit einzelnen seiner Freunde,—immer einen seltenen Verkehr zu Zweien,—nur mit grossen Unterbrechungen möglich machte.
Leiden und Einsamkeit,—das sind also die beiden grossen Schicksalszüge in Nietzsches Entwicklungsgeschichte, immer stärker ausgeprägt, je näher man dem Ende kommt. Und sie tragen bis an das Ende jenes wundersame Doppelgesicht, welches sie als ein äusserlich gegebenes Lebenslos, und zugleich als eine rein psychisch bedingte, eine gewollte innere Nothwendigkeit erscheinen lassen. Auch sein physisches Leiden, nicht minder als seine Verborgenheit und Einsamkeit, reflectirte und symbolisirte etwas Tiefinnerliches—und dies so unmittelbar, dass er es auch in seine äussere Schickung aufnahm wie einen ihm zugedachten ernsten Freund und Wegegenossen. So schreibt er einmal bei Gelegenheit einer Beileidsäusserung (Ende August 1881 aus Sils-Maria): »Es jammert mich immer zu hören, dass Sie leiden, dass Ihnen irgend etwas fehlt, dass Sie Jemanden verloren haben: während bei mir Leiden und Entbehrung zur Sache gehören und nicht, wie bei Ihnen, zum Unnöthigen und zur Unvernunft des Daseins.«
Hierauf beziehen sich die einzelnen, in seinen Werken zerstreuten Aphorismen über den Werth des Leidens für die Erkenntniss.
Er schildert den Einfluss der Stimmungen des Kranken und des Genesenden auf das Denken, er begleitet die feinsten Uebergänge solcher Stimmungen bis ins Geistigste hinauf. Eine periodisch wiederkehrende Erkrankung, wie die seinige es war, scheidet beständig eine Lebensperiode, und damit auch eine Gedankenperiode von der vorhergehenden. Sie gibt durch dieses Doppeldasein die Erfahrungen und das Bewusstsein zweier Wesenheiten. Sie lässt alle Dinge immer wieder auch dem Geiste neu werden,—»neu schmecken« nennt er es einmal höchst treffend,—und setzt ganz neue Augen auch noch für das Gewohnteste, Alltäglichste ein. Ein Jegliches erhält etwas von der Frische und dem lichten Thau der Morgenschönheit, weil eine Nacht es vom vorhergehenden Tage getrennt hat. So wird jede Genesung ihm zu einer Palingenesis seiner selbst und darin zugleich des Lebens um ihn,—und immer wieder ist der Schmerz »verschlungen in den Sieg«.
Deutet Nietzsche es schon selbst an, dass die Natur seines physischen Leidens sich gewissermassen in seinen Gedanken und Werken widerspiegle, so springt der enge Zusammenhang von Denken und Leiden noch auffälliger hervor, wenn man sein Schaffen und dessen Entwicklung als Ganzes betrachtet. Man steht nicht jenen allmäligen Veränderungen des Geisteslebens gegenüber, wie sie ein Jeder durchmacht, der seiner natürlichen Grösse entgegenwächst,— nicht den Wandlungen des Wachsthums: sondern einem jähen Wandel und Wechsel, einem fast rhythmischen Auf und Nieder von Geisteszuständen, die letzten Grundes nichts Anderem zu entspringen scheinen, als einem Erkranken an Gedanken und einem Genesen an Gedanken.
Nur aus der innersten Bedürftigkeit seiner ganzen Natur, nur aus dem quälendsten Heilungsverlangen heraus erschliessen sich ihm neue Erkenntnisse. Kaum aber ist er völlig in ihnen aufgegangen, kaum hat er an ihnen ausgeruht und sie seiner eignen Kraft assimilirt,—da ergreift es ihn auch schon wieder wie ein neues Fieber, etwas wie ein unruhig drängender Ueberschuss an innerer Energie, der zuletzt seinen Stachel gegen ihn selbst kehrt und ihn an sich selber erkranken lässt. »Das Zuviel von Kraft erst ist der Beweis der Kraft», sagt Nietzsche im Vorwort zur Götzen-Dämmerung (s. I);—in diesem Zuviel thut seine Kraft sich Schmerzen an, tobt sie sich aus in leidvollen Kämpfen, reizt sich auf zu den Qualen und Erschütterungen, an denen sein Geist fruchtbar werden will.[4] Mit der stolzen Behauptung: »Was mich nicht umbringt, macht mich stärker!« (Götzen-Dämmerung, Sprüche und Pfeile 8) geisselt er sich,—nicht bis zum Umbringen, nicht bis zum Tode, aber eben bis zu jenen Fiebern und Verwundungen, deren er bedarf. Dieses Schmerzheischende zieht sich durch die ganze Entwicklungsgeschichte Nietzsches als die eigentliche Geistesquelle in ihr; er spricht es am treffendsten in den Worten aus: »Geist ist das Leben, das selber ins Leben schneidet: an der eignen Qual mehrt es sich das eigne Wissen,—wusstet ihr das schon? Und des Geistes Glück ist dies: gesalbt zu sein und durch Thränen geweiht zum Opferthier,— wusstet ihr das schon?... Ihr kennt nur des Geistes Funken: aber ihr seht den Amboss nicht, der er ist, und nicht die Grausamkeit seines Hammers!« (Also sprach Zarathustra II 33.) »Jene Spannung der Seele im Unglück,... ihre Schauer im Anblick des grossen Zügrundegehens, ihre Erfindsamkeit und Tapferkeit im Tragen, Ausharren, Ausdeuten, Ausnützen des Unglücks, und was ihr nur je von Tiefe, Geheimniss, Maske, Geist, List, Grösse geschenkt worden ist:—ist es nicht ihr unter Leiden, unter der Zucht des grossen Leidens geschenkt worden?« (Jenseits von Gut und Böse 225.)
Und immer wieder tritt Zweierlei an diesem Vorgang besonders auffällig hervor: Einmal der enge Zusammenhang von Gedankenleben und Seelenleben in seinem Wesen, die Abhängigkeit seines Geistes von den Bedürfnissen und Erregungen seines Innern. Dann aber die Eigenthümlichkeit, dass aus dieser so engen Zusammengehörigkeit sich immer von Neuem Leiden ergeben müssen; jedesmal bedarf es einer höhen Gluth der Seele, wo es zu höchster Klarheit, zu hellem Licht der Erkenntniss kommen soll,—aber nie darf diese Gluth in wohlthuender Wärme ausströmen, sondern muss verwunden mit sengenden Feuern und brennenden Flammen: auch hier gehört,—wie er es in dem oben angeführten Briefe ausdrückt,—»das Leiden zur Sache«.
Wie Nietzsches körperliches Leiden der Anlass zu seiner äusseren Vereinsamung wurde, so muss auch in seinem psychischen Leidenszustand einer der tiefsten Gründe gesucht werden für seinen scharf zugespitzten Individualismus, für die strenge Betonung des »Einzelnen« als des »Einsamen« in Nietzsches besonderem Sinn. Die Geschichte des »Einzelnen« ist durchaus eine Leidensgeschichte und nicht irgend welchem allgemeinen Individualismus zu vergleichen,—ihr Inhalt lautet viel weniger: »Selbstgenügsamkeit« als: »Selbsterduldung«.Betrachtet man das leidensvolle Auf und Nieder seiner Geisteswandlungen, dann liest man die Geschichte eben so vieler Selbstverwundungen, und es verbirgt einen langen, schmerzlichen Heldenkampf mit sich selbst, wenn Nietzsche über seine Philosophie die kühnen Worte setzt: »Dieser Denker braucht Niemanden, der ihn widerlegt: er genügt sich dazu selber!« (Der Wanderer und sein Schatten 249.)
Seine ausserordentliche Fähigkeit, sich immer wieder in die härteste Selbstüberwindung einzuleben, in jeder neuen Erkenntniss immer wieder heimisch zu werden, scheint nur da zu sein, um die Trennung vom Neuerrungenen jedesmal um so erschütternder zu gestalten. »Ich komme! brich Deine Hütte ab und wandre mir entgegen!« gebietet ihm der Geist, und mit trotziger Hand macht er sich selbst obdachlos und sucht von Neuem das Dunkel, das Abenteuer und die Wüste auf mit der Klage auf den Lippen: »Ich muss den Fuss weiter heben, diesen müden, verwundeten Fuss: und weil ich muss, so habe ich oft für das Schönste, das mich nicht halten konnte, einen grimmigen Rückblick,—weil es mich nicht halten konnte!« (Fröhliche Wissenschaft 309.) Sobald ihm in einer Anschauungsweise wahrhaft wohl geworden ist, erfüllt sich an ihm selbst sein Wort: »Wer sein Ideal erreicht, kommt eben damit über dasselbe hinaus.« (Jenseits von Gut und Böse 73.)[5]
Der Meinungswechsel, der Wandlungsdrang stecken daher der Philosophie Nietzsches tief im Herzen, sie sind durchaus bestimmend für die Art seines Erkennens. Nicht umsonst nennt er sich im Schlusslied von »Jenseits von Gut und Böse« einen: »Ringer, der zu oft sich selbst bezwungen,—Zu oft sich gegen eigne Kraft gestemmt.... Durch eignen Sieg verwundet und gehemmt.«
Im Heroismus der Bereitwilligkeit, die eigne Ueberzeugung preiszugeben, nimmt dieser Drang in seinem Innern geradezu die Stelle der Ueberzeugungstreue[6] ein. »Wir würden uns für unsere Meinungen nicht verbrennen lassen:« heisst es in Der Wanderer und sein Schatten (333), »wir sind ihrer nicht so sicher. Aber vielleicht dafür, dass wir unsere Meinungen haben dürfen und ändern dürfen.« Und in der Morgenröthe (370) spricht sich diese Gesinnung in den schönen Worten aus: »Nie etwas zurückhalten oder Dir verschweigen, was gegen Deinen Gedanken gedacht werden kann. Gelobe es Dir! Es gehört zur ersten Redlichkeit des Denkens. Du musst jeden Tag auch Deinen Feldzug gegen Dich selber führen. Ein Sieg und eine eroberte Schanze sind nicht mehr Deine Angelegenheit, sondern die der Wahrheit,—aber auch Deine Niederlage ist nicht mehr Deine Angelegenheit!« Darüber steht als Titel: »Inwiefern der Denker seinen Feind liebt.« Aber diese Feindesliebe entspringt der dunklen Ahnung, dass im Feind ein künftiger Genosse verborgen sein könne, und dass nur des Unterliegenden neue Siege harren: sie entspringt der Ahnung, dass für ihn der stets gleiche, schmerzliche Seelenprocess der Selbstverwandlung unumgängliche Bedingung aller Schaffenskraft sei. »Der Geist ist es, der uns rettet, dass wir nicht ganz verglühen und verkohlen.... Vom Feuer erlöst, schreiten wir dann, durch den Geist getrieben, von Meinung zu Meinung,... als edle Verräther aller Dinge.« (Menschliches, Allzumenschliches, I 637.) »—wir müssen Verräther werden, Untreue üben, unsere Ideale immer wieder preisgeben. (Menschliches, Allzumenschliches, I 629.) Dieser Einsame musste gleichsam sich selber vervielfältigen, in eine Mehrheit von Denkern zerfallen, in dem Masse, als er sich in sich selber abschloss;—nur so vermochte er geistig zu leben. Der Selbstverwundungstrieb war nur eine Art seines Selbsterhaltungstriebes: nur indem er sich immer wieder in Leiden stürzte, entlief er seinen Leiden. »Unverwundbar bin ich allein an meiner Ferse!... Und nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen!... Also sang Zarathustra;« (II 46).—Er, zu dem das Leben einst »dies Geheimniss redete«: »Siehe, sprach es, ich bin das, was sich immer selber überwinden muss« (II 49).[7]
Ueber nichts hat wohl Nietzsche so oft und so tief nachgedacht, wie über dieses sein eignes Wesensräthsel, und über nichts können wir uns daher aus seinen Werken so gut unterrichten wie gerade hierüber: im Grunde waren ihm alle seine Erkenntnissräthsel nichts anderes. Je tiefer er sich selbst erkannte, desto rückhaltsloser wurde seine ganze Philosophie zu einer ungeheuren Widerspiegelung seines Selbstbildes,—und desto naiver legte er es dem Allbilde als solchem unter. Wie unter den Philosophen abstracte Systematiker ihre eignen Begriffe zu einer Weltgesetzlichkeit verallgemeinert haben, so verallgemeinert Nietzsche seine Seele zur Weltseele. Aber um sein Bild zu zeichnen, bedarf es nicht erst der Zurückführung seiner sämmtlichen Theorien auf ihn selbst, wie es in den folgenden Theilen geschieht. Ein gewisses Verständniss dafür ist auch schon hier möglich, wo Nietzsche lediglich in Bezug auf seine geistige Veranlagung betrachtet wird, Der Reichthum derselben ist zu mannigfaltig, als dass er in einer bestimmten Ordnung erhalten werden könnte; die Lebendigkeit und der Machtwillen jedes einzelnen Talentes und Geistestriebes führen nothwendig zu einer nie beschwichtigten Nebenbuhlerschaft aller Talente. In Nietzsche lebten in stetem Unfrieden, nebeneinander und sich gegenseitig tyrannisirend, ein Musiker von hoher Begabung, ein Denker von freigeisterischer Richtung, ein religiöses Genie und ein geborener Dichter. Nietzsche selbst versuchte, daraus die Besonderheit seiner geistigen Individualität zu erklären, und erging sich häufig in eingehenden Gesprächen darüber.