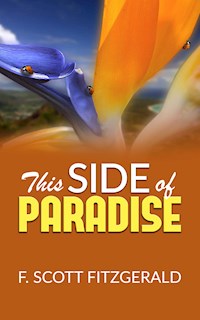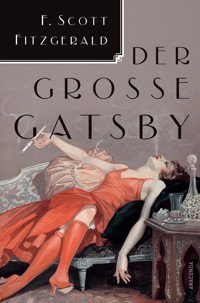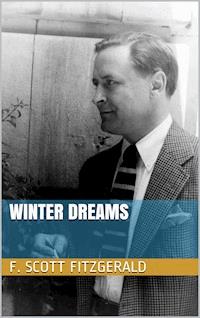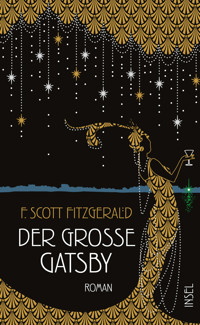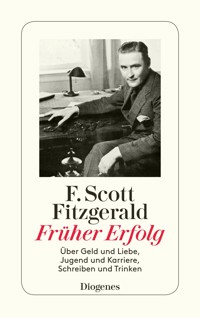
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor des ›Großen Gatsby‹ über sich und andere: über seine Erfolge und Miseren, über das Leben mit Zelda und über Schriftstellerfreunde wie Ernest Hemingway. Fünfundzwanzig mal launige, mal schwermütige Betrachtungen, die Fitzgerald selbst als »ungemein persönlich« bezeichnete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
F. Scott Fitzgerald
Früher Erfolg
EssaysÜber Geld und Liebe,Jugend und Karriere,Schreiben und Trinken
Aus dem Amerikanischen vonMelanie Walz,Bettina Abarbanell undRenate Orth-Guttmann
Titel der 2005 bei Cambridge University Press, Cambridge, erschienenen Originalausgabe: ›My Lost City‹
Copyright © 2005 by Eleanor Lanahan, Thomas P. Roche, Jr., and Charles Byrne
Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 im Diogenes Verlag
Covermotiv: F. Scott Fitzgerald am Schreibtisch
Copyright © The Arthur Mizener Collection
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2017
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24408 3
ISBN E-Book 978 3 257 60198 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
Wer es zu etwas bringt – und warum [7]
Princeton [13]
Was ich mit fünfundzwanzig denke und fühle [31]
Wie man 36000Dollar im Jahr verprassen kann [49]
Wie man mit fast nichts über die Runden kommt [71]
Phantasie – und verschiedene Mütter [101]
»Warten Sie nur, bis Sie Kinder haben!« [115]
Wie man Stoff vergeudet – Eine Notiz über meine Generation [133]
Hundert Fehlstarts [143]
Ring [159]
Eine kurze Autobiographie (Mit Dank an Nathan) [169]
Mädchen glauben an Mädchen [173]
Meine verlorene Stadt [183]
»Bringen Sie Mr.und Mrs.F. zu Nummer ***« [201]
Echos des Jazz Age [225]
Der Zusammenbruch [241]
Das Zusammenflicken [251]
Vorsicht, zerbrechlich [261]
* * *
[6] Auktion im Stil von 1934 [269]
Schlafen und Wachen [281]
Das Haus des Schriftstellers [291]
Nachmittag eines Schriftstellers [303]
Die Mutter eines Schriftstellers [313]
Früher Erfolg [319]
Meine Generation [331]
Anmerkungen [343]
[7] Wer es zu etwas bringt – und warum
Die Geschichte meines Lebens ist die Geschichte des Widerstreits zwischen einem überwältigenden Drang zu schreiben und einer Verkettung von Umständen, die dem entgegenwirken.
Als ich in St.Paul wohnte und etwa zwölf Jahre alt war, schrieb ich den ganzen Schulunterricht hindurch hinten in mein Erdkundebuch und in meine Lateinfibel und auf die Seitenränder von Aufsätzen und Deklinationstabellen und Mathematikaufgaben. Zwei Jahre später entschied ein Familienrat, der einzige Weg, mich zum Lernen zu zwingen, bestehe darin, mich in ein Internat zu stecken. Das war ein Fehler. Es lenkte mich von meinem Schreiben ab. Ich beschloss, Football zu spielen, zu rauchen, aufs College zu gehen, alles mögliche Nebensächliche zu tun, das nichts mit dem zu tun hatte, worauf es wirklich ankam, nämlich der richtigen Mischung von Beschreibung und Dialogen in der Short Story.
In der Schule schlug ich jedoch einen neuen Kurs ein. Ich sah ein Musical mit dem Titel The Quaker Girl, und von jenem Tag an bog sich mein Schreibtisch unter Gilbert-&-Sullivan-Libretti und Dutzenden von Arbeitsheften mit Keimen für Dutzende von Musicals.
Gegen Ende meines letzten Schuljahrs sah ich zufällig [8] eine neue Musical-Partitur auf dem Klavier liegen. Es war ein Stück namens His Honor the Sultan, und der Titelseite war zu entnehmen, dass es vom Triangle Club der Universität Princeton aufgeführt worden war.
Das genügte. Von da an war die Wahl der Universität keine Frage mehr. Princeton war mein Ziel.
Ich verbrachte mein ganzes erstes Studienjahr damit, eine Operette für den Triangle Club zu schreiben. Um das zu tun, fiel ich in Algebra durch, in Trigonometrie, in analytischer Geometrie und in Hygiene. Aber der Triangle Club nahm mein Stück an, und mittels Nachhilfe einen stickigen August hindurch gelang es mir, in das zweite Jahr vorzurücken und als Ensembletänzerin in meinem Musical mitzuspielen. Kurz danach kam es zu einer Unterbrechung. Ich erkrankte schwer, verließ eines Dezembers das College und verbrachte den Rest des Jahres im Westen, um mich zu erholen. Ich erinnere mich, wie ich kurz vor meiner Abreise mit hohem Fieber auf der Krankenstation lag und einen letzten Songtext über die Triangle-Aufführung jenes Jahres verfasste.
Zu Beginn des nächsten Jahres – 1916–17 – war ich wieder am College, doch inzwischen vertrat ich die Ansicht, Lyrik sei das einzig Wahre, und während in meinem Kopf Algernon Swinburnes Versformen und Rupert Brookes Versinhalte klingelten, verbrachte ich das Frühjahr mit dem frühmorgendlichen Verfertigen von Sonetten, Balladen und Rondeaus. Irgendwo hatte ich gelesen, jeder bedeutende Dichter habe vor dem Erreichen des einundzwanzigsten Lebensjahrs bedeutende Gedichte geschrieben. Ich hatte nur noch ein Jahr Zeit, und außerdem stand der Krieg [9] vor der Tür. Ich musste ein Buch mit aufsehenerregenden Dichtungen veröffentlichen, bevor ich im Mahlstrom verschwand.
Im Herbst befand ich mich in einem Infanterieoffiziersausbildungslager in Fort Leavenworth, mit der Lyrik in der Schublade und einem nagelneuen ehrgeizigen Vorhaben im Sinn: Ich wollte einen unsterblichen Roman schreiben. Jeden Abend, den Notizblock hinter dem Ratgeber für Infanteristen versteckt, schrieb ich Absatz um Absatz einer leicht geschönten Geschichte, die mich und meine Phantasie zum Inhalt hatte. Der Entwurf für zweiundzwanzig Kapitel, vier davon in Versform, war fertig; zwei Kapitel waren abgeschlossen – da wurde ich erwischt, und das Spiel war vorbei. Ich konnte während des Unterrichts nicht mehr schreiben.
Das war eine merkliche Erschwernis. Mir blieben nur noch drei Monate Lebenszeit – in jenen Tagen waren alle Infanterieoffiziere überzeugt, dass ihnen nur noch drei Monate Lebenszeit blieben –, und ich hatte der Welt noch keinen Stempel aufgeprägt. Aber ein so verzehrender Ehrgeiz war durch einen bloßen Krieg nicht zu bändigen. Jeden Samstag um ein Uhr nachmittags, wenn die Arbeitswoche vorbei war, flitzte ich in den Offiziersclub, wo ich drei Monate lang jedes Wochenende in der Ecke eines Zimmers inmitten von Zigarettenqualm, Unterhaltungsfetzen und Zeitungsgeraschel an einem Roman von einhundertzwanzigtausend Wörtern schrieb. Überarbeitet habe ich ihn nicht; dafür hatte ich keine Zeit. Jedes Kapitel, das ich beendete, schickte ich einer Schreibkraft in Princeton zum Abtippen.
[10] In jener Zeit waren die bleistiftverschmierten Blätter mein ganzes Leben. Der Drill, das Exerzieren und der Ratgeber fürInfanteristen waren nichts weiter als ein schemenhafter Traum. Mit dem Herzen war ich ganz und gar bei meinem Buch.
Schließlich begab ich mich glücklich zu meinem Regiment – ich hatte einen Roman geschrieben. Jetzt konnte der Krieg weitergehen. Ich vergaß Absätze und Anapäste, Synonyme und Syllogismen. Ich wurde zum Oberleutnant befördert, wurde für den Einsatz in Übersee eingeteilt – und dann schrieb mir ein Lektor, The Romantic Egotist sei zwar das originellste Manuskript, das seit Jahren eingereicht worden war, doch er könne es nicht veröffentlichen. Es sei inhaltlich zu vage und führe nirgendwo hin.
Sechs Monate später kam ich in New York an und überreichte meine Visitenkarte den Büroboten von sieben Zeitungsredakteuren mit dem Begehr, bei ihnen als Reporter genommen zu werden. Ich war gerade zweiundzwanzig geworden, der Krieg war zu Ende, und ich wollte tagsüber Mördern nachspüren und nachts Short Stories schreiben. Aber bei den Zeitungen konnte mich niemand brauchen. Sie schickten ihre Büroboten vor, die mir sagten, dass sie mich nicht brauchen konnten. Der Anblick meines Namens auf einer Visitenkarte löste in ihnen die definitive und unverrückbare Gewissheit aus, dass ich mich nie und nimmer zum Reporter eignen würde.
Stattdessen wurde ich Reklameschreiber für neunzig Dollar im Monat und verfasste die Reklamesprüchlein, die Kurzweil in die öden Stunden in ländlichen Bussen [11] bringen. Nach der Arbeit schrieb ich Geschichten – von März bis Juni. Es waren insgesamt neunzehn; eine davon hatte ich innerhalb von nur anderthalb Stunden geschrieben, für eine andere drei lange Tage gebraucht. Niemand wollte sie haben, niemand schickte mir auch nur einen persönlichen Brief. Ich hatte einhundertzweiundzwanzig Absagen als Fries an meine Zimmerwände geheftet. Ich schrieb Filmdrehbücher. Ich schrieb Songtexte. Ich schrieb komplizierte Reklameentwürfe. Ich schrieb Gedichte. Ich schrieb Sketche. Ich schrieb Witze. Ende Juni verkaufte ich eine Erzählung für dreißig Dollar.
Am Nationalfeiertag ging ich zurück nach Hause, nach St.Paul, zutiefst angewidert von mir selbst und von allen Lektoren, Redakteuren und Herausgebern, und teilte meiner Familie und meinen Freunden mit, dass ich meine Stelle aufgegeben hatte und nach Hause gekommen war, um einen Roman zu schreiben. Sie nickten höflich, wechselten das Thema und sprachen sehr freundlich über mich. Doch dieses Mal wusste ich, was ich tat. Endlich war mir klar, welchen Roman ich schreiben wollte, und zwei heiße Monate hindurch schrieb und überarbeitete, ergänzte und kürzte ich. Am fünfzehnten September wurde die Eilzustellung von Diesseits vom Paradies vom Verlag entgegen- und angenommen.
In den nächsten zwei Monaten schrieb ich acht Erzählungen und verkaufte neun. Die neunte wurde von derselben Zeitschrift gekauft, die sie vier Monate zuvor abgelehnt hatte. Und im November verkaufte ich meine erste Erzählung an die Redaktion der Saturday Evening Post. Bis zum Februar hatte ich ihnen ein halbes Dutzend [12] verkauft. Dann erschien mein Roman. Dann habe ich geheiratet. Und nun wundere ich mich, wie das alles passiert ist.
In den Worten des unsterblichen Julius Cäsar: »Das ist alles; mehr gibt es nicht.«
[13] Princeton
In der Schule und bis zur Mitte meines ersten Collegejahrs machte mir zu schaffen, dass ich nicht nach Yale gehen würde und nicht nach Yale gegangen war. Ließ ich mir eines der großen amerikanischen Geheimnisse entgehen? Über Yale lag ein Glanz, der Princeton fehlte; Princetons Flanellhosen waren über eine Woche nicht gebügelt worden, sein Haar war immer ein wenig windzerzaust. Nichts in Princeton kam an die Perfektion heran, mit der in Yale der Abschlussball der jüngeren Semester oder die Wahlen in die Verbindungen der Älteren durchgeführt wurden. Vom dilettantischen Gezänk bei den Clubwahlen, deren Snobismus Narben und jugendliches Herzeleid hinterließ, bis zum Rätsel am Ende des letzten Studienjahrs, dem Rätsel, was Princeton eigentlich war und wofür es stand, von Plattitüden und Phrasen einmal abgesehen, präsentierte es sich nie mit dem harten, klaren, faszinierenden Leuchten Yales. Nur wenn man sich einen Teil der eigenen Vergangenheit aus dem Herzen reißen will, wie ich es einmal versucht habe, wird man sich der Macht dieser Vergangenheit bewusst, tiefe und unverwüstliche Liebe zu wecken.
Princeton-Absolventen nehmen Princeton als selbstverständlich hin und sind für Analysen nicht zu haben. [14] Schon 1899 wurde Jesse Lynch Williams mit dem Bannstrahl belegt, weil er berichtet hatte, der Wein von Princeton vergolde die Minuten. Hätte der Princetonianer beständig versichern wollen, sein College sei die wahre Krönung amerikanischer Demokratie und sei selbstverständlich und inbrünstig Amerikas Maßstab für Benimm und Erfolg, hätte er in Yale studiert. Sein Bruder und viele seiner Mitschüler haben dort studiert. Er hingegen entscheidet sich für Princeton, weil die Furien, die auf die amerikanische Jugend einpeitschen, für den Geschmack des Siebzehnjährigen etwas zu aufdringlich wurden. Er wünscht sich etwas Ruhigeres, Milderes, weniger Überwältigenderes. Er sieht sich in einem zügellosen Wettbewerb gefangen, der ihn Hals über Kopf nach New Haven bringen und ihn restlos verwirrt in die Welt hinausbefördern wird. Die vielen Auszeichnungen, die dem Gewinner jedes Rennens winken, sind zweifellos verlockend, aber er wünscht sich den Genuss friedlicher Weiden und eine Ruhepause, in der er tief durchatmen und nachdenken kann, bevor er sich in den lärmenden Kampf des amerikanischen Lebens begibt. In Princeton trifft er auf andere seines Schlages, und so kommt es zu Princetons spöttischer und leicht ironischer Haltung gegenüber Yale.
Harvard existiert für Princeton nicht einmal als Vorstellung. Harvard-Leute waren immer »Bostoner mit affektiertem Akzent« oder »dieser Isaacs, der das Hochschulstipendium zu Hause bekommen hat«. Lee Higginson & Company mietete die Sportler für sie an, aber wie viel man auch für Harvard tat, konnte man weder zu Fly noch zu Porcellian gehören, ohne Groton oder St. Mark’s [15] besucht zu haben. Solche Vorstellungen waren befriedigend, wenn auch unzutreffend, denn Cambridge war in mehr als nur einer Hinsicht meilenweit entfernt. Harvard bedeutete sporadische Beziehungen, manchmal erfreulich, manchmal feindselig – mehr nicht.
Princeton liegt mitten im flachen Land New Jerseys, wo es sich als grüner Phönix aus einer denkbar hässlichen Landschaft erhebt. Das trostlose Trenton schwitzt und schwärt ein paar Meilen weiter südlich; im Norden sind Elizabeth und die Erie-Eisenbahn und die Vorortslums von New York; im Westen erstreckt sich der öde Oberlauf des Delaware River. Doch rings um Princeton liegt wie ein Schutzwall ein Ring der Stille – staatlich anerkannte Molkereien, große Ländereien mit Pfauen und Wildgehegen, hübsche Bauerngehöfte und Wälder, die wir im Frühjahr 1917 als Vorbereitung auf den Krieg abschritten und kartierten. Der geschäftige Osten ist bereits abgeschüttelt, wenn der Zug vom Knotenpunkt mit vertrautem Rattern auf die Nebenstrecke abzweigt. Zwei hohe Kirchtürme, und dann breitet sich um einen herum mit einem Mal die bezauberndste Ansammlung neugotischer Architektur in Amerika aus, Brustwehr reiht sich an Brustwehr, Herrenhaus an Herrenhaus, durchbrochen von Bögen und berankt – üppig und lieblich auf zwei Quadratmeilen grünen Rasens. Keinerlei Eintönigkeit, nicht die Spur des Eindrucks, all das wäre gestern erst als Laune des neuesten neureichen Millionärs erbaut worden; Nassau Hall war bereits zwanzig Jahre alt, als hessische Kugeln seine Mauern durchbohrten.
Alfred Noyes hat Princeton mit Oxford verglichen. Für [16] mich unterscheiden die beiden sich deutlich. Princeton ist magerer und frischer, sowohl weniger tiefgründig als auch flüchtiger. All seiner Vergangenheit zum Trotz erhebt Nassau Hall sich hohl und leer, nicht wie eine Mutter, die Söhne geboren hat und die Spuren ihrer Geburtsmühen trägt, sondern wie eine geduldige alte Amme, misstrauisch und liebevoll im Umgang mit den Pflegekindern, die als Amerikaner an keinen Ort unter der Sonne gehören.
In meinen romantischen Tagen habe ich versucht, das Princeton Aaron Burrs, Philip Freneaus, James Madisons und Light-Horse Harry Lees heraufzubeschwören, gewissermaßen Anschluss an das achtzehnte Jahrhundert zu finden, an die Menschheitsgeschichte. Doch die Kette riss beim Bürgerkrieg, der wie immer das gerissene Glied in der Kontinuität amerikanischen Lebens war. Das Princeton der Kolonialzeit war letzten Endes eine kleine konfessionelle Hochschule. Das Princeton, das ich gekannt und zu dem ich gehört habe, erhob sich in den siebziger Jahren aus Rektor McCoshs großem Schatten, wuchs zusammen mit den großen Nachkriegsvermögen in New York und Philadelphia und umfasste zuletzt Nachhilfepartys und Bierpartys und das spätere Gewissen Amerikas und Booth Tarkingtons Triangle Club und Wilsons klösterliche Pläne für ein Utopia der Bildung. Und an irgendeiner Stelle war damit der Aufstieg des American Football verbunden.
Denn Football wurde damals in den neunziger Jahren in Princeton wie in Yale fast zu einem Symbol. Und wofür stand dieses Symbol? Für die ewige Gewalttätigkeit des amerikanischen Lebens? Für die ewige Unreife des [17] amerikanischen Volkes? Für das Scheitern einer Kultur innerhalb der eigenen vier Wände? Wer weiß. Football war zuerst etwas Befriedigendes und dann etwas Notwendiges und Schönes. Lange bevor die unersättlichen Millionen ihn wie Gertrude Ederle und Mrs.Snyder ins Herz schlossen, wurde er zum eindringlichsten und dramatischsten Schauspiel seit den Olympischen Spielen. Johnny Poes Tod im Black-Watch-Regiment in Flandern bringt für mich die Zimbeln zum Erklingen und zupft an den Saiten nervöser Violinen, wie es kein geistiges Abenteuer in Princeton je vermochte. Vor einem Jahr kam ich auf den Champs-Élysées an einem schlanken, dunkelhaarigen jungen Mann vorbei, der einen für ihn charakteristischen trägen Gang hatte. Ich drehte mich um und sah ihm nach. Es war der romantische Buzz Law, den ich zuletzt im Dämmerlicht eines kalten Herbstes im Jahr 1913 gesehen hatte, als er mit einem blutigen Kopfverband den Ball hinter der Endlinie nach vorn kickte.
Neben der Schönheit seiner Türme und der Dramatik seiner Spielfelder zeichnet sich Princeton durch eine dritte weithin bekannte Besonderheit aus: seine »Klientel«.
Einen Großteil der Jeunesse dorée, die bereit ist, sich Bildung einflößen zu lassen, treibt es nach Princeton. Goulds, Rockefellers, McCormicks, Wannamakers, Cudahys und DuPonts lassen sich dort für eine Saison nieder, mehr oder weniger wohlgelitten. Verführerisch klingen die Namen Pell, Biddle, Van Rensselaer, Stuyvesant, Schuyler und Cooke in den Ohren der nachfolgenden Mamas und Papas mit gesellschaftlichen Ambitionen in Philadelphia oder New York. Ein durchschnittliches Semester [18] setzt sich aus drei Dutzend Absolventen solcher vergoldender Institute wie St.Paul’s, St.Mark’s, St. George’s, Pomfret und Groton zusammen, dazu einhundertfünfzig Abgänger von Lawrenceville, Hotchkiss, Exeter, Andover und Hill und vielleicht weiteren zweihundert Eleven weniger bekannter Internate. Die restlichen zwanzig Prozent kommen von den Highschools, und aus diesem Kontingent bezieht Princeton den größten Teil seiner späteren Führungskräfte. Für diese Studenten war es sowohl finanziell als auch intellektuell eine größere Leistung, den Weg nach Princeton zu finden. Sie sind durchtrainiert und kampfbereit.
Zu meiner Zeit, vor einem Jahrzehnt, waren die Prüfungen im Winter des ersten Studienjahrs ein gewaltiges Aussieben. Schwächere Athleten, reiche Söhne, die geistig schwerfälliger waren als ihre Vorfahren, fielen scharenweise am Wegesrand. Oft waren sie im Alter von zwanzig oder einundzwanzig Jahren und mit Hilfe spezieller Vorbereitungsschulen bis zu den Pforten der Universität gelangt und mussten dann feststellen, dass schon die erste Prüfung zu schwer war. Diese frühen Ausfälle waren meistens fünfzig oder sechzig nette Leute, und man sah sie ungern scheiden.
Heutzutage kommen nur sehr wenige Exemplare dieser Spezies nach Princeton. Unter den neuen Zulassungsbestimmungen sind ihre ersten universitären Verrenkungen und Pleiten so verräterisch, dass sie umgehend davon informiert werden, Princeton sei nur für jene bestimmt, deren Gehirn das durchschnittliche Gewicht erreicht. Der Grund dafür ist, dass es vor einigen Jahren erforderlich [19] wurde, eine Zugangsbeschränkung auszusprechen. Der kriegsbedingte Wohlstand ermöglichte vielen Jungen den Besuch eines Colleges, und im Jahr 1921 überstieg die Zahl der Anwärter, die das Minimum an Voraussetzungen für Princeton erfüllten, die Kapazitäten der Universität bei weitem.
Und deshalb muss der Anwärter neben seinen Prüfungsergebnissen vom College auch seine Schulakte vorlegen, ein Empfehlungsschreiben seiner Hochschule und von zwei Princeton-Absolventen, und er muss sich einem psychologischen Intelligenztest unterziehen. Etwa sechshundert Kandidaten, die unter diesen Voraussetzungen den günstigsten Eindruck auf das Aufnahmekomitee machen, werden zugelassen. Jemand, der auf einem akademischen Gebiet völlig versagt, kann im Einzelfall einen anderen übertrumpfen, der alles bestanden hat. Ein junger Mann mit guten Noten in Naturwissenschaften und Mathematik und einer schlechten Note in Englisch wird eher aufgenommen als einer mit durchschnittlich guter Allgemeinbildung, aber ohne besondere Begabung. Dieses Vorgehen hat das Niveau der Gelehrsamkeit erhöht und hat Männer wie A. ferngehalten, die zu meiner Zeit in vier verschiedenen Seminaren als dauerhafte Beleidigung der Intelligenz auftauchten.
Ob das sprichwörtlich engstirnige Urteilsvermögen der Schulleiter über Heranwachsende ausreichen wird, die Goldsmiths, die Byrons, die Whitmans und die O’Neills fernzuhalten, dies zu beurteilen ist es noch zu früh.
Ich ertappe mich bei der Hoffnung, dass einige verrufene Existenzen sich einschmuggeln werden, um das Salz [20] der Erde zu salzen. Dünkel macht Princeton keine Ehre. Zu meiner Zeit verkörperte so etwas der Polity Club. Das war eine Gruppe, die sich alle vierzehn Tage feierlich zu Füßen eines Mr. Schwab oder Judge Gary oder eines anderen hochmögenden Gönners der Universität versammelte, die für den Anlass angekarrt wurden. Hätten diese wortgewaltigen Plutokraten Kniffe ihres Gewerbes verraten oder wenigstens den Schlüssel zu zynisch-forschem Geschäftssinn, dann hätte die Peinlichkeit sich noch in Grenzen gehalten, doch sie speisten den Polity Club mit dem aufgewärmten seichten Gefasel über die Werkzeitschrift und die paradiesischen Produktionsbedingungen ab, angereichert mit ein paar Brocken über »künftige Führer der Menschheit«. Wenn ich in einer Ausgabe des letzten Jahrbuchs blättere, finde ich keinen Polity Club mehr. Vielleicht widmet er sich inzwischen würdigeren Anliegen.
Rektor Hibben ist eine Mischung aus »Normalheit« und Scharfsinn, aus sturem Festhalten am Status quo und einer bemerkenswerten Toleranz, die fast an intellektuelle Neugier heranreicht. Ich habe ihn schon eine Sprechblasenrede voll rhetorischer Klischees der ärgsten Dürftigkeit halten hören, aber ich habe noch nie erlebt, dass er innerhalb Princetons schäbig, engstirnig oder kurzsichtig gehandelt hätte. Als Reaktion auf den Idealismus Wilsons wurde Hibben 1912 zum Thronerben, und ich glaube, dass er seitdem seinen Horizont ganz nebenbei verblüffend erweitert hat. Er befand sich in einer nicht unähnlichen Situation wie Harding zehn Jahre später, doch indem er Leute wie Gauss, Heermance und Alexander Smith [21] gewinnen konnte, zeigte er Tatkraft und leitete die Universität auf fortschrittliche und oft genug sogar herausragende Weise.
Unter ihm erblüht eine vorzügliche Philosophische Fakultät, eine herausragende Fakultät der Altphilologie, betreut von dem verehrungswürdigen Dekan West, eine Naturwissenschaftliche Fakultät, der Namen wie Oswald Veblen und Conklin Glanz verleihen, und eine überraschend blasse Fakultät des Englischen, kopflastig, öde und mit einem geradezu erschreckenden Händchen dafür, jungen Männern jede Freude an der Literatur auszutreiben. Dr.Spaeth war eine der wenigen Ausnahmen; in seinen vormittäglichen und nachmittäglichen Kursen vermochte er Interesse an den romantischen Dichtern und sogar Begeisterung für sie zu wecken – ein Interesse, das später in den Vorlesungen wieder abgetötet wurde, in denen lauwarm poetisch gestimmte Gentlemen sich gegen jede temperamentvolle Äußerung verwahrten und die Studenten aus besseren Kreisen beim Vornamen nannten.
Das Nassau Literary Magazine ist die älteste Zeitschrift an einem amerikanischen College. In ihren Annalen findet man die erste Craig-Kennedy-Geschichte ebenso wie Prosa oder Poesie aus der Feder Woodrow Wilsons, John Grier Hibbens, Henry van Dykes, David Graham Phillips’, Stephen French Whitmans, Booth Tarkingtons, Struthers Burts oder Jesse Lynch Williams’ – kurz, von fast jedem Schriftsteller, der in Princeton studiert hat, bis auf Eugene O’Neill. Princeton hatte das Pech, dass O’Neill seine studentische Laufbahn auf eigenes Verlangen drei Jahre zu früh beendete. Die Tageszeitung The [22] Princetonian ist nicht weiter bemerkenswert, obwohl sie bisweilen tatsächlich zusammenhängende Gedanken zu verfolgen imstande ist, insbesondere unter der Leitung von James Bruce, Forrestal und John Martin, mittlerweile Mitarbeiter der Times. Die satirische Zeitschrift Tiger kann im Allgemeinen ihren Konkurrenten Lampoon,Record oder Widow nicht das Wasser reichen. Wenn es knapp wurde mit dem Drucktermin, verfassten John Biggs und ich ganze Nummern zwischen Abenddämmerung und Morgenröte.
Der Triangle Club (Theater, Gesang und Tanz) ist Princetons typischste Erscheinung. Von Booth Tarkington anlässlich der Aufführung seines Librettos The Honorable Julius Caesar gegründet, erblüht er seither jedes Jahr zur Weihnachtszeit in einem Dutzend Städte. Alles in allem ist er eine bemerkenswerte Einrichtung, und unter den Fittichen Donald Clive Stuarts hat er sich im Unterschied zu dem Mask and Wig Club der Pennsylvania University zu einer völlig universitätsinternen Sache entwickelt. Seine größten Erfolge feierte er mit so begabten Stegreifkomikern unter den Studenten wie Tarkington, Roy Durstine, Walker Ellis, Ken Clark und Erdman Harris. Zu meiner Zeit war sein Ruf etwas zweifelhaft, aber angesäuselte Komiker oder »Nachtproben« gibt es schon lange nicht mehr. Mittlerweile tummelt sich darin eine zunehmende Zahl von Jazzvirtuosen, und die Nachfrage nach Rollen in den Stücken und im Tanzensemble beweist seine Beliebtheit und seine Ausstrahlung.
Princetons geheiligte Tradition ist der Ehrenkodex, eine Art Selbstverpflichtung, die zur Verblüffung [23] Außenstehender tatsächlich funktioniert und Misstrauen und Überwachung überflüssig macht. Die Studienanfänger werden innerhalb der ersten Woche mit diesem moralischen Gesetz vertraut gemacht. Ich persönlich habe nie erlebt, dass ein Princetonianer in einer Prüfung betrogen hätte, obwohl ich gehört habe, die wenigen Fälle seien erbarmungslos und ohne viel Federlesens erledigt worden. Ich entsinne mich so mancher Gelegenheit, wenn der Blick auf eine Seite voller Notizen in der Toilette für mich den Unterschied zwischen Scheitern und Erfolg ausgemacht hätte, doch ich kann mich keines moralischen Zauderns entsinnen. So etwas zu tun war undenkbar, genauso undenkbar, wie die Brieftasche des Zimmergenossen zu plündern. Vielleicht war das, was einem an der unerfreulichen Ausgabe des Lampoon vom vergangenen Herbst am meisten unter die Haut ging, der Spott und die gehässigen Anspielungen auf den Ehrenkodex.
Keine Erstsemester dürfen sich auf der Prospect Street blicken lassen, wo sich die achtzehn Clubs befinden, in denen die älteren Studenten verkehren. Ich habe das erste Mal vor fast zwanzig Jahren in einem Artikel in Collier’s von ihnen gelesen, er muss von Owen Johnson gewesen sein. Bilder vom Ivy, Cottage, Tiger Inn und Cap and Gown lachten mich von der Zeitungsseite an, nicht etwa wie Grabmäler von Raubrittern am Rhein, sondern eher wie friedliche und achtbare Zufluchtsorte, an denen jüngere und ältere Semester dreimal täglich in mehr oder weniger privater Atmosphäre speisen konnten. Später bedeutete Prospect Street für mich das Licht der Fackeln bei der Parade der Erstsemester, deren unsteter Schein auf die [24] ehrfurchtgebietenden Fassaden der Häuser fiel, und die weißen Hemdbrüste der älteren Studenten und das Funkeln in den Champagnerkelchen, die erhoben wurden, um auf die Mitglieder meines Jahrgangs anzustoßen, die sich bereits hervorgetan hatten.
In Princeton gibt es keine studentischen Verbindungen; gegen Ende jedes Jahres nehmen die achtzehn Clubs jeweils an die fünfundzwanzig Neulinge auf, etwa drei Viertel eines Jahrgangs. Das übrige Viertel isst weiterhin in den Speisesälen der Universität, und dieser Sachverhalt hat schon Revolutionen ausgelöst, war Anlass für Proteste und Eingaben und für zahllose Leitartikel im Alumni Weekly. Aber die Clubs stehen für eine Investition von zwei Millionen Dollar der Alumni, und die Clubs bleiben bestehen.
Der Ivy Club wurde 1879 gegründet, und in vier von fünf Jahren ist er der gesuchteste Club von Princeton. Sein Ansehen ist so überwältigend, dass er zwanzig Studenten eine Mitgliedschaft antragen könnte, und fünfzehn würden zusagen. Nicht selten kommt es dabei aber auch zu Katastrophen. Cottage, Tiger Inn und Cap and Gown – drei Clubs, die zusammen mit Ivy lange als die »großen Clubs« bekannt waren – nehmen zehn oder fünfzehn der Jungstudenten auf, die Ivy gern hätte, und für Ivy bleiben ein Gerippe von einem Dutzend Studenten und ein Gefühl beträchtlicher Bitterkeit gegenüber den erfolgreicheren Rivalen. Der University College Club, gefürchtet und in politischer Hinsicht verhasst, hat solche Fischzüge wiederholt erfolgreich unternommen. Cottage Club, der architektonisch eindrucksvollste aller Clubs, wurde 1886 [25] gegründet. Seine Anhänger stammen vorwiegend aus den Südstaaten, vor allem aus St.Louis und Baltimore. Im Unterschied zu diesen Clubs befleißigt sich Tiger Inn einer unverblümten Schlichtheit. Die Mitglieder sind hauptsächlich solche, die sich sportlich auszeichnen, und obwohl man so tut, als gäbe man nichts auf Herkunft und Ansehen, hat der Club strenge Auswahlkriterien. Cap and Gown, der vierte große Club, war zu Anfang ein Zirkel ernsthafter und mehr oder weniger religiös gesinnter junger Männer, doch in den letzten zehn Jahren hat das wachsende Prestige des Clubs die ursprünglichen Ideale zunehmend in den Hintergrund gedrängt. Noch 1916 konnte sein Vorsitzender ein Publikum aus unentschlossenen Zweitsemestern mit der überzeugenden Losung »Schließ dich Cap and Gown an, und komme zu Gott« vom Stuhl reißen.
Die einflussreichsten unter den anderen Clubs sind Colonial, ein alter Club mit einer Geschichte aus Höhen und Tiefen, der verhältnismäßig neue Charter Club und der Quadrangle Club, der als Einziger ein dezidiert intellektuelles Flair pflegt. In den Kriegswirren ist ein Club verschwunden. Zwei neue wurden seitdem gegründet, beide in einem kleinen alten Gebäude, das die Geburt vieler Clubs erlebt hat. Ihre besonderen Merkmale sind so unbeständig, dass es an Tollkühnheit grenzen würde, sie zu beschreiben. Einer dieser Clubs, dessen Mitglieder zu meiner Zeit unermüdliche Besucher der Nassau Inn Bar waren, wurde, soweit ich weiß, zu einer Art Mensa für die Philadelphian Society.
Die Philadelphian Society ist Princetons Christlicher [26] Verein Junger Männer, und wenn sie vernünftig ist, bescheidet sie sich damit. Aber hin und wieder überkommt sie der messianische Drang, die Universität zu bekehren. Zu meiner Zeit ließ sie zu diesem Zweck einen berüchtigten Demagogen kommen, einen Dr.Soundso, der allen Ernstes ein geläutertes »übles Subjekt« mitbrachte. Die Studenten, die sich aus Frömmigkeit oder Neugier einfanden, wurden in der Alexander Hall versammelt und erlebten dort eine der abgeschmacktesten Obszönitäten, die jemals unter dem Dach einer bedeutenden Bildungseinrichtung veranstaltet wurde. Als die Predigt Dr.Soundsos in einen inbrünstigen Singsang überging, erhoben sich mehrere Dutzend Studenten so unerschütterlich wie farbige Gentlemen und traten vor, um sich bekehren zu lassen. Darunter ein beliebter Freigeist und Schluckspecht, dessen Ernsthaftigkeit in dieser Sache wir später zu ergründen versuchten, allerdings ohne Erfolg. Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Bericht des üblen Subjekts über die Verfehlungen seiner Vergangenheit, deren Tiefpunkt oder Krönung sein unfreiwilliger Abstieg in einen veritablen Straßengraben darstellte, gefolgt von seiner Bekehrung und seinem Aufstieg zum schlechten Beispiel im Dienst des Wanderzirkus unseres Dr. Soundso.
Zu diesem Zeitpunkt war den zarter besaiteten Zuhörern bereits merklich unwohl geworden, während die weniger zart besaiteten aufbegehrten – einige verließen sogar den Schauplatz. Das Salbungsvolle der Veranstaltung war selbst in jenen zaghafteren Zeiten zu viel des Guten, und später wurden gegen solche Darbietungen Vorbehalte schlicht aus Gründen des guten Geschmacks vorgebracht. [27] Im vergangenen Jahr war die »Oxford-Bewegung« als harmlosere Ausprägung des gleichen Phänomens Anlass für ziemlich offene und unnachsichtige Kritik in Studentenzeitschriften.
Vieles, was Princeton ausmacht, habe ich gar nicht erwähnt. Aber vielleicht sind einzelne charakteristische Eindrücke die beste Annäherung an ein allgemeines Bild. Dieses farbenprächtige Bild war im Winter und im Frühjahr von 1917 kurz vor Kriegseintritt in besonders helles Licht getaucht.
Nie zuvor war das, was die Universität ausmacht, so kraftvoll und so deutlich zutage getreten. An die achtzig Zweitsemester hatten sich demokratisch geweigert, in Clubs einzutreten, angeführt von David Bruce (einem Sohn des Senators Bruce), Richard Cleveland (einem Sohn Präsident Clevelands) und Henry Hyacinth Strater aus Louisville, Kentucky. Letzterer, der Erste in seinem Studienjahr, der sich am Princetonian beteiligte, und leidenschaftlicher Anhänger Tolstois und Edward Carpenters, gab sich mit diesem Protest nicht zufrieden, sondern wurde Pazifist. Er war ein herausragender Student und überaus beliebt; er wurde von vielen Seiten protegiert, von anderen missbilligt, aber nie auch nur entfernt gemaßregelt. Er scharte eine spärliche Anhängerschaft um sich, die zu den Quäkern übertrat und pazifistisch blieb.
Das Nassau Literary Magazine versuchte, unter der Leitung von John Peale Bishop einen größeren Leserkreis zu erobern – mit Erfolg. Jack Newlin, der später in Frankreich fiel, zeichnete Frontispize im Stil von Beardsley; ich schrieb Stories über beliebte Mädchen, Geschichten, die [28] später in einen Roman einflossen; John Biggs stellte sich den Krieg so gekonnt vor, dass er sogar Veteranen damit täuschte; und John Bishop unternahm einen letzten Anlauf, den seinerzeitigen Kreuzzug metrisch mit der Amerikanischen Revolution zu verbinden, während wir alle, die wir darauf warteten, einberufen zu werden, die aufgeblasene Rhetorik jener Tage nach Kräften verabscheuten. Wir veröffentlichten eine satirische Ausgabe unserer Zeitschrift, eine Parodie auf das Cosmopolitan Magazine, mit der wir die geistig weniger beweglichen Mitglieder der Fakultät für Englische Literatur erzürnten. Wir – in diesem Fall die Redaktion des Tiger – veröffentlichten eine freche Ausgabe, in der wir uns über den Lehrstuhl, die Bewegung gegen die Clubs und die Clubs selbst unter Verwendung ihrer richtigen Namen lustig machten. Um uns herum war alles in Aufruhr begriffen. Es war eine Zeit voller Verheißungen; am Horizont drohte der Krieg; nichts würde jemals wieder so sein wie vorher, und man scherte sich um nichts. In den folgenden zwei Jahren scherte man sich tatsächlich um nichts. Fünf Prozent meiner Kommilitonen, einundzwanzig junge Männer, fielen im Krieg.
Von jenem Frühling habe ich späte Abende im Nassau Inn in Erinnerung, wenn Bill Coan, der Prorektor, draußen vor der Tür wartete, um ausgewählte Exemplare am nächsten Tag vor den Rektor zu komplimentieren. Ich entsinne mich der langen Nachmittage des Militärdrills auf Fußballfeldern, vielleicht zusammen mit einem militärischen Ausbilder vom Vormittag. Wir kicherten über Professor Wardlaw Miles’ Bemühungen, den schroffen [29] Kommandoton des Ausbildungshandbuchs mit seinem korrekten und pedantischen Gebrauch der englischen Sprache zu vereinbaren. Als er zwei Jahre später einbeinig und mit einer Brust voller Auszeichnungen aus Frankreich zurückkehrte, wurde nicht mehr gekichert. Tausende Studenten jubelten ihm bei seiner Heimkehr zu. Ich entsinne mich des letzten Abends im Juni, als unser Jahrgang – zwei Drittel von uns in Uniform – auf der Treppe von Nassau Hall sein Abschiedslied sang und manche von uns weinen mussten, weil wir wussten, dass wir nie wieder so jung sein würden, wie wir es hier gewesen waren. Und mir ist, als entsänne ich mich einer Menge persönlicherer Dinge, die mittlerweile so verwischt und undeutlich geworden sind wie der Rauch unserer Zigaretten oder der Efeu am Gebäude von Nassau Hall an diesem letzten Abend.
Princeton ist Princeton. Williams College ist nicht, »was Princeton einmal war«. Williams ist für behütete Knaben, deren weibliche Verwandte sie vor der Wirklichkeit abschirmen wollen. Princeton ist kein Wolkenkuckucksheim und gehört in gewisser Weise zur »oberen Liga«, und es hat sich seit schätzungsweise sechzig Jahren dort nichts verändert. Heute wird weniger gesungen und mehr getanzt. Bierpartys gibt es nicht mehr, aber Verehrer stehen Schlange, um die junge Lois Moran abzupassen. Es gibt keinen Elizabethan Club wie in Yale, der eine Vorliebe für Lyrik gesellschaftsfähig – manchmal vielleicht zu gesellschaftsfähig – machen könnte; außergewöhnliche Begabung muss in Princeton ihr eigenes Publikum finden, wie sie es im Leben auch tun muss. Allen Überredungsversuchen zum Trotz trägt der Unisportler sein P in [30] konservativer Manier an der Innenseite seines Pullovers, und bislang ist unter den Alumni weder ein Justizminister Palmer noch ein Richter Thayer aufgetaucht. Rektor Hibben hat manchmal laute Meinungsverschiedenheiten mit Finanzminister Mellon, und im vergangenen Jahr haben sich nur zweiundneunzig Studenten des Abschlusssemesters trocken bekannt.
Wenn man nach einem Jahrzehnt zurückblickt, wird das Idealbild einer Universität zu einem Mythos, einer Vision, einer Feldlerche zwischen Fabrikschloten. Und dennoch ist es in Princeton vielleicht lebendig, nur weniger greifbar als unter dem Himmel des preußischen Rheinlands oder Oxfordshires, und vielleicht stoßen die einen unversehens darauf und können es sich aneignen, während es anderen für alle Zeiten unzugänglich bleibt. Und selbst sie versuchen als gestandene Männer vergebens, etwas von jener Republik zu erhaschen, die so viel von dem bewahrt, was am amerikanischen Leben edel, anmutig, bezaubernd und ehrenhaft ist.
[31] Was ich mit fünfundzwanzig denke und fühle
Der Mann hielt mich auf der Straße an. Er war alt, aber kein Seefahrer. Er hatte einen langen Bart, und sein Auge funkelte. Ich glaube, er war ein Freund der Familie oder etwas Ähnliches.
»Hören Sie, Fitzgerald«, sagte er, »hören Sie! Eins müssen Sie mir mal erklären! Was zum Teufel reitet einen – einen Mann Ihres Alters, dass Sie so pessimistische Sachen schreiben? Was soll das?« Ich versuchte, es mit einem Lachen abzutun. Er sagte, er sei ein Jugendfreund meines Großvaters. Daraufhin wollte ich ihn auf keinen Fall mit meinem Pessimismus anstecken. Also versuchte ich, es mit einem Lachen abzutun.
»Ha, ha, ha!«, sagte ich entschieden. »Ha, ha, ha!« Und dann: »Ha, ha! Tja, ich muss jetzt weiter.«
Ich wollte gehen, aber er packte meinen Arm mit festem Griff, und alles deutete darauf hin, dass er den Nachmittag in meiner Gesellschaft zu verbringen gedachte.
»In meiner Jugend –«, setzte er an, und dann entwarf er das Bild von der herrlichen, glücklichen, sorglosen Zeit, die er als Fünfundzwanzigjähriger erlebt hatte, wie alle es immer tun. Anders gesagt, erzählte er mir Dinge, von denen er sich einbildete, er hätte sie in der nebelumflorten Vergangenheit gedacht.
[32] Ich ließ ihn reden. Ich brummte sogar hin und wieder höflich, um mein Erstaunen kundzutun. Denn eines Tages werde ich genauso sein. Ich werde für die Nachgeborenen einen Scott Fitzgerald erfinden, den – so viel ist sicher – keiner meiner Zeitgenossen gegenwärtig wiedererkennen würde. Aber auch sie werden dann alt sein, und sie werden meine Erfindung genauso akzeptieren wie ich die ihre…
»Und Sie«, schloss der glückliche Alte, »sind jung, Sie sind gesund, Sie sind zu Geld gekommen, Sie sind außerordentlich glücklich verheiratet, Sie haben beträchtlichen Erfolg in einem Alter, in dem Sie noch genug Zeit haben, ihn zu genießen – können Sie einem unwissenden alten Mann bitte erklären, warum zum Teufel Sie diese –«
Ich konnte nicht widerstehen. Ich würde es ihm sagen. Ich setzte an: »Nun ja, verstehen Sie, Sir, ich habe den Eindruck, dass man mit zunehmendem Alter immer verletz…«
Aber weiter kam ich nicht. Kaum hatte ich zu sprechen begonnen, schüttelte er mir hastig die Hand und ging. Er wollte mir nicht zuhören. Er wollte nicht wissen, warum ich dachte, was ich dachte. Er hatte einfach nur das Bedürfnis gehabt, eine kleine Ansprache zu halten, und ich war sein Opfer gewesen. Seine Gestalt entfernte sich und entschwand unsicheren Schrittes um die nächste Ecke.
Das war der erste Vorfall. Der zweite ereignete sich neulich, als jemand von einem großen Zeitungskonsortium zu mir kam und sagte: »Mr. Fitzgerald, in New York geht das Gerücht um, dass Sie und – äh – Sie und Mrs. Fitzgerald sich mit dreißig Jahren das Leben nehmen wollen, weil Sie das mittlere Alter fürchten und verabscheuen. Ich will etwas Reklame für Sie machen und die Sache als [33] Geschichte für den Unterhaltungsteil von fünfhundertvierzehn Sonntagszeitungen ausbauen. In einer Ecke der Seite wird –«
»Halt!«, rief ich. »Ich weiß: In einer Ecke wird das lebensmüde Paar stehen, sie mit einem Arsencocktail, er mit einem orientalischen Dolch. Beider Blicke sind auf eine große Uhr geheftet, deren Zifferblatt mit Totenschädel und gekreuzten Knochen versehen ist. In der anderen Ecke ist ein großer Kalender mit rot markiertem Datum abgebildet.«
»Ganz genau!«, rief der Konsortiumsmann begeistert. »Sie haben es erfasst! Was wir als Erstes –«
»Jetzt passen Sie mal auf!«, sagte ich streng. »An diesem Gerücht ist nichts dran. Überhaupt nichts. Mit dreißig werde ich nicht mehr mein jetziges ICH, sondern jemand anders sein. Ich werde einen anderen Körper haben, denn das steht so in einem Buch, das ich einmal gelesen habe, und ich werde eine andere Haltung zu allem und jedem haben. Ich werde sogar mit einer anderen Person verheiratet sein –«
»Aha!«, unterbrach er mich mit gierig aufleuchtenden Augen und zog ein Notizbuch aus der Tasche. »Das ist wirklich interessant.«
»Nein, nein, nein!«, rief ich schnell. »Ich will damit sagen, dass meine Frau eine andere geworden sein wird.«
»Verstehe. Sie haben eine Scheidung im Auge.«
»Nein! Ich will –«
»Na ja, wie auch immer. Was wir auf jeden Fall brauchen, damit diese Geschichte eine runde Sache wird, sind eine Menge Bemerkungen über Knutschpartys. Halten Sie [34] die – äh – Knutschparty für eine ernsthafte Gefahr für unsere Verfassung? Und wollen wir als Überleitung sagen, dass der Hauptgrund für Ihren Selbstmord frühere Knutschpartys sind?«
»Augenblick!«, versuchte ich ihn verzweifelt zu stoppen. »Verstehen Sie doch bitte. Ich weiß nicht, was Knutschpartys damit zu tun haben sollen. Ich habe mich immer vor dem Alter gefürchtet, weil es zwangsläufig die Verletz…«
Doch wie im Fall des Familienfreundes gelangte ich über diese Silbe nicht hinaus. Der Konsortiumsmann nahm meine Hand mit festem Griff. Er schüttelte sie. Dann murmelte er etwas über ein Interview mit einer Revuetänzerin, die eine Fußkette aus reinem Platin haben sollte, und machte sich davon.
Das war der zweite Zwischenfall. Verstehen Sie, es war mir gelungen, zwei verschiedenen Männern zu sagen, dass das »Alter zwangsläufig die Verletz…«. Aber keiner der beiden hatte es hören wollen. Der alte Mann hatte von sich selbst gesprochen, und der Konsortiumsmann hatte von Knutschpartys gesprochen. Als ich von der »Verletz…« zu sprechen begann, hatten beide auf einmal dringende Verabredungen gehabt.
Und deshalb habe ich mit einer Hand auf dem achtzehnten Verfassungszusatz und mit der anderen auf dem ernstzunehmenden Teil unserer Verfassung feierlich gelobt, irgendjemandem meine Geschichte zu erzählen.
Wenn ein Mann älter wird, wird er zwangsläufig verletzlicher. Vor drei Jahren war ich zum Beispiel nur auf eine einzige Weise zu verletzen, nämlich durch mich selbst. [35] Wären der Ehefrau meines besten Freundes von einer elektrischen Waschmaschine die Haare ausgerissen worden, hätte mich das natürlich bekümmert. Ich hätte dem Freund eine lange Ansprache gehalten, immer wieder »alter Junge« gesagt und mit einem Absatz aus Washingtons Abschiedsbotschaft geendet; aber danach hätte ich ein gutes Restaurant besucht und wie gewohnt mein Abendessen verzehrt. Wäre dem Ehemann meiner Cousine zweiten Grades die Pulsader aufgeschlitzt worden, während er sich die Fingernägel maniküren ließ, dann will ich nicht leugnen, dass ich das ganz sicher bedauerlich gefunden hätte. Doch ich wäre bei einer solchen Nachricht keineswegs in Ohnmacht gefallen und hätte nicht etwa mit einem zufällig vorbeikommenden Wäschereiwagen nach Hause gebracht werden müssen.
Alles in allem war ich ziemlich unverwundbar. Ich beklagte es gebührend, wenn ein Schiff versenkt wurde oder wenn ein Zug entgleiste, aber ich glaube nicht, dass ich eine schlaflose Nacht verbracht hätte, wenn ganz Chicago von der Erdoberfläche getilgt worden wäre – solange ich nicht Grund zu der Annahme gehabt hätte, dass St.Paul als Nächstes dran sei. Und selbst dann hätte ich mein Gepäck nach Minneapolis befördern lassen und eine ungestörte Nachtruhe genießen können.
Doch das ist drei Jahre her, und ich war noch ein junger Mann gewesen. Ich war erst zweiundzwanzig. Wenn ich etwas sagte, was den Rezensenten nicht gefiel, konnten sie sagen: »Verdammt: So etwas Unreifes!« Man musste mich nur unreif nennen, und schon war ich erledigt.
Jetzt bin ich fünfundzwanzig und nicht mehr unreif – [36] zumindest kann ich nichts davon in meinem Spiegelbild erkennen. Stattdessen bin ich verletzlich. Verletzlich in jeder Hinsicht.
Allen Steuerinspektoren und Filmregisseuren, die möglicherweise diese Zeitschrift lesen, erkläre ich an dieser Stelle, dass verletzlich zu sein bedeutet, dass man leicht zu verwunden ist. Ja, das heißt es. Ich bin inzwischen leichter zu verwunden. Nicht nur in meiner Brust, meinen Gefühlen, meinen Zähnen und meinem Bankkonto kann man mich verwunden, sondern auch in meinem Hund. Können Sie mir folgen? In meinem Hund.
Nein, das ist kein neuer Körperteil, den das Rockefeller Institute vor kurzem entdeckt hat. Ich spreche von einem echten Hund. Ich will sagen, dass jemand, der meinen Hund einem Hundefänger übergibt, mich selbst damit fast ebenso sehr trifft wie den Hund. Er verwundet mich in dem Hund. Und wenn unser Arzt morgen zu mir sagt: »Ihr Kind wird niemals blond sein«, dann, ja dann hat er mich auf eine Weise verwundet, auf die ich nie zuvor hätte verwundet werden können, weil ich nie zuvor ein Kind gehabt hatte, durch das man mich hätte verwunden können. Und wenn meine Tochter heranwächst und als Sechzehnjährige mit einem Burschen aus Zion City durchbrennt, der glaubt, die Welt wäre eine Scheibe – so etwas würde ich nicht schreiben, wenn ich nicht wüsste, dass sie erst sechs Monate alt ist und ganz sicher noch nicht lesen kann und deshalb auf keine dummen Gedanken kommen kann –, nun ja, dann wird auch das mich verwunden.
Auf Verwundungen durch die eigene Ehefrau will ich nicht weiter eingehen, denn das ist ein heikles Thema. Das [37] gilt auch in meinem Fall. Aber ich habe am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, wenn jemand aus heiterem Himmel zu meiner Frau sagt, wie bedauerlich es sei, dass sie partout Gelb tragen wolle, obwohl sie dadurch so verhärmt aussehe. Keine sechs Stunden später erleidet man selbst Schreckliches für das, was dieser Jemand gesagt hat.
»Verletze ihn über seine Frau«, »Entführe sein Kind!«, »Binde seinem Hund eine Blechdose an den Schwanz!« Wie oft hören wir das im Leben und erst recht im Kino. Und jedes Mal zucke ich zusammen! Vor drei Jahren hätte man so etwas eine ganze Sommernacht hindurch vor meinem Fenster rufen können, und ich hätte nicht mal die Augen aufgeschlagen. Um mich auf die Beine zu bringen, hätte man schon sagen müssen: »Warte mal. Ich glaube, ich kann ihn von hier aus abschießen.«
Früher hatte ich ungefähr drei Quadratmeter Haut, die empfindlich auf Kälte und Fieber reagierten. Inzwischen hat sich die Fläche fast verzehnfacht. Doch nicht ich bin größer geworden – die dreißig Quadratmeter beinhalten die Haut meiner ganzen Familie, aber es macht keinen großen Unterschied, denn sobald Kälte oder Fieber diese dreißig Quadratmeter Haut angreifen, beginne ich zu frösteln.
Und so sickere ich fast unmerklich ins mittlere Alter, denn das wahre mittlere Alter besteht nicht im Ansammeln von Lebensjahren, sondern im Ansammeln einer Familie. Mit dem Einkommen eines kinderlosen Paares kommt man erstaunlich weit. Zwei Leute benötigen ein Zimmer mit Bad; ein Paar mit Kind benötigt die Millionärssuite auf der Sonnenseite des Hotels.
[38] Den ernsthaften Teil dieses Artikels will ich deshalb damit eröffnen, dass ich sage, wenn der Herausgeber dachte, er würde etwas Jugendliches und Fröhliches bekommen – und natürlich etwas Unreifes –, dann muss ich ihn an meine Tochter verweisen, falls sie sich dazu bequemt zu diktieren. Falls irgendjemand mich für unreif halten sollte, dann kann ich ihm nur empfehlen, einen Blick auf sie zu werfen – sie ist so unreif, dass ich lachen muss. Sie muss selbst lachen, wenn sie daran denkt, wie unreif sie ist. Wenn irgendwelche Literaturkritiker sie sähen, bekämen sie auf der Stelle einen Nervenzusammenbruch. Andererseits muss sich jeder, der mir schreibt, darüber im Klaren sein, ob Lektor oder sonst wer, dass er es mit einem Mann mittleren Alters zu tun hat.
Nun gut, ich bin fünfundzwanzig Jahre alt, und ich muss zugeben, dass ich mit einigen dieser Jahre ganz zufrieden bin. Die ersten fünf waren ganz in Ordnung – aber die letzten zwanzig! Nichts als Gegensätze! Tatsächlich begann ich sogar, ab und an Listen zu führen, um herauszufinden, wann ich am glücklichsten war. Bis ich mich so aufgeregt habe, dass ich die Listen zerriss.
Wenn ich all die Fehler übergehe, die zusammengenommen meine Kindheit ergeben, würde ich damit beginnen, dass ich mit fünfzehn auf die Highschool kam und dass meine zwei Jahre dort vergeudet waren, eine ausgesprochen sinnlose und unglückliche Zeit. Ich war unglücklich, weil ich mich in einer Situation gefangen sah, in der alle erwarteten, dass ich mich wie sie verhielte – und ich hatte nicht den Mut, mich abzusondern und das zu tun, was ich wollte.
[39] Es gab beispielsweise einen ziemlich einfältigen Jungen namens Percy an der Schule, dessen Beifall ich aus einem unerfindlichen Grund für unbedingt erstrebenswert hielt. Und um mir diese jämmerliche Null gewogen zu machen, ließ ich das bisschen Geist, das ich entwickelt hatte, in einen Zustand der Verrohung zurücksinken. Ich verbrachte Stunden in einer stickigen Turnhalle, wo ich mich mit einem muffigen Basketball abplagte und mich in einen wilden Zorn steigerte, statt draußen spazieren zu gehen, was ich lieber getan hätte.
All das, um es Percy recht zu machen. Für ihn war es das, was man zu tun hatte. Wenn man nicht jeden Morgen diese stickige und muffige Angelegenheit hinter sich brachte, war man »morbid«. Das war sein Lieblingswort, und vor diesem Wort fürchtete ich mich. Ich wollte nicht morbid sein. Also wurde ich stattdessen muffig.
Percy war auch im Unterricht keine Leuchte; folglich tat ich so, als wäre ich es auch nicht. Wenn ich Geschichten schrieb, schrieb ich sie heimlich und kam mir dabei vor wie ein Verbrecher. Wenn mir nur irgendein Gedanke kam, der Percys nettem, leerem Geist nicht entsprach, schob ich ihn sofort beiseite und hätte mich am liebsten dafür entschuldigt.
Natürlich schaffte Percy es nicht aufs College. Er wurde berufstätig, und ich habe ihn seither nicht oft gesehen, obwohl er ein durchaus angesehener Leichenbestatter geworden sein soll. Die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, war vergeudete Zeit; schlimmer noch: Es war kein Vergnügen, sie zu vergeuden. Letzten Endes hatte er mir nichts zu geben, und ich hatte keinen Grund, mich darum [40] zu scheren, was er dachte oder sagte. Aber als ich das herausfand, war es zu spät.
Das Schlimmste ist, dass es so weiterging, bis ich zweiundzwanzig war. Anders gesagt, ich hätte munter und fröhlich das getan, was ich tun wollte, wenn nicht irgendjemand auf einmal den Kopf geschüttelt und gesagt hätte: »Jetzt passen Sie mal auf, Fitzgerald, das sollten Sie lieber bleibenlassen. Es ist – es ist morbid.«
Und jedes Mal jagte mir das Wort »morbid« einen gehörigen Schrecken ein, und ich gab auf, was ich tun wollte und was zu tun richtig gewesen wäre, und tat das, was jemand anders wollte. Ab und zu schickte ich einen von ihnen zum Teufel; sonst hätte ich es zu gar nichts gebracht.
Während der Offiziersausbildung 1917 begann ich, einen Roman zu schreiben. Ich fing jeden Samstagnachmittag um ein Uhr an und arbeitete wie ein Verrückter bis Mitternacht. Danach arbeitete ich weiter von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends am Sonntag, wenn ich mich wieder zum Dienst melden musste. Ich war rundum glücklich und zufrieden.
Nach einem Monat kamen drei Freunde mit finsterer Miene: »Hör mal, Fitzgerald, du solltest deine Wochenenden nutzen, um dich auszuruhen und dich zu erholen. Was du machst, das ist – morbid!«
Dieses Wort überzeugte mich. Es sandte mir den gewohnten Schauder den Rücken hinunter. Am Wochenende darauf legte ich den Roman beiseite, ging mit den anderen in die Stadt und tanzte die ganze Nacht auf einer Party. Aber mein Roman ließ mir keine Ruhe. Er beschäftigte mich so sehr, dass ich keineswegs erholt, sondern völlig [41] niedergeschlagen zurückkehrte. Da war mir tatsächlich morbide zumute. Danach bin ich nie wieder ausgegangen. Den Roman habe ich beendet. Er wurde abgelehnt; aber ein Jahr später schrieb ich ihn um, und er wurde unter dem Titel Diesseits vom Paradies veröffentlicht.
Aber bevor ich ihn umschrieb, hatte ich eine Liste aller »Morbiditäten« aufgestellt, die Leuten angekreidet werden, lang genug, um bis zur nächsten Irrenanstalt zu reichen. Morbid war:
1. Sich zu verloben, ohne genug Geld zum Heiraten zu haben,
2. nach drei Monaten aus dem Reklamegeschäft auszusteigen,
3. überhaupt schreiben zu wollen,
4. zu glauben, ich könnte es,
5. über »dumme kleine Jungen und Mädchen, von denen niemand lesen will« zu schreiben