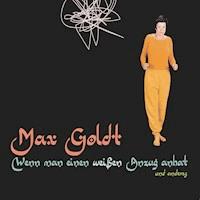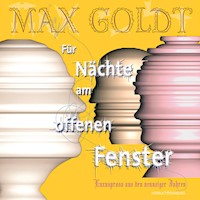9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Frauen waren ungeschminkt und trugen anstrengende Frisuren. Wenn Sie nicht wissen, was anstrengende Frisuren sind, dann schlagen Sie bitte im Lexikon unter «Frisuren, anstrengende» nach. Wenn das in Ihrem Lexikon nicht drinsteht, dann haben Sie ein genauso schlechtes Lexikon wie ich, und wir könnten eine Podiumsdiskussion zum Thema «Unser Lexikon ist schlecht» organisieren, uns hinterher besaufen und möglichst ordinär Brüderschaft trinken. Sie wissen schon: Zungenküsse bis weit runter in die Speiseröhre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Max Goldt
Für Nächte am offenen Fenster
Die prachtvollsten Texte 1987–2002
Über dieses Buch
Die Frauen waren ungeschminkt und trugen anstrengende Frisuren. Wenn Sie nicht wissen, was anstrengende Frisuren sind, dann schlagen Sie bitte im Lexikon unter «Frisuren, anstrengende» nach. Wenn das in Ihrem Lexikon nicht drinsteht, dann haben Sie ein genauso schlechtes Lexikon wie ich, und wir könnten eine Podiumsdiskussion zum Thema «Unser Lexikon ist schlecht» organisieren, uns hinterher besaufen und möglichst ordinär Brüderschaft trinken. Sie wissen schon: Zungenküsse bis weit runter in die Speiseröhre.
Vita
Max Goldt, geboren 1958 in Göttingen, lebt in Berlin. Zuletzt veröffentlichte er «Räusper. Comic-Skripts in Dramensatz» (2015) und «Chefinnen in bodenlangen Jeansröcken» (2014). Im Jahr 2008 erhielt er den Hugo-Ball-Preis und den Kleist-Preis.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2003 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Hamburg, nach einem Entwurf von Plastische Planung / (e.) Twin Gabriel, Berlin
ISBN 978-3-644-02248-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Cocooning
Die Mitgeschleppten im Badezimmer
Bartschattenneid
Ist es zynisch, im Wohnzimmer zu frühstücken?
Die Erfindung des Briefbeschwerers
Ich zog ein elektronisches Goldfischglas hinter mir her, in dem ein Wetter herrschte wie auf der Venus
Rille ralle ritze ratze (Harte Haare)
Nackenstützkeil (Comic)
Klärendes und Triftiges
Pünktlichkeit plus
Es soll keiner dabei sein, den man nicht kennt
Bomben gegen Bananen im Mund? Niemals!
Der schlimme Schal oder: Der Unterschied zwischen Wäwäwäwäwä und Wäwäwäwäwäwäwä
Warum Dagmar Berghoff so stinkt
In der Duz-Falle
Mein Nachbar und der Zynismus
Tagebuchpassage 11.9. – 15.9.2001
Der Lachmythos und der Mann, der 32 Sachen gesagt hat
Schulen nicht unbedingt ans Netz
Polythematischer Treibsand
Affige Pizzen
Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau
Zwickender Wirrwarr
Hier liegen ja lauter tote Soldaten (Comic)
Ich lasse meine Ohren nicht von einem Kunstdirektor abfackeln
Mademoiselle 25 Watt
Anette von Aretin, Hans Sachs, Guido Baumann sowie alternierend Marianne Koch und Anneliese Fleyenschmidt (Erinnerungssport)
Ah, München! Stadt der vielen Türme! (Comic)
Kennen Sie das Wort «Mevulve»?
Das Diskretionsteufelchen und der Motivationsfisch
Besser als Halme: Blutmagen, grob
Teilweise natürlich schon. Auch. Aber nicht nur. (Monologe, Szenen und Dialoge)
Mini-Talk am Nachmittag
Schweres tragend
Die Aschenbechergymnastik
Das Gründungskonzert des Weltjugendnichtraucherorchesters
Brillenputztücher
Aus Herrn Eibuhms Badezimmerradio
Babypflegestäbchen
Wenigstens einer, der mitdenkt (Comic)
Zischelnde Mädchen im deutschsprachigen Teil Belgiens
Ein Leben auf der Flucht vor der ‹Koralle›
Das Sandwich mit der Dietrich
Die legendäre letzte Zigarette
Die Erderwärmung
Der Sommerverächter
Gemeine Gentechniker wollen Ute Lemper wegen der Hitze in eine Euterpflegecreme-Fabrik auf Helgoland verwandeln
Die rot-blaue Luftmatratze
Ich will wissen, ob die Schwester von Claudia Schiffer schwitzte (In Unterhose geschrieben)
Tagebuchpassage 4.1. – 7.1.2002
Smart, fürstlich, galaktisch und nobel
Waffen für El Salvador
Dank Bügelhilfe fühlt man sich wie ein geisteskranker König
Milch und Ohrfeigen
Also kochte Cook der Crew
Intaktes Abdomen dank coolem Verhalten
Du Eumel! (Comic)
Veränderungen des Neigungswinkels von Hutablagen sind keine Hausmädchenarbeit
Die Dolmetscherin und das Double
Die Mittwochsmemmen oder: Warum tragen Ausländer immer weiße Socken?
Not cocooning
Hyppytyyny huomiseksi (Ich bin begeistert und verbitte mir blöde Begründungen)
Ein Flugzeug voller Nashi-Birnen, ein Jesus voller Amseln
Dreieckssandwiches der Bahn (Comic)
Auch Tote dürfen meine Füße filmen
Elegante Konversation im Philharmonic Dining Room
Österreich und die Schweiz
Kölner und Düsseldorfer
Kiesinger weiß kein Mensch was drüber
Die grenzenlose Güte (Comic)
Tagebuchpassage 15.11. – 16.11.2001
Las Vegas, «Kitsch» und «Satire»
Knallfluchttourismus
Gestrandet an Leben und Kunst
Der heile Krug
Wie gut, daß ich ein Künstler bin!
Bolde und Urge (Comic)
Junger Mann, der sich eine Schallplatte gekauft hat
Ich beeindruckte durch ein seltenes KZ
Berliner Befremdlichkeiten
Mückenplage, Atomkrieg, Liebeskummer – Wider die Generalverherrlichung von Büchern
Der Sonderoscar für prima Synchronisation geht in diesem Jahr an den Film ‹Fünf stattliche Herren und ein Flockenquetschen-Selbstbau-Set›
Ben-Katchor-Comic (Comic)
Tagebuchpassage 20.9. – 26.9.1999
Okay, Mutter, ich nehme die Mittagsmaschine
Einige Songtexte
Anderthalb Magnesium für jeden
Flugstunden und Autostunden
Schleichwege zum Christentum
Zimt auf Samt
Gefährdet
An die Wand gelehnt
Dies ist deine Jugend
Die schönste Art, halbtot zu sein (Gekitzelt werden)
Könnten Bienen fliegen
Quellenverzeichnis
Cocooning
Die Mitgeschleppten im Badezimmer
Gäste haben! Gäste zu haben ist ein Jumbo-Plaisir, doch will beachtet werden, wie die Gastlichkeit zu bewerkstelligen sei. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Immanuel Kant oder Uwe Seeler war, der einmal bemerkte, wenn man Gäste zu sich bitte, solle deren Anzahl diejenige der Grazien, also drei, nicht unter-, und diejenige der Musen, neun, nicht überschreiten. Ich halte mich an diese Regel, denn wenn man nur zwei Personen einlädt, ist man ja insgesamt bloß zu dritt, und zu dritt ist man ja schon, wenn man zu zweit ist und der Heizkörperableser klingelt. Bittet man aber zu viele Gäste zu sich, weiß man gar nicht, wie die alle heißen. Auf jeden Fall muß man den Gästen beizeiten einbleuen, daß sie auf keinen Fall jemanden mitbringen dürfen! Sonst hat man ein oder zwei Stunden lang die Wohnung voll mit Gestalten, die man überhaupt nicht kennt und auch nicht kennenlernen wird, die dafür aber um so ungehemmter in die byzantinischen Bodenvasen aschen, und wenn dann um zwölf die Getränke alle sind, setzt ein großes Woandershin-Walking ein, und schließlich sitzt man da mit ein paar trüben Tassen, für die man später Luftmatratzen aufpusten darf. Nein, die Gäste müssen sorgsam aufeinander abgestimmt werden wie die Aromen in einem Parfum; ein einziger Mitgeschleppter kann wie ein einzelner Gallenröhrling in einem Steinpilzgericht wirken und alles verderben.
Nun ist es 20 Uhr, und die Gäste tun das, was nur Gäste können, nämlich eintrudeln. Hat man je davon gehört, daß Arbeiter in der Fabrik eintrudeln oder Fußballspieler auf dem Spielfeld? Sind die Deutschen anno ’39 in Polen eingetrudelt? Nein, eintrudeln ist gästespezifisches Ankunftsverhalten. Zuerst nötigt man die Besucher, in rascher Abfolge zwei oder drei Manhattans oder Old Fashioneds zu trinken, damit sie nicht wie dösige Ölgötzen bräsig in der Sitzschnecke abhängen. Gästezungen wollen wachgekitzelt werden. Jetzt mag es sein, daß die Menschen von des Tages Knechtungen mattgepaukt sind und trotz der munterlaunigen Drinks nicht in Schwätzchenstimmung kommen. Für diesen Fall sollte man stets einige Gegenstände zum Zeigen haben, denn Gäste, denen man etwas zeigt, müssen wohl oder übel das Maul aufkriegen zwecks Kommentar. Da trifft es sich gut, wenn man gerade eine wertvolle Gesamtausgabe der Werke Rainer Barzels oder ein Prunkschwert aus dem Hindukusch gekauft hat. Es muß aber gar nicht unbedingt so etwas Großartiges sein, oft reicht schon eine repräsentative Blumenkohlhaube, ein Mardergerippe oder ein vom Mittelmeer mitgebrachter Badeschwamm, um die Konversation zum Moussieren zu bringen.
Nun darf man sich aber nicht pathetisch vor den Gästen aufbauen und den Schwamm angeberisch hochhalten wie Hamlet seinen Totenschädel, sondern man muß allen Anwesenden mit viel Einfühlungsvermögen das Gefühl vermitteln, daß das jetzt nicht irgendein wildfremder, anonymer Schwamm ist, der ihnen da wortgewandt präsentiert wird, sondern daß es auch, zumindest vorübergehend, «ihr» Schwamm ist. Man muß die Gäste teilhaben lassen an den durch den Schwamm ausgelösten emotionalen Updrifts. Dies erreicht man, indem man Nähe ermöglicht, Betatschungen zuläßt, den Gästen also erlaubt, den Schwamm zu betatschen. Man muß sie bitten, die Augen zu schließen und sich vorzukommen wie ein blindes, blondes Mädchen in einem Blindentastgarten, wodurch bedauerlicherweise die Frage aufgeworfen wird, ob auch Blinde Blondinenwitze machen, und wenn ja, dann gäbe es in solchen Witzen vielleicht Blondentastgärten, in denen lauter dornige Sträucher stehen, und die blinden Blondinen schrieen immer «Aua, Aua».
Doch zurück zum Schwamm. Man kann ihn kreisen lassen im Gästerund, von rechts nach links, jeder darf «ihn» zwei Minuten halten, gleichzeitig kann man von links nach rechts das Mardergerippe herumgehen lassen. Da kann es passieren, daß der in der Mitte sitzende Besucher beides hat, Schwamm und Gerippe, und man glaube mir, es wäre ein lausiger Gastgeber, wer dies nicht zum Anlaß nähme, bleichesten Gesichtes zu verkünden, daß man in der Ukraine glaube, einer, der in der einen Hand einen Schwamm halte und in der anderen ein Mardergerippe, dessen Namenszug im Buch des Lebens werde bald verdorren. Nach einiger Zeit ist es allerdings geboten, zu erwähnen, daß nichts Ernstes zu befürchten sei, daß man nur gerade ein wenig geistreich habe erscheinen wollen. Man sieht hieran, wie kinderleicht es ist, seinen Gästen Kaiserstunden der Geselligkeit zu bieten.
Nach den ersten Cocktails wird bald eine erste Stimme erdröhnen, die ankündigt, der Toilette einen Besuch abzustatten. Da ist zu hoffen, daß man das Bad gut gewichst, gewienert und poliert hat, wie überhaupt die ganze Wohnung, denn wenn man das nicht tut, ist ja kein Platz für den neuen Schmutz, den einem die Gäste in die Bude schleppen mit ihren verdammten Drecklatschen. Gerade jüngere Menschen, die darauf erpicht sind, sich eine gut besonnte gesellschaftliche Position zu erstreiten, sollten wissen, daß die Reputation im Badezimmer mitgebacken wird. Man mache sich doch nichts vor: Fast jeder, der in einer fremden Wohnung aufs Klo geht, macht das Badezimmerschränkchen auf und guckt, was da drin ist. Und wenn da zig Medikamente gegen Depressionen, Inkontinenz, Pilzbefall und Impotenz drin sind, dann nimmt der Gast seine Menschenbewertungsskala und schiebt den Gastgeber nach unten. Deswegen: Solche Sachen immer schön verstecken. Die Menschen sind dünkelhaft und gieren danach, Schulnoten zu verteilen. Zeitschriften und Talkshows haben die halbe Menschheit in dumpfe kleine Hobbypsychologen verwandelt. Legt einer seinen Zeigefinger zwischen die Lippen, dann wird allen Ernstes geglaubt, das bedeute irgendwas. Und wenn jemand im Bad eine sogenannte Badezimmergarnitur hat, lautet das Urteil der Jury «proll». Eine hundertprozentige Fehldeutung liegt hier indes nicht vor: Eine Klodeckelbespannung aus altrosa oder türkisem Frottee mit passender Badezimmermatte und Klofußumpuschelung läßt weder humanistische Bildung noch Adel erahnen. Doch muß man differenzieren: Die vor der Wanne liegende Matte mindert das Risiko feuchtfüßigen Ausgleitens, des leidigen «Pardauz, Tatü-Tata, Friedhof». Aber warum müssen Toiletten umpuschelt werden?
Ich muß jetzt leider etwas Hartes äußern. Ich habe in meinem Leben so manche resttröpfchengetränkte Toilettenumpuschelung sehen müssen, und immer hieß mich der Takt zu schweigen. Doch nun muß das Harte aus mir raus, und ich sage: Resttröpfchengetränkte Klofußumpuschelungen sind nicht sehr hübsch. Obendrein sind, wenn man sie spitzen Fingers umdreht, immer Haare darunter und erinnern an der Maden Vielzahl, die einem ins Auge springt, wenn man auf einem Spaziergang mit einem Stock einen toten Vogel umdreht. Ich habe nichts gegen Haare an sich. Wenn sie gut sitzen, bilden sie nützliche natürliche Mützen, die uns vor vorwitzigen Blicken und Blitzen schützen. Man kann auch gut in ihnen wuscheln, falls einem das erlaubt wird von dem, wo die Haare drauf wachsen. Aber jene Sorte Haare, wie man sie unter Umpuschelungen antrifft, wird sich kaum einer gern in den Frühlingsquark rühren. Nicht auszuschließen ist, daß es Lesefröschchen gibt, die eine syphige Umpuschelung ihr eigen nennen und jetzt aufgrund meiner rauhbeinigen Worte bittere Tränen vergießen, Tränen, die bitterer sind als die bitteren Tränen der Petra von Kant in dem Faßbinder-Film ‹Die bitteren Tränen der Petra von Kant›. Diese Perspektive knickt mich. Zum Trost sag ich den Fröschchen: Stellen Sie sich doch mal vor, jetzt kommt der Mensch, den Sie am meisten liebhaben, in Ihr Zimmer und sieht Sie weinen. Natürlich möchte er Ihnen die Tränen fortwischen, aber er findet kein Taschentuch und nähert sich Ihren blaugeweinten Wangen mit Ihrer Kloumpuschelung. Da würden Sie doch auch zurückweichen, gell?
Die Gäste sind nun abgezischt. Das ganze Wohnzimmer voll mit benutzten Einwegspritzen, Kondomen, geplatzten Gummipuppen, blutigen Peitschen, kotbeschmierten Dildos und zertretenen Mardergerippen! Ich übertreibe natürlich ein wenig. In Wirklichkeit ist der Salon nur leicht krümelübersät. Doch Grund genug zu sagen: «Nie wieder Gäste! Das nächste Mal treffe ich mich lieber wieder wie dereinst mit meinen alten Existenzkomplizen, nennen wir sie mal spaßeshalber Bruno, Ewald und Hugo, am schrammigen Holztisch im Wirtshaus zum knallgrünen Huhn.»
«Hallo Hugo, hallo Ewald, hallo Bruno!» tönt es daher bald durch die Gasse. Doch da ist ja noch wer. Ächz, ein Persönchen. «Das ist Claudia», sagt Ewald im Ton verkrampfter Lockerheit, und ein kurzer Blick von ihm erzählt die ganze fade Story. Daß sie den ganzen Tag rumgenölt habe wegen heute abend, daß er dann gesagt habe: «Komm doch einfach mit!», worauf sie erwiderte: «Ihr wollt ja nur wieder Bier saufen!», daß sie dann mit ihrer Schwester telephoniert, daraufhin geweint, dann Bauchweh bekommen und sich in letzter Minute doch entschieden habe, mitzukommen.
«Vier Hefeweizen und eine kleine Sprite!»
«Wieviel trinkt ihr denn davon, wenn ihr euch trefft?» fragt die Mitgebrachte. «Och, so vier oder fünf können das schon werden», wird geantwortet. «Fünfmal 5 Mark 50, das sind ja 27 Mark 50 für jeden. Also, ich muß von elfhundert Mark im Monat leben bei 680 Mark kalt, ihr ja offenbar nicht», bemerkt die Stimmungskanone, worauf sie ihren von einem widerwärtigen roten Samtding zusammengehaltenen Pferdeschwanz öffnet und das widerwärtige rote Samtding mitten auf den Tisch legt. Ihre weiteren Gesprächsbeiträge lauten: «Kannst du deinen Rauch nicht mal in eine andere Richtung blasen?» und «Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen?» Irgendwann fängt sie an zu heulen, weil der Hund ihrer Schwester vorige Woche gestorben ist, und um halb elf stellt sie fest, daß es schon halb elf sei und Ewald ganz furchtbar müde aussehe, worauf sie sich denselben krallt und zum Abschied in scherzhaft ironischem Ton meint, sie hoffe, uns nicht den Abend verdorben zu haben. «Aber nein», sagen wir und meinen das auch sehr ironisch.
Bruno sagt: «Die tollsten Frauen laufen auf der Straße herum, aber die besten Freunde, die man hat, geraten immer an solche mißgünstigen Ranzteile.» Hugo weiß noch mehr: «Unseren Ewald sehen wir so bald nicht wieder. Der wird für Jahre in der Ranzschnecke verschwinden. Besuchen ist auch nicht drin. Sie würde es ihm selbstverständlich erlauben, aber wenn wir dann mal kämen, würde sie mit einer Wolldecke auf dem Sofa liegen und die Bürde unserer Anwesenheit als qualvoll lächelnde Märtyrerin geduldig ertragen. Sollte unser Gespräch trotz allem mal ein bißchen in Fahrt kommen, dann würde es bald unter der Wolldecke hervortönen: ‹Ewald, ich hab so kalte Hände. Kannst du sie mir nicht ein bißchen warmrubbeln?› oder ‹Ich will euch nicht hetzen, aber kannst du mir sagen, wie lange ihr ungefähr noch braucht? Nur ganz ungefähr.› Und dann dieser übertriebene Fruchtgestank überall von diesen Produkten aus dem Body Shop.» Ich weiß zu ergänzen: «Sie wird ihn zuschleimen mit Elton-John-Songs und Astrologie, wird ihn einspinnen in einen Kokon aus esoterischem Wirrwarr und hausfraulichem Quatsch, wird die ganze Bude vollstellen mit Schälchen, in denen kleine Perlen sind und verstaubte Blumenblätter und die widerwärtigen Samtdinger für den Pferdeschwanz, und bald wird er auch einen Pferdeschwanz haben, zusammengehalten von der männlichen Variante, einem widerwärtigen Frotteeding.»
Aus Sorge um den armen Ewald trinken Hugo, Bruno und ich noch ganz viel, machen sogar noch ein Woandershin-Walking. Bruno meint dann in dem Absturzladen, die Menschen werden von ihrem Vornamen geprägt, es gebe z.B. regelrechte Manfred- oder Christoph-Typen. In Frankreich sei sogar ein Buch zu diesem Thema auf dem Markt. Tatsache sei, das mindestens 50 Prozent aller blöden Freundinnen von netten Freunden Claudia heißen, das sei ein richtiger Migränetantenname. Bei blöden Lebenspartnern von netten Freundinnen sei die Bandbreite viel größer, die heißen Jens, Clemens, Oliver, Torsten und Tobias. Nur Ewald, Hugo und so weiter heißen die nie, denn die sind nett, und es folgt ein endloses Gebrabbel, welches meine Meinung bestätigt, daß dem Phänomen des trunkenen Woandershin-Walking prinzipiell kritisch gegenüberzustehen ist und daß das meiste, was nach zwei Uhr am Morgen passiert und gesprochen wird, ohne Reu vergessen werden kann.
Bartschattenneid
Zweierlei Erscheinungen bezeichnet man als Bartschatten. Ein Mann läßt einen Daumentief warmes Wasser ins Waschbecken laufen, stöpselt zu und macht mit dem Wasser den Rasierpinsel naß und befreit in dem Wasser die Klinge von Stoppeln. Nach der Rasur läßt er das Wasser ablaufen, und im Becken bleibt ein Film aus Seife und Bartstoppeln zurück. Das ist der Waschbecken-Bartschatten. Er ist unpopulär. Was gibt’s dazu noch zu sagen?
Vielleicht, daß manche Männer «nadeln». Frauen, die einen behaarten Mann haben, seufzen manchmal, in die Dusche oder aufs Bettzeug blickend: «Nett ist er ja, aber er nadelt so. Ein Weihnachtsbaum ist nichts dagegen.»
Auch Rasierpinsel verlieren Haare. Es sind Dachshaare, die da kreuz und quer im Bartschatten liegen. Dies kann man nur glauben, wenn man weiß, daß Mitarbeiter von Blindenwerkstätten gegen geringen Lohn die Haare von Dachsen zu Rasierpinseln bündeln. Es gibt auch welche mit synthetischen Haaren, doch mit denen hilft man den Blinden nicht, und es gibt auch welche aus Gemsenhaar, aber die sind teuer und zu schade zum Naßmachen. Acht Stunden lag der Mann im Gänsekleid, knapp zwei Minuten später pflegt er sich mit Dachskleid. Horst Tappert schläft sogar neun Stunden, wie man aus einer Zeitschrift weiß.
Einem Veganer, dem bewußt wird, daß er mit der Verlautbarung, er trage keine Lederschuhe und verzichte sogar auf Honig, das Haus nicht mehr rocken kann, weil mittlerweile jeder diese Beispiele kennt, dem leg ich nahe, zu verkünden: «Ich benutze noch nicht mal einen Rasierpinsel aus Dachshaaren.» Das hat noch nie einer in einer Talkshow gesagt. Der, der’s zum ersten Mal sagt, der rockt das Haus wie früher, als noch alle riefen: «Waas? Auch keine Eier?»
Noch keine Religion wurde aus der Frage gemacht, ob man sich besser vor dem Duschen rasiert oder hinterher. Ich würde sagen: Nach dem Duschen ist besser, denn dann wird man ohne hautirritierende Rubbelei trocken. Wenn jemand erwidert, es sei aber besser, es vor dem Duschen zu tun, weil harter Wasserstrahl auf frisch geschorener Haut den Poren Gutes tue, würde ich versuchen, interessiert zu schauen. Ich würde mich jedenfalls zusammenreißen und höchstens mit dem Fuß wippen, also keinesfalls losschreien.
Schon etwas eher identitätsstiftend ist es, ob man der Naß- oder der Trockenrasur den Vorzug gibt. Männer über 60, insbesondere welche aus weniger einkommensstarken Schichten, sind diejenigen, die heute am häufigsten zum Elektrorasierer greifen, denn diese Männer sparten in der Jugend auf ein Auto oder wenigstens ein Moped, sie sparten und sparten, aber es langte nie, da kauften sie sich halt einen Rasierapparat, der galt auch als modern damals und hatte den Status einer «Anschaffung». Sich bleibende Werte «anzuschaffen» war in den Nachkriegsjahrzehnten von höchster Priorität, später ging man dazu über, sich Vergängliches ins vollmöblierte Haus zu holen. Die neue Scheibe von Slade – die hat man sich in den siebziger Jahren nicht angeschafft, die hat man sich zugelegt.
Als die heute über Sechzigjährigen dann doch ein Auto kaufen konnten, hatten sie sich an den Rasierapparat gewöhnt, so daß keiner von ihnen sagte: «Jetzt, wo ich ein Auto habe, kann ich mich ja eigentlich wieder naß rasieren.» Sie haben ihren Werdegang nicht genau genug beobachtet und den Zusammenhang übersehen.
Am Modernen orientierte Männer bevorzugen heute im allgemeinen die Naßrasur. Sich mit einem schwächlich brummenden Maschinchen im Gesicht herumzufuhrwerken gilt nicht mehr als im klassischen Sinne männlich. Außerdem genießt der Naßrasierer den Vorteil, daß er sich wenigstens einmal am Tag, ohne extra dran zu denken, das Gesicht wäscht. Für komplexere Bartschuren hat man freilich zusätzlich noch einen elektrischen Kotelettentrimmer und allerlei dem Millimeter verpflichtete Spezialgeräte. Politiker, Manager und andere Männer, die auch abends noch Termine wahrnehmen müssen, halten es lange schon mit der Kompromißlösung der Vielfotografierten: Morgens ausführliche Naßrasur und abends in der Limousine noch mal schnell elektrisch drüberwandern.
Dieses Verfahren ist aber nur bei dunkelhaarigen Männern mit dunklem Bartschatten notwendig. Als Bartschatten bezeichnet man ja nur in zweiter Linie den Schmutz im Waschbecken nach der Naßrasur, häufiger versteht man darunter die dunklen Pünktchen, die nach der Entfernung des Bartnachwuchses manches Mannes Antlitz auszeichnen, also jenen Mohnbrötcheneffekt, mit denen Witz- und Comic-Künstler früher gern Verbrechertypen, z.B. die Panzerknacker, kennzeichneten, woran man erkennen kann, daß ein starker Bartwuchs oft mit einer gewissen Zwielichtigkeit in Verbindung gebracht wurde. Darin widerrum muß man eine Angst des Angelsächsischen vor allem Mediterranen, womöglich sogar Arabischen sehen.
Heute begegnet man dunkelhaarigen Männern überall. Man ist auch schon verreist gewesen. Und es erwuchs aus dem Verreist-gewesen-Sein und dem Erblicken der gleichmäßigen schwarzen Pünktchen beim Einkauf von Gemüse der bislang nicht so genannte Bartschattenneid.
Männer beneiden einander um Autos, Frauen, Positionen und Geld. Dies geben sie zu, indem sie es entweder ironisieren oder aggressiv werden. Der Neid auf den mediterranen Bartschatten ist ein heimlicher Neid, von dem niemand spricht. Hellhaarige, die oft nur insularen Bartwuchs haben, blicken oft mit sehr viel «Will-ich-auch-haben» auf die «perfekt gemähte männliche Blumenwiese» im Gesicht eines Südländers. Es ist völlig okay, ja sogar angenehm, daß niemand davon spricht. Aber wenn man im Zug sitzt, und die Tür geht auf, worauf ein Mann, der laut Namensschild «Herr Yildiz» heißt, die Fahrkarte zu sichten verlangt, dann ist es auch nicht völlig falsch zu denken, daß all die Pünktchen, die Herr Yildiz im Gesicht trägt, doch eigentlich recht schick sind.
Ist es zynisch, im Wohnzimmer zu frühstücken?
Eine Person sagt zu einer zweiten Person:
«Normalerweise frühstücken wir nicht im Wohnzimmer, aber sonntags frühstücken wir durchaus im Wohnzimmer. Auch feiertags, also beispielsweise am 26.12. und am Ostermontag. Wir wissen aber noch nicht, wie wir uns verhalten werden, wenn der Pfingstmontag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wird, um die Pflege alter und behinderter Menschen in den östlichen Bundesländern zu gewährleisten. Möglicherweise würden wir dann zwar weiterhin im Wohnzimmer frühstücken, das aber als zynisch empfinden. Andererseits: Vielleicht frühstücken die alten und behinderten Menschen ja selber im Wohnzimmer und denken nicht im Traum daran, sich zu überlegen, ob es zynisch sein könnte, im Wohnzimmer zu frühstücken, während jene, die es durch den Verzicht auf den Pfingstmontag erst ermöglichen, daß die Älteren und Behinderten, die unter Umständen gar kein Wohnzimmer haben oder nur ein ganz kleines, überhaupt was zum Frühstücken haben, aus Solidarität mit Alten und Behinderten an abgeschafften Feiertagen in der Küche sitzen und mit Stielaugen in Richtung Wohnzimmertür schielen.»
Die zweite Person erwidert:
«Könnten Sie Ihren Gedanken vielleicht ein zweites Mal vortragen?»
Die Erfindung des Briefbeschwerers
Während eines Streifzuges durch das Kaufhaus des Westens sprang mir neulich ein Set von sechs vergoldeten Sektquirlen für 98 Mark ins Auge.
Einen Moment lang liebäugelte ich mit der Idee, mir vom Verkaufspersonal eine Obstkiste bringen zu lassen, mich auf sie zu stellen und eine gesellschaftliche Rede zu halten, in welcher ich Begriffe wie «Somalia» und «Pelzmantelschlampe» aufs gekonnteste miteinander kontrastiert hätte. Ich bevorzugte jedoch ein heiteres Stillbleiben, währenddessen ich mich vergeblich an den Sinn nicht nur von Sektquirlen, sondern auch von Nußspendern und Grapefruitlöffeln heranzutasten versuchte. Warum soll man Sekt verquirlen? Damit die Damen nicht rülpsen? Ich meine, auch der Kehle einer nicht quirlenden Dame entfahren keine gesellschaftsunfähigen Geräusche, und Herren trinken ohnehin kaum klebrige Getränke. Und warum soll man Nüsse spenden? In meiner Kindheit gab es ein Onkel-Tante-Gefüge, in dessen Haushalt sich ein Nußspender befand. Das war ein brauner Kasten mit zwei Öffnungen und einem Knopf. Oben tat man die Nüsse herein, dann drückte man auf den Knopf, und unten kam eine Nuss heraus. Nicht etwa geknackt oder gewürzt, sondern im gleichen Zustand, in dem sie oben hineingegeben wurde. Des weiteren mag ich nicht vertuschen, daß ich im Besitz eines Grapefruitlöffels bin. Ein solcher Löffel hat vorn kleine Zähne, die vermeiden helfen sollen, daß einem Saft in die Augen spritzt beim Ausbaggern der Frucht. Natürlich spritzt es trotzdem. Es weiß doch aber eh jeder, daß man, wenn man sich mit einer Grapefruit befassen will, vorher seine Tapezierhosen anzieht und eine Sonnenbrille aufsetzt. Ich möchte jetzt nicht sämtliche Narreteien aufzählen, welche von Spezialversandhäusern angeboten werden, also keinesfalls jenen Papierkorb erwähnen, der, sobald man etwas hineinwirft, gesampelte Beifallsgeräusche von sich gibt, auch nicht den beinahe legendären Göffel, eine Kreuzung aus Löffel und Gabel, den eine Münchner Designerin mit dem Gleichgewichtsstörungen verursachenden Namen Bib Hoisak-Robb entwarf. Lieber möchte ich die Aufmerksamkeit auf die klassischste Überflüssigkeit richten, nämlich den Briefbeschwerer. Warum in aller Welt soll man einen Brief beschweren? Wohnte sein Erfinder in einer windigen Wohnung? Ich will mir kurz was denken.
Ich denke mir einen Erfinder, und der hatte eine rülpsende Gemahlin. «Das liegt an dem Sekt, den die den ganzen Tag säuft», dachte er und erfand den Sektquirl. Er ließ ihn patentieren, und bald gab es ihn überall zu kaufen. Der Bund kritischer Verbraucher fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen.
«Wir benötigen keine Anti-Rülps-Quirle, während in der Dritten Welt … etc. … Gerade wir als eines der reichsten Länder der Welt sollten endlich mal … etc.» riefen seine Mitglieder, schmissen des Erfinders Fensterscheiben ein und schrieben Drohbriefe. Nun herrschten in der Wohnung des Ingenieurs zugige Zustände, und die Drohbriefe flatterten in seiner Stube umher wie das herbstliche Laubwerk, wenn dem Jahr die Puste knapp wird.
«Wie soll ich denn die Briefe lesen, wenn sie durchs Zimmer schunkeln wie herbstliches Laubwerk?» brüllte da der Erfinder. Seiner betrunkenen Frau mißfiel das Gebrüll so sehr, daß sie sich einen der Pflastersteine griff, mit denen die Fensterscheiben zerschmettert worden waren, um ihn gegen ihren cholerischen Mann anzuwenden. Wegen ihrer Angeschickertheit verfehlte sie aber seinen Kopf und knallte den Stein auf den Rauf-und-runter-kurbel-Wohnzimmertisch, über welchem gerade besonders viele Drohbriefe wirbelten, und so kam es, daß zwischen Tischplatte und Pflasterstein ein Brief eingeklemmt wurde. Plötzlich ganz schweigsam, verharrte das Ehepaar vor dem Tisch. Die Geburt einer großen Idee hatte Suff und Zorn die Tür gewiesen.
«Dieser Augenblick ist so erhaben, daß wir den Rauf-und-runter-kurbel-Wohnzimmertisch so weit hinaufkurbeln sollten, wie es nur irgend geht», sprach der Ingenieur. Und sie kurbelten die ganze Nacht, sie kurbelten den Tisch höher als je zuvor und vermutlich auch höher, als irgendwo auf der Welt je ein Wohnzimmertisch gekurbelt wurde. Dann stellten sie sich unter den Tisch und küssten sich dermaßen französisch, daß man das Geschmatze und Geschlabber bis zu den Mülltonnen hören konnte, also bis zu diesen garstigen Mülltonnen, bei denen sich allabendlich die dümmere Jugend der Siedlung traf. Bislang wußten nur Insider, in was für einer engen Beziehung die Entstehungsgeschichte der Redewendung «Sie küssen sich so laut, daß man es bis zu den Mülltonnen hört» zu der Erfindung des Briefbeschwerers steht. Jetzt wissen es alle.
Ich zog ein elektronisches Goldfischglas hinter mir her, in dem ein Wetter herrschte wie auf der Venus
Wenn ich mit der Bahn fahre, versuche ich schon auf dem Weg zum Bahnhof, mir die Sitzplatznummer einzuprägen, damit ich nicht im Getümmel auf dem Bahnsteig meine Fahrkarte aus der sicheren Jackentasche holen muß. Viel Segen ruht auf Waggon- und Platznummernkombinationen, die geschichtliche Ereignisse wachrufen, Wagen 19, Sitz 19 z.B., da fühlt man sich von der Leiche der Rosa Luxemburg an die Hand genommen und sicher zu seinem Sitz geleitet. Dumm ist aber, wenn man in Wagen 4 sitzt, denn im 5. Jahrhundert war anscheinend nicht viel los, jedenfalls nichts, was sich als Jahreszahl dem historischen Laien einprägte. Wahrscheinlich gab es in diesem Jahrhundert nur Seuchen und Sümpfe, und die Menschen waren vom krank-durch-die-Sümpfe-Waten zu genervt, um am Mühlrad der Geschichte zu drehen. Manchmal merke ich mir den Sitzplatz auch anders: Ich saß einmal Wagen 17 Platz 48, da dachte ich: 1748 Zimmer hat der Palast des Sultans von Brunei.
Wohl aus dem gleichen halbseidenen Grund, aus dem der Sultan von Brunei einst mit einem Abakus durch seinen Palast schritt und dessen Zimmer zählte, durchmaß ich vor einiger Zeit meine Wohnung und zählte meine Elektrogeräte. Lampen nicht mit eingerechnet, kam ich auf 43. Die Bekanntgabe dieser Zahl sorgte in meiner Umgebung für offenstehende Münder und Basedowsche Augen. Die meisten Menschen haben nur 13 oder 14 Elektrogeräte. Noch größer wird das Glotzen und Maulaffenfeilhalten, wenn ich hinzufüge, daß zu meiner Bilanz weder ein Fön noch ein Bügeleisen und erst recht kein elektrisches Tranchiermesser beiträgt, weil ich grundsätzlich nicht föne, bügele und tranchiere. Angeblich soll ein Fön dazu gut sein, die Preisschilder von CDs zu entfernen, sie lösen sich unter der Heißluftdusche, aber ich käme mir dumm vor beim Fönen von Tonträgerbehältern. Einige Elektrogeräte schätze ich aber sehr, z.B. meine elektrische Zahnbürste. Zum Reinigen einer elektrischen Zahnbürste ist übrigens eine mechanische Zahnbürste sehr geeignet, wogegen man noch nie davon gehört hat, daß Rockmusiker ihre elektrischen Gitarren mit akustischen Gitarren putzen. Man hört überhaupt nur sehr selten, daß Rockmusiker ihre Instrumente reinigen, obwohl die Gitarren nach einem matschigen Rockfestival bestimmt nicht schöner aussehen als die Gummistiefel der Queen nach einem nächtlichen Ritt durch ihr aufgeweichtes Reich.
Viel Freude bereitet mir meine Geschirrspülmaschine. Sie ist sowohl Sportgerät als auch Beruhigungspulver. Der Sport besteht darin, daß ich versuche, so viel wie möglich in sie hineinzustopfen. Wenn andere Leute sagen würden: Die ist jetzt aber wirklich voll, dann räume ich noch einmal um, positioniere die Töpfe anders, stelle die Teller enger, und wenn dadurch Platz gewonnen wurde, trinke ich extra noch ein Glas Saft, nur damit ich auch dieses Glas noch hineinstellen kann. Nun endlich erlaube ich der Maschine, ihre beruhigenden Geräusche zu entfalten. Früher dachte ich immer, Geschirrspülmaschinen würden klappern. Doch nein, sie erzeugen ein sanftes Rauschen und Strullen, man fühlt sich beruhigt wie ein Kind, das in seinem Bettchen liegt und denkt: «Es rauscht, es strullt. Mutti ist also zu Hause, es ist alles in Ordnung.» Man könnte das Geräusch auch mit Meeresbrandung vergleichen, die man durch ein geschlossenes Hotelfenster hört, aber das ist kein guter Vergleich wegen der Möwen, die zum Brandungsrauschen mit dazugehören. Besser vergleiche man das Geschirrspülmaschinengeräusch mit Meeresrauschen im Mutterleib, aber nicht aus der Perspektive des Fötus, sondern aus der Perspektive des die werdende Mutter umarmenden Kindsvaters. Der Mann denkt lieb: «Pazifik tost in meiner Frau, da werden wir wohl Zukunft haben.»
Am schönsten ist es, wenn der Geschirrspüler läuft, Regentropfen «klopfen» an die Fensterscheiben, im Nebenzimmer brabbelt ein Nachrichtensprecher leise Weltpolitisches vor sich hin, und man sitzt in der Küche und schält Äpfel für den Apfelkuchen, der im Sitznachbarn der Geschirrspülmaschine, dem wunderbaren Backofen, bald gebacken werden wird. Man ist beheimatet, die Welt ist nebenan bis draußen, die Zukunft sitzt als Weltgeschichte vitaminverwöhnt und froh im Mutterleib.
Wenn man Gästen selbstgebackenen Kuchen vorsetzt, können manche gar nicht fassen, daß man den wirklich selbst gebacken hat. Die meisten backen nie und halten das infolgedessen für eine geheimnisvolle Kunst. Daher die Backmischungen in den Supermärkten, die nur aus Zucker, Mehl und Backpulver bestehen, allerdings fünfmal so teuer sind wie einzeln gekauft. Butter, Eier und alles andere muß man hinzufügen. Verglichen mit dem Kochen ist Backen aber kinderleicht. An den Türen vieler Friseure klebt ein Aufkleber mit dem Wortlaut: «Was Friseure können, können nur Friseure». In Analogie dazu müßte, wenn es mit rechten Dingen zuginge, an den Türen der Bäcker (zumindest der meisten Berliner Bäcker) stehen: «Was Bäcker können, können die meisten Menschen besser als Bäcker». Jeder, der neu nach Berlin zuzieht, wird nach nicht langer Zeit in die heimliche Nationalhymne der Stadt einstimmen, ein seit Jahrzehnten oft vernommenes Klagelied namens «In Berlin kriegt man nirgendwo ein anständiges Stück Kuchen». So oft man diese Hymne hört, so unbeeindruckt von ihr bleiben die Berliner Bäcker, denn böse Bäcker kennen keine Lieder bzw. sie kennen schon Lieder, aber die Lieder, die sie sich endlich mal hinter die Löffel schreiben sollten, die kennen sie nicht. Nach der Wende sind etliche West-Berliner zu Bäckern in den Ostteil gefahren, was sich wegen der Brötchen einige Jahre lang auch tatsächlich lohnte, aber der Kuchen war dort auch nie gut. Man muß halt selber backen, jedoch sollte man dies weniger zwecks Übertrumpfung der Bäcker als wegen des guten Geruchs in der Wohnung tun. Ist die Bude verqualmt und verbläht: Rasch einen Kuchen backen!
Ich stehe also in freundschaftlichem Einvernehmen mit meinen Elektrogeräten, denn sie verbreiten gute Geräusche und Gerüche.
Doch schwarze Schafe gibt es überall.
Die ärgerliche Angelegenheit begann vor gut zwei Jahren. Ich sauge gerne Staub. Ich liebe das knisternde Geräusch, wenn Krümel und kleine Steinchen das metallene Rohr hinauffliegen. Mein alter Staubsauger lahmte aber schon seit langem. Das Wort Saugkraft war für ihn nur noch eine aschfahle Reminiszenz an Tage stets vor dem Überkochen stehender Mannbarkeit, an Hosen voll immer mehr und immer wieder wollendem Natterngezücht, an Bergwiesen voll singender Mädchen auf der Suche nach den berühmten wilden Berg- und Talaprikosen von Aquilatxarantxa gewissermaßen. Eines Tages hörte ich im Hörfunk von einem Wunderding aus England, einem Staubsauger, der gar nicht in der Lage sei, seine Saugkraft einzubüßen, weil er nämlich ohne Staubbeutel funktioniere. Ich hörte immer wieder von dem Gerät, ich hörte davon auf Promenaden, Flaniermeilen und Boulevards, in Kurmuscheln, Arkaden und Künstlerlokalen.
Zum Thema Künstlerlokal darf ich eine Bemerkung einfügen. Wenn zwei Künstler miteinander einen heben gehen, sagt man, die beiden verbinde eine Künstlerfreundschaft. Man scheint eine solche Beziehung für etwas so Intensives und Außergewöhnliches zu halten, daß man meint, sie verdiene einen besonderen Namen. Wenn zwei Elektriker miteinander ausgehen, sagt man nicht, die beiden hätten eine Elektrikerfreundschaft. Künstler führen freilich auch keine normale Ehe, sondern eine Künstlerehe, und wenn sie ausgehen, dann zieht es sie in Künstlerlokale. Davon gibt es zwei Sorten. Einmal die traditionellen. Darin sitzen alte Zauseln, sogenannte Originale, und diese zeichnen sich durch eine Vorliebe für Urtümliches und Deftiges aus, weshalb es in diesen Gaststätten immer Bratkartoffeln gibt, von denen es heißt, Curd Jürgens habe schon von ihnen geschwärmt, und bevor er nach Amerika geflogen sei, habe er sich von Lilo oder Hertha – so heißen Künstlerlokalwirtinnen – eine Portion einpacken lassen und sie in New York im Waldorf Astoria vom Empfangschef aufwärmen lassen. Hinter ihm habe Yul Brynner gestanden und auch einchecken wollen, aber der habe hübsch warten müssen, bis der Rezeptionist die Künstlerbratkartoffeln für Curd Jürgens warm gemacht habe. So etwas erzählt man sich gern im Künstlerlokal, unter der Galerie aus signierten Fotos von Gert Fröbe, Lilli Palmer, Curd Jürgens natürlich und dem ganz jungen Mario Adorf. Heutigere Künstler hängen dort selten, denn die sind, so denkt Lilo, Lackaffen und wollen keine Bratkartoffeln mehr, die wollen Wildreis, aber den macht Hertha nicht. Wildreis, wo käme sie denn da hin, sie sei doch nicht vom wilden Affen gebissen, wie laut Lilo Hänschen Rosenthal zu sagen pflegte, der natürlich auch an der Wand hängt, mit Ilse Pagé oder Alice Treff einer Kamera zuprostend. Es gibt auch moderne Lokale, die um den Ruf bemüht sind, Treffpunkt von Künstlern zu sein, und dort gibt es freilich Wildreis säckeweise, aber kaum Künstler, sondern Werber, Seriendarsteller und Medienmenschen, und die erzählen sich keine Künstleranekdoten, sondern sprechen über ihre neuesten Elektrogeräte.
Von dem vielumwisperten englischen Wunderstaubsauger gab es bald auch Bilder. Das Gerät sah herrlich aus. Einerseits erinnerte es ganz schwach an jene Triops genannten Urkrebse, deren Eier man als amerikanische Wundertüte in naturwissenschaftlichen Museen kaufen und im heimischen Gurkenglas schlüpfen lassen kann; die so von Kinderhand gezüchteten jurassischen Nachzügler werden vermutlich in der Toilette ihr Nesthäkchendasein beenden. Noch schwächer erinnerte der Staubsauger an Aibo, den interaktiven Roboterhund aus Japan, obgleich es den noch gar nicht gab, als ich die Staubsaugerbilder in den Zeitschriften bestaunte. Ich rief alle Media-Märkte und ähnliche Superstores an, ob sie den DYSON DC 02 mit dual cyclone technology vorrätig hätten, und überall hieß es, man zögere sehr, das Gerät ins Sortiment zu nehmen. Nach einem halben Jahr gab es die grau-gelbe Designpreziose aber doch irgendwo. Leicht waren die Einzelteile zusammengesteckt, enorm war die Saugkraft. Bilder von urzeitlichen Staubstürmen kamen mir in den Sinn, als ich beobachtete, wie sich der durchsichtige Behälter mit Zusammenwehungen grauer Gewölle füllte. Ich zog ein elektronisches Goldfischglas hinter mit her, in dem ein Wetter herrschte wie auf der Venus. Das ist mehr als Staubsaugen, das ist Staubernte, das ist nicht einfach Schmutz, das ist kosmischer Prachtschmutz, jubilierte ich. Hinterher würde ich meine Ernte begutachten wie eine gelungene Wertschöpfung – alles selbst erzeugter Schmutz! –, und ich würde den Staubtopf vom Gerät lösen und meinen Gästen sagen: «Guckt mal, vor einer halben Stunde lag all der Schmutz, den ihr hier sehen könnt, noch auf diesem Teppich!» Doch leider – au! Ein elektrischer Schlag. Und, au, noch einer. Immer wieder bekam ich kleine elektrische Schläge versetzt, dabei habe ich nirgends synthetischen Teppichboden liegen, sondern überall persisches Handwerk. Ich griff zur Gebrauchsanweisung. Dort steht: «Es kann passieren, daß sie kleine elektrische Schläge bekommen, aber das ist kein Anlaß zur Beunruhigung.» Netter wäre es gewesen, allerdings auch geschäftlicher Selbstmord, wenn die Herrschaften diese Information groß auf den Karton und in ihre Anzeigen geschrieben hätten.
Ganz schlimm wird’s, wenn der Staubtopf voll ist. Nach dem ersten Versuch dürfte jedem klar sein, daß man ihn unmöglich in der Wohnung ausleeren kann. Man braucht zumindest einen Balkon, aber es muß absolut windstill sein, und es geht nur zu zweit. Einer muß einen Plastiksack aufhalten, und der andere schüttet. Hinter ihrem Mundschutz schimpfen beide, was das denn für Irre seien, die einen Staubsauger ohne den seit Jahrzehnten bestens bewährten Staubbeutel lancieren oder gar kaufen, da könnte man ja ebensogut Uhren ohne Zeiger, Frauen ohne Schatten, Bier ohne Alkohol auf den Markt werfen oder sogar Globusse ohne Island und dies ohne jenes und jenes ohne dies –
Man könnte hier natürlich noch ewig herumsitzen und die x-ohne-y-Liste verlängern, aber irgendwann möchte man ja auch mal nach Hause, und deswegen werden die Pferde jetzt entsattelt und kriegen einen Gute-Nacht-Kuß, oder was genau macht man abends mit Pferden? Ich glaube schon, daß man ihnen den Sattel abnimmt und sie einer Gute-Nacht-Striegelung teilhaftig werden läßt, aber die Hufe läßt man dran, die werden ihnen nicht jede Nacht abgekloppt. Insofern ist jetzt Feierabend, aber weil ich den Globus ohne Island bereits kurz erwähnte, meine ich, es käme einem Auspinkeln von geweckter Neugierde gleich, wenn ich hier nicht noch drauf einginge. Wolfgang Müller, der Künstler und Islandexperte, entdeckte in einem Schreibwarengeschäft einen Bleistiftanspitzer in Form eines Globus und stellte fest, daß Island darauf vergessen worden war. Er rief bei der Herstellerfirma an und wies auf den Mangel hin. «Das interessiert doch keinen Menschen!» ranzte der Globusbleistiftanspitzerboss in die Muschel. Ich würde sagen, eine Art ist das nicht.
Rille ralle ritze ratze (Harte Haare)
In der Münchner Innenstadt kann man eine Sorte Damen herummarschieren sehen, über welche ich bis vor kurzem mutmaßte, daß es sie in Berlin nicht gebe. Diese Damen tragen Lodenmäntel, und um die Schultern haben sie sich fransige Dreieckstücher drapiert, die erschossene Enten, Halali-Hörner und sonstige Jagdmotive zeigen. Wäre es schicklich, auf ihre Haare zu fassen, könnte man sich an einer leicht knisternden, nachgiebigen Härte ergötzen. Mit einer Mischung aus 90 Prozent Desinteresse und 10 Prozent Entzücken habe ich einmal ein Exemplar, dessen Wimpern mit Tuschebatzen knefig schwarz bepelzt waren wie ein Klatschmohnstengel mit Läusen, dabei beobachten können, wie es ein winziges Schälchen chilenischer Himbeeren für 16 DM erstand und in einem arttypischen Weidenkorb mit Klappdeckel versenkte. Ich dachte: Das sind denn wohl auch die Leute, die die Steinchen kaufen, die das Toilettenspülwasser blau machen.
Seit mich neulich ein Preisgepurzel ins KaDeWe lockte, weiß ich, daß man Ententuchmatronen, komplett mit Haaren hart wie Hardrock, auch in Berlin beobachten kann, aber nur am Vormittag von Montagen. Wie von geheimen Kommandos gesteuert, entströmen sie ihren südwestlichen Villen, wo Kieswege Doppelgaragen anknirschen, und schreiten entschlossen durch bessere Geschäfte, einander nicht kennend, doch verabredet wirkend. Ich nehme an, daß sie u.a. an Sammeltellereditionen, Gedenkfingerhüten und Teewagen Interesse haben. Teewagen sind ein ziemliches Desaster. Wenn meine Mutter Femme-fatale-Ambitionen überfielen, stellte sie in der Küche das Kaffeegeschirr auf den Teewagen, um diesen zum ca. sechs Meter entfernten Wohnzimmertisch zu rollen. Auf dem Wege waren aber zwei Türschwellen und drei Teppichkanten zu überwinden, was mit einem ganz erbärmlichen Angehebe, Geruckel, Gezerre und Übergeschwappe einherging. Es ist, nebenbei erwähnt, für die Entwicklung von Jugendlichen schädlich, wenn sie ihre Mütter bei derart ungraziösen Zurschaustellungen beobachten müssen. Manch einer soff später oder stand auf bedenklich dünnen Beinen an übelbeleumundeten Straßenkreuzungen.
Zurück ins KaDeWe. Es hat wenig gefehlt, und ich hätte mir einen auf 250 DM herabgesetzten Hausmantel gekauft. Zwar bin ich zu 99 Prozent erbitterter Gegner jedweden Gockel- und Geckentums, und ich hab schon mehr als einmal Herren, die allzu bunte Hemden trugen, mit finsteren Blicken überzogen, von denen ich auch Frauen nicht verschont lassen kann, die Lockenungetüme spazierentragen. Der wichtigste Damenkopfmerksatz lautet: Helm statt Mähne. Leitbild ist hier die Königin der Niederlande; der kann man einen Teewagen an den Knopf knallen, und sie merkt’s nicht. So ist sie immer fit fürs Amt, während die Löwenmähnen blutend im Bett liegen.
Zu einem einzigen, wenngleich auffallend hübschen Prozent bin ich jedoch Propagandist verschwollenster Dandyismen. Ich strich verträumt über Hausmantelseide und sah mich meine Klause durchmessen, eine Schlafbrille auf die Stirne geschoben, hinter welcher sich belanglose Reizwörter zu unverständlichen Gedichten zusammenballten, für die ich schon einen ausreichend dummen Verleger gefunden hätte. Auf dem Teewagen glitzerte die Morphiumspritze; unter dem heruntergesetzten Hausmantel flüsterte und schrie der Körper den Wunsch, sie zu benutzen. Gamaschen hatte ich auch an, obwohl ich gar nicht genau weiß, was Gamaschen sind. Und ein Spitzel war ich, egal für wen. Nichts aromatisiert die Biographie eines Halbseidenen mehr als politische Irrfahrten. Bald hatte ich aber genug von den albernen Hausmänteln und den durch sie geborenen Visionen, kaufte daher keinen, sondern schnöde Strümpfe, schmelzte mir daheim einen Spinatklotz, und bald war es Abend und Fernsehzeit.
Ein kleiner Fernsehstar ist zur Zeit Nicole Okaj. Das ist die junge Dame, die am Ende der Reklame für «always ultra» sagt: «Die Leute, die diese Binde entwickelt haben, die haben sich wirklich etwas gedacht dabei.» Ich verehre diesen Satz, spielt er doch auf die Möglichkeit an, daß es auch Bindenentwickler gibt, die ihrer Profession gedankenlos und nebenbei nachgehen. Man denkt sich schusselige Wissenschaftler mit Dotterresten im Bart, die abwesend in Kübeln rühren, plötzlich hineinschauen und rufen: «Huch, Damenbinden!» Um die sturzbachgerechte Saugfähigkeit dieser Binden zu demonstrieren, wird auch eine blaue Flüssigkeit auf sie herabgekippt. Hinreißend ist es, daß man es für notwendig hält einzublenden, daß es sich um eine Ersatzflüssigkeit handelt. Hier erfreut betuliche Dezenz. Lautete die Einblendung statt Ersatzflüssigkeit Wick Medi-Nait, Curaçao oder Toilettenspülwasser aus hygienehysterischem Ententuchfrauenklo, würden die Fernsehzuschauer unruhig auf ihren Polstergarnituren herumrutschen.
Interessieren würde mich, wie Nicole Okaj rumpfunterhalb beschaffen ist. Trüge sie eine grüne Damencordhose mit Bügelfalte, wäre ich ganz außerirdisch vor Glück, es würden quasi SAT-1-Bälle auf mich niederrieseln, so froh wäre ich. Ich setzte mich zu ihr aufs Sofa und führe mit den Fingernägeln in den Rillen ihrer Cordhose hin und her.
Rille ralle ritze ratze würd ich selig singen. Mit der anderen Hand würde ich auf ihren hoffentlich recht hart besprühten Haaren herumklopfen. Die Psychologen unter den Lesern sollten hier der Analyse entraten und lieber ihre dreckige Wohnung aufräumen. Da liegen Krümel auf dem Teppich! Neben der Stereoanlage liegt ein Knäuel miteinander verknoteter, kaputter Kopfhörer! Machen Sie das weg! Die Libido streunt gern auch mal abseits der Hauptverkehrsachsen, da gibt’s gar nichts zu deuten.
Nun ist Nicole gegangen. Auf dem Sofa, wo sie saß, ist ein kleines, blaues Pfützchen. «Rille ralle ritze ratze» hat sie arg in Wallungen gebracht. Meine Kolumne ist aus, dort läuft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große, große Pelzkappe daraus machen.
Klärendes und Triftiges
Pünktlichkeit plus
Verspätungen sind unbeliebt und werden so ungünstig wie möglich interpretiert. Erscheint z.B. ein Künstler nicht zur angekündigten Zeit auf der Bühne, stellen sich die Zuschauer vergnügt vor, wie der Manager in der Garderobe an dem in seinem Erbrochenen liegenden Star-Wrack herumrüttelt und wie ein Arzt mit zweifelhafter Vergangenheit diesem eine Droge injiziert, die die Wirkung jener Droge aufheben soll, die sich der Künstler selbst zugeführt hat. Die Möglichkeit, daß der Veranstalter um Verschiebung des Auftrittsbeginns gebeten hat, weil es am Einlaß Probleme gibt, wird als zu unglamourös nicht in Betracht gezogen. Und selbst wenn der Veranstalter die Bühne betritt und verkündet, die Verzögerung habe technische Gründe, er danke für das Verständnis, denkt das Publikum: «Jaja, Verständnis. Technische Gründe. Kennen wir. Die kriegen wahrscheinlich die Drogendose nicht auf.»
Kein Wunder, daß manche Leute panische Angst davor haben, sich zu verspäten. Wenn mein Großvater zu seinem Stammtisch fuhr, hat er immer einen Bus früher als nötig genommen. Er lief lieber jeden Mittwoch zwanzig Minuten vorm Musikhaus Hack auf und ab und guckte sich die Orffschen Raschelinstrumente an, als seinen Skatfreunden Gelegenheit zu höhnischen Vermutungen zu geben. Andere Menschen beunruhigt der Gedanke, ungewöhnlich früh aufstehen zu müssen, z.B. wegen einer Flugreise. Schon eine Woche vorher beginnen sie, täglich jeweils eine halbe Stunde früher aufzustehen, damit sie am Vorabend der Reise müde genug sind, drei Stunden früher als normal ins Bett zu gehen.
Zu Unrecht im Schatten der Kritik an Verspätungen stehen die Einwände gegen die Verfrühung. Was ich schon immer ahnte, ist mir Gewißheit, seit ich im Besitz einer von der Atomuhr CS1 in der Braunschweiger Technischen Bundesanstalt gesteuerten Funkarmbanduhr bin. Die einzigen beiden Fernsehserien, die ich mir absichtlich und mit voller Geistesanwesenheit anschaue, beginnen oftmals zu früh. Die ‹Lindenstraße› fängt oft bis zu 40 Sekunden zu früh an, aber noch viel unpünktlicher erscheinen die ‹Simpsons›. Mal bis zu vier Minuten zu spät, mal aber auch viel zu früh. Um wegen der schwankenden Anfangszeit nichts zu verpassen, habe ich mir angewöhnt, den Fernsehapparat schon zeitig anzustellen, wodurch ich öfters noch die letzten Minuten einer durch und durch mysteriösen amerikanischen Krankenhausserie namens ‹Chicago Hope› mitbekomme. Stets erklingt eine einfache, «melodramatische» Musik, die mitteilt, daß hier gerade intensiv in zähflüssigen Schicksalsfluten gebadet wird. Gern und oft wird geweint. Die Menschen sind immer damit beschäftigt, Ungeheuerliches zu verkraften. Leis und langsam sind die Dialoge zwischen denen, die verkraften, und den anderen, die das Verkraften unterstützend begleiten. Gelegentlich setzt sich auch einer ans Klavier und singt mit tränenerstickter Stimme ein Lied. Was genau sie verkraften, weiß ich nicht. Eine zu frühe Geburt vielleicht, einen zu frühen Tod, ein zu frühes Verkraften-müssen. Was zu Frühes jedenfalls. Ich habe noch nie eine ganze Folge gesehen. Vier Uhr nachmittags ist mir einfach zu früh.
Auch nicht gut ist ein zu frühes Kommen. Ich meine das nicht im sexuellen Sinne. Sicher, wenn der Mann zu früh «kommt», dann schlägt die Frau mit den Fäusten auf das Nachttischschränkchen, ruft «So geht das nicht!» und schleppt den Partner anderntags zu einer raffgierigen geschiedenen Hausfrau, deren Adresse sie vom Fax-Abrufservice der Sendung ‹Wa(h)re Liebe› hat. Die Dame ist Orgasmusberaterin, wohnt in einem Hochhaus mit nach Urin riechendem Fahrstuhl und sagt an der Tür «Ich bin die Gaby. Kommt rein», und das Ehepaar denkt: «Mein Gott, hat das Weib häßliche Möbel.»
Meine Kritik bezieht sich vielmehr auf unsexuelles Kommen, auf das Besuchen. Es ist sehr wichtig, Besuch zu empfangen. Immer wieder hört man von Personen, die nie Besuch bekommen. Inmitten von tausenden von Bierbüchsen und verdorbenen Lebensmitteln wird die Leiche entdeckt. Im Bett einundzwanzig mumifizierte Katzen. Hier ihre Namen: Muschi, Mutzi, Batzi, Tosca, Sherry-Lou, Funky, Minki, Volker, Lulu, Meike, Mandy, Patty, Pablo, Karlsquell, Lissi, Hanni, Nanni, Aznavour, Sokrates, Felix – aber damit soll’s gut sein. Katzennamen halt. Alle 21 will ich hier nicht aufzählen. Entrümpelungsfachleute mit Gasmasken müssen die Wohnung ausräumen, begleitet vom Ruckedigu der im Badezimmer nistenden Tauben.
Soziale Kontrolle ist das ideale Mittel gegen die Verwahrlosung. Da aber bei Leuten, die nie im Gefängnis waren, keine Bewährungshelfer und bei Kinderlosen niemand vom Jugendamt aufzukreuzen pflegt, muß man rechtzeitig sogenannte Treffpunkte aufsuchen, Arbeitsplätze, schummrige Bars oder Joga-Kurse, sich dort durch unverzagte Fingerzeige seine persönlichen sozialen Kontrolleure, in der Umgangssprache auch Freunde genannt, aussuchen und diese durch das Inaussichtstellen von Gratisgetränken und Knabberwerk bewegen, einen in sinnvollen Abständen zu besuchen und ein bißchen, nicht allzu auffällig freilich, nach dem Rechten zu schauen, in ernsten Fällen vielleicht auch mal zu fragen: «Du, sag mal, diese Katzen auf deinem Bett – direkt schnurren tun die doch nicht mehr, oder?» In der Stunde vor dem Eintreffen des Gastes hat man vieles zu erledigen: wischen, Teppiche klopfen, die Unterseite der Klobrille reinigen, Getränke kalt stellen, Gardinen waschen, Fingernägel schneiden, sich Gesprächsthemen auf die Handinnenfläche schreiben – es ist eine rechte Hektik. Für jede Minute ist man dankbar. Nun geschieht aber das Scheußliche, und statt um 20 Uhr klingelt der Gast eine Viertelstunde früher! Was für eine Roheit!
Natürlich sitzt man ungekämmt auf der Toilette und putzt sich mit einer Hand die Zähne und mit der anderen Hand die Schuhe. Mit Zahnpastaschaum im Mund geht man zur Tür, und der Gast plappert fröhlich: «Ich hatte die Entfernung überschätzt. Hätte ich etwa noch eine Viertelstunde um den Block gehen sollen?» Falsch verstandene Höflichkeit gebietet es nun, den Schaum herunterzuschlucken und «Aber nein» zu sagen, obwohl die einzige richtige Antwort hätte lauten müssen: «Ja, selbstverständlich hättest du bis acht Uhr um den Block gehen müssen.» Kleine Verspätungen sind, zumindest bei Hausbesuchen, nicht schlimm und entschuldbar. Verfrühungen aber sind eine leicht vermeidbare Unfreundlichkeit und unverzeihlich.
Einmal erwartete ich einen Tisch. Seine Lieferung war mir für die Zeit zwischen 8 und 13 Uhr versprochen worden. Um halb acht verließ ich das Haus, um mir Frühstückslektüre zu holen. Als ich um zehn vor acht zurückkam, fand ich einen Zettel an der Tür, auf dem es hieß, ich sei während der vereinbarten Lieferzeit nicht daheim gewesen. Mein Telephon sieht noch jetzt ganz mitgenommen aus von den berechtigten Schmähworten, welche ich dem Möbelhaus übermittelte. In solchen Fällen sollte man streitbar sein, notfalls bis vors Bundessonstwasgericht gehen, so wie der eine Gymnasiast, der dadurch berühmt wurde, daß er nicht zum Chemieunterricht gehen wollte, oder die hartnäckige Bürgerin, die seit zwanzig Jahren dafür kämpft, daß sie nicht mit Frau Rechenberg, sondern mit Dame Rechenberg angeredet wird, weil man ja auch nicht Mann, sondern Herr Rechenberg sage.
Ist nun aber Pünktlichkeit die Lösung? Nein, nein, gar nicht. Vor einigen Jahren traf ich mich am Bremer Hauptbahnhof mit einigen Herren, um mit ihnen den in einem niedersächsischen Dorf lebenden Schriftsteller Walter Kempowski zu besuchen. Während der Autofahrt beratschlagten wir uns, wie wir den Besuch gestalten könnten, ohne den von uns verehrten, als eigenwillig bekannten Autor zu nerven. Zweierlei war uns bekannt: daß Herr Kempowski die Pünktlichkeit schätzt und daß er Ludwig den Frommen für die verachtenswerteste geschichtliche Gestalt hält. Dies wußten wir aus dem Fragebogen des Magazins der ‹Frankfurter Allgemeinen Zeitung›, und somit war uns klar, daß wir auf keinen Fall das Gespräch auf diese historische Figur lenken sollten, was uns aber nicht in Schwierigkeiten brachte, da Ludwig der Fromme uns allen recht fremd war – wir gehörten einfach nicht zu dem erlauchten kleinen Zirkel, in dem Ludwig der Fromme noch für Schweißausbrüche sorgt. Das mit der Pünktlichkeit aber nahmen wir ernst. Wir standen vor der Haustür, ich blickte auf meine Braunschweiger Atomarmbanduhr, und wir begannen einen richtigen kleinen Mondraketen-Countdown: zehn Sekunden vor 15 Uhr, neun Sekunden, acht Sekunden, usw. usf., eine Sekunde vor 15 Uhr – KLINGELN. Herr Kempowski öffnete die Tür und sagte:
«Das ist ja schon fast peinlich, wie penetrant pünktlich Sie sind.»
Inzwischen weiß ich, daß es am freundlichsten ist, bei einer solchen Einladung zehn bis fünfzehn Minuten nach dem vereinbarten Termin zu erscheinen. Der Gastgeber wird dann entspannter angetroffen. Man lasse ihn noch einmal schauen, ob wirklich keine Krümel oder private Sexfotos auf dem Tisch liegen. Sonst kriegt man zwar recht wunderbar die Arbeitsweise des Künstlers erläutert, bekommt die delikatesten biographischen Splitter geliefert, aber hinterher, auf dem Weg vom Autor zum Auto, sagt man nur: «Der hatte ja lauter Krümel und private Sexfotos auf dem Kaffeetisch liegen.»
Diese menschenfreundliche leichte Verspätung ist nichts Neues. Früher sprach man vom «akademischen Viertel». Aber das ist ein obsoleter Ausdruck. Ich schlage vor, von Pünktlichkeit plus zu sprechen, denn dieses nachgestellte plus ist z.Zt. ein großer sprachlicher Hit. Es gibt ein Erfrischungsgetränk namens Apple plus. Es handelt sich um mit Mineralwasser gemischten Apfelsaft. «Früher hieß so etwas Apfelschorle», mögen nun Scharfzüngige einwenden. Gewiß. Aber auf andere Beispiele läßt sich das nicht übertragen, z.B. das neue Konto Postbank Giro Plus hieß früher nie und nimmer Postbank Giro Schorle. Im allgemeinen will das plus wohl sagen, daß man uns mit allerlei Bonusleistungen und Serviceergänzungen zu ergötzen trachtet. Beim Nahrungsergänzungsmittel Calcium plus z.B. wird das nahrungsergänzende Calcium noch zusätzlich durch die Bonusergötzung Magnesium ergänzt. Fordert man die Generation Sixty plus zu einem schwungvollen Dasein auf, kriegt man zusätzlich zu den Sechzigjährigen auch rastlose Siebzig- bis Hundertjährige vor die Kamera. Die Telekom-Tarifsbereichbezeichnung City plus will meinen, daß man zum gleichen Preis wie innerhalb Berlins auch noch mit irgendwelchen ätzenden Kleinstädten in Brandenburg telephonieren kann.
Sollte Deutschland mal den Wunsch haben, seine europäischen Nachbarn, insbesondere das euroskeptische Britannien, mit einem unsensiblen Späßchen zu reizen, dann rate ich dazu, in Brüssel zu beantragen, die Europäische Union in Germany plus umzubenennen.
PS: Neulich war ich in einer der «ätzenden brandenburgischen Kleinstädte», und dort sah ich einen Kuchenstand, der mir ausgezeichnet gefiel. Über ihm hing ein Transparent mit der Aufschrift: 8 Jahre PDS, 6 Jahre Kuchenstand der PDS.
Es soll keiner dabei sein, den man nicht kennt
Für den Fall, daß das Gespräch stockt, gibt es ein Repertoire harmloser Fragen, auf die jeder etwas sagen kann. So fragte man mich neulich, was ich täte, wenn ich unvorstellbar viel Geld hätte. Ich wußte nicht so recht.
An Autos habe ich gar kein Interesse, an teurer Kleidung nur ein theoretisches, also kein tatsächlich in Boutiquen führendes. Neulich sah ich ein extrem nobles Bett aus der Kollektion «Gentleman’s Home», ich dachte, hey, das ist ein richtig cooles Sterbebett, da können sie dann alle drumherumsitzen mit ihren Stirnabtupfschwämmchen – aber ich habe mir schon vor drei Jahren ein neues Bett gekauft, und einer, der sich alle drei Jahre ein neues Sterbebett zulegt, über den werden die Menschen tuscheln und sagen, der wechsele seine Sterbebetten, wie diejenigen Leute ihre Liebhaber wechseln, über die wir Liebhaber abgewetzter Redensarten immer tuscheln, daß sie die Liebhaber wie ihre Socken wechseln würden. Außerdem kostete das Bett nur 20000 Mark. Das ist etwas dürftig für großen Reichtum. Für eine Villa mit Garten wiederum braucht man Personal – Personal, dessen Arbeitseifer ständig zu überwachen wäre. Immer würde man mit dem Zeigefinger über Kommoden streichen und rufen: «Ha! Staub! Gehaltsabzug!»
Man würde ein mißtrauischer Mensch werden, würde bemerken, daß die Housekeeperin heiser in ein Telephon flüstert, würde gerade noch verstehen: «Du – ich muß Schluß machen, der Alte kommt», und wie man den Salon betritt, sieht man die Hausdame einen Blumenstrauß rearrangieren und hört sie scheinheilig ein Lied pfeifen, worauf man fragt: «Mit wem haben Sie denn telephoniert, Frau Harrison?» Die Antwort lautet: «Telephoniert? Ich? Sie sollten mehr unter Menschen gehen, wenn Sie Stimmen hören.» Bald schon ist man nervenleidend, da kriegt man heiße Milch ans Bett gebracht, die aber seltsam schmeckt, und so wird die Frage gestellt: «Die heiße Milch, die schmeckte so nach Bittermandel, wie kann das bitteschön möglich sein?»
«Menschen, die einsam, reich und nervös sind», kommt es zur Antwort, «haben oft einen bitteren Geschmack im Mund – auch die letzte Herrschaft, der ich diente, Reichsmusikrat Häberle, hatte in den Wochen vor seinem Tode, den die Herren vom Feuilleton – und natürlich auch ich! – als arg verfrüht empfanden, oft über eine bittere Note im Munde geklagt – das ist also ganz normal», sagt Frau Harrison nun. Daher: Bloß keine Villa im Falle großen Geldes.
Lieber würde ich mir schon ein kleines Sanatorium in einem Luftkurort kaufen. Nicht um darin zu wohnen – sondern nur, um dort zwei- oder dreimal im Jahr mit offenen Armen und vor absolut echter Freude strahlenden Zähnen empfangen zu werden. Ein halbes Dutzend guter Menschen in weißen Kitteln, die wie Kinder ungeduldig auf einer Freitreppe auf- und niederhüpfen und «Da ist er! Da ist er!» rufen, sobald sie mein Taxi dem Sanatorium sich nähern sehen, das sollte mir schon noch vergönnt sein im Leben. Nach den üblichen Vorsorgeuntersuchungen und Anwendungen gäbe es ein Diner in einem auserlesenen Kreis aus Politik, Kultur und Wissenschaft, von dem ich mich früh zurückzöge, um mir nebenan in einer Bibliothek, schön ausgestattet mit der Liege «Duke», dem Tisch «Churchill» und dem Hocker «Edward» aus der Collection «Gentleman’s Home», unter ärztlicher Aufsicht Heroin spritzen zu lassen.
Seit langem wünsche ich mir, einmal Heroin auszuprobieren. Es ist kein besonders dringlicher Wunsch, eher ein vager Plan wie: Ich möchte gern mal eine Rundreise auf den Azoren machen. Es ist mir egal, ob es nächstes Jahr passiert oder in fünfzehn Jahren, und ich würde mein Leben auch nicht als ein verpfuschtes ansehen, wenn es gar niemals geschähe. Wohl gab es schon Gelegenheit, die Droge auszuprobieren, aber es waren unbehagliche schmuddelige Gelegenheiten, es war zuvor Alkohol geflossen, es waren Leute dabei, die ich nicht kannte, ich mochte die Musik nicht, und die Küche war schmutzig. Ich dachte: Nee, das isses jetzt nicht. Ich will lieber auf den richtigen warten – den richtigen Moment. Ich möchte hier nicht bis sonstwann herumliegen und dann mittags mit einem schrecklich trockenen Mund voll ungeputzter Zähne in einem Doppeldeckerbus voll lärmender Schüler nach Hause fahren und mich nicht wirklich interessanter fühlen als auf herkömmliche Art durchgemacht.
Es soll vielmehr so sein: Ich liege in der bereits erwähnten Bibliothek auf einer Récamiere, einer der zu meinem Sanatorium dazugehörigen Ärzte, der mehr als lediglich «Ahnung» vom Verlauf meiner Venen haben sollte, injiziert mir das Rauschgift, und ein mir befreundeter Pianist beginnt mit großem Mitempfinden Schubert zu spielen. Er kann statt mit mir auch mit dem Arzt befreundet sein – es ist mir eigentlich egal, mit wem er befreundet ist, Hauptsache, seine Freunde rufen nicht an, während er spielt.
Allmählich stellt sich dann dieses mit gar nichts vergleichbare Glück ein, diese allumfassende Wärme, von der Rockstars in ihren Post-Entzugs-Interviews immer auf so überaus unpädagogische Weise schwärmen. Sollten das Glück und die Wärme von irgendwelchen physischen Unerfreulichkeiten begleitet werden, drücke ich auf einen Knopf, und sofort kommen die mich natürlich sowieso durch unauffällige Löcher in einem sich im Nebenzimmer befindlichen Gemälde betrachtenden Ärzte herbei und regulieren mich. Ich hoffe aber, das wird nicht nötig sein: Die Ärzte werden das Heroin in einem blitzsauberen Laboratorium selbst hergestellt und mit einem speziell entwickelten Computerprogramm die für mich ideale Dosis genau berechnet haben.
Nach einer vitaminreichen Erholungsphase kommt es zu einer anrührenden Abschiedsszene auf der Freitreppe. Alles hat sich eingefunden, und wir schauen einander dankbar in die Augen. Ich ergreife des Chefarztes beide Hände, wie man es tut, wenn man sich einander wirklich verbunden fühlt, und wie ich schon fast beim Taxi bin, lasse ich meinen Koffer fallen und renne noch einmal zurück, um alle zu umarmen. Im Auto sitze ich dann in frischer Kleidung, mit gut geputzten Zähnen, und sehe mich zufällig im Innenrückspiegel. Ich bemerke, daß auch der Sanatoriumsfriseur beste Arbeit geleistet hat, so gute Haare hatte ich noch nie. Soll ich den Fahrer veranlassen, noch einmal umzukehren, damit ich auch den Friseur umarmen kann? Ich denke: Nächstes Mal, er läuft mir ja nicht weg, ich bin ja sein Brotherr.
Daheim sitz ich auf nacktem Stuhl in zierdelosem Zimmer und verrichte ruhig und trocken eine harte Arbeit nach der andern, ganz so, wie’s sein soll in einer Welt von Pflicht, Verstand und Sitte. Zwischendrin frag ich mich aus: War das Glücksgefühl wirklich mit nichts anderem vergleichbar? Wenn ich dann sag, woll woll – es war schon mighty special, und wenn ich dies nach langem Inmichgehen noch immer ohne Selbstbelügung sag, dann fahre ich nach einem halben Jahr noch mal in mein Sanatorium zu meinen wunderbaren Ärzten, zum Pianisten und Friseur. Wenn nicht, dann verkaufe ich die Klinik wieder. Wenn aber doch, dann würde ich mir nach einigen Testjahren den Bundespräsidenten schnappen, ihm eine MiniDisc in den Mund schieben und ihn im Fernsehen sagen lassen: «Wäre es nicht klug, wenn wir das ganze dumme alltägliche Gesaufe und Gekiffe sein ließen und uns zweimal im Jahr auf feierliche Weise und unter Bedingungen, die unserer Kultur entsprechen, den wirklich interessanten