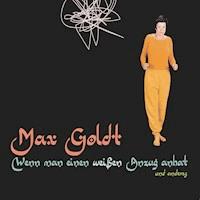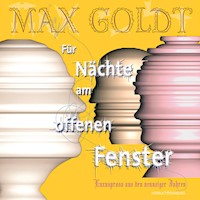9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus dem Buch: «Im allgemeinen bin ich recht zufrieden mit dem, was mir aufgetischt wird. Mich wundern allerdings regelmäßig Restaurant-Kritiken, in denen kaum jemals der Umstand berücksichtigt wird, daß ein hungriger Mensch nicht nur einen Mund hat, sondern auch zwei Beine. Ein guter Eßtisch hat meines Erachtens vier Beine, und zwar, ganz simpel, an jeder Ecke eines. Restauranttische haben jedoch oft nur einen Mittelsockel, welcher, indem er sich unten zu einem ausladenden Fuß weitet, den Gast die Füße nach außen zu biegen zwingt wie weiland Charlie Chaplins Tramp, wodurch es zu Durchblutungsstörungen kommen kann. Man will schon gehört haben, daß Menschen, die längere Zeit mit verdrehten, abgeknickten Füßen sitzen mußten, ‹obenrum› aber mit lebhafter Konversation befaßt waren – so daß das Einschlafen der Füße unbemerkt blieb –, sich beim Aufstehen einen Fuß gebrochen haben. In nostalgischen, mit Trödel ausstaffierten Lokalen wird dem Gast bisweilen sogar zugemutet, an alten Nähmaschinen-Tischen der Firma ‹Singer› Platz zu nehmen, in deren schnörkelreichem Untertischgekröse Frauen mit hohen Absätzen sich schon qualvoll verfangen haben wie ein erbeutetes Insekt im Spinnennetz.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Max Goldt
Lippen abwischen und lächeln
Die prachtvollsten Texte 2003 bis 2014 (und einige aus den Neunzigern)
Über dieses Buch
Aus dem Buch: «Im allgemeinen bin ich recht zufrieden mit dem, was mir aufgetischt wird. Mich wundern allerdings regelmäßig Restaurant-Kritiken, in denen kaum jemals der Umstand berücksichtigt wird, daß ein hungriger Mensch nicht nur einen Mund hat, sondern auch zwei Beine. Ein guter Eßtisch hat meines Erachtens vier Beine, und zwar, ganz simpel, an jeder Ecke eines. Restauranttische haben jedoch oft nur einen Mittelsockel, welcher, indem er sich unten zu einem ausladenden Fuß weitet, den Gast die Füße nach außen zu biegen zwingt wie weiland Charlie Chaplins Tramp, wodurch es zu Durchblutungsstörungen kommen kann. Man will schon gehört haben, daß Menschen, die längere Zeit mit verdrehten, abgeknickten Füßen sitzen mußten, ‹obenrum› aber mit lebhafter Konversation befaßt waren – so daß das Einschlafen der Füße unbemerkt blieb –, sich beim Aufstehen einen Fuß gebrochen haben. In nostalgischen, mit Trödel ausstaffierten Lokalen wird dem Gast bisweilen sogar zugemutet, an alten Nähmaschinen-Tischen der Firma ‹Singer› Platz zu nehmen, in deren schnörkelreichem Untertischgekröse Frauen mit hohen Absätzen sich schon qualvoll verfangen haben wie ein erbeutetes Insekt im Spinnennetz.»
Vita
Max Goldt, geboren 1958 in Göttingen, lebt in Berlin. Zuletzt veröffentlichte er «Räusper. Comic-Skripts in Dramensatz» (2015) und «Chefinnen in bodenlangen Jeansröcken» (2014). Im Jahr 2008 erhielt er den Hugo-Ball-Preis und den Kleist-Preis.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2024
Copyright © 2016 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-02247-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Die schönen Dinge und die arme Welt
Charleys Tante in der Wüste
Sodbrennen statt Snobismus, ich meine umgekehrt
Am Strand der Birnenwechsler
Mein preußischer Nachmittag
Kleiner Diskurs über kleines Gepäck
Ein Querulant hört was knarren
Prekariat und Prokrastination
Das Loch
Tätowiert, motorisiert, desinteressiert – der Kleinbürger zwischen Statistik und Traum
Weltanschauung in der Seilbahn
Über Fernsehmusik
Feichte Brott
Gastronomisches 2
Deutsche im Hotel
Schulisches
Der Amethyst
Preisung der grotesken Dame
Fans
King Kong in Flip Flops
Äpfel im Bett und Ärzte im Bergwerk
Was schön ist und was häßlich ist
Das süße Nichts (Ich weiß noch, über was wir gestern abend geredet haben)
Sie sehen so lustig aus, wie Sie auf dem Ball sitzen! (Das Jahr 2009)
Dem Elend probesitzen
Zsá Zsá Inci
Pluto soll auf einen Klumpen zurückgestuft werden
In Toronto gab es Kuchen mit Semikolon
Die Prophezeiung
Oh doch!
Der Zauber des seitlich dran Vorbeigehens
Das alte Kabel
Die Verachtung
Staunen
Nein zum Masermontag
Gedanken bei der Cranio
Die Schöneberger Gräberin
Im Visier von Pakistan und Texas
Staat, misch dich ein! Es wird auch dir nützen
Sehr wenig vom Glück
Ich hatte – verzeihen Sie! – nie darum gebeten, im Schatten einer Stinkmorchel Mandoline spielen zu dürfen
Das Alter und die teure Stadt (Fünf Gurken)
Rede des erbleichenden Dreisten
Warum wird die junge Frau geschont?
Unsere traurige technische Zukunft: Lupen und Taschenlampen
Szenen und Dialoge
Wir desertieren
Die Ministerialdirigentin Martinek am Tag, als sie das letzte Mal gesehen wurde
Der Hugo
Metrosexualität, Transparenz und die drei dümmsten Aphorismen von Oscar Wilde
Rosel Zech wird behelligt
Juliette Gréco
Penisg’schichterln aus dem Hotel Mama
Plüsch
Einige Sprachkritiken
Lippen abwischen und lächeln
Der Sprachkritiker als gesellschaftlicher Nichtsnutz und Kreuzritter der Zukunftsfähigkeit
Ein bißchen mehr Bedeutung wäre manchmal schön
Hannah Arendt hat recht
Unheimliche Geschenke
So machen es die klugen Sprachen
Die Mütter-Trilogie
Kinder fauler Mütter sprechen unbezahlt in Mikrophone
Mütter mit nach hinten
Die Verbesserung von Jessicas Mutter mit Hilfe eines Mülleimers
Ohne Mutter weiter im Text
Touristische Perspektiven für Münster
Die Chefin verzichtet auf demonstratives Frieren
Fast vierzig zum Teil recht coole Interviewantworten ohne die dazugehörigen dummen Fragen
Einige Bildbetextungen
… und einige Texte mit Wurzeln in den Neunzigern
Das innere Singen des Dampfes
Die armen Hasen
Finanztantenhappen in Freiheit heißen Hering
Herr Kosmos ist von den Menschen enttäuscht
Die Lampen leiden am meisten darunter
Lockende Wucherungen, schäbige Irrtümer
Der Mann, der sich wie die Kühe fühlt und die Frau, die nicht weiß, wann sie Middach kochen soll
Im Zaubermärchenwald der Phantasie
Die Beatles in München
Über kaltes Duschen
Quellenverzeichnis
Die schönen Dinge und die arme Welt
Charleys Tante in der Wüste
Herr Schmitt, ein alter Freund aus jungen, freiheitlichen Tagen, wurde von der Tourismusbehörde des Staates Katar auserkoren, für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» einen schönen langen Text über diesen an mangelnder Bekanntheit und schlechtem Image leidenden Kleinstaat zu verfassen. Normalerweise läßt sich Herr Schmitt auf solcherlei Reisen von seiner Gemahlin begleiten, doch die hatte «sowas von» keine Lust. Herr Schmitt daher, am Telephon:
«Sag mal, wie sieht’s’n aus? Claudia kann Wüsten nicht ab. Hättest Du nicht Lust, quasi als Gattinnenersatz einzuspringen und ein paar Tage in Doha zu verbringen?»
«Was ist denn Doha?»
«Hauptstadt von Katar, da unten bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, gehört aber nicht dazu.»
Da ich als kompromißloser Verehrer lieblich grüner Wälder, sanfter Hügel und blühender Wiesen noch nie in einem arabischen Land gewesen war, sagte ich: «Ja, wenn’s nichts kostet, dann von mir aus. Aber: Ich verkleide mich nicht als Ehegattin. Ich werde nicht Charleys Tante spielen.»
Okay okay okay. Man flog dann also.
Schon schön, ein paar Tage auf Kosten zwar vermutlich unsympathischer, aber freigiebiger Funktionäre in einem Ritz-Carlton-Hotel zu verbringen.
Schon schön, in der VIP-Etage von einem Konsortium internationaler junger Service-Damen, von Tove aus Schweden, Anna aus Prag, Laura aus Mexiko und Lorna aus Malaysia unentwegt bemuttert und betuddelt zu werden.
You want ingwer musli?
Yes!
You want red wine?
Yes!
You want the Neue Zürcher Zeitung?
Yes!
Schon schön, in monsterweichen Riesensesseln zu versinken, in der Hauptstadt eines Gasstaates, den man wenige Wochen zuvor auf dem Globus nur mit Mühe hätte ausfindig machen können. Man schaut sich um, der Look ist einem durchaus nicht unbekannt. Auch in Deutschland gibt es Hotels, die sich bereits vollkommen dem Geschmack des Mittleren Ostens unterworfen haben, das Adlon in Berlin etwa oder der Breidenbacher Hof in Düsseldorf.
In der VIP-Lounge gab es Buchregale, durch die sich lange Reihen prächtig ledergebundener, hundert Jahre alter, eigenartigerweise allerdings ausnahmslos schwedischer Konversationslexika zogen. Nicht lange dauerte es, bis uns auch der Fußballspieler Stefan Effenberg in Begleitung einer mit engen Dingen bekleideten Dame erschien. Er selbst trug kurze bunte Kinderhöschen und ließ Rotwein kommen. Die Kinderhöschen erregten mein Mißfallen.
Wohlgefallen erregten natürlich hingegen die Zimmer. Man hatte uns tatsächlich in zweien der insgesamt sieben Präsidenten-Suiten untergebracht. Sie sahen aus wie Möbellager, die auf ein in einen farbenblinden Zweig der Gothic-Szene verlegtes Remake von «Ein Käfig voller Narren» warten. Auch in den dortigen feisten Betten hätte man sich der Lektüre antiquarischer schwedischer Nachschlagewerke widmen können, sie standen meterlang zur Verfügung. Man hat wohl irgendwann einmal ein Frachtschiff voll davon ersteigert, um eine Art Zivilisationsatmosphäre zu erzeugen.
Am Morgen erwartete uns ein mit Air-Brush-Motiven verziertes SUV vom QIT, also ein sport utility vehicle der katarischen Tourismusbehörde. Der Fahrer, ein so sanfter wie hagerer Mann aus Palästina, sprach kaum Englisch, und wir natürlich kein Arabisch, aber vielleicht war es auch besser, daß der Ausflug überwiegend in Schweigsamkeit verlief, denn bei der in Katar üblichen Fahrweise verbietet sich jede Zerstreuung des Wagenlenkers. Bislang dachte ich, die wildesten Autofahrer der Welt seien in Argentinien anzutreffen. Aber wer jemals eine katarische Frau in der schärfsten Verhüllungsvariante – Sehschlitz, darüber ein halbtransparanter Schleier – mit Tempo 110 ohne jegliches Abbremsen, mitten in der Innenstadt – und selbstverständlich telefonierend – in einen Kreisverkehr hat hineinbrettern sehen, dem ist mindestens einmal so heftig die Pumpe gestockt, daß er die Argentinier von da an in etwas milderem Licht sieht. Nun ging es in die Wüste.
Wüsten, so hört man in unseren Breiten oft sagen, hafte etwas Faszinierendes an. Öde seien sie keinesfalls, sondern voll geheimen Lebens, und wer dies nicht sähe, der wisse nichts, der reiße seine Augen nicht weit genug auf. Am atemberaubendsten sei die Wüste des Nachts, dann würden überall weiße Hasen und Füchse umhertanzen, oder nach Regenfällen: Binnen Sekunden, naja Tagen, brächen die wunderbarsten Blumen und Sträucher aus dem krustigen Gestein hervor.
Wir hatten Gelegenheit, dies nachzuprüfen. Dreimal hat es während unserer Exkursion für mehrere Minuten geregnet; jubelnd filmten wir die Tropfen auf der Windschutzscheibe, aber draußen stieß nichts aus dem Erdreich hervor, nicht einmal ein kümmerlicher Alfalfakeimling.
Ich nehme an, daß die gerade in gebildeten europäischen Kreisen verbreitete Wüstenverehrung die gleichen Ursachen hat wie die Vorliebe für demonstrativ Schlichtes in Mode und Architektur. Wo die unverputzte, graue Wand als ehrlich gilt, der Schmuck als Widersacher der Funktion, Pracht und Pathos grundsätzlich als hohl, wo Details für neckisches Blendwerk stehen und die Floskel vom «genial Einfachen» lebensmottohaft beherzigt wird, da liebt man auch die Wüste. Das Einfache aber ist, meine Damen und Herren, nur dann genial, wenn es als Folge komplizierter Gedanken auftritt, und in der Kunst gibt es vieles, ja sogar sehr vieles, was man als «genial kompliziert» bezeichnen müßte, obwohl man diese Wendung niemals hört. Die Wüste ist, das sag ich leise donnernd, ein Ort, wo es an allem fehlt, was gut und herrlich ist. Wo Wüste auf der Welt ist, da ist was nicht in Ordnung mit der Welt.
Der folgende Tag stand im Zeichen der katarischen Tierzucht. Erst fuhr man zu einem Gestüt mit schönen, sympahischen Pferden, dann zu ebenfalls kerngesunden und noch sympathischeren Kamelen, später noch zu schönen, bedauerlicherweise aber kränkelnden Raubvögeln. Der Besuch einer Falkenklinik stand auf dem Programm. Die Falken hockten, einer neben dem andern, wie Figuren eines Schachbretts, auf dem Boden eines großen Raums und schauten, wie uns schien, nicht gerade lebenslustig vor sich hin. Einige hatten Abszesse unter der Zunge, die meisten jedoch litten am «bumble foot disease», einer knollenartigen Verdickung des Fußes, welche infolge der unnatürlich häufigen Landevorgänge nur bei Jagdfalken auftritt.
Wir wurden eingeladen, dem Chirurgen über die Schulter zu schauen. Allerdings war der Falke, dessen Operation wir nun beiwohnten, überhaupt nicht krank. Er war lediglich ein besonders kostbarer Vogel, der zum Verkauf anstand, und der neue Besitzer wollte sich vergewissern, daß er organisch einwandfrei war, zu welchem Zweck der Vogel geöffnet wurde. Man forderte uns auf, ganz dicht ranzugehen, und wie ich nun dastand und ohne Mundschutz in die Eingeweide des Vogels schaute, kam mir ein Gedanke, der mich schon einmal befallen hatte, und zwar, als mir ein freundlicher Germanist im Marbacher Literaturarchiv ohne trennende Glasplatte eine Kafka-Handschrift vorlegte, nämlich: «Ich könnte da jetzt draufspucken!» Nicht, daß ich derlei jemals ernsthaft in Erwägung zöge, um Himmels willen, ich spucke nicht mal nachts auf menschenleere Bürgersteige, bin Eigenspeichelrunterschlucker durch und durch, neige nie zu neurotischen Attentaten – aber der Gedanke! Daß ich für einen winzigen Augenblick die Herrschaft über mein Handeln verloren haben könnte und dem Falken in den aufgeschnittenen Hunderttausenddollarwanst gespien hätte! Hätte ich je wieder sattgrüne Wälder gesehen?
Auf jeden Fall wäre das Abendessen mit Frau Abdulagic abgesagt worden, einer Dame mit dramatischem Augen-Make-up und einem strengen Sinn fürs Effiziente, die, soweit ich es verstanden habe, lange Jahre in Kolumbien als Gesandte ihrer Heimat Jugoslawien diente und sich jetzt in leitender Funktion mit der Verbesserung des Rufes von Katar als Reiseziel befaßt. Da wir uns ihren Namen auf die Schnelle nicht hatten einprägen können, sprachen wir sie mit «Madame» an, was sie als Diplomatin nicht störte, zumal solche Anrede in englischsprachigem Kontext durchaus auf zarte Weise weltgewandt wirkt. Um das Ingangkommen der Konversation nicht allein auf den Schultern der Gastgeberin lasten zu lassen, fragte ich sie munter, wieso die vielen indischen Bauarbeiter in Katar denn alle lila Overalls trügen, andernorts würden körperlich hart arbeitende Männer nur ungern lila tragen, weil das ja «irgendwie leicht gay» wirke. Das war Madame wohl klar, und es wurde uns mit wirkungssicheren Damenblicken klargemacht, daß diese Art von leichter westeuropäischer Plauderei von ihrer Seite nicht vorgesehen war. Um indes nicht allzu schroff zu wirken, erfreute uns Frau Abdulagic rasch mit der wohl oft schon vorgebrachten spaßigen Bemerkung, daß es leider nicht möglich sei, den Namen des Landes zu ändern, obwohl dieser in vielen Sprachen der Welt an einen Schnupfen erinnere. In erster Linie aber wollte uns Madame über Wirtschaft, Infrastruktur und vor allem das hervorragende Erziehungswesen von Katar unterrichten und scheute dabei auch vor statistischen Angaben nicht zurück. Sie verwendete dermaßen viele statistische Angaben, daß mir das von einem Top-Koch aus München zubereitete Dinner kaum mehr schmecken wollte und ich dachte: «Kann die Geheimdienstziege nicht mal den Rand halten?» Wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, war es Jacqueline Kennedy, die einmal zu Nikita Chruschtschow sagte: «Herr Präsident, Sie wollen mich doch nicht etwa mit Ihren Zahlen langweilen!» Dieser Abend im Restaurant «Le mer» im dreiundzwanzigsten Stockwerk des Ritz-Carlton-Hotels war jedoch nicht der geeignete Moment, mich als geistiger Erbe Jackie Kennedys zu gebärden, und so versuchte ich zu lauschen und sagte gelegentlich «Oh really?», «So many?» oder «That’s a pretty good amount!»
Ein Leichtes war das Lauschen indes nicht, denn kaum fünf Meter hinter mir betätigte sich ein Pianist mit hartem Anschlag und beschränktem Repertoire. Alle fünfzehn Minuten wurde der grundüble Schmusesong «Feelings» gespielt, und zwar mit der Zartheit eines Teppichklopfers. Mister Schmitt sagte, es sei eine junge blonde Dame in bodenlanger Robe, die da in die Drahtkommode dresche, aber ich war zu faul, mich umzudrehen, schließlich kann man sich’s ja auch denken. Auf der ganzen Welt lassen sich langhaarige junge Frauen in Abendkleidern zur Romantisierung miserabler Musik mißbrauchen, im deutschen Fernsehen zum Beispiel gibt es kaum noch eine Unterhaltungssendung, in der darauf verzichtet wird, Playbackvorführungen mit meist vier bis sechs Geigerinnen zu dekorieren, selbst in Fällen, bei denen das Musikarrangement offenkundig überhaupt keine Streicher enthält. Am schmierigsten wird es, wenn die geigenhaltenden Statistinnen in einem «Meer von Kerzen» sitzen, weil Frauen eben wunderbare «Wesen» sind oder gar «Engel» aus einem Himmelreich der süßen Illusionen – nicht alle allerdings, muß man hinzufügen: Nachdem ich eine Weile zu den zahl- und zahlenreichen Worten unserer herrischen Tischherrin immer nur genickt oder «Oh, that is very interesting!» gesagt hatte, forderte sie mich auf, darzulegen, was ich nun meinerseits zur Entwicklung des katarischen Fremdenverkehrs beizutragen hätte. «Ich? Ich sitze hier doch nur, weil die Frau von Mister Schmitt keine Lust hatte, mitzukommen», sagte ich nicht, sondern antwortete – in Ermangelung einer vernünftigen Antwort –, die Tourismusförderer sollten sich zunächst die «Länderabklapperer» und Visumsstempel-Sammler vorknöpfen. Es gebe in Deutschland einen berühmten Rockmusiker namens Farin Urlaub, der sich zum Ziel gesetzt hat, jedes Land der Welt, auch das kleinste und abwegigste, wenigstens einmal besucht zu haben. An solche Leute müsse Katar seine Tourismuswerbung richten. Madame war an reiselustigen deutschen Punkrockern offensichtlich nicht interessiert und erwiderte barsch, Rucksacktouristen wolle man auf keinen Fall, viel eher sei man, schon um sich vom vergnügungsorientierten Dubai zu unterscheiden, an Familien mit Kindern interessiert.
Der Wein war phantastisch. Wenn nun jemand sagt, selbst der phantastischste Wein könne einem keinen unangenehmen Gesprächspartner versüßen, erwidere ich: Doch. Ich guckte um acht auf die Uhr, ich guckte um neun auf die Uhr, ich guckte um zehn auf die Uhr. Mit jeder Stunde wurde die Propaganda erträglicher. Als ich allerdings endlich im Bett liegen durfte, überlegte ich, wie Madame sich das eigentlich vorstellt, deutsche Familien zu veranlassen, ihre Ferien in Katar zu verbringen. Gewiß, es gibt einen «Corniche» genannten Uferweg in Doha, auf dessen stolzen sieben Kilometer Länge sich jedoch nicht eine einzige Erfrischungsbude findet. Kinder wünschen aber Brause und Eis in Aussicht gestellt zu bekommen, wenn man ihnen bei bereits Anfang Mai herrschenden Tagestemperaturen von vierzig Grad im Schatten das Abschreiten sieben Kilometer langer unbeschatteter Promenaden schmackhaft machen möchte. Von rasanten Autofahrten hingegen wird Kindern übel, daher ist jene beliebteste Freizeitbeschäftigung junger Wüstensöhne, die «Dune bashing» genannte motorisierte Vergewaltigung von Sandhügeln nämlich, ebenfalls kein ideales Angebot.
Nun war allerdings das Blöde, daß Herr Schmitt und ich noch einen weiteren Termin um zehn Uhr morgens hatten, nämlich schon wieder mit Madame und, zusätzlich, einem Sport-Attaché, der uns seine Visionen über die Zukunft Katars als Austragungsort internationaler Sportereignisse darlegen wollte.
Um neun Uhr dreißig rief Mister Schmitt an. Ihm sei schlecht, er sei malade, ihm sei nicht gut, gar nicht gut, die fremde, heiße Luft, drinnen auch noch die Air Conditioning, der viele Rotwein gestern, die schreckliche Frau, ich wisse schon. Der einzige Weg, seinen unguten Zustand lebend zu überstehen, sei ein sich weit in den Nachmittag hinziehender Verbleib in dem herrlichen Bett. Ich möchte bitte den Termin mit Madame und dem Sportfunktionär allein wahrnehmen. Ich rief in die Muschel: «Knall oder was? Denk ja nicht dran! Wer ist denn hier der Journalist? Ich ja wohl kaum!»
Ich machte mich mit der Espressomaschine vertraut. Um viertel nach zehn klopfte Laura aus Mexiko an meine Tür und sagte, Madame sei «very upset» und «very angry». Ich solle mich «immediately» in ihrem Büro einfinden.
Ging natürlich nicht hin. Zwar haben uns Tove aus Schweden, Anna aus Prag, Laura aus Mexiko und Lorna aus Malaysia im Verlaufe des Tages nicht mehr gegrüßt und schon gar nicht bemuttert, aber man muß dem Staat Katar zubilligen, daß er uns nicht an der Ausreise hinderte. Wir haben das Land mit einem ganz ungewöhnlichen Gefühl verlassen, nämlich dem Gefühl der Undankbarkeit. Man hat uns prächtig bewirtet, in riesigen Zimmern untergebracht und für uns Falken aufgeschlitzt, und wir – wir verwöhnten, pingeligen, meckernden Mitteleuropäer? Wir mochten es einfach nicht.
Sodbrennen statt Snobismus, ich meine umgekehrt
Hin und wieder male ich mir aus, versehentlich über Nacht in einer Bibliothek eingeschlossen zu sein. Nach anfänglicher Panik komme ich zur Ruhe und freunde mich mit dem Gedanken an, die Stunden bis zu meiner Befreiung blätternd und schmökernd zu verbringen. Allerdings stelle ich bald fest, daß es sich bei all den schönen leinen- und ledergebundenen Büchern in den Regalen um nichts als eine von sonderbarem Wahn zusammengetragene Sammlung sämtlicher Artikel handelt, die in den letzten zwanzig Jahren in Magazinen und Illustrierten zum Thema «Volkskrankheit Sodbrennen» veröffentlicht wurden. Glücklicherweise ist, wovon hier berichtet wird, kein Alptraum, sondern eine Tagesphantasie, die sich an beliebiger Stelle abbrechen läßt.
In der Tat aber staune ich seit langem, mit welcher Regelmäßigkeit in Zeitschriften, die sich hauptsächlich oder auch nur am Rande mit Gesundheit befassen, Texte zum Thema Magenübersäuerung gebracht werden. Vermutlich fungieren solcherlei Artikel im populären Medizinjournalismus als eine Art Feuertaufe; so, wie in männlich dominierten Gemeinschaften überholter Art jeder Neuling, um die Anerkennung der anderen zu erlangen, erst einmal einen Regenwurm schlucken oder gar verklemmte sexuelle Triezereien über sich ergehen lassen mußte, hat ein jeder, der in der Welt der Apothekenzeitschriften Fuß fassen möchte, als Einstand seine obligatorische Schreibarbeit über Sodbrennen abzuliefern. Novizenquälerei in der Tradition der französischen «Bizutage» also – anders läßt sich die Vielzahl der Einlassungen zu diesem Thema kaum erklären.
Volksleiden sind mir nicht summa summarum fremd oder suspekt. Rückenschmerzen, winterliche Trockenheit der Nasenschleimhaut, darüber könnt ich wohl zur Laute singen, hätt ich eine Laute, selbst die aus den Werbeblöcken des Vorabendfernsehens bekannte «Morgensteifigkeit» ist mir in milden Versionen vertraut, aber Sodbrennen hatte ich noch nie. Noch nie? Ich herrlich Unsaurer! Doch, ein einziges Mal hatte ich Sodbrennen: als Nebenwirkung einer Penicillingabe. Ich weiß daher, wie es vor sich geht: Man liegt mehr oder weniger ballonförmig in einem Sessel, und in Begleitung knurrender und gurgelnder kleiner Geräusche entweichen dem Rachen grünliche Gasbällchen, die kurz durchs Zimmer fliegen und bald ploppend über den Einrichtungsgegenständen zerplatzen. Ein bittersaures Seifenblasenkonzert, an dessen Ende Möbel mit verätztem Firnis stehen. Wem geschieht derlei ohne Penicillin? Was sind das für Leute, die sich in volksleidenshafter Regelmäßigkeit in den Genuß eines dermaßen unangenehmen körperlichen Unterhaltungsprogramms bringen?
Ich habe ein Wochenende in Großbritannien verbracht und sah dort Einwohnerinnen, die auf exzessive Weise ihre Erlebnisgier zum Ausdruck brachten. Es war ein früher Abend im späten Winter, kaum fünf Grad plus. Die Frauen aber waren angezogen, als müßten ihre Brüste und Beine trotz Dunkelheit ganz dringend von Sonne und Männerblicken geröstet werden. Können Männerblicke Brüste rösten? Ich glaube, es muß dichterisch erlaubt sein, das zu sagen. Man muß da jetzt nicht so einen Bohei drum machen wie vor einigen Jahren über Peter Handkes «andersgelbe Nudelnester». Immer wenn ich auf einem südlichen Markt bin und die nestartig hingelegten Nudeln in verschiedenen Gelbtönen sehe, denke ich an Peter Handke, diesen zu Recht berühmten Dichter und seine schöne, nur von höhnischen Windeiern verhöhnte Nudelformulierung. Doch wir sind hier nicht auf einem südlichen Viktualienmarkt, sondern im klammen Glasgow, zumindest war vor kurzem noch die allerdings nicht namentliche Rede von dieser windigen schottischen Stadt, wo ich Frauen sah, die nicht ausreichend bekleidet waren. Das Dekolleté nicht bedeckt, Schenkel gleichfalls bloß und bar, die Füße in viel zu hohen Sommerschuhen, in denen zu gehen ihnen niemand beigebracht hatte. Indes sie quietschend Konversation betrieben, schwankten sie, einander untergehakt stützend, durch die Straßen und gossen sich dabei Roséwein direkt aus der Flasche in die Schlünder. Sie amüsierten mich und rührten mich auch etwas, diese erzdummen, mopsfidelen, übersexualisierten und irgendwie auch lieben jungen Schachteln, ich dachte aber auch: Unterleibsverkühlung kann denen nicht unbekannt sein, ebensowenig Sodbrennen.
Man muß aber nicht unbedingt dem Beispiel halbnackter britischer Nachtschwärmerinnen Folge leisten und Roséwein aus der Flasche trinken, um grüne Gülleperlen auszuatmen. Wie es auch geht, kann man in jedem x-beliebigen Hotelfrühstücksraum in Augenschein nehmen. Wie ich neulich erfuhr, habe ich eine Gemeinsamkeit mit den Mitgliedern der Gruppe «Tokio Hotel», nämlich die Angewohnheit, in Hotels am Morgen Pfefferminztee zu trinken, da es merkwürdigerweise selbst in Häusern, an deren Eingang ulkig uniformierte Männer mit Zylinder auf dem Kopf den Gästen das Gepäck aus der Hand reißen, bitteren Thermoskannenkaffee jener Qualität gibt, die von meiner ostelbischen Verwandtschaft «Lorke», manchmal auch «Plörre» genannt wurde. Bis vor kaum mehr als einem Jahrzehnt habe ich mir selbst allmorgendlich gut anderthalb Liter Plörre «gekocht», die bis in die frühen Abendstunden auf der Warmhalteplatte vor sich hin knisterten. Man kannte es nicht anders. Heute kennt man es sehr wohl anders, allerdings nicht überall – bei der Deutschen Bahn zum Beispiel nicht und auch nicht beim Hotelfrühstück. Ein großer Teil der Gäste dort scheint sich indes am Lorkecharakter des Kaffees nicht zu stören, und bizarrerweise trinken sie zur gleichen Zeit Orangensaft, oft in alternierenden Schlucken. Es gibt so einiges, was «alle» machen und mir trotzdem grundfalsch erscheint – das aggressive morgendliche Getränkedoppel zählt dazu. Ich frage mich, warum sie Kaffee und Saft nicht bereits vor dem Trinken zusammenschütten, gewissermaßen nach Art der heute als so praktisch empfundenen «2 in 1»-Präparate. Doch scheinen sie beharrlich den eigenen Magen als Shaker für ihren grausamen Cocktail zu bevorzugen und lassen es dort ätzen und brodeln, auf daß noch viele Sodbrennen-Texte geschrieben werden können.
Die vielgefragte Gloria von Thurn und Taxis hat zu diesem Thema einst einen Standpunkt niedergelegt, den ich folgendermaßen kurzfassen möchte: «Man hat kein Sodbrennen. Man hat Jagdverletzungen.» Ein einigermaßen rigoroses, wenn auch frischvergnügtes Statement hat sie damit abgegeben, das ich allerdings der Ausgewogenheit halber gern mit einem in Tierschutzkreisen berühmten Wort von Theodor Heuss konterkarikieren möchte, nach welchem die «Jagd eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit» sei. Am bekömmlichsten ist es wohl, man hat weder Sodbrennen noch Jagdverletzungen.
Zweifelsohne würde man eine Mehrheit von Deutschen finden, die die fürstliche Aussage mit dem Wort Snobismus belegen, und zwar unter Hinzufügung derjenigen Adjektive, mit denen der Snobismus im Deutschen zwangsverheiratet zu sein scheint, nämlich «unfaßbar» und «unsäglich». Dabei gibt es zahlreiche schönere Adjektive, die zum Snobismus gut passen, beispielsweise «amüsant», «rührend», aber auch «löblich». Es ist zu beklagen, daß die Snobs heute einen so schlechten Leumund haben. Noch vor wenigen Jahrzehnten war das anders: Sie galten als schillernde Individualisten, die man als bunte Vögel gern auf Partys einlud. Witzzeichner stellten sie nicht selten mit Monokel dar und legten ihnen Sprüche in den Mund wie: «Liebe? Ach, das überlassen wir lieber den einfachen Menschen.» Da sich die Snobs finanziell und rhetorisch mitunter überforderten, waren sie vor Lächerlichkeit durchaus nicht gefeit, aber das nahmen sie hin, um in interessanter, also «gehobener» Gesellschaft sein zu dürfen, und die Gesellschaft freute sich an ihrer Kauzigkeit. In der heutigen Diktatur der Masse hat’s der Snob dagegen schwer. Er hat kaum jemals mit anderen Echos zu rechnen als dem monotonen Vorwurf: «Der will wohl was Besseres sein!» Warum gilt es heutzutage als Todsünde, etwas Besseres sein zu wollen? Ist das, was uns umgibt, so herrlich und perfekt, daß jeder Wunsch nach Besserung automatisch eine Unverschämtheit ist? Und wer die Welt verbessern möchte, fange praktischerweise bei seiner eigenen Person an, denn da gibt es bei jedem einiges zu renovieren.
Snobismus ist eine klassische Form der heutzutage vielbequasselten Exzellenzinitiative. Er schadet nie und nützt oft, und dies nicht nur dem Snob selbst. Wem verdanken wir es denn, daß wir zumindest außerhalb von Hotels so vielerorts guten Kaffee, aber auch feine Weine, tollen Käse, ja sogar – in Bioläden – gutes Brot bekommen? Den Ernährungssnobs natürlich! Man achte sie! Der Snobismus hat ein ungerechtfertigt schlechtes Image, die meisten wissen eh nicht recht, was der Begriff bedeutet, und verwenden ihn synonym mit Arroganz, Hochtrabendheit und dem respektlosen Hinabschauen auf sogenannte einfache Leute. Solche Erscheinungen sind aber allenfalls unschöne Nebeneffekte. Der Kern des Snobismus ist nicht das Hinabschauen, sondern der Blick nach oben. Als sein Gegenteil könnte man einen Ausdruck anführen, den Lars Brandt, der Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers, einmal in bezug auf den SPD-Sauertopf Herbert Wehner und dessen Frau gebrauchte: «skandinavisches Bescheidenheitsgetue». Oder auch die seit einigen Jahren lästig redensartliche Formulierung von der «gleichen Augenhöhe», auf der angeblich alle Menschen miteinander umzugehen hätten. Die ewig gleiche Augenhöhe vernachlässigt eindeutig die menschliche Halswirbelmuskulatur. Man sollte unbeirrt hinab- wie hinaufschauen, das eine mit möglichst wenig Spott und Verachtung, das andere ohne Eifer und blinde Begeisterung. Der Snob orientiert sich an der nächsthöheren gesellschaftlichen Schicht, und er hat dabei die gleichen Möglichkeiten wie ein mittelmäßiger Musiker, der einem guten nacheifert. Entweder er verbessert sich tatsächlich, oder er wird prätentiös und macht sich lächerlich. Na und? Fliegenpilze, Löwen, gesellschaftliches Glatteis – gefahrvoll ist das Leben! Aber immerhin: Er hat es gewagt, ein Besserer, ein Größerer zu werden wenigstens zu wollen! Die deutsche Menschheit schätzt Schuster, die bei ihren Leisten bleiben, doch sie braucht auch Schuster, die nach den Sternen greifen, indem sie zum Beispiel Manufakturen für besonders feine Schuhe gründen und somit anspruchsvolle Arbeitsplätze schaffen. Ja, in der Tat, sie sind so frei, sie nehmen sich heraus, einem inneren Aufruf zur Selbstverbesserung und somit Weltverbesserung Gehör zu schenken, ohne Herrn Muff und Frau Pief um Erlaubnis zu fragen. Die Summe meiner Worte sei: Strebsamkeit und Ehrgeiz sind genauso gute Weltmotoren wie die Liebe.
Mein preußischer Nachmittag
Ein interessanter Aspekt in Zusammenhang mit der Texterstellung ist, wann man etwas zu Papier bringt. Ich meine jetzt nicht die Frage nach der bevorzugten Tageszeit, die in Interviews mit Schriftstellern so gern gestellt wird. Geschrieben wird natürlich zu allen Zeiten, in denen man nicht schläft, ißt, Bürodreck erledigen muß oder Geselligkeit betreibt, kurzum, man schreibt, wenn man ruhig und bei Sinnen ist. Ob das in Frank Sinatras «wee small hours of the morning» ist oder nachmittags, hat keine Bedeutung, sehr wohl aber der zeitliche Abstand zwischen einem Erlebnis oder Ereignis und der Niederschrift seiner Erinnerung daran. Wenn man zu bald schreibt, ist das Ergebnis vielleicht frisch und «nah dran», aber vielleicht auch O-Ton-artig platt. Es ist besser, wenn man etwas Erinnertes zunächst im Hirnkasten verschließt, damit es Verbindungen mit anderem, was dort gärt und lagert, eingehen kann, auf daß ein guter dunkler Sud entstehe, den man, wenn der Tag gekommen ist, in die Tastatur gießt. Allzulang sollte man aber auch nicht warten, denn es mag passieren, daß zu bestimmten Themen eine allgemeine mediale Retrospektive einsetzt, die die persönliche ordnende Rückschau verfälschen oder vergiften kann. An die West-Berliner Punk- und New-Wave-Zeit beispielsweise kann man sich heute kaum noch fein und säuberlich erinnern, weil seither Tonnen von Artikeln und Fernsehfeatures zu dem Thema in die Nachwelt geschickt worden sind, in denen rein gar nichts von dem vorkommt, was einem damals etwas bedeutet hat, und die immer gleichen Räuberpistolen aufgewärmt werden, wie zum Beispiel die, daß Punks und Waver ihre Energie vor allem aus dem Haß auf die Hippies, ihre «Wabermusik» und lasche Friedlichkeit gespeist hätten. In Wahrheit waren die Übergänge zwischen den Fraktionen fließend, in der Aufmachung wie im Denken, in der Musik durchaus auch, und es gab zahlreiche friedvolle und fruchtvolle Kontakte. Die Medien zeigen in ihren Zeitgemälden nicht das, was signifikant war, sondern das, wovon sie eben Bildmaterial haben. Immer wieder wird zum Beispiel an eine lächerliche Straßenschlacht zwischen Punks und Poppern erinnert, die 1980 am Hermannplatz stattgefunden hat und die jedermann, der damals in West-Berlin zugange war, mit den Worten kommentierte, es gebe hier doch gar keine Popper und daß die vermeintliche Auseinandersetzung wohl eine Inszenierung des Springer-Blattes «BZ» gewesen sein dürfte. Es existiert aber Fernsehmaterial davon, und nun sieht es so aus, als ob die Rauferei ein relevantes zeittypisches Ereignis gewesen wäre.
Man kann seine Erinnerung an bestimmte Lebensereignisse freilich auch selbst verfälschen, indem man sie immer wieder anekdotenhaft verkürzt anderen Leuten erzählt. Es wird nicht lange dauern, und man erinnert sich nur noch an die jeweils letzte Erzählvariante, hinter der das tatsächliche Ereignis allmählich erlischt.
Ich möchte nun über eine Begegnung aus der späten Punk- und New-Wave-Zeit berichten, die nichts mit Punk oder New Wave zu tun hat, dafür um so mehr mit dem literarischen Chanson der zwanziger Jahre und mit afrikanischer Musik. Meine Erinnerung daran ist blaß, gewiß auch lückenhaft, aber sicherlich nicht durch langjähriges Anekdotieren verfälscht, schließlich habe ich kaum jemals davon gesprochen, und zwar aus dem schlichten Grunde, daß ich nie danach gefragt worden bin und die Geschichte niemanden, den ich kannte, je interessiert, geschweige denn beeindruckt hätte. Da aber die Erinnerung an das Erlebte, eine Einladung zu einem sonderbaren Nachmittags-Tee, auch nach 22 Jahren nicht von mir weicht, erscheint es mir möglich, daß ihm eventuell doch ein Kern von Bedeutsamkeit innewohnt.
Es fing damit an, daß ich, wie an so manchem Tag, einer reizvollen Beschäftigung namens «nach Wohnungen gucken» nachgegangen war, die darin bestand, ein Stadtviertel zu durchstreifen und nach Häusern Ausschau zu halten, in denen ich gern wohnen würde, um mich später telefonisch bei der Hausverwaltung nach Leerstand zu erkundigen. Das schien mir sinnvoller, als in Tageszeitungen Annoncen zu studieren und bei der Besichtigung festzustellen, daß die angebotene Wohnung in einem verwahrlosten Haus an einer lauten Ecke liegt. Bei dem genannten Streifzug entdeckte ich in einer überfüllten, daher offenstehenden Mülltonne einen Stapel Schallplatten, Testpressungen in weißen Hüllen – Rezensionsexemplare für die Presse. Ein Journalist hatte wohl ausgemistet. Es handelte sich um wenig verlockendes Zeug, Opernquerschnitte, Folklore usw., aber eine Platte interessierte mich. «HEITER UND BESINNLICH Folge 14 – In den Abendwind geflüstert – Blandine Ebinger singt Chansons von Friedrich Hollaender».
Die Lieder gefielen mir sehr. Von einem befreundeten Schallplattensammler erfuhr ich, daß «die Ebinger» als Legende gelte, allerdings nur in Kennerkreisen, und «seinerzeit» mit Friedrich Hollaender verheiratet gewesen sei, der ihr in den frühen Zwanzigern den Chansonzyklus «Lieder eines armen Mädchens» auf den Leib geschnitten habe. Dieser wiederum sei zweifelsohne eines der bedeutendsten Musikwerke der Weimarer Republik, im Rang gleich hinter der Dreigroschenoper stehend. In den Dreißigern habe sie emigrieren müssen, sei aber zurückgekehrt und habe erst kürzlich hochbetagt einige vielumjubelte Comeback-Konzerte gegeben. Des weiteren erfuhr ich, daß sie mit vollständiger Adresse im Telefonbuch stehe. Worauf ich ihr eine Postkarte schrieb mit der Frage, ob sie mir erlaube, eines ihrer Chansons, «Das Currendemädchen», zu covern, und zwar mit einem «elektronischen Arrangement».
Bald klingelte das Telefon. Blandine Ebinger sagte, sie möchte sich mit mir unterhalten, ob ich sie nicht einmal besuchen wolle. Da ich damals – was sich kaum geändert hat – nur selten Anrufe von Leuten bekam, die mit Bertolt Brecht, Marlene Dietrich und weiß Gott mit wem noch allem persönlichen Verkehr gepflegt haben, war ich recht verdattert und wußte nicht, was ich sagen sollte; mir war nur klar, ich darf auf keinen Fall erwähnen, daß es eine Mülltonne war, die mir die Bekanntschaft mit ihrem Œuvre vermittelt hat, und muß wohl irgend etwas wie «Ich finde Ihr Material echt gut» gesagt haben, denn aus der Muschel kam es ziemlich scharf zurück: «Ma-te-ri-al!»
«Wie bitte?»
«Ma-te-ri-al! Sie haben ‹Matrial› gesagt. Wenn Sie etwas singen wollen, dürfen Sie keine Silben verschlucken!»
Ich dankte für den unerwarteten, aber bei genauer Betrachtung durchaus angebrachten Rat und nahm ihre Einladung an.
Ohne Rosen und Krawatte, doch selbstverständlich ordentlich gebürstet und gewaschen, stand ich wenig später vor einer Apartmentanlage in Berlin-Wilmersdorf und schärfte mir ein allerletztes Mal ein: nicht die Mülltonne erwähnen und auf gar keinen Fall «Matrial» sagen! Und schon gar nicht «Matajahl». Wenn ich «Matajahl» sage, schmeißt sie mich glatt raus.
Ich holte tief Luft und drückte auf die Klingel. Der Ehemann der Diseuse, nicht der zehn Jahre zuvor verstorbene Friedrich Hollaender, sondern sein Nachfolger, vier bis fünf Jahrzehnte jünger als sie selber, öffnete mir und geleitete mich in einen geräumigen Wohnraum, in dem Frau Ebinger mich stehend erwartete und sogleich zu erkennen gab, daß sie an einem allzu langen einleitenden Geplänkel kein Interesse habe. Sie deutete auf einen eher legendenunwürdigen billigen Radio-Recorder und forderte mich auf, eine Kassette mit «elektronischen Arrangements» einzulegen, die mitzubringen sie mich am Ende unseres Telefonats gebeten hatte. Ich legte ein, wir setzten uns, Frau Ebinger lauschte ernst und konzentriert, ich schwitzte und nahm erstens an, knallrot im Gesicht zu sein, und zweitens, einer alten Dame etwas zuzumuten. Die selbsterzeugte Elektronik rann vorbei, und Frau Ebinger sagte: «Das war hochinteressant. Es hat mich sehr an afrikanische Musik erinnert.» Diesen Vergleich fand ich übertrieben freundlich, aber im Prinzip richtig. Wir versicherten einander, große Freunde der afrikanischen Musik zu sein. Anschließend wurde der Ehemann, der sich nach der Begrüßung zurückgezogen hatte, aber gerade Tee hereinbrachte, gebeten, eine ebenfalls «hochinteressante» Kassette aus dem Völkerkundemuseum in den Recorder zu legen. Nun begann das große Getrommel.
Es trommelte und stampfte, man knurrte auch und zischte. Durchaus nicht übel, doch wurde bald klar, daß die Musiker sich dereinst nicht getroffen hatten, um eine Single aufzunehmen, sondern um den angereisten Musikethnologen ein ungekürztes Geisterbeschwörungsritual ins Mikrophon zu liefern. Dieses mußte nun durchlebt werden. Es wäre nicht möglich gewesen, sich in Konversation zu flüchten, denn wenn Musikfreunde anderen Musikfreunden Musik vorspielen, und um eine solche Situation handelte es sich hier doch wohl, dann wird erst wieder geredet, wenn das Musikstück vorbei ist. «Reinquatschen» gilt als ignorant. Außerdem hat sie ja auch nicht geredet, als ich ihr meine Elektronik vorspielte, von der ich allerdings nur zwei Minuten mitgebracht hatte. Eine Beendigung der akustischen Vorführung herbeizuführen, war noch weniger denkbar, denn schließlich setzt man sich nicht in das Wohnzimmer von etwas Ähnlichem wie Marlene Dietrich und sagt: «Könnse nicht mal was anderes auflegen?» Nach einer Viertelstunde wußte ich absolut nicht mehr, wo ich noch hingucken sollte. Ich hatte die Wohnungseinrichtung schon nahezu auswendig gelernt. Eine dreistufige Treppe war da, mitten im Zimmer. Ich dachte: Wenn ich einmal so alt bin, möchte ich aber bitte keine Treppe im Wohnzimmer haben. Wie heißt noch einmal das, was sich alte Damen zuziehen, wenn sie stürzen? Ach ja, «Oberschenkelhalsbruch» heißt das. Nun hatte ich neben «Mülltonne» und «Matajahl» noch ein drittes Wort, das ich im weiteren Gespräch keinesfalls erwähnen sollte.
Mein Gott: trommel, trommel, trommel. Der dunkle Kontinent: Wiege der Menschheit, aber auch Wiege der Monotonie. Es nahm und nahm kein Ende. In Richtung meiner Gastgeberin konnte ich nicht schauen, da sie ihrerseits unentwegt und unbewegt mich im Visier hatte. Wollte sie meine Contenance und Duldsamkeit einer Prüfung unterziehen, oder war sie einfach mit offenen Augen eingeschlafen? Ich hätte sie gern fotografiert, wagte jedoch nicht, meinen Apparat hervorzuholen. Ein schönes Bild wäre das geworden: das Inbild einer «reizenden alten Dame», Jahrgang 1899, doch hinter der Fassade ein ziemlich scharfer Hund, in einem viel zu wuchtigen Seniorensessel. Sie war so klein, daß die Füße nicht den Teppich berührten, sondern baumelten.
Es handelte sich um eine vollbespielte C-60-Kassette, d.h., die Trommelei war, da meine Gastgeberin die Freundlichkeit besaß, die Kassette nicht umzudrehen, nach einer halben Stunde vorbei. Statt nun in irgendeiner Weise auf die Absichten einzugehen, die sie mit der langwierigen Perkussionsdemonstration verbunden haben mochte, forderte mich Frau Ebinger auf, aufzustehen und mich direkt vor ihren Sessel zu stellen.
«Kommen Sie ruhig noch ein Stück näher! Und nun tragen Sie mir ‹Das Currendemädchen› vor.»
Ach du Schreck! Einer greisen Diseuse mit baumelnden Beinen in einem Abstand von einem halben Meter ihr eigenes legendäres Chanson vorsingen! Das hatte mir gerade noch gefehlt! Doch ich sang:
«Auf den Höfen, Geldes wegen, singen wir Currendemeechen …»
«Lauter!»
«Auf den Höfen, Geldes wegen, singen wir Currendemeechen …»
«Ich habe gesagt: lauter!»
«Okay. Auf den Höfen, Geldes wegen, singen wir Currendemeechen …»
«Warum singen Sie ‹Meechen›? Es heißt ‹Mädchen›.»
«Das ist Alt-Berliner Dialekt! Sie singen es doch auch so.»
«Nein. Ich singe es nicht so.»
«Doch! Sie singen es genau so! Ich habe die Platte ja fünfzigmal gehört», sagte ich nicht und fuhr fort:
«Also gut: Mädchen. Auf den Höfen, Geldes wegen …»
«Lassen Sie Ihre Arme aus dem Spiel! Und stehen Sie gerade!»
Inzwischen fand ich die Situation nicht mehr «so richtig gut». In den labbrigen siebziger und achtziger Jahren war man ein solches Treatment einfach nicht gewöhnt. Was da im Seniorensessel vor mir saß, war der Geist des alten Preußen! Preußen – das kannte ich nur aus irgendwelchen Pickelhauben-Ausstellungen, und plötzlich saß es winzig vor mir und verlangte, daß ich gerade stehe und lauter singe! Die von mir nicht gewünschte Prüfung wurde abgebrochen. Die Verabschiedung vollzog sich sehr höflich und recht unherzlich.
Ich war damals einfach noch nicht so weit, solcherlei künstlerische Strenge für schätzenswert halten zu können. Mittlerweile denke ich wieder mit Wärme an Blandine Ebinger zurück, an meine erste und letzte Begegnung mit dem wahrhaftigen Preußen. Irgend etwas Wichtiges habe ich bestimmt von ihr gelernt. «Matrial» sage ich allerdings noch immer, immerhin aber nicht «Matajahl». Menschen, die heute in dem Alter sind, in dem ich vor einem knappen Vierteljahrhundert war, haben keinerlei Gelegenheit mehr, solche Menschen kennenzulernen. Sie sind unwiederbringlich verschwunden, was gewiß sehr schade ist. Die Frage, ob es darüber hinaus auch ein kleines bißchen wunderbar ist, wollen wir aus Respekt vor dem kulturellen Erbe hintanstellen.
Kleiner Diskurs über kleines Gepäck
In grundguten Jahreszeiten wie zum Beispiel dem Altweibersommer setzt sich der Stadtbewohner an unbeschwerten, arbeitsfreien Tagen gern mit familiärem oder befreundetem Anhang in ein Auto und begibt sich in die ländliche Umgebung, um etwa auf einem Naturlehrpfad einen See zu umrunden, in Schloßpantoffeln durch ein bei leisester Berührung knarrendes Schloß zu rutschen und irgendwo «nett Kaffee» zu trinken. Es handelt sich um eine, außer bei Pubertierenden in der Trotzphase sowie tageslichtscheuen Computernarren, gängige und beliebte Freizeitgestaltung von jung und alt. Als sich ein solcher Ausflug, der meinen Begleiter und mich ins Ostbrandenburgische geführt hatte, neulich seinem Ende zuneigte, der Kaffee also getrunken und die Schlösser besichtigt waren, kamen wir ungeplant in das Städtchen Seelow, welches uns vom Namen her bekannt war, weil sich in seiner Nähe im April 1945 die letzte gräßliche Schlacht zwischen Wehrmacht und Roter Armee vor dem Sturm auf Berlin zugetragen hatte. Es gibt dort eine während der DDR-Jahre errichtete Gedenkstätte. Obwohl wir eigentlich bereits genug von der schönen Gegend hatten, hätten wir es für einen Ausdruck mangelnder historischer Pietät gehalten, an der blutgetränkten Stätte einfach arrogant vorbeizubrettern, und so sagten wir uns: «Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir auch das noch mit.» Wir schlenderten also durch das im Abendlicht liegende Gelände. Das Wort «schlendern» mag angesichts einer Kriegsgedenkstätte auf den ersten Blick anstößig klingen, aber wenn ich die Art unseres Ganges rückblickend analysiere, ist sie mit Schlendern durchaus am passendsten beschrieben – und wie hätten wir das Areal auch sonst begehen sollen? Indem wir marschiert, gar stolziert, gewatschelt oder getorkelt wären? Oder hätte man schreiten müssen? Schreiten tun lediglich Staatsmänner unter Aufsicht der Geschichtsschreibung, Schreitvögel sowie Sargträger bei angemessener musikalischer Begleitung. Wir jedoch hielten es wie eine kleine Gruppe russischer Touristen und schlenderten, nur leise sprechend, über die Gedenkstätte, die von einer selbstverständlich monumentalen Bronzeplastik eines Rotarmisten gekrönt wird. Da sich ein jeder ungefähr vorstellen kann, wie solche von Diktaturen errichteten Ehrenmäler aussehen, scheint es mir nicht dringlich, die Figur hier zu beschreiben. Lediglich ein Einzelaspekt scheint mir erwähnenswert, nämlich die Tasche, die der bildhauerisch verewigte Soldat trägt: Er trägt eine jener heute irrtümlicherweise als generationsspezifisch geltenden, von Magazinjournalisten und Anhängern leicht gehobener Auffassungen anhaltend und beharrlich verspotteten Umhängetaschen.
Dadurch, daß wir eben von einer Bronzeplastik sprachen, sind wir zwar logisch nicht dazu gezwungen, einen Blick in die Bronzezeit zu werfen, aber verboten ist es auch nicht: Wir sehen Ackerland. Olles, tumbes Ackerland von breitester und braunster, kläglich frühhistorischer Märzenödheit. Trübe, trist und nochmals trübe, mehr muß gar nicht gesagt werden. Ein Sämann kommt aus seiner Hütte, seinem Häuschen, seiner museumsdorfartigen Wohnanlage oder worin ein Bronzezeitmensch auch immer gehaust haben mag. Da er nun einmal ein Sämann ist, möchte er säen und hat sich mit einem dicken Packen Saatgut ausgestattet, um es auf seinen Feldern auszubringen. Es ist anzunehmen, daß unser Sämann bereits einen Sinn fürs Praktische hatte; körperliche Verrenkungen wird er kaum weniger gemocht haben als unsereiner, somit wird er den zu verteilenden Samen wahrscheinlich nicht in einem – obschon wohl handwerklich bereits möglichen – Rucksack transportiert haben, sondern es zuliebe eines leichteren Zugriffs bevorzugt haben, sein Saatgut auf der Körpervorderseite oder an der Flanke zu tragen. Zu diesem Zweck wird er sich eine Tasche mit langem Henkel ausgedacht und angefertigt haben. Da Geschichte früher langsamer vorankam als heute, wird er sich einige hundert Jahre lang darüber geärgert haben, daß ihm die Tasche hin und wieder von der Schulter glitt. Eines Tages aber wird ein anonymer, mithin ungeehrter Pionier die schulemachende Idee gehabt haben, den Taschenhenkel quer über den Oberkörper zu legen. Diese Idee hielt sich: Wenn wir in ein Museum gehen, vielleicht ein Postmuseum, werden wir Abbildungen oder Wachsfiguren von Briefträgern vergangener Jahrhunderte sehen. Da Briefträger nicht durchweg dümmer sind als bronzezeitliche Agrarier, werden sich nicht wenige von ihnen einer Umhängetasche zum Austragen der Briefschaften bedient haben. Durch das Schlingen des Trageriemens diagonal über die Brust waren sie nämlich vor berittenen Räubern recht gut geschützt.
Nachdem wir nun die frühgeschichtliche sowie die postalische Abteilung unseres Schloßmuseums überstanden haben, sollten wir, bevor schon wieder «nett Kaffee» getrunken wird, vielleicht noch den Raum «Aufbruch und Revolte – Jugendkultur nach 1967» anschauen: Als nämlich der Verfasser dieses Beitrags sich zu Beginn der siebziger Jahre zu alt wähnte, um einen Ranzen zu tragen, begann er, seine Schulsachen in einer Umhängetasche aus graugrünem Militärstoff zu verstauen. Auf die Klappe der Tasche schrieb er mit Kugelschreiber Namen von Rockgruppen, deren Musik er überhaupt nicht kannte. Ebenfalls beliebt unter Schülern waren Umhängetaschen aus einem groben, kratzenden Wollstoff sowie solche aus einem teppichähnlichen Material, auf das man allerdings schwerlich Gruppennamen schreiben konnte. Da die Menschen damals noch keine Computer mit sich herumtrugen und vor allen Dingen selbst kilometerlange Fußmärsche ohne Wasserbevorratung überstanden, waren die Taschen etwas kleiner als die heutigen, doch das Prinzip war das gleiche.
In welche Ecke der Geschichte man auch schaut: Eigentlich gab es immer Umhängetaschen, und ich kann darüber nicht sehr staunen, denn sie sind der traditionsreichste, sinnvollste, ich möchte fast sagen: der normalste Taschentypus überhaupt. Zeitweilig allerdings gab es einige Aussetzer.
Nachdem nämlich die Umhängetasche in den siebziger Jahren in den Ruf geraten war, ein typisches Ausstattungselement in den Nachmittag hineinschlafender Langhaariger zu sein, galt sie während der New-Wave-Zeit als obsolet. Die jungen Leute in den Städten trugen ihre Siebensachen in Plastiktüten herum, insbesondere in solchen, die erkennen ließen, daß man in gutbeleumundeten Plattenläden einkaufte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie lästig es war, einen solchen Beutel zwischen die Oberschenkel zu klemmen, wenn man einmal ausgiebiger im Portemonnaie zu wühlen hatte. Eine andere Möglichkeit in dem Fall, daß man beide Hände benötigte, bestand darin, eine Hand durch das Griffloch zu zwängen und die Tüte am Handgelenk baumeln zu lassen. So ließ sich ein allgemeines Aufatmen vernehmen, als ab Mitte der achtziger Jahre kleine Kunststoffrucksäcke als Stadtgepäck aufkamen. Bald aber entwickelten sich diese Rucksäcke zum Lieblingsgepäckstück von sowohl Mittelstufenschülern als auch rüstigen Senioren, und deshalb nimmt es nicht wunder, daß es zumindest unter denjenigen, die sich weder den Schülern noch den Rentnern zurechneten, zu einem erneuten Aufatmen kam, als der westlichen Welt etwa Mitte der neunziger Jahre die Umhängetasche zurückerstattet wurde. Schon wenig später setzte dann das bis heute immer wieder vernehmliche, im allgemeinen nicht oder sehr schlecht begründete Klagen über die Umhängetasche ein: Sie sei ein Requisit studentischer Langzeitloser, die dem Ernst des Lebens nicht ins Auge sehen können, heißt es. Ich fürchte allerdings, mit solchen Äußerungen begibt man sich in das geistige Jammertal von Leuten, die einander danach kategorisieren, welche Automarke sie fahren. Ich fürchte darüber hinaus, daß die beharrlichen Kritiker von quer über die Brust gehängten Taschen einen beschränkten Überblick und Rückblick haben. Sie würden auf diesen Einwand vermutlich erwidern: «Na, hören Sie mal: Bronzezeit, Hippiezeit, Schlacht auf den Seelower Höhen – das war alles vor meiner Zeit! Entschuldigen Sie bitte, daß ich noch nicht so alt bin wie Sie!» Dem auch aus Quizsendungen bekannten entschuldigenden Hinweis, daß sich manche Ereignisse vor jemandes eigener Lebenszeit abgespielt haben, haftet eine deutliche Ignoranz an. Wir leben in einer Zeit ständiger Rückblicke und Wiederveröffentlichungen. Wir können Spielfilme aus den siebziger Jahren anschauen, deren Handlung im 17. Jahrhundert liegt, wir können uns, fragend und erschauernd, von den rätselhaft eiernden Stimmen des Vorkriegstheaters anschreien lassen, durch Burgen, Grüfte und Klosterbüchereien schlurfen und, von Büchern angeleitet, Brot backen wie vor zehntausend Jahren. Nie zuvor war es so einfach, in mehreren Zeiten gleichzeitig zu leben. Man bekommt heute so viel Vergangenheit geboten, ja aufgebrummt, daß man wahrhaft große Taschen brauchte, um alles wahr- und mitzunehmen.
Was sind eigentlich die Alternativen zur Umhängetasche?
Im Zeitalter der plastischen Chirurgie gibt es vermutlich die Möglichkeit, sich Hamsterbacken annähen zu lassen. Wer solcherlei Torheit plant, sollte bedenken, daß sich die Menschheit für schlanke Gesichter wenigstens bei Erwachsenen eher begeistert als für pausbackige. Mir fällt da John Lennon ein, gegenüber dem sein gewiß nicht weniger begabter Kollege Paul McCartney immer ein Coolness-Handicap hatte – vor allen Dingen wohl wegen seiner rundlicheren Physiognomie. Man kann auch, um weitere Alternativen zu nennen, alle häufiger benötigten kleinen Dinge in seine Kleidungstaschen stopfen, was jedoch nur außerhalb des Sommers geht, oder sie in einem Tonkrug auf dem Kopf balancieren, womit freilich in der modernen Welt selbst die meisten Afrikanerinnen überfordert wären. Manche meinen sogar, man brauche überhaupt kein Behältnis – wozu müsse man denn immer soviel Zeugs umhertragen? Die so sprechen, sind im allgemeinen Autofahrer, also keine eigentlich urbanen Menschen. Sie verlagern das Problem des Transports der persönlichen Gegenstände in ihr Fahrzeug, wo es dann häufig aussieht wie in einer ganz schlimmen Handtasche. Der Mensch braucht immer irgendein Zeug. Selbst wer den Inbegriff seines persönlichen Freiheitsgefühls darin sieht, vollkommen nackt am Strand spazierenzugehen, wird binnen kurzem Sehnsucht nach irgendwelchen Gegenständen haben, nach einer Flasche Sonnenlotion, einem Ball, einer Schaufel oder wenigstens nach einem Stock, mit dem er, hoffend, daß ein aufmerksames Kleinflugzeug ihn bemerkt, in den Sand schreiben kann: «Ich habe Durst!»