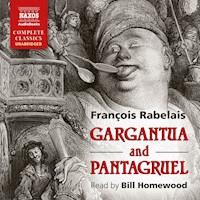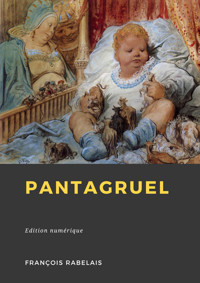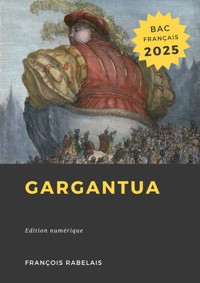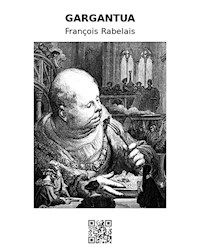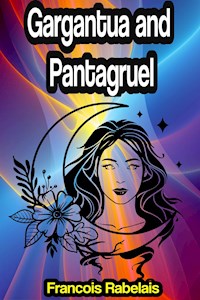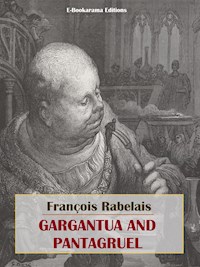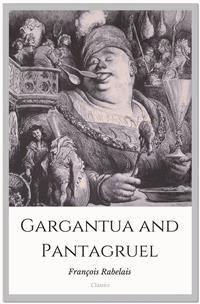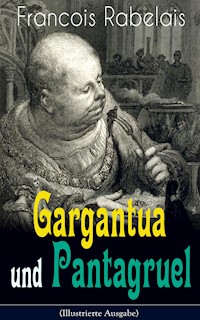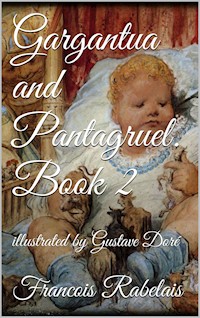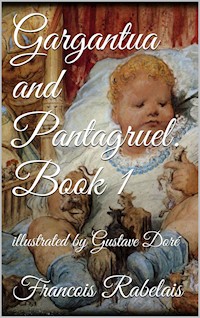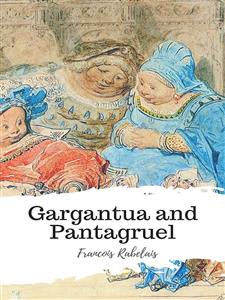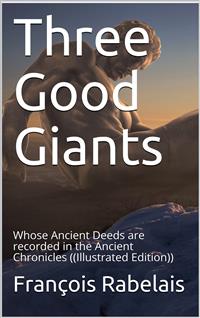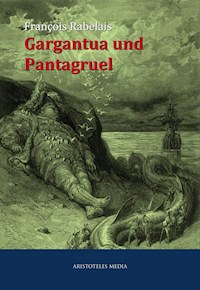
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pantagruel, Sohn des Gargantua, ist ein Riese, der sich nicht auf eine Größe festlegen läßt. Mal passt er in einen Gerichtssaal, mal hat er einen derart großen Mund, dass der Erzähler eine Zeit lang in dessen Mund leben kann und zusammen mit ihm ein ganzes Volk. Und da ist sein Freund Panurge, der über das Für und Wider einer Heirat philosophiert und mit dem er viele Abenteuer bestreitet auf der Seereise und der Suche nach dem Orakel, der göttlichen Flasche. Hier begegnen sie vielem Fremdartigen und erstaunlich Sonderbarem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
François Rabelais
Gargantua und Pantagruel
Einführung
»Sehr treffliche Zecher und ihr, meine kostbaren Venusbrüder – denn euch und sonst niemandem sind meine Bücher zugeschrieben ...« Mit diesen Worten wendet sich Maistre Alcofribas Nasier (Anagramm von François Rabelais) im Vorwort zu seinem Höchst erstaunlichen Leben des großen Gargantua (1534) an seine Zeitgenossen. Eine Anrede von zweifelhafter Herzlichkeit! Die »sehr trefflichen Zecher« von 1534 aber waren weniger zimperlich. Lockere Sitten in Liebesangelegenheiten waren in den besten Familien an der Tagesordnung, und was das Zechen betrifft, so hat es noch nie als ehrenrührig gegolten, ein trinkfester Saufbruder zu sein. Nein, die damaligen Leser der unerhörten Heldentaten des Gargantua und Pantagruel waren entzückt. Da war endlich jemand, der ihre Sprache redete – eine Sprache, die die Dinge beim Namen nannte, so unverhohlen und eindeutig, daß die gelehrten ›Abstraktoren‹ jener Zeit es mit der Angst bekamen: »Euch aber soll Antonius' Feuer brennen, soll fallende Sucht zu Boden werfen, Krebs fressen, Blutfluß abzapfen, Aussatz, fein wie Kuhhaar, mit Quecksilber verfeuert, in den Hintern fahren, und ihr sollt wie Sodom und Gomorrha in Schwefel, Feuersglut und Höllengestank umkommen, wenn ihr nicht getreulich alles glauben werdet, was ich euch in dieser gegenwärtigen Chronik berichten tue.«
Das war ein ganz neuer Ton, ein Stil, der sich den Teufel scherte um jede erzieherische oder bildende Absicht einer Ars Poetica. Die Gebildeten, die echten wie die falschen, fühlten sich vor den Kopf gestoßen. Der Sorbonne, der allmächtigen Regentin über Wissen und Gewissen, fiel es nicht schwer, schockiert zu sein. Ihr genügten die Freiheiten des Pantagruel (1532), um das Buch in Grund und Boden zu verdammen. Doch auch die Humanisten sahen zunächst in Pantagruel nicht viel mehr als einen groben, unanständigen Ulk. »Was fällt dir ein, Rabelais?« schreibt 1533 der Dichter Nicolas Bourbon, ein Freund Rabelais'. »Immer mehr lenkst du unsere Scholaren von ihren Pflichten ab, vom Studium der Literatur und von der Liebe zu den heiligen Büchern. Willst du denn zusehen, wie sie ihre schöne Jugend ... in deinen frivolen und finsteren Volksmären ... in unwürdigen Gemeinheiten, im Mist, im Schlamm verlieren? « Erst zwei Jahre, später, nach der Veröffentlichung des Gargantua, entdeckte man »la sustantificque mouelle«, das »substantialische Mark« dieser anscheinend so groben Knochen. Die hochgelehrte Welt der Sorbonnisten und Scholastiker verdarb sich daran gründlich den Magen. Die Humanisten und Reformatoren aber wußten den Nährwert zu schätzen.
Und was empfindet der unbefangene Leser von heute? Mehr an Ordnung gewöhnt, wird ihn die wild wuchernde Sprache, die Unförmigkeit des Ganzen verwirren. Geschult am pointierten Stil, an der diskreten Formulierung, die mehr andeutet als ausspricht, wird es ihm manchmal schwerfallen, über Rabelais' grobkörnigen Witz zu lachen. Andererseits entschädigt ihn die Fülle für die mangelnde Form. Dies ist kein Spaziergang durch den wohlproportionierten Park von Versailles – dazu ist es noch ein Jahrhundert zu früh –, sondern ein rauher Marsch durch die Wildnis, voller Überraschungen und nicht immer angenehm. Denn daß in der freien Natur nicht alles nach Eau de Cologne riecht, weiß jeder Naturfreund, und dem Philosophen ist klar, daß dies eben in der Freiheit der Natur begründet ist. Mit anderen Worten: es geht – um das Ärgernis gleich vorwegzunehmen – nicht darum, Rabelais' berühmte Unanständigkeit zu entschuldigen. Es geht darum, sie zu verstehen, aus der Zeit, aus der Anlage des Gesamtwerkes.
Man hat Rabelais' gesunde Schamlosigkeit mit der eines großen, nackten Babys verglichen. Damit ist im Grunde nicht viel gesagt. Urwüchsigkeit und Infantilität sind ja hier nicht Gegenstand, sondern Form der Auseinandersetzung. Man vergißt über den Spaßmacher zu leicht den Gelehrten. Der gleiche Rabelais, der über »Gargantua, Pantagruel, Saufaus, die Würdigkeit des Hosenlatzes, Speckerbsen cum commento etc.« schrieb und zu schreiben sich vornahm, hat Galenus ex cathedra gelehrt und die Aphorismen des Hippokrates nach dem griechischen Urtext kommentiert. In seinen fünf Büchern ist ein Wissen von enzyklopädischer Breite aufgespeichert. Die zahllosen Zitate, Anspielungen, Reminiszenzen aus der Antike und dem Mittelalter, geschöpft aus allen Wissensbereichen, vermag heute kaum noch jemand ohne einen wissenschaftlichen Kommentar zu verstehen. Rabelais' Gelehrsamkeit will ernst genommen sein. Sie ist nicht, wie etwa das romantische Rittertum des Don Quichotte, sich selbst ein Gegenstand überlegener Ironie. Trotz der Angriffe auf Pseudo-Wissen und Pro-forma-Bildung, trotz der Versuche, die Zwangsjacke der Scholastik zu sprengen, hat Rabelais seine eigene scholastische Erziehung so wenig verleugnen wie verwinden können. Es ist übereilt, aus ihm einen Pionier der Neuzeit zu machen, ihn als den ersten großen Realisten zu feiern oder ihn gar für sozialistische Ideologien in Anspruch zu nehmen. Rabelais hat noch an einem großen Packen kritiklos übernommenen Bildungsballastes zu schleppen. Wie schwer ihn diese Last drückte, mag man an der Grobheit seiner Ausfälle ablesen.
Rabelais' Zweideutigkeit ist die Zweideutigkeit seiner Zeit. Diese Zeit läßt sich nicht in eine Formel bringen. Die französische Renaissance im 16. Jh. ist Bewegung, Gärung, nicht Ruhe im Zustand. Die Vergangenheit ist noch nicht überwunden, und die Gegenwart, unendlich bereichert durch die Entdeckung der Alten und der Neuen Welt, ist noch nicht verarbeitet. Die Wissenschaft gerät in Widersprüche, resultierend aus dem Bemühen, die Entdeckungen mit der Überlieferung in Einklang zu bringen. Das ganze Leben jener Zeit, deren Friedensjahre man an den Fingern abzählen kann, macht den Eindruck eines riesigen Bauplatzes: Neubauten schießen aus dem Boden, baufällige Ruinen brechen zusammen, andere, solidere Bauten werden gestützt und ausgebessert. Geistesgeschichtlich ist dies der Prozeß der reifenden Autonomie des Individuums. Die Emanzipation des Geistes, die man als das entscheidende Kriterium der Neuzeit ansieht, beginnt im späten Mittelalter und verwirklicht sich zum erstenmal in Shakespeare. Rabelais liegt in der Mitte – nicht zeitlich, aber entwicklungsmäßig. Aus seinen Büchern spürt man eine der stärksten Regungen des Neuen im Schoß des Alten, des autonomen Geistes in der mittelalterlichen Geborgenheit. Ob man die Neuzeit mit ihm beginnen läßt oder schon mit ihren verborgenen Ansätzen im Spätmittelalter oder erst mit dem Auftreten Shakespeares, ist lediglich eine Frage der Größenordnung, für das Ereignis selbst aber ohne Belang.
Diese ungeordnete Zeit spiegelt sich wider in den Schicksalen der Menschen, die in ihr lebten. Das 16. Jh. kennt wenige Persönlichkeiten, deren Leben in klaren, geordneten Bahnen verlaufen wäre. Vieles an ihnen erscheint uns heute ungereimt. Etienne Dolet, später gefeiert als ›Märtyrer der Renaissance‹, verschrieb sich gestern dem Geist der Reformation, verfaßte heute ein Gedicht zu Ehren der heiligen Jungfrau, machte sich morgen über die Wallfahrten lustig und endigte schließlich auf dem Scheiterhaufen. Clément Marot, Dichter am Hofe Franz I., saß unter der Anklage, während der Fastenzeit Speck gegessen zu haben, im Gefängnis und schrieb dort einige seiner geistvollsten Gedichte. Das Leben François Rabelais' war nicht weniger bunt und abenteuerlich. »Wundersames Leben und unerhörte Taten des Meisters Rabelais, Franziskaner, Benediktiner und abtrünniger Mönch, fahrender Scholast, Doktor der Medizin und Dichter, Humanist, Weltbürger, Evangelist und Pfarrgeistlicher« – nicht lang und barock genug könnte ein solcher Titel über seiner Lebenschronik sein. Tatsächlich weiß man über seine Person nicht allzu viel. Manches liegt im Dunkel, verbirgt sich hinter der Vielfalt der Erscheinungen. Anderes ist Legende oder unsichere Anekdotenüberlieferung, zu der gerade Rabelais ideale Anlässe bietet. Trotzdem bleibt eine Fülle von Tatsachen. Nur in groben Umrissen kann an dieser Stelle auf das Wichtigste eingegangen werden.
François Rabelais (geb. wahrscheinlich 1494) stammt aus Chinon in der Touraine, dem ›Garten Frankreichs‹, der von Ronsard über Descartes zu Balzac so viele große Genies hervorgebracht hat. Über seine Jugend weiß man am wenigsten. Vermutlich wurde er in einem Franziskanerkloster bei Angers erzogen und dort für den Priesterberuf vorbereitet. Die scholastische Philosophie und Theologie des Duns Scotus, in die er damals eingeweiht wurde – nicht nach dem Urtext, sondern nach den Schriften der Kommentatoren –, hat er später nicht genug verspotten können. Mit dem Jahr 1521 beginnt in dem Franziskanerkloster Fontenay-le-Comte in Poitou Rabelais' Mönchsleben, das fünfzehn Jahre dauern sollte. Für seine Bildung und Formung waren es die entscheidendsten. Zwei Erfahrungen bestimmten seine ganze spätere Haltung: die Mißstände im Klosterleben und der Humanismus. Gegen den geistigen und religiösen Verfall der Klöster, gegen die Heuchelei und Zügellosigkeit der Mönche richtete Rabelais später seine schärfste Satire. Dem Kontakt mit einigen großen Humanisten seiner Zeit, u.a. mit Guillaume Budé, verdankte er seine humanistische Bildung, vor allem die Kenntnis des Griechischen. Darauf beginnt die unruhige Zeit seines Lebens. Rabelais wird Weltgeistlicher, bereist Frankreich und studiert in Montpellier Medizin. 1537 treffen wir ihn in Lyon, wo er bei einer öffentlichen anatomischen Demonstration die Leiche eines Gehenkten seziert, ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen; denn damals waren die Leichen nicht so geduldig wie heute. Sie sträubten sich noch hartnäckig gegen die Anatomie, aus Furcht, womöglich ihre spätere Auferstehung zu komplizieren. ›Citra adustionem et incisionem‹ – nur ohne Brennen und Schneiden, also nur ohne die eigentliche ärztliche Praxis war es kirchlicherseits Doktor Rabelais erlaubt, die Medizin auszuüben – nach unserer modernen Auffassung eine Absurdität. Aber es sollte noch lange dauern, bis die Medizin sich dazu bequemte, vom Katheder herunterzusteigen. Noch ein Jahrhundert später lieferten die Herren Mediziner von der Fakultät, die ihre Kranken mit Latein zu kurieren pflegten, einem Molière den dankbarsten Komödienstoff.
Inzwischen hatte Rabelais Pantagruel (1532) und Gargantua (1534) publiziert und im Gefolge seines großen Protektors, des Kardinals Du Bellay, zwei Romreisen unternommen. Das Dritte Buch (1546), nach Ansicht der Theologen »vollgestopft mit den verschiedensten Häresien«, trug seinem Verfasser zwei Exiljahre in Metz ein. Nach einer dritten Romreise und der Veröffentlichung des Vierten Buches (1552) verlieren sich Rabelais' Spuren. 1553 war er nominell Pfarrer in Meudon bei Paris, und er starb vermutlich Anfang April des gleichen Jahres in Paris. Erst nach seinem Tode, 1564, erschien das Fünfte Buch. Man ist sich noch immer nicht einig, ob und wieweit Rabelais der Verfasser ist. Vermutlich wird sich diese Frage nie eindeutig entscheiden lassen.
Kaum ein dichterisches Werk hat so sehr die literarische Forschung strapaziert wie diese fünf Bücher Rabelais'. Phantasie und Scharfsinn interpretierten um die Wette, für alles suchte und fand der philologische Eifer eine Erklärung. Indessen wurden die Unklarheiten nicht beseitigt – im Gegenteil, sie vermehrten sich proportional der einander oft widersprechenden Deutungen. Die Forschung wurde zum Selbstzweck, verlor sich in Einzelheiten und übersah oder leugnete den Zusammenhang. Kommentar gelungen – Dichtung tot. Erst seit kurzem verzichtet man ein wenig auf die Detailinterpretation zugunsten einer großzügigeren Gesamtanalyse. – Es ist nicht leicht, über Gargantua und Pantagruel summarisch etwas auszusagen. Der Stoff ist so reich und vieldeutig, daß die Entscheidung über die Auswahl genauso schwerfällt wie die über die Art der Darstellung. Letztlich ist es Sache des Lesers, ob er das »substantialische Mark« heraussaugen und darin »einen anderen Schmack und tief verborgenere Lehre« finden wird.
Was veranlaßte Rabelais zu seinen burlesken Erzählungen? Soll man seiner treuherzigen Versicherung glauben, daß er sie allein zur »Erheiterung der Kranken, Siechen und Gichtbrüchigen« geschrieben habe? Wohl kaum! Seine »Naivität« ist ja die Tarnung, hinter der sich die Satire verbirgt. Für Rabelais' Zwecke eignete sich besonders gut die Chronik eines Riesengeschlechtes; denn es kursierte bereits zu seiner Zeit mit großem Erfolg ein harmloses Volksbuch, anonym erschienen unter dem Titel Die große und unschätzbare Chronik vom großen und gewaltigen Riesen Gargantua. Was lag näher, als dieses beliebte Sujet auszubeuten? So wurde Rabelais' Riesenchronik – riesig in jeder Hinsicht: in der Unzahl der Ereignisse, der Anspielungen, in der Breite des Wissens, im Ausmaß der sprachlichen und stilistischen Formen – zu einer riesigen Zeit-und Gesellschaftskritik.
Rabelais' schärfste Satire richtet sich gegen das Mönchswesen. Die langen Jahre im Kloster hatten in ihm einen Haß geschürt, den er zeit seines Lebens nicht verwinden konnte. Kein Ausdruck ist ihm zu unflätig, kein Tier abscheulich genug zur Bezeichnung der Kuttenträger, der feigen, geilen und verlogenen Parasiten der menschlichen Gesellschaft. Rabelais bleibt jedoch nicht in der Beschimpfung stecken; seine Satire dringt tiefer als die übliche Mönchspolemik des Mittelalters. Sie trifft die Wurzel des Übels, nämlich jene mönchische Haltung, die jede geistige und religiöse Regung einem ebenso starren wie bequemen Formalismus unterordnet und auf Kosten Gottes und der Mitmenschen zu einem tatenlosen Opportunismus einlädt. Die Mönche der Abtei von Seuillé (Gargantua, Kap. 21) greifen angesichts der bevorstehenden Plünderung nicht etwa zu den Waffen: sie flüchten sich wie scheue Hasen in die Kirche, empfehlen sich der Güte Gottes und intonieren ihr »Impetum inimicorum«. Rabelais läßt es aber nicht bei der negativen Kritik bewenden. Der prächtige Bruder Jahn, ebenso hochherzig wie seine Mitbrüder duckmäuserisch, weiß nicht, was er lieber tut: ob mit dem Kreuzholz auf die Feinde dreschen oder mit einem Humpen Wein seinen ewigen Durst löschen. Die Abtei von Thélème, mit der er von Gargantua für seine Taten belohnt wird, ist Rabelais' ›Sozialutopie‹. »Tu, was du willst« – das ist die einzige Ordensregel der Thélèmiten, die Formel für jedes menschliche Zusammenleben; denn nur im Klima der Freiheit – der richtig verstandenen Freiheit – können Kunst, Wissenschaft, Tugend und auch die Liebe gedeihen. Man hat viel über die Abtei von Thélème geschrieben, hat in ihr die Quintessenz des ganzen Werkes und darüber hinaus »das Gedicht der Renaissance« sehen wollen. Vielleicht geht das zu weit. Thélème ist wohl in der Hauptsache ein antiklösterliches Pamphlet, die Rache eines abtrünnigen Mönches, der sich, wie Bruder Jahn, »seine Religion im Gegensatz zu allen anderen einrichtete«. Daß der Ex-Franziskaner Rabelais nicht als einziger am Klosterwesen Anstoß nahm, beweisen die Schriften des Ex-Augustiners Erasmus. Rabelais hat Erasmus nicht nur bewundert und als den »unbesiegbaren Champion der Wahrheit« gepriesen; er verdankt ihm auch allerlei, wenn nicht das Wesentliche.
Parallel der Auflehnung gegen die klösterlich-scholastische Enge erhebt sich in den Werken Rabelais' ein Protest, den man als »Protest des Fleisches« bezeichnen könnte. Sein wichtigster Repräsentant ist Panurge, Konglomerat aus Intelligenz, Feigheit, Nonchalance, Treue und Unsittlichkeit. Panurges Worte und Werke sind nicht geeignet zur Wiedergabe in Damengesellschaft; mit ihm stellt sich das Problem der berüchtigten Rabelaisschen Obszönität – ein Problem, das seine unverdiente Stellung wohl nur der Tatsache verdankt, daß es lange unter falschen Voraussetzungen angegangen wurde. Man unterstellte dem Unanständigen eine unanständige Absicht, nahm es mit großem Bedauern in Kauf und formulierte Entschuldigungen oder Aggressionen, je nach dem offiziellen Grade der Schamhaftigkeit und der mutmaßlichen Empörung des Lesers. Anstatt es einfach als das zu erklären, was es ist: eine Reaktion. Ob und wieweit diese Reaktion übers Ziel hinausschießt, darüber zu urteilen ist nicht Sache der Nachwelt; denn die Maßstäbe liegen im 16. Jh., nicht im 20. Es ist dies das Jahrhundert des Pseudogeistes und der Scheinmoral auf trügerischem religiösem Goldgrunde, das Jahrhundert gleichzeitig der fanatischen Askese und der päpstlichen Ehebruchskinder. Rabelais protestiert nicht gegen den Geist an sich, vielmehr gegen die widernatürliche Verachtung des Fleisches auf Kosten beider, gegen die Zerlegung des Menschen in edle und gemeine Bestandteile. »Ich werde dir die Kehrseite dieser hochmütigen Demut zeigen. Du wirst sehen, wohin die Vergewaltigung der Naturgesetze führt. Schau nur auf dich selbst. Deine Gelüste bringen dein Büßerhemd zum Platzen. Dein Unschuldskleid paßt dir nicht mehr: aus allen Löchern verrät es dein wollüstiges Fleisch. Zwischen zwei Litaneien oder zwei Sophismen stopfst du dich voll mit Essen bis zum Platzen. Da siehst du, was man erreicht, wenn man unsere erste Heimat, die Erde, verachtet. Wer sich zum Engel erhöhen will, der wird zum Tier erniedrigt.« Mit diesem Zitat ist über das heikle Thema eigentlich alles gesagt. Auch Rabelais' vieldiskutierte Geringschätzung des weiblichen Geschlechts ist im Grunde eine Reaktion auf den saft- und kraftlosen, in äußeren Formen erstarrten Frauenkult seiner Zeit. Dagegen halte man Panurges unzweideutige Liebeswerbung: »Madame, dem Staat wär es ersprießlich, Euch ergötzlich, Euerm Stammbaum zur Ehre gereichend und mir notwendig, wenn Ihr Euch mit meiner Rasse belegen ließet.« Dies und alles andere, was sich unterhalb des Gürtels abspielt, wird so ohne jede unanständige Verschleierung beim Namen genannt, daß die polemische Absicht viel zu deutlich ist, als daß die Gefühle des Lesers ernstlich verletzt werden könnten – es sei denn, er leide unter der gleichen scholastischen Verdrängung.
Mit der gleichen Treffsicherheit polemisiert Rabelais gegen das Erziehungswesen, gegen die Rechtsmißbräuche, die Dummheit und Eitelkeit der Gelehrten und vieles andere mehr. Unmöglich, das alles anzuführen. Doch es stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang, nach einem roten Faden innerhalb des Ganzen. Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck eines ungeordneten Panoptikums, ohne tiefere Organisation. Bis heute wird zum großen Teil an dieser Meinung festgehalten. Vielleicht macht man es sich damit zu leicht. Denn schließlich hat jedes dichterische Werk seine eigene, manchmal verborgene Kohärenz, seinen Ausgangspunkt und sein Ziel.
In Gargantua und Pantagruel wird nach dem Muster der mittelalterlichen Ritterromane über Jugend, Ausbildung und kriegerische Taten der Helden berichtet. Das Dritte Buch behandelt im wesentlichen die Frage, ob sich Panurge verheiraten soll. Sieht man von den Personen ab, so ist diese Episode nicht so willkürlich an diese Stelle gesetzt, wie es den Anschein hat. Die Heirat ist für jeden Mann eine gewichtige Angelegenheit, ein entscheidender Schritt ins Leben; geht es doch auch – und sogar vor allem – dabei um Nachkommenschaft, – Erhaltung der Rasse usw. (Rabelais selbst hatte mindestens drei uneheliche Kinder) – also um ernste und dringliche Fragen. Das Risiko allerdings, das jede Heirat mit sich bringt, läßt sich nicht durch Ratschläge Fremder beseitigen. Auf Panurges Frage, ob seine zukünftige Frau ihm Hörner aufsetzen wird, gibt es seitens der Wissenschaft keine beruhigende Antwort. Die vielen Konsultationen im Dritten Buch bleiben ohne Ergebnis und motivieren das Vierte und Fünfte Buch, nämlich die lange Reise zum Orakel der Göttlichen Flasche.
Man muß den Sinngehalt all dieser Episoden und Bilder begreifen, um die in ihnen verborgene Wahrheit aufzuspüren. Zu Anfang des Dritten Buches entwirft Rabelais im »Lob der Schulden« eine harmonische Welt, ein Ideal. Die Harmonie der Ehe ist auch ein Ideal. Die beschwerliche Suche nach dem Ideal können dem Suchenden die anerkannten Ratgeber der Welt weder ersparen noch erleichtern. Das institutionelle Wissen muß abdanken und den Weg freigeben für die höchstpersönliche Fahrt zur Göttlichen Flasche – ein langer und gefährlicher Weg. Aber selbst die Göttliche Flasche orakelt keine Patentlösung, im Gegenteil: ihre Antwort »Trink« ist die Aufforderung zum eigenen aktiven Handeln. In vino veritas – allerdings. Aber trinken muß man selbst. Man hätte Rabelais vergessen, wäre sein Werk nichts weiter als eine zeitgebundene Satire. Aber »... die guten Leute, die mit toten Steinen bauen, stehen im Buch meines Lebens überhaupt nicht verzeichnet, denn ich baue nur Lebendiges, d.h. Menschen«. Und dieses Lebendige hat die Jahrhunderte überdauert. Es ist heute so frisch und aktuell wie vor 400 Jahren. Oder wäre etwa der Eroberungswahn eines Diktators vom Schlage Pikrochols heute ein Anachronismus, die Demagogie seiner Hauptleute etwas uns völlig Fremdes? Gibt es heute keine volksverdummenden Disputationen mehr, wo der Publikumsbeifall proportional der Anzahl der leeren Worte steigt? Die Menschen haben sich weniger geändert, als es die Geschichte wahrhaben möchte. Nicht nur ist alles schon einmal dagewesen: es kommt offenbar alles auch einmal wieder. Jedenfalls liefert uns Rabelais dafür einen ergötzlichen Beweis, und eben das garantiert die Wahrheit und den Fortbestand seiner Dichtung.
Die vorliegende Ausgabe beruht auf einer späteren Bearbeitung (von Ulrich Rauscher, 1913) der ältesten deutschen Gesamtübertragung von Gottlob Regis (1832-41). Der Umfang des Stoffes machte eine Auswahl notwendig. Gekürzt wurden aber lediglich die weitschweifigen Exkurse, zahllosen Belege und Zitate von antiken Schriftstellern u.ä. Selbstverständlich gehört zu einem genauen Studium Rabelais' die Kenntnis seines Gesamtwerkes. Dessen Übersichtlichkeit und flüssigere Lektüre aber werden durch eine solche Einbuße eher gefördert. Die von Regis in bewußt altertümlichem Deutsch gehaltene Übersetzung wurde nur dort geändert, wo sie in Wortgebrauch und Formulierung dem modernen Leser unverständlich erschienen wäre.
Helmut Müller
An meine Leser
Freund, der du dies Buch durchblätterst, Laß dich nicht in Harnisch bringen, Daß du mir nicht tobst und wetterst, Denn du find'st von schlechten Dingen Nichts darin. Ob arg viel Gutes? Weiß ich nicht, 's wär' denn das Lachen! Und ich will euch lachen machen. In der Dumpfheit eures Blutes Kann euch ja kein Scherz gelingen! Eure Tränen steh'n euch schlecht: Lachen! das ist Menschenrecht!
Des Autors Prolog
Sehr treffliche Zecher und ihr, meine kostbaren Venusbrüder (denn euch und sonst niemandem sind meine Bücher zugeschrieben): Alcibiades, in dem Gespräch des Platon, Gastmahl betitelt, sagt unter anderen Reden zum Lob seines Meisters Sokrates, welcher unstreitig der Weltweisen Kaiser und König war, daß er sei gleich den Silenen gewesen. Silenen waren einstens kleine Büchslein, wie wir sie heut in den Läden der Apotheker sehen, von außen bemalt mit allerlei lustigen, schnakischen Bildern, als sind Harpyien, Satyrn, gezäumte Gänslein, gehörnte Hasen, gesattelte Enten, fliegende Böcke, Hirsche, die an der Deichsel ziehen, und andre vergnügliche Bilder mehr, zur Kurzweil konterfeiet, um einen Menschen lachen zu machen: wie denn des guten Bacchus Lehrmeister Silenus auch beschaffen war. Hingegen im Innersten derselben verwahrte man die feinen Spezereien, als Balsam, Bisam, grauen Ambra, Zibeth, Amomum, Edelstein und andre auserlesene Dinge. So, sagt er, war auch Sokrates; weil ihr denselben von außen betrachtend und äußerm Ansehn nach schätzend nicht einen Zwiebelschnitz für ihn gegeben hättet: so häßlich war er von Leibesgestalt, so linkisch in seinem Betragen, mit einer Spitznas, mit Augen wie eines Stieres Augen, mit einem Narrenantlitz, einfältigen Sitten, bäurisch in Kleidung, arm an Vermögen, bei Weibern übel angesehen, untauglich zu allen Ämtern im Staat, immer lachend, immer jedem zutrinkend, immer Leute foppend, immer und immer Verstecken spielend mit seiner göttlichen Wissenschaft. Aber, so ihr die Büchse nun eröffnet, würdet ihr inwendig gefunden haben himmlisch unschätzbare Spezereien: einen mehr denn menschlichen Verstand, wunderwürdige Tugend, unüberwindlichen Starkmut, Nüchternheit sondergleichen, feste Genügung, vollkommenen Trost, unglaubliche Verachtung alles dessen, darum die sterblichen Menschen so viel rennen, wachen, schnaufen, schiffen und raufen.
Wohin (denkt ihr in euern Gedanken) zielt doch dies Vorspiel, dieser Probschuß? Dahin, daß ihr meine guten lieben Jüngerlein und etliche eurer Mitmaulaffen, wann ihr die lustigen Titel etlicher Bücher von unsrer Erfindung leset, als: Gargantua, Pantagruel, Saufaus, die Würdigkeit des Hosenlatzes, Speckerbsen cum commento etc., allzu leichtfertig urteilt, es werde darinnen nichts abgehandelt als eitel Spottwerk, Narreteien und lustige Lügenmärlein, da ja ihr äußerlich Sinnschild (das ist der Titel) ohne weitre Untersuchung gemeinlich für Possen und Schimpf geachtet wird. Aber also leichtfertig ziemt sich nicht Menschenwerk abzuschätzen; denn ihr pflegt doch selbst zu sagen, daß das Kleid nicht den Mönch mache, und mancher ist verkappt in eine Mönchskutte, der innerlich wenig vom Mönchtum weiß; geht auch wohl mancher im spanischen Mantel, dem sein Sinn nimmer nach Spanien stehet. Derhalb soll man das Buch recht auftun, und was drin ausgeführt, sorglich erwägen. Dann werdet ihr merken, daß die Spezerei drin wohl von einem andern und höheren Wert ist, als euch die Büchse verhieß: will sagen, daß die hie behandelten Materien nicht alle so töricht sind, als es die Überschrift vorgeschützt.
Und den Fall gesetzt, daß ihr auch im buchstäblichen Sinn genugsam lustige Dinge anträfet, die sich wohl zum Namen schickten, sollt ihr doch gleichwohl hieran nicht haften bleiben wie am Sirenensang, sondern vielmehr im höheren Sinn auslegen, was ihr vielleicht nur Scherzes halber gesagt zu sein vermeint hattet. Zogt ihr je einer Flasche den Pfropf aus? Ei potz Zäpel! So denket zurück, wie ihr euch dazu angestellet. Oder sahet ihr je einen Hund, wann er ein Markbein am Wege fand? Dies ist, wie Plato Lib. 2 de Rep. schreibt, das philosophischste Tier der Welt. Wenn ihr's gesehen habt, habt ihr wohl merken können, wie andächtig er es erspäht, wie eifrig er's wahrt, wie hitzig er's packt, wie schlau er's anbricht, wie brünstig zerschrotet, wie emsig aussaugt. Wer treibt ihn an, also zu tun? Was ist die Hoffnung seiner Hundsmüh? Was vermeint er hieraus Gutes zu erlangen? Nichts weiter als ein wenig Mark: wenn schon in Wahrheit dieses Wenig weit köstlicher denn alles Viel der anderen Dinge ist, da denn das Mark eine Nahrung, die zur Vollkommenheit der Natur ist erwirket worden, wie Galenus spricht III. facult. nat. et XI. de usu partium.
Nach dessen Fürbild nun ziemet euch Klugheit, daß ihr fein riechen, wittern und schätzen mögt diese edeln saftigen Schriften, die man zwar leichtlich pürschen mag, schwer aber treffen; daß ihr dann mittels fleißigen Lesens und steter Betrachtung den Knochen erbrecht und das substantialische Mark draus sauget, in gewisser Hoffnung, daß euch solch Lesen witzigen und erleuchten wird. Denn ihr sollt wohl einen anderen Schmack und tiefverborgenere Lehre drin finden, die euch höchst überschwengliche Sakramente und schaudervolle Mysterien offenbaren wird, sowohl unsre Religion als auch Welt- und Regentenstand und die Hauszucht betreffend.
Glaubt ihr auch wohl, auf euern Eid, daß Homer, als er die Ilias und Odyssee schrieb, jemals an die Allegorien gedacht habe, die aus ihm auskalfatert Plutarch, Eustatius, Phornutes, Heraklit, Pontiquus und was aus ihnen Politian gestohlen hat? Wo ihr es glaubt, kommt ihr weder mit Händen noch Beinen zu meiner Meinung, die besagt, daß dem Homer dergleichen so wenig im Traum erschienen, als dem Ovid in seinen Metamorphosen die evangelischen Sakramente, wie sie ein Bruder Hungerleider und wahrer Mückensieber sich drin zu erweisen sich gemartert hat, ob er vielleicht mehr Narren wie er und, wie das Sprichwort sagt, Deckel auf seinen Topf fänd.
So ihr es aber nicht glaubt, ei! was hindert euch, mit dieser muntern und neuen Chronik nicht eben auch also zu tun? Wiewohl ich, derweil ich's diktiert, so wenig dran gedacht hab' wie ihr, die ihr wohl so gut trinkt wie ich. Der ich mit Herstellung dieses sehr herrlichen Buches nicht mehr Zeit vertan noch verdorben hab', als die ich mir zu Einnahme meiner Leibesnahrung vorbestimmt hätt', nämlich während Essens und Trinkens. Auch ist dies just die rechte Stund, da man von so erhabenen Dingen und tiefen Wissenschaften schreiben soll.
Wie sich gar wohl darauf verstanden Homer, der Spiegel aller Schriftgelehrten, und Ennius, der lateinischen Poeten Ziehvater; wie Horaz bezeuget: wenn auch ein Wirrkopf behaupten will, daß seine Verse mehr nach Wein denn nach Öl röchen.
Dergleichen sagt nun ein Hanswurst auch von meinen Büchern. Aber ich acht ihn einen Quark. Weingeruch, o wie weit nützlicher, schützlicher, kützlicher, himmlisch holdseliger ist er doch als der des Öles! Und werd er mir's zu keinem geringern Ruhm anrechnen, daß man von mir sag, ich hab in Wein mehr aufgehn lassen denn in Öl, als Demosthenes tat, da man ihm nachsagt', er hätt' in Öl mehr vertan denn in Wein. Ich für mein Teil kann nur Ehr und Ruhm davon haben, so man mich für einen guten Schlucker und Kunden mitgelten und laufen läßt. Bin unter dem Namen gern gesehen bei allen guten Pantagruelsbrüdern. Dem Demosthenes hat's ohnehin ein Sauertopf längst vorgeruckt, daß seine Reden wie eines alten garstigen Ölhökers Lumpen röchen. Derhalb legt meine Wort und Werk zum allervollkommensten aus, habt Ehrfurcht vor dem käsförmigen Hirnbrei, der euch mit diesen schönen Schaumbläschen ätzet und, so viel an euch, bleibt mir fein allzeit guter Dinge.
Nun, so erlabt euch dran, liebe Schätzlein: lest es fröhlich zu Leibestrost und Nierenfrommen. – Aber halt! Daß euch der Wolf ins Gesäß schlag! Wollt ihr mir gleich meinen Gottslohn zutrinken? Salu! Ich tu euch Bescheid!
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Von des Gargantua Antiquität und Stammbaum
Wollt' Gott, ein jeder wüßt' seinen Stammbaum vom Kasten Noah bis diese Stund! Ich halt dafür, es sind gar manche heutzutag Kaiser, Könige, Herzöge, Fürsten und Papst auf Erden, welche von einigen Ablaßhausierern und Ballenbindern das Leben haben. Und wiederum gar manche sind Spitalbrüder, elende Lumpen und Hungerleider, die vom Geschlecht und Blute großer Könige und Kaiser entsprossen sind, hinsichtlich der erstaunlichen Versetzung der Staaten und Königreiche:
Assyriens in Medien, Mediens in Persien, Persiens in Mazedonien, Mazedoniens in Rom, Roms in Griechenland, Griechenlands in Frankreich.
Und daß ich mich, der ich's euch sag', allein zu einem Exempel aufwerf', so glaub' ich gänzlich, daß ich etwa von einem reichen König oder Fürsten der Vorzeit herkomm'; denn ihr habt euer lebelang keinen Menschen gesehen, der einen stärkern Trieb, König und reich zu sein, in sich verspürt hätt', als mich: auf daß ich auch im Saus könnt' leben, nix schaffen noch sorgen dürft' und meine Freunde und alle frommen und geschickten Leut daneben auch stattlich reich machen möcht'. Aber ich tröst' mich wiederum damit: ist es nit hie, so ist es dort; ja wohl weit mehr, als ich mir jetzt zu wünschen erkühnt. Tröstet auch ihr euch in euerm Unglück mit diesen oder besseren Gedanken, und ist es tunlich, habt allzeit frisches Getränk bei euch.
Um jetzt wieder auf besagten Hammel zu kommen, sag' ich, daß uns durch höchste Schenkung des Himmels die Antiquität und Stammbaum Gargantuas vollständiger sind erhalten worden als irgendeiner, ohn des Messias Stammbaum, von welchem ich nicht sprechen mag, denn es geziemt mir nicht: auch sind die Teufel (das sind die Heuchler und falschen Betbrüder) dawider. Er ward gefunden durch Hans Audeau auf einer Wiesen, so er hätt unweit der Gualeauer Schleusen unter Olive auf der Seit gen Narsoy. Wie der die Gräben dort stechen ließ, da stießen die Gräber mit ihren Hacken auf ein großes Grab von Erz; lang ohnemaßen, denn sie konnten nimmer ein End davon finden, weil es bis weit in die Vienner Gemarkung strich. Als sie solches an einem Ort erbrochen hatten, wo ein Becher gezeichnet war und mit etruskischen Lettern rings umhergeschrieben: ›Hic bibitur‹, fanden sie da neun Flaschen in Ordnung stehen, wie man die Kegel in Gasconien zu setzen pflegt, und unter deren mittelster lag ein klein graugrün, artig, schartig, ziemlich schimmelig Büchlein, das stärker denn Rosen, aber nicht besser roch.
In selbigem hat man ermeldten Stammbaum der Läng nach mit Kanzellarschrift geschrieben funden, nicht auf Papier noch Pergament, auch nicht auf Wachs, sondern geschrieben auf Ulmenrinden, wenn schon vor Alter so abgenützt, daß man davon mit Müh drei Ziffern in gleicher Reih gewahren mocht.
Ich nun (wiewohl der Ehr unwürdig) ward dazu hin berufen, wo ich sodann mit guter Brillenhilfe die Kunst des Aristoteles, wie man unscheinbare Lettern liest, ausgeübt und, so wie ihr hie sehen könnt, verdolmetscht hab' zum Frommen aller Pantagruelleser, nämlich der becherschwingenden frohen Leser der schauderhaften Pantagruelstaten.
Zweites Kapitel
Wie Gargantua elf Monden im Mutterleibe getragen ward
Grandgoschier war zu seiner Zeit ein guter Schäker, liebt' sowohl als irgendeiner damals auf Erden, rein auszutrinken, und aß gern Gesalzenes. Zu dem End führt' er für gewöhnlich einen ganzen Schub Mainzer und Bayonner Schinken, Rauch-Zungen die schwere Meng, Würst im Überfluß, wann die Zeit war, und gepökelt Rindfleisch mit Senf. Als er mannbar geworden, nahm er zum Weibe Gargamelle, die Tochter des Königs der Millermahler, ein schönes Frauenzimmer, hübschen Visiers, und machten die beiden öfters zusammen das Tier mit zween Rücken, rieben sich den Speck aneinander lustiglich, bis sie von einem schönen Sohne schwanger ward, und denselben trug bis in den elften Monat.
Denn so lang und länger können die Weiber Leibesfrucht tragen, insonderheit wenn es ein Wunderwerk der Natur ist und eine Person, die ihrer Zeit mannhafte Taten verüben soll.
Die Art und Weis, wie Gargamelle ins Kindbett kam, war folgende: und wo ihr's nicht glaubt, entgehet euch das Fundament. Das Fundament entging ihr eines Nachmittags am dritten Hornung, als sie zu viele Bauntzen gessen. Bauntzen sind feiste Magendärm von Barrenrindern. Barrenrinder sind an der Kripp und auf Zwirentwiesen gemästete Ochsen. Zwirentwiesen sind die, so zweimal im Jahr Gras tragen. Von selbigen feisten Ochsen nun hatten sie 367 014 geschlagen zum Einsalzen auf Fastnacht, daß sie im Frühjahr fein zeitigs Pökelfleisch die Füll erzielten; denn sie wollten gern zur Mahlzeit Anfang auch ihr Wörtlein mit Gesalznem reden, weil der Wein drauf noch einmal so gut schmeckt. Der Kutteln waren viel, wie ihr von selbst einseht, und waren so köstlich, daß jeder darnach die Finger leckt'. Aber der Teufel dabei war nur, daß man sie unmöglich lang verwahren noch sparen konnt'; denn sie wären verfaulet, welches sich nicht gebühren wollt. Ward also beschlossen, mit Stumpf und Stiel sie aufzuessen. Hierzu luden sie alle Leut von Sainnais, Seuillé, Laroche-Clermaud, Vaugaudry, vergaßen auch nicht die von Couldray, Montpensier, von Gué de Vede und andere Nachbarn – alles gute Kunden, gute Zecher, wackere Kegelschieber. Der gute Mann Grandgoschier hatte daran sein herzlich Lust und Freud und ließ es ihnen mit Scheffeln messen, warnet' aber dabei sein Weib, daß sie davon das wenigste äße, weil sie nah auf ihrem Ziel ging und dies Gedärm just keine sehr ratsame Speis war. »Denn«, sprach er, »der muß große Lust zum Dreckkäun tragen, der diese Säck' ißt.« Dieser Ermahnungen doch ungeachtet, aß sie deren doch sechzehn Ohm, zwei Tonnen und sechs Eimer auf. O schöne fäkalische Materie, die ihr den Leib auftreiben sollt'!
Nach dem Mittagsimbiß zogen sie all kopfüber unter das Weidicht hinaus und tanzten da auf dem dichten Gras nach hellen Pfeiflein und süßen Schalmeien so fröhlich, daß es eine himmlische Lust war, sie dergestalt sich tummeln zu sehen.
Drittes Kapitel
Auf welch seltsame Art Gargantua geboren ward
Während sie noch dergestalt sich verlustierten, fing Gargamelle über Leibschmerz zu klagen an; daß Grandgoschier vom Gras aufstund, ihr liebreich zusprach in Meinung, es wären die Kindeswehen, und zu ihr sagt', es wär ihr dort zu frisch gewesen in dem Weidengebüsch und würd gewiß nicht lang mehr währen, so würd sie junge Beine kriegen; müßt also sich auch ein frisch Herze fassen zur frischen Ankunft ihres Püppleins, und wenn ihr der Schmerz auch ein wenig streng däucht', so würd er doch bald ein Ende nehmen, und die drauf folgende Freud ihr all dies Leid vertreiben, also daß sie gar nicht mehr dran denken würd. »Denn«, sprach er, »ich beweis' es euch: unser Heiland im Evangelium Johannis sechzehn, sagt er nicht: ›Ein Weib, wenn es gebärt, so hat sie Traurigkeit; wenn aber sie das Kindlein erst zur Welt geboren, gedenkt sie nicht mehr an die Angst‹?« – »Ei«, sprach sie, »daran sagt ihr recht, und diese evangelische Reden hör' ich weit lieber und tun mir besser, als wenn mir einer ein langes und breits das Leben der heiligen Margret vorsagt und mehr dergleichen Pfaffengewäsch.« – »O du Lamms-Courage!« sprach er, »schafft dies fort, so machen wir bald sein neues.« – »Ha!« sprach sie, »was doch ihr Mannsleut für gut reden habt. Nu, mit Gottes Hilfe will ich mich zwingen, weil's euch lieb ist. Aber ich wollt zu Gott, daß er euch abgehauen wär.« – »Wer? Was?« sprach Grandgoschier. – »Ha«, antwortete sie, »wie blöd ihr tut! Ihr versteht's ja wohl.« – »Mein Hahn?« sprach er, »Potz Zickelblut! Wenn euch dies ansteht, schafft doch gleich ein Messer her!« – »Ach«, sprach sie, »ach bei Leib nit! Gott verzeih mir's, ich meint's nit von Herzen! An meine Reden dürft ihr euch nicht kehren, weder wenig noch viel. Aber heut werd ich wohl mächtig zu schwitzen kriegen, so Gott mir nicht beisteht, und das alls um eures Hähnchens willen, damit's euch wohl wär.«
»Nur Herz gefaßt, nur Herz«, sprach er, »bekümmer dich des weitern nicht, und laß die vier Ochsen da vorn nur ziehen. Ich geh jetzt und trink' noch ein paar Schlückel, werd aber gar nicht weit sein; wo dich indeß ein Weh anstieß', bin ich auf einen Pfiff in die Hand flugs wieder bei dir.«
Bald fing sie zu ächzen, zu lamentieren, zu schreien an. Alsbald erschienen Hebammen haufenweis von allen Enden; die befühlten sie zuunterst und fanden ein Geschling von ziemlich argem Geschmacke, dachten, es wär das Kind: allein es war das Fundament, das ihr entging durch die Erweichung des graden Darmes (welchen ihr den Mastdarm nennt), weil sie zu viele Kutteln gegessen, wie wir zuvor berichtet haben.
Da gab ihr eine alte Vettel aus der Gevatterschaft, die für eine große Ärztin geachtet, ein entsetzliches Stopfmittel, welches ihr alle Karunkeln im Leib dermaßen zusammenschnürt' und räutelt', daß ihr sie mit genauer Not mit den Zähnen hättet erlockern mögen – was schauderhaft zu denken ist: zumal der Teufel doch in der Meß des heiligen Martin, als er das Getratsch der beiden Sibyllen aufschrieb, sein Pergament mit schönen Zähnen gar wohl zu prolongieren wußt.
Durch diesen Unfall öffneten sich die Mutterdrüsen der Gebärmutter oberwärts, durch welche das Kind kopfüber hupft' in die hohle Ader, dann durch das Zwerchfell weiter kroch bis über die Achseln (wo sich gedachte Ader in zwei teilt) und, seine Straß zur linken nehmend, endlich durchs linke Ohr zu Tage kam. Sobald es geboren war, schrie es nicht, wie die andern Kinder, mi mi mi!, sondern mit lauter Stimm: zu trinken! zu trinken! zu trinken!, gleich als ob es die ganze Welt zu trinken ermahnt', so hell auf, daß es die ganze Gegend von Beusse und Bibaroys vernahm. Ich bild' mir ein, ihr werdet an diese verwundersame Nativität nicht steif und fest zu glauben wagen. So ihr's nicht glaubt, ficht's mich nix an: aber ein Biedermann, ein Mann von Verstande, glaubet allzeit das, was man ihm sagt und was er in Schriften findet. Sagt nicht Salomo Sprichwörter am Vierzehnten: ›Der Unschuldige glaubt jedes Wort‹ usw.? Und der heilige Paulus ersten Korinther 13: ›Die Liebe glaubet alles?‹ Warum wollet ihr's also nicht glauben? Weil man es nimmer ersehn hat, sagt ihr. Ich aber sag' euch, daß ihr eben um dieser einen Ursach willen ihm vollen Glauben schenken müßt. Denn die Sorbonnisten nennen den Glauben einen Beweis derer Ding, die man niemals mit Augen siehet.
Läuft's etwa wider unser Gesetz, wider Glauben, Vernunft oder Heilige Schrift? Ich, meines Orts, kann in der Bibel nichts finden, was dawider wär. Und wenn es Gott so gefallen hätt', meint ihr, er hätt's nicht tun können? Ei, ich bitt' euch doch um alles, umnebelkäppelt euch nicht die Köpf mit solchen eiteln Gedanken: ich sag' euch, daß bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und wenn er wollt', so brächten von Stund an die Weiber ihre Kinder also durchs Ohr zur Welt! Kam Bacchus nicht aus dem Schenkel des Jupiter? Fliegenschnäpper aus seiner Ammen Pantoffeln zur Welt? Minerva – entsprang sie nicht durchs Ohr aus Jupiters Hirn? Adonis durch eines Myrrhenbaums Rinden? Kastor und Pollux aus einem Ei, das Leda gelegt und ausgebrütet? Wie aber sollt ihr erst erstarren und staunen, wenn ich euch jetzt gleich das ganze Kapitel des Plinius auslegen wollt', in welchem er von seltsam unnatürlichen Geburten handelt? Gleichwohl bin ich noch lang kein so dreister Lügner als er. Lest nur in seiner Naturgeschichte das dritte Kapitel des siebenten Buchs und quält mir nicht länger die Ohren damit.
Viertes Kapitel
Wie Gargantua benamset ward, und wie er sich zur Tränk hielt
Während der gute Mann Grandgoschiere noch zecht' und mit den andern schwärmet', hört' er das mörderliche Geschrei, welches sein Sohn bei seinem Eintritt in dieses Licht der Welt erhub, als er zu trinken! zu trinken! brüllte, und sprach: »I gar! Kannt du aa schon fein dursten!« Welches als die Gäst vernahmen, sagten sie, daß er um dieserwillen durchaus Gargantua heißen müßt', weil dies das erste Wort seines Vaters bei seiner Geburt gewesen wär, nach Fürgang und in Nachahmung der alten Hebräer. Hierin war derselbe ihnen auch gern zu Willen, gefiel auch seiner Mutter wohl. Und um ihn zufrieden zu stellen, brachten sie ihm zu trinken, was oben hinein wollt': und ward nach frommer Christen Sitt zur Tauf getragen und getauft.
Und wurden 17913 Küh von Pautillé und Brehemond verschrieben, für gewöhnlich ihn zu säugen; denn eine hinlänglich ergiebige Amme zu finden, war im ganzen Land unmöglich, in Betracht der großen Mengen Milch, die zu seiner Nahrung erforderlich waren. Zwar wollen ein Paar Doktoren behaupten, daß seine Mutter ihn gestillt hab' und daß sie 1402 Eimer und neun Maß Milch auf jeden Ruck aus ihren Brüsten hab' melken können. Aber es ist der Wahrheit nicht ähnlich, und ist dieser Satz von der Sorbonne pro scandaloso wehmütigen Ohren ärgerlich und schon von weitem nach Ketzerei ausdrücklich stinkend erkläret worden.
In solcher Weis bracht' er ein Jahr und sechs Monden hin, um welche Zeit man nach dem Rat der Ärzte ihn anfing auszutragen, und ward ein schöner Ochsenwagen gebauet, in selbem kutschierte man ihn fröhlich umher: und war eine Lust, ihn anzusehen, denn er hatt' ein hübsch Göschlein, wohl zehn Kinn am Hals, schrie auch fast wenig; dafür aber bekackt' er sich zu allen Stunden, denn er war eines ungebührlich durchschlägigen Gesäßes, teils aus natürlicher Komplexion, teils durch zufälligen Habitus, den ihm das viele Saugen des September-Traubenmüsleins zuzog. Doch sog er davon keinen Tropfen ohn Ursach; denn wenn sich's traf, daß er verdrüßlich, dickschnutig, bös oder grandig war, wann er schrie, strampelt', heult', und man bracht' ihm zu trinken, gleich kam er auch wieder zu sich und war ganz still und guter Ding. Seiner Wärterinnen eine hat mir's bei ihrem Heiligsten geschworen, er hätt' dies also in der Art, daß er beim bloßen Schall der Kannen und Flaschen schon in Verzückung kam, als ob er die Freuden des Paradieses im voraus schmeckt'; derhalb sie in Betrachtung dieser göttlichen Eigenschaft, um ihn am frühen Morgen aufzuheitern, mit einem Messer an die Gläser klinkten, oder mit Flaschenspunden, oder mit Kannendeckeln klirrten: auf diesen Schall würd er gleich lustig, hüpft' auf und wiegt' sich selber ein, mit dem Kopfe wackelnd, trillert' mit den Fingern und brummte Bariton mit dem Hintern.
Fünftes Kapitel
Wie man Gargantua kleiden tät
Als er in das Alter gekommen, befahl sein Vater, ihm Kleider zu machen nach seinen Farben, weiß und blau. Da ward sogleich Hand angelegt, und wurden gemacht, genäht, geschneidert nach damal kursierender Landesmod. Aus den alten Archiven der Rechnungskammer zu Montsoreau erseh ich, daß er in folgender Art bekleidet war:
Zu seinem Hemd wurden ausgehoben 900 Ellen Leindwand von Chastelleraud, und 200 zu den Zwickelkißlein unter die Achseln. Und ward nicht gefältelt; denn das Fälteln der Hemden ist erst aufkommen, seit die Näherinnen die Spitzen ihrer Nadeln zerbrochen haben und mit dem Öhr zu hantieren begonnen.
Zu seinem Wams wurden ausgehoben 813 Ellen weißer Atlas, und zu den Nestelschnüren 1509 und ein halb Hundshäut, denn damals fing die Welt an, die Hosen an das Wams zu henken, nicht das Wams an die Hosen, denn es läuft dies der Natur zuwider, wie ausführlich dartut Ockam im Kapitel über die Exponibilien des Meisters Beinkleiderios.
Zu seinen Hosen wurden erhoben 1105 und ein drittel Ellen weißen Sammets, und waren geschlitzt in Form geriefter, krenelierter Säulen hinten, damit sie ihm nicht die Nieren erhitzten; die Mützen aber mit blauem Damast innwenig geflitzert so viel als nötig; und ist zu merken, daß er sehr schön beschienbeint war und in der rechten Proportion zu seiner übrigen Leibesstatur.
Zu seinem Hosenlatz wurden erhoben 16 und ein Viertel Ellen des nämlichen Zeuges, und war wie ein Strebebogen gar lustig zwischen zwei schöne güldene Rinken gespannet, in die zwei Heftel von Glockenspeis eingriffen, und in jedem derselben war ein dicker Smaragd von der Größ eines Pomeranzapfels eingefaßt. Denn es hat dieser Stein (wie Orpheus Libro de Lapidibus, und Plinius Libro ultimo lehren) erektivische und stärkende Kraft des natürlichen Gliedes. Des Latzes Schlitz war einen Stab lang, geschlitzt wie die Hosen und mit blauem Damast gepufft wie oben. Hättet ihr aber erst die schöne gestickte Verbrämung gesehen und das artige Goldschmiedwerk dran, besetzt mit feinen Diamanten, feinen Rubinen, feinen Türkisen, feinen Smaragden und persischen Perlen, so würdet ihr ihn einem schönen Horn des Überflusses verglichen haben, wie ihr auf den Antiken seht, und wie sie Rhea den beiden Nymphen Adrastea und Ida, den Ammen Jupiters, verehrt'. Stets prächtig, trächtig, übersäftig, immer grünend, immer blühend, früchtesprühend, voller Blüten, voll aller Frucht und Herrlichkeit. Gott sei mein Zeuge, ob nicht der Latz ein stattliches Aussehn hätt', doch werd' ich euch davon noch ganz andre Ding berichten in dem Buch, das ich von der 'Würdigkeit der Lätze' verfaßt hab'. Eins aber sollt ihr dennoch wissen: daß er, obschon so lang und breit, doch innerlich sehr wohl verproviantieret und beschlagen war, in keinem Stück den heuchlerischen Scheinlätzen einer ganzen Schar von Schleckern ähnlich, in welchen zu großem Leidwesen der Weibsleut gar nichts enthalten ist denn Wind.
Zu seinen Schuhen wurden erhoben 406 Ellen karmesinblauen Sammets. Zur Besohlung derselben nahm man 1100 braune Kuhhaut, geschnitten nach der Stockfischschwänzenart.
Zu seinem Leibrock wurden erhoben 1800 Ellen blauen Sammet, rings mit schönem Laubwerk bordiert und in der Mitten mit silbernen Bechern von Cantille, umgestülpt unter güldenen Sparren mit dichten Perlen, anzuzeigen, daß er ein guter Stürzbecher zu seiner Zeit werden würd.
Sein Gürtel war aus 300 und einer halben Ellen Seidenserge, halb weiß, halb blau, wofern ich nicht sehr irre.
Sein Degen war nicht von Valencia, noch auch sein Dolch von Saragossa, denn sein Vater haßte dies ganze vermauschelte und verkommene Hidalgovolk wie den Teufel, sondern er hatte einen schönen Degen von Holz und einen Dolch von gummiertem Leder, so fein verguldet und gemalt, wie sich's nur einer wünschen mocht.
Sein Säckel war aus dem Hodensack eines Elefanten gefertigt, den ihm Mynheer Prakontal, Statthalter in Lybien, verehret.
Zu seinem Mantel wurden erhoben 9600 weniger zwei Drittel Ellen blauen Sammet, wie oben, ganz mit Gold durchfadelt in diagonalischer Figur: welches nach richtiger Perspektive eine unbekannte Farbe gab, wie ihr an Turtelhaubenhälsen sehet, allen denen die ihn sahen, ein unvergleichlicher Augentrost.
Zu seinem Barettlein wurden erhoben 302 und ein Viertel Ellen weißen Sammet, und war die Form desselben weit und rund nach Umfang des Hauptes. Sein Vater sagte, daß diese heutigen Barettlein auf Marrabesisch, wie ein Pastetensatz gestaltet, noch eines Tages ihren Verstutzten schlimme Händel zuziehn würden. Statt Federbusches trug er eine schöne große blaue Feder von einem Onokrotalus aus dem wilden Hyrkanien, die ihm gar zierlich übers rechte Ohr hing. Zu seiner Medaille führt' er in einer güldenen, 68 Mark schweren Platten eine Figur von gleichem Schmelzwerk, worin ein menschlicher Leib graviert war mit zwei Köpfen, den einen gegen den andern gedreht, vier Armen, vier Beinen und zwei Hintern, wie Plato in Symposio sagt, daß die menschliche Figur in ihrem mystischen Ursprung beschaffen gewesen, und stund darum mit ionischen Lettern geschrieben: ΑΓΑΠΗ ΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΑ ΕΑΥΤΗΣ
Sein gülden Kettlein, das er am Hals trug, wog 25063 Mark Goldes, in Form großer Beeren, mit grünen, rauh geschliffenen Jaspissteinen durchzogen, die wie Drachen graviert und geschnitten waren, sämtlich mit Strahlen und Funken umzirkelt, wie einst der König Necepsos trug, und hing ihm bis zum obern Wulst des Bauchs herunter; davon er dann sein Lebelang den Nutzen spürte, welches den griechischen Ärzten bewußt ist.
Zu seinen Handschuhen wurden verschnitten 16 Koboldsfelle, und zum Vorstoß dran 3 Wehrwolfshäut; und wurden ihm also zugericht nach dem Rat der Kabbalisten zu Saintlouand. Von Ringen (deren ihn sein Vater zu Erneuerung des Zeichens alter Ritterschaft tragen ließ) hatt' er am Zeigefinger der Linken einen Karfunkel von der Größe eines Straußeneies, in feines Seraphsgold zierlich gefaßt. Am Zeigefinger eben dieser Hand hatt' er einen Ring aus den vier Metallen allzumal, auf die wunderbarste Art verfertigt, die man noch je mit Augen gesehen; denn weder verschlang der Stahl das Gold, noch bracht das Silber das Kupfer unter. Alles gemacht durch Hauptmann Chappuys und seinen guten Faktor Alcofribas. Am Zeigefinger der Rechten hatte er einen Ring in spiralischer Form, darein ein vollkommner Balas-Rubin, ein ausgespitzter Diamant und ein Smaragd vom Physon, unschätzbaren Wertes, gefaßt waren. Denn Hans Carvel, Groß-Juwelier des Königs von Melindien, schätzt' sie zusammen auf 69 894 018 lange Wollenhammel. So hoch haben's auch die Fugger von Augsburg geschätzet.
Sechstes Kapitel
Von des Gargantua Jugend
Gargantua ward vom dritten bis zum fünften Jahr in aller gebührlichen Zucht gepflegt und auferzogen nach dem Willen seines Vaters, und bracht' die Zeit zu, wie die kleinen Kinder des Landes pflegen: nämlich mit Trinken, Essen und Schlafen, mit Essen, Schlafen und Trinken, mit Schlafen, Trinken und Essen.
Allzeit wälzte er sich im Kot, vermaskeriert' sich die Nas, bedreckt' sich's Gesicht, trat seine Schuh hinten über, gafft' gern nach den Mucken und lief den Millermahlern fleißig nach, über die sein Vater das Regiment hatte. Er seicht' in seine Schuh, macht' in sein Hemd, schneuzt' sich in Ärmel, rotzt' in die Suppen und patscht' überall durch; trank aus seinem Pantoffel und kraut' sich den Bauch für gewöhnlich an einem Korb. Stochert' sich die Zähn mit einem Holzschuh, wusch seine Hand in Fleischbrüh, strählt' sich mit einem Humpen, setzt' sich ärschlings zwischen zwei Stühl an die Erd, trank unter die Suppen, aß seinen Wecken ohn Brot, biß lachend, lacht' beißend, leckt' vorn, kratzt' hinten, pißt' gegen die Sonnen, versteckt' sich ins Wasser vorm Regen, bespie sich, schoß die Katz fürn Hasen, spannt' die Ochsen hinter den Karren, zog die Würm aus der Nasen, kratzt' sich, wo's ihn nit biß, packt' viel an und hielt wenig fest, verzehrt' sein Weißbrot vorneweg, beschlug die Graspferd, füttert' die Wetzstein, kitzelt' sich selbst zum Lachen, guckt' weidlich in die Töpf, behielt das Korn, gab Gott das Stroh, sang Magnificat zur Metten und meint', es paßt' sich trefflich wohl, aß Kohl, schiß Mangolt, ließ keiner Muck ein Bein am Leib, zerhudelt das Papier, verschmiert' das Pergament, riß aus wie Schafleder, macht' seine Rechnung ohn den Wirt, schlug auf den Busch und fing nicht den Vogel, sah den Himmel für einen Dudelsack und Hagel für Zuckererbsen an, schnitt zwei Pfeifen aus einem Rohr, schlug auf den Sack und meint' den Esel, macht' aus seiner Faust einen Schlägel, fing die Kranich im ersten Sprung, sah dem geschenkten Gaul allzeit ins Maul, setzt' sich vom Pferd auf den Esel, hofft, die Lerchen gebraten zu fangen, wenn der Himmel einfiel, macht' aus der Not eine Tugend, frug weder nach Geschabt noch Geschoren. Alle Morgen bespie er sich. Seines Vaters kleine Hunde aßen mit ihm aus einer Schüssel, er desgleichen wieder mit ihnen, er biß sie in die Ohren, sie zerkrellten ihm die Nas, er blies ihnen in den Hintern, sie leckten ihm das Schnäuzel. Und sollt ihr's glauben? Daß euch der Teufel frikassiere! Dies kleine Hurenjägerlein betastet seine Wärterinnen schon hinten und vornen, oben und unten harri hotto! in einem fort, und fing schon an sein Hosenlätzlein zu exerzieren. Selbiges schmückten seine Wärterinnen alle Tag mit schönen Sträußlein, schönen Bändern, schönen Blumen, schönen Flunkern, schönen Quästlein; und hatten ihre Kurzweil dran, wann er wie ein Rollpflästerlein ihnen unter die Hand geriet. Dann kicherten sie, wann er die Ohren spitzt', gleich als ob ihm das Spiel behagt'.
Siebtes Kapitel
Von des Gargantua Steckenpferden
Hierauf, damit er all sein Lebtag ein guter Reiter wär, macht' man ihm ein schönes großes Pferd von Holz: das ließ er paradieren, tummeln, wenden, sprengen, tänzeln, alles zugleich, im Schritt, im Trott, im Mittelschritt, Galopp, Paß, Hoppas, im Kleppergang, im Kameltrott, Harttrab, Waldeseltritt, und färbt' ihm das Haar um, wie die Mönch ihre Alben nach den Festen in braun, in fuchsrot, apfelgrau, rattenfarb, hirschhaar, rotschimmel, kühfahl, scheckigt, weiß.
Er selbst macht' sich aus einem großen Holzklotz ein Pferd zur Jagd, ein andres aus einem Trottbaum zum täglichen Brauch, und aus einem dicken Eichenstamm ein Maultier samt der Schabrack fürs Zimmer. Außerdem hatt' er ihrer noch zehn bis zwölf zur Umspann und sieben zur Post, und nahm sie auch nachts alle mit zu Bett.
Einmal besucht' der Herr von Qualimsack seinen Vater mit großer Suite und Anhang, auf welchen Tag desgleichen auch der Herzog von Offentisch und der Graf von Nasengüsel schon bei ihm eingesprochen waren.
Mein Treu! Da ging das Logement etwas knapp her für so viel Volk, und sonderlich die Pferdeställ. Der Hofmeister also nebst dem Furier besagten Herrn von Qualimsacks, um zu erforschen, ob es im Haus noch sonst wo ledige Ställ hätt', wandten sich an das junge Männlein Gargantua und fragten ihn heimlich, wo die Ställ für die großen Pferd wären, denn sie dachten, daß Kinder gern alle Ding ausschwatzen und offenbaren. Da führt' er sie die große Schloßtrepp hinan, durch den zweiten Saal auf einen langen Gang, aus dem sie in einen dicken Turm kamen. Wie es nun wiederum andere Stiegen hinauf ging, spricht der Furier zum Hofmeister: »Das Kind narret uns, denn niemals sind doch die Ställ zu oberst im Haus.« – Frug also den Gargantua: »Mein kleiner Schatz, wo führt Ihr uns hin?« »Zum Stall«, sprach er, »wo meine großen Pferd stehen; werden gleich da sein, steigt nur noch die paar Stiegen.« Darauf bracht' er sie wieder durch einen andern großen Saal und führt' sie endlich in seine Kammer, zog die Tür zurück und rief: »Da sind die Ställ, die ihr begehrt, da ist mein Spanier, mein Wallach, mein Schweißfuchs, mein Gasconier.« Und nahm einen schweren Hebebaum, packt' ihn den beiden auf und sprach: »Diesen Friesländer schenk ich euch; hab ihn von Frankfurt, er soll aber euer sein. Ist ein gut Rößlein; so klein es ist, so hart und arbeitsam ist es. Mit einem Habichtmännlein, einem halben Dutzend Bracken und ein paar Windhunden seid ihr Hasen- und Hühnerkönige den ganzen Winter.« »Beim Sankt Johannes!« sprachen sie, »da kommen wir schön an. Diesmal sind wir die Angeschmierten.« – Hie ratet nun, ob sie sich eher vor Scham in die Erd verkriechen oder vor Lachen hätten bersten mögen über den Schnack. Enteilten also spornstreichs wieder hinunter ganz verblüfft und kamen in den untersten Saal zurück, wo die ganze Gesellschaft beisammen war, erzählten da diese neue Mär; da lachten alle wie ein Rudel Fliegen.
Achtes Kapitel
Wie Grandgoschier des Gargantua wunderbaren Verstand an Erfindung eines Arschwisches erkannte
Gegen das End des fünften Jahres, als Grandgoschier von seinem Sieg über die Canarier heim kam, besucht' er seinen Sohn Gargantua. Da ward er erfreut, wie ein solcher Vater, der einen solchen Sohn ansiehet, sich erfreuen durft': halset' und küßt' ihn und fragt ihn allerlei kleine kindische Fragen, trank auch zum Willkomm eins mit ihm und seinen Wärterinnen. Die befragt er unter andern gar besorglich, ob sie ihn auch fein sauber und reinlich gehalten hätten. Wogegen ihm Gargantua zur Antwort gab, er hätt' hierauf sich so beflissen, daß im ganzen Land kein reinerer Knab als er zu finden war. – »Ei wie dann so?« frug Grandgoschier. »Ich hab«, antwortet' Gargantua, »durch lange Praktik und Erfahrung das allerherrlichst, trefflichst und probatste Mittel mir den Arsch zu wischen erfunden, dergleichen man noch je erhöret.« – »Nun; was ist's?« frug Grandgoschier. – »Was ich Euch gleich erzählen werd«, sprach Gargantua.
»Ich wischt' mich einmal mit dem sammetnen Schleier einer Dame und fand's gut, denn die Weichheit der Seide macht' mir am Sitzfleisch eine ziemliche Wollust.
Ein andres Mal mit einer Haube von eben derselben, und war desgleichen.
Ein andres Mal mit einem Brusttuch: wieder ein andermal mit den karmesinatlasnen Ohrhäublein; aber ein läusegüldener Plunder von Perlen und Gebräms daran zerschund mir den ganzen Hintersten. Schlag doch der Blutschiß dem Goldschmied auf den Arschdarm, der's gemacht hat, und dem Weibsstück, das es trug!
Dies Übel verging, als ich mich mit einem Pagenbarett wischt', auf Schweiz'risch mit Federn wohl beblümt.
Hernach, wie ich einmal mein Notdurft hinter einem Busch tat, fand ich da eine Märzkatz und wischt' midi dran. Ihre Krallen aber verschwulsteten mir den ganzen Mastdarm. Ich heilt' mir's am andern Morgen, da ich mich mit meiner Mutter wohlparfümierten Handschuhen wischt'. Darnach wischt' ich mich mit Salbei, mit Fenchel, Majoran, Anis, mit Rosen, Kohl, mit Kürbisblättern, Weinlaub, Eibisch, mit Wollenkraut, mit Lattichblättern, mit Spinat – und tat alles meinem Bein sehr wohl; mit Bingeln, mit Wasserpfeffer, mit Nesseln, mit Rittersporn, aber davon kriegt' ich die Lombardische Blutscheiß. Kuriert' mir's wieder, als ich mich mit meinem Latz wischt'. Darauf wischt' ich mich mit Laken, Decken, Umhäng, mit einem Kissen, mit einem Teppich, mit der grünen Tapete, Schneuztüchel, Salveten, mit einem Puderhemd. Und hat mir alles wohler gedäucht als dem Räudigen, wenn man ihn krauet.« – »Wohl!« sprach Grandgoschier, »aber welcher Arschwisch bedünket dir der beste zu sein?« – »Ich komm' schon drauf«, sprach Gargantua, »gleich sollt ihr das Kurz und Lang davon hören. Ich wischt' mich mit Heu, mit Stroh, mit Werg, mit Haar, mit Woll, mit Papier, allein:
Wer mit Papier sein wüscht Loch fegt, Stets einen Zundel läßt am G'mächt.«
»Ei was!« rief Grandgoschier, »mein kleiner Hodenmatz, ich mein, du hast zu tief in die Kann geguckt, daß du schon reimest?« – »Hui«, antwortet' Gargantua, »ich reim' was Zeug hält, mein Herr König, und reim' mich oft unreimisch drüber.
Merket, diesen Rundreim:
Als ich mich eines Tags laxiert, Beroch ich meine Leibesfracht. Das stank weit mehr, als ich gedacht. Ich war davon ganz parfümiert. O daß mir einer hergeführt Diejenige, nach der ich schmacht. Beim Scheißen.
Denn alsbald hätt' ich ihr pitschiert Ihr Harnloch grob und ungeschlacht, Derweil sie mit den Fingern sacht Mein Loch vom Kote renoviert Beim Scheißen.
Nun sagt hinfort mehr, daß ich nix könn'. Und hab' es doch, beim Exkrement! nicht einmal selbst gemacht. Vielmehr, die Frau Bas dort hat mir's oft vorgesagt, da hab' ich's dann im Ränzel meines Gedächtnis so aufgespart.«
»Aber«, sprach Grandgoschier, »wiederum auf unsere Sach zu kommen –«
»Auf welche?« frug Gargantua, »aufs Kacken?« – »Nein«, sprach Grandgoschier, »auf die Arschwische.« – »Aber wollt ihr«, sprach Gargantua, »auch ein Lägel Bretannierwein zahlen, wenn ich in dieser Materie euch lahmleg?« – »Ei freilich!« antworte Grandgoschier.
»Den Arsch zu wischen«, spricht Gargantua, »tut nicht not, es sei denn Dreck dran. Dreck kann nicht dran sein, wenn man nicht zuvor gekackt hat: gekackt also muß sein, eh man den Arsch kann wischen.« – »Ei, mein klein Bürschlein«, spricht Grandgoschier, »wie bist du g'scheit! Dieser nächsten Tag laß ich dich zum Doktor der lustigen Künste schlagen. Du hast bei Gott mehr Verstand denn Alter.
Nur fahr jetzt fort, ich bitt' dich drum, in dieser arschwischlichen Wissenschaft! Und bei meinem Bart, statt eines Lägels sollst du sechzig Tonnen haben, und zwar von diesem edlen Bretannier, der gar nicht in Bretannien wächst, sondern hieselbst in unserm guten Land Verron.«
»So wischt' ich mich«, sprach Gargantua, »weiter mit einer Nachtmütz, mit einem Pantoffel, mit einem Kopfkissen, mit einem Ränzel, mit einem Spreukorb; aber, oh, des sehr unlieblichen harten Wisches! Darauf mit einem Hut, und hiebei merket, daß von diesen Hüten etlich glatt sind, etlich rauh, etlich sammten, etlich von Atlas. Die besten von allen sind die rauhen, denn sie bewirken eine sehr gute Entfernung der Fäkalmaterie.
Hernach wischt' ich mich mit einem Huhn, mit einem Hahn, mit einem Küken, mit einem Kalbsfell, mit einem Hasen, mit einem Kolkraben, mit einer Taube, mit eines Advokaten Schriftsack, mit einer Mütze, mit einem Federball.