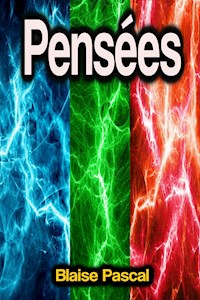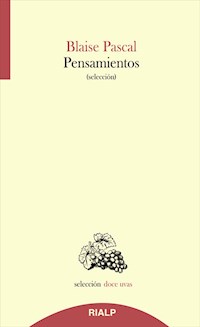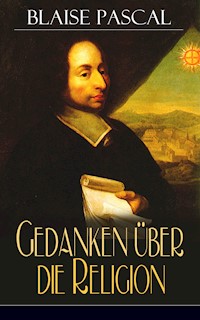Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Universalgenie Blaise Pascal gehört zu den schillerndsten Gestalten der Philosophiegeschichte. Ein religiöser Denker, der kein Theologe ist, ein Mathematiker und Physiker von hohem Rang, ein Anwalt der Vernunft ("Unsere ganze Würde besteht im Denken"). Nach seinem Tod fand man mehr als achthundert Notizzettel. Diese "Gedanken" in aphoristischer Form haben die Geistesgeschichte erschüttert. Pascal erweist sich darin als äußerst scharfsinniger Denker der menschlichen Existenz und beeinflusste damit die Romantik, die Existenzphilosophie sowie die Philosophiegeschichte bis in die Gegenwart. "So verrinnt das ganze Leben: man sucht die Ruhe, indem man einige Schwierigkeiten, die uns hindern, überwinden will; und hat man sie überwunden, dann wird die Ruhe unerträglich." Was Pascal hier beschreibt, ist noch immer für die meisten Zeitgenossen gültig. Kein Autor des 17. Jahrhunderts ist "moderner", nüchterner und zugleich als Mensch uns näher als Pascal. Pascals "Gedanken" liegen hier vollständig in einer völlig neuen Übersetzung vor. Sie korrigiert fehlerhafte Wiedergaben früherer Übersetzungen und beeindruckt durch Präzision und sprachliche Eleganz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BLAISE PASCAL
GEDANKEN –PENSÉES
AUS DEM FRANZÖSISCHENNEU ÜBERSETZT UND HERAUSGEGEBENVON BRUNO KERN
INHALT
Blaise Pascal oder das abgründige Rätsel menschlicher Existenz
Größe und Elend
Tyrannei, Willkür, Recht und Unrecht
Eitelkeit, Vergänglichkeit, Vergeblichkeit
Vernunft, Sinne, Einbildungskraft und Wahrheit
Langeweile und wesentliche Eigenschaften des Menschen
Grund und Ursache der Wirkungen
Widersprüchliches und Zuwiderlaufendes
Teil und Ganzes
Zerstreuung
Tugenden, Laster, Moral
Schönheit, Poesie, Ästhetik
Philosophen
Das höchste Gut
Logik des Herzens, Geist der Geometrie und Geist des Feinsinns
Von der Erkenntnis des Menschen zur Erkenntnis Gottes
Die Wette
Das Mémorial
Der verborgene Gott
An Port-Royal
Apologie des Christentums
Glaube und Vernunft
Gottsuche, Gottesbeweise, Gotteserkenntnis
Bildliche Redeweise der Heiligen Schrift
Über die Erbsünde
Beständigkeit der christlichen Religion
Mose
Jesus Christus
Heilige Schrift, Heilsgeschichte, Kirche, Sakramente
Weissagungen
Christliches Leben und Gnade
Juden und Christen
Wunder
Häretiker
Polemik zwischen Jansenisten und Jesuiten
Vermischtes
Sach- und Personenregister
Verzeichnis der Bibelstellen
»Denn was ist der Mensch schließlich innerhalb der Natur?
Ein Nichts im Vergleich zum Unendlichen,
ein Alles im Vergleich zum Nichts,
eine Mitte zwischen Nichts und Allem […]«
Blaise Pascal
BLAISE PASCAL ODER DAS ABGRÜNDIGE RÄTSEL MENSCHLICHER EXISTENZ
Leben und Wirkung
»Da war einmal ein Mensch, der als Zwölfjähriger mithilfe von Stäben und Ringen die mathematische Wissenschaft begründete; der als Sechzehnjähriger die gelehrteste Abhandlung über die konischen Körper seit der Antike schrieb; der mit neunzehn Jahren eine Wissenschaft, die nur dem Verstande zugänglich war, maschinell erfassbar gemacht hat; der mit dreiundzwanzig die Phänomene des Luftgewichts aufzeigte und damit einen der großen Irrtümer der älteren Naturwissenschaft zerstörte; der in einem Alter, in dem die anderen Menschen kaum damit begonnen haben zu erwachen, bereits den ganzen Umkreis des menschlichen Wissens umschritten hatte, als er auch schon dessen Nichtigkeit erkannte und sich der Religion zuwandte. […] Dieses erschreckende Genie hieß Blaise Pascal.« (Chateaubriand, zitiert nach Schäfer 1981, 324)
Pascal, der große Zeitgenosse des René Descartes, war möglicherweise tatsächlich das letzte Universalgenie der Menschheit. Staunend steht man vor der umfassenden Leistung dieses Lebens, das doch nur 39 Jahre währte. Die Widersprüchlichkeit und Ungesichertheit der menschlichen Existenz, die Pascal selbst so scharfsinnig analysierte, wird nicht nur in seiner eigenen Biografie deutlich, sie spiegelt sich nicht zuletzt in der Wirkungsgeschichte, die sein Werk auslöste. Während die Vertreter der Romantik ihn vereinnahmten, geißelten ihn Voltaire und andere »Aufklärichte« (E. Bloch) als Feind des Fortschritts der Menschheit. Für so unterschiedliche Denker und Schriftsteller wie Nietzsche, Baudelaire, Péguy oder Kierkegaard wird er zur einzigartigen Inspirationsquelle. Den Existenzialismus des 20. Jahrhunderts hat er in vielfacher Weise vorweggenommen. Vor allem auf dem Gebiet der Mathematik und der Physik hat er bahnbrechende Leistungen vollbracht. Er legte die Grundlagen für die Infinitesimalrechung und die Wahrscheinlichkeitsrechnung, konstruierte die erste Rechenmaschine, widerlege innerhalb der Physik die alte Vorstellung des horror vacui experimentell und wies die Möglichkeit des leeren Raums nach etc. Und dennoch verdankt er seinen bis heute anhaltenden Ruhm einem Haufen von Notizzetteln, die man nach seinem Tod auffand, zusammentrug und in eine provisorische Ordnung brachte: den Pensées (»Gedanken«). Der Großteil dieser mehr als achthundert Fragmente setzt sich aus Gedankenskizzen für das geplante große Opus einer Apologie des Christentums zusammen.
Blaise Pascal wurde am 19. Juni 1623 in Clermont, der Hauptstadt der Auvergne, geboren. Sein Vater, Etienne Pascal, war selbst ein Mathematiker von Rang und stand als Steuerbeamter im Dienst der französischen Krone. Drei Jahre nach Blaise Pascals Geburt starb die Mutter und hinterließ drei Kinder: neben Blaise dessen beide Schwestern Gilberte und Jacqueline. Nach dem Tod seiner Frau gab Etienne Pascal sein Amt auf und siedelte mit den Kindern nach Paris über, wo er sich ungeteilt deren Erziehung widmen wollte. Die Wahl des Wohnortes hing vermutlich mit Etienne Pascals eigenen wissenschaftlichen Interessen zusammen: In ganz Europa bildeten sich im 17. Jahrhundert die sogenannten »Akademien«, d. h. regelmäßige Zusammenkünfte, bei denen führende Gelehrte der unterschiedlichen Wissensgebiete ihre Forschungsergebnisse vorstellten und sie der Prüfung durch die anderen anheimstellten. Bekannt sind vor allem die Accademia dei Lincei in Rom, der auch Galilei angehörte, die Accademia del Cimento in Florenz und natürlich die Londoner Royal Society. In Paris war es die Zelle eines Minoritenmönches, des Paters Marin Mersenne, die zum Zentrum lebendigen Austauschs führender Gelehrter wurde. Neben Etienne und später Blaise Pascal selbst trafen sich dort unter anderem Thomas Hobbes und René Descartes. Marin Mersenne trat in eigener Person durch keine Forschungen hervor, zeichnete sich aber durch ein umfassendes enzyklopädisches Wissen aus und scheint vor allem ein außerordentliches Talent gehabt zu haben, die richtigen Fragen zu formulieren. So wurde er zum Anreger und Korrespondenten großer Geister des französischen »Goldenen Zeitalters«. (vgl. dazu Clévenot 1989, 68–75).
Der junge Blaise Pascal hat nie eine Schule besucht. Sein Vater übernahm persönlich den Unterricht des Heranwachsenden und orientierte sich dabei an den Vorstellungen des Humanisten und Freidenkers Michel de Montaigne. Das leitende Prinzip war dabei, die Lerngegenstände der psychologischen Entwicklung des Kindes anzupassen und es keinesfalls zu überfordern. So ergaben sich die Bildungsinhalte zunächst ganz selbstverständlich aus den Alltagsereignissen, zu deren Reflexion der Knabe ermuntert wurde. Bezeichnend dafür ist eine Begebenheit, die Gilberte Pascal in der Lebensbeschreibung ihres Bruders wiedergibt: »Der Knabe entdeckte, dass ein Steingutteller, an den man ein Messer schlug, einen Klang erzeugte, der abbrach, sobald man den Teller mit der Hand berührte. Auf diese Weise wurde der Elfjährige zum Nachdenken über die Gesetze der Akustik angeregt.« (Gilberte Pascal 1991, 105)
Etienne Pascal hatte zunächst vorgesehen, dem Knaben die Grundlagen der Grammatik allgemein beizubringen, damit er sich darauf die Sprachen Latein, Altgriechisch und Italienisch aneigne. Um ihn von diesen Gegenständen nicht abzulenken, achtete er penibel darauf, ihn vor allem von der Mathematik fernzuhalten, die erst für das Alter von sechzehn Jahren vorgesehen war. Den Knaben Blaise Pascal scheint dies jedoch umso mehr zur Beschäftigung mit der Mathematik angestachelt zu haben: Gilberte Pascal berichtet:
»Eines Tages kam mein Vater dorthin, wo er [Blaise] sich aufhielt, ohne dass mein Bruder ihn hörte. Er war so sehr vertieft, dass es lange dauerte, bis er das Kommen des Vaters bemerkte. Man kann nicht sagen, wer von beiden mehr überrascht war: der Sohn, der den Vater erblickte, wegen dessen ausdrücklichen Verbots [sich mit der Mathematik zu beschäftigen], oder der Vater, der seinen Sohn inmitten all dieser Dinge [mit Kreide gezeichneter geometrischer Figuren] sah. Doch die Überraschung aufseiten des Vaters war wohl größer: Als er den Sohn fragte, was er hier mache, sagte er ihm, er suche nach der und der Sache1: Es handelte sich um den 32. Lehrsatz des ersten Buches des Euklid.« (Gilberte Pascal 1991, 106–107)
Der noch nicht Zwölfjährige hatte sich also selbstständig einen Teil der Grundlagen der Mathematik erarbeitet. Seit dieser Zeit nahm der Vater Blaise Pascal zu den Zusammenkünften bei Marin Mersenne mit. Im Alter von sechzehn Jahren begründete Pascal seinen Ruf als Mathematiker mit seiner Abhandlung über die Kegelschnitte.
Die äußeren Lebensumstände änderten sich abrupt, als Etienne Pascal bei Kardinal Richelieu in Ungnade fiel. Um der Gefängnishaft zu entgehen, floh er zunächst mit seinen Kindern in die Auvergne. Der jüngeren Tochter Jacqueline – einer begabten Poetin und Schauspielerin – gelang es jedoch, den Kardinal wieder günstig zu stimmen. Etienne Pascal übernahm daraufhin die Aufgabe, in Rouen in der Normandie das Steuerwesen neu zu organisieren. Um dem Vater die beschwerliche Aufgabe zu erleichtern, konstruierte Blaise Pascal seine Rechenmaschine. Das erste Mal wurde die geistige Arbeit des Rechnens von einem ausgeklügelten Mechanismus übernommen – letztlich das Urbild unseres Computers.
Noch entscheidender für Pascals Werdegang war aber, dass die Familie in Rouen in Kontakt mit der religiösen Strömung des Jansenismus kam. Auslöser war ein Unfall von Etienne Pascal, bei dem er sich ein Hüftgelenk auskugelte. Die Brüder Deschamps, die ihm mit ihren chirurgischen Kenntnissen in dieser Situation beistanden, machten die Familie mit den Werken der führenden Jansenisten vertraut: Saint-Cyran, Arnauld und Jansenius selbst. Diese religiöse Strömung orientierte sich an der Gnadenlehre des Augustinus, an der absoluten Souveränität von Gottes Gnadenwahl. Vor allem bei Blaise Pascal führte die Begegnung mit dieser Art gelebten Christentums zu dem, was spätere Autobiografen seine »erste Bekehrung« nannten. Blaise Pascal hatte durchaus auch eine an der Bibel und den Kirchenvätern orientierte religiöse Erziehung genossen, und die Familie pflegte den konventionellen Katholizismus ihrer Zeit. Nun aber ging es, um mit Gilberte Pascal zu sprechen, darum, »dass die christliche Religion uns verpflichtet, allein für Gott zu leben« (Sellier 1991, 9–10), um eine kompromisslose Religiosität also, die das gesamte Leben in Beschlag nimmt. Blaise Pascal beschäftigte sich von nun an intensiv mit den religiösen Auseinandersetzungen der Zeit, vor allem zwischen den Jansenisten und ihren Gegnern, den Molinisten, die hauptsächlich Jesuiten waren. Letztere hielten an der heilsrelevanten Rolle des freien Willens des Menschen fest. Er las das Hauptwerk des Jansenismus, den berühmten Augustinus des Jansenius, und die Werke des Augustinus selbst.
Allerdings bedeutete diese Hinkehr zur intensiven Beschäftigung mit religiösen Fragen keineswegs – wie manche Gegner behaupteten – eine Abkehr von den Wissenschaften! Zusammen mit seinem Schwager Florin Périer griff er die Experimente des Italieners Toricelli auf, erweiterte und vertiefte sie und erbrachte so den experimentellen Nachweis, dass Effekte, die man bisher auf den postulierten horror vacui, den natürlichen Abscheu vor der Leere, zurückführte, mittels des Gewichts der Luft zu erklären waren. Mit seiner Lehre vom Vakuum begab er sich in direkte Gegnerschaft zu René Descartes. Auch auf dem Gebiet der Mathematik setzt er seine Forschungen fort und entwickelt etwa die Idee der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Seit 1647 hatte sich Pascal zusammen mit seiner Schwester Jacqueline wieder in Paris niedergelassen. In dieser Zeit verschlechtert sich sein Gesundheitszustand immer mehr. Tatsächlich hatte er seiner Schwester Jacqueline bekannt, bereits seit dem achtzehnten Lebensjahr keinen Tag ohne Schmerzen zugebracht zu haben. Über die Art seiner Erkrankung wird von den verschiedenen Biografen aufgrund der wenigen Anhaltspunkte zu seinen Schmerzen (Unterleibsschmerzen, Lähmungserscheinungen, dazu heftige Kopfschmerzen) spekuliert. Die meisten gehen von einer schweren Erkrankung des Intestinaltraktes, etwa von Darm- und Magenkrebs, bzw. -tuberkulose aus. Im Krankenzimmer fand dann auch die Begegnung zwischen den beiden großen Geistern der Zeit, Pascal und René Descartes, statt, bei der es wohl hauptsächlich um das Problem des Vakuums und die von Descartes angenommene feinstoffliche Materie ging.
Die Jahre 1647 bis 1654 werden oftmals als Pascals »weltliche Periode« bezeichnet. Er verkehrt in den vornehmen Salons, in Adelskreisen und pflegt den Kontakt zu führenden Freigeistern seiner Zeit wie etwa Damien Mitton. Doch bald schon wuchs in ihm das Empfinden der Eitelkeit und Flüchtigkeit dieser weltlichen Existenz. Die Kontakte zum Pariser Kloster Port Royal, in das seine Schwester Jacqueline bald eintrat und das um sich eine Laiengemeinschaft im jansenistischen Geist versammelte, intensivieren sich. Aus dieser Zeit stammen auch Briefe Pascals an seine Schwester Gilberte, in denen er sich in ausgesprochen dichter Weise zu theologischen Themen äußert. Der Eintritt von Pascals Schwester Jacqueline ins Kloster Port Royal scheint zunächst eine tiefe Krise ausgelöst zu haben. Schließlich fällt in das Jahr 1954 auch das Ereignis, das gern als die »zweite Bekehrung« Pascals bezeichnet wird und das er selbst in seinem berühmten Mémorial festhält (S. 152 f.). Unter Angabe von genauem Datum samt Uhrzeit beschreibt Pascal hier das überwältigende innere Erleben, das in einem Bekenntnis zum biblisch bezeugten »Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zum Gott Jesu Christi« im Gegensatz zum (deistisch gedachten) Gott der Philosophen mündet. Bis zu seinem Tod bewahrt er die Niederschrift dieser Gotteserfahrung eingenäht in seinen Rock bei sich auf.
Die Jahre darauf sind vor allem von Pascals engagiertem Eingreifen in die Auseinandersetzung um den Jansenismus geprägt. Unter einem Pseudonym (Louis de Montalte) verfasst er in scharfem polemischem Stil die vielbeachteten Lettres à un provincial, mit denen er diese wohl wichtigste religiöse Kontroverse seiner Zeit wesentlich mitprägt. Über die damalige theologische Auseinandersetzung hinaus gelten die Provinzialbriefe oder Briefe an einen aus der Provinz aufgrund ihres eleganten Stils vielen als die Geburtsstunde des modernen Französisch.
Für Pascals intensive Beschäftigung mit religiösen Fragen war ein außergewöhnliches Ereignis, nämlich die als »Wunder« interpretierte Spontanheilung seiner Nichte (zugleich sein Patenkind), von nicht unerheblicher Bedeutung: Die junge Marguerite Périer litt an einer ständig nässenden Fistel am Auge, die ausgebrannt werden sollte. Nach der Berührung einer Reliquie (eines Dornes der angeblichen Dornenkrone Jesu) kam es zu einer aufsehenerregenden Spontanheilung, die Pascal auch für sich selbst als providenziell empfand. Die in den Pensées enthaltenen Reflexionen über das Wunder (s. S. 372, 380) haben dieses Ereignis zum äußeren Anlass.
Die letzten Lebensjahre Pascals – von 1658 bis 1662 – sind trotz erheblicher krankheitsbedingter Einschränkungen in vieler Hinsicht von erstaunlicher Schaffenskraft auf allen Gebieten geprägt. Er widmet sich weiter der Kampagne gegen den moralischen Laxismus der Jesuiten, mathematisch beschäftigt er sich mit dem Problem der Zykloide (d. h. der Kurve, die ein an der Peripherie eines sich vorwärtsbewegenden Rades befestigter Nagel beschreibt) und zusammen mit dem Herzog von Roannez schafft er das erste (Pferde-)Omnibussystem für Paris und damit das erste öffentliche Nahverkehrssystem überhaupt. Letzter Unternehmung war trotz oder gerade wegen aller Fortschrittlichkeit jedoch kein kommerzieller Erfolg beschieden.
Pascal lebt in dieser Zeit in äußerster Bescheidenheit und legt eine außerordentliche Fürsorge für die Armen an den Tag, denen er auch seine Einkünfte widmet. In diese letzten Lebensjahre fällt auch die gedankliche Vorbereitung auf sein großes geplantes Werk, einer Apologie der christlichen Religion, das er nicht vollenden sollte. Die mehr als achthundert Textfragmente, die man nach seinem Tod finden und aus denen dann ein Werk von weltliterarischem Rang werden sollte, die Pensées, kann man zu einem großen Teil den Vorarbeiten zu dieser geplanten Apologie zuordnen.
Es ist erstaunlich: Blaise Pascal, der auf den Gebieten der Mathematik, der Physik, der Ingenieurskunst etc. so Grundlegendes geleistet hat, ist uns heute aufgrund seiner posthum aufgefundenen Notizen vor allem als religiöser Denker, als Denker gläubiger Existenz, bekannt. Die meisten dieser mehr als achthundert Notizzettel sind – wie gesagt – kleine Gedächtnisstützen für eine geplante großangelegte Apologie des Christentums. Die denkerische Rechenschaft über den christlichen Glauben ist hier allerdings ganz anderer Art als etwa die der Scholastik. Für Pascal ist die Existenz des Menschen selbst als eines endlichen und der Selbstreflexion fähigen Wesens zum zentralen Problem geworden. Wenn überhaupt, dann erschließt sich der spezifische Sinngehalt des Glaubens aus dem Dasein des Menschen und seinen Aporien, die in seiner Endlichkeit, im Scheitern seiner Freiheit, in Schuld und in der Tatsache zum Ausdruck kommen, dass er sich – im Gegensatz zum natürlichen Seienden – selbst aufgegeben ist. In Pascal erleben wir den Durchbruch der Moderne auch im Selbstverständnis von Religion und Glaube. Erst eine radikal genug gedachte Anthropologie führt an jene Grenze, an der der Sinn göttlicher Freiheit, göttlicher Selbstmitteilung aufleuchten kann. Darin liegt die Aktualität von Pascals religiösem Denken bis heute begründet.
Der Jansenismus – vielschichtiges Phänomen und Kampfbegriff
Vorweg sei gesagt, dass das auch in seinem religiösen Denken sehr eigenständige Profil Pascals den Jansenismus weit überragt und in keinem Fall darauf reduziert werden kann. Dennoch bestimmt diese seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in Frankreich so bedeutsame Strömung Pascals Auseinandersetzung mit dem Glauben nach innen wie nach außen entscheidend. Der Namensgeber dieser Glaubensrichtung ist der Löwener Theologe Cornelius Jansenius (1585–1638), der mit seinem monumentalen, drei Bände umfassenden Werk Augustinus die innerkatholische Auseinandersetzung um die Gnadenlehre wesentlich bestimmen sollte. Das Verhältnis von menschlicher Freiheit einerseits und der Souveränität von Gottes Gnadenhandeln andererseits gehört wohl zu den grundlegenden Fragen christlicher Theologie, um die stets aufs Neue gerungen wird – bündeln sich doch darin die zentralen Fragen um das Verständnis des Menschen, um das Gottesbild, um Handeln und Vorsehung Gottes. Im 5. Jahrhundert war es die überragende Gestalt des Augustinus von Hippo, die in Auseinandersetzung mit den »Pelagianern« diese Frage zugunsten einer sehr einseitigen Betonung der »Prädestination«, also der Vorherbestimmung zum Heil ohne das Zutun des Menschen, löste. Die pessimistische Auffassung des Augustinus vom Menschen, dessen Wille durch die Erbsünde von sich aus zum Guten nicht fähig sei, wurde in der mittelalterlichen Scholastik vor allem vom »anthropozentrischen Denken« des Thomas von Aquin korrigiert. Ihm zufolge hebt die Gnade die menschliche Natur nicht auf, sondern setzt sie gerade voraus und vollendet sie!2 Die Reformation knüpfte allerdings wieder an Augustinus an und erfuhr in Johannes Calvin die radikalste Zuspitzung in dieser Frage. Nach den blutigen Konfessionskriegen hatte sich in Frankreich die katholische Mehrheit durchgesetzt. Von der Reformation aufgeworfene grundlegende, nicht zu unterdrückende theologische Fragen tauchten nach der Marginalisierung der protestantischen Minderheit im innerkatholischen Raum wieder auf. Dem in Reaktion auf die Reformation durchgeführten Konzil von Trient war es letztlich nicht gelungen, mit seinen Formelkompromissen den Streit in befriedigender Weise beizulegen. Im Gegenteil: Stärker denn je brachen die Gegensätze hervor. Besonders der noch junge, aber bereits starke und einflussreiche Jesuitenorden profilierte sich hier.
Der spanische Jesuitentheologe Luis de Molina (von daher die Bezeichnung der Gegner der Jansenisten als »Molinisten«) bestimmte mit seinem Werk Über die Vereinbarkeit der menschlichen Willensfreiheit mit den göttlichen Gnadengaben das theologische Niveau der Debatte. Es ging ihm – ganz im Sinne des Renaissance-Humanismus – um den Schutz der Autonomie des menschlichen Willens und dessen Heilsrelevanz. Wie aber kann man dann gleichzeitig das souveräne Handeln Gottes und die Ungeschuldetheit der Gnade behaupten? Gott sehe – so Molina – das Freiheitshandeln des Menschen voraus und bestimme es aufgrund dieses Vorauswissens zum Heil. Gerade innerhalb der Löwener Fakultät, an der auch Jansenius wirkte, lösten Molinas Positionen heftige Auseinandersetzungen aus. Jacob Jansonius etwa vertrat im Gegensatz zu Molina die Auffassung, dass Gottes Gnade unabdingbar für jede gute Handlung des Menschen sei. Sie übe zwar keinen direkten Zwang aus, versetze aber seinen freien Willen in eine Situation, in der er dem Heilshandeln Gottes nicht widerstehen könne. Wirkmächtig wurde aber vor allem der Augustinus des Jansenius selbst, der damit den Anspruch erhob, die Gnadenlehre des Augustinus von Hippo in systematisch stringenter Gestalt vorzulegen.3 Sein zentraler Gedanke dabei ist die »Unwiderstehlichkeit« der göttlichen Gnade, der der Mensch erliegen muss.
Allerdings sollte man sich davor hüten, die Bewegung des Jansenismus auf diese recht subtilen innertheologischen Streitigkeiten zu reduzieren. Die jansenistische Bewegung ist vielmehr als eine innerkatholische Erneuerungsbewegung in Frankreich zu betrachten, der es um eine verinnerlichte, »mystische« Frömmigkeitspraxis und eine strenge asketische Lebensführung ging. Bezeichnend war auch ein biblischer Supranaturalismus. Die Gegnerschaft zu den Jesuiten gründete sich denn auch viel stärker auf deren angeblich laxistische Moralauffassung und auf den Vorwurf, sie würden das Christentum letztlich in das Allgemein-Vernünftige aufgehen lassen. Treffend und konzise beschreibt Michel Clévenot den Jansenismus:
»Es handelte sich nicht so sehr um eine Partei oder eine Doktrin, sondern vielmehr um eine Haltung, um eine bestimmte geistige Einstellung. Pessimistisch im Hinblick auf die menschliche Natur, verängstigt aus Furcht vor der Sünde und der Verdammnis, gegenüber dem römischen Zentralismus und dem französischen Absolutismus feindlich gesinnt.« (Clévenot, 82)
Die Auseinandersetzung um den Jansenismus geriet sehr bald ins Räderwerk unterschiedlicher politischer Interessen. Nach den blutigen Konfessionskriegen kam es der französischen Krone ganz und gar nicht gelegen, einen neuerlichen Religionsstreit aufflammen zu sehen. Zentrale Thesen aus dem Augustinus des Jansenius wurden schließlich von Rom verurteilt. Die Bezeichnung »Jansenismus« wurde aufgrund dieser politischen Verflechtungen alsbald zum Kampfbegriff, der nichts weiter als eine Gegnerschaft zur französischen Krone, zum Papst oder zum Jesuitenorden zum Ausdruck brachte und herzlich wenig mit den ursprünglichen theologischen und spirituellen Intentionen zu tun hatte.
Pascals Weg im Spannungsverhältnis zu Port-Royal
Das Zisterzienserinnenkloster Port-Royal in Paris entwickelte sich bald zum Zentrum jansenistischer Frömmigkeit, mit einer enormen Ausstrahlung auf die gehobenen Gesellschaftsschichten. Zu verdanken ist dies in erster Linie einem engen Freund und Weggefährten des Jansenius, Duvergier de Hauranne, Abt von Saint-Cyran (und deshalb auch Saint-Cyran genannt), der seit 1635 als Seelsorger des Frauenklosters wirkte. Ihm ging es in erster Linie um eine erneuerte Frömmigkeit, die sich an der Zeit der Kirchenväter, vor allem an Augustinus, orientieren sollte. Saint-Cyran war der geistliche Berater der »parti dévot«. Er propagierte eine Erneuerung des christlichen Lebens durch einen zeitweiligen Rückzug aus der Welt, durch Einkehr und ein intensives Gebetsleben. Die »liberale« jesuitische Spiritualität war ihm suspekt. Das Wesen seiner Spiritualität kommt sehr schön in seinen geistlichen Anweisungen für die Ordensschwestern zum Ausdruck:
»Die Seelen, die Gott angehören, dürfen weder Sicherheit noch Vorsorge genießen; sie müssen im Glauben handeln, der im Streben nach guten Werken weder Gewissheit noch Sicherheit kennt; sie schauen auf Gott und folgen ihm in jedem Augenblick, in Abhängigkeit von den Begegnungen, die seine Vorsehung herbeiführt. […] Eine christliche Seele bedarf einer unvergleichlichen und allgemeinen Flexibilität. Sie muss es verstehen, von der Ruhe zur Arbeit, von der Arbeit zur Ruhe, vom Gebet zum Tun, vom Tun zum Gebet überzugehen. Nichts soll sie [eigennützig] lieben, an nichts sich festhalten, sie soll sich darin verstehen, alles zu tun und auch nichts zu tun, wenn ihr die Krankheit oder der Gehorsam Einhalt gebietet, und dabei soll sie nutzlos in Frieden und Freude verharren […].« (Clévenot 1989, 80)
Port-Royal war aber vor allem von einer Familie geprägt, der Familie Arnauld. Mit elf Jahren bereits wurde Angélique Arnauld zur Äbtissin des Klosters gemacht! Nachdem sie sich, zunächst widerstrebend, mit ihrem Schicksal arrangiert hatte, lösten die Fastenpredigten eines Kapuziners eine tiefgreifende innere Umkehr bei ihr aus. Tatkräftig nahm sie die Reform des Klosters in Angriff, das sich bald von einer komfortablen Versorgungsstätte von Damen aus bestem Haus zu einem Zentrum beispielhaften monastischen Lebens entwickelte. Unter den vielen Angehörigen, die in der Folge Port-Royal prägen sollten, ragt ihr Bruder Antoine hervor, genannt der »Große Arnauld«, der im Streit um den Jansenismus zum theologischen Hauptprotagonisten werden sollte. Ein Neffe der Äbtissin, Antoine Le Maître, gab als junger Mann seine vielversprechende Karriere als Rechtsanwalt auf, um in einem eigenen Haus bei Port-Royal ein zurückgezogenes Leben zu führen. Es war der Beginn der berühmten Gruppe der »Messieurs de Port-Royal«, die sich aus meist hochgebildeten Männern vornehmster Familien zusammensetzte. Die enorme Ausstrahlungskraft Port-Royals auf die gehobene Gesellschaftsschicht rief sogar Kardinal Richelieu auf den Plan und trug Saint-Cyran, nachdem der Versuch gescheitert war, ihn »wegzuloben«, Gefängnishaft ein.
Dieses spirituelle Zentrum sollte sich für Pascals weiteren Weg als schicksalshaft erweisen. Nachdem die Familie wieder nach Paris zurückgekehrt war, ist es zunächst die begabte Schauspielerin und Schriftstellerin Jacqueline Pascal, die den heftigen Wunsch äußert, in Port-Royal einzutreten. Ihr Vater hatte in diesen Plan aber nur eingewilligt, wenn sie bereit wäre, bis zu seinem Tod zu warten. Im Jahr 1651 starb schließlich Etienne Pascal, und für Jacqueline schien der Weg frei. Überraschenderweise war es aber nun Blaise Pascal selbst, der sich heftig widersetzte: zum einen, weil der inzwischen Kranke wohl auf ihre Unterstützung angewiesen ist, zum anderen – und das überrascht angesichts der Haltung, die Blaise Pascal später an den Tag legen wird – aus finanziellen Gründen. Blaise Pascal war nicht bereit, die für die Aufnahme ins Kloster nötige Mitgift bereitzustellen und damit den Zugriff auf ein Vermögen zu verlieren, das er zur Realisierung seiner eigenen Pläne brauchte. Bewegend schildert Gilberte in der Lebensbeschreibung ihrer Schwester, wie diese, ohne den Bruder vorher informiert zu haben, das Haus verlässt und nach Port-Royal aufbricht, wo sie zunächst ohne Mitgift aufgenommen wird (vgl. Clévenot 1989, 88–90).
Blaise Pascal durchlebte zunächst eine Periode, in der die Möglichkeiten seiner wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Karriere im Mittelpunkt standen. Intensiv widmete er sich Problemen der Physik sowie der reinen Mathematik, und er schien auch Heiratspläne gefasst zu haben. Bestimmend war für ihn in dieser Zeit die Freundschaft mit dem Herzog von Rouannez, zu dessen lebendigen geistigen Interessen auch die Beschäftigung mit religiösen Fragen gehörte. Doch bald schon wurde Blaise Pascal von einer tiefen inneren Krise erfasst. Immer stärker litt er an den Oberflächlichkeiten eines weltlichen Lebens, ja er entwickelte eine regelrechte Abneigung gegen die Zerstreuungen und Konventionen der gesellschaftlichen Kreise, in denen er sich bewegte.
Dann kam es zur alles entscheidenden Wende, die Pascal akribisch mit Datum und Uhrzeit festielt: Nach seinem Tod fand man durch Zufall eingenäht in seinen Rock zwei Pergamentstücke, die beide den gleichen Text enthielten: einmal flüchtig und in Eile niedergeschrieben, dann noch einmal in sauberer Reinschrift. Pascal hatte dieses »Mémorial« seit diesem Zeitpunkt stets bei sich getragen. Es bezeugt ein überwältigendes inneres Erleben, den entscheidenden Durchbruch einer religiösen Erkenntnis, die von nun an sein weiteres Leben bestimmen würde: In den Nachtstunden des 23. November 1654 bekennt er sich hier unter starken Emotionen zum »Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs«, zum »Gott Jesu Christi«, zum Gott der biblischen Offenbarung also, den er im Gegensatz zum »Gott der Philosophen« begreift. Auf dieses entscheidende innere Erleben Pascals wird noch zurückzukommen sein. Das Bekenntnis zum Gott der geschichtlichen Offenbarung löste offenbar in ihm die Spannung der vergangenen Jahre. Verbunden ist es für Pascal mit einer konkreten Konsequenz: der Unterwerfung unter die Autorität einer geistlichen Leitung (im »Mémorial« angedeutet mit den Worten »soumission douce et total«, d. h. »sanfte und vollständige Unterwerfung«). Pascal wandte sich Port-Royal endgültig zu.
Inzwischen spitzte sich die innerkirchliche Auseinandersetzung um den Jansenismus immer stärker zu. Bereits im Jahr 1653 hatte Papst Innozenz X. aufgrund einer entsprechenden Intervention der theologischen Fakultät der Pariser Sorbonne fünf Thesen aus dem Augustinus des Jansenius verurteilt. Die Verteidigung der Jansenisten bestritt nicht den häretischen Charakter dieser Thesen, wohl aber die Tatsache, dass sie im Augustinus enthalten seien. In einem Dekret aus dem Jahr 1656 bekräftigte allerdings Papst Alexander VII., dass die beanstandeten Thesen dem Werk des Jansenius entnommen seien.
Blaise Pascal wurde bald zur intellektuellen Speerspitze der Jansenisten in diesem Streit. Unter einem Pseudonym veröffentlichte er seine Lettres à un provinciale, insgesamt 18 Schriften, die vor allem eine scharfe Polemik gegenüber den Jesuiten enthalten. Hier zwei kleine Kostproben seiner ebenso geschliffenen wie kompromisslosen Polemik:
»Wahrhaftig, Patres, es gibt sehr wohl einen Unterschied zwischen dem Verspotten der Religion und dem Verspotten derer, die dieselbe durch ihre absonderlichen Auffassungen entweihen. Es wäre ein Frevel, wenn es einem am Respekt vor den Wahrheiten mangelte, die Gottes Geist geoffenbart hat; doch es wäre darüber hinaus ein weiterer Frevel, wenn es einem an Verachtung der Irrtümer mangelte, die der Geist des Menschen ihnen entgegenhält […] Ein seltsamer Eifer ist das, der sich gegen jene entzündet, welche die öffentlichen Fehler anklagen, und nicht gegen jene, die sie begehen!« (Clévenot 1989, 82)
»Denn, Patres, wofür wollt ihr schließlich gehalten werden? Für Kinder des Evangeliums oder für Feinde des Evangeliums? Man kann nur dieser oder jener Seite angehören, es gibt hier keine mittlere Position. Wer nicht für Jesus ist, der ist gegen ihn […]. Seht also zu, Patres, welchem der beiden Reiche ihr angehört. Ihr habt sehr wohl die Sprache der Stadt des Friedens, welche das mystische Jerusalem genannt wird, und ihr habt ebenso die Sprache der Stadt des Aufruhrs, welche die Schrift das geistliche Sodom nennt. Welche dieser beiden Sprachen versteht ihr? Welche sprecht ihr?« (Sellier 1991, 66)
Die öffentliche Resonanz auf diese Briefe war enorm. Erst die letzten beiden Briefe wandten sich jenseits der Polemik dem theologischen Kernproblem, der Gnadenlehre, zu. Es zeichnet sich darin das Bemühen um eine tiefere Synthese ab, die die verhärtete Konfrontation aufzubrechen imstande gewesen wäre.4 Ohne erkennbaren äußeren Anlass brechen die Briefe plötzlich ab.
Im weiteren Fortgang der Auseinandersetzung legte Pascal allerdings eine befremdliche kompromisslose Haltung an den Tag und überwarf sich mit Port-Royal, insbesondere mit Antoine Arnauld und Nicole. Anlass dieses letzten Zerwürfnisses war das berühmte Formulaire, eine offizielle Verurteilung der fünf Thesen des Jansenius, die – analog zum späteren »Antimodernisteneid« – alle Kleriker zu unterzeichnen hatten. Bis zu seinem Tod rückte Pascal anscheinend nicht von dieser harten Linie ab.
Die letzten Jahre
Sein schlechter gesundheitlicher Zustand hatte Pascal gezwungen, Port-Royal zu verlassen. Obwohl er nicht mehr zu kontinuierlicher Arbeit fähig war, entwickelte er eine ungeheure Energie und leistete Erstaunliches. Allein wegen seiner nachlassenden Kräfte war er gezwungen, sich – entgegen aller früheren Gewohnheit – Notizen zu machen. So sind uns Pascals Gedanken dazu wenigstens in Form dieser posthum aufgefundenen Fragmente erhalten geblieben. Den großartigen Aufbau des Ganzen lassen sie indes nur noch erahnen.
Über Pascals Sterben liegt uns vor allem der bewegende Bericht seiner Schwester Gilberte vor (vgl. Gilberte Pascal 1991, bes. 129–135). Trotz des erbitterten Kampfes im Zuge des Jansenismus-Streites bezeugte Pascal hier eine zutiefst kirchliche Orientierung seines Glaubens, wie sie ja auch in den Pensées zum Ausdruck kommt. Angesichts des nahenden Endes verlangte er inständig, dass man ihm die Eucharistie reiche und das Sakrament der Krankensalbung spende. Man verweigert ihm dies zunächst mit dem Hinweis, dass sein Zustand dies nicht rechtfertige, da die Krankensalbung nach damaligem Verständnis den Sterbenden (als »Letzte Ölung«) vorbehalten war. Daraufhin äußert Pascal eine Bitte, die auf beeindruckende Weise sein Verständnis der Menschwerdung Jesu und der Eucharistie offenbarte: Er wolle in Gegenwart eines Kranken sterben, um den man sich ebenso intensiv kümmern möge wie um ihn, oder man möge ihn ins Hospital der Unheilbaren bringen, damit er in Gemeinschaft der Armen sterben könne. Pascal zeigt hier, dass er den Kern der christlichen Botschaft, die Gegenwart Gottes im Sakrament der Armen (vgl. etwa Mt 25), auch zur Mitte seiner eigenen Auffassung vom Christentum gemacht hat!
Die Haltung, in der Pascal gestorben ist, hat wohl seine Schwester Gilberte am besten wiedergegeben:
»Er sagte noch, mitten in seinen heftigsten Schmerzen, als man bedrückt war, ihn so leiden zu sehen: ›Beklagt mich nicht; die Krankheit ist der natürliche Zustand der Christen, denn hierin ist man, wie man immer sein sollte, im Erleiden der Übel, all der Güter und sinnlichen Vergnügungen beraubt, frei von allen Leidenschaften, die im Lauf des gesamten Lebens am Werk sind, ohne Ehrgeiz, ohne Habgier und in ständiger Erwartung des Todes. Müssen Christen nicht genau so ihr Leben zubringen? Und ist es nicht ein großes Glück, wenn man sich notwendigerweise in einem Zustand befindet, zu dem man verpflichtet ist, und dass man nichts anderes zu tun hat, als sich ihm demütig und still zu unterwerfen? Deshalb bitte ich euch nur darum, Gott zu bitten, mir diese Gnade zuteil werden zu lassen.‹ […] Als der Herr Pfarrer kam, um ihm die Kommunion zu reichen, gab er sich einen Ruck, richtete sich von selbst halb auf, um ihn mit mehr Respekt empfangen zu können. Und nachdem ihn der Pfarrer dem Brauch entsprechend nach den wichtigsten Geheimnissen des Glaubens gefragt hatte, antwortete er klar und deutlich: ›Ja, mein Herr, ich glaube dies alles aus meinem ganzen Herzen.‹ Und dann empfing er die heilige Wegzehrung und die Letzte Ölung mit solch zarten Gefühlen, dass er Tränen vergoss. Er beantwortete alles und bedankte sich beim Pfarrer. Und als dieser ihn mit der Monstranz segnete, sagte er: ›Gott möge mich nicht verlassen.‹ Dies waren seine letzten Worte. Denn nachdem er seine Danksagung verrichtet hatte, befielen ihn sofort wieder die Krämpfe, die nicht mehr nachlassen sollten und ihm keinen Augenblick geistiger Freiheit mehr gönnten. Sie dauerten bis zu seinem Tod an, der 24 Stunden danach eintrat, am 19. August [1662] um ein Uhr morgens, im Alter von 39 Jahren und zwei Monaten.« (G. Pascal 1991, 133–135)
Mit seinen letzten Worten greift Blaise Pascal übrigens eine Zeile aus seinem »Mémorial« wieder auf, das die bange Frage enthält: »Mein Gott, wirst du mich verlassen?«
Zur bleibenden Bedeutung der Pensées
Pascals Notizen und Reflexionen hatten trotz ihres unabgeschlossenen, aphoristischen Charakters in die Zukunft weisende Bedeutung und erweisen sich vielfach seinem großen Antipoden, René Descartes, als überlegen. Dies gilt zunächst in wissenschaftstheoretischer, methodologischer Hinsicht. Die Mathematik etablierte sich mit ihren klaren Definitionen und strengen Schlussfolgerungen aus Anfangsprinzipien als der Idealtypus jeglicher Erkenntnis überhaupt. Pascal setzt nun dieser Art von Rationalität keineswegs einen irgendwie gearteten Irrationalismus entgegen. Er leistet vielmehr eine immanente Kritik mathematischer Erkenntnis und zeigt scharfsinnig auf, dass sich die Mathematik nicht selbst begründen kann. Ihre Methode des Definierens und Beweisens stößt auf notwendige innere Grenzen. Die letzten Axiome, von denen sie auszugehen hat, sind selbst nicht mehr rational ableitbar, sondern nur noch intuitiv erfassbar. Die Mathematik weist so von sich her über sich hinaus. Damit nimmt er in gewisser Weise Einsichten der großen Mathematiker und Logiker (Frege, Russell, Whitehead, Gödel …) des 20. Jahrhunderts über die inneren Grenzen des Formalisierens vorweg: Ein geschlossenes formales System, das in sich selbst völlig rational begründbar ist, also sein eigenes Metasystem wäre, ist demnach nicht möglich. Mathematische Erkenntnis verweist somit auf ein Eingebettetsein in einen größeren Zusammenhang. Pascal bringt in diesem Kontext das vieldeutige Wort coeur, Herz, ins Spiel, das zu so vielen Missverständnissen Anlass gab. Es hat nichts mit Sentimentalität in unserem banalen Sinne zu tun. Philippe Sellier hat das mit »Herz« bei Pascal Gemeinte folgendermaßen zu erfassen versucht:
»Das Herz bei Pascal ist der Sitz innerer, unmittelbarer, nicht beweisbarer Erkenntnisse: Diese Erkenntnisse sind wesentlich, sei es, weil sie den Ausgangspunkt aller anderen darstellen (die ersten Grundsätze wie etwa Sein, dreidimensional, das Ganze größer als die Teile …), sei es, weil sie die Lebensführung bestimmen (Spürsinn, Geschäftssinn, ästhetisches Empfinden, Intuitionen jeglicher Art), sei es, weil sie dem Menschen das offenbaren, was ihn am meisten betrifft, sein Schicksal. Über diese breite Erkenntnistätigkeit hinaus […] umfasst das Herz die Gesamtheit des Willens mitsamt seinen unbewussten Neigungen oder bewussten Wünschen, seine Entscheidungen, seine Freuden oder seine Gewissensbisse. Es umfasst auch das moralische Gewissen. Die Dynamik, mit welcher sich der Mensch an die Tat macht, liegt ihm voraus. Das Herz meint also die Tiefe und Spontanität, unser wahres Sein. Die Einbildungskraft und die Vernunft, die ihm fremd sind, stellen nur die Oberfläche des Menschen dar. Insbesondere innerhalb einer religiösen Perspektive ist das Herz die Wahrheit des Menschen: Die Fähigkeit des Unendlichen, des Absoluten.« (Sellier 1991, 45–46)
Damit wird vor allem deutlich, dass Pascals methodologische und erkenntnistheoretische Überlegungen und sein denkerisches Durchdringen der menschlichen Existenz nicht zwei voneinander unabhängige Sphären darstellen, sondern unmittelbar zusammenhängen! Eine konsequente Reflexion des menschlichen Erkenntnisvermögens selbst mündet von sich aus im Nachdenken über das Ich, die Person und deren exponierte Stellung im Universum.5
Wissenschaftstheoretisch ist noch in anderer Hinsicht ein wesentlicher Unterschied zu Descartes festzuhalten: Während für Letzteren die – formale – Mathematik auch der Weg zu jeglichem materiellem Erkenntnisgewinn ist, insistiert Pascal auf der methodischen Eigenständigkeit der empirischen Erkenntnis! Nicht Deduktion allein, sondern die empirische Überprüfung von Hypothesen sichert Erkenntnis in diesem Bereich. Pascals methodologische Überlegungen führen ihn schließlich zu jenem Falsifizierbarkeitskriterium6, das Karl Popper im 20. Jahrhundert zum wissenschaftstheoretischen Standard erhebt.
Des Weiteren gelangt Pascal gerade aufgrund der Naturforschung zu einer positiven Würdigung der Tradition und Geschichtlichkeit des Denkens. Während Philosophen der Aufklärung in der Regel Vernunft und Tradition abstrakt einander gegenüberstellen, zeigt Pascal, dass menschliches Wissen sich entwickelndes Wissen ist, dass es sich gerade durch seine Perfektibilität im Gegensatz zu einer statischen Festgelegtheit auszeichnet, dass Wissensfortschritt immer an einen Kontext gebunden ist und einen Zeitindex trägt. Um die Aktualität des philosophischen Denkens Pascals für gegenwärtige Debatten zu ermessen, vergleiche man nur den heute so populären naturalistischen, reduktionistischen und vulgärmaterialistischen Diskurs mit dem denkerischen Niveau des Fragments 230!
Vor allem aber hat Pascal seine bleibende Bedeutung als Denker der menschlichen Existenz! Wiederum ist der Vergleich mit René Descartes erhellend. Letzterem geht es um die Gewissheit des Denkens, der theoretischen Welterkenntnis. Sein »methodischer Zweifel« führt ihn schließlich zu seinem Cogito, ergo sum als dem unerschütterlichen Fundament der Wahrheit und Gewissheit. Pascal aber, in dessen Pensées die Auseinandersetzung zwischen Skeptikern (»Pyrrhonikern«) und Dogmatisten eine große Rolle spielt, geht es um die Ungesichertheit, Ausgesetztheit, Bedrohtheit der menschlichen Existenz überhaupt, um sein Verlorensein im unermesslichen All, sein »Sein zum Tode«, die Widersprüchlichkeit seiner Existenz. Die naturwissenschaftliche Kenntnisse seiner Zeit, die Erschließung sowohl des Mikro- wie des Makrokosmos, werfen den Menschen gerade auf sich selbst und seine Fragilität zurück. Gerade das, was seine Größe ausmacht und ihn heraushebt aus allen anderen Seinsarten, die Fähigkeit zu denken, ist gleichzeitig auch Grund seines Elends. In unübertrefflichen Formulierungen kennzeichnet Pascal den Menschen als »Mitte zwischen Nichts und All«. Nicht das »Ich« des »cogito« Descartes’, sondern vielmehr das existenzielle Ich, das menschliche Dasein in seiner eigentümlichen Stellung in der Welt, ist Gegenstand seiner Analyse. Pascal erweist sich als psychologisch genauer Beobachter, wenn er beschreibt, wie der Mensch der Konfrontation mit dem eigenen Dasein entgehen will. Die geschäftige Tätigkeit des Menschen entlarvt er schonungslos als Zerstreuung, die keinen anderen Zweck hat, als den Menschen der radikalen Besinnung auf sich selbst zu entheben. Mit seinen scharfen Beschreibungen der Conditio humana, nimmt Pascal Kierkegaard, Heidegger und Sartre vorweg.
Die Paradoxie menschlicher Existenz eröffnet auch den Zugang zu dem, was Pascal mit einer »Apologie« der christlichen Religion beabsichtigt. Der Anspruch, die Wahrheit des christlichen Glaubens mit Vernunftgründen zu rechtfertigen, ist bereits im Neuen Testament formuliert (vgl. 1 Petr 3,15). Im Gegensatz zu vielen seiner prominenten Zeitgenossen weist Pascal jedoch jeden Versuch einer metaphysischen Beweisführung zurück – im System von Descartes ist dies ein zentraler Baustein, nur über den Umweg eines metaphysischen Gottesbeweises schlägt er die Brücke von der denkenden Selbstgewissheit zur Existenz der Außenwelt. Eine solche Beweisbarkeit verfehlte gerade ihren Gegenstand. Der unendlich unbegreifbare Gott kann nicht auf dem Weg logischer Beweisführung erreicht werden. Wie sehr unterscheidet sich Pascal hierin von so manchen Zeitgenossen und deren apologetischen Werken, die heute allerdings in Vergessenheit geraten sind! Wie sehr unterscheidet er sich vom Triumphalismus eines Jacques-Bénigne Bossuet, der sein Erstaunen darüber äußerte, dass nicht jedermann die so sichtbaren Werke der Vorsehung erkenne. Der Glaube ist für Pascal keine Sache theoretischer Beweisführung, sondern des Engagements der gesamten menschlichen Existenz. Er erfordert einen radikalen Akt der Entscheidung. Eine Rechtfertigung des Glaubens kann also nur der denkerische Nachvollzug einer existenziellen Entscheidung sein und diese keineswegs ersetzen wollen. Damit aber befindet sich Pascal im Gegensatz zur herkömmlichen Apologetik auf der Höhe fundamentaltheologischer Reflexion unter dem Primat der Praxis. Pascal wendet sich deshalb an die »Ungläubigen«, indem er auf die gemeinsame Erfahrung des menschlichen Daseins verweist.
Eines der meistdiskutierten Fragmente Pascals in diesem Zusammenhang ist ohne Zweifel die Wette (S. 146–151). Ausgehend von den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung will Pascal hier zeigen, dass das »Setzen« auf Gott in jedem Fall die bessere Wahl sei. Als gültig festzuhalten bleibt hier, dass Pascal den Glauben als einen notwendigen Akt der Entscheidung begreift: Man muss wählen, selbst wenn man sich der bewussten Entscheidung zu entziehen versucht, hat man bereits gewählt! Als gültig festzuhalten bleibt, dass es bei der Frage nach Gott nicht um theoretische Spekulation, sondern um eine praktische Grundoption des Daseins geht. Um die Existenz Gottes wissen wir durch den Glauben, und nicht umgekehrt! Die Konsequenzen für die Gestaltung des Lebens stehen im Mittelpunkt. Damit nimmt Pascal eine – m. E. heute nicht mehr zu unterbietende – Position Immanuel Kants vorweg, für den Gott eines der »Postulate der praktischen Vernunft« und eben nicht metaphysischer Erkenntnis war. Es bleibt aber gleichzeitig die Frage, ob Pascal mit diesem rationalistischen Kalkül den christlichen Glauben in seiner materialen Substanz wirklich adäquat einholt. Dies wird in der konkreten Beschreibung der praktischen Konsequenzen der Wette überdeutlich: »Welches Übel hättet Ihr nun zu gewärtigen, wenn Ihr diesen Standpunkt bezieht? Ihr werdet treu, ehrbar, demütig, dankbar, wohltätig, ein aufrichtiger und wahrer Freund sein. Tatsächlich werdet Ihr nichts mit vergifteten Vergnügungen zu schaffen haben, nichts mit Ruhm und eitlen Genüssen. Doch habt Ihr dafür nicht andere Freuden?« Was hier beschrieben wird, ist harmlose und behagliche bürgerliche Anständigkeit. Kann dies der Radikalität eines Glaubens gerecht werden, der im Ernstfall nach dem Vorbild seines Stifters sein Leben aufs Spiel setzt? Wird hier das Christentum nicht auf das Maß biederen Bürgertums herabgestutzt? Diese Frage ist nicht nur an Pascal zu stellen, sondern vielmehr noch an zeitgenössische Vertreter einer bürgerlichen Religiosität wie etwa an Hans Küng, für dessen eigenes Glaubensverständnis Pascals Wette zentral ist.
Dass das wirkmächtigste Werk Pascals eine Sammlung von Fragmenten ist, entspricht möglicherweise seinen Inhalten mehr als ein vollendetes Opus. Die Gebrochenheit des menschlichen Daseins findet hier ihre adäquate äußere Gestalt. Und gerade sein aphoristischer Charakter hat die Dichte und geschliffene Zuspitzung seiner wesentlichen Einsichten so deutlich hervortreten lassen. Pascal bleibt mit seinen Pensées eine Provokation und Herausforderung für jede Art »halbierter« Aufklärung, jeder Art von Rationalismus, der seine eigenen Voraussetzungen nicht mehr zu denken imstande ist, und jede Art von Banalisierung des Menschseins.
Denkerische Durchdringung gläubigen Daseins
Wen hatte Pascal eigentlich als Adressaten seiner geplanten »Apologie« vor Augen? Es scheint jener »honnête homme« gewesen zu sein, den Méré als Ideal zeichnet, jener Gebildete, klar Urteilende also, der dem Religiösen mit Respekt begegnet. Die Wahrheit des Christentums kann jedoch nicht »demonstriert« werden, sie erschließt sich nur der existenziellen Entscheidung, die keines »Beweises« fähig oder bedürftig ist. Doch eben diese existenzielle Entscheidung kann transparent gemacht, vor dem Forum der Vernunft gerechtfertigt werden, ohne dabei ihren eigenständigen Sinn preiszugeben. Eine solche »Rechenschaft des Glaubens« (vgl. 1 Petr 3,15) war den Jansenisten zutiefst fremd und suspekt.
Pascal ist ein durch und durch existenzieller Denker. Er ist bereits geprägt vom Zerfall des mittelalterlichen Daseinsgefühls, von der Erfahrung des Nichts, der »Ortlosigkeit« des menschlichen Daseins und der stumpfen Gleichgültigkeit der objektiven Wirklichkeit des Alls gegenüber dem Menschen, in dem es zum Bewusstsein gelangt. Das ungesicherte, der Endlichkeit preisgegebene Dasein selbst ist ihm zum Problem geworden. Erkenntnis selbst vollzieht sich für ihn – den großen Mathematiker und Naturwissenschaftler! – nicht in unbeteiligter Objektivität, sondern sie ist letztlich Stellungnahme zum Dasein! Es geht hierbei um uns selbst und damit ums Ganze.
Pascal begreift das menschliche Dasein als eigenständige Wirklichkeit, als neue qualitative Ebene, die nicht unter Mathematik und Physik subsumiert werden kann. Entgegen jeder Form von Reduktionismus vermag Pascal die Sinnebenen des Wirklichen in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit zu unterscheiden. Das großartige Fragment 339 (S. 245–247) ist in dieser Hinsicht ein Schlüsseltext! Hier unterscheidet er die Wirklichkeitsebenen von corps, ésprit und surnaturel bzw. charité (Körper, Geist, Übernatürliches bzw. Nächstenliebe). Jeder Wirklichkeitsbereich hat seine eigene Logik, die jeweils höhere Ebene kann nicht einfach aus der niedrigeren abgeleitet werden, sie erschließt sich jedoch aus deren Aporien. Die Aporien des menschlichen Daseins, die auf dieser Ebene nicht zur Auflösung kommen, lassen die religiöse Ebene als sinnvoll aufleuchten.
Metaphysische »Gottesbeweise« werden deshalb ihrem Gegenstand gar nicht gerecht. Sie verfehlen gerade das Wesen des Glaubens als existenzieller Entscheidung! Ihnen mangelt es deshalb auch an jeglicher Überzeugungskraft. Allenfalls als denkender Nachvollzug der vollzogenen Glaubensentscheidung haben sie ihre Berechtigung. Pascal bestreitet nicht, dass es den schlussfolgernden »Weg« (im Sinne der quinquae viae des Thomas von Aquin) zu Gott, etwa über die Natur, gibt, er erschließt sich jedoch lediglich dem bereits gläubigen Auge.
»Das Herz ist es, das Gott empfindet, nicht die Vernunft«, heißt es in Fragment 680 (S. 129). Damit ist aber alles andere als einem blinden Irrationalismus das Wort geredet! Auf die spezifische Bedeutung von »Herz« bei Pascal wurde weiter oben bereits eingegangen (S. 26–28). Es bildet eben nicht den Gegensatz zum Intellekt, sondern gerade die Voraussetzung der Erkenntnis! Im Fragment 204 (S. 198) erweist sich Pascal wiederum als ein Meister der Dialektik, wenn er aufzeigt, dass es die Vernunft selbst ist, die einsieht, dass der Glaube sie übersteigt! Damit ist aber der Glaube gerade nicht das Irrational-Emotionale im Gegensatz zur Vernunft. Mit »Herz« bezeichnet Pascal ja jene Instanz, in der die ersten Axiome des Denkens wie Raum, Zeit, Bewegung, Zahlen, zur Anschauung gelangen – des schlussfolgernden Denkens, das sich letztlich nicht selbst begründen kann. Der Akt des Herzens ist also letztlich konstitutiv für das Denken selbst. Was hier infrage steht, ist das Verhältnis von Erkennen und Wille. Pascal geht letztlich von der Existenzialität der Wahrheit aus, das heißt, die liebende Bezogenheit auf den Gegenstand ist die Voraussetzung seiner Erkenntnis, der theoretische Geist ist letztlich getragen vom wertschätzenden Geist.
Eine Reihe von Fragmenten kreist um den Deus absconditus (S. 154–171), um das Ärgernis des verborgenen Gottes bzw. die Ambivalenz seiner Offenbarungsgestalt: Gerade das, was ihn ins Menschliche übersetzt (etwa die historische Person Jesu), verhüllt ihn zugleich! Pascal zeigt, dass diese eigentümliche Verborgenheit Gottes (seine Gegenwart in Gestalt des Vermissens – so darf man aus heutiger Sicht formulieren) die Voraussetzung der Glaubenspraxis ist. Jede logische Evidenz ließe keinen Spielraum mehr für die existenzielle Entscheidung, um die es dabei geht.
Entscheidend für das Verständnis von Pascals Auffassung von Christentum und Glaube ist natürlich sein »Mémorial«, in dem er eine innere Erfahrung (seine »zweite Bekehrung«, wie es vielfach heißt) festhält. Ein entscheidender Satz darin ist das Bekenntnis zum Gott der biblischen Offenbarung im Gegensatz zum Gott der Philosophen (wobei bereits hinreichend klar geworden sein dürfte, dass Pascal damit der philosophischen Annäherung an Gott keineswegs ihre Berechtigung abspricht; die Glaubensreflexion muss diese vielmehr in sich aufnehmen und integrieren). Was sich in dieser inneren Erfahrung Pascals ausdrückt, ist letztlich die zentrale Einsicht: Die Wirklichkeit Gottes kann nicht geschlussfolgert werden, sie kann sich nur – so es tatsächlich um Gottes Wirklichkeit geht – von sich aus erschließen! Gott kann, soll er denn der letzte Grund unserer Wirklichkeit sein, unser eigenes Personsein jedenfalls nicht unterschreiten, er kann sich als Person jedoch letztlich nur selbst als Handelnder und Sprechender mitteilen. Wir sind also auf konkrete Geschichte verwiesen, wenn es um Gott geht. Darin besteht ja das Ärgernis des jüdisch-christlichen Glaubens überhaupt, dass dieser keine vage, mehr oder weniger vernunftkompatible Idee Gottes verkündet, sondern dass diese Gottesidee ihre Eindeutigkeit erst im Verweis auf die konkrete Geschichte als den Ort seiner Selbstoffenbarung gewinnt.
Damit wendet sich Pascal aber gegen eine deistische Gottesauffassung, die für ihn ebenso Feind des Glaubens ist wie der Atheismus. Insbesondere im bedeutenden Fragment 690 (S. 164–168) führt Pascal dies näher aus. Der Gott, den die Christen meinen, ist nicht einfach der Urheber der Ordnung der Dinge und der Gesetze der Mathematik und Physik. Es ist gerade die Definition Gottes, dass er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Jesu Christi, ist, in dessen Lebenspraxis und Schicksal das, was mit Gott gemeint ist, wer er ist, Eindeutigkeit gewinnt. Er ist der lebendige Gott, der uns gerade in der geschichtlichen Gestalt seiner Offenbarung in die Entscheidung ruft.
Die Bedeutung des »Mémorial« für Pascals Glaubensverständnis und Denken überhaupt hat wohl kaum jemand so klar erfasst wie Romano Guardini:
»Als Pascal jene Erfahrung durchlebte, von der das Mémorial Kunde gibt, hat er nicht aufgehört, Mathematiker, Physiker, Ingenieur, Psychologe und Philosoph zu sein. Die Wirklichkeit, auf welche jene Erkenntniskräfte sich richten, hat er nach wie vor gesehen, und war nach wie vor entschlossen, ihnen gerecht zu werden. Ihm war aber eine neue Wirklichkeit dazu aufgegangen, der Lebendige Gott. Eine Wirklichkeit, die er nicht auf sich beruhen lassen konnte; auch nicht in eine besondere Sphäre abkapseln, etwa nach der idealistischen Methode der doppelten Wahrheit. Sondern sie war so, dass sie forderte, von ihr aus das ganze Dasein neu zu denken. […] Die Welt bleibt für Pascal die Welt; die Philosophie bleibt Philosophie; aber alles wird in einen neuen Zusammenhang gerufen, und das Denken zu einer neuen Anstrengung aufgefordert durch die Erkenntnis, dass jener Gott, den der ›Philosoph‹ nur als das ›Absolute‹ erfasst, in Wahrheit der Lebendige Gott ist, der in Jesus Christus in die Geschichte tritt […].« (Guardini 41991, 60–61)
Pascals Glaube ist folgerichtig durch und durch christozentrisch. Im schon erwähnten Fragment 690 kommt dies in besonders eindringlicher und dichter Weise zum Ausdruck. Pascal beschreibt Jesus Christus hier als das Ziel von allem, als das Zentrum, dem alles zustrebt, und den Grund aller Dinge, in dem alles seinen Bestand hat. Damit holt er nicht nur adäquat jene neutestamentlichen Aussagen über den »kosmischen Christus« ein; bis in die konkreten Formulierungen hinein weisen Pascals Sätze hier voraus auf jenen anderen großen französischen Naturwissenschaftler und Theologen, der im 20. Jahrhundert eine großartige Synthese von Christentum und einem evolutiven Weltbild schuf: Pierre Teilhard de Chardin. Für ihn streben die Sinnlinien, die er im Evolutionsgeschehen erkennt, letztlich auf einen Konvergenzpunkt, auf den »Punkt Omega« zu, den er mit dem Gottmenschen Jesus Christus ineins fallen lässt. Pascals christologische Aussagen scheinen für Teilhard durchaus eine Inspirationsquelle gewesen zu sein.
Beachtenswert ist auch Pascals Schrifthermeneutik. Natürlich kann hier nicht der heutige Stand exegetischer Forschung und bibeltheologischer Reflexion als Maßstab herangezogen werden. Im schroffem Gegensatz zu jedem Biblizismus, der ja gerade für Jansenisten nahelag, definiert Pascal eine »Mitte der Schrift« im Luther’schen Sinne, ein hermeneutisches Prinzip ihrer Lektüre: »Der einzige Gegenstand der Schrift ist die Nächstenliebe«, heißt es in Fragment 301 (S. 220). Alles, was nicht zu ihr hinführt und nicht sie zum Zentrum hat, ist Bild. Genau in diesem Sinne bezeichnet er Christus als die Mitte sowohl des Alten wie des Neuen Testaments!
Diese knappen Hinweise erschöpfen natürlich bei Weitem das nicht, was Pascals denkerische Durchdringung des Glaubens ausmacht. Möge die Lektüre seiner Gedanken einen weit größeren Reichtum entdecken lassen, als er hier nur angedeutet werden kann. Klar dürfte jedoch sein, dass Blaise Pascals Gedanken zu Christentum und Religion keineswegs nur eine Facette der Geistesgeschichte des 17. Jahrhunderts darstellen, sondern auch für ein gegenwärtiges Glaubensverständnis bleibende Aktualität besitzen.
Zur Geschichte der Textüberlieferung und zu dieser Ausgabe
Die recht komplizierte Überlieferungsgeschichte des Textes der Pensées ist unter anderem in der Einführung Philippe Selliers zu der von ihm besorgten Ausgabe dargestellt (vgl. Pascal 1991). Wertvolle Hinweise bietet auch Gérard Ferreyrolles in seiner Einführung zur Taschenbuchausgabe eben dieser Edition (Ferreyrolles 2000, bes. 14–23). An Details Interessierte mögen sich bei diesen beiden Autoren kundig machen. Die Geschichte des Textes sei hier nur kurz rekapituliert: Die von Pascal hinterlassenen mehr als achthundert Fragmente wurden in einem recht chaotischen Zustand aufgefunden. Es handelte sich nur in geringerem Maß um ganze Blätter, zum Großteil waren diese zerschnitten. Ein Fragment konnte sich über mehrere Stücke Pergament hinziehen, umgekehrt konnte ein Blatt mehrere Fragmente umfassen, etc. Teilweise waren die Blätter in Bündel zusammengefasst, was für die späteren Anordnungsversuche einen äußeren Anhaltspunkt bot. Die Fragmente stellen nicht immer eigenständige, vollständig ausgeführte Gedankengänge dar. Vielfach handelt es sich einfach um elliptische Sätze bzw. Halbsätze, deren Sinn sich erst vor dem Hintergrund der Kenntnis des gesamten Pascal’schen Werkes erschließt (etwa wenn man ähnliche Wendungen in den Provinzialbriefen ausfindig machen kann), deren Deutung aber nur allzu oft spekulativ bleibt. Soweit der Sinn einigermaßen sicher erschlossen werden kann, wurden in Form von Fußnoten entsprechende Hinweise aufgenommen. Viele Fragmente haben einfach die Funktion von »Merkposten«, unseren heutigen »Post-it«-Notizen vergleichbar. Pascal wollte z. B. bestimmte Stellen in der von ihm rezipierten Literatur (z. B. Montaignes Essais) festhalten. Unter den Überschriften »Ordnung« hat er den Aufbau bestimmter Abschnitte skizziert. Die meisten Fragmente sind von Pascal persönlich handschriftlich festgehalten, etliche aber sind von ihm diktiert oder von jemand anderem in Schönschrift übertragen. Der Großteil dieser Fragmente stellt wohl Notizen für die geplante Apologie des Christentums dar, in etlichen Fällen ist aber der Zusammenhang offensichtlich ein anderer. In einigen Fällen sind die Gedanken dem Projekt der Provinzialbriefe zuzuordnen. Eine Sonderstellung nimmt die Meditation ein, die Fragment 749 wiedergibt (S. 252–254). Nur wenige Fragmente sind wirklich vollständig oder nahezu vollständig ausgeführt, so zum Beispiel die Fragmente 78 und 230).
Einem Neffen Pascals, dem Abbé Louis Périer, kommt das Verdienst zu, für die Erhaltung dieser Textfragmente gesorgt zu haben. Er hat sie zunächst in ein gebundenes Album eingeklebt, das sich heute im Besitz der Bibliothèque National de France befindet. Dieser erste Versuch einer Textsammlung ist heute unter dem Namen Originalsammlung (Recueil original des Pensées de Pascal) bekannt und stellt die Textgrundlage (nicht aber die Grundlage für die Anordnung der Texte!) für alle künftigen Editionen dar. Es ist nicht verwunderlich, dass bereits dieser erste Versuch der Konservierung etliche unglückliche Textzuordnungen bzw. -aufteilungen aufweist. Die Anordnung ist recht willkürlich und eher von der Sorge bestimmt, mit wenig Papier auszukommen. Périer übergab dieses Album der Abtei Saint-Germain-des-Prés. Die erste Edition erfolgte im Jahr 1670 durch das Kloster Port-Royal, weitere Ausgaben folgten in den Jahren 1842 und 1938. Sie standen alle vor der Schwierigkeit, das aufgefundene Chaos der Zettel und Bündel in eine thematische Ordnung zu bringen, die die Absicht bzw. den Editionsplan Pascals für seine Apologie erkennen lassen.
Die Ausgabe von Sellier gilt vielen Fachleuten, was die Lesart bestimmter Passagen betrifft, als die zuverlässigste. Um den Rückgriff auf das französische Original zu erleichtern, wurde in dieser Übersetzung hinter jedes Fragment die entsprechende Nummer der Sellier-Ausgabe gesetzt. Der Neuübersetzung lag neben dem Bemühen um Präzision und eine zeitgemäße Sprache insbesondere die Tilgung sinnentstellender Fehler früherer Übersetzungen zugrunde. Was die Anordnung der Fragmente betrifft, war das Bestreben, sich von allen bisherigen Versuchen völlig zu lösen. Leitender Gesichtspunkt war die inhaltliche Rezeption durch heutige Leser und Leserinnen. Hierbei war es auch in einigen Fällen nötig, Fragmente aufzuspalten und die jeweiligen Passagen in inhaltlich andere Zusammenhänge einzuordnen.
Die thematische Erschließung des Pascal’schen Textes wird durch ein umfassendes Personen- und Sachregister sowie durch ein Verzeichnis der Bibelstellen erleichtert. In der Ausgabe Selliers sind von Pascal durchgestrichene Textpassagen dadurch gekennzeichnet, dass sie in runde Klammern und kursiv wiedergegeben werden. Um der besseren Lesbarkeit willen wurde auf diese Kennzeichnung weitgehend verzichtet und nur dann darauf zurückgegriffen wenn die entsprechende getilgte Passage den Duktus des Textes unterbricht. Die erläuternden Fußnoten wurden auf das Minimum dessen beschränkt, was für das unmittelbare Textverständnis nötig ist, nehmen aber dennoch einen beträchtlichen Umfang ein.
Wie jedem der bisherigen Einteilungsversuche haftet natürlich auch diesem Versuch einer konsequent thematischen Anordnung etwas Subjektives an. Im Vordergrund jedenfalls stand das Bemühen, dass die Darstellung der inneren Logik des Pascal’schen Denkens gerecht wird. Jedes rein philologische Interesse hatte zurückzutreten vor der Intention, die reiche Gedankenwelt Pascals heutigen Leserinnen und Lesern so zu erschließen, dass sie existenziell ergreift und ins Nachdenken des eigenen Daseins mündet.
Bruno Kern
Literatur
Originalausgabe:
Pascal, Blaise, Pensées. Texte établi par Philippe Sellier d’apres la copie de référence de Gilberte Pascal, Paris 1991.
(Die in Klammern angegebenen Zahlen verweisen auf die Zählung dieser Ausgabe)
Sekundärliteratur:
Clévenot, Michel, Angélique Arnauld, Abbesse de Port-Royal, 1602–1661, in: ders., Les chrétiens du XVIIe siècle. Ombres et lumières du Grand Siècle (Les hommes de la fraternité, IX), Paris 1989, 76–84.
Clévenot, Michel, Blaise Pascal, 1623–1662, vu par ses soeurs Gilberte et Jacqueline, in: ders., Les chrétiens du XVIIe siècle. Ombres et lumières du Grand Siècle (Les hommes de la fraternité, IX), Paris 1989, 85–94.
Clévenot, Michel, Le Père Marin Mersenne, Secrétaire de l’europe savante, 1588–1648, in: ders., Les chrétiens du XVIIe siècle, aaO., 68–75.
Ferreyrolles, Gérard, Introduction, in: Pascal, Blaise, Pensées. Présentation et notes par Gérard Ferreyrolles, Paris 2000, 5–35.
Guardini, Romano, Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal, Mainz/Paderborn 41991.
Hell, Leonhard, Cornelius Jansenius. Konservativer Augustinismus zwischen den Fronten, in: Walter, Peter/Jung, Martin H. (Hg.), Theologen des 17. und 18. Jahrhunderts. Konfessionelles Zeitalter – Pietismus – Aufklärung, Darmstadt 2003, 70–87.
Küng, Hans, Ich glaube, also bin ich?, Blaise Pascal, in: ders., Existiert Gott?, München 1978, 64–118.
Gilberte, La vie de M. Pascal, in: Pascal, Blaise, Pensées, aaO. 103–135.
Pesch, Otto Hermann, Thomas von Aquin. Grenze und Größe mittelalterlicher Philosophie, Mainz 1988.
Raffelt, Albert, Universalgenie Blaise Pascal, Würzburg 2011.
Rahner, Karl, Über das Verhältnis von Natur und Gnade, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. 1, Einsiedeln 1958, 323–245.
Reinhardt, Rudolf, Die katholische Kirche, in: Kottje, Raymund/Moeller, Bernd (Hg.), Ökumenische Kirchengeschichte, Bd. 3: Neuzeit, Mainz/München 31983, 10–47.
Schäfer, Lothar, Blaise Pascal, in: Höffe, Ottfried (Hg.), Klassiker der Philosophie, Bd. 1: Von den Vorsokratikern bis David Hume, München 1981, 322–337.
Sellier, Philippe, Introduction, in: Pascal, Pensées, aaO., 5–102.
1Es handelte sich um den mathematischen Beweis, dass die Winkelsumme eines Dreiecks zwei rechten Winkeln entspricht.
2In der Tradition des thomasischen Denkens setzte sich theologisch die Einsicht durch, dass die Gnade Gottes die menschliche Freiheit nicht ausschließt, sondern sie allererst begründet und trägt! Vgl. dazu die einschlägigen Passagen bei Pesch 1988.
3Den häufig – so auch von Romano Guardini – erhobenen Vorwurf an Jansenius, er habe Augustinus simplifiziert, lässt sich allerdings nicht ohne Weiteres nachvollziehen. Seine subtile Unterscheidung von sensu divisu und sensu composito etwa scheint vielmehr auf eine einflussreiche Position der katholischen Theologie des 20. Jahrhunderts, nämlich auf die Karl Rahners, vorauszuweisen. Rahner will einerseits den »Extrinsezismus« vermeiden, also die Auffassung, dass die Gnade dem Menschen etwas bloß Äußerliches wäre. Die Annahme einer zum Wesen des Menschen selbst gehörenden Hinordnung auf die Gnade würde allerdings deren Charakter als ungeschuldetes Geschenk gefährden. So spricht er vom »übernatürlichen Existenzial« des konkreten, faktisch existierenden Menschen. Vgl. Rahner 1958, passim.
4Eine bessere Kenntnis des Thomas von Aquin, aber vor allem Pascals Fähigkeit zur Unterscheidung der Sinnebenen der Wirklichkeit, wie sie insbesondere in Fragment 339 (S. 245–247) zum Ausdruck kommt, sind hier entscheidend: In der Ordnung der Liebe und Freiheit ist der Kausalitätsbegriff ein anderer als auf intellektueller und psychischer Ebene. Hier kann man nur erahnen, was es bedeutet hätte, wenn Pascal seine Apologie des Christentums tatsächlich vollendet und die Gnadenlehre in sie integriert hätte!
5Hans Küng stellt in seiner Interpretation zwar den unmittelbaren Zusammenhang zur methodischen Reflexion der mathematischen Erkenntnis nicht in dieser Deutlichkeit her, aber auch er betont, dass »Herz« bei Pascal keineswegs als Widerspruch zur Vernunft gesehen werden darf: »[…] ›Herz‹ meint nicht das Irrational-Emotionale im Gegensatz zum Rational-Logischen, nicht eine ›Seele‹ im Gegensatz zum ›Geist‹. Herz meint jene – durch das körperliche Organ symbolisch bezeichnete – geistige Personmitte des Menschen, sein innerstes Wirkzentrum, den Ausgangspunkt seiner dynamisch-personalen Beziehungen zum Anderen, das exakte Organ menschlicher Ganzheitsverfassung. Herz meint durchaus den menschlichen Geist: aber nicht insofern er ein rein theoretisch denkender, schlussfolgernder, sondern insofern er spontan präsenter, intuitiv erspürender, existentiell erkennender, ganzhaft wertender ja im weitesten Sinn liebender (oder auch hassender) Geist ist. Von daher versteht man vielleicht Pascals meistzitiertes, aber kaum zu übersetzendes Wortspiel richtig: ›Le coeur a ses raison, que la raison ne connaît point: on le sait en milles choses.‹ – ›Das Herz hat seine (Vernunft-)Gründe, die die Vernunft nicht kennt; man erfährt das in tausend Dingen.‹ Das also ist die Logik des Herzens: das Herz hat seine eigene Vernunft!« (Küng 1978, 72)
6Hypothesen können grundsätzlich nicht verifiziert werden, da man hierfür alle positiven Fälle erfassen müsste. Hingegen genügt ein einziger einer Hypothese widersprechender Fall, um sie zu falsifizieren. Falsifizierbarkeit wird somit zum entscheidenden Kriterium der Wissenschaftlichkeit einer Hypothese.
GRÖSSE UND ELEND
Wenn ein Tier durch Geisteskraft das vollbrächte, was es aufgrund von Instinkt tut, und wenn es durch Geisteskraft das laut von sich gäbe, was es aufgrund des Jagdinstinkts von sich gibt und um seinen Jagdgefährten zu signalisieren, ob die Beute gestellt oder verloren ist, dann spräche es auch ebenso in Angelegenheiten, die es innerlich mehr betreffen, etwa um zu sagen: »Zernagt diesen Strick, der mich wund macht und den ich nicht zu fassen kriege.« (137)
Größe
Die Ursache der Wirkungen zeigt die Größe des Menschen an: dass er aus der Begierde eine so schöne Ordnung hervorgebracht hat. (138)
Was in uns ist es eigentlich, das Vergnügen empfindet? Die Hand? Der Arm? Das Fleisch? Das Blut? Es wird sich zeigen, dass es sich um etwas Immaterielles handeln muss. (140)
Ich kann mir sehr wohl einen Menschen ohne Hände, ohne Füße und ohne Kopf ausdenken, denn wir wissen lediglich aus Erfahrung, dass der Kopf notwendiger ist als die Füße. Doch ich kann mir keinen Menschen ohne Gedanken ausdenken. Das wäre ja dann ein Stein oder ein stumpfsinniges Tier. (143)
Instinkt und Vernunft: Kennzeichen zweier Naturen. (144)
Denkendes Schilfrohr
Es ist nicht der Raum, worin ich meine Würde suchen muss, es ist vielmehr der geordnete Ablauf meines Denkens. Ich hätte überhaupt nichts davon, Ländereien zu besitzen. Durch den Raum umfasst und verschlingt mich das Universum. Ich hingegen erfasse das Universum im Gedanken. (145)
Die Größe des Menschen besteht darin, dass er sich in seinem Elend erkennt. Ein Baum erkennt sich selbst nicht in seinem Elend. Es bedeutet also elend zu sein, wenn man sich in seinem Elend erkennt, doch es bedeutet zugleich zu groß sein, wenn man erkennt, dass man elend ist. (146)
Immaterialität der Seele. Die Philosophen, die ihre Leidenschaften bezähmten: Welche Materie war es, die das bewirken konnte? (147)
All dieses Elend ist gerade der Beweis seiner Größe. Es ist das Elend eines großen Herrn, das Elend eines seines Throns beraubten Königs. (148)
Die Größe des Menschen
Die Größe des Menschen liegt so offensichtlich zutage, dass man sie selbst aus seinem Elend erkennen kann. Denn das, was bei den Tieren Natur heißt, nennen wir in Bezug auf den Menschen Elend. Damit anerkennen wir, dass er, dessen Natur heute der der Tiere entspricht, eine bessere Natur, die ihm einst eigen war, bei seinem Fall verloren hat.
Denn wer ist darüber unglücklich, nicht König zu sein, wenn nicht ein entthronter König? Hat man erlebt, dass Aemilius Paul[l]us unglücklich darüber war, kein Konsul zu sein? Im Gegenteil! Alle fanden, er sei glücklich, dass er Konsul gewesen war, denn es entsprach ihm nicht, dies für immer zu sein. Perseus7 hingegen erlebte man unglücklich darüber, kein König zu sein, denn ihm hätte es entsprochen, für immer König zu sein, und man wunderte sich darüber, dass er das Leben weiter ertragen konnte. Wer ist glücklich darüber, nur einen Mund zu haben? Und wer wäre nicht unglücklich darüber, nur ein Auge zu haben? Man ist wohl noch nie auf den Gedanken gekommen, traurig darüber zu sein, dass man keine drei Augen hat, aber man ist untröstlich, wenn man gar keines hat. (149)