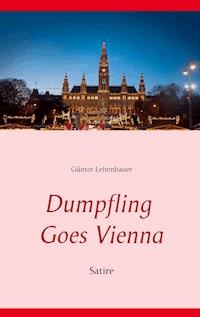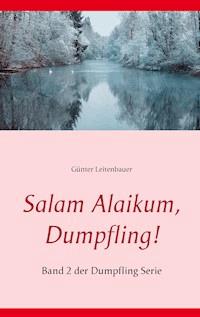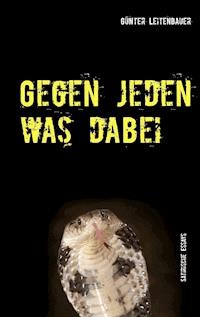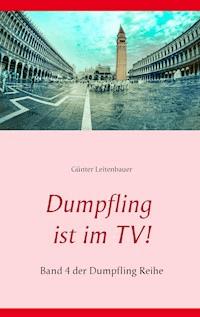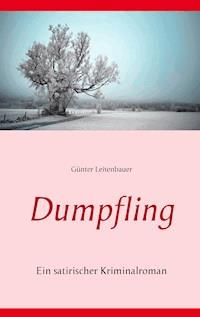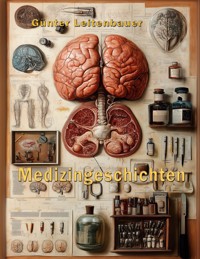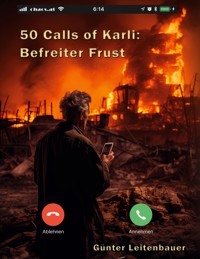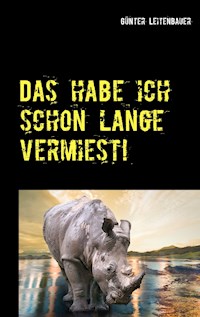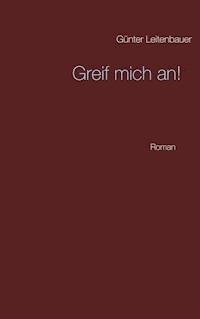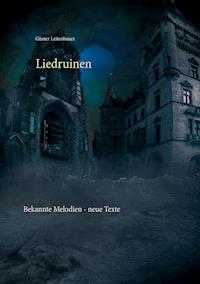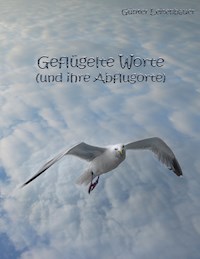
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch geht über 400 bekannten Redewendungen und Ausdrücken auf den Grund, erläutert deren Ursprung und informiert über die geschichtlichen Zusammenhänge. Dabei spannt sich der zeitliche Bogen von der biblischen Zeit über die Antike bis zur Gegenwart, der thematische von der Mythologie über die Religion, Etymologie und Geschichte bis zur Wissenschaft. Das Buch ist in einem lockeren Stil geschrieben und daher leicht lesbar. Etliche eingeflochtene Anekdoten zaubern einem beim Lesen ein Schmunzeln ins Gesicht, und am Ende ist man mit Sicherheit um ein paar Dinge schlauer geworden, die eben nicht jeder weiß. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis erleichtert das Auffinden einer gesuchten Redensart, sodass das Buch auch als Nachschlagewerk geeignet ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Vorwort des Autors
Als ich nach der Drucklegung meines Buchs „Elementare Geschichten“ überlegte, welches ich als nächstes Projekt angehen sollte – denn irgendetwas muss ich immer zu tun haben – ließ mich meine Fantasie im Stich. Und damit hatte ich mein Thema: Ich könnte doch den so oft verwendeten Sprichwörtern und Redewendungen, derer man sich häufig bedient, aber deren Herkunft man nicht immer sofort erklären kann, auf den Grund gehen.
In der Tat war „im Stich lassen“ die erste Redewendung, die ich mir notierte. Ich begann also zu recherchieren, was heutzutage mit dem Internet nicht allzu schwierig ist. Dachte ich jedenfalls. Bei obiger Redewendung ist es das tatsächlich nicht, aber ich stieß doch auf etliche, deren Herkunft nicht eindeutig geklärt werden kann. Zumeist findet man dann eine Erklärung, die auf den ersten Blick plausibel klingt, als die am öftesten angeführte. Gleichsam Ockhams Rasiermesser: „Wenn es mehrere mögliche Erklärungen gibt, ist die einfachste mit den wenigsten zusätzlichen Annahmen zumeist die richtige.“
Ein Beispiel? Wenn Ihnen nahe am Neusiedlersee ein nasser Hund begegnet, ist die vermutlich korrekte Erklärung, dass der Hund im See baden war und nicht, dass er just dann unter dem Balkon des Seehotels stand, als das Zimmermädchen die Blumen gegossen hat. Vor allem dann, wenn die Balkone gar keine Blumen haben, weil es so etwas nur in Salzburg und in Tirol gibt.
Bei einigen Redewendungen kommt man, wenn man genauer recherchiert, schnell dahinter, dass die immer wieder zu lesende Erklärung auf zumeist genau eine Quelle zurückgeführt werden kann. Und die kann – muss aber nicht – eine richtige Erklärung bieten. Recherchiert man weiter, findet man auf einmal auch andere Möglichkeiten. Und dann muss man sich eben für eine entscheiden. Dabei sind dann die Gesetze der Logik meines Erachtens ein besseres Werkzeug als nur nachzuzählen, welche Erklärung öfter auftaucht.
Wie auch immer: Ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Durchaus möglich ist, dass ich mich da und dort geirrt habe. Aber dann habe ich mich zumindest mit bestem Wissen und Gewissen und einiger Bemühung geirrt; auf diese Rechtfertigung lege ich Wert, auch wenn ich mich sonst nicht gerne rechtfertige. Was als gelernter Österreicher einer längeren Nachschulung bedurfte.
Es gibt im deutschen Sprachraum nun etwa 400.000 Sprichwörter und Redewendungen, habe ich recherchiert. Das wäre dann für ein Buch doch etwas viel, also habe ich die Sprichwörter gleich eliminiert und konzentriere mich nur auf die Redewendungen und einige wenige Einzelwörter. Aber auch da kann ich in diesem Buch bestenfalls an der Oberfläche kratzen, und beschränke mich daher auf etwas über 400 dieser Formulierungen. Statt vierhunderttausend also vierhundert, man hat demnach tausend weggelassen, würde unser Finanzminister sagen. Sie werden somit viele Redewendungen in diesem Buch finden, aber noch viel mehr bleiben außen vor. Ich hoffe, ich enttäusche Sie damit nicht! Das Buch ist nämlich nicht sonderlich dick, aber es ist vielseitig.
Wenn Sie übrigens der Meinung sind, dass ich hier irgendwo Blödsinn geschrieben habe, dann lassen Sie es mich bitte wissen! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dazu durchaus berechtigten Anlass gibt. Aber bitte schreiben Sie mir erst, nachdem Sie selbst ein wenig genauer nachgeforscht haben als zwei Minuten in Wikipedia! Und brechen Sie bitte nicht gleich den Stab über mich, lesen Sie mir nicht die Leviten, und halten Sie mir keine Standpauke, ja? Gleiches gilt für Textteile, mit denen ich jemandem auf die Zehen getreten sein könnte. Dahinter steckt ja keine böse Absicht. Es ist somit nicht nötig, mir darüber eine Gardinenpredigt zu halten. Sagen Sie es mir lieber durch die Blume!
Kurz: Ich lege für die Richtigkeit nicht die Hand ins Feuer, auch wenn ich Ihnen hier kein Seemannsgarn oder Jägerlatein erzähle. Darauf gebe ich Ihnen gerne Brief und Siegel. Und falls mir eine wichtige Redensart durch die Lappen gegangen sein sollte, bin ich auch für einen Hinweis dankbar!
Ansonsten soll dieses Buch einmal mehr vor allem Spaß machen. Nicht alles hier ist bierernst zu nehmen, und wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, wissen Sie auch, wo das jetzt wieder seinen Ursprung hat.
Liebe Ehefrauen! Wenn Sie die Faxen Ihres Mannes dicke haben, dann schlagen Sie dieses Buch auf statt es einfach unter den Tisch fallen zu lassen! Liebe Ehemänner! Wenn Ihre Frau mit diesem Buch herumwedelt, dann führt sie etwas im Schilde. Geben Sie dann am besten Fersengeld, bevor sie Ihnen mit dem Zaunpfahl winkt. Wenn eine Flucht unmöglich ist, dann fügen Sie sich ohne viel Fisimatenten in Ihr Schicksal, Sie können ja doch nicht gewinnen. Hand aufs Herz – wer kann schon gegen die Argumente einer Frau auf Dauer bestehen? Sie sind uns so meilenweit überlegen; da wird man so schnell über den Tisch gezogen, dass man die Reibungshitze auch noch für Nestwärme hält.
Um zu solchen Erkenntnissen zu gelangen, müssen Sie dieses Buch nicht unbedingt von vorne nach hinten lesen. Die einzelnen Kapitel sind weitgehend unabhängig, Sie können also durchaus das eine oder andere überspringen oder von hinten nach vorne lesen (kapitelweise; buchstabenweise ist das mühsam!). Andererseits lohnt sich das vielleicht doch, denn im Buch halte ich mich nicht sklavisch an die Redensarten. Ich halte auch nicht mit kleinen Bonmots hinter dem Berg und schüttle gerne das eine oder andere geschichtliche Faktum frei von der Leber weg aus dem Ärmel. Ich bin mir dabei ziemlich sicher, dass ich damit keine Perlen vor die Säue werfe.
Ich trage da und dort auch das Herz (also meine subjektive Meinung) auf der Zunge. Das sollten Sie bitte nicht dahingehend interpretieren, dass ich felsenfest davon überzeugt wäre, dies sei die einzig richtige Sicht der Dinge! Nein, es ist nur meine, und selbst die ändert sich von Zeit zu Zeit. Eine demokratische und pluralistische Gesellschaft muss verschiedene Meinungen aushalten, ohne dass Aggressionen auftauchen – solange diese Meinungen einigermaßen höflich ausgetauscht werden und einer kritischen Betrachtung wenigstens einigermaßen standhalten, möchte ich hinzufügen. Wenn mir jemand einreden will, dass die Erde flach sei, ist das definitiv nicht mehr der Fall, dann ist meine Grenze der Meinungstoleranz überschritten, da verdrehe ich die Augen zum schönsten Silberblick.
Die Redewendungen in Kapitel und Unterkapitel einzuteilen war vermutlich das Schwierigste an der ganzen Arbeit. Ich befürchte, die Einteilung ist daher entsprechend willkürlich, gleichsam an den Haaren herbeigezogen. Also Kraut und Rüben, wenn Sie so wollen. Damit Sie einen gesuchten Ausdruck trotzdem schnell finden, habe ich (ganz ohne Aufpreis) ein Stichwortverzeichnis eingefügt, in dem die zentralen Worte einer Redewendung mit einer fett gedruckten Seitenzahl versehen wurden, die Sie schnell zum richtigen Unterkapitel bringt. Ein Beispiel gefällig?
Sie suchen eine Erläuterung zur Redewendung „auf den Hund kommen“. Dann ab ins Stichwortverzeichnis, wo Sie hinter dem Wort „Hund“ einige Seitenzahlen finden. Alle, die fett gedruckt sind, verweisen auf eine Redewendung, in der das Wort „Hund“ vorkommt. Also auf Redewendungen wie „auf den Hund kommen“, „Da wird der Hund in der Pfanne verrückt!“ und so weiter.
Übrigens ging es mir beim Schreiben wie den Contact Tracern in einer Pandemie: Man erklärt eine Redewendung und stößt auf zwei bis drei neue, bis man irgendwann den Scheitelpunkt erreicht hat, worauf die gefundenen neuen Redewendungen langsam zurückgehen. Manchmal bricht dann wieder eine Infektionskette aus, dann geht es wieder zurück. Aber ganz auf null kommt man nie. Man erklärt einfach irgendwann das Ganze für beendet, weil das Buch nun wirklich schon dick genug ist.
Genug gequasselt! Bevor ich mich hier noch total verfranze, wünsche ich Ihnen viel Spaß! Und bleiben Sie gesund!
Günter Leitenbauer, April / Dezember 2020
Danksagung
Wie immer hat sich auch diesmal meine liebe Freundin Doris Rettenegger dazu bereiterklärt, das Lektorat zu übernehmen. Das läuft dann so ab, dass ich ihr das Manuskript auf ihren Kindle schicke, worauf sukzessive die Rückmeldungen eintrudeln. Sie findet Fehler, die ich selbst mehrmals überlesen habe. Wenn trotzdem noch welche im Buch sind, habe ich die vermutlich beim Ausbessern der gefundenen Fehler noch schnell hinzugefügt. Ich kann dir für deine Geduld gar nicht genug danken, liebe Doris!
An dieser Stelle möchte ich auch meine Familie, vor allem meine Mutter und meine beiden Söhne lobend erwähnen. Die sind alle so brav und hilfsbereit, dass mir viele Sorgen erspart bleiben und ich den Kopf zum Schreiben frei habe. Ich danke euch dafür, dass ihr da seid. Ihr seid eine Wucht!
Inhalt
Vorwort des Autors
Danksagung
Einleitung
Nehme ich Sie auf den Arm?
Das zieht sich durch die ganze Sache wie ein roter Faden!
Von Rittern, Helden und alten Zeiten
Im Stich lassen
Auf keinen grünen Zweig kommen
Arm wie eine Kirchenmaus
Etwas im Schilde führen
Jemanden in die Schranken weisen
Dir mache ich Feuer unter dem Hintern!
Fersengeld geben
Sich die ersten Sporen verdienen
Ich fühl‘ mich wie gerädert
Aus dem Stegreif
Auf großem Fuß leben
Jemanden ausstechen
08/15
Jemanden abblitzen lassen
In die Bresche springen
Ich kenne meine Pappenheimer!
Alter Schwede!
Die Flinte ins Korn werfen
Jemandem das Wasser abgraben
Pech gehabt!
Aus der Bahn geworfen
Aus heiterem Himmel
Du kannst mir den Buckel runterrutschen!
Mit etwas hinter dem Berg halten
Lunte riechen
Das Heft in der Hand halten
Noch ist Polen nicht verloren!
Händler, Gauner und Gerichte
Das passt mir nicht in den Kram!
Etwas auf dem Kerbholz haben
Jemanden um die Ecke bringen
Von den Pompfinewaran geholt werden
Das ist schon die halbe Miete
Aller guten Dinge sind drei
Dingfest machen
Das ist keinen Deut besser!
Etwas auf die hohe Kante legen
Drakonische Strafen
Jemanden zur Sau machen
Vor die Hunde gehen
Auf den Hund gekommen
Bankrott machen
Schreib dir das hinter die Ohren!
Ich leg‘ für ihn die Hand ins Feuer
In die Brüche gehen
Mit Fug und Recht
Auf den Busch klopfen
Jägerlatein und Seemannsgarn
Man hat ihm etwas angehängt
Jemandem den Garaus machen
Als Prügelknabe dienen
Ein Sündenbock
Jemandem die Leviten lesen
Eine Standpauke halten
Schlitzohr!
Jemandem das Handwerk legen
Über jemandem den Stab brechen
Jemanden hänseln
Stante pede
Der Spießrutenlauf
Der eiserne Vorhang
In Bausch und Bogen
Immer der Nase nach!
Torschlusspanik
Mit der grünen Minna abtransportieren
Hinter schwedischen Gardinen
Jemand türmt
Stiften gehen
Schmiere stehen
Etwas in petto haben
Jemandem eine Gardinenpredigt halten
Den Spieß umdrehen
Kulinarisches und Lukullisches
Etwas ausgefressen haben
Durch den Kakao ziehen
Schokolade bricht das Fasten nicht
In Saus und Braus leben
Das Schlaraffenland
Sein Fett abbekommen
Den Braten riechen
Interessiert mich nicht die Bohne!
Jemanden mit etwas abspeisen
Der Hanswurst
So eine treulose Tomate!
Du kannst ihr nicht das Wasser reichen!
Alles in Butter
Nimm nicht alles so bierernst!
Einen Eiertanz aufführen
Den Löffel abgeben
Bis zur bitteren Neige
Reinen Wein einschenken
Da ist Hopfen und Malz verloren!
Die beleidigte Leberwurst
Ins Bockshorn jagen
Die Landpomeranze
Tomaten auf den Augen haben
Seinen Senf dazugeben
(
Fr)essen wie ein Scheunendrescher
Stell dein Licht nicht unter den Scheffel!
Nicht ganz koscher
Über den Tisch ziehen
Einen hinter die Binde gießen
Keinen Pfifferling auf etwas geben
Das macht das Kraut auch nicht fett!
Weder Fisch noch Fleisch
Abwarten und Tee trinken!
Kraut und Rüben
Jemandem ein Ei legen
Zuckerbrot und Peitsche
Etwas frei von der Leber weg sagen
Kohldampf haben
Ins Kraut schießen
Erbsenzähler
Ich habe mit dir ein Hühnchen zu rupfen!
Animalisches
Da lachen ja die Hühner!
Das ist doch Kokolores!
Danach kräht kein Hahn mehr!
Jemandem die Hammelbeine langziehen
Jemandem einen Bärendienst erweisen
Schlau wie ein Fuchs
Da liegt der Hase im Pfeffer
Ein Pechvogel sein
Flink wie ein Wiesel
Dumm wie ein Esel
Einen Kater haben
Schnapsdrosseln und Schluckspechte
Einen Frosch im Hals haben
Die Katze aus dem Sack lassen
Unter aller Sau und unter aller Kanone
Einen Vogel haben!
Wissen wie der Hase läuft
Alles abklappern
Zur Strecke bringen
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt!
Schwein gehabt!
Du Unglücksrabe!
Rabeneltern
Das geht auf keine Kuhhaut!
Alles für die Katz‘
Seine Schäfchen ins Trockene bringen
Mit den Wölfen heulen
Mich laust der Affe!
Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?
Ein dicker Hund
Mein Name ist Hase
Jemandem einen Bären aufbinden
Klappe zu, Affe tot!
Nur ein Katzensprung
Hol’s der Geier!
Ein Galgenvogel
Das Fell über die Ohren ziehen
Eulen nach Athen tragen
Perlen vor die Säue werfen
Krokodilstränen vergießen
Sei kein Frosch!
Wie die Made im Speck
Im goldenen Käfig sitzen
Das Huhn schlachten, das goldene Eier legt
Wie ein begossener Pudel
Einen Affenzahn draufhaben
Zum Kuckuck!
Einen Bock schießen
Wie der Affe am Schleifstein
Wie ein Dreckspatz aussehen
Ein Schmierfink sein
Den Bock zum Gärtner machen
Frommes und weniger Frommes
Halt endlich die Klappe!
Jemandem einen Korb geben – eine bodenlose Frechheit!
So ein Tohuwabohu!
In der Not frisst der Teufel Fliegen!
Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben
Hokuspokus
Ein Canossagang
Ein Pyrrhussieg
Tacheles reden
Alles Larifari!
Etwas aus dem Ärmel schütteln
Sodom und Gomorra
Zur Salzsäule erstarrt
Lügen, dass sich die Balken biegen
Kalte Füße bekommen
Das knöpfen wir ihr ab!
Kruzitürken!
Jemandem ein Schnippchen schlagen
Die Kirche im Dorf lassen
Alle Wege führen nach Rom
Stein und Bein schwören
Das ist peinlich!
Im siebten Himmel
Er lässt sich nicht lumpen!
Etwas an die große Glocke hängen
Etepetete
Wie ein Berserker wüten
Geld stinkt nicht!
Schweinepriester
Eine Goschen wie ein Schleifer
Den Teufel an die Wand malen
In Teufels Küche – der Satansbraten
Zielwasser trinken
Buchstäbliches und Namentliches
Ein Buch aufschlagen
Keine Fisimatenten machen
Sich verzetteln – oder etwas anzetteln
Das kann kein Schwein lesen!
Hinz und Kunz
Sich total verfranzen
Darauf geb‘ ich dir Brief und Siegel!
Etwas unter den Tisch fallen lassen
Die Pechsträhne
Die Faxen dicke haben
Das sind doch Kinkerlitzchen!
Nach Schema F
Alte Zöpfe abschneiden
Weg vom Fenster
Der fackelt nicht lange!
Etwas aus dem Effeff beherrschen
Sich einen Reim auf etwas machen
Not am Mann
Völlig abgebrannt sein
Geld auf den Kopf hauen
Ein armer Schlucker
Etwas durch die Blume sagen
Unter die Haube kommen
Das ist eine hanebüchene Geschichte
Das Brett vorm Kopf
Jemandem auf den Leim gehen
Ein X für ein U vormachen
Durch die Lappen gehen
Manschetten haben
Ins Fettnäpfchen treten
Toi toi toi!
Den Kürzeren ziehen
Das geht mir über die Hutschnur!
Sei kein Korinthenkacker!
Spießgesellen
Reinen Tisch machen
Firlefanz!
Auf Tuchfühlung gehen
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Das also war des Pudels Kern!
Etwas abkupfern
Dreck am Stecken haben
Ein Buch mit sieben Siegeln
Mumpitz!
Lügen wie gedruckt
Jemanden zur Minna machen
Hangover
Auf den Putz hauen
Böhmische Dörfer
Das kommt mir spanisch vor!
Etwas springen lassen – mit klingender Münze bezahlen
Die Stilblüte
Unterwegs
Auf dem Holzweg sein
Den Rubikon überschreiten
Sich ins Zeug legen
Etwas Revue passieren lassen
Potemkin’sches Dorf
Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer
Darüber scheiden sich die Geister
Wolkenkuckucksheim
Mit der Tür ins Haus fallen
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!
Mit dir werde ich Schlitten fahren!
Aus allen Wolken fallen
Seine Siebensachen packen
Trittbrettfahrer
Bahnhof verstehen
In die Ferne schweifen
Siebengescheit und neunmalklug!
In den April schicken
Anatomisches
Einen Pferdefuß haben
Im Handumdrehen
Etwas übers Knie brechen
Einen Zahn zulegen
Jemanden auf dem falschen Fuß erwischen
Jemandem die Daumen drücken
Das sagt mir das Bauchgefühl
Jemandem eine lange Nase drehen
Jemanden auf den Arm nehmen
Da rutscht einem das Herz in die Hose
Der Schalk im Nacken
Sich jemanden vom Hals halten
Sich den Mund (das Maul) zerreißen
Sich den Mund (das Maul) verbrennen
Sicher wie in Abrahams Schoß
Jemandem freie Hand lassen
Jemandem Daumenschrauben anlegen
Ungeschoren davonkommen
Jemanden an der Nase herumführen
Das Gesicht wahren (verlieren)
Jemandem auf der Nase herumtanzen
Holzauge sei wachsam!
Jemandem auf die Pelle rücken
Wie aus dem Gesicht geschnitten
Jemanden übers Ohr hauen
Jemandem auf den Zahn fühlen
Einen an der Waffel haben
Mundtot machen
Wie Schuppen von den Augen fallen
Dem geht der Arsch auf Grundeis!
Du kannst mich buckelfünfern!
Du Zimtzicke!
Kein Haar krümmen
Haare auf den Zähnen
Hals über Kopf
Mit dem falschen Fuß zuerst aufstehen
Von langer Hand planen
Sich in die Haare geraten (kriegen)
Wenn das Blut in den Adern gefriert
Blaues Blut
Aus der Schule geplaudert
Unter aller Kanone
Aus der Schule plaudern
Zart besaitet
Die Würfel sind gefallen
Radebrechen
Lehrgeld zahlen
Etwas bleibt immer hängen!
Im Dreieck springen
Ein ungehobelter Kerl
Der hat das Pulver auch nicht erfunden!
Einen Stiefel zusammenrechnen (-reden)
Grips haben
Alle Register ziehen
Jemandem einen Denkzettel verpassen
Sein Scherflein beitragen
Nach Adam Riese
Daumen mal Pi
Hinters Licht geführt
Eine Eselsbrücke bauen
Die Gretchenfrage stellen
Ach du grüne Neune!
Nicht viel Federlesens machen
Nicht alle Tassen im Schrank
Tiefe Wasser und dunkle Wälder
Mit allen Wassern gewaschen
Klar Schiff machen
Oberwasser haben
Vor Neid platzen
Etwas ausbaden müssen
Jemanden eintunken
Wasser hat keine Balken
… das sich gewaschen hat!
Eine Hand wäscht die andere
Es ist etwas im Busch
Von etwas Wind bekommen
Jemanden ausbooten
Vom Regen in die Traufe
Ein Schlag ins Wasser
Jemandem ins Gehege kommen
Ein Glückspilz!
Durch den Wind sein
In die Binsen gehen
Binsenweisheit
Zu nah am Wasser gebaut
Sich freuen wie ein Schneekönig
Das Gras wachsen hören
Bunt gemischt
Blau machen
Rot sehen
Etwas durch die rosarote Brille sehen
Keinen roten Heller wert
Rote Zahlen schreiben
Schwarzer Humor
Jedes Wort auf die Goldwaage legen
Ein Silberstreif am Horizont
Schwarze Magie
Grau ist alle Theorie
Die graue Eminenz
Eine weiße Weste haben
Die weiße Fahne hissen
Es ist nicht alles Gold was glänzt
Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?
Über den grünen Klee loben
Gelb vor Neid sein
Der blaue Brief
Nur gemischt, nicht bunt
Etwas daher faseln
Mehrere Eisen im Feuer haben
Jemanden auf den Schlips treten
Du Tollpatsch!
Die Kuh vom Eis holen
Ins Gras beißen
Auf die Folter spannen
Immer wieder die alte Leier
Die reinste Heimsuchung
Mit Kind und Kegel
Über die Stränge schlagen
Außer Rand und Band
Etwas auf dem Kasten haben
Der Groschen ist gefallen
Steinreich sein
Der Wink mit dem Zaunpfahl
Schindluder treiben
Abgebrüht oder ausgekocht sein
Sich verhaspeln
Mein lieber Herr Gesangsverein!
Auf dem Präsentierteller liegen (sitzen)
O tempora, o mores!
Aus dem Schneider sein
Vor Wut schäumen
Auf die Barrikaden gehen oder steigen!
Jemanden über den Löffel barbieren (oder balbieren)
In der Kreide stehen / jemandem etwas ankreiden
Die Galgenfrist
Enterisch!
Alles unter einen Hut bringen
Ein heißes Eisen anfassen (anpacken)
Spitz auf Knopf stehen
Auf die lange Bank schieben
Durch die Bank
Auf Nadeln sitzen
Ein schwebendes Verfahren
Auf (unter) den Nägeln brennen
Sich an einen Strohhalm klammern
Der Silberblick
Eine Leiche im Keller haben
Sich breitschlagen lassen
Die Feuerprobe
Der Drahtzieher
Stichwortverzeichnis
Weitere Bücher des Autors
„Viele Worte sind lange zu Fuß gegangen, ehe sie geflügelte Worte wurden.“
Marie von Ebner-Eschenbach
(1830 - 1916)
Einleitung
Nehme ich Sie auf den Arm?
Nur, wenn Sie nicht allzu schwer sind. Die Grenze liegt dabei etwa beim Gewicht einer Hauskatze. Aber nicht einmal diese Stubentiger nehme ich gerne auf den Arm, weil ich allergisch gegen Katzen bin. Genaugenommen gegen ihre Epithelzellen, die mich innerhalb kürzester Zeit zum Niesen bringen, meinen Augen eine Färbung verleihen, die Dracula vor Neid noch blasser werden ließe, und, wenn es mich ganz schlimm erwischt, und die Katze vorher nicht mit 120 bar gegen den Strich gekärchert worden ist, bekomme ich auch noch Kopfschmerzen und Juckreiz am ganzen Körper.
Aber ein ganz klein wenig nehme ich Sie in diesem Buch doch auf den Arm. Im „übertragenen Sinne“, wie man so sagt. Und dieses gerade in Österreich so allgegenwärtige „Wie man so sagt!“ ist der sich durch dieses ganze Buch ziehende rote Faden, der ja selbst schon wieder einer Erklärung bedarf, für die wir ein Stück weit in die Vergangenheit reisen müssen.
Das zieht sich durch die ganze Sache wie ein roter Faden!
Tatsächlich findet sich dieses Idiom beim guten, alten Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe. Dieser schrieb seine „Wahlverwandtschaften“, einen schwer in eine Epoche oder Kategorie einzuordnenden Roman, im Jahre 1809. Die Handlung ist zwar schnell zusammengefasst, doch wird keine Zusammenfassung dem Werk gerecht. Ist ja auch irgendwie logisch: Wenn es da und dort kürzer auch gegangen wäre, hätte der alte Fuchs das schon selbst so geschrieben. Aber egal: Es geht um ein abgeschieden lebendes Paar, dessen Ehe das Auftreten zweier neuer Personen auf Dauer nicht übersteht. Das Auseinanderzerren und Verdrängen zieht sich dabei wie ein roter Faden durch das ganze Werk, und genau diesen Faden beschreibt Goethe darin auch:
„Wir hören von einer besonderen Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, dass sie der Krone gehören.“
Goethe, vor allem sein „Faust“, ist ja sowieso eine Fundgrube für Sprüche. Wer dieses Buch im Haus hat, spart sich meines, denn in Bezug auf Redewendungen ist der „Faust“ des Pudels Kern. Wir werden ihm also dann und wann auf jeden Fall noch begegnen.
Wenn wir noch bedeutend weiter in der Geschichte zurückgehen, landen wir beim ebenfalls roten Faden der Ariadne, die eine Tochter des kretischen Königs Minos war, und welche diesen Faden ihrem Helden, dem tapferen Helden Theseus, schenkte. Der rollte den Faden bei seinem Eindringen in das Labyrinth ab, in dem sich der Minotauros befand. Nachdem Theseus den Minotauros getötet hatte (was die eigentliche Heldentat war), fand er entlang des Fadens dann auch den Rückweg in Ariadnes Arme wieder. Jedoch war den beiden kein dauerhaft‘ Glück beschieden, wie wir spätestens seit Richard Strauss‘ Oper „Ariadne auf Naxos“ wissen, zu der übrigens Hugo von Hofmannsthal das Libretto geschrieben hat. Theseus ließ die Arme auf Naxos nämlich einfach im Stich. Glücklicherweise verliebte sich der Weingott Dionysos in sie und ehelichte die Unglückliche. Ihr Diadem schleuderte er in den Himmel, wo es zum Sternbild „Corona borealis“, also der nördlichen Krone wurde. Das war zu Zeiten, als „Corona“ noch ein Sternzeichen und kein Bier – und schon gar kein Virus – war.
Wir sollten ja froh sein, dass es so kam, denn einer der Söhne der beiden war Oenopion, der legendäre König von Chios, dem man die Verbreitung der Kunst des Kelterns zuschreibt. Weinhersteller nennt man deshalb noch heute Önologen.
Und so läuft das auch in diesem Buch. Ich leite mehr oder weniger gekonnt von einem Thema zum anderen über (fragen Sie nicht, wie lange ich für manche Überleitungen nachdenken musste), und versuche dann die Herkunft eines auf diese Weise ganz unauffällig eingestreuten Idioms, Aphorismus‘ oder sonst irgendwie (be-)merkenswerten Ausdrucks zu beleuchten. Dabei wird keine auf den ersten Blick erkennbare Reihenfolge sichtbar, lediglich eine grobe thematische Ordnung. Wenn Sie jedoch auf den zweiten, dritten oder meinetwegen auch dreizehnhundertzwölfundneunzigsten Blick ein richtiges System finden, dann lassen Sie es mich wissen! Dann hat mich eine höhere Macht anscheinend doch nicht im Stich gelassen, denn bewusst habe ich selbst hier keine Reihenfolge eingebaut.
Falls Sie aber eine pedantische Natur sein sollten, dann verweise ich Sie auf das Stichwortverzeichnis, in dem alle hier vorkommenden Aphorismen alphabetisch angeführt sind. Mir sagt man einen Ordnungsfimmel ja auch immer nach, aber das ist Unsinn. Ich hasse es einfach nur, wenn nicht alle Bleistifte am Schreibtisch nach Größe geordnet, parallel und mit der Schrift nach oben in gleichen Abständen sortiert vor mir liegen. Das hat mit Pedanterie rein gar nichts zu tun!
Von Rittern, Helden und alten Zeiten
Sehr viele unserer heutigen Sprichwörter und Redewendungen haben ihre Wurzeln im Mittelalter. Ein beträchtlicher Teil davon kommt aus der Welt der Ritter, wohl weil außer den Mönchen bestenfalls diese Schichten des Schreibens und Lesens mächtig waren. Und so beginnt auch das vorliegende Buch eher kriegerisch, aber keine Angst, es wird in der Folge dann auch noch andere Gebiete abdecken; ich werde Ihre Erwartungen diesbezüglich erfüllen. Versprochen!
Im Stich lassen
Wenn Sie brav lesen, werde ich immer an Ihrer Seite sein, um Ihre Fragen zu beantworten, ganz wie im Mittelalter ein braver Knappe an der Seite seines Ritters zu sein hatte.
War er das nicht, hatte der Ritter ein Problem. Zumindest, wenn er im Schlachtengetümmel vom Ross stürzte. In seiner Rüstung war er am Boden nämlich ziemlich unbeweglich und hilflos. Half ihm der Knappe nicht schnellstens wieder auf die Beine und in der Folge auch aufs Schlachtross, dann war der Ritter den Lanzen und Piken der Feinde hilflos ausgeliefert. Und die wussten nur zu gut, wo und wie man zwischen den Teilen der Rüstung hindurchstechen konnte. Ein hilflos am Boden liegender Ritter war also vom Knappen „im Stich der Feinde gelassen worden.“
Gegen Ende des Mittelalters wurden diese Rüstungen immer schwerer, weil auch die Waffen immer effektiver wurden. Eine Armbrust entwickelte vor allem auf kurze Entfernung eine Durchschlagskraft, der so eine Rüstung kaum etwas entgegenzusetzen hatte. Und als im Spätmittelalter die Feuerwaffen ihren Siegeszug feierten, war die Zeit der Ritter endgültig vorbei.
Ein Ritter war dabei die niedrigste Form des Adeligen. Oft hatten diese kein eigenes Lehen, hatten also selbst kein vom König leihweise überlassenes Land, und waren darauf angewiesen, sich ihren Unterhalt entweder durch Raub oder durch Söldnerdienste bei ihrem Lehnsherren zu verdienen. Viele von ihnen kamen so tatsächlich ihr ganzes Leben lang auf keinen grünen Zweig.
Auf keinen grünen Zweig kommen
Ich schreibe jetzt das dreizehnte Buch, aber auf einen grünen Zweig bin ich mit den zwölf Büchern davor zumindest finanziell nicht gekommen. Aber ich schreibe sie ja auch nicht, um reich zu werden, sondern weil es mir Spaß macht. Und einen wirklichen grünen Daumen hatte ich sowieso noch nie.
Für die Herkunft dieser Redensart gibt es übrigens mindestens drei Erklärungsversuche. Ist man religiös, dann schlägt man die Bibel auf und findet bei Hiob, Kapitel 14, Vers 7-9:
Ein Baum hat Hoffnung, wenn er schon abgehauen ist, daß er sich wieder erneue, und seine Schösslinge hören nicht auf. Ob seine Wurzel in der Erde veraltet und sein Stamm im Staub er-stirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und wächst daher, als wäre er erst gepflanzt.
Wenn also kein grüner Zweig austreibt, hat man keine Hoffnung.
Dieser Erklärungsversuch ist aber vermutlich falsch und schlicht und einfach an den Haaren herbeigezogen. Schon näher an der Wahrheit ist da die Erklärung, dass grüne Zweige seit jeher ein Symbol der Fruchtbarkeit seien. So hat man früher neu hinzugekommenen Nachbarn, also neuen Hausbesitzern, ein Stück Erde mit einem grünen Zweig überreicht, als Symbol des Willkommens gleichsam.
Das ist nur nicht die Erklärung, sondern ebenfalls schon ein Brauch, der auf der tatsächlichen Herkunft fußt. Der grüne Zweig war nämlich in Zeiten des Feudalismus das Symbol, das der Lehnsherr seinem Gefolgsmann überreichte, wenn er ihm ein Lehen, also ein Stück Land samt der darauf wohnenden hörigen Bevölkerung überließ. Erst später wurde daraus der rechtswirksame Brauch, beim Kauf eines Hauses ein Stück Rasenscholle mit einem Zweig darin als Bekräftigung des Vertragsabschlusses zu übergeben.
Wer demnach nie so ein Lehen oder Haus erwerben konnte, war „auf keinen grünen Zweig gekommen.“ Der war und blieb arm wie eine Kirchenmaus.
Arm wie eine Kirchenmaus
Diese Redewendung dürfte ursprünglich aus Großbritannien kommen. Es heißt dort tatsächlich „to be as poor as churchmice“. Manchmal darf man also tatsächlich wörtlich übersetzen. Aber wovon kommt dieser Spruch nun?
Im Mittelalter ernährten sich die Mäuse vor allem von den Vorräten der Menschen. Sie nisteten daher gerne in Vorratskammern von Häusern. In den Kirchen allerdings gab es keine Vorräte. Wenn eine Maus ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie Wahl des Wohnortes nun unklug ausübte und ihre Zelte in einer Kirche aufschlug, hatte das ein Problem bezüglich der Grundversorgung mit Nahrungsmitteln zur Folge. Diese Kirchenmaus war tatsächlich sehr arm.
In unseren kollektiven Sprachschatz führte dieses Sprichwort vermutlich Dostojewski wieder ein, als er in seinem Buch „Der Spieler“ schrieb:
„Alles, was ich besitze, ist ihm verpfändet; ich bin arm wie eine Kirchenmaus!“
Aber vielleicht ist unsere Maus ja umgezogen und hat sich verbessert. Ende gut, alles gut. Dieses Sprichwort kommt übrigens wie Dostojewski aus Russland und muss nicht erklärt werden. Und es beschreibt den Lebenslauf des Schriftstellers ziemlich gut:
Fjodor Michailowitsch Dostojewski stammt aus dem weißrussischen Dorf Dostojewo. Sein Vater war Arzt, seine Mutter kam aus wohlhabenden Verhältnissen. Aber was für den jungen Fjodor (manchmal auch Fedor geschrieben) wichtiger war: Seine Eltern legten Wert auf die Ausbildung ihrer insgesamt acht Kinder. Als der junge Mann knapp 18 war, starben innerhalb eines Jahres beide Elternteile. Seine Mutter an Tuberkulose, sein Vater an einem Schlaganfall. Anschuldigungen seines Bruders, dass ein Leibeigener seinen Vater erschlagen hätte, verarbeitete der Schriftsteller später in seinem berühmten Roman „Die Brüder Karamasov“. Er hatte mittlerweile eine Offizierskarriere eingeschlagen und begann ab etwa 1843 mit dem Schreiben. Darüber kam er auch in Kontakt mit dem Sozialismus, und das führte schließlich 1849 zu seiner Verhaftung und einem Todesurteil, da war er gerade einmal 28 Jahre alt.
Am 22. Dezember 1849 führte man die Delinquenten zum Erschießungsplatz und band sie an die Pfähle. Als sie sich bereits sicher waren, hingerichtet zu werden, verlas man einen Erlass, der ihre Urteile in acht Jahre Lagerhaft, Degradierung und danach Dienst als „gemeiner Soldat“ umwandelte. Dieser Erlass hatte zu diesem Zeitpunkt schon über einen Monat Gültigkeit, aber man zog es vor, die Delinquenten der Qual einer Scheinhinrichtung zu unterziehen. Die Russen waren damals eben nicht zimperlich.
Übrigens hat der Österreicher Stefan Zweig diese qualvollen Stunden Dostojewskis später in seinem Werk „Sternstunden der Menschheit“ aufgegriffen.
Dostojewski verbrachte fünf Jahre in einem Lager in Sibirien. Er durfte nicht schreiben und war die ganze Zeit in Ketten. 1854 wurde er dann zum Militärdienst überstellt, ebenfalls in Sibirien. Erst 1857 bekam er seine Bürgerrechte zurück und begann dann wieder zu schreiben. Nach einigen Petitionen an den Zaren durfte er erst 1859 wieder in sein geliebtes St. Petersburg zurückkehren. Mittlerweile war Zar Nikolaus I. gestorben, und das Klima war etwas liberaler geworden. Es gab sogar Ansätze einer freien Presse. Nun erst entstanden auch seine großen Romane, von denen „Schuld und Sühne“ und „Die Brüder Karamasov“ sicherlich am berühmtesten wurden.
Der Epileptiker Dostojewski starb schließlich mit nicht einmal 60 Jahren an einer Lungenblutung. Seine Werke waren auch bei Lenin und vor allem Stalin nicht sehr beliebt, wie alles, was gesellschaftskritische Ansätze hatte, die sich nicht ein rein kommunistisches Mäntelchen übergeworfen hatten. Unter Chruschtschow wurde er dann aber sogar mit einer Briefmarke bedacht. Einer Art postalischem Wappen quasi. Und das bringt uns zum nächsten geflügelten Wort.
Etwas im Schilde führen
Meine Mutter erkannte immer gleich, wenn ich den Schalk im Nacken hatte, etwas ausheckte – kurz: einen Streich plante. „Du führst etwas im Schilde, stimmt’s?“ Ich weiß nicht, woher Mütter diese Gabe haben. Vielleicht nimmt man ja die Mädchen irgendwann in ihrer Kindheit zur Seite, und es verrät ihnen eine Hohepriesterin der Mimik die Geheimnisse der variierenden Gesichtsausdrücke. Eine Gabe, derer wir Männer nicht würdig sind. Und das nützen die Frauen dann ein Leben lang aus und wissen einfach immer, wenn wir etwas zu verheimlichen haben, wenn etwas im Busch ist. Also am besten gar nichts verbergen wollen, man kann auch mit der Wahrheit trefflich lügen. Wie das geht? Einfach dabei lachen, wenn die Angebetete fragt, ob man wieder mit dem Karli zechen war (war man tatsächlich) und man entgegnet: „Ja klar, ich hab‘ ja sonst nichts zu tun!“ Das sichert den häuslichen Frieden.
Dabei ist die Herkunft des Spruchs „etwas im Schilde führen“ alles andere als friedlich.
Im Mittelalter waren Schilde längst nicht nur mehr reine Schutzeinrichtungen. Auf ihnen trug man auch mit einem Wappen zur Schau, wer man war – und wem man folgte, zu wem man gehörte. Da war schon von weitem sichtbar, wessen Zeichen „man im Schilde führte“. Das ist aber doch etwas Positives, warum hat dann dieser Spruch so einen negativen Touch?
Der Grund ist, dass der Spruch weniger von den offensichtlich auf dem Schild zur Schau getragenen Zeichen kommt, sondern vielmehr davon, dass man den Schild nicht nur als Schutz verwenden konnte. Man konnte dahinter vor allem auch recht gut die eine oder andere Waffe verbergen, sie also „im Schilde führen“. Und wenn der Gegner das nicht rechtzeitig bemerkte, konnte man ihn mit diesen Waffen in seine Schranken weisen.
Jemanden in die Schranken weisen
Der englische Begriff für „Eisenbahn“, also „railroad“, tauchte bereits in den 1730er Jahren erstmals auf. Ab dem 19. Jhdt. begann man, damit Güter auf kurzen Strecken zu transportieren, vor allem Kohle. Den Personentransport erfand man natürlich in England, wo 1821 die erste „tramroad“, noch als Pferdeeisenbahn, zwischen Stockton und Darlington gebaut und auf Anregung Stephensons „railroad“ genannt wurde. Da war es nicht mehr weit bis zur ersten dampfbetriebenen Eisenbahn, und die konnte man nicht so schnell zum Stehen bringen, wenn sie einmal dahinrollte. Weshalb man dort Schranken bauen musste, wo die Eisenbahn eine Straße kreuzte.
Nur hat das mit dem Sprichwort kaum etwas zu tun, aber das dachten Sie sich schon, oder? Die „Schranken“ allerdings, die man an den Bahnübergängen baute, ähnelten denen, die man bei mittelalterlichen Ritterturnieren zwischen den Laufbahnen der gegeneinander auf ihren Pferden anstürmenden Ritter verwendete. Diese Lanzenstechereien zu Pferde nannte man Tjosts. Und weil man jedem teilnehmenden Ritter erst einmal zeigen musste, welche Bahn für ihn bestimmt war, ihn also „in die Schranken wies“, in denen er seinen ehrenhaften Kampf auszuführen hatte, bekam dieses Idiom seinen einschränkenden (Verzeihung für dieses Wortspiel!) Charakter.
Wenn man heutzutage jemanden in seine Schranken weist, dann tut man nichts anderes als ihm zu erklären, nach welchen Regeln ein Spiel funktioniert, in welchen definierten Bahnen er bleiben muss, um ehrenhaft zu kämpfen. Und wenn der Gute sich nicht daran hält, dann macht man ihm eben ein wenig Feuer unter dem Hintern.
Dir mache ich Feuer unter dem Hintern!
Unsere deutsche Variante ist ja noch relativ friedlich. Die Engländer streben da schon eine drastischere Lösung an: „to put a bomb under his ass“. Andererseits geht’s da vielleicht sogar schmerzloser, weil schneller.
Dabei ist die ursprüngliche Bedeutung ganz friedlich.
Haben Sie schon einmal eine alte Burg besucht? Sicher haben Sie das! Dabei ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wie eng und klein in so einer Burg die Räume und vor allem auch die Fenster sind. Das hat nur zum Teil damit zu tun, dass die Menschen damals im Schnitt 15-20 Zentimeter kürzer waren als wir. Vielmehr waren Burgen auch sehr schlecht zu heizen, und das war doppelt schlimm, weil es ab etwa 1400 auch noch einmal kälter wurde, man spricht von der „kleinen Eiszeit“. Diese endete dann im 19. Jahrhundert, es war also über 400 Jahre lang deutlich ungemütlicher, als wir es heute gewöhnt sind.
Fazit: Es war kalt, feucht und dunkel in so einer Burg, und das nicht nur im Winter. Geheizt wurden nur ganz wenige Räume, und die Wärme durch große Fenster ins Freie entfliehen zu lassen wäre blanker Luxus gewesen. Wenn es kalt war, behalf man sich eben mit Decken.
Oder mit heißen Steinen. Diese wickelte man in Decken ein (oder gab sie in ein kleines Fass) und setzte sich darauf. Wenn der Diener dem Herrn oder der Frouwe auf diese Weise „Feuer unter dem Hintern“ machte, dann weckte das schon einmal die Lebensgeister und die Tatkraft des Ritters beziehungsweise seiner Gemahlin. Und davon kommt unsere heutige Interpretation.
Nur waren agile Ritter nicht immer das, was man brauchen konnte. Wenn so ein Ritter dann auch noch betrunken oder schlechter Laune war, dann war es manchmal besser, rasch Fersengeld zu geben.
Fersengeld geben
Wissen Sie, was ein „Farre“ ist? Nein? Ich wusste es auch nicht, bevor ich versuchte, die Bedeutung dieses Spruchs zu ergründen. Ein Farre war im Mittelalter ein junger Bulle, also ein Rindvieh. Und eine junge Kuh war demnach eine „Färse“; den Ausdruck hätte ich sogar gekannt.
Wenn eine Frau einen Mann heiratete, weil sie dachte, dass er ein mächtiger Bulle werden würde, kam sie später manchmal darauf, dass sie wie eine dumme Kuh gehandelt hatte. Nur kam man damals aus einer Ehe nur sehr schwer wieder heraus. Es gab aber Gegenden, vor allem im Sachsen des 13. Jahrhunderts, wo es dafür Möglichkeiten und Regeln gab – diese Regelung findet sich sogar im „Sachsenspiegel“ von 1230, einer der bekanntesten Gesetzessammlungen des Mittelalters. Damit die Frau ihren Mann verlassen durfte, musste sie ihm den Gegenwert einer Kuh ersetzen. Also „Färsengeld“ geben. Das waren damals etwa drei Schillinge, die diese Frau vom Leben mit ihrem Ochsen erlösen konnten. Sie gab ihm dieses Färsengeld und suchte das weite. Und diese Bedeutung hat es heute noch: Abhauen!
Manche glauben auch, es könnte davon kommen, dass man von fliehenden Soldaten nur noch die Fersen sah, und dass diese, wenn man sie erwischte, ein „Fersengeld“ bezahlen mussten, um der üblichen Strafe für Deserteure zu entgehen. Und vielleicht stimmt das auch, ist dann aber wohl nur eine Weiterentwicklung des „Färsengeldes“.
Auf jeden Fall hat die Frau, wenn sie das Geld für die Kuh hatte, Schwein gehabt. Und ihr verlassener Ehemann etwas zu essen. Oder zumindest die Milch der Kuh, um daraus Käse und Butter zu machen. Als Ehemann hatte er sich seine ersten Sporen verdient, wenn man so will.
Wenn Sie das nächste Mal vor irgendetwas oder irgendjemandem die Flucht ergreifen, dann denken Sie daran, wie billig Sie heutzutage davonkommen!
Sich die ersten Sporen verdienen
Wer sich in unserer Zeit im Beruf seine ersten Sporen verdient hat, ist endlich jemand. Das war auch früher nicht anders, zumindest nicht bei den Rittern. Doch die Ausbildung zum berittenen Kämpfer dauerte lange und war zumeist nur Kindern von Adeligen vorbehalten, die damit immerhin eine geregelte Ausbildung erhielten, während die allgemeine Schulpflicht ja erst viel später (in Österreich unter Kaiserin Maria Theresia bzw. Kaiser Joseph II.) eingeführt wurde.
Wie verlief nun dieser Weg eines angehenden Ritters?
Mit etwa sieben Jahren wurde der Junge von seiner Familie zu einer befreundeten Adelsfamilie geschickt, wo er zunächst einmal etwa sieben Jahre als Page diente. Wenn er sehr viel Glück hatte, kam er an einen Fürstenhof, denn dort war die nun folgende Ausbildung am besten – und die Karrierechancen am größten. Aber die meisten kamen lediglich zu einem anderen Ritter. Das war ja, wie bereits erwähnt, der niedrigste Adelsstand damals. Dann kamen die Freiherren (Barone), die Grafen und ganz oben die Herzoge bzw. die Fürsten.
Die Pagenzeit war vermutlich die angenehmste Zeit während der Ausbildung. Man lehrte ihn die ritterlichen Tugenden, zu denen neben dem Reiten, Bogenschießen, Ringen, und so weiter auch die feinen Manieren zu Tisch, das Lesen und Schreiben und oftmals sogar das Musizieren und etwas Rhetorik gehörten. Diesen Teil der Ausbildung übernahmen oft die Geistlichen und die Dame des Hauses.
Mit etwa 14 Jahren wurde aus dem Pagen ein Knappe. Für die Ausbildung war nun in erster Linie der Burgherr (Ritter) zuständig. Der angehende Ritter wurde in die Feinheiten der Jagd, der Pferdepflege, des Kampfes mit scharfen Waffen und auch der Behandlung der daraus unweigerlich folgenden Wunden eingewiesen. War der Ritter in einer Schlacht, zog der Knappe mit. Fiel der Ritter vom Pferd, musste er dem Wehrlosen wieder in den Sattel helfen, was im Schlachtengetümmel zumeist eine lebensgefährliche Aufgabe war. Der Knappe war also mehr als ein Lehrling, er war auch eine Art Beschützer und nächtigte vor allem in der Fremde meist vor der Tür des Zimmers, in dem sein Herr lag, um etwaige Anschläge vereiteln zu können.
Nach weiteren sechs bis sieben Jahren als Knappe war der junge Mann bereit für den Ritterschlag, wie es ab dem Spätmittelalter hieß, wo dieser die bis dahin übliche, deutlich aufwändigere „Schwertleite“ ersetzte. Diese Zeremonie lief wie folgt ab:
Zuerst nahm der angehende Ritter ein Bad, um seine Sünden abzuwaschen. Das war damals der einzig vorstellbare Zweck eines Bades, denn die Meinung, dass das Baden Körper und Geist verweichlichte, war weit verbreitet. Das Mittelalter muss olfaktorisch die reine Hölle gewesen sein!
Dann verbrachte er die ganze Nacht betend in einer Kapelle. Und zwar wach, er durfte keinesfalls einschlafen. Er hielt also wörtlich „Wache“. Auch das gehörte zum Reinigungsritual. Erst ein von allen Sünden gereinigter und geläuterter Mann war würdig, in den Ritterstand erhoben zu werden. „Läutern“ kommt ja vom mittelhochdeutschen Wort „luter“, das so viel wie „gereinigt“, „gewaschen“ oder auch „rein“ bedeutet. „Aus lauter Liebe“ heißt also eigentlich „aus reiner Liebe“.
Am nächsten Morgen folgte dann die obligate Morgenmesse. Danach wurde der Jüngling eingekleidet. Ein rotes Wams erinnerte ihn an die Pflicht, für seinen jeweiligen Lehnsherren unter Einsatz seines Lebens (Blutes) zu kämpfen, schwarze Strümpfe mahnten ihn, immer auf den Tod vorbereitet zu sein, und ein weißer Gürtel sollte ihn daran erinnern, bis zu seiner Ehe keusch zu bleiben.
Und dann brauchte es noch einen höherrangigen Adeligen, der ihm im Rahmen eines Festakts feierlich Schwert und Sporen überreichte – und es bedurfte natürlich auch eines Geistlichen, der ihn segnete. Nun war er ein Ritter und hatte sich seine Sporen wahrlich verdient.
Später vereinfachte man das ein wenig, indem man die Schwertleite durch den Ritterschlag ersetzte, bei dem der hohe Adelige symbolisch Hals oder Schulter mit dem Schwert berührte:
„Nimm diesen Schlag. Es soll der letzte sein, den du je hinnehmen musst!“
Ich vermute, der Ritter war dann ziemlich müde. Er muss sich nach geschätzten 40 Stunden ohne Schlaf wie gerädert gefühlt haben.
Ich fühl‘ mich wie gerädert
Wenn Sie zart besaitet sind, sollten Sie dieses Kapitel besser überspringen. Ich würde es auch nicht den Kindern zum Einschlafen vorlesen, es sei denn, Sie möchten wie ein angehender Ritter die ganze Nacht wach bleiben; denn dieses Sprichwort kommt von einer der grausamsten Strafen, die das Mittelalter und die frühe Neuzeit kannten. Tatsächlich stammt der letzte bekannte Fall, bei dem ein Delinquent gerädert wurde, aus Preußen 1841.
Rädern war eine Todesstrafe, deshalb wurde sie auch für fürchterliche Delikte wie Straßendiebstahl verhängt. Gut, auch für Mord, aber in erster Linie war das Rädern etwas für Straßendiebe. Diese wurden dabei öffentlichkeitswirksam auf einer Art Bühne mit weggespreizten Gliedmaßen auf einen speziellen Tisch geschnallt, wobei man unter ihren Beinen und Armen noch eine Art Gegenlager (scharfkantige Querhölzer) montierte. Dann nahm der Henker ein großes, eisenbeschlagenes Wagenrad und zertrümmerte, bei den Füßen beginnend und sich langsam hocharbeitend, die Knochen und Gelenke, indem er das schwere Rad auf die Knochen heruntersausen ließ.
„Aufs Rad geflochten“ wurden dann oftmals die Delinquenten zusätzlich auch noch, indem man die nach dem Brechen sehr flexiblen Gliedmaßen durch die Speichen eines großen Rades fädelte, dort festband und das Rad mit dem noch lebenden (manchmal auch nicht mehr lebenden) Delinquenten öffentlich zur Schau stellte, bis er nach Stunden oder Tagen endlich starb.
Begraben wurden die auf diese Weise hingerichteten Übeltäter normalerweise nicht. Den Leichnam überließ man den Raben und den Hunden. Und weil nicht bestatteten Seelen der Eintritt ins Himmelreich laut katholischem Glauben verwehrt ist, war das in den Augen der Öffentlichkeit sogar das Schlimmste an der gesamten Strafe.
Ganz, ganz selten überlebten die Bestraften diese Prozedur. Das sah man dann als Gottesurteil an, und sie wurden freigelassen. Es gibt sogar medizinische Aufzeichnungen über die Behandlung ihrer Verletzungen, dennoch blieben die Armen mit Sicherheit für den Rest ihres Lebens Krüppel.
Wer sich also heute „wie gerädert“ fühlt, übertreibt in den meisten Fällen schamlos. Dazu braucht man nicht einmal dieses Buch zu lesen, das kann man aus dem Stegreif sagen.
Aus dem Stegreif
Als Kind dachte ich – wie vermutlich viele andere auch – dass diese Floskel etwas mit „stehen“ und „greifen“ zu tun haben müsse, konnte mir aber keinen rechten Reim darauf machen. Was auch logisch ist, denn damit hat es genau gar nichts zu tun, sondern vielmehr mit dem Sitzen. Und zwar mit dem Sitzen im Sattel eines Pferdes. Deshalb fehlt auch das stumme „h“ nach dem „e“.
Das Wort ist nämlich an anderer Stelle zu trennen: Steg|reif.
Ein Stegreif ist nun was? Richtig! Das ist ein altes und heute nicht mehr gebräuchliches Wort für „Steigbügel“. Beides, „Steg“ und „steigen“ kommt vom gleichen althochdeutschen Wort „stigan“, und wenn Sie das nächste Mal einen Bootssteg betreten, dann wissen Sie jetzt auch aus dem Stegreif, warum dieser so heißt.
Aber warum nehmen wir ausgerechnet diesen mittelalterlichen Steigbügel her, wenn wir heutzutage ausdrücken möchten, dass wir etwas wissen oder können, ohne uns darauf vorzubereiten oder etwas nachschlagen zu müssen?
Die Antwort ist einfach: Wenn man nicht einmal aus dem Sattel steigen muss, um etwas zu erledigen, dann ist das die ultimative Form der Erledigung en passant, also im Vorbeigehen, ohne jede Vorbereitung. Man bleibt sogar mit den Füßen im Steigbügel, arroganter und ignoranter geht es kaum. Allerdings hat dieses geflügelte Wort heute jede negative Konnotation verloren. Wer etwas aus dem Stegreif beherrscht, zu dem sieht man auf wie anno dazumal zum Ritter. Und von unten sehen seine Füße vermutlich auch recht groß aus, was aber nicht zwangsläufig heißen muss, dass dieser Mensch auf großem Fuße lebt.
Übrigens findet sich schon bei Goethe ein Beispiel: „Aus dem Stegreif die Reime zu machen, wie leicht war das!“ Der lebte literarisch wahrlich auf großem Fuße!
Auf großem Fuß leben
Mir fehlt zwar heute finanziell nichts mehr, das heißt aber nicht, dass ich reich wäre oder gar auf großem Fuße leben würde. Nein, ich wüsste nur nicht, was ich unbedingt haben wollte und mir doch nicht leisten könnte. So gesehen bin ich also eher arm – an Wünschen. Und das ist vielleicht der größte Reichtum. Das Leben ersetzt Erwartungen ja doch zumeist mit (davon mehr oder weniger abweichenden) Erfahrungen, sagt der Realist. Daher erwarte ich mir nicht, dass dieses Buch ein Bestseller wird. Wenn ich dann erfahren haben werde, dass es keiner geworden ist, wird das keine Enttäuschung sein (na ja, vielleicht ein wenig). Ich habe übrigens auch eine Variante für Pessimisten, die sagen nämlich lieber: „Für Optimisten ersetzt das Leben Erwartungen durch Enttäuschungen!“ Das kann einem Pessimisten naturgemäß ja kaum passieren, außer er ist dermaßen pessimistisch, dass er sich bei einem selbstverständlich nie erwarteten Lottogewinn sagt: „Eh klar! Nicht einmal auf das Pech kann man sich mehr verlassen!“ (Ende des Exkurses in die Philosophie).
Aber wo wir schon beim Thema Geld sind: Wenn jemand auf großem Fuße lebt, dann will man damit ausdrücken, dass er verschwenderisch mit seiner (zumeist durchaus reichlich vorhandenen) Penunse umgeht. In Oberösterreich sagen wir dazu: „Der blost ordentlich!“, was vermutlich in irgendeinem Zusammenhang mit „aufgeblasenem Gehabe“ steht. Die Bedeutung dieses Spruchs ist demnach klar negativ besetzt.
Die angebliche Herkunft, zu der aber (vermutlich berechtigte) Zweifel bestehen, ist das ebenfalls. Meist wird man bei einer Nachfrage zu diesem geflügelten Wort dahingehend aufgeklärt, dass im 13. Jahrhundert ein reicher, französischer Adeliger mit missgebildeten Füßen seine Problematik mit großen Schuhen zu verstecken suchte, denen er vorne zu allem Überfluss noch mächtige Schnäbel hinzufügte. Die Herkunft dieser Schnabelschuhe dürfte aber einen weniger anatomischen Grund gehabt haben: Adelige stellten mit solch äußerst unbequemen Schuhwerk ganz bewusst zur Schau, dass sie es sich leisten konnten, auf das Gehen zu verzichten, um sich stattdessen einer Sänfte zu bedienen. Je unpraktischer der Schuh, desto reicher und edler der Träger! Was wiederum das Sprichwort bestätigt, dass sie auf großem Fuße zu leben imstande waren.
Nur leider kommt es vermutlich nicht davon. Die Redewendung dürfte viel später, nämlich erst im 17. Jahrhundert entstanden sein – zumindest gibt es keine früheren schriftlichen Nachweise dazu. Und damals bedeutete „Fuß“ eben nicht nur die entsprechende Extremität, sondern auch eine „Art des Seins“, einen „way of life“ – die Aufwendungen, mit denen man sein Leben lebte. Wenn man viel Aufwand betrieb (beziehungsweise betreiben ließ), dann lebte man auf großem Fuße. Damit stach man unliebsame Konkurrenten bei der Dame des Herzens schon auch mal aus.
Jemanden ausstechen
Ich hab‘ ja als Kind immer gerne ausgestochen. Zumeist Kekse. Dabei konnte ich es Mama aber selten recht machen, denn sie wollte immer, dass ich diese möglichst platzsparend aussteche. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass ich Physiker geworden bin, denn Physiker sind immer auch ein wenig Mathematiker (allerdings ohne die Penetranz typischer Mathematiker bzgl. der Formalismen, sie sind also gleichsam „Mathematiker mit Lebenserfahrung“), und Mathematiker machen sich um Dinge Gedanken wie: „Wie kann man Kreise so anordnen, dass man möglichst wenig Zwischenraum verschwendet?“ dabei fangen sie mit gleich großen Kreisen an, und wenn das Problem gelöst ist, kommt ein Kollege und „erweitert es“ auf „n Kreise mit Radius rn und m Kreise mit Radius rm“ oder sowas. Ja, diese Zahlenakrobaten sind manchmal schräg drauf.
Physiker würden hingegen die Keksformen einfach quadratisch oder sechseckig machen. Da kann man dann ganz ohne verschwendetes Material arbeiten. Was? Ja, ja, sofern der Teig unendlich groß ist oder die Form so gestaltet wird, dass am Rand nichts übrig bleibt, sagt mir ein Mathematiker gerade ein. Verstehen Sie jetzt, was ich meine?
Kurz: Physiker stechen Mathematiker beim Ausstechen von Keksen aus, weil sie die schon wieder fertig gebacken aus dem Rohr holen, wenn die Mathematiker noch am Rechnen sind. Dabei muss man beim Anordnen auf dem Blech übrigens wiederum aufpassen, weil man natürlich auch so viele wie möglich darauf unterbringen möchte, ohne dass diese aber an den Rändern zusammenbacken. Das Leben ist halt kein Mathebuch, und wir sind alle moderne Ritter, die ihren Burgfräulein gefallen wollen.
Davon kommt übrigens der Ausdruck „jemanden ausstechen“. Ritter wollten einer Dame gefallen und versuchten, den Konkurrenten im Turnier mit der Lanze aus dem Sattel zu stechen. Bei Affen oder Schlangen würde man das „Kommentkampf“ nennen, bei der Spezies Homo sapiens nennt man es Ritterlichkeit. Bei solchen Turnieren kam zwar selten aber manchmal doch auch der Konkurrent ums Leben. Einer der prominentesten, die es dergestalt erwischt hat, war der französische König Heinrich II.
Der hatte lange Zeit Ärger mit den Habsburgern. Als man 1559 endlich Frieden schloss und dies mit einem Tjost (Lanzenstechen in Turnierform) feierte, durchbohrte ein Teil einer gesplitterten Lanze sein Visier und drang durch das Auge ins Gehirn ein. Man versuchte noch, ihn zu operieren, was ohne Narkose entsetzlich weh getan haben muss, aber er schaffte es nicht und starb zehn Tage später.
Und nicht einmal die ewige Ruhe ließ man dem armen König. Während der Französischen Revolution öffnete man 1793 sein Grab, plünderte es und verscharrte seine Knochen in einem 08/15 Massengrab. Die haben da nicht lange gefackelt, aber das erkläre ich später.
08/15
Ich hoffe, dass meine Bücher nicht „nullachtfünfzehn“ sind. Denn nichts ist schwerer zu ertragen als Mittelmäßigkeit. Wenn etwas heutzutage als „08/15“ bezeichnet wird, dann meint man damit meist abwertend (oder bestenfalls wertfrei), dass dieses Etwas unauffällig, durchschnittlich oder – im schlimmsten Falle – gar billig und langweilig ist.
Aber woher kommt dieser im gesamten deutschen Sprachraum gebräuchliche Ausdruck?
Dazu müssen wir zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Da man sich immer jeden neuen Krieg so vorstellte wie den jeweils letzten, weil man nunmal die jüngsten waffentechnischen Entwicklungen in ihrer Bedeutung noch nicht richtig einschätzen konnte, waren die Aufmarschpläne der Mittelmächte eben auch veraltet. Wobei jedoch im Ersten Weltkrieg das mittlerweile erfundene Maschinengewehr die Verteidiger gegenüber den Angreifern in Vorteil versetzte. Die Borniertheit der Militärs hat dann dazu geführt, dass sich die Fronten im Westen im nordfranzösischen Schlamm eingruben und es jahrelang kaum ein Vor oder Zurück gab, bis schlussendlich das stupide Denken der Feldherren an die zehn Millionen Menschen sinnlos das Leben gekostet hatte. Erich Maria Remarques 1928 erschienener berührender Roman „Im Westen nichts Neues“ handelt davon. Das Buch wurde 1933 von den Nazis verboten und öffentlich verbrannt. Sie kennen sicher den Witz, wo ein Neonazi in den Buchladen kommt, ja? „Soll ich Ihnen das Buch einpacken oder verbrennen Sie es gleich hier?“
Eines dieser Maschinengewehre war das deutsche Modell „MG 0-8-15“. Die Soldaten wurden lange Zeit daran ausgebildet und mussten immer und immer wieder die gleichen Handgriffe üben, damit sie das Maschinengewehr in der Schlacht auch mit verbundenen (oder vom Giftgas blinden) Augen bedienen konnten. Diese langweiligen Übungen prägten, so eine Erklärung, den Ausdruck „Das ist nullachtfuffzehn!“ Gegen Ende des Kriegs, als die Ressourcen knapp wurden, sank auch die Qualität der gelieferten Gewehre, sodass etwas, das „08/15“ war, damit als durchschnittlich bis schlecht abgestempelt wurde.
Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass es das erste einheitliche Maschinengewehr des deutschen Heeres war. Alle MGs waren gleich, sie waren „nullachtfünfzehn“. Dabei bedeuten die beiden Zahlen übrigens das Erstentwicklungsjahr (1908) und das Weiterentwicklungsjahr (1915) des Maschinengewehrs.
Übrigens gibt es auch eine sehr lesenswerte Romantrilogie von Hans Hellmut Kirst, deren Titel allesamt die Zeichenfolge „08/15“ beinhalten. Diese handelt vom Soldatenleben in der Wehrmacht während des zweiten Weltkriegs. Kirsts Protagonist war dabei der Gefreite Asch (das „r“ habe er absichtlich entfernt, meinte er später). Ein cleverer Soldat, eine Art Schwejk, der seine Vorgesetzten mit allerlei Tricks und Finten vorführt, um dem stupiden Drill auf dem Kasernenhof zu entgehen.
Franz Josef Strauß hat dieses Buch so sehr gehasst, dass er die Buchhändler zum Boykott aufforderte. Kein Wunder, es passte nicht in seine Philosophie, dass die frühe Bundesrepublik bezüglich ihrer Wehrhaftigkeit die (damals noch weniger in Verruf gewesene) Wehrmacht in manchen Bereichen, vor allem in der Pflichterfüllungsidiotie, nachahmen sollte. Aber die Buchhändler ließen ihn mit seinem Ansinnen großteils abblitzen, die Romane wurden Bestseller, verbrennen musste Strauß das Buch zuhause.
Die Bayern und einige andere deutsche Bundesländer haben daraus wenig gelernt und später bei Falcos Hit „Jeanny“ etwas Ähnliches noch einmal versucht, indem sie ihren staatlichen Sendern verboten, das Lied zu spielen, wobei auch diverse Frauenorganisationen interveniert haben sollen. Das Ergebnis war ähnlich durchschlagend, was Falco dem Vernehmen nach mit einem „Die Kerzerlschlucker haben mir einen Gefallen getan!“ kommentiert haben soll, womit er auf die rechtskonservativ-christliche CSU anspielte. Ich weiß nicht, ob das stimmt – aber wenn nicht, ist es gut erfunden; zu Falco passen würde es auf jeden Fall.
Jemanden abblitzen lassen
Als ich jung war, war ich ziemlich schüchtern. Bei Frauen bin ich meistens abgeblitzt, denn junge Mädchen wollen selbstbewusste Machos, auch wenn sie das immer abstreiten. Das mag auch der Grund sein, dass sie oft so unglücklich verliebt sind: Wenn junge Frauen in einen Raum mit 100 Männern gehen, picken sie sich mit beeindruckender Sicherheit und Geschwindigkeit den einzigen Macho heraus. Ihnen ist jetzt nicht entgangen, dass ich damit implizit andeute, dass 99% der Männer nett sind, ja?
Später habe ich immer wieder den alten Spruch der Shaolin beherzigt, dass man seine Schwäche zu seiner Stärke machen soll, und habe meine Schüchternheit zum Programm gemacht. Das hat einige Male verblüffend gut funktioniert, und im Endeffekt ist es jungen Männern dann ziemlich egal, warum sie eine Frau verführen, auch wenn es aus Sicht der Dame nur Mitleid ist. Ich bin darauf nicht besonders stolz, und vielleicht stimmt das alles ja auch gar nicht, die Beurteilung überlasse ich anderen ;-)
Mittlerweile hat sich mein Selbstwertgefühl gefestigt, manche unterstellen mir sogar Narzissmus, aber auch das spielt keine Rolle mehr, weil man sich irgendwann einfach seine Hörner ausreichend abgestoßen hat. Man „findet seine Mitte“, würden Psychologen sagen, und ich muss bei diesem Spruch sofort an meine Badezimmerwaage denken, worauf es mit dem „in sich Ruhen“ auch schon wieder vorbei ist. Aber ich weiche einmal mehr vom Thema ab. Woher kommt dieser Ausdruck: „jemanden abblitzen lassen“?
Thematisch sind wir hier wieder bei den Gewehren, wenn auch bei etwas früheren Ausführungen als bei der zuletzt besprochenen Redewendung, denn bei den ersten Luntenflinten kam es durchaus häufig vor, dass das Pulver einfach nur mit einem Blitz verbrannte statt durch eine Explosion die Kugel aus dem Lauf zu schleudern. Dann war man mit diesem Schuss „abgeblitzt“, hatte also nicht den gewünschten Erfolg verbuchen können, und jemand anderer musste für einen in die Bresche springen.
In die Bresche springen
Wissen Sie, was eine Bresche ist? Das ist eine Lücke, die man in die Verteidigung des Gegners gerissen hat. Das Wort kommt vom französischen „brèche“ und hat die gleichen Wurzeln wie das deutsche Wort „brechen“.
Als es noch keine Feuerwaffen gab, mussten Mauern vor allem eins sein: hoch! Die Stärke war weniger ausschlaggebend, solange sie zumindest den Steinen standhielten, die die Belagerer mit ihren Katapulten auf diese schleuderten. Somit bestand die zumeist einzige Möglichkeit, in eine Burgmauer eine Bresche zu schlagen, darin, diese zu unterminieren, also zu untergraben, in diesem unterirdischen Gang dann ein großes Feuer zu entzünden, worauf mit etwas Glück die Mauer darüber wenigstens zum Teil einstürzte.
Mit Entwicklung der Feuerwaffen wurden die Mauern dicker und niedriger, sodass es auch schweren Kanonen kaum möglich war, Lücken in sie zu schießen. Bei der Türkenbelagerung Wiens gruben die Angreifer Stollen, die viele hundert Meter lang waren, rollten Fässer mit Schießpulver durch diese Stollen unter die Stadtmauer und steckten die Lunte in Brand. Die Verteidiger versuchten, die durch das Graben entstehenden Erschütterungen mit auf Trommeln liegenden Erbsen zu lokalisieren und den Angreifern zuvorzukommen. Tatsächlich dürfte Wien 1529 auf diese Weise der Eroberung gerade noch so eben entgangen sein, denn wenn einmal eine große Bresche geschlagen ist, sind die Angreifer im Vorteil, auch wenn der Erstangriff zumeist ein Himmelfahrtskommando ist.
Außer die Bresche in der Burg war nur relativ klein. Dann sprang ein Ritter in diese Lücke und verstopfte sie unter Einsatz seines Lebens, bis genügend Baumaterial herangeschafft werden konnte, um sie notdürftig instand zu setzen. Das Verschließen einer Lücke mit dem eigenen Körper ist also kein Monopol der 300 Spartaner des Königs Leonidas, die auf diese Weise heldenhaft tagelang die Thermopylen gegen zigtausende Perser unter Xerxes I. verteidigt hatten.
Wenn Sie heute für jemanden in die Bresche springen, haben Sie üblicherweise gute Überlebenschancen und damit dem armen Ritter etwas voraus. Und der Freund, dem Sie damit helfen, kann nachher mit Fug und Recht behaupten, dass er seine Pappenheimer kenne.
Ich kenne meine Pappenheimer!
In Mittelfranken gibt es eine Stadt namens „Pappenheim“ mit heute etwa 4000 Einwohnern. Diese Stadt ist zwar ziemlich alt, vermutlich deutlich älter als die erste urkundliche Erwähnung um 750 n. Chr., aber berühmt wurde sie erst durch Schillers „Wallenstein“, genauer: durch „Wallensteins Tod“.
In diesem Drama ruft der alte Feldherr aus: „Daran erkenne ich meine Pappenheimer!“, und er meint das positiv, denn die