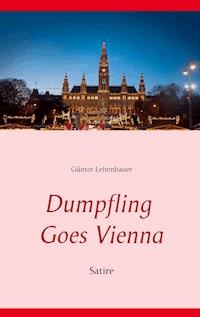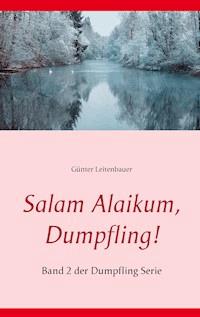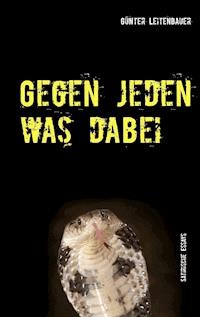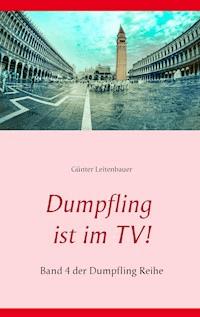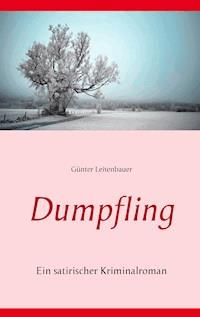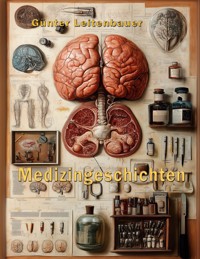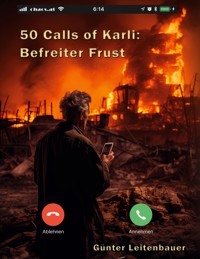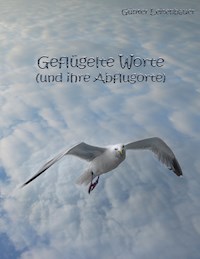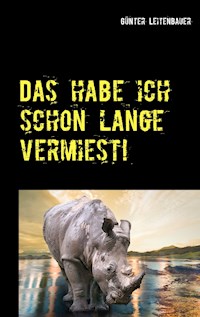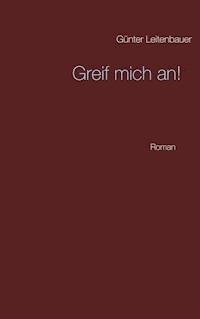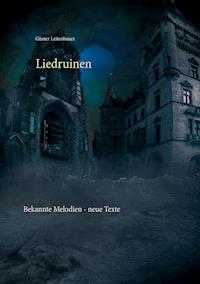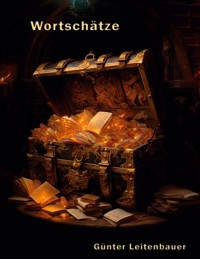
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Linguistische Raritäten, fast vergessene Ausdrücke, ungewöhnliche Wörter, sprachliche Kuriositäten und Wörter, die Ihre Kinder oder Enkel wohl nicht mehr kennen. Eingerahmt in die oft interessante Herkunft dieser Kleinodien, verfeinert mit Geschichten und Ausflügen in Wissenschaft und Geschichte, Literatur und Alltagskultur. Wort-Schätze im Sinne des Wortes eben, bei denen auch der Humor nicht zu kurz kommt. Jean Paul sagte einmal, Deutsch sei die Orgel unter den Sprachen. Er meinte damit vermutlich, man könne mit und in dieser Sprache sehr viel ausdrücken, so wie eine Orgel viele verschiedene Klangfarben hat. Die deutsche Sprache ist in der Tat ein Quell steter Überraschungen. So gibt es für gleiche oder ähnliche Dinge oftmals viele verschiedene Ausdrücke, die sich zumeist nur in Nuancen unterscheiden. Und manche davon hört man viel zu selten, sie sind im Alltag rar geworden. Dieses Buch nimmt sich ihrer an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wort-Schätze
Linguistische Raritäten, fast vergessene Ausdrücke, sprachliche Kuriositäten und Wörter, die unsere Kinder oder Enkel nicht mehr kennen – oder die nur Ihre Kinder kennen
von Günter Leitenbauer
Gestaltung der Titelseite: Günter Leitenbauer
Vorwort des Autors
Die „Geflügelten Worte“ waren endlich fertig. Sie verkauften sich (zumindest für meine bescheidenen Ansprüche) auch gar nicht so schlecht – und fanden sogar Beachtung in den Medien. Es gab einige Berichte in Zeitungen, zweimal war ich damit im ORF Radio Oberösterreich, und sogar das Lokalfernsehen drehte eine Homestory, was mich glücklicherweise dazu nötigte, endlich meine Küche aufzuräumen. Apropos: Meine Küche könnte mal wieder so einen Dreh gebrauchen.
Und dann stand natürlich die Frage der Fragen an: Welches Projekt gehe ich als nächstes an?
Einen Roman? Ideen gäbe es zuhauf. Oder doch noch ein Sachbuch? Wenn ja, welches? Ich begann halbherzig, an einem Buch über Farben zu schreiben – und ließ es dann doch wieder sein. Vorerst zumindest. Beim Schreiben eines Buchs ist es wie beim Sex: Es macht nur Spaß, wenn Lust und Liebe dabei sind. Und dann fiel es mir, um das deutsche Komikerurgestein Otto Waalkes zu zitieren, „wie Schuppen aus den Haaren“, als mir jemand wegen meines letzten Buchs mit Worten (aber nicht wörtlich) den Bauch pinselte, denn „bauchpinseln“ ist ein selten verwendetes, fast vergessenes Wort. Welche Vertreter dieser vom Aussterben bedrohten Art gibt es noch? Könnte man darüber tatsächlich ein Buch schreiben? Sogar mehrere, wenn es sein muss! Dieses Thema hat nämlich den Vorteil, dass man unmöglich Vollständigkeit erreichen (oder auch nur anstreben) kann, was es im Gegenzug recht einfach machen sollte, sich auf mehr oder weniger willkürlich gewählte Teilausschnitte der Gattung „Wortexoten“ zu beschränken. Dachte ich zumindest.
Jean Paul sagte einmal, Deutsch sei die Orgel unter den Sprachen. Er meinte damit vermutlich, man könne mit und in dieser Sprache sehr viel ausdrücken, so wie eine Orgel viele verschiedene Klangfarben hat. (und nicht etwa, dass jede Pfeife schreiben sollte!) Um das zu erweitern: Recht viele Tasten scheinen an dieser Orgel tatsächlich nicht zu fehlen, aber eine ganz bestimmt: Wie bezeichnet man das Gegenteil von durstig? Dafür gibt es in der Tat im Deutschen kein Wort. Böse Zungen behaupten, das sei so, weil wir Österreicher und Deutschen immer durstig sind. Wie das in der Schweiz ist, dazu fehlt mir leider jegliche Information.
Zudem wurden einige durchaus gebräuchliche Wörter in dieses Buch aufgenommen, bei denen ich einfach die Herkunft interessant fand. „Bub“ ist eines dieser Wörter, das mir bei einem Interview eines früheren österreichischen Bundeskanzlers in den Sinn kam. Hätten Sie gewusst, dass es vermutlich nicht die gleiche Abstammung hat wie „Puppe“? Ich nicht. Aber man lernt bekanntlich nie. Aus! Die deutsche Sprache ist ein Quell steter Überraschungen. So gibt es für gleiche oder ähnliche Dinge oftmals viele verschiedene Ausdrücke, die sich zumeist nur in Nuancen unterscheiden. Und manche davon hört man viel zu selten, sie sind im Alltag rar geworden. Übrigens sollten Sie sich bitte nicht über den einen oder anderen politischen Seitenhieb wundern oder gar ärgern: Ich habe diesbezüglich keinerlei Präferenzen. Es gibt Parteien, die ich nicht mag, und es gibt Parteien, die ich gar nicht mag. Gewählt wird dann halt immer die Partei, die ich am wenigsten nicht mag. Diese Formulierung tut mir im Übrigen selbst in den Augen weh.
Als ich mitten in der Schreibarbeit war, begann ich, „Krieg und Frieden“ von Leo Tolstoi zu hören. Ich lese zwar sehr gerne, aber Hörbücher haben nun einmal den Vorteil, dass man sie sich auch während des Autofahrens einverleiben kann. Auf meine Fahrweise hat das einen positiven Einfluss: Ich fahre tatsächlich noch langsamer, seit ich immer ein Hörbuch laufen habe. Seitdem sehe ich von den Traktoren manchmal auch die rechte Seite. Aber zurück zu „Krieg und Frieden“. Ich habe mit Freude festgestellt, dass darin viele der Wörter in diesem Buch in einer ganz selbstverständlichen Weise Verwendung finden. Wie auch in Henry Millers „Im Wendekreis des Krebses“, das ich mir vor kurzem ebenfalls als Hörbuch gegönnt habe. Das Buch ist eine Ferkelei, aber eine sprachlich schöne.
Diese Wörter waren also nicht immer exotisch oder selten, sie sind nur im Laufe der Zeit irgendwie … versunken. Unsere Sprache ist eben ein Wörter-Schatz im Silbensee, und dieses Buch geht auf Schatzsuche. Helfen Sie mir beim Heben?
Günter Leitenbauer, April 2021 – Oktober 2024
Danksagung
Mein größter Dank gebührt wie immer meiner leidensfähigen Lektorin Doris Rettenegger. Ohne ihre Mühe wäre dieses Buch mit etlichen Tipp- und anderen Fehlern gespickt. Wenn trotzdem noch welche drinnen sind, dann vermutlich, weil ich nach dem Lektorat noch irgendwelche Dinge geändert habe.
Danke auch wieder an meine Familie, die mir zwar nicht beim Schreiben hilft, mich aber stets bei Laune hält. Bei uns geht es meistens recht lustig zu, und das ist gut so. Das Leben ist zu kurz für miese Laune und schlechten Wein. Falls ihr das lest, liebe Söhne: Irgendwo mitten im Buch (ich sage euch nicht, wo genau; das zwingt euch dazu, es zu lesen!) kommt ihr in einer Geschichte vor, für die ihr mir aber bitte nicht grollen möget, ja?
Inhalt
Vorwort des Autors
Danksagung
Inhalt
Einleitung
Wie teilt man ein solches Buch am besten ein?
Anatomisches
bauchpinseln
Odeur und Odem
Gekröse
Gemächt
Malaise
kreißen
Schimpf, Schande und Streit
Büberei
Kabale
vermaledeit
Schmach
kujonieren
gelackmeiert
Ränke
derohalben
Zwietracht und Zankapfel
Kämpe
Malefiz
Schergen, Häscher und Büttel
Federfechter
desavouieren
Dignität
Mystik, Religion und Geschichte
abgöttisch
Devotionalien
mesmerisieren
Kürass, Harnisch und Brünne
defilieren
läutern, geläutert
schwadronieren
lakonisch
vierschrötig
Mär
Gefühle
berückend
anmutig
artig und abartig
gewahr (werden)
garstig
goutieren
Bramarbas
nonchalant
eingedenk
Techtelmechtel
Buhle
Emotivität
Unbill - Unbilden
piesacken
anheischig, erheischen
Larmoyanz
Flatterie
Pläsanterie
In Bewegung und in Ruhe
derweil
lustwandeln
Vestibül
gemach!
treideln
Sommerfrische
retirieren
Veloziped
ambulieren
beiwohnen
Modisch, bequem oder einfach Unfug?
kommod
Mumpitz
pomale
unbotmäßig
Kinkerlitzchen
Firlefanz
ondulieren
Sprachliches und Unaussprechliches
flektieren
harangieren
Konnotation
konjizieren
schlechterdings
Tapet
weidlich
vexieren
trefflich
dünken und Dünkel
krakeelen
schlankerhand
ingleichen und desgleichen
Kamellen und olle Kamellen
deteriorieren
Lemma, Dilemma und Trilemma
lugen
Kauderwelsch
ridikül
purgieren
vermittels (vermittelst)
Minuskeln und Majuskeln
Etikette
affrontieren
Attitüde
ziemen und geziemen
Lotterleben
proper
Ausgeleit
Cochonnerie
pikiert
indigniert
lind
poussieren
sich erdreisten, sich erkühnen
kosen und liebkosen
brüsk
barsch
haselieren
radotieren
hold
Sozio…, sozio… ach, Gesellschaftskram halt
manierlich
Kalamität
Adlatus
Kalfaktor und Faktotum
Händel
Gezänk
Unglimpf
Haderlump
Privatier
Hagestolz
Vettel
Grisette
Jugendsprache
cringe
Digga
Alman
Baba und Babo
Sheesh!
Bre, Bro, Bra und Bruh
sus und shady
lit
No front!
Gommemode
Facepalm
flexen
Lauch
Snackosaurus
Foodporn
Nasenorgasmus
wack / whack
Beef
dissen / Diss
safe
Fail
slay
Aura
Allerlei Geschäfte und Örtlichkeiten
Abtritt und Abort
Boudoir
Pfründe
Kemenate
Koben
Meriten
urgieren
Reibach
Karzer
Obolus
Speis und Trank
Brosamen
geschleckig, schleckig
kredenzen, Kredenz
laben und Labsal
Spezereien
Golatsche, Kolatsche
chambrieren
Wertvolles und Klingendes
Kleinod
haschen und erhaschen
Krawall
wohlfeil
hehr
Weise
quinkelieren
Faszinosum
Das große Ganze und die Zeit
allgemach
dräuen
eklektisch
itzo
exorbitant
fürderhin
weiland
akkurat
deuchte, dünken
erwirken und verwirken
majorenn und minorenn
spornstreichs und spornschlags
sputen
Menetekel
suppletorisch
saumselig und die Saumsal
sich kasteien, Kasteiung
ubiquitär
(Un-)Fähigkeiten
famos, infam
Kanaille, Canaille
abgefeimt
fatigant
unbedarft
debil und imbezil.
genant
gentil
luzid
Brimborium
pejorativ und meliorativ
inbrünstig
Ingrimm
vif
prätentiös, unprätentiös
Klüngel
pittoresk
Exegese, Exeget
hoffärtig
reputierlich, Reputation
Megäre
toll
Verballhornung
Allzu menschlich
Garaus
Falott
Bub und Puppe
verlustieren
Schwerenöter
Müßiggang
Backfisch
Steckenpferd
auf Lepschi gehen
Galan
echauffieren
abkupfern
Sperenzchen
Rabulist
Indolenz
Eidame, Basen und Oheime
Parvenü
Bunt und gemischt
obschon
blümerant
Gfrett
Gedöns
unwirsch
gefeit sein
Brast
greinen
Konterfei
honett
hären
Tuchent
irden
Zuber
Depesche
Panik
Eine letzte Erkenntnis
Stichwortverzeichnis
Weitere Sachbücher des Autors
„Schreiben ist leicht.
Man muß nur die falschen Wörter weglassen.“
Mark Twain
(1835 - 1910)
„Mit voller Hose ist leicht stinken, Mark!“
Günter Leitenbauer
(*1965)
Einleitung
Wie teilt man ein solches Buch am besten ein?
Der Ansatz, der mir bei einem derartigen Buch zuerst einfiel, war die alphabetische Anordnung. Das hätte etwas Strukturiertes, fast schon etwas Nerdiges, entspräche also meinem Charakter: Wer ein T-Shirt mit der Aufschrift „My password is the last eight digits of PI“ trägt, ist definitiv ein Nerd. Man sagt mir auch manchmal nach, ein exorbitanter Pedant zu sein. Allerdings haben die Betreffenden noch nie mein „Atelier“ gesehen, wie ich die Rumpelkammer des Grauens, in der ich skizziere, zeichne und male, sehr euphemistisch zu bezeichnen pflege. Unter anderem deswegen, weil ich zudem meine Leserinnen, Freunde, Verwandten und Bekannten immer wieder gerne ein wenig verwirre, mich gleichsam mit dem Odem des Geheimnisvollen umgebe, fällt diese Möglichkeit erstmal aus.
(Notiz an mich: „Odem“ und „exorbitant“ sind schräg genug, um sie in diesem Buch zu behandeln)
Mein früherer Deutschlehrer, der auch Geschichte unterrichtete, hätte sie vermutlich entweder nach ihrem zeitlichen Aspekt oder aber einfach nach dem grammatikalischen Typ (Verb, Substantiv, Adjektiv, etc.) eingeteilt. Da ich mich im Unterricht zumeist fadisiert habe, will ich auf diese Mechanismen lieber nicht zurückgreifen. Allerdings möchte ich betonen, dass er trotz der wenig charismatischen Ausstrahlung ein sehr guter Deutschlehrer war, dem ich viel von dem Wenigen, das ich über diese Sprache weiß, verdanke. (Über diesen letzten Satz würde er sicherlich nur in Agonie den Kopf schütteln.)
Man könnte die Wörter auch nach dem Grad der Exotik einteilen, also danach, wie ungewöhnlich sie sind. Das stellt einen aber vor zwei gravierende Probleme:
Erstens: Wer soll diese Exotizität1 messen oder bestimmen? Nun, das wäre ja noch eine lösbare Schwierigkeit, denn der Autor ist in seinem Buch der Herr im Haus. Allerdings gibt es da noch ein zweites Problem: Soll man die Wörter nach fallender oder nach steigender Schrägheit anordnen? Anders formuliert: Soll das Buch am Anfang oder am Ende interessant sein? Am Anfang interessante Bücher werden selten zu Ende gelesen, erst am Ende interessante Bücher werden gar nicht gelesen. Nein, das ist also auch kein zielführendes Konzept.
Somit bleibt einmal mehr nur die Möglichkeit, die Ausdrücke in irgendeiner Weise thematisch anzuordnen. Das reduziert das Problem auf ein überschaubareres, nämlich auf die Anordnung der Themengebiete. Hier habe ich mich dafür entschieden, den Zufall walten zu lassen, und so beginne ich mit der Anatomie. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass ich damit möglicherweise auch die Nerds unter meinen Leserinnen und Lesern zufriedenstelle, weil es so scheint, als würde das Alphabet zumindest bei den Themen eine gewisse Rolle spielen. Dabei ist der wahre Grund ein viel profanerer: „bauchpinseln“, also der Stein des Anstoßes zum Buch, hat eben etwas Anatomisches an sich, auch wenn selbiges bei meinem stetig zunehmenden Wohlstandsgewölbe schön langsam eine Herkulesaufgabe würde, so sich jemand dazu bereit erklärte.
1 Ich bin guter Hoffnung, dass diese meine zungenbrechende Wortschöpfung es in die engere Auswahl zum Wort des Jahres schafft, falls ich eine Politikerin finde, die es zu ihrem Lieblingsausdruck macht.
Anatomisches
Wurden Sie schon einmal über die Maßen gelobt? Wenn ja, teilen Sie mir bitte mit, wie sich das anfühlt. Ich muss das immer selbst tun. Eine Runde Mitleid bitte! Ja, Sie dürfen mir ruhig ein wenig den Bauch pinseln, ich halte das schon aus!
bauchpinseln
Ob man jemandes Bauch pinselt, oder ihn (sie) bauchpinselt, oder gar dieser Person den Bauch pinselt, sind bedeutungsmäßig äquivalente Ausdrücke. Sie unterscheiden sich nur im Casus, also dem grammatikalischen Fall. Nun bin ich zwar zeitlebens ein Freund des Genitivs, aber der Akkusativ ist auch akzeptabel. Nur dem Dativ hängt irgendwie immer etwas Triviales an, finde ich. Also bleiben wir hier beim „bauchpinseln“.
Die Herkunft ist hier nicht mit letzter Sicherheit zu klären, aber es gibt einen Konsens darüber, dass dieser Ausdruck erst im 20. Jahrhundert entstanden sein dürfte2, vermutlich in einer Schweizer Studentenvereinigung. Weil die Schweizer ein ganz eigenes Verhältnis zum Diphthong haben, hieß es dort ursprünglich wohl „buchpinslet“.
Dass sich das vom Streicheln einer Katze herleitet, wie manche behaupten, darf durchaus angezweifelt werden. Wenn ich meinen Kater an einer anderen Stelle als unter dem Kinn kraule, kratzt er mich jedenfalls fast immer augenblicklich, obwohl er an und für sich ein äußerst friedfertiges Exemplar der Spezies Felis catus ist. Was uns nun doch ein paar Jahrhunderte in der Zeit zurück versetzt, denn in der frühen Neuzeit kannte man den Ausdruck wohl als „den Kauzen streichen“, und damit war vielleicht das Kraulen unter dem (Doppel-)Kinn gemeint. So genau lässt sich das nicht mehr feststellen. Leider entwickelt der Mensch das Doppelkinn oft erst in einem Lebensalter, in dem niemand mehr das Bedürfnis hat, ihn dort zu kraulen.
Wenn das Bauchpinseln wirklich bei den Studenten erfunden wurde, könnte man mutmaßen, dass es eine sexuelle oder eine alkoholische Komponente hat. Was bei ersterem der Pinsel ist, muss nicht erklärt werden, oder? Und das medizinische Wort für das betreffende Organ des männlichen Körpers ist sprachlich tatsächlich mit dem Pinsel verwandt.
Ich jedenfalls möchte jetzt die Kurve zur Anständigkeit erwischen, und postuliere einmal, dass der Ursprung in einem nach lukullischen Genüssen vollen Bauch liegen mag, über den man sich dann zufrieden strich. Damit schmeichelte man sich gleichsam selbst, und „jemandem schmeicheln“ ist ja auch die Bedeutung von „bauchpinseln“.
Der Pinsel selbst geht übrigens auf die alten Römer zurück. Dort war „peniculus“ das lateinische Wort für Bürste, Pinsel oder auch Schwamm. Haben Sie sich übrigens einmal gefragt, wie die Römer aufs Klo gingen? Und vor allem, wie sie sich danach reinigten?
Der Toilettenbesuch war bei den Römern ein gesellschaftliches Ereignis. Man saß aufgereiht wie die Hühner nebeneinander auf einem Donnerbalken, um sich nach erledigtem Geschäft mit einem Schwamm zu reinigen, der zwischendurch in einen Eimer mit Wasser getaucht wurde. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen damit geht, aber ich lebe ganz gern in unserer Zeit, vor allem, wenn ich mir das dort herrschende Odeur vorstelle, ganz zu schweigen vom gemeinsamen Schwamm.
Odeur und Odem
Das Odeur kommt natürlich aus dem Französischen, wobei der Ursprung, wie bei so vielen Wörtern der romanischen Sprachen, im Lateinischen liegt, wo das Wort „odor“ so ziemlich alle Bereiche zwischen „Wohlgeruch“ und „Gestank“ abdeckt. Dabei sind die olfaktorischen Wahrnehmungsmöglichkeiten des Menschen deutlich besser, als die meisten glauben: Angeblich kann unser Geruchssinn bis zu einer Billion (also tausend Milliarden, außer Sie sind österreichischer Finanzminister; dann ist es eine Million mit sechs vergessenen Nullen hintendran) verschiedene Nuancen wahrnehmen. Das hat die Evolution somit recht gut hinbekommen. Wir können deutlich mehr Gerüche unterscheiden als zum Beispiel Farben.
Beim Riechvorgang kommen die Moleküle der Geruchsstoffe an die Riechschleimhaut in der oberen Nasenhöhle. Dort werden sie gelöst, und sind erst dann für die Zellen der Rezeptoren chemisch existent. Da wir etwa 350 Rezeptorgruppen besitzen, jede für eine bestimmte Geruchsgruppe, ergibt sich erst aus der Mischung die Möglichkeit, die oben genannte hohe Zahl an unterschiedlichen Geruchsnuancen wahrzunehmen. Dabei ist für jeden Menschen natürlich die genetische Veranlagung am wichtigsten, aber auch das Training spielt eine große Rolle, fragen Sie einmal einen Somelier! Das Gehirn kann das Riechvermögen tatsächlich durch Übung „erlernen“ – oder zumindest verfeinern.
Da es nichts gibt, was die EU nicht normt, gibt es auch für die Olfaktometrie eine Norm: Die europäische Norm EN 13725:2003 standardisiert tatsächlich das Messen von Gerüchen. Man untersucht dabei einfach, wie stark man eine Probe verdünnen kann, bis die Hälfte der Prüferinnen nichts mehr riecht. Diese Verdünnung ist dann der Zahlenwert der Geruchsstoffkonzentration. Die Einheit lautet GEE/m3 („Europäische Geruchseinheit pro Kubikmeter“). Schon irgendwie krass, oder? Eine Frage, die mir dabei nicht aus dem Kopf geht: Ändern sich die Werte, wenn die Prüferinnen einen Schnupfen haben?
Der Odem hingegen ist der „Atem des Lebens“. Das kommt nicht aus dem Lateinischen und ist mit dem Odeur auch nicht verwandt, außer Sie haben gerade eine wohlschmeckende und hintendrein weniger wohlriechende Knoblauchsuppe gegessen. Ich meinte hier aber ohnehin die sprachliche Verwandtschaft, und nicht die olfaktorische. Vermutlich kommt das Wort „Odem“ aus dem Indogermanischen, aber den betreffenden indogermanischen Begriff kennen wir nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass im Althochdeutschen „atum“, und im Mittelhochdeutschen „atem“ oder „aten“ genau das bezeichnet, was wir heute noch darunter verstehen: den Atem, den (Luft-)Hauch. Der „Odem“ ist eher bei Dichtern gebräuchlich, weil das Wort irgendwie weicher, edler und schöner klingt; und natürlich in Martin Luthers Bibelübersetzung, wohl aus ganz ähnlichen Gründen. Was nach so viel Schönheit beinahe danach verlangt, durch einen harten Kontrast in die Innereien der deutschen Sprache einzudringen. Gleichsam ins linguistische Gekröse. Oder, wie der berühmte deutsche Dramatiker und Lyriker des 19. Jahrhunderts, Friedrich Hebbel es so plakativ auszudrücken pflegte:
Menschen, worin Gottes Odem sitzt
wie in einem aufgeblasenen Darm.
Gekröse
Wenn Sie einen Jäger fragten, würde er unter Gekröse den „Aufbruch“, also die inneren Organe eines erlegten Tiers verstehen. Tatsächlich kommt das Wort auch davon, denn spätmittelhochdeutsch war „gekroese“ eben das Gedärm von Kalb und Lamm. Vermutlich kommt unser Adjektiv „kraus“ (wie in „krauses Haar“) davon, weil ja die Gedärme gleichsam in Locken im Bauchraum liegen. Nein, ich scherze hier nicht.
Mediziner verstehen darunter allerdings etwas anderes. Das Gekröse (Fachbegriff: Mesenterium) besteht aus Gewebebändern, die verschiedene Darmabschnitte im Körper befestigen. Also die Darmaufhängevorrichtung, wenn Sie so wollen. Das hatte übrigens schon der Universalgelehrte Leonardo da Vinci, der selbst ja nie eine Universität besucht hatte, entdeckt. 2018 gab es dann eine Menge Getöse ums Gekröse, als zwei irische Wissenschaftler entdeckten, was so ziemlich jede Medizinstudentin3 in der Anatomievorlesung schon seit Jahrzehnten gelernt hatte: Das Gekröse sei ein Organ! Keine einzelnen Bänder, nein ein richtiges Organ! Das publizierten die beiden auch gleich im Fachjournal „The Lancet“ – und ernteten Kopfschütteln, Spott und Hohn. Warum? Dazu müssen wir uns ansehen, wie ein „Organ“ definiert ist:
„Ein Organ ist eine funktionelle Einheit verschiedener Zellen in einem Lebewesen. Es entwickelt sich aus demselben Stamm an Zellen (Organogenese).“
Und genau daran hatte beim Mesenterium in der Medizin auch nie jemand gezweifelt. Bevor das alles jetzt aber allzu medizinisch wird, folgen wir wieder schwungvoll einer Darmwindung in Richtung eines etwas profaneren Wissens zum Gekröse, wobei ich meine Leserinnen für den nächsten Absatz entschuldige. Er betrifft sie kaum:
Das Gekröse ist nämlich der verantwortliche Bösewicht, der Männern den Bierbauch beschert. Neben Blutgefäßen, die den Darm versorgen, besteht es vor allem aus einem: aus Fett! Warum der Bierbauch dann nicht Fettbauch heißt, weiß ich allerdings nicht. Was ich aber (vom Hörensagen) weiß:
Wenn diese Wampe allzu umfangreich wird, verlängert das für Männer aus Sichtgründen den Suchvorgang nach dem Gemächt. Diese (zumeist bereits älteren) Männer müssen dann häufiger zur Toilette, weil eben nicht mehr jeder Gang von Erfolg gekrönt ist. Habe ich gehört. Es könnte aber auch nur ein bösartiges Gerücht ums Gemächt sein.
Gemächt
In diesem Wort steckt die Macht. Genauer: die Macht zur Zeugung, also die Potenz4. Was nicht verwundert, schließlich bezeichnet es ja auch die männlichen Geschlechtsorgane. Bezüglich der Wortherkunft habe ich mich auf die Suche gemacht (sic!) und folgendes gefunden:
Im Althochdeutschen gibt es das Wort „müht“, das so viel wie „Kraft“, „Vermögen“ (im Sinne von etwas können) oder auch „Macht“ bedeuten kann. Die Vorsilbe „gi“ ist im Althochdeutschen eine verstärkende Silbe, weshalb „gimaht“, als Ursprung des Gemächts, eben ein noch extra betontes Vermögen darstellt. Süffisant könnte man jetzt anmerken, dass dies für manche Männer auch schon ihr gesamtes Vermögen ist, aber ich bin bekanntlich weder süffisant noch humorvoll oder gar sarkastisch.
Und nun die Antwort auf die Frage, die sich alle Frauen dieser Welt seit Anbeginn der Zeiten nie stellten: Warum greift sich das zweitschönste Geschlecht so gern öffentlich ans Gemächt? Auf der Webseite wunderweib.de – ja, diese Seite gibt es tatsächlich, und es ist eine Seite von Frauen für Frauen, auch wenn Sie mir das jetzt nicht glauben wollen – ist man der Frage auf den Grund gegangen, um schlussendlich mit folgenden Erklärungen an die begierig auf diese Enthüllungen wartende Leserinnenschaft zu gehen:
Erste Erklärung: Es juckt. Kommt an den besten Körperstellen vor, warum also nicht auch an den allerbesten?
Zweite Erklärung: Das gute Stück hat lagebedingt eine Unbequemlichkeit hervorgerufen und muss in eine angenehmere Position bugsiert werden.
Dritte Erklärung: Man schwitzt. Folge: siehe bei Erklärung eins.
Vierte Erklärung: Mann hat eine (ungewollte) Erektion. So etwas ist vor allem an zwei Orten äußerst unangenehm: In der Sauna und am Strand. Ersteres führt schnell zu einer peinlichen Situation, zweiteres zu einem Sonnenbrand am Rücken. Boshafte Frauen sollen das angeblich sogar absichtlich provozieren. Habe ich gehört.
Fünfte Erklärung: (Ge-)Macht der Gewohnheit. Manche streicheln im Auto liebevoll den Knüppel der Gangschaltung, andere haben eine Automatik und müssen den Streicheltrieb anderweitig befriedigen.
Sechste Erklärung: Der Mann überprüft, ob da unten eh noch alles da ist. Diese Erklärung wird mit zunehmendem Alter und abnehmender Erinnerungsfähigkeit irgendwann zum Hauptgrund.
Das war mir jetzt alles ein wenig peinlich. Daher eine Bitte: Fragen Sie mich nicht, wie ich auf diese Seite gestoßen5 bin. Ich erinnere mich nicht … ach, vergessen Sie den letzten Satz bitte! In was für eine Malaise bin ich jetzt wieder geraten?
Malaise
Die Malaise ist so etwas Ähnliches wie die Misere. Nur in der Schweiz nicht, da sagt man „das Malaise“ – ich weiß auch nicht, warum. Und im Französischen ist es männlich – man überlässt Übles dort eben nicht gerne den Damen, das erledigt ein richtiger Mann lieber selbst.
Dabei ist die genaue Definition des Begriffes gar nicht so leicht, denn Malaise kann auch (politisches) Unbehagen, Missstimmung, Übelkeit, Unpässlichkeit, Schlamassel, Verzweiflung und noch einiges mehr bedeuten. Gebildet wird dieses Wort aus dem französischen Wort für „Befinden“ oder „Wohlbehagen“, nämlich „aise“ und dem vorangestellten „mal“, also „schlecht“, „übel“. In der Malaise befindet man sich also übel. Man kann sich das sogar als Regel merken: Wenn etwas mit „mal“ beginnt, ist es schlecht. Denken Sie an Wörter und Sätze wie „Malefiz“, „malignes Geschwür“, zum Beispiel ein sich veränderndes Muttermal – oder auch an den „Maler“, vor allem, wenn der nichts kann.
„Mal nicht den Teufel an die Wand!“ ist auch so ein Beispiel, und nicht umsonst seufzen viele Frauen, wenn sie an ihr „erstes Mal“ denken. Ich hatte auch einmal ein schlimmes Festmahl, bei dem die Speisen zwar aussahen wie gemalt, aber schmeckten wie aus Malachit gemeißelt, aber das hat damit mal wieder nichts zu tun. Jedenfalls lief ich dann in der Farbe des grünen Minerals an. Und wenn Sie mich hier mal wieder allzu ernst genommen haben, ist das auch eine Malaise, aber nicht meine.
Wirklich unangenehm, um auf das „erste Mal“ zurückzukommen, ist es, wenn dieses dazu führt, dass der Bauch auf einmal zu wachsen beginnt. Dann wird man nach im Schnitt neun Monaten kurz mal in die Klinik müssen, genauer: in den Kreißsaal.
kreißen
Schon der römische Dichter Horaz (65 – 8 v. Chr.) schrieb: „Es kreißen die Berge, zur Welt kommt nur ein lächerliches Mäuschen.“ – ein Satz, den man heutzutage eher in der verkürzten Form „Der Berg kreißte und gebar eine Maus.“ zu hören bekommt, wenn einer großmäuligen Ankündigung keine oder nur kleine Ergebnisse folgen. Also in der Politik. Manchmal möchte man deswegen verzweifelt schreien.
Davon kommt das Wort ja auch. Im Mittelhochdeutschen gab es ein Wort „kryzen“, das so viel wie „(gellend) kreischen“ oder „schreien“ bedeutete. Das Wort „kreischen“ (und auch „schreien“) leitet sich auch lauttechnisch davon ab, genauso wie das englische Wort „cry“. All diese Wörter haben daher onomatopoetischen Ursprung, klingen also so ähnlich wie das, was sie beschreiben, wie zum Beispiel auch „brummen“, „schnurren“ oder „Kuckuck“. Es gibt sogar lyrische Onomatopoesie, also lautmalerische Gedichte, zum Beispiel von James Krüss (Krüss, nicht Kreiß! Der war Kinderbuchautor. Er schrieb unter anderem den bekannten Roman „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“):
Hörst du, wie die Flammen flüstern,
Knicken, knacken, krachen, knistern,
Wie das Feuer rauscht und saust,
Brodelt, brutzelt, brennt und braust?
(Ausschnitt aus dem Gedicht „Das Feuer“)
Weil eine Geburt eben eine schmerzhafte Angelegenheit ist, die Frauen also dabei häufig laut und gellend schreien, wurde im 17. Jahrhundert aus dem „kryzen“ schließlich das uns bekannte „kreißen“, das man immer mit ‚ß‘ schreibt, nie mit ‚ss‘. Daher hat auch der Kreißsaal seinen Namen, den man somit tunlichst auch nicht „Kreisssaal“ oder gar „Kreissaal“ schreiben darf. Mit einem Kreis hat er also nichts zu tun, höchstens mit dem Kreislauf der Kreißenden und dem Kreislauf des Lebens.
Am Ende des Kapitels lade ich Sie ein, mit den hier beschriebenen Worten einen Satz zu bilden. Falls Sie diese Malaise meistern, also ein ansehnliches, grammatikalisch korrektes Ergebnis kreißen, ohne dass dem Satz das Odeur des künstlich Zusammengestoppelten anhängt (wobei vermutlich das Gemächt und das Gekröse die größte thematische Hürde bilden werden) hat Sie der Odem der Musen gestreift, und ich pinsle Ihnen hiermit respektvoll (aber nur im übertragenen Sinne) den Bauch.
2 Ich liebe die deutsche Sprache auch aufgrund ihres Konjunktivs, der einem immer einen Fluchtweg offen hält, wenn man sich einmal geirrt haben sollte (!) Das macht ihn vor allem auch für Politiker so ungemein attraktiv.
3 Dieses Buch ist ein Buch über sprachliche Themen. Daher weigere ich mich, hier „Studierende“ zu schreiben, denn das ist etwas anderes als „Studentinnen“ oder „Studenten“. Kein Student ist permanent am Studieren, somit also auch nicht immer studierend. Das (übertriebene) Gendern überlasse ich gerne anderen. Ich mische hier stattdessen einfach die männlichen und die weiblichen Formen nach Belieben und Zufälligkeit, das jeweils andere Geschlecht ist mitgemeint.
4 von lateinisch potentia „Kraft, Macht, Vermögen, Fähigkeit“, zurückgehend auf das unregelmäßige Verb „posse“ „können, vermögen“
5 Es ist bei diesem Thema wirklich schwierig, zweideutige Worte völlig zu vermeiden.