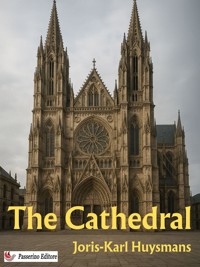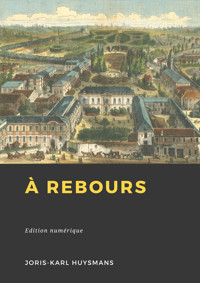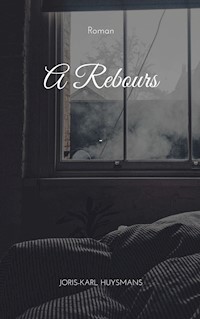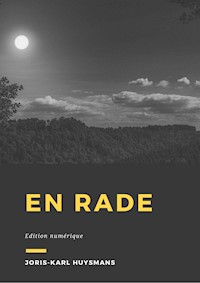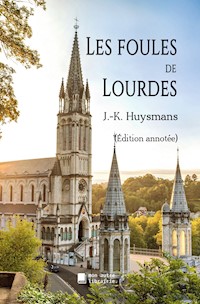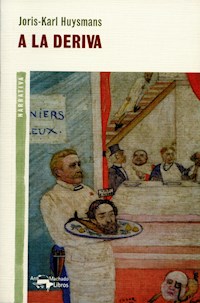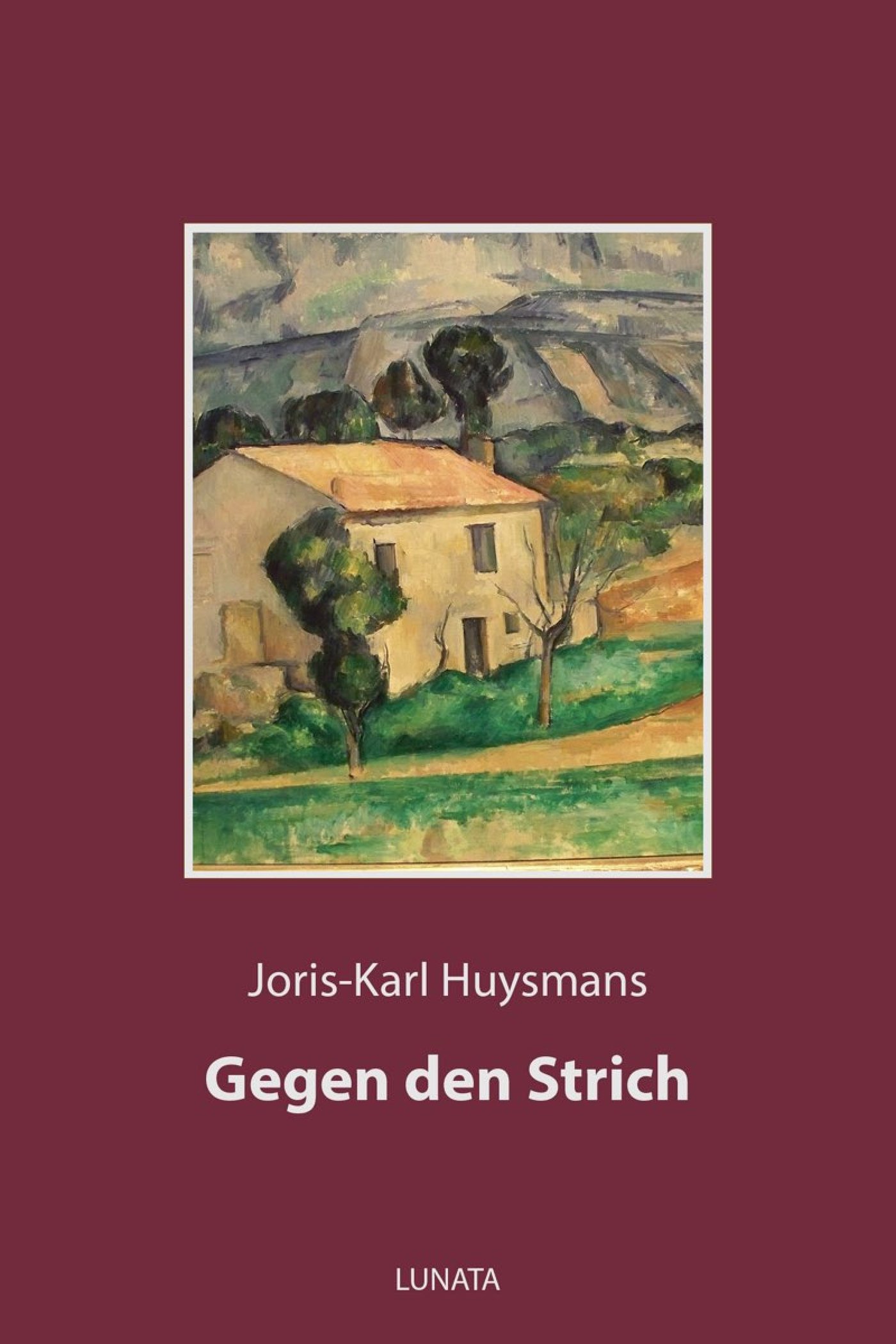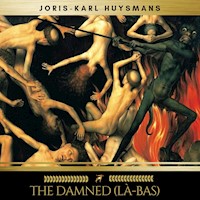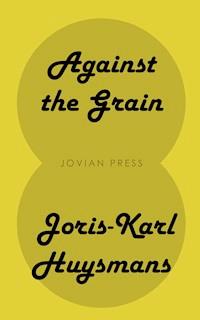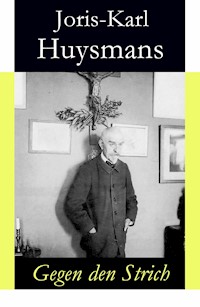
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Gegen den Strich" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Gegen den Strich (Alternativtitel: Gegen alle; Originaltitel: À rebours) ist das bekannteste Werk des französischen Autors Joris-Karl Huysmans. Mit dem 1884 erschienenen Roman brach Huysmans endgültig mit dem Geist seiner früheren, realistischen Werke und setzte dem Begriff der Dekadenz ein Denkmal. À rebours wurde für die Anhänger und Vertreter von Dekadenzdichtung, Symbolismus und L'art pour l'art bald zum Kultbuch. Ein französischer Roman, der den Protagonisten in Oscar Wildes Roman Das Bildnis des Dorian Gray zu dekadenten Ausschweifungen inspiriert, wird häufig als Anspielung auf À rebours gedeutet. Wilde war - wie auch Stéphane Mallarmé - ein Bewunderer des Romans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gegen den Strich
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
Wenn man nach den Porträts urteilen sollte, die im Schloss Lourps aufbewahrt werden, so müsste die Familie Floressas des Esseintes in alten Zeiten aus athletischen alten Haudegen und rauhen Kriegsmannen bestanden haben.
Gedrängt und eingeengt in ihre alten Rahmen, die sie mit ihren breiten Schultern gänzlich ausfüllen, könnten sie uns mit ihren starren Augen, den ä la yatagans gedrehten Schnurrbärten und ihrer mit gewölbtem Panzer bedeckten Brust nahezu erschrecken.
So sahen die Ahnen der berühmten Familie des Esseintes aus; die Bilder der Nachkommen fehlen, da die Reihenfolge unterbrochen. Ein einziges Gemälde dient als Mittelglied, Vergangenheit und Gegenwart verbindend. Es war dies ein gar eigentümliches, schlaues Gesicht mit bleichen, schlaffen Zügen, die Backenknochen wie rot punktiert, das Haar wie angeklebt und von Perlen durchfechten, mit ausgestrecktem, geschminktem Hals, der aus den tiefen Falten einer steifen Krause hervortritt.
Schon auf diesem Bilde eines der intimsten Vertrauten des Herzogs von Epernon und des Marquis d'O machten sich die Gebrechen einer untergrabenen Gesundheit wie der Einfluss des lymphatischen Blutes bemerkbar.
Der Verfall dieser Familie hatte zweifellos seinen regelmässigen Verlauf genommen; die Verweichlichung der männlichen Linie war immer mehr hervorgetreten, und als ob die des Esseintes das Werk der Zeit hätten selbst vollenden wollen, hatten sie während zweier Jahrhunderte ihre Kinder unter sich verheiratet, wodurch der Rest ihrer Kraft in naher verwandtschaftlicher Verbindung noch mehr geschwächt worden war.
Von dieser einst so zahlreichen Familie, welche fast das ganze Gebiet von Isle-de-France, und Brie bewohnte, lebte nur noch ein einziger Nachkomme, der Herzog Jean, ein schmächtiger junger Mann von dreissig Jahren, blutarm und nervös, mit eingefallenen Backen, kalten stahlblauen Augen, gerader feiner Nase und dürren schmalen Händen.
Durch ein seltsames Vorkommnis der Vererbung hatte dieser letzte Sprosse eine ganz auffällige Ähnlichkeit mit dem Urahnen, von dem er den spitzen Bart von ausserordentlich hellem Blond und den doppelsinnigen Ausdruck des sehr ermüdeten und doch lebendigen Gesichtes hatte.
Seine Kindheit war eine traurige gewesen; bedroht von Skrofeln und heimgesucht von hartnäckigen Fiebern war er dennoch mit Hülfe frischer Luft und Pflege so weit gediehen, dass er die Klippen der Reifezeit überschritt. Von da ab hielten seine Nerven stand, so dass er, die Schwächen der Bleichsucht überwindend, es schliesslich bis zur vollständigen Entwickelung brachte.
Seine Mutter, eine sehr blasse Frau, still und schweigsam, starb an Entkräftung, während sein Vater einer unbestimmbaren Krankheit erlag, als Jean des Esseintes eben sein achtzehntes Jahr erreichte.
Von seinen Eltern war ihm nur eine Erinnerung verblieben, die einer gewissen Furcht. die jedes kindliche Gefühl erstickte. Seinen Vater, der fast immer in Paris lebte, kannte er kaum: und seine Mutter vermochte er sich nur in einem dunklen Zimmer des Schlosses von Lourps unbeweglich auf dem Schlummerbette liegend vorzustellen. Selten nur waren die Gatten vereint gewesen, und von jenen Tagen erinnerte er sich nur noch der gar einförmigen Zusammenkünfte, wo beide sich gegenüber sassen, zwischen sich einen Tisch, auf dem eine grosse Lampe brannte, die durch einen Lampenschirm tief verhängt war, da die Frau Herzogin weder Licht noch Lärm zu ertragen vermochte, ohne einer Nervenkrisis zu verfallen. Hier im Halbdunkel wechselten die Gatten wohl einige wenige Worte, bis der Herzog aufstand, sich verabschiedete und gleichsam erleichtert den nächsten besten Zug nahm, der ihn wieder nach Paris zurückführte. —
Bei den Jesuiten, zu denen Jean zur Erziehung geschickt wurde, fand er wohlwollend freundliche Aufnahme. Die Pater gewannen das Kind, dessen Fassungskraft sie in Erstaunen setzte, recht lieb. Dennoch aber vermochten sie nicht, es trotz all ihrer Bemühungen dahin zu bringen, dass es sich den geregelten Studien widmete. Wohl fand es Geschmack an gewissen Arbeiten, so dass es frühzeitig der lateinischen Sprache mächtig ward, dagegen war es aber unfähig, nur zwei Worte griechisch zu erklären. Es hatte durchaus keine Befähigung für das Erlernen der lebenden Sprachen und zeigte sich geradezu stumpf, sobald man sich bemühte, es in die Anfangsgründe der exakten Wissenschaften einzuführen.
Seine Familie kümmerte sich wenig um Jean; dann und wann besuchte ihn sein Vater auf einen Augenblick in der Pension: „Guten Tag! — Adieu! — Sei artig! Arbeite tüchtig!" — dies war alles, was er zu hören bekam.
Die Sommerfellen verbrachte er im Schlosse von Lourps; doch vermochte seine Gegenwart nicht, die Mutter ihrem träumerischen Zustande zu entreissen. Sie bemerkte ihn oft kaum oder betrachtete ihn während einiger Sekunden mit fast schmerzlichem Lächeln und versenkte sich dann wieder von neuem in die durch dicke Gardinen erzeugte künstliche Nacht.
Die Dienstboten waren langweilig und alt. Der Knabe, sich selbst überlassen, durchstöberte an Regentagen die Bücher der Bibliothek und streifte bei schönem Wetter in der Umgegend umher.
Seine grösste Freude war, in das kleine Thal hinunter zu gehen bis nach Jutigny, einem kleinen Dörfchen, das sich am Fusse der Hügel ausdehnte und aus wenigen kleinen Häusern und Hütten bestand, die, meist mit Stroh bedeckt, gleichsam aus dem Moos herauswuchsen. Er warf sich dann wohl auf die Wiesen im Schatten eines hohen Heuschobers nieder, dem dumpfen Geplätscher der Wassermühle lauschend, oder auch die frische Luft der Voulzie einatmend. Manchmal dehnte er seinen Spaziergang bis zum Torfmoor oder bis zu dem grünen und schwarzen Weiler von Longueville aus, oder erkletterte gar die Anhöhen hinauf, wo der Wind schärfer wehte und von wo er eine schönere Aussicht genoss. An der einen Seite hatte er unter sich das Seine-Thal, das sich in weiter Ferne mit dem Blau des Himmels mischte; an der anderen Seite hatte er den Blick hoch oben gen Westen auf die Kirchen und den Turm von Provins, welche in der Sonne und dem goldigen Luftstaub zu zittern schienen.
Er las oder träumte, in vollen Zügen die Abgeschlossenheit einsaugend, wohl bis zur Dunkelheit; und da er sich immer grübelnd denselben Gedanken hingab, so konzentrierte sich sein Geist, und seine bis dahin noch unbestimmten Ideen begannen vorzeitig zu reifen. Nach den Ferien kam er jedesmal nachdenklicher und störrischer zu seinen Lehrern zurück, denen diese Veränderung keineswegs entging. Scharfsinnig und schlau — durch ihren Beruf daran gewöhnt, die Seelen bis ins Innere zu ergründen — Hessen sie sich durch seine aufgeweckte, doch unlenksame Intelligenz durchaus nicht hinters Licht führen. Sie erkannten wohl, dass dieser Schüler niemals zum Ruhme ihrer Anstalt beitragen werde; da aber seine Familie reich war und sich wenig um seine Zukunft bekümmerte, so verzichteten sie vollständig darauf, ihn auf den einträglichen Schulberuf hinzulenken, obgleich er gern diejenigen der theologischen Doktrinen mit ihnen erörterte, welche ihn durch ihre Spitzfindigkeit und ihren Scharfsinn reizten. Dachten sie doch nicht einmal daran, ihn für ihren Orden zu gewinnen; denn trotz aller ihrer Bemühungen blieb sein Glaube schwach , weil sie ihn, aus Klugheit und Furcht vor etwas Unvorhergesehenem, auch ruhig die Studien verfolgen Hessen, die ihm eben zusagten, und andere dagegen vernachlässigen, damit ihnen sein selbständiger Charakter nicht durch die Plackereien weltlicher Studienlehrer noch mehr entfremdet werde.
So lebte er vollständig zufrieden, das väterliche Joch der Priester kaum fühlend, indem er mit seinen lateinischen und französischen Studien ganz in seiner Weise fortfuhr, und, obgleich Theologie nicht auf dem Schulplan stand, widmete er sich doch den Lehren derselben, deren Studium er bereits im Schlosse Lourps in der vom Urgrossonkel, dem Domherrn Prosper, dem vormaligen Prior der Ordensstiftsherren von Saint-Ruf, hinterlassenen Bibliothek begonnen hatte.
Als er die Erziehungsanstalt der Jesuiten bei seiner Grossjährigkeit verlassen musste, wurde er Herr seines Vermögens; sein Vetter und Vormund, der Graf von Montchevrel, legte ihm Rechenschaft über seinen Besitz ab. Die Beziehungen zwischen ihnen aber waren nur von kurzer Dauer, da es keinen Berührungspunkt zwischen beiden gab, weil der eine alt, der andere jung war. Aus Neugier, Langeweile und Höflichkeit setzte der junge Herzog dennoch eine Weile den Umgang mit der Familie fort. Er machte einige Besuche in ihrem Palais in der Rue de la Chaise; entsetzlich langweilige Abende, an denen die steinalten Verwandten sich über adelige Familien, heraldische Monde und veraltetes Ceremoniel unterhielten.
Mehr noch als diese vornehmen alten Damen hier erschienen ihm jene hochadeligen Herren, welche die Whisttische umsassen, als verknöcherte, höchst unbedeutende Menschen.
Die Nachkommen der alten Helden, die letzten Zweige der feudalen Geschlechter erwiesen sich dem Auge des Herzogs Jean des Esseintes nach Lüftung ihrer Maske meist nur als vom Katarrh geplagte arg verschrobene Käuze, die immer wieder dieselben faden Redensarten und hundertjährigen Phrasen im Munde führten. Nachdem er einige Abende in solcher Gesellschaft zugebracht, fasste er den Entschluss, trotz aller Einladungen und Vorwürfe nie wieder dort hinzugehen.
Jetzt fing er an mit jungen Leuten seines Alters und seines Standes zu verkehren.
Einige von ihnen waren mit ihm in der Ordensschule erzogen und hatten durch diese Erziehungsweise gleichsam einen besonderen Stempel aufgedrückt erhalten. Sie gingen regelmässig zur Messe, beichteten zu Ostern, besuchten die katholischen Kreise und hielten jeden ihrer Angriffe, die sie auf schöne Mädchen niedergeschlagenen Auges unternahmen, geheim wie ein Verbrechen. Es waren dies meist geistlos unselbständige Zierpuppen, welche die Geduld ihrer Lehrer ermüdet hatten, die aber trotzdem ihren Wünschen soweit nachgekommen waren, sie in der menschlichen Gesellschaft als gehorsame und fromme Wesen hinzustellen.
Die andern, meist Schüler der Staats-Gymnasien, waren weniger Heuchler, sondern im allgemeinen freier, aber sie waren weder interessanter noch aufgeweckter als jene. Sie liebten die Vergnügungen jeder Art, waren grosse Freunde der Operette und des Turfs, waren an jedem Spieltisch zu finden, ihr Vermögen auf Pferde und Karten verwettend.
Nach Verlauf eines Jahres war der junge Herzog dieser Gesellschaft müde und überdrüssig. Ihren Ausschweifungen sich hinzugeben, die sie ohne Unterscheidung, ohne fieberhafte Vorbereitung, ohne wirkliche Wallung und Aufregung des Blutes und der Nerven durchmachten, erschien ihm mehr als flach und geradezu gemein. Nach und nach zog er sich daher von ihnen zurück und schloss sich den Litteraten an, bei denen er mehr geistige Verwandtschaft zu finden und sich wohler zu fühlen hoffte. Dies aber führte nur neue Enttäuschungen mit sich, denn er war empört, ihre kleinlichen und rachsüchtigen Urteile zu erkennen, ihre banale Unterhaltung und ihre widerlichen Streitigkeiten zu hören, wonach der Wert eines Werkes einfach nach der Zahl der Auflagen und dem Ertrag des Verkaufes bemessen wurde.
Er lernte zu gleicher Zeit die Freidenker wie die Prinzipienreiter des Bürgerstandes kennen, Leute die alle Freiheit beanspruchten, um die Meinungen der andern zu ersticken; habsüchtige, schamlose Puritaner, deren Bildung er noch geringer schätzte als die des ersten besten Eckenstehers.
Seine Menschenverachtung nahm immer mehr zu; er erkannte, dass die Menschheit zum grossen Teil aus leeren Prahlhänsen und Dummköpfen besteht, so dass er die Hoffnung aufgab, bei anderen wahre Seelengrösse oder reinen Hass zu entdecken. Er verzichtete darauf, einer Fassungskraft zu begegnen, die sich wie die seine in einer arbeitsamen Abgeschlossenheit gefiel, oder in einem Schriftsteller oder Gelehrten den scharf durcharbeiteten Geist zu finden, der sich dem seinen anschliessen konnte.
Er fühlte sich nervös und mehr als unbehaglich, war von der Flachheit der Ideen, die man gegenseitig austauschte, angewidert, und wurde wie die Leute, von denen Pierre Nicole sagt, dass sie überall empfindlich und gereizt seien. Es kam so weit, dass er sich fortwährend seine Haut aufritzte. Geradezu unerträglich litt er bei der Lektüre patriotischer oder sozialer Thorheiten, die jeden Morgen von den Zeitungen unter die Leute gebracht und mit denen die ehrsamen Leser abgespeist wurden.
Er begann schon von einer abgeschiedenen. Thebaïde, einer komfortablen Wüstenei, einer unbeweglichen und angenehm durchwärmten Arche zu träumen, wohinein er sich vor der wachsenden Flut des schon mehr unmenschlichen Blödsinns zu flüchten gedachte.
Eine einzige Leidenschaft, das Weib, hätte ihn von dieser allgemeinen Verachtung, welche ihn erdrückte, zurückhalten können, aber diese Saite war ja leider auch verbraucht. Hatte er doch an dieser Fleischestafel mit dem launenhaften Heisshunger eines Menschen gelagert, der an krankhafter Esslust leidet, und dessen Gaumen bald abgestumpft und übersättigt ist. Während der Zeit, in der er mit den Junkern verkehrte, hatte er an ihren tollen Gelagen teilgenommen, bei denen trunkene Dirnen sich zum Nachtisch die Kleider lüften und mit dem Kopfe, wenn nicht unter, so doch auf dem Tische liegen. Selbstredend war er hinter den Coulissen gewesen; er hatte es mit Schauspielerinnen und Sängerinnen versucht und ausser der den Frauen angeborenen Dummheit die rasende Eitelkeit elender Küstlerinnen zu ertragen gehabt; er hatte mit galanten, ihrer Schönheit wegen berühmten Frauenzimmern in Verbindung gestanden und gewaltiges Geld an gewisse Agenturen bezahlt, wofür er sehr zweifelhafte Vergnügungen genossen, um sich schliesslich übersättigt und dieses gleichförmigen Luxus, dieser erkünstelten Zärtlichkeiten überdrüssig, in die untersten Schichten der Gesellschaft zu stürzen. Hier hoffte er seine nimmersatte Gier durch den Kontrast neu aufstacheln und seine schlummernde Sinnlichkeit durch die aufreizende Unreinheit des Elends wieder anfachen zu können.
Doch was er auch versuchen mochte, ein ungeheurer Weltschmerz drückte ihn nieder. Er gab dennoch den Kampf nicht auf. Er nahm seine letzte Zuflucht zu den gefährlichen Liebkosungen der Virtuosinnen; seine Gesundheit wurde schwach und seine Nerven zermürbten mehr und mehr. Sein Nacken wurde empfindlich und seine Hand fing schon zu zittern an. Allerdings hielt er sie noch gerade, sobald er einen schweren Gegenstand ergriff, doch war sie kraftlos, sobald er etwas Leichtes, zum Beispiel ein Glas zu Munde führen wollte.
Die Prognose der Ärzte beunruhigte ihn. Es war Zeit, diesem Leben Einhalt zu thun und auf jene Experimente zu verzichten, die nur die letzten Kräfte raubten. Während einiger Zeit verhielt er sich ruhig; aber sein Gehirn erhitzte sich bald von neuem und rief ihn wieder zu den Waffen. Wie die jungen Mädchen in der Reife ein Verlangen nach allen möglichen aufreizenden Dingen empfinden, kam er dahin, sich ganz absonderlich sinnliche Freuden und Genüsse auszumalen und sich solchen hinzugeben. Dies aber war der Anfang vom Ende. Übersättigt und erschöpft von allem verfielen seine überreizten Sinne einer Art Lethargie — das sichere Anzeichen eines herannahenden Unvermögens.
Er kam dann wieder von seinen Verirrungen ernüchtert, entsetzlich ermattet zurück, ein Ende herbeisehnend, vor dem die Feigheit seines in Sinnlichkeit versunkenen Charakters zurückschauderte.
Seine Idee, sich irgendwo fern von der Welt niederzulassen, sich gleichsam in einem Winkel einzunisten und wie ein Kranker zu leben, der die Strasse mit Stroh bedecken lässt, um den Lärm des unerbittlichen Lebens zu dämpfen, wurde immer stärker in ihm.
Zudem war auch der Zeitpunkt gekommen, einen Entschluss zu fassen, denn seine Vermögensverhältnisse erschreckten ihn. Den grössten Teil seines Erbgutes hatte er thörichterweise längst vergeudet, und der Rest steckte in Ländereien, die ihm lächerlich wenig einbrachten.
Er entschloss sich daher, Schloss Lourps zu verkaufen, wohin er doch nicht mehr ging, und wo ihn keine Erinnerung und kein Bedauern fesselte; er liquidierte ebenfalls seine andern Güter, kaufte sich Staatspapiere und machte sich in solcher Weise ein jährliches Einkommen von 50,000 Franken. Er behielt ausserdem noch eine ansehnliche Summe zurück, die er für den Kauf und die Einrichtung des Häuschens bestimmte, in welchem er in völliger Stille und Zurückgezogenheit leben wollte.
Er suchte die Umgegend von Paris ab und entdeckte ein kleines Häuschen hoch oben in Fontenay-aux-Roses, das billig zu verkaufen war, weil es an einem entlegenen Platze ganz ohne Nachbarn in der Nähe der Feste lag. Sein Traum erfüllte sich, denn in diesem Orte, der wenig von Parisern heimgesucht ist, war er ziemlich sicher, die gewünschte Zurückgezogenheit zu finden. Die Schwierigkeit der unzuverlässigen Verbindung mittels Eisen- und Pferdebahn, die am Ende des Städtchens stationiert waren, und die gingen und kamen, wie es ihnen passte, beruhigte ihn sehr. Wenn er an diese neue Existenz dachte, die er sich daselbst gründen wollte, empfand er eine grosse Freude, und dies um so mehr, als die Wohnung ziemlich weit vom Seineufer entfernt lag, so däss ihn der Menschenstrom selbst nicht erreichte, während er dennoch in der Nähe der Hauptstadt verblieb, so dass ihm seine Zurückgezogenheit nicht gerade fühlbar wurde.
Er schickte die Maurer in das neu erstandene Haus, und eines Tages, ohne irgend jemand etwas von seinen Plänen zu verraten, verkaufte er sein Mobiliar, entliess seine Diener und verschwand, ohne seine Adresse zu hinterlassen.
Erstes Kapitel.
Mehr als zwei Monate vergingen noch, bevor sich Herzog Jean in die stille Zurückgezogenheit seines Häuschens in Fontenay vergraben konnte. Einkäufe aller Art nötigten ihn, noch eine Weile in Paris zu verbleiben und die Stadt oft von einem Ende bis zum andern zu durchlaufen.
Lange hatte er nachgeforscht und gegrübelt, ehe er die neue Wohnung endlich den Tapezierern überlassen konnte. —
Vormals, da er noch schöne Frauen zu sich kommen Hess, hatte er ein Boudoir nach seiner Angabe einrichten lassen, wo sich inmitten kleiner geschnitzter Möbel aus hellem japanischen Kampferholz unter einem Zelt von indischem Rosa- Atlas der nackte Körper beim künstlichen Wiederschein des bauschigen Stoffes noch zarter färbte.
Jenes Gemach, dessen grosse Spiegel sich beständig reflektierten und so eine ganze Reihe von Rosa-Boudoirs darstellten, war bei den Damen der galanten Welt sehr berühmt gewesen; denn es machte ihnen grosses Vergnügen, ihre Nacktheit in dieses sanfte Inkarnat zu tauchen, wie auch den starken Duft der Möbel einzuatmen.
So hatte er unter anderem aus Hass und Verachtung seiner Kindheit unter dem Plafond dieses Boudoirs einen kleinen Käfig aufgehängt, in dem ein kleines Heimchen zirpte, wie er's oft in der Asche der hohen Kamine im Schlosse Lourps gehört, während jener langen stillen Abende, die er bei seiner Mutter zubringen musste; und die Erinnerung daran, wie an das Alleinsein in seiner traurigen Jugend stieg in wirrem Durcheinander vor ihm auf. Bei den Bewegungen des Weibes, welches er liebkoste, und dessen Geschwätz oder Lachen seine Vision verscheuchte und ihn plötzlich in die Wirklichkeit versetzte, — in diesem so weltlichen Boudoir entstand ein Kampf in seiner Seele, ein Bedürfnis, alle die erlittenen Trübsale zu rächen, eine Wut, durch schändliche Gemeinheiten die Familienerinnerungen zu be26 sudeln, das rasende Verlangen, auszukeuchen auf diesem Menschenleib, bis zum letzten Tropfen die wahnsinnigsten der sinnlichen Verirrungen auszukosten.
Dann wieder einmal, wenn der Spleen ihn packte und wenn bei nassem Herbstwetter der Widerwille gegen sein Heim und gegen den trüben wolkenschweren Himmel draussen ihn erfasste, dann flüchtete er sich an das verborgene Plätzchen, bewegte leise den Käfig und beobachtete, wie derselbe sich rings herum unzählige Male wieder-spiegelte, bis es seinen trunkenen Augen endlich vorkam, als ob der Käfig sich nicht mehr bewegte, dass aber das ganze Boudoir schwanke und sich drehe wie in einem sanften rosa Walzer.
Ein anderes Mal, als Jean des Esseintes sich wieder durch seine Sonderbarkeit auszeichnen wollte, hatte er ein Möblement nach seltsamem Geschmack zusammengestellt. Er teilte seinen Salon in eine Reihe von Nischen, die alle verschieden ausgeschmückt waren und die miteinander vereinigt werden konnten. Es waltete hier eine tolle Übereinstimmung von freundlichen und düstern, von zarten und krassen Farben. Dann liess er sich in einer dieser Nischen nieder, deren Dekoration ihm am besten mit der Eigenart des Werkes, welches er gerade las, zu harmonieren schien.
Schliesslich hatte er noch einen hohen Saal herrichten lassen, in dem er seine Lieferanten empfing. Sie mussten sich nebeneinander in eine Art von Kirchenstühlen setzen. Hier bestieg er eine hohe Kanzel, von der herab er ihnen eine Predigt über die Eitelkeit und das Geckentum der Welt hielt. Er forderte von hier aus seinen Schuhmacher und Schneider feierlich auf, sich aufs genaueste nach seinem päpstlichen Schreiben hinsichtlich des Schnittes zu richten, wobei er sie mit einem pekuniären Kirchenbann bedrohte, so sie nicht die in seinem väterlichen Ermahnungsschreiben und seinen Encykliken gegebenen Anweisungen buchstäblich zur Ausführung brächten.
So erlangte er bald den Ruf eines höchst excentrischen Menschen, den er dadurch zu krönen suchte, dass er sich Anzüge aus weissem Sammt anfertigen liess; wie er auch Westen aus Goldbrokat trug und statt der Krawatte einfach einen grossen Veilchenstrauss in den weiten Ausschnitt seines Hemdes steckte. Dann gab er den Litteraten oft grossartige Diners, unter anderm ein Trauerdiner nach dem Muster des achtzehnten Jahr-hünderts, um ein ganz unbedeutendes kleines Missgeschick, das ihm zugestossen, klassisch zu feiern.
Der Esssaal war ganz schwarz ausgeschlagen. Er führte nach dein völlig umgestalteten Garten hinaus, dessen Alleen zu diesem Zweck mit feinem Kohlenstaub bestreut waren; das kleine mit Basaltstein umrandete Wasserbecken war mit schwarzer Tinte gefüllt, die Gebüsche bildeten Fichten und Cypressen. Die Mahlzeit wurde auf einem schwarzen Tischtuch serviert, auf dessen Mitte sich Blumenkörbe, mit Veilchen und Skabiosen gefüllt, befanden. In hohen Kandelabern brannten grünliche Flammen, und Wachskerzen in Armleuchtern erhellten den Saal. Ein unsichtbares Orchester spielte Trauermärsche, und die Gäste wurden von nackten Negerinnen, bekleidet mit Pantoffeln und kleinen Strümpfen aus Silbergewebe, die mit glänzenden Kugelchen besäet waren, bedient.
Man ass von Tellern mit schwarzein Rande: Schildkrötensuppe, russisches Schwarzbrot, reife türkische Oliven, Kaviar, Seebarben (ein im Süden von Frankreich sehr beliebtes Gericht). Wildpret in schwarzer Sauce, so schwarz als wär's Lakritzensaft und Stiefelwichse, Trüffel- puree, Schokoladenpudding, dem dann ganz dunkle Blutpfirsiche, blauschwarze Traunen, Maulbeeren und schwarze Kirschen folgten. Man trank aus dunklen Gläsern die Weine von Limagne und Roussillon, von Tenedos, Val de Peñas und Porto und labte sich schliesslich nach dem Kaffee mit Nussschnaps, Kwas, Porter und Stout.
Die Einladungen zu diesem Diner waren auf Papier mit breitem, schwarzem Trauerrand geschrieben.— —
Aber diese Extravaganzen und Tollheiten, in denen er früher seinen Ruhm suchte, hatten sich erschöpft.
Heute gedachte er nur mit Verachtung jener kindischen Albernheiten und veralteten Prahlereien, jener absurden Kleidung und seltsamen Ausschmückungen seiner Wohnung. Jetzt beabsichtigte er, sich einfach ein bequemes Heim zu seinem persönlichen Vergnügen zu schaffen und nicht das Staunen anderer zu wecken,
Er hatte jetzt nur vor, sich eine ruhige, wenn auch barocke Wohnung einzurichten, die sich für seine künftige einsame Lebensweise am besten eignen sollte.
Als das Haus in Fontenay von seinem Architekten schliesslich hergestellt und nach seinen Wünschen und Plänen eingerichtet war, und als ihm nur noch die innere Ausschmückung zu erledigen übrig blieb, da stellten sich ihm die ersten Schwierigkeiten in den Weg.
Das was er wollte, waren nämlich Farben, welche beim Lampenlichte Stich hielten. Ob sie bei Tage hart oder unschön, war ihm gleich, da er die Nacht zum Tage zu machen gedachte, da er sich sagte, dass man dann erst ganz allein sei, und der Geist erst wirklich bei der näheren Berührung der Schatten der Nacht belebt und erregt werde. Er fand eine gewisse Befriedigung darin, sich ganz allein in einem grossen, hell erleuchteten Räume aufzuhalten, während alles um ihn herum wie ausgestorben war,
Sorgfältig überlegend wählte er die Farben.
Blau wird bei Licht ein ungewisses Grün; und wenn es Kobalt oder Indigoblau ist, so wird es schwarz aussehen; ist es hell, so verändert es sich in grau, und ist es blau wie der Türkis, so nimmt es eine trübe eisige Färbung an, es sei denn, dass man es mit einer anderen Farbe mischt; sonst kann man es kaum in einem Raum verwerten. Andererseits nimmt das Eisengrau ebenfalls eine unfreundlich schwere Färbung an; Perlgrau verliert seine Zartheit und verwandelt sich in schmutziges Weiss; Braun wirkt trübe und erkaltend; und was Dunkelgrün, Kaisergrün und Olivengrün anbelangt, so hat es denselben Nachteil wie Dunkelblau und verschmilzt mit Schwarz; bleiben also nur noch die blassgrüneren Farben, wie Pfauengrün, dann Zinnober, die Lackfarben, hier aber verjagt das Licht das Blau und lässt das Gelb hervortreten, welches wieder einen unnatürlich verschwommenen Ton annimmt.
Es war auch nicht daran zu denken, Lachsfarbe, Maisgelb oder Rosenrot zu nehmen, denn diese weichen Farben standen im Widerspruch mit den Gedanken seiner Abgeschiedenheit; unmöglich war ebenfalls Veilchenblau, da es bei Licht verschwimmt und das Rot darin allein des Abends hervortritt, doch was für ein Rot! Dick und klebrig! Es schien ihm ausserdem überflüssig, zu dieser Farbe seine Zuflucht zu nehmen, denn wenn man ein wenig Santonine einmischt so erscheint es violett; diese Farbe ist nicht leicht zur Wandbekleidung zu verwenden.
Er nahm daher von diesen Farben Abstand, und so blieben ihm nur noch drei übrig: Orangegelb, Citronengelb und Rot.
Er zog das Orangegelb vor, indem er durch sein eigenes Beispiel die Wahrheit einer Theorie bestätigte, welche er im Übrigen für mathematische Richtigkeit erklärte: nämlich, dass eine Harmonie zwischen der sinnlichen Natur eines Menschen, der wirklich Künstler ist, und der Farbe existiert, welche sein Auge besonders lebhaft sieht.
Wenn man die grosse Menge beiseite lässt, deren grobe Netzhaut weder die eigenartige Harmonie der Farben bemerkt, noch den geheimnisvollen Reiz ihrer Abstufungen und ihrer Zusammenstellung kennt; wenn man gleichfalls die Bürger- Philister beiseite lässt, welche unempfänglich für die Pracht und den Sieg der starken kräftigen Nuancen sind, und um sich nur auf diejenigen zu beschränken, deren Augen durch Litteratur und Kunst verfeinert sind, so erscheint es zweifellos, dass das Auge desjenigen, der Ideales träumt und der Illusionen bedarf, gewöhnlich eine Vorliebe für Blau und dessen Abstufungen, sowie für die lila und perlgraue Farbe habe, vorausgesetzt, dass diese Nuancen weich und verschwommen bleiben und nicht die Grenze überschreiten, wo sie in ein bestimmtes Violett und scharfes Grau übergehen.
Diejenigen aber, die frei und ungebunden leben, kräftige Sanguiniker, starke energische Menschen sind, gefallen sich meistens in schimmernden Farben, wie Rot und Gelb, wie sie auch die Zimbelschläge des Zinnobers und der Chromfarben lieben, die sie blenden und berauschen.
Die geschwächten und nervösen Menschen dagegen, deren sinnlicher Appetit nach Speisen sucht, welche scharf gewürzt sind, — die Augen dieser hektischen, überreizten Naturen lieben fast alle die krankhaft aufregende Farbe mit täuschendem Glänze, mit scharfem, unruhigem Wechsel: das Orangegelb.
Die Wahl, welche der Herzog Jean treffen würde, liess also kaum Zweifel zu; dennoch aber entstanden neue Schwierigkeiten, denn wenn auch das Rot und Gelb sich bei Lichte glänzend bewährten, so geschieht das nicht immer bei ihrer Zusammenstellung. Das Orangegelb verschärft und verwandelt sich oft in Dunkelrot oder gar in Feuerrot.