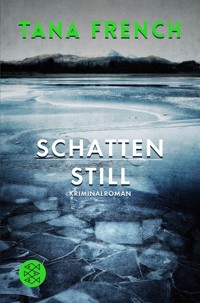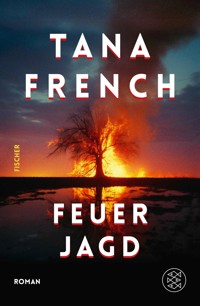Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mordkommission Dublin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein Toter. Acht Mädchen. Nur ein Tag für die Wahrheit. Mord im Dubliner Internat: der psychologisch-literarische Kriminalroman von Tana French; Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. »Überwältigend. Die Sprache glüht.« Stephen King »Absolut hypnotisierend.« Gillian Flynn Vor einem Jahr ist im Park des traditionsreichen Mädcheninternats St. Kilda der sechzehnjährige Chris Harper erschlagen worden. Nun hängt sein Bild am Schwarzen Brett – mit der Überschrift: ICH WEISS, WER IHN GETÖTET HAT. Nur eines von acht Mädchen kann die Karte aufgehängt haben. In zwei Cliquen stehen sie sich gegenüber – unverbrüchliche Freundinnen, erbarmungslose Feindinnen. Der junge Detective Stephen Moran kann die toughe Ermittlungsleiterin Antoinette Conway überreden, ihn mit nach St. Kilda zu nehmen. Denn Stephen kennt eines der Mädchen, Holly Mackey, aus einem früheren Fall. Die Detectives wissen beide, was auf dem Spiel steht, auch für sie selbst. Doch sie haben unterschätzt, in welch verfängliches Netz sie sich begeben. Tana Frenchs fünfter Kriminalroman
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 9 min
Ähnliche
Tana French
Geheimer Ort
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Dana, Elena, Marianne und Quynh Giao, die zum Glück ganz anders waren.
Prolog
Da läuft oft so ein Song im Radio, aber Holly kriegt immer nur ein paar Fetzen davon mit. Remember oh remember back when we were, eine Frauenstimme, klar und eindringlich, der schnelle, leichtfüßige Beat, der dich auf die Zehenspitzen hebt und deinen Puls antreibt mitzuhalten, und dann ist es vorbei. Sie will die anderen immer fragen: Was ist das?, aber nie kriegt sie genug Text mit, um die Frage zu stellen. Immer rutscht der Song durch die Ritzen, wenn sie gerade über irgendwas Wichtiges reden oder wenn sie schnell zum Bus müssen. Und wenn sie dann wieder ruhig werden, ist er weg, alles still, oder Rihanna oder Nicki Minaj hämmern die Stille ins Nichts.
Diesmal schallt er aus einem Auto, einem Auto mit offenem Verdeck, um allen Sonnenschein einzusaugen, der in diesem unverhofften Ausbruch des Sommers zu kriegen ist, denn morgen ist es vielleicht schon wieder vorbei damit. Der Song kommt über die Hecke auf den Spielplatz im Park, wo sie Hörnchen mit schmelzender Eiscreme möglichst weit weg von ihren Einkäufen fürs neue Schuljahr halten. Holly – auf der Schaukel, den Kopf nach hinten gelegt, um in den Himmel zu blinzeln und das Sonnenlichtpendel zwischen ihren Wimpern zu bestaunen – setzt sich aufrecht hin und lauscht. »Der Song da«, sagt sie, »was –«, aber im selben Moment fällt Julia ein Klacks Eiscreme ins lange Haar, und sie springt vom Karussell hoch und schreit: »Scheiße!« Und als sie von Becca ein Papiertaschentuch bekommen und sich Selenas Wasserflasche geborgt hat, um das Taschentuch nass zu machen und sich das klebrige Zeug aus den Haaren zu wischen, wobei sie schimpft – hauptsächlich, damit Becca rot wird, wie ihr vielsagender Seitenblick zu Holly verrät –, sie würde ja aussehen, als hätte sie wem einen geblasen, der schlecht zielen kann, ist das Auto längst weg.
Holly isst ihr Eis auf und hängt sich kopfüber an die Schaukelketten, so dass ihre Haare fast die Erde streifen und sie die anderen von unten und von der Seite sehen kann. Julia hat sich auf dem Karussell ausgestreckt und dreht es langsam mit den Füßen. Das Karussell quietscht, ein träges, regelmäßiges Geräusch, beruhigend. Neben ihr liegt Selena auf dem Bauch, kramt genüsslich in ihrer Einkaufstüte und lässt Jules die ganze Arbeit machen. Becca, die sich ins Klettergerüst gefädelt hat, betupft ihr Eis mit der Zungenspitze, um möglichst lange etwas davon zu haben. Verkehrsgeräusche und Jungenstimmen tröpfeln über die Hecke, von Sonne und Entfernung versüßt.
»Noch zwölf Tage«, sagt Becca und schaut zu den anderen, ob sie froh darüber sind. Julia hebt ihr Eishörnchen, als wolle sie ihr zuprosten; Selena stößt mit ihrem Matheheft dagegen.
Die riesengroße Einkaufstüte neben dem Schaukelgestell geht Holly nicht aus dem Kopf, eine Freude, selbst wenn sie nicht dran denkt. Du möchtest am liebsten das Gesicht und beide Hände reinstecken, dieses unberührt Neue an den Fingerspitzen spüren und tief durch die Nase einatmen: glänzende Ringbücher mit Ecken, die noch nicht abgestoßen sind, elegante Buntstifte, so spitz, dass du dich dran stechen kannst, ein Lineal-Set, jeder winzige Millimeterstrich sauber und glatt. Und dieses Jahr auch noch andere Sachen: gelbe Handtücher, von einem Band zusammengehalten und flauschig; Bettwäsche mit breiten gelben und weißen Streifen, in rutschiger Plastikverpackung.
Tschip-tschip-tschip-tschürr ruft ein lauter kleiner Vogel aus der Hitze. Die Luft ist weiß und brennt Dinge von den Rändern nach innen weg. Selena, die aufschaut, ist bloß ein langsames Nachhintenwerfen von Haaren und ein sich öffnendes Lächeln.
»Netzbeutel!«, sagt Julia plötzlich hinauf in den flirrenden Himmel.
»Hmmm?«, fragt Selena in ihren Handfächer aus Pinseln.
»Auf der Ausstattungsliste für Internatsschülerinnen. ›Zwei Netzbeutel für den hauseigenen Wäschedienst.‹ Echt, wo gibt’s die? Und was macht man damit? Und wie sieht so ein Netzbeutel überhaupt aus?«
»Die sind dafür da, dass deine Sachen beim Waschen zusammenbleiben«, sagt Becca. Becca und Selena wohnen schon seit der ersten Jahrgangsstufe im Internat, als sie noch alle zwölf waren. »Damit du hinterher nicht irgendwelche ekligen Unterhosen von jemand anders dabei hast.«
»Mum hat letzte Woche welche für mich besorgt«, sagt Holly und setzt sich auf. »Ich kann sie fragen, wo«, und als sie das sagt, riecht sie den Wäschegeruch zu Hause, der warm aus dem Trockner kommt, während sie und Mum ein Laken ausschütteln und zusammenfalten, Vivaldi im Hintergrund sprudelt. Wie aus dem Nichts verwandelt sich der Gedanke, in der Schule zu wohnen, für einen schauderhaften Augenblick in ein Vakuum in ihr drin, das ihren Brustkorb nach innen saugt. Sie möchte nach Mum und Dad schreien, ihnen in die Arme springen, sich anklammern und betteln und flehen, dass sie für immer zu Hause bleiben darf.
»Holly«, sagt Selena sanft und lächelt nach oben, als das Karussell sie vorbeiträgt. »Es wird super.«
»Klar«, sagt Holly. Becca, die sich an einer Stange vom Klettergerüst festhält und sie beobachtet, ist schlagartig ganz fahrig vor Sorge. »Ich weiß.«
Und es ist vorbei. Nur ein Rest bleibt zurück, macht die Luft körnig und kratzt ihr innen in der Brust: Noch kannst du es dir anders überlegen, tu’s schnell, ehe es zu spät ist, lauf, lauf, lauf bis nach Hause und verkriech dich. Tschip-tschip-tschürr, sagt der laute kleine Vogel, spöttisch und unsichtbar.
»Ich krieg ein Bett am Fenster, das sag ich euch jetzt schon«, sagt Selena.
»Nee, von wegen«, sagt Julia. »Das ist unfair, wo Holly und ich noch nicht mal wissen, wie die Zimmer aussehen. Du wartest gefälligst, bis wir da sind.«
Selena lacht sie aus, während sie langsam durch den heißen verschwommenen Laubschatten kreisen. »Du weißt aber, wie ein Fenster aussieht. Willst du’s, oder willst du’s nicht?«
»Das entscheide ich, wenn ich es sehe. Schluss, aus.«
Becca beobachtet Holly noch immer unter heruntergezogenen Augenbrauen, während sie gedankenverloren an ihrem Eishörnchen knabbert wie ein Kaninchen. »Ich nehm das Bett, das am weitesten von Julia weg ist«, sagt Holly. Die dritte Jahrgangsstufe wohnt in Viererzimmern: Sie werden zu viert sein, zusammen. »Die schnarcht wie ein Büffel, der absäuft.«
»Spinnst du, tu ich gar nicht. Ich schlafe wie eine zarte Märchenprinzessin.«
»Tust du wohl, manchmal«, sagt Becca und wird rot, weil sie sich das getraut hat. »Als ich letztes Mal bei dir zu Hause übernachtet hab, konnte ich’s richtig spüren, als würde der ganze Raum vibrieren«, und Julia zeigt ihr den Stinkefinger, und Selena lacht, und Holly grinst sie an und freut sich wieder wie verrückt auf Sonntag in einer Woche.
Tschip-tschip-tschürr, ruft der Vogel noch einmal, träge jetzt, weich und verschlafen. Und verstummt.
1
Sie kam zu mir. Die meisten Leute bleiben auf Abstand. Ein gestammeltes Murmeln in der Zeugenhotline, Damals, ’95, da hab ich gesehen, wie, kein Name, ein Klick, wenn du nachhakst. Ein anonymer Brief, ausgedruckt und in der falschen Stadt eingeworfen, Papier und Umschlag säuberlich abgewischt. Wenn wir sie kriegen wollen, müssen wir sie aufstöbern. Aber sie: Sie kam zu mir.
Ich erkannte sie nicht. Ich war schon mit Schwung halb die Treppe rauf Richtung Großraumbüro. Der Maimorgen fühlte sich an wie Sommer, saftige Sonne strömte durch die Fenster unten am Empfang, beleuchtete den ganzen Raum mit seinem rissigen Putz. Ich hatte eine Melodie im Kopf, vielleicht summte ich sie sogar.
Ich sah sie, natürlich sah ich sie. Auf dem verkratzten Ledersofa in der Ecke, Arme verschränkt, wippender Fuß. Langer platinblonder Pferdeschwanz; schicke Schuluniform, grün-blauer Schottenrock, blauer Blazer. Die Tochter von irgendwem, dachte ich, wartet auf Daddy, damit er sie zum Zahnarzt bringt. Das Kind vom Superintendenten vielleicht. Auf jeden Fall von jemandem mit mehr Geld als ich. Nicht bloß das Wappen auf dem Blazer, die graziös lässige Haltung, das gereckte Kinn, als könnte der Laden hier ihr gehören, wenn sie bloß den Nerv für den ganzen Papierkram hätte. Dann war ich an ihr vorbei – knappes Nicken für den Fall, dass sie zum Boss gehörte – und griff nach der Tür zum Großraumbüro.
Ich weiß nicht, ob sie mich erkannte. Vielleicht nicht. Es war sechs Jahre her, damals war sie noch ein kleines Mädchen, und an mir ist eigentlich bloß mein rotes Haar auffällig. Gut möglich, dass sie das vergessen hatte. Oder sie hatte mich auf Anhieb erkannt und schwieg aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen.
Sie ließ den Kollegen am Empfang sagen: »Detective Moran, da möchte Sie jemand sprechen« und mit einem Stift aufs Sofa zeigen. »Miss Holly Mackey.«
Sonne huschte mir übers Gesicht, als ich herumfuhr, und dann: na klar. Ich hätte die Augen wiedererkennen müssen. Groß, strahlend blau, der zarte, leicht katzenartige Schwung der Lider, ein blasses, schmucktragendes Mädchen in einem alten Gemälde, ein Geheimnis. »Holly«, sagte ich, Hand ausgestreckt. »Hallo. Lange nicht gesehen.«
Eine Sekunde blinzelten diese Augen nicht, nahmen alles an mir wahr, ohne mir irgendetwas zu verraten. Dann stand sie auf. Sie schüttelte mir noch immer die Hand wie ein kleines Mädchen, zog ihre zu schnell zurück. »Hi, Stephen«, sagte sie.
Ihre Stimme war gut. Klar und kühl, nicht dieses comichafte Quieksen. Der Akzent: gepflegt, aber nicht übertrieben nervig-vornehm. Ihr Dad hätte ihr das nicht durchgehen lassen. Raus aus dem Blazer und rein in die stinknormale öffentliche Schule, wenn sie den mit nach Hause gebracht hätte.
»Was kann ich für dich tun?«
Leiser: »Ich möchte Ihnen was geben.«
Ich war verdutzt. Morgens halb zehn in Schuluniform: Sie schwänzte den Unterricht, und zwar den einer Schule, wo so was auffiel. Ganz sicher hatte sie keine um Jahre verspätete Dankeskarte dabei. »Wirklich?«
»Ja, aber nicht hier.«
Der Seitenblick zu unserem Empfang signalisierte: unter vier Augen. Bei einer Sechzehnjährigen ist man da besser vorsichtig. Und bei der Tochter eines Detective gilt das doppelt. Aber bei Holly Mackey: Holst du jemanden dazu, den sie nicht haben will, bist du ganz schnell unten durch.
Ich sagte: »Suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen.«
Ich arbeite im Dezernat für Ungelöste Fälle. Wenn wir Zeugen vorladen, bilden sie sich ein, sie müssten das nicht weiter ernst nehmen: keine brandheiße Mordermittlung, nirgendwo Pistolen und Handschellen, nichts, was dein Leben durchschüttelt wie eine Schneekugel. Stattdessen irgendwas Altes und Weiches, an den Rändern längst ausgefranst. Wir spielen mit. Unser Hauptvernehmungsraum sieht aus wie das Wartezimmer eines netten Zahnarztes. Gemütliche Sofas, Jalousien, Glastisch mit zerlesenen Illustrierten. Schlechter Tee und Kaffee. Die Videokamera in der Ecke oder der Einwegspiegel hinter einer Jalousie ist leicht zu übersehen, wenn man will, und die meisten wollen. Wird nicht lange dauern, Sir, bloß ein paar Minuten, dann können Sie auch schon wieder nach Hause.
Dorthin ging ich mit Holly. Jede andere in ihrem Alter hätte auf dem ganzen Weg dahin große Augen gemacht und Kopftennis gespielt, aber für Holly war das alles nicht neu. Sie ging den Korridor entlang, als würde sie bei uns wohnen.
Unterwegs sah ich sie mir genauer an. Sie war bisher ziemlich prima geraten. Durchschnittlich groß oder ein bisschen darunter. Schlank, sehr schlank, aber auf natürliche Art: kein Hungerhaken. Vielleicht erst halb ausgeformte Rundungen. Kein Hingucker, jedenfalls noch nicht, aber weiß Gott nicht hässlich – keine Pickel, keine Zahnspange, im Gesicht alles da, wo es hingehörte –, und die Augen hoben sie von der üblichen blonden Massenware ab, ließen dich zweimal hinsehen.
Ein Freund, der sie geschlagen hatte? Angegrapscht, vergewaltigt? Wollte Holly lieber mit mir reden als mit irgendeinem Fremden im Dezernat für Sexualdelikte?
Ich möchte Ihnen was geben. Beweismittel?
Sie ließ die Tür vom Vernehmungsraum hinter uns zufallen, ein Schnippen des Handgelenks und ein Knall. Schaute sich um.
Ich schaltete die Kamera ein, drückte ganz beiläufig auf den Knopf. Sagte: »Setz dich.«
Holly blieb stehen. Fuhr mit dem Finger über das abgewetzte Grün des Sofas. »Der Raum hier ist gemütlicher als die früher.«
»Wie geht’s dir so?«
Sie schaute sich noch immer den Raum an, nicht mich. »Okay. Ganz gut.«
»Möchtest du eine Tasse Tee? Kaffee?«
Kopfschütteln.
Ich wartete. Holly sagte: »Sie sehen älter aus. Früher haben Sie ausgesehen wie ein Student.«
»Und du hast ausgesehen wie ein kleines Mädchen, das sein Stoffpony mit zu den Vernehmungen brachte. Clara, richtig?« Jetzt drehte sie den Kopf in meine Richtung. »Ich würde sagen, wir sehen beide älter aus.«
Zum ersten Mal lächelte sie. Ein kleines, bemühtes Grinsen, das gleiche, das ich in Erinnerung hatte. Damals hatte es etwas Klägliches an sich gehabt und mich jedes Mal gerührt. Das tat es auch diesmal.
Sie sagte: »Es ist schön, Sie zu sehen.«
Mit neun, zehn Jahren war Holly Zeugin in einem Mordfall gewesen. Es war nicht mein Fall, aber ich war derjenige, mit dem sie redete. Ich nahm ihre Aussage auf, bereitete sie auf ihren Auftritt als Zeugin vor Gericht vor. Sie wollte dort nicht aussagen, tat es aber trotzdem. Vielleicht brachte ihr Dad, der Detective, sie dazu. Möglich. Selbst als sie neun war, machte ich mir nicht ein einziges Mal vor, sie ganz zu durchschauen.
»Dito«, sagte ich.
Ein rasches Einatmen, das ihre Schultern hob, ein Nicken – in sich hinein, als hätte irgendwas klick gemacht. Sie ließ ihre Schultasche auf den Boden fallen. Schob einen Daumen unter ihr Revers, um auf das Wappen zu zeigen. Sagte: »Ich geh jetzt aufs Kilda.« Und beobachtete mich.
Schon mein Nicken kam mir anmaßend vor. St. Kilda: die Art von Schule, von der Leute wie ich eigentlich nie was gehört haben sollten. Und das hätte ich auch nicht, wäre da nicht ein toter Junge gewesen.
Mädchengymnasium mit Internat, Privatschule, Villengegend. Nonnen. Vor einem Jahr machten zwei Nonnen einen Morgenspaziergang und sahen bei einer Baumgruppe am Rande des weitläufigen Parks rings um die Schule einen Jungen liegen. Zuerst dachten sie, er würde schlafen, wäre möglicherweise betrunken. Wollten ihn schon ordentlich zusammenstauchen, herausfinden, wessen kostbare Tugend er geraubt hatte. Ein markerschütternder Nonnenstimmendonner: Junger Mann! Aber er rührte sich nicht.
Christopher Harper, sechzehn, von der Jungenschule eine Straße und zwei extrahohe Mauern weiter. Irgendwann in der Nacht hatte ihm jemand den Schädel eingeschlagen.
Der Fall verbrauchte genügend Manpower, um einen Büroblock hochzuziehen, genug Überstunden, um Hypotheken abzubezahlen, genug Papier, um einen Fluss aufzustauen. Ein zwielichtiger Hausmeister, Mädchen für alles, irgendwas: ausgeschlossen. Ein Klassenkamerad, der sich mit dem Opfer geprügelt hatte: ausgeschlossen. Irgendwelche finsteren Ausländer, die bei irgendwelchen finsteren Dingen beobachtet wurden: ausgeschlossen.
Dann nichts. Keine weiteren Verdächtigen, kein Grund, warum Christopher auf dem Gelände vom St. Kilda war. Dann weniger Überstunden und weniger Personal und noch mehr nichts. Du darfst es nicht aussprechen, nicht bei einem so jungen Opfer, aber der Fall war durch. Inzwischen stapelte sich das viele Papier im Keller des Morddezernats. Früher oder später würden unsere Häuptlinge Druck von den Medien kriegen, und der Fall würde bei uns landen, in der Abteilung der Letzten Hoffnung.
Holly zupfte ihr Revers wieder gerade. »Sie wissen das mit Chris Harper«, sagte sie. »Oder?«
»Klar«, sagte ich. »Warst du da schon am Kilda?«
»Ja. Ich bin seit der ersten Stufe da.«
Und dabei beließ sie es, machte mir jeden Schritt schwer. Eine falsche Frage, und sie wäre weg, hätte mich abgeschrieben: zu alt, bloß noch so ein unbrauchbarer Erwachsener, der nichts schnallte. Ich tastete mich behutsam vor.
»Wohnst du im Internat?«
»Die letzten zwei Jahre, ja. Bloß von Montag bis Freitag. Am Wochenende bin ich zu Hause.«
Ich hatte den Wochentag vergessen. »Warst du in der Nacht da, als es passiert ist?«
»In der Nacht, als Chris ermordet wurde.«
Blaublitzende Gereiztheit. Daddys Tochter: keine Nachsicht für vorsichtige Umschreibungen, jedenfalls nicht bei anderen.
»In der Nacht, als Chris ermordet wurde«, sagte ich. »Warst du da?«
»Ich war nicht dabei. Klar. Aber ich war in der Schule, ja.«
»Hast du irgendwas gesehen? Irgendwas gehört?«
Wieder Ärger, diesmal feuriger. »Das haben die mich schon gefragt. Die Detectives vom Morddezernat. Die haben uns alle gefragt, mindestens tausendmal.«
Ich sagte: »Aber dir könnte ja noch was eingefallen sein. Oder du könntest dir überlegt haben, irgendwas doch nicht zu verschweigen.«
»Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, wie so was läuft. Schon vergessen?« Sie scharrte mit den Füßen, war kurz davor zu gehen.
Andere Taktik. »Kanntest du Chris?«
Holly wurde ruhiger. »Nicht besonders gut. Unsere Schulen machen viel zusammen, da trifft man sich eben. Wir waren nicht befreundet oder so, aber unsere Cliquen waren öfter zusammen.«
»Wie war er so?«
Achselzucken. »Ein Junge halt.«
»Mochtest du ihn?«
Erneutes Achselzucken. »Er war einfach da.«
Ich kenne Hollys Dad ein bisschen. Frank Mackey, Undercoverabteilung. Wenn du ihn direkt attackierst, weicht er aus und springt dich von der Seite an; versuchst du’s von der Seite, geht er mit gesenktem Kopf zum Angriff über. Ich sagte: »Du bist hergekommen, weil du mir irgendwas mitteilen willst. Ich habe keine Lust auf Ratespielchen, die ich nicht gewinnen kann. Falls du dir nicht sicher bist, ob du’s mir sagen willst oder nicht, geh wieder und denk noch mal drüber nach. Falls du dir jetzt schon sicher bist, dann spuck’s aus.«
Das gefiel Holly. Fast hätte sie wieder gelächelt, stattdessen nickte sie.
»Wir haben da so ein Schwarzes Brett an der Schule«, sagte sie. »Eine Pinnwand. Im obersten Stock gegenüber vom Kunstraum. Nennt sich Geheimnisort. Wenn du ein Geheimnis hast, zum Beispiel wenn du deine Eltern hasst oder auf einen Typen stehst oder so, kannst du das auf eine Karte schreiben und da aufhängen.«
Es hätte nichts gebracht zu fragen, warum jemand so was machen sollte. Junge Mädchen versteht kein Mensch. Ich habe Schwestern. Ich habe gelernt, einfach den Mund zu halten.
»Gestern Abend war ich mit meinen Freundinnen im Kunstraum – wir arbeiten da an so einem Projekt. Ich hab mein Handy oben vergessen, als wir wieder gingen, hab’s aber erst gemerkt, als wir schon Nachtruhe hatten, deshalb konnte ich es nicht mehr holen. Also bin ich gleich am nächsten Morgen hoch, vor dem Frühstück.«
Das kam viel zu glatt über die Lippen. Keine Pause, kein Blinzeln, kein Stocken. Bei einem anderen Mädchen hätte ich gesagt, die erzählt mir einen vom Pferd. Aber Holly hatte Übung, und sie hatte ihren Dad. Gut möglich, dass er sie jedes Mal verhörte, wenn sie zu spät nach Hause kam.
»Ich hab einen Blick auf das Schwarze Brett geworfen«, sagte Holly. Bückte sich zu ihrer Schultasche, klappte sie auf. »So im Vorbeigehen.«
Und da war sie plötzlich: die Hand, die über der grünen Mappe zögerte. Die eine Sekunde mehr, die sie das Gesicht nach unten zur Tasche gewandt hielt, weg von mir, um es unter dem baumelnden Pferdeschwanz zu verbergen. Da war die Nervosität, auf die ich gewartet hatte. Also doch nicht ganz so softeis-cool und lässig.
Dann richtete sie sich auf und sah mich wieder an, ausdruckslos. Ihre Hand kam hoch, hielt mir die grüne Mappe hin. Ließ los, sobald ich sie berührte, so schnell, dass ich sie fast hätte fallen lassen.
»Das da hing an der Tafel.«
Auf der Mappe stand handschriftlich Holly Mackey, 4L, Sozialkunde. Darin: eine Klarsichthülle. Darin: eine Heftzwecke unten in einer Ecke und eine Karte.
Ich erkannte das Gesicht schneller, als ich Hollys erkannt hatte. Er hatte wochenlang auf jeder Titelseite und jedem Fernsehbildschirm geprangt, auf jeder Dezernatsmitteilung.
Das hier war eine andere Aufnahme. Er blickte über die Schulter nach hinten, vor verwischtem frühlingsgrünen Laub, den Mund zu einem Lachen geöffnet. Gutaussehend. Glänzendes braunes Haar, boygroupmäßig nach vorne zu den dicken dunklen Augenbrauen gekämmt, die nach außen hin schräg abfielen und ihm einen treuherzigen Hundeblick verliehen. Reine Haut, rosige Wangen, ein paar Sommersprossen auf den Wangenknochen, nicht viele. Ein Kinn, das markant geworden wäre, wenn es mehr Zeit gehabt hätte. Ein breites Grinsen kräuselte Augen und Nase. Ein bisschen frech, ein bisschen lieb. Jung, alles, was einem an Grünem und Frischem in den Sinn kommt, wenn man das Wort jung hört. Sommerschwarm, Held des kleinen Bruders, Kanonenfutter.
Unterhalb des Gesichts, quer über dem blauen T-Shirt, klebten Buchstaben, die aus einem Buch ausgeschnitten worden waren, weit auseinander wie in einem Erpresserbrief. Saubere Kanten, akkurat geschnitten.
Ich weiß, wer ihn getötet hat.
Holly beobachtete mich schweigend.
Ich drehte die Hülle um. Eine einfache weiße Karte, wie man sie überall kaufen konnte, um Fotos auszudrucken. Kein Text, nichts.
Ich sagte: »Hast du das angefasst?«
Augen zur Decke. »’türlich nicht. Ich bin in den Kunstraum, hab die da geholt« – die Hülle – »und ein Federmesser. Ich hab die Heftzwecke mit dem Messer rausgefriemelt und die Karte und die Heftzwecke in der Hülle aufgefangen.«
»Gut gemacht. Und dann?«
»Hab ich die Hülle unter meiner Bluse versteckt, bis ich wieder in meinem Zimmer war, und dann hab ich sie in die Mappe getan. Dann hab ich gesagt, mir wäre schlecht, und hab mich wieder ins Bett gelegt. Nachdem die Krankenschwester da war, hab ich mich rausgeschlichen und bin hergekommen.«
Ich fragte: »Warum?«
Holly starrte mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Weil ich dachte, das da würde euch vielleicht interessieren. Falls nicht, können Sie’s ja wegschmeißen, und ich mach, dass ich zurück zur Schule komme, ehe die merken, dass ich nicht mehr da bin.«
»Es interessiert mich. Ich bin sogar froh, dass du das gefunden hast. Ich frage mich nur, warum du es nicht einer von deinen Lehrerinnen gezeigt hast oder deinem Dad.«
Sie blickte hoch zur Wanduhr, bemerkte dabei die Videokamera. »Scheiße. Da fällt mir ein. Die Krankenschwester will in der großen Pause noch mal nach mir sehen, und wenn ich nicht da bin, flippen die aus. Können Sie nicht in der Schule anrufen und sagen, Sie wären mein Dad und dass ich bei Ihnen bin? Mein Großvater wäre gestorben und Sie hätten mich angerufen und es mir erzählt, und ich wäre einfach los, ohne Bescheid zu sagen, weil ich keine Lust hatte, zur Schulpsychologin geschickt zu werden, um über meine Gefühle zu reden.«
Das kam mir ganz recht. »Ich ruf gleich in der Schule an. Aber ich werde mich nicht als dein Dad ausgeben.« Entnervtes, explosionsartiges Ausatmen von Holly. »Ich sag einfach, du hast was gehabt, was du uns geben wolltest, und dass du genau das Richtige getan hast. Damit müsste dir doch Ärger erspart bleiben. Oder?«
»Meinetwegen. Können Sie denen denn wenigstens sagen, dass ich nicht drüber reden darf? Damit die mich nicht nerven?«
»Kein Problem.« Chris Harper lachte mich noch immer an, genug Energie im Schwung seiner Schultern, um halb Dublin mit Strom zu versorgen. Ich schob ihn in die Mappe zurück, klappte sie zu. »Hast du irgendwem davon erzählt? Vielleicht deiner besten Freundin? Ich meine, das wäre völlig okay. Ich muss es bloß wissen.«
Ein Schatten glitt über die Rundung von Hollys Wangenknochen, machte ihren Mund älter, weniger arglos. Unterlegte ihre Stimme mit etwas. »Nein. Ich hab’s keinem erzählt.«
»Okay. Dann ruf ich jetzt in der Schule an, und dann nehme ich deine Aussage auf. Soll dein Dad oder deine Mom dabei sein?«
Das holte sie wieder zurück. »Ach du Schande, nein. Muss denn jemand dabei sein? Können Sie das nicht allein machen?«
»Wie alt bist du?«
Sie erwog zu lügen. Entschied sich dagegen. »Sechzehn.«
»Dann muss eine geeignete erwachsene Person dabei sein. Damit ich dich nicht einschüchtern kann.«
»Sie schüchtern mich nicht ein.«
Ach nee. »Ich weiß, klar. Trotzdem. Du wartest jetzt hier, machst dir eine Tasse Tee, wenn du willst. Ich bin in zwei Minuten wieder da.«
Holly ließ sich aufs Sofa plumpsen. Verdrehte den Körper wie eine Brezel. Beine angezogen, Arme um den Körper geschlungen. Zog die Spitze ihres Pferdeschwanzes nach vorn und fing an, darauf herumzukauen. Das Gebäude war wie üblich überhitzt, aber sie schien zu frieren. Sie schaute nicht zu mir, als ich ging.
Dezernat für Sexualdelikte, zwei Etagen tiefer, da ist immer eine Sozialarbeiterin in Bereitschaft. Ich holte sie, nahm Hollys Aussage auf. Fragte die Frau hinterher im Flur, ob sie Holly zurück zum St. Kilda fahren würde – Holly warf mir dafür einen vernichtenden Blick zu. Ich sagte: »So weiß die Schule auf jeden Fall, dass du wirklich bei uns warst und nicht bloß einen Freund überredet hast anzurufen. Erspart dir Scherereien.« Ihr Blick besagte, dass ich ihr nichts vormachen konnte.
Sie fragte mich nicht, wie es nun weiterging, was wir wegen der Karte unternehmen würden. So dumm war sie nicht. Sie sagte bloß: »Bis bald.«
»Danke, dass du gekommen bist. Du hast das Richtige getan.«
Holly erwiderte nichts darauf. Sie lächelte bloß andeutungsweise und winkte kurz, halb sarkastisch, halb nicht.
Ich sah ihrem geraden Rücken nach, der sich über den Flur entfernte, während die Sozialarbeiterin neben ihr hertrippelte und versuchte, mit ihr zu plaudern, als mir etwas auffiel: Sie hatte meine Frage nicht beantwortet. War ihr ausgewichen, geschickt wie auf Inlineskates, und hatte einfach weitergemacht.
»Holly.«
Sie drehte sich um, zog den Rucksackriemen über die Schulter. Argwöhnisch.
»Was ich dich vorhin gefragt hab. Wieso bist du damit zu mir gekommen?«
Holly taxierte mich. Beunruhigend, dieser Blick, wie wenn man bei einem Gemälde das Gefühl hat, die Augen würden einem folgen.
»Damals«, sagte sie. »Das ganze Jahr lang sind alle wie auf Zehenspitzen um mich rumgeschlichen. Als ob ich einen Nervenzusammenbruch kriegen würde und in eine Zwangsjacke gesteckt werden müsste, mit Schaum vor dem Mund, wenn sie bloß ein falsches Wort sagten. Sogar Dad – der hat so getan, als würde ihm das alles überhaupt nichts ausmachen, aber ich hab ihm angesehen, dass er sich Sorgen gemacht hat, andauernd. Es war alles einfach nur ahhh!« Ein gepresster Laut purer Wut, Finger steif abgespreizt. »Sie waren der Einzige, der sich nicht benommen hat, als würde ich demnächst denken, ich wäre ein Huhn. Sie waren einfach so, Okay, das ist jetzt echt ätzend, aber was soll’s, viele Leute erleben noch Schlimmeres, und die kommen auch irgendwie damit klar. Also los, bringen wir’s hinter uns.«
Es ist sehr, sehr wichtig, im Umgang mit minderjährigen Zeugen Feingefühl an den Tag zu legen. Bei uns gibt es für so was Workshops und so weiter, Powerpoint-Präsentationen, wenn wir richtig Glück haben. Aber ich weiß noch, wie es war, Kind zu sein. Viele vergessen das. Ein kleiner Schuss Feingefühl: prima. Ein Schuss mehr: okay. Noch ein Schuss, und du träumst von einer sauberen Geraden gegen den Kehlkopf.
Ich sagte: »Zeuge sein ist wirklich ätzend. Für jeden. Du hast es besser hingekriegt als die meisten.«
Diesmal kein Sarkasmus in ihrem Lächeln. Jede Menge anderes, aber kein Sarkasmus. »Können Sie denen in der Schule bitte erklären, dass ich nicht denke, ich bin ein Huhn?«, fragte Holly die Sozialarbeiterin, die noch eine Portion Feingefühl mehr in ihren Gesichtsausdruck legte, um ihre Verwirrung zu kaschieren. »Nicht mal ein winziges bisschen?« Und ging.
Eines sollten Sie über mich wissen: Ich habe Pläne.
Das Erste, was ich machte, sobald ich Holly und der Sozialarbeiterin zum Abschied gewinkt hatte, war, den Harper-Fall im Computer aufzurufen.
Ermittlungsleitung: Detective Antoinette Conway.
Eine Frau im Morddezernat sollte nichts Besonderes sein, sollte nicht mal besonders erwähnenswert sein. Aber ein Großteil der alten Knaben da sind auch alte Schule und ein Großteil der jungen ebenso. Gleichberechtigung ist papierdünn, ein Fingernagel genügt, um sie wegzukratzen. In der Gerüchteküche heißt es, Conway habe den Job bekommen, weil sie mit irgendwem ins Bett gegangen ist oder weil sie als Alibifrau gebraucht wurde. Sie hat noch was anderes in sich als das übliche käsige, kartoffelgesichtige Irische: blasse Haut, auffallend kräftige Nase und Wangenknochen, blauschwarz glänzendes Haar. Ein Jammer, dass sie nicht im Rollstuhl sitzt, sagt die Gerüchteküche, sonst wäre sie längst Commissioner.
Ich kannte Conway schon, ehe sie berühmt wurde, zumindest vom Sehen. Auf der Polizeischule war sie zwei Jahrgänge hinter mir. Hochgewachsen, Haare straff nach hinten gebunden. Gebaut wie eine Läuferin, lange Gliedmaßen, lange Muskeln. Kinn immer hoch, Schultern immer zurück. In ihrer ersten Woche schwirrten jede Menge Kerle um Conway herum: wollten ihr bloß dabei helfen, sich einzugewöhnen, ist doch nett, freundlich zu sein, ist doch nett, nett zu sein, reiner Zufall, dass die Frauen, die nicht ihr Aussehen hatten, anders behandelt wurden. Was auch immer die Jungs von ihr zu hören kriegten, nach der ersten Woche gaben sie die Anmachversuche auf. Stattdessen machten sie ihr das Leben schwer.
In der Ausbildung zwei Jahre hinter mir. Wechselte ein Jahr nach mir von der Schutzpolizei zur Kripo. Wurde etwa zur selben Zeit, als ich ins Dezernat für Ungelöste Fälle kam, ins Morddezernat versetzt.
Ungelöste Fälle ist gut. Sogar verdammt gut für jemanden wie mich: Dubliner Junge aus dem Arbeitermilieu, der Erste in meiner Familie, der Abi machte, statt eine Lehrstelle zu suchen. Ich kam mit sechsundzwanzig zur Kripo, schaffte es mit achtundzwanzig aus dem Pool für Sonderfahnder zur Sitte – Hollys Dad hatte da ein paar Strippen für mich gezogen – und in der Woche, in der ich dreißig wurde, zu den Ungelösten Fällen. Ich hoffte, dass da keiner irgendwelche Strippen für mich gezogen hatte, fürchtete aber, dass doch. Jetzt bin ich zweiunddreißig. Zeit für den nächsten Schritt nach oben.
Ungelöste Fälle ist gut. Morddezernat ist besser.
Hollys Dad kann da keine Strippen mehr für mich ziehen. Der Boss kann ihn nicht ausstehen. Auf mich steht er auch nicht gerade.
Dieser Fall damals, bei dem Holly meine Zeugin war: Da habe ich die Festnahme durchgeführt. Ich klärte den Festgenommenen über seine Rechte auf, ich legte ihm Handschellen an, ich unterschrieb das Festnahmeprotokoll. Ich war bloß ein Sonderfahnder, hätte alles Wichtige, auf das ich stieß, schnurstracks nach oben weitergeben sollen; hätte schön brav im Soko-Raum sitzen und irgendwelche Hab-nix-gesehen-Aussagen abtippen sollen. Ich nahm die Festnahme trotzdem vor. Das hatte ich mir verdient.
Noch etwas sollten Sie über mich wissen: Ich erkenne meine Chance, wenn ich sie sehe.
Diese Festnahme damals und die kleine Unterstützung von Frank Mackey halfen mir aus dem Pool für Sonderfahnder. Diese Festnahme verschaffte mir die Chance bei den Ungelösten Fällen. Diese Festnahme verschloss mir die Tür zum Morddezernat.
Ich hörte das Klicken zusammen mit dem Klicken der Handschellen. Sie haben das Recht zu schweigen, und ich wusste, ich würde für unabsehbare Zeit auf der schwarzen Liste des Morddezernats landen. Aber die Festnahme anderen zu überlassen hätte mich auf die Versagerliste gebracht und dazu verdammt, die nächsten Jahrzehnte für andere Leute Hab-nix-gesehen-Aussagen zu tippen. Alles, was Sie sagen, wird schriftlich festgehalten und kann als Beweismittel verwendet werden. Klick.
Du siehst deine Chance, du ergreifst sie. Ich war sicher, diese Tür würde sich wieder öffnen, irgendwann einmal.
Sieben Jahre später wurde mir die Realität allmählich klar.
Das Morddezernat ist das Vollblutgestüt. Es ist strahlend und schillernd, ein geschmeidiges Wogen wie das Spiel gestählter Muskeln, es verschlägt dir den Atem. Das Morddezernat ist ein Brandzeichen auf deinem Arm, wie das eines Elitesoldaten, eines Gladiators, und verkündet für den Rest deines Lebens: Einer von uns. Den Besten.
Ich will ins Morddezernat.
Ich hätte die Karte und Hollys Aussage mit einem kurzen Vermerk rüber zu Antoinette Conway schicken können, Schluss, Ende, aus. Noch vorschriftsmäßiger wäre gewesen, sie anzurufen, sobald Holly die Karte rausrückte, und ihr die Sache zu überlassen.
Von wegen. Das war meine Chance. Die einzige, die ich je kriegen würde.
Der zweite Detective im Fall Harper: Thomas Costello. Das alte Schlachtross des Morddezernats. Ein paar hundert Jahre Bulle, seit ein paar Monaten pensioniert. Wenn beim Morddezernat eine Stelle frei wird, weiß ich das. Antoinette Conway hatte sich noch keinen neuen Partner gesucht. Sie war noch immer Einzelkämpferin.
Ich ging zu meinem Boss. Er durchschaute natürlich, was ich vorhatte, aber er mochte die Vorstellung, dass es ein gutes Licht auf uns werfen würde, wenn wir an der Lösung eines publicityträchtigen Falls beteiligt wären. Und er mochte die Aussicht auf ein hoffentlich größeres Budget im kommenden Jahr. Mich mochte er auch, aber nicht so sehr, dass ich ihm fehlen würde. Er hatte kein Problem damit, mich rüber zum Morddezernat gehen zu lassen, um Conway ihre Glücklicher-Mittwoch-Karte persönlich zu überreichen. Keine Eile mit der Rückkehr, sagte der Boss. Falls das Morddezernat mich in der Sache haben wolle, kein Problem.
Conway würde mich nicht haben wollen. Sie würde mich trotzdem kriegen.
Conway war in einer Vernehmung. Ich setzte mich auf einen leeren Schreibtisch im Großraumbüro, blödelte ein bisschen mit den Jungs rum. Es wird nicht mehr viel rumgeblödelt; das Dezernat ist hektisch. Wenn du da reinkommst, spürst du, wie sich dein Puls beschleunigt. Telefone klingeln, Computertastaturen klickern, Leute kommen und gehen; nicht hastig, aber schnell. Trotzdem nahmen sich ein paar von ihnen die Zeit für ein paar Sticheleien. Du willst zu Conway? Hab mir schon gedacht, dass es der wer besorgt, hat die ganze Woche noch keinen angeschnauzt. Hätte aber nie gedacht, dass sie mit ’nem Kerl in die Kiste geht. Danke, dass du dich für uns opferst, Mann. Hast du auch alle Impfungen? Hast du deinen Latex-Anzug dabei?
Sie waren alle ein paar Jahre älter als ich, alle ein bisschen schicker gekleidet. Ich grinste und hielt die Klappe, mehr oder weniger.
»Bin erstaunt, dass sie auf Rothaarige steht.«
»Ich hab wenigstens Haare, Mann. Frauen stehen nicht auf Glatze.«
»Das sieht mein Prachtweib zu Hause aber nicht so.«
»Da hat sie letzte Nacht aber was ganz anderes erzählt.«
Mehr oder weniger.
Antoinette Conway kam mit einer Handvoll Papiere herein, knallte die Tür mit dem Ellbogen zu. Ging zu ihrem Schreibtisch.
Noch immer dieser ausladende Gang, wer nicht mitkommt, soll sich verpissen. So groß wie ich – gut eins achtzig – und das mit Absicht: Fünf Zentimeter davon waren Blockabsätze, die einem glatt die Zehen zerquetschen konnten. Schwarzer Hosenanzug, nicht billig, eng auf Figur geschnitten; kein Versuch, die Form der langen Beine zu verbergen, den strammen Hintern. Schon allein beim Durchqueren des Büros signalisierte sie auf zigfache Weise: Ärger gefällig?
»Hat er gestanden, Conway?«
»Nein.«
»Tss. Kein Händchen mehr dafür, was?«
»Er ist kein Tatverdächtiger, du Arsch.«
»Und davon lässt du dich aufhalten? Ein ordentlicher Tritt in die Eier, und die Sache ist geritzt: Geständnis.«
Nicht bloß das übliche Hin und Her. Ein Prickeln in der Luft, eine schneidende Anspannung. Ich konnte nicht sagen, ob es an ihr lag oder einfach bloß an diesem Tag oder ob es hier immer so zuging. Das Morddezernat ist anders. Der Rhythmus ist schneller und härter, das Drahtseil ist höher und dünner. Ein falscher Schritt, und du bist weg vom Fenster.
Conway ließ sich in ihren Sessel fallen, fing an, irgendwas in ihren Computer zu tippen.
»Dein Schatz ist da, Conway.«
Sie überhörte das.
»Kriegt er denn nicht mal ein Küsschen?«
»Was redet ihr da für ’nen Scheiß?«
Der Witzbold zeigte mit dem Daumen auf mich. »Er gehört dir.«
Conway starrte mich an. Kalte dunkle Augen, ein volllippiger Mund, der sich keinen Millimeter bewegte. Kein Make-up.
»Ja?«
»Stephen Moran. Ungelöste Fälle.« Ich hielt ihr den Beweismittelbeutel hin, über den Schreibtisch. Dankte Gott, dass ich nicht einer von denen war, die sie auf der Polizeischule angebaggert hatten. »Das wurde mir heute gebracht.«
Ihr Gesicht veränderte sich nicht, als sie die Karte sah. Sie inspizierte sie in aller Ruhe, Vorder- und Rückseite, las die Aussage. »Ach die«, sagte sie, als sie zu Hollys Namen kam.
»Du kennst sie?«
»Hab sie vernommen, letztes Jahr. Ein paarmal. Hab absolut nichts aus ihr rausgekriegt. Arrogantes kleines Biest. Das sind sie alle da an der Schule, aber sie war eine der schlimmsten. Wie Zähne ziehen.«
Ich sagte: »Meinst du, sie hat irgendwas gewusst?«
Scharfer Blick, Anheben des Aussageformulars. »Wieso hattest du das Vergnügen?«
»Holly Mackey war Zeugin in einem Fall, den ich ’07 bearbeitet hab. Wir haben uns gut verstanden. Anscheinend sogar besser, als ich dachte.«
Conways Augenbrauen hoben sich. Sie hatte von dem Fall gehört. Was bedeutete, dass sie auch von mir gehört hatte. »Okay«, sagte sie. Ihr Tonfall verriet weder das eine noch das andere. »Danke.«
Sie drehte ihren Sessel schwungvoll von mir weg und tippte in ihr Telefon. Klemmte sich den Hörer unters Kinn und lehnte sich im Sessel zurück, las erneut.
Grob, hätte meine Mam über Conway gesagt. Diese Antoinette, und ein Seitenblick mit gesenktem Kopf: ein bisschen grob. Nicht ihre Art wäre gemeint gewesen oder nicht nur, sondern auch, wo sie herkam. Der Akzent verriet es einem, und der herausfordernde Blick. Dublin, Innenstadt, vielleicht nur ein kurzes Stück zu Fuß von da, wo ich aufgewachsen bin, und doch meilenweit davon entfernt: Hochhäuser. Möchtegern-IRA-Graffiti und Pissepfützen. Junkies. Menschen, die im ganzen Leben keine Prüfung bestanden hatten, aber alle Tricks und Kniffe kannten, wie man sein Arbeitslosengeld aufstockte. Menschen, die Conways Berufswahl nicht befürwortet hätten.
Es gibt Leute, die Grobheit gut finden. Sie denken, sie ist lässig, sie ist cool, sie wird abfärben, und dann können sie den ganzen tollen Slang draufhaben. Aber wenn du auf Tuchfühlung damit aufgewachsen bist, wenn deine ganze Familie sich wie verrückt abgestrampelt hat, um den Kopf über der anschwellenden Flut zu halten, kommt einem Grobheit überhaupt nicht sexy vor. Ich mag es weich, weich wie Samt.
Ich rief mir in Erinnerung: Du musst nicht Conways bester Kumpel sein. Sei einfach nur so nützlich, dass du auf dem Radar von ihrem Boss auftauchst, und bleib dran.
»Sophie. Antoinette hier.« Ihr Mund wurde lockerer, wenn sie mit jemandem sprach, den sie mochte, ein Zu-allem-bereit-Kräuseln im Mundwinkel, ein bisschen verspielt. Es machte sie jünger, machte sie zu jemandem, den du im Pub anquatschen würdest, wenn du in draufgängerischer Stimmung wärst. »Ja, ganz gut. Und selbst? … Ich schick dir gerade ein Foto … Nee, die Harper-Sache. Ich brauche Fingerabdrücke, aber könntest du für mich auch einen Blick auf das Foto an sich werfen? Feststellen, womit es aufgenommen wurde, wann und wo und worauf es ausgedruckt wurde? Alles, was du finden kannst.« Sie hob die Hülle an. »Und es sind Buchstaben draufgeklebt. Ausgeschnittene Buchstaben, wie auf ’nem Erpresserbrief. Versuch doch mal rauszukriegen, woraus die ausgeschnitten wurden, okay? … Jaja, ich weiß. Vollbring für mich ein Wunder. Bis dann.«
Sie legte auf. Zog ein Smartphone aus der Tasche und fotografierte die Karte: Vorderseite, Rückseite, von Nahem, mit etwas Abstand, Details. Ging zum Drucker in der Ecke und druckte alles aus. Drehte sich wieder zu ihrem Schreibtisch um und sah mich.
Fixierte mich. Ich starrte zurück.
»Noch da?«
Ich sagte: »Ich möchte in dem Fall mit dir zusammenarbeiten.«
Abgehacktes Lachen. »Ja klar willst du das.« Sie fiel wieder in ihren Sessel, kramte in einer Schreibtischschublade nach einem Umschlag.
»Du hast selbst gesagt, du hast aus Holly Mackey und ihren Freundinnen nichts rausgekriegt. Aber sie hat mir das da gebracht, weil sie mich mag oder weil sie mir vertraut. Und wenn sie mit mir redet, wird sie auch ihre Freundinnen dazu bringen, mit mir zu reden.«
Conway dachte darüber nach. Drehte sich mit dem Sessel hin und her.
Ich fragte: »Was hast du zu verlieren?«
Vielleicht gab mein Akzent den Ausschlag. Die meisten Cops kommen vom Land, aus Kleinstädten. Die mögen keine Dubliner Klugscheißer, die sich für den Mittelpunkt des Universums halten, wo doch alle wissen, dass das ausgemachter Schwachsinn ist. Oder vielleicht gefiel ihr auch, was sie über mich gehört hatte. Jedenfalls: Sie schrieb einen Namen auf den Umschlag, steckte die Karte hinein. Sagte: »Ich fahr zur Schule, seh mir diese Pinnwand an, rede mit ein paar Leuten. Du kannst mitkommen, wenn du willst. Falls du zu gebrauchen bist, können wir darüber reden, wie’s weitergeht. Falls nicht, marschierst du zurück zu den Ungelösten Fällen.«
Ich hütete mich, mir meinen inneren Triumph anmerken zu lassen. »Alles klar.«
»Musst du noch deine Mammy anrufen und sagen, dass du nicht nach Hause kommst?«
»Mein Boss weiß Bescheid. Ist kein Problem für ihn.«
»Also schön«, sagte Conway. Sie schob ihren Sessel zurück. »Ich bring dich unterwegs auf den neusten Stand. Und ich fahre.«
Irgendwer pfiff hinter uns her, leise, als wir zur Tür hinausgingen. Allgemeines Kichern im Raum. Conway drehte sich nicht um.
2
Am ersten Sonntagnachmittag im September kehren die Internatsschülerinnen ins St. Kilda zurück. Über ihnen strahlt der Himmel in einem saubergewaschenen Blau, das noch zum Sommer gehören könnte, wäre da nicht das V aus Vögeln, die in einer Ecke des Bildes den Formationsflug üben. Die Mädchen kreischen dreifache Ausrufungszeichen und springen sich auf Korridoren, die nach verträumter Sommerleere und frischer Farbe riechen, gegenseitig in die Arme. Sie kommen mit abpellender, sonnengebräunter Haut, mit Urlaubsgeschichten, neuen Frisuren und frisch entwickelten Brüsten, die sie anfangs fremd und unnahbar wirken lassen, selbst für ihre besten Freundinnen. Und nach einer Weile ist Miss McKennas Begrüßungsrede vorbei, und die Teekannen und leckeren Kekse sind weggeräumt. Die Eltern haben sie zum Abschied umarmt und peinliche letzte Ermahnungen bezüglich Hausaufgaben und Inhalatoren vom Stapel gelassen, ein paar Neuankömmlinge haben geweint; die letzten vergessenen Sachen sind geholt worden, und die Geräusche sich entfernender Autos sind die Einfahrt hinunter leiser geworden und in der Außenwelt verklungen. Zurück bleiben nur die Internatsschülerinnen und die Hausmutter und ein paar Mitarbeiter, die die Arschkarte gezogen haben, und die Schule.
Holly kommt vor lauter neuen Eindrücken kaum noch mit. Sie versucht, ein unbeeindrucktes Gesicht aufzusetzen, und hofft, dass sich das alles früher oder später real anfühlen wird. Sie zieht ihren Koffer über die fremden gefliesten Korridore des Internatsflügels zu ihrem neuen Zimmer, auf Rollen, deren Surren hinauf in hohe Ecken hallt. Sie hängt ihre gelben Handtücher an ihre Haken und bezieht ihr Bett mit der gelb-weiß gestreiften Bettwäsche, frisch aus der Plastikverpackung und noch mit akkuraten Falten. Sie und Julia haben die Fensterbetten; Selena und Becca haben ihnen doch die Wahl überlassen. Die Außenanlagen vor dem Fenster sehen aus diesem neuen Blickwinkel anders aus: ein geheimer Garten mit versteckten Winkeln, die mal da sind und dann wieder verschwinden, auf Erkundungen warten, wenn du schnell genug bist.
Selbst die Cafeteria fühlt sich irgendwie neu an. Holly kennt sie nur in der Mittagspause, wenn der ganze Raum übersprudelt vor aufgeregtem Geschnatter und Hektik, alle über Tische hinweg schreien, mit einer Hand essen und mit der anderen simsen. Beim Abendessen hat sich die Aufregung der Rückkehr gelegt, und die Schülerinnen hocken in kleinen Gruppen mit großen Lücken dazwischen an Resopaltischen, lümmeln sich über Frikadellen und Salat, die Gespräche ein Murmeln, das ziellos durch die Luft irrt. Das Licht fühlt sich trüber an als beim Mittagessen, und der Raum riecht irgendwie stärker, gebratenes Fleisch und Essig, irgendwo zwischen appetitlich und eklig.
Nicht alle unterhalten sich nur halblaut. Joanne Heffernan, Gemma Harding, Orla Burgess und Alison Muldoon sitzen zwei Tische weiter, aber Joanne geht ganz selbstverständlich davon aus, dass alle im Raum jedes Wort aus ihrem Munde mithören wollen, und obwohl sie da falschliegt, haben nur die wenigsten den Mumm, ihr das zu sagen. »Hallo? Das stand in der Elle, du kannst doch lesen, oder? Soll voll super sein, und ehrlich gesagt, Orla, nimm’s mir nicht übel, aber so’n hypergeniales Peeling wär nicht das Schlechteste für dich, oder?«
»O Mann«, sagt Julia, die das Gesicht verzieht und sich das Ohr auf ihrer Joanne-Seite reibt. »Versprecht mir, dass sie beim Frühstück leiser ist. Ich bin ein Morgenmuffel.«
»Was ist ein Peeling?«, will Becca wissen.
»Was für die Haut«, sagt Selena. Joanne und die anderen machen absolut alles, was du laut Frauenzeitschriften mit deinem Gesicht, deinen Haaren und deiner Cellulitis machen solltest.
»Klingt wie ’n Gartengerät.«
»Klingt wie ’ne Massenvernichtungswaffe«, sagt Julia. »Und die da sind die Androiden der Peeling-Armee, die bloß Befehlen gehorchen. Wir müssen peelen.«
Ihre Dalek-Roboterstimme ist bewusst so laut, dass Joanne und die anderen herumfahren, aber da hat Julia schon ein Stück Frikadelle mit der Gabel aufgespießt und fragt Selena, ob es normal ist, dass da Augäpfel drin sind, als hätte sie Joanne überhaupt nicht wahrgenommen. Joannes Augen starren herüber, leer und kalt; dann wendet sie sich mit einem gekonnten Haarwurf ab, als würde sie von Paparazzi beobachtet, und stochert in ihrem Essen.
»Wir müssen peelen«, sagt Julia monoton und fragt dann sofort wieder in ihrer eigenen Stimme: »Hey, Holly, was ich dich schon die ganze Zeit fragen will. Hat deine Mum diese Netzbeutel gekriegt?« Sie alle sind kurz davor loszukichern.
Joanne faucht: »Entschuldigung, redest du mit mir?«
»Hab ich in meinem Koffer«, sagt Holly zu Julia. »Wenn ich auspacke, geb ich – Wer, ich? Meinst du mich?«
»Wer auch immer. Habt ihr ein Problem?«
Julia und Holly und Selena blicken verständnislos. Becca stopft sich ein Stück Kartoffel in den Mund, damit der Knoten aus Angst und Aufregung nicht zu einem Lachen explodiert.
»Dass die Frikadellen eklig sind?«, schlägt Julia vor. Und lacht – eine Sekunde zu spät.
Joanne lacht zurück, genau wie die anderen Kampfmaschinen, aber ihre Augen bleiben kalt. »Sehr witzig«, sagt sie.
Julia lächelt gekünstelt. »O vielen Dank. Ich geb mir Mühe.«
»Gute Idee«, sagt Joanne. »Versuch’s weiter«, und wendet sich wieder ihrem Essen zu.
»Wir müssen peel –«
Diesmal ertappt Joanne sie um ein Haar. Selena wirft gerade noch rechtzeitig ein: »Ich hab noch ein paar Netzbeutel übrig, falls ihr welche braucht.« Ihr ganzes Gesicht ist verzerrt von unterdrücktem Kichern, aber sie sitzt mit dem Rücken zu Joanne, und ihre Stimme klingt friedlich und ruhig, ohne jeden Anflug von Lachen. Joannes Eisesblick gleitet über sie und die anderen Tische hinweg, sucht nach der Übeltäterin, die sich eine solche Frechheit erlaubt.
Becca hat sich ihr Essen zu schnell reingeschaufelt. Ein lauter Rülpser platzt aus ihr heraus. Sie wird knallrot, aber das liefert den anderen dreien den Vorwand, nach dem sie gelechzt haben: Sie brüllen vor Lachen, halten sich aneinander fest, die Gesichter fast auf der Tischplatte. »Mein Gott, ihr seid voll widerlich«, sagt Joanne, zieht eine hochnäsige Schnute und wendet sich ab. Ihre Clique, gut abgerichtet, ahmt beides nach, das Wegdrehen und die Schnute. Damit machen sie den Lachanfall nur noch schlimmer. Julia prustet sich ein Bröckchen Frikadelle in die Nase, läuft knallrot an und muss es geräuschvoll in eine Papierserviette schnupfen, und die anderen kippen fast von ihren Stühlen.
Als das Gelächter endlich nachlässt, wird ihnen ihre eigene Frechheit bewusst. Sie sind immer gut mit Joanne und ihrer Clique klargekommen. Was sehr ratsam ist.
»Was war das denn eben?«, fragt Holly leise Julia.
»Wieso? Wenn die nicht mit dem Gekreische über ihr bescheuertes Hautzeugs aufgehört hätte, wär mir das Trommelfell geplatzt. Und, hallo: Es hat funktioniert.« Die Roboter sitzen über ihre Tabletts gebeugt, schielen immer wieder argwöhnisch rüber und unterhalten sich demonstrativ leise.
»Aber jetzt ist sie angesäuert«, flüstert Becca mit großen Augen.
Julia zuckt die Achseln. »Na und? Was will sie machen, mich hinrichten? Hab ich irgendwie nicht mitgekriegt, dass sie mir was zu sagen hat?«
»Schalt einfach einen Gang runter, mehr nicht«, sagt Selena. »Wenn du Krach mit Joanne willst, hast du das ganze Jahr Zeit dazu. Muss nicht gleich heute Abend sein.«
»Was habt ihr denn? Wir waren doch noch nie dicke Freunde.«
»Wir waren noch nie Feinde. Und jetzt musst du irgendwie mit ihr klarkommen.«
»Genau«, sagt Julia und dreht ihr Tablett so, dass sie an den Obstsalat kommt. »Ich glaube, ich krieg dieses Jahr jede Menge Spaß.«
Eine hohe Mauer und eine baumbestandene Straße und eine weitere hohe Mauer entfernt sind auch die Internatsschüler vom St. Colm zurück in der Schule. Chris Harper hat seine rote Decke aufs Bett geworfen, seine Klamotten in sein Schrankfach gepackt und singt eine versaute Version der Schulhymne mit seiner neuen, raueren, tiefen Stimme, grinst, als seine Zimmergenossen mitsingen und die entsprechenden Gesten machen. Er hat ein paar Poster übers Bett gehängt, das neue gerahmte Familienfoto auf den Nachttisch gestellt. Er hat die Plastiktüte voller Verheißungen in ein schäbiges altes Handtuch gewickelt und tief in seinem Koffer verstaut, den Koffer oben auf dem Schrank ganz weit nach hinten geschoben. Er hat im Spiegel kontrolliert, dass ihm der Pony auch richtig in die Stirn fällt, und prescht jetzt zusammen mit Finn Carroll und Harry Bailey runter zum Abendessen, wobei sie alle drei lärmend und extra laut lachend den gesamten Korridor in Beschlag nehmen. Sie rempeln sich an und rangeln versuchsweise miteinander, um rauszufinden, wer nach dem Sommer der Stärkste von ihnen ist. Chris Harper ist für das Schuljahr bereit, freut sich darauf. Er hat einiges vor.
Er hat noch acht Monate und zwei Wochen zu leben.
»Und jetzt?«, fragt Julia, als sie ihren Obstsalat gegessen und die Tabletts weggebracht haben. Aus der geheimnisvollen inneren Küche dringen Abwaschgeklapper und ein Streit in einer Sprache, die Polnisch sein könnte.
»Alles, was wir wollen«, sagt Selena, »bis zur Studierzeit. Manchmal gehen wir ins Shopping-Center, oder wenn die Jungs vom Colm ein Rugbyspiel haben, können wir uns das ansehen, aber bis zum nächsten Wochenende dürfen wir das Schulgelände nicht verlassen. Also gehen wir entweder in den Gemeinschaftsraum oder …«
Sie bewegt sich schon Richtung Ausgangstür, Becca neben ihr. Holly und Julia folgen.
Es ist noch hell draußen. Der Schulpark breitet sich in unendlichen Grünschattierungen vor ihnen aus. Bislang war es eine Zone, die Holly und Julia eigentlich nicht betreten sollten; nicht direkt verboten, aber die einzige Chance für Tagesschülerinnen, sich hier aufzuhalten, ist in der Mittagspause, und da ist nie genug Zeit. Jetzt ist es so, als wäre eine beschlagene Glasscheibe vor ihren Augen verschwunden: Jede Farbe springt hervor, jeder einzelne Vogelruf klingt unverwechselbar und klar in Hollys Ohren, die Schattenbahnen zwischen den Bäumen sehen so tief und kühl aus wie Brunnen. »Kommt«, sagt Selena und rennt dann über den weiten Rasen hinter der Schule, als würde er ihr gehören. Becca folgt ihr ohne Zögern. Julia und Holly laufen auch los, werfen sich in den Strudel aus Grün und rauschendem Wind, um sie einzuholen.
Vorbei an dem verschnörkelten Eisentor und hinein in die Bäume, und auf einmal ist der Park ein Wirrwarr aus kleinen Pfaden, von denen Holly nichts wusste, Pfade, die nicht hierhergehören, bloß ein kurzes Stück von der Hauptzufahrt entfernt: Sonnenflecken, Flattern, dichtes Astwerk über dir und Kleckse von lila Blumen irgendwo am Rande des Gesichtsfelds. Den Pfad hinauf und weg, Beccas dunkle Zöpfe und Selenas goldblonde Pracht wippen im Gleichtakt, als sie abbiegen, einen kleinen Hang hinauf, vorbei an Büschen, die aussehen, als hätten Gartenkobolde sie zu ordentlichen Kugeln gestutzt, und dann: aus dem Hell-Dunkel-Gesprenkel hinein in die lichte Sonne. Einen Moment lang muss Holly die Augen abschirmen.
Die Lichtung ist klein, bloß ein Kreis aus niedrigem Gras, umringt von hohen Zypressen. Die Luft ist schlagartig und vollkommen anders, still und kühl, nur hier und dort von kleinen Wirbeln durchweht. Laute fallen hinein – das träge Gurren einer Ringeltaube, das Sirren von emsigen Insekten, irgendwo – und verschwinden wieder, ohne ein Kräuseln zu hinterlassen.
Selena sagt, kaum außer Atem: »… oder wir kommen hierher.«
»Die Stelle hier habt ihr uns noch nie gezeigt«, sagt Holly. Selena und Becca werfen sich einen Blick zu und zucken die Achseln. Eine Sekunde lang fühlt Holly sich fast hintergangen – Selena und Becca wohnen seit zwei Jahren im Internat, aber sie ist nie auf den Gedanken gekommen, dass die beiden irgendwas Eigenes haben –, bis sie begreift, dass sie jetzt ein Teil davon ist.
»Manchmal kriegt man das Gefühl, man dreht gleich durch, wenn man nicht wo hingeht, wo man für sich ist«, sagt Becca. »Dann kommen wir hierher. Unser geheimer Ort.« Sie lässt sich in einem Spinnengewirr aus dünnen Beinen zu Boden sinken und blickt ängstlich zu Holly und Julia hoch. Sie hat die geöffneten Hände fest aneinandergelegt, als ob sie ihnen die Lichtung als Willkommensgeschenk darbieten würde und nicht sicher wäre, ob es ihnen genügt.
»Es ist super«, sagt Holly. Sie riecht gemähtes Gras, die satte Erde im Schatten; den Hauch von etwas Wildem, wie von Tieren, die leise auf ihrem Weg von einem nächtlichen Ort zum nächsten vorbeitrotten. »Und sonst kommt nie einer her?«
»Die anderen haben ihre eigenen Stellen«, sagt Selena. »Da gehen wir nicht hin.«
Julia dreht sich um, den Kopf in den Nacken gelegt, um Vögel zu beobachten, die in dem kreisrunden Blau dahinsausen, aus ihrem V ausbrechen und sich wieder einordnen. »Gefällt mir«, sagt sie, »gefällt mir sehr«, und lässt sich neben Becca ins Gras fallen. Becca grinst und atmet tief aus, und ihre Hände lösen sich voneinander.
Sie strecken sich aus, verändern ihre Position, bis die schwindende Sonne ihnen nicht mehr in die Augen scheint. Das Gras ist dicht und glänzend wie das Fell eines Tieres, schön zum Draufliegen. »Gott, McKennas Rede«, sagt Julia. »›Ihre Töchter haben schon jetzt einen so wunderbaren Start ins Leben, weil Sie alle so gebildet sind und gesundheitsbewusst und kultiviert und einfach überhaupt supertoll, und wir können uns kaum halten vor Begeisterung, dass wir Ihre gute Arbeit fortführen dürfen‹, und gib mir bitte einer die Kotztüte.«
»Die Rede ist jedes Jahr gleich«, sagt Becca. »Wort für Wort.«
»Im ersten Jahr hätte mein Dad mich wegen der Rede fast direkt wieder mit nach Hause genommen«, sagt Selena. »Er meint, sie wäre elitär.« Selenas Dad wohnt in einer Kommune in Kilkenny und trägt handgewebte Ponchos. Ihre Mum hat das Kilda ausgesucht.
»Mein Dad hat dasselbe gedacht«, sagt Holly. »Ich hab’s ihm angesehen. Ich hatte Schiss, er würde irgendwas Superschlaues sagen, als McKenna fertig war, aber Mum hat ihm auf den Fuß getreten.«
»Klar war die Rede elitär«, sagt Julia. »Na und? Elitär ist doch nicht schlecht. Manche Sachen sind nun mal besser als andere Sachen. Wer so tut, als wäre das nicht so, ist nicht aufgeschlossen, der ist bloß dämlich. Mich hat am meisten die ganze Schleimerei angekotzt. Als wären wir irgendwelche Produkte, die unsere Eltern rausgedrückt haben, und McKenna tätschelt ihnen den Kopf und erzählt ihnen, wie gut sie ihre Sache gemacht haben, und die schwänzeln und lecken ihr die Hand und würden am liebsten auf den Boden pinkeln. Woher will sie das eigentlich wissen? Was, wenn meine Eltern noch nie im Leben ein Buch gelesen haben und mir zu jeder Mahlzeit frittierte Marsriegel vorsetzen?«
»Ist ihr egal«, sagt Becca. »Die will nur, dass sie sich gut dabei fühlen, einen Haufen Geld dafür zu bezahlen, uns los zu sein.«
Plötzlich wird es still. Beccas Eltern arbeiten die meiste Zeit in Dubai. Sie konnten heute nicht kommen; die Haushälterin hat Becca hergebracht.
»Das ist gut«, sagt Selena. »Dass ihr hier seid.«
»Kommt mir noch gar nicht real vor«, sagt Holly, was nur halbwegs stimmt, aber besser kann sie es nicht ausdrücken. Es kommt ihr manchmal blitzartig real vor, zwischen langen unscharfen Phasen aus statischem Rauschen, aber diese blitzartigen Augenblicke sind so klar, dass sie jede andere Sorte von Realität aus ihrem Kopf verscheuchen und es sich anfühlt, als wäre sie nie irgendwo anders gewesen als hier. Und dann sind sie vorbei.
»Mir schon«, sagt Becca. Sie lächelt zum Himmel hinauf. Ihre Stimme klingt nicht mehr so verletzt.
»Wird schon«, sagt Selena. »Das dauert eine Weile.«
Sie liegen da, spüren, wie ihre Körper tiefer in die Lichtung sinken und den Rhythmus verändern, mit den Dingen um sie herum verschmelzen: dem Tink-Tink-Tink eines Vogels irgendwo, dem langsamen Gleiten und Blinken von Sonnenstrahlen durch die dichten Zypressen. Holly merkt, dass sie den Tag durchblättert, so wie sie das jeden Nachmittag im Bus nach Hause macht, sich einzelne Stellen herauspickt, die sie erzählen wird: eine lustige, leicht freche Geschichte für Dad, etwas, um bei Mum Eindruck zu schinden, oder – falls Holly gerade sauer auf sie ist, was in letzter Zeit irgendwie ein Dauerzustand ist – irgendwas Schockierendes, das ihr eine Reaktion entlockt wie: Um Himmels willen, Holly, was ist das denn für eine Ausdrucksweise …, während Holly die Augen zum Himmel verdreht. Ihr fällt ein, dass sie das jetzt nicht mehr machen muss. Das Bild, das jeder Tag hinterlässt, wird nicht von Dads Grinsen und Mums hochgezogenen Augenbrauen bestimmt, jetzt nicht mehr.
Stattdessen wird es von den anderen bestimmt werden. Holly betrachtet sie und spürt, wie sich der Tag verändert, sich den Konturen anpasst, an die sie sich noch in zwanzig Jahren erinnern wird, in fünfzig: der Tag, an dem Julia das mit der Maschinen-Stimme einfiel, der Tag, an dem Selena und Becca sie und Julia mit zu der Zypressenlichtung nahmen.
»Wir müssen bald zurück«, sagt Becca, ohne sich zu rühren.
»Ist doch noch früh«, sagt Julia. »Ihr habt gesagt, wir dürften machen, was wir wollen.«
»Stimmt auch, größtenteils. Aber wenn du neu bist, sind die megamäßig dahinter her, dich ständig im Auge zu haben. Als würdest du sonst abhauen.«
Sie lachen, leise, in den Kreis aus stiller Luft. Wieder hat Holly so einen blitzartigen Moment – ein Faden aus Wildgänseschreien hoch über den Himmel gespannt, ihre Finger tief ins kühle Fell des Grases gedrückt, das Flattern von Selenas Wimpern vor der Sonne, und das hier ist ewig, alles andere ist ein Wachtraum, der am Horizont verblasst. Diesmal geht er nicht vorbei.
Ein paar Minuten später sagt Selena: »Aber Becs hat recht. Wir müssen los. Wenn die uns suchen und hierherkommen …«
Wenn ein Lehrer auf die Lichtung käme: Der Gedanke windet sich in ihr Rückgrat, stößt sie aus dem Gras hoch. Sie klopfen sich ab, Becca zupft grüne Fitzelchen aus Selenas Haar und streicht es mit den Fingern glatt. »Ich muss sowieso noch zu Ende auspacken«, sagt Julia.
»Ich auch«, sagt Holly. Sie denkt an den Internatsflügel, die hohen Decken, die scheinbar von kühlen, dünnen Nonnengesängen erfüllt werden wollen. Ihr ist, als schwebte ein neues Ich neben dem gelbgestreiften Bett und wartete auf seinen Moment: so neu wie sie alle. Sie spürt die Veränderung durch ihre Haut dringen, in den unendlichen Räumen zwischen den Atomen wirbeln. Plötzlich versteht sie, warum Julia Joanne beim Abendessen provoziert hat. Diese Flut hat auch sie ins Taumeln gebracht. Sie hat gegen die Strömung angestrampelt, bewiesen, dass sie mitbestimmen kann, wohin die sie trägt, ehe sie über ihrem Kopf zusammenschlägt und sie fortreißt.
Du weißt, du kannst jederzeit nach Hause kommen, hat Dad gefühlte achtzigtausendmal gesagt. Tag oder Nacht: ein Anruf, und ich bin in spätestens einer Stunde da. Klar?
Ja, ich hab’s kapiert, danke, hat Holly achtzigtausendmal gesagt, falls ich es mir anders überlege, ruf ich dich an und komm sofort wieder nach Hause. Bis zu diesem Moment ist sie nie auf den Gedanken gekommen, dass es vielleicht nicht so einfach ist.
3
Conway mochte Autos. Verstand auch was davon. Im Fuhrpark suchte sie sich sofort einen schwarzen MG-Klassiker aus, ein Prachtstück. Ein pensionierter Detective hatte ihn der Polizei in seinem Testament vermacht, sein ganzer Stolz. Der Typ, der den Fuhrpark betreut, hätte Conway den Wagen niemals überlassen, wenn sie sich nicht damit ausgekannt hätte – Getriebe spielt verrückt, Detective, tut mir leid, gleich da drüben wäre ein prima VW Golf … Sie winkte, er warf ihr die Schlüssel zu.
Sie behandelte den MG, als wäre er ihr Lieblingspferd. Wir mussten in den südlichen Teil der Stadt, dahin, wo die feinen Leute wohnen, und Conway brauste in dem Gewirr aus kleinen Gässchen rasant um die Ecken, drückte auf die Hupe, wenn einer nicht schnell genug Platz machte.
»Damit eins klar ist«, sagte sie. »Das ist meine Show. Hast du Probleme damit, dir von einer Frau Anweisungen geben zu lassen?«
»Nein.«
»Das sagen alle.«
»Ehrlich.«
»Gut.« Sie bremste scharf vor einem ökomäßig aussehenden Café, dessen Fenster dringend mal geputzt werden mussten. »Hol mir einen Kaffee. Schwarz, ohne Zucker.«
So schwach ist mein Ego nicht. Es braucht kein tägliches Fitnesstraining, um nicht zusammenzubrechen. Raus aus dem Wagen, zwei Kaffee zum Mitnehmen, brachte sogar die depressive Kellnerin zum Lächeln. »Bitte sehr«, sagte ich, als ich mich wieder auf den Beifahrersitz schob.
Conway trank einen Schluck. »Schmeckt beschissen.«
»Du hast den Laden ausgesucht. Sei froh, dass der Kaffee nicht aus Sojabohnen ist.«
Sie hätte fast gelächelt, bremste sich. »Ist er aber. Schmeiß den weg. Deinen auch. Das Zeug stinkt mir sonst den Wagen voll.«
Der Mülleimer war auf der anderen Straßenseite. Aussteigen, Autos ausweichen, Mülleimer, Autos ausweichen, wieder einsteigen, allmählich ahnen, warum Conway noch immer Einzelkämpferin war. Sie trat aufs Gas, als mein Bein noch halb draußen war.
»Also«, sagte sie. Leicht aufgetaut, aber nur ganz leicht. »Du kennst den Fall, ja? Die groben Fakten?«
»Klar.« Jeder Straßenköter kannte die Fakten.
»Du weißt, dass wir keinen Erfolg hatten. Sagt die Gerüchteküche irgendwas dazu, warum?«
Die Gerüchteküche sagte vieles. Ich sagte: »Bei manchen Fällen ist das nun mal so.«