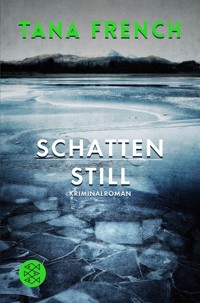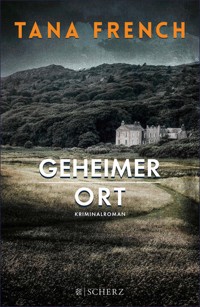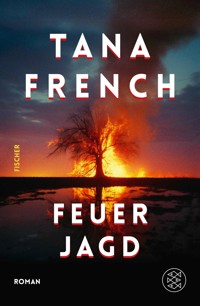
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: West-Irland
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Platz 1 der Krimi-Bestenliste (10/24) 100 Bedeutende Bücher des Jahres (New York Times) 10 Beste Krimis & Thriller des Jahres(Washington Post) »Herausragend. Welch ein Glück für uns Leser!« Stephen King Zwei Männer kommen nach Ardnakelty. Einer kommt nach Hause. Einer kommt, um zu sterben. Und ein junges Mädchen steht zwischen allen Fronten. Ein ungewöhnlich heißer Sommer hat Irland im Griff. Die Farmer sind nervös, die Ernten bedroht. Die 15-jährige Trey hat an das kleine Dorf schon ihren Bruder verloren. Etwas Sicherheit bietet der Außenseiterin nur der ehemalige Polizist Cal, der sie liebt wie eine Tochter. Da kommt nach Jahren der Abwesenheit unerwartet Treys Vater zurück. Mit offenen Armen empfängt ihn niemand, doch er bringt einen verheißungsvollen, gefährlichen Plan mit. Und einen Fremden. Cal versucht, Trey zu schützen, aber Trey will keinen Schutz. Sie will Rache. »Einzigartig stimmungsvoll ... außergewöhnlich ... wer immer noch glaubt, Tana French müsse sich an die Regeln halten, hat ihre bemerkenswerten Romane nicht verdient.« Washington Post »Tana Frenchs Dialoge gehören zu den besten der Branche. Sie zeigt das banale Böse hinter dem lächelnden Gesicht des Dorfes und erinnert uns daran, dass wir solche Orte auf eigene Gefahr unterschätzen.« New York Times »Vielschichtig erzählt, eindringlich und atmosphärisch ... Die Figuren werden so lebendig, dass ich mich noch lange nach der Lektüre frage, wie es ihnen geht – ein Beweis für die Meisterschaft der Autorin.« Guardian »Vielleicht Tana Frenchs bester Roman bisher. Spannend und intelligent erkundet die Autorin Fragen von Loyalität, Instinkt und Gemeinschaft. Meisterhaft legt sie Geheimnisse frei, die wir aus Liebe oder Rache bewahren, und erforscht, wie weit wir gehen, um unsere Familie zu schützen, sei sie blutsverwandt oder gewählt.« CrimeReads »Eine fesselnde Geschichte von Vergeltung, Aufopferung und Familie – von der Königin der irischen Spannungsliteratur.« TIME
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Ähnliche
Tana French
Feuerjagd
Roman
Über dieses Buch
Der irische Westen, weites Land, verwurzelte Menschen. Doch die Idylle trügt. Der zugezogene Ex-Cop Cal Hooper hat es erlebt. Gemeinsam mit der einheimischen Lena kümmert er sich um die junge Trey. Das wortkarge, willensstarke Mädchen hat nach dem gewaltsamen Tod ihres Bruders bei Cal und Lena wieder Halt gefunden. Bis Treys Vater Johnny unerwartet ins Dorf zurückkehrt. Mit einem Engländer und einer Verheißung im Gepäck. Während die legendären grünen Felder in der Hitze verdorren, nimmt ein gefährlicher Goldrausch seinen Lauf.
»Tana French kann kaum einer das Wasser reichen.« Bücher
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Tana French schreibt Romane und Kriminalromane von mächtiger Spannung und Schönheit. Die vielfach ausgezeichnete Autorin zeichnet mit ihrer eindrücklichen Sprache markante Natur- und Gesellschaftsbilder und schaut tief in die Seelen der Menschen. Ihre Werke stehen weltweit ganz oben auf den Bestsellerlisten. Tana French wuchs in Irland, Italien und Malawi auf, absolvierte eine Schauspielausbildung am Trinity College und arbeitete für Theater, Film und Fernsehen. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im nördlichen Teil von Dublin. Nach »Der Sucher« ist »Feuerjagd« der zweite Roman, den Tana French im weiten, bergigen Westen von Irland angesiedelt hat.
Inhalt
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Danksagung
Für David, der jetzt für immer nett zu mir sein muss.
1
Trey kommt mit einem kaputten Stuhl über den Berg. Sie trägt ihn auf dem Rücken, die Stuhlbeine ragen an ihrer Taille und den Schultern nach vorn. Das helle Blau des Himmels sieht aus wie glasiert, und die Sonne brennt ihr im Nacken. Selbst in den schwachen spitzen Rufen der Vögel, die zu hoch fliegen, als dass man sie sehen könnte, vibriert die Hitze. Die Frau, der der Stuhl gehört, hat angeboten, sie heimzufahren, aber Trey hatte keine Lust, ihr einen Einblick in ihr Leben zu geben, und weder Lust noch Kraft, für die Dauer einer Autofahrt über holprige Bergstraßen Konversation zu machen.
Ihr Hund Banjo trabt in weiten Kreisen abseits des Fußwegs, schnüffelt und buddelt im dichten Heidekraut, das für Juli schon zu braun an den Rändern ist und viel zu stark duftet. Wenn der Hund sich hindurchschlängelt, raschelt es trocken. Alle paar Minuten kommt er angelaufen und berichtet Trey mit freudigen Schnaufern und Japsern, was er gefunden hat. Banjo ist eine schwarzbraune Promenadenmischung mit dem Kopf und Körper eines Beagles, aber auf Beinen, die für etwas Stämmigeres gedacht sind, und er ist sehr viel mitteilsamer als Trey. Seinen Namen hat er dem banjoförmigen weißen Fleck am Bauch zu verdanken. Trey wollte eigentlich etwas Originelleres, aber sie kam nur auf Namen, die sich irgendein Trottel aus einem Kinderbuch für einen Hund ausdenken würde.
Cal Hooper, der Amerikaner, der unten in der Nähe vom Dorf wohnt, hat einen Hund aus demselben Wurf wie Banjo. Er hat ihn Rip genannt, und wenn ein simpler Name für Cals Hund gut genug ist, dann ist er es auch für Treys. Außerdem verbringt sie viel Zeit bei Cal, weshalb auch die beiden Hunde viel zusammen sind und es blöd klänge, wenn die Namen nicht zueinanderpassten.
Trey wird den Stuhl später zu Cal bringen. Cal und Trey reparieren Möbel für andere Leute oder bauen welche, und sie kaufen kaputte alte Möbel und restaurieren sie, um sie dann auf dem Samstagsmarkt in Kilcarrow zu verkaufen. Einmal haben sie einen Beistelltisch ergattert, den Trey zuerst völlig unbrauchbar fand, zu klein und wackelig, aber dann hat Cal im Internet rausgefunden, dass das Teil fast zweihundert Jahre alt war. Als sie den Tisch fertig hatten, konnten sie ihn für hundertachtzig Euro verticken. Bei dem Stuhl, den Trey auf dem Rücken schleppt, sind zwei Streben und ein Bein gesplittert, als hätte ihm jemand ein paar kräftige Tritte verpasst, aber wenn sie ihn repariert haben, wird keiner mehr merken, dass er je kaputt war.
Vorher geht sie zum Lunch nach Hause, weil sie bei Cal zu Abend essen will – Trey wächst in diesem Sommer so schnell, dass sie ihre Tage hauptsächlich nach den Mahlzeiten taktet –, und sie ist zu stolz, um gleich zweimal an einem Tag zur Essenszeit bei ihm aufzutauchen. Sie achtet streng darauf, Grenzen einzuhalten, gerade weil sie am liebsten bei Cal wohnen würde. Da ist alles so ruhig. Treys Elternhaus liegt oben in den Bergen, weit weg von irgendwelchen Nachbarn, deshalb müsste es eigentlich ganz friedlich sein, doch sie fühlt sich dort eingeengt. Ihre beiden älteren Geschwister sind fort, aber Liam und Alanna sind sechs und fünf und die meiste Zeit am Rumschreien. Maeve ist elf, meckert andauernd und knallt die Tür zu dem Zimmer, das Trey und sie sich teilen. Selbst wenn die anderen zufällig mal keinen Krach machen, sind sie ein ständiges Hintergrundrauschen. Ihre Mam ist schweigsam, aber es ist kein friedliches Schweigen. Es nimmt Raum ein, als steckte sie in einer schweren Schale aus rostigem Eisen. Lena Dunne, die unten im Tal wohnt und Trey den Hund geschenkt hat, sagt, Treys Mam hätte früher viel geredet und gelacht. Sie würde ihr gern glauben, aber sie kann es sich einfach nicht vorstellen.
Banjo kommt aus dem Heidekraut geschossen. Bester Laune schleppt er irgendetwas an, das Trey eine Meile gegen den Wind riechen kann. »Aus!«, befiehlt sie. Banjo blickt sie vorwurfsvoll an, aber er ist gut erzogen und lässt das Ding fallen, das dumpf auf den Weg plumpst. Es ist schmal und dunkel, vielleicht ein junges Hermelin. »Braver Hund«, sagt Trey, nimmt eine Hand von dem Stuhl und will Banjo streicheln, doch der ist gekränkt. Statt wieder loszurennen, trottet er mit hängendem Kopf und Schwanz neben ihr her, um ihr zu zeigen, dass sie seine Gefühle verletzt hat.
An manchen Stellen führt der Weg steil bergab, aber Treys Beine sind daran gewöhnt, und sie kommt nicht aus dem Tritt. Ihre Turnschuhe wirbeln Staubwölkchen auf. Sie hebt die Ellbogen an, um ihre verschwitzten Achselhöhlen an der Luft trocknen zu lassen, doch bei der schwachen Brise bringt das nicht viel. Weiter unten erstrecken sich die Weiden, ein Mosaik aus Grüntönen in seltsam verwinkelten Formen, das Trey genauso gut kennt wie die Risse in ihrer Zimmerdecke. Die Heuernte ist im Gange: Winzige Ballenpressen tuckern hin und her, folgen geschickt den unerklärlichen Krümmungen der Steinmauern und hinterlassen dicke gelbe Zylinder wie Pferdeäpfel. Die Lämmer sind weiße Schnipsel, die übers Gras flattern.
Trey nimmt eine Abkürzung über eine halb verfallene Trockenmauer, so niedrig, dass sie Banjo nicht hinüberhelfen muss, durch hüfthohes kratziges Unkraut, das eine ehemalige Weide überwuchert hat, und hinein in ein dichtes Fichtenwäldchen. Die Äste zersieben das Sonnenlicht zu einem verwirrenden Schattenspiel, das ihr den Nacken kühlt. Über ihr schwirren kleine Vögel sommertrunken hin und her, eifrig bemüht, sich gegenseitig zu übertönen. Trey pfeift einen Triller zu ihnen hoch und grinst, als sie schlagartig verstummen und versuchen, aus ihr schlau zu werden.
Sie kommt zwischen den Bäumen hervor auf die gerodete Fläche hinter ihrem Elternhaus. Vor ein paar Jahren hat das Haus einen neuen buttergelben Anstrich bekommen, und das Dach wurde stellenweise ausgebessert, aber nichts kann den heruntergekommenen Eindruck übertünchen. Der First hängt durch, und die Fensterrahmen sind verzogen. Der aus Unkraut und Staub bestehende Garten geht in den Berghang über und ist mit irgendwelchem Zeug übersät, das Liam und Alanna zum Spielen benutzen. Trey hat jeden ihrer Schulfreunde einmal mit nach Hause genommen, um zu zeigen, dass sie sich nicht dafür schämt, und sie danach nie wieder eingeladen. Sie hält die Dinge aus Prinzip getrennt. Was dadurch erleichtert wird, dass sie ohnehin keine Freunde hier aus dem Dorf hat. Trey gibt sich mit Leuten aus Ardnakelty nicht ab.
Sobald sie die Küche betritt, weiß sie, dass etwas anders ist. Die Atmosphäre wirkt angespannt, alles ist reglos und still. Noch ehe sie Zeit hat, aus diesem Umstand und dem Geruch von Zigarettenrauch Schlüsse zu ziehen, hört sie das Lachen ihres Vaters aus dem Wohnzimmer.
Banjo wufft einmal kurz. »Nein«, sagt Trey leise und schnell. Er schüttelt mit schlackernden Ohren Heidekraut und Dreck ab und stürzt zu seinem Wassernapf.
Trey bleibt einen Moment in dem breiten Streifen Sonnenlicht stehen, der durch die Tür auf das abgelaufene Linoleum fällt. Dann schleicht sie in den Flur und verharrt vor dem Wohnzimmer. Die Stimme ihres Vaters klingt klar und heiter, während sie eine Frage nach der anderen stellt, die mit aufgeregtem Geplapper von Maeve oder mit Gemurmel von Liam beantwortet werden.
Trey spielt mit dem Gedanken, wieder zu gehen, doch sie will ihn sehen, will es genau wissen. Sie stößt die Tür auf.
Ihr Dad sitzt mitten auf dem Sofa, bequem zurückgelehnt und grinsend, die Arme um Alanna und Maeve gelegt. Die beiden grinsen ebenfalls, aber unsicher, als hätten sie gerade ein dickes fettes Weihnachtsgeschenk bekommen, das sie vielleicht gar nicht wollten. Liam hat sich in eine Ecke des Sofas gequetscht und starrt seinen Dad mit offenem Mund an. Ihre Mam sitzt in einem Sessel, ganz vorn auf der Kante, den Rücken gerade und die Hände flach auf den Oberschenkeln. Obwohl sie die ganze Zeit hier war und Treys Dad sich seit vier Jahren nicht mehr hat blicken lassen, sieht Sheila aus, als fühle sie sich fremd in dem Zimmer.
»Na, Donnerwetter.« Johnny Reddys Augen mustern Trey zwinkernd. »Da schau her. Die kleine Theresa ist groß geworden. Wie alt bist du jetzt? Sechzehn? Siebzehn?«
Trey sagt: »Fünfzehn.« Sie weiß, dass sie eher noch jünger aussieht.
Johnny schüttelt staunend den Kopf. »Dann muss ich wohl demnächst die jungen Burschen mit ’nem Knüppel von der Haustür vertreiben. Oder bin ich zu spät dran? Hast du schon einen Freund? Oder sogar mehrere?« Maeve kichert schrill und blickt dann fragend zu ihm hoch, ob das in Ordnung ist.
»Nee«, sagt Trey knapp, als klarwird, dass er auf eine Antwort wartet.
Johnny seufzt erleichtert. »Dann hab ich ja noch Zeit, mir ’nen guten Knüppel zu suchen.« Trey hat vergessen, den Stuhl abzustellen, und jetzt deutet Johnny mit dem Kinn darauf. »Was ist das? Hast du mir ein Geschenk mitgebracht?«
»Den reparier ich wieder«, sagt Trey.
»Sie verdient damit Geld«, sagt Sheila. Ihre Stimme ist klarer als sonst, und auf ihren Wangen sind leuchtende Flecken. Trey kann nicht einschätzen, ob sie froh oder wütend über seine Rückkehr ist. »Deshalb konnten wir uns die neue Mikrowelle leisten.«
Johnny lacht. »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Immer ein bisschen was am Laufen haben. Ganz wie der Vater.« Er zwinkert Trey zu. Maeve windet sich unter seinem Arm, damit er merkt, dass sie auch noch da ist.
Trey hat ihn hochgewachsen und kräftig in Erinnerung, aber er ist bloß mittelgroß und ziemlich schmächtig. Sein Haar, das genau dieselbe mausbraune Farbe hat wie ihres, fällt ihm in die Stirn wie bei einem Teenager. Seine Jeans, sein weißes T-Shirt und die schwarze Lederjacke sind die neusten Sachen im Haus. Um ihn herum wirkt das Wohnzimmer sogar noch schäbiger.
Sie sagt zu ihrer Mam: »Ich bring den zu Cal.« Sie dreht sich um und geht in die Küche.
Von hinten hört sie Johnny belustigt fragen: »Cal, wer ist das? Einer von Senan Maguires Jungs?«
Banjo trinkt noch immer geräuschvoll aus seinem Napf, aber als Trey hereinkommt, springt er hoch, schwänzelt mit dem ganzen Hinterteil und starrt hoffnungsvoll auf seinen Futternapf. »Nee«, sagt Trey zu ihm. Sie hält das Gesicht unter den Wasserhahn und wäscht sich Schweiß und Staub ab. Sie spült den Mund aus und spuckt kräftig ins Becken. Dann legt sie die hohlen Hände zusammen und trinkt ausgiebig.
Als sie hinter sich ein Geräusch hört, fährt sie herum, aber es ist nur Alanna. Sie hat ihr schlaffes Plüschhäschen unter einen Arm geklemmt, während sie mit der anderen Hand die Tür hin und her schwingt. »Daddy ist wieder da«, sagt sie, als wäre es eine Frage.
»Stimmt.«
»Er sagt, du sollst wieder reinkommen.«
»Muss los«, erwidert Trey. Sie durchsucht den Kühlschrank, findet eine Packung Schinkenscheiben und klatscht ein paar davon zwischen zwei Scheiben Brot. Sie packt das Sandwich in Küchenpapier und stopft es in die Gesäßtasche ihrer Jeans. Alanna schwingt weiter die Tür hin und her, während sie zusieht, wie Trey sich den Stuhl wieder auf den Rücken hievt, Banjo mit einem Fingerschnippen zu sich ruft und hinaus in die Weite des Sonnenlichts geht.
Cal ist dabei, seine Hemden auf dem Küchentisch zu bügeln, und überlegt, sich den Bart abzurasieren. Als er ihn damals in Chicago wachsen ließ, beruhten seine Vorstellungen vom irischen Wetter auf Touristen-Websites, die überwiegend sattgrüne Weiden und glückliche Menschen in Strickpullovern zeigten. In seinen ersten zwei Jahren hier entsprach das Klima mehr oder weniger der Werbung. Aber dieser Sommer scheint sich von einer ganz anderen Website angeschlichen zu haben, vielleicht einer über Spanien. Die Hitze hat etwas Schamloses, Stures an sich. Cal, der sich daran gewöhnt hat, dass die meisten Tage einen Mix aus magerem Sonnenschein, unterschiedlich starker Bewölkung und allen Arten von Regen bieten, findet es ziemlich beunruhigend. Die Hitze passt nicht zu der Landschaft, deren Schönheit auf zurückhaltendem Wandel beruht, und sie zerrt an den Nerven der Farmer, weil sie ihren Zeitplan für Silage und Heuernte durcheinanderbringt, die Schafe unruhig macht und die Weideflächen verdorren lässt. Bei den Männern im Pub hat die Dürre als Hauptgesprächsthema nicht nur die Nationale Meisterschaft der Hütehunde verdrängt, sondern auch die Frau, die Itchy O’Connors Ältester aus Dublin mitgebracht hat, und die mutmaßlichen Bestechungen beim Bau des neuen Freizeitzentrums in der Stadt. Eine der kleineren Unannehmlichkeiten der Hitze ist, dass sie Cals Bart in eine Wärmefalle verwandelt hat. Sobald er nach draußen geht, fühlt es sich an, als hätte seine untere Gesichtshälfte ihr eigenes tropisches Klima.
Aber Cal mag seinen Bart. Ursprünglich war er auf diffuse Art mit seinem vorzeitigen Ruhestand verbunden: Er hatte genug davon, ein Cop zu sein und wie ein Cop auszusehen. Was die Leute in Ardnakelty betrifft, so erwies sich der Bart als sinnlos. Die hatten ihn schon durchschaut, bevor er überhaupt seine Kartons ausgepackt hatte. Aber er hängt trotzdem an ihm.
Selbst in der Hitze bleibt sein Haus kühl. Es ist ein kleines Cottage aus den 1930ern, an dem nichts Besonderes ist, aber die Wände sind dick und solide und erfüllen ihren Zweck. Als Cal es kaufte, war es so gut wie verfallen, aber er hat es wieder hergerichtet und sich dabei Zeit gelassen, weil er sonst nicht viel zu tun hat. Der Raum, in dem er jetzt steht, eigentlich eine Kombination aus Wohnzimmer und kleiner Küche, fühlt sich mittlerweile nicht mehr wie ein Projekt an, sondern einfach wie ein guter Ort zum Verweilen. Er hat ihn weiß gestrichen, nur die Ostwand ist goldgelb – Treys Idee –, passend zum Licht des Sonnenuntergangs, das auf sie fällt. Nach und nach hat er Möbel angeschafft, um die vom Vorbesitzer zurückgelassenen Stücke zu ergänzen: Er hat jetzt drei Stühle für den Küchentisch, einen alten Sekretär, an dem Trey ihre Hausaufgaben macht, einen Sessel, ein zerschlissenes blaues Sofa, das mal aufgepolstert werden müsste, und sogar eine Stehlampe. Außerdem hat er sich einen Hund zugelegt. In seiner Ecke neben dem Kamin bearbeitet Rip gründlich einen Kauknochen. Der Mischling hat Schlappohren, ist klein und ein Muskelpaket. Er ist halb Beagle, mit einem niedlichen Beagle-Gesicht und den wahllosen schwarzen, braunen und weißen Flecken, aber die andere Hälfte gibt Cal noch immer Rätsel auf. Er tippt auf Vielfraß.
Durch das offene Fenster dringt das ausgelassene Gezwitscher der Vögel, die sich anders als die Schafe an Hitze und Insektenüberfluss ergötzen. Der leichte Wind treibt sanft und sahnig herein. Mit ihm kommt eine Hummel ins Zimmer und fliegt gegen Schränke. Cal lässt ihr ein bisschen Zeit, und schließlich begreift sie, wo das Fenster ist, und taumelt wieder hinaus ins Sonnenlicht.
Draußen vor der Hintertür sind Bewegung zu hören und fröhliches Kläffen. Rip schießt aus seiner Ecke und flitzt durch den Flur, um seine Nase so kräftig gegen die Tür zu drücken, dass Cal sie nicht mehr aufkriegt. So läuft das immer ab, wenn Trey und Banjo kommen, aber Rip, ein geselliger Bursche, vergisst es vor lauter Freude jedes Mal wieder.
»Zurück«, befiehlt Cal und schiebt Rip mit dem Fuß beiseite. Rip schafft es bebend, sich gerade so lange zu beherrschen, bis Cal die Tür öffnen kann. Zwei junge Krähen flattern von der Türstufe auf und hinüber zu ihrer Eiche am Ende des Gartens. Sie keckern dabei so heftig, dass sie förmlich durch die Luft purzeln.
Rip jagt hinter ihnen her, fest entschlossen, sie in Stücke zu reißen. »Gibt’s ja nicht«, sagt Cal amüsiert. Seit er in das Haus eingezogen ist, hat er versucht, eine Beziehung zu dieser Krähenkolonie aufzubauen, aber die gestaltet sich anders als erhofft. Er hatte so eine disneymäßige Vorstellung, sie würden ihm Geschenke bringen und aus der Hand fressen. Die Krähen betrachten ihn ganz eindeutig als Bereicherung für die Nachbarschaft, aber hauptsächlich, weil er ihnen Essensreste hinlegt, und wenn ihnen langweilig wird, schimpfen sie von oben in seinen Schornstein, schmeißen Steine in den Kamin oder klopfen an die Fenster. Das keckernde Kläffen ist neu.
Kurz vor dem Baum macht Rip eine Hundertachtziggradwende und saust ums Haus herum Richtung Straße. Cal weiß, was das bedeutet. Er geht zurück ins Wohnzimmer, um das Bügeleisen auszustöpseln.
Trey kommt allein herein: Rip und Banjo jagen sich gegenseitig durch den Garten oder ärgern die Krähen oder stöbern irgendwas in den Hecken auf. Die Hunde finden auf Cals vier Hektar großem Grundstück mehr als genug Beschäftigung. Sie werden keine Schafe hetzen und sich erschießen lassen.
»Hab den hier abgeholt«, sagt Trey. Sie nimmt den Stuhl vom Rücken. »Von der Frau hinterm Berg.«
»Prima«, sagt Cal. »Hunger?«
»Nee. Hab schon gegessen.«
Cal, der selbst in bitterer Armut aufgewachsen ist, versteht Treys empfindliche Reaktion auf solche Angebote. »Kekse sind in der Dose, falls du noch was Süßes willst«, sagt er. Trey geht zum Schrank.
Cal hängt noch ein Hemd auf einen Kleiderbügel und stellt dann das Bügeleisen zum Abkühlen auf die Küchenarbeitsplatte. »Ich überlege, den hier loszuwerden«, sagt er und zupft an seinem Bart. »Was meinst du?«
Trey bleibt mit einem Keks in der Hand stehen und starrt ihn an, als hätte er vorgeschlagen, nackt durch die Hauptstraße von Ardnakelty zu spazieren. »Nee«, sagt sie mit Nachdruck.
Cal sieht ihren Gesichtsausdruck und muss grinsen. »Nee? Wieso nee?«
»Du würdest blöd aussehen.«
»Besten Dank, Trey.«
Sie zuckt die Achseln. Cal kennt sämtliche Spielarten ihres Achselzuckens. Diesmal bedeutet es, sie hat gesagt, was sie davon hält, und damit ist die Sache für sie erledigt. Sie stopft sich den Rest des Kekses in den Mund und trägt den Stuhl in das kleinere Zimmer, das sie jetzt als Werkstatt nutzen.
Da Treys Konversationsfähigkeiten nun mal sind, wie sie sind, verlässt sich Cal meistens darauf, dass Timing und Qualität ihres Schweigens ihm vermitteln, was er wissen sollte. Normalerweise hätte sie das Thema nicht so schnell fallenlassen, sondern ihn noch ein bisschen damit aufgezogen, wie er glatt rasiert aussehen würde. Irgendwas beschäftigt sie.
Er bringt die Hemden in sein Schlafzimmer und geht zu Trey in die Werkstatt. Der kleine sonnige Raum, den sie mit der übrig gebliebenen Farbe vom Haus gestrichen haben, riecht nach Sägemehl, Lack und Bienenwachs. Er ist eng und vollgestopft, aber gut sortiert. Als Cal klarwurde, dass sie das Möbelrestaurieren ernsthaft betreiben würden, hat er mit Trey ein stabiles Regal samt Fächern für Nägel, Dübel, Schrauben, Lappen, Stifte, Schraubzwingen, Wachs, Holzbeize, Holzöl, Schubladengriffe und so weiter gebaut. An den Wänden sind Lochplatten mit reihenweise Halterungen für Werkzeuge, deren Umrisse säuberlich aufgezeichnet sind. Cal hat mit der alten Werkzeugkiste seines Großvaters angefangen und mittlerweile sämtliche Schreinerwerkzeuge angesammelt, die es gibt, und noch ein paar mehr, die es offiziell nicht gibt, die er und Trey aber für ihre Bedürfnisse entworfen haben. Es gibt einen Arbeitstisch, eine Drechselbank, und in einer Ecke stapeln sich Restholzstücke für Reparaturarbeiten. In einer anderen Ecke lehnt ein kaputtes Wagenrad, das Trey irgendwo gefunden hat und das sie behalten, weil man ja nie weiß.
Trey schiebt mit dem Fuß ein Stück Abdeckplane zurecht, um den Stuhl daraufzustellen. Der Stuhl ist von guter Qualität, Handarbeit, und so alt, dass zahllose Hinterteile eine Mulde in die Sitzfläche gescheuert haben und viele Füße eine weitere in die vordere Querstrebe. Rückenlehne und Beine sind fein gedrechselte Stäbe, hier und dort mit Rillen und Wülsten verziert. Aber er hat die längste Zeit seines Lebens nah an einem Kamin oder Herd gestanden: Rauch, Fett und Politurschichten haben ihn mit einem dunklen, klebrigen Film überzogen.
»Schöner Stuhl«, sagt Cal. »Müssen wir erst gründlich reinigen, ehe wir mit der eigentlichen Arbeit anfangen.«
»Hab ich ihr auch gesagt. Sie war einverstanden. Ihr Großvater hat ihn gebaut.«
Cal kippt den Stuhl, um den Schaden zu begutachten. »Am Telefon hat sie gesagt, die Katze hätte ihn umgestoßen.«
Trey stößt ein skeptisches Pfft aus.
»Klar«, sagt Cal.
»Ihr Sohn Jayden ist auf meiner Schule«, erklärt sie. »Er ist ein Arsch. Schlägt kleine Kinder.«
»Wie auch immer«, sagt Cal. »Das hier muss alles ausgetauscht werden. Welches Holz würdest du nehmen?«
Trey inspiziert die Sitzfläche, die von den vielen Hinterteilen so sauber geblieben ist, dass man die Maserung sieht und die Bruchstellen. »Eiche. Weiß.«
»Guck mal nach, ob wir ein Stück haben, das dick genug zum Drechseln ist. Farbe ist erst mal egal, wir beizen es sowieso. Aber die Maserung muss möglichst ähnlich sein.«
Trey hockt sich vor den Stapel Holzreste und beginnt, ihn durchzusehen. Cal geht in die Küche und mischt in einer alten Kanne Essigessenz mit warmem Wasser. Dann wischt er mit einem weichen Lappen den Staub vom Stuhl, lässt Trey Raum, in den sie hineinreden kann, falls sie Lust dazu hat, und beobachtet sie.
Sie ist groß geworden. Vor zwei Jahren, als sie zum ersten Mal in seinem Garten auftauchte, war sie ein mageres, schweigsames Kind, das sich selbst die Haare geschoren hatte und zwischen Fluchtimpuls und Angriffslust hin und her pendelte wie eine halbwüchsige Raubkatze. Jetzt reicht sie ihm bis über die Schulter, die raspelkurzen Haare sind einem passablen Bubikopf gewichen, ihre Gesichtszüge bekommen allmählich eine neue Klarheit, und sie kramt in seinem Haus herum, als würde sie hier wohnen. Sogar richtige Gespräche führt sie, zumindest an den meisten Tagen. Sie zeigt nichts von dem gezierten Getue und der Raffinesse, die manche Teenager an den Tag legen, aber sie ist trotzdem ein Teenager, was bedeutet, dass ihre Psyche und ihr Leben mit jedem Tag komplizierter werden. In den Dingen, die sie sagt, über die Schule, ihre Freunde und so weiter, schwingen neue Bedeutungen mit. Cal hat damit offenbar mehr Probleme als sie selbst. Wenn er auch nur ansatzweise wahrnimmt, dass sie irgendwas beschäftigt, breitet sich neuerdings die Sorge in ihm weiter und dunkler aus. Mit fünfzehn kann zu viel passieren, das zu viel Schaden anrichtet. Auf ihre eigene Art wirkt Trey solide wie Hartholz, aber sie hat schon zu viele Schläge eingesteckt, um nicht irgendwo in ihrem Innern Risse zu haben.
Cal nimmt einen sauberen Lappen und fängt an, den Stuhl mit der Essigmischung abzureiben. Der klebrige Film löst sich leicht, hinterlässt lange braune Streifen auf dem Lappen. Vor dem Fenster tönt melodischer Amselgesang von weit her über die Felder, und Bienen schwelgen in dem Klee, der Cals Garten erobert hat. Die Hunde haben einen Stock gefunden, mit dem sie Tauziehen spielen.
Trey hält zwei Holzstücke nebeneinander, um sie zu vergleichen, sagt: »Mein Dad ist wieder da.«
Cal erstarrt schlagartig. Das zählte nicht zu den vielen Ängsten, die in ihm herumschwirrten.
Nach einer gefühlten Ewigkeit sagt er: »Seit wann?« Es ist eine dumme Frage, aber etwas anderes fällt ihm nicht ein.
»Heute Vormittag. Als ich den Stuhl geholt hab.«
»Okay«, sagt Cal. »Und? Ist er für immer zurück? Oder bloß zu Besuch?«
Trey antwortet mit einem übertriebenen Achselzucken: keine Ahnung.
Cal wünscht, er könnte ihr Gesicht sehen. Er sagt: »Wie findest du das?«
Trey sagt barsch: »Von mir aus kann er sich verpissen.«
»Okay«, sagt Cal. »Das ist verständlich.« Vielleicht sollte er ihr eine Ansprache halten, in der die Worte »aber er ist doch dein Daddy« vorkommen, doch Cal hat es sich zur Regel gemacht, Trey nie irgendwelchen Schwachsinn zu erzählen, und seine Gefühle in Bezug auf Johnny Reddy decken sich zufälligerweise mit ihren.
Trey fragt: »Kann ich heute Nacht hierbleiben?«
Schon wieder erstarrt Cal innerlich. Er macht sich weiter daran, den Stuhl abzureiben, achtet auf einen gleichmäßigen Rhythmus. Nach einem Moment sagt er: »Hast du Angst, dein Dad könnte irgendwas machen?«
Trey schnaubt. »Nee.«
Sie klingt, als meine sie es ehrlich. Cal entspannt sich ein wenig. »Was hast du dann?«
»Er kann nicht einfach wieder so reingeschneit kommen.«
Sie steht mit dem Rücken zu Cal und kramt in dem Holzstapel, aber ihre gebeugte Wirbelsäule wirkt angespannt vor Wut. »Stimmt«, sagt Cal. »Würde ich wahrscheinlich genauso sehen.«
»Also darf ich hierbleiben?«
»Nein«, sagt Cal. »Keine gute Idee.«
»Wieso?«
»Tja«, sagt Cal. »Dein Dad ist vielleicht nicht glücklich darüber, dass du abhaust, sobald er wieder da ist. Und ich denke, ich sollte ihn nicht gleich am Anfang verärgern. Falls er dableibt, wäre es besser, wenn er nichts dagegen hat, dass du Zeit hier verbringst.« Dabei belässt er es. Sie ist alt genug, zumindest einige der anderen Gründe zu verstehen, die dagegensprechen. »Ich ruf Lena an. Vielleicht kannst du bei ihr übernachten.«
Sie will widersprechen, überlegt es sich dann aber anders und verdreht stattdessen die Augen. Cal merkt zu seiner eigenen Überraschung, dass er sich zittrig fühlt, als ob er von irgendetwas Hohem heruntergefallen wäre und sich hinsetzen müsste. Er lehnt sich an den Arbeitstisch und zieht sein Handy aus der Tasche.
Nach kurzem Nachdenken schickt er Lena eine Textnachricht, statt sie anzurufen. Kann Trey heute bei dir übernachten? Keine Ahnung, ob du es schon gehört hast, aber ihr Dad ist wieder da. Ihr ist nicht danach, in seiner Nähe zu sein.
Er bleibt still stehen – beobachtet, wie das Sonnenlicht auf Treys schmalen Schultern spielt, während sie Holzstücke herauszieht und wieder weglegt –, bis Lena zurückschreibt: Scheiße. Kann sie gut verstehen. Klar kann sie bei mir übernachten. Kein Problem.
Danke, antwortet Cal. Ich schick sie nach dem Abendessen rüber.
»Sie schreibt, du kannst gern bei ihr schlafen«, sagt er zu Trey und steckt sein Handy ein. »Aber du musst deiner Mama Bescheid geben, wo du bist. Oder bitte Lena, dass sie das macht.«
Trey verdreht die Augen noch mehr. »Hier«, sagt sie und zeigt ihm eine alte Eichenschwelle. »Geht das?«
»Sieht gut aus.«
Trey markiert das Ende der Schwelle mit einem schwarzen Filzstift und legt sie wieder in die Ecke. »Geht das Zeug ab?«, fragt sie.
»Ja, ganz prima. Kinderleicht.«
Trey sucht sich einen sauberen Lappen, tunkt ihn in die Essigmischung und wringt ihn kräftig aus. Sie sagt: »Was, wenn er nicht will, dass ich herkomme?«
»Meinst du, er hat was dagegen?«
Trey denkt darüber nach. »Früher war ihm scheißegal, was wir gemacht haben.«
»Na, dann wird ihm das hier wahrscheinlich auch scheißegal sein. Falls nicht, lassen wir uns schon was einfallen.«
Trey blickt kurz zu ihm hoch.
Cal sagt: »Wir lassen uns was einfallen.«
Sie nickt, eine entschlossene, ruckartige Bewegung, und fängt an, den Stuhl zu bearbeiten. Cal hat schon wieder das Gefühl, sich hinsetzen zu müssen, weil ein Satz von ihm sie noch immer beruhigen kann.
Trotzdem ist sie selbst für ihre Verhältnisse heute einsilbig. Nach einer Weile kriegen Rip und Banjo Durst. Sie kommen durch die offene Haustür herein, trinken lange und geräuschvoll aus ihren Näpfen, um sich dann in der Werkstatt ein bisschen Zuwendung zu holen. Trey hockt sich auf den Boden und schmust ein Weilchen mit ihnen, lacht sogar, als Rip sie so fest unters Kinn stupst, dass sie auf den Hintern fällt. Dann legen sich die Hunde in ihrer Ecke hin, um auszuruhen, Trey nimmt wieder ihren Lappen und bearbeitet weiter den Stuhl.
Auch Cal ist nicht unbedingt nach Reden zumute. Er hätte niemals damit gerechnet, dass Treys Vater zurückkommt. Obwohl er Johnny Reddy nur vom Hörensagen kennt, hält er ihn für einen Typ Mann, mit dem er schon zu tun hatte: ein Kerl, dessen Masche es ist, an einem neuen Ort aufzutauchen und sich als irgendwas auszugeben, was ihm gerade nützlich erscheint. Um dann so viel wie möglich aus der Verkleidung herauszuholen, bis sie zu fadenscheinig wird, um ihn länger zu tarnen. Cal fällt kein überzeugender Grund ein, warum Johnny Reddy ausgerechnet hierher zurückkommen sollte, an den einzigen Ort, an dem er sich nicht als etwas anderes ausgeben kann, als er nun mal ist.
Lena hängt ihre Wäsche an der Leine im Garten auf, was ihr mehr Freude bereitet, als man denken könnte. Sie nimmt nicht nur intensiv die warme, nach frisch gemähtem Gras duftende Luft wahr und das üppige Sonnenlicht, sondern macht sich auch bewusst, dass sie genau da steht, wo schon Generationen von Frauen standen, um vor dem Grün der Weiden und der fernen Silhouette der Berge dieselbe Arbeit zu verrichten. Als ihr Mann vor fünf Jahren starb, eignete sie sich die Fähigkeit an, jedes Fitzelchen Glück mitzunehmen, das sie finden konnte. Ein frisch bezogenes Bett oder eine perfekt gebutterte Scheibe Toast konnten ihr genug Erleichterung verschaffen, um ein- oder zweimal durchzuatmen. Ein Lufthauch bläht die Laken an der Leine auf, und Lena singt leise vor sich hin, Liedfetzen, die sie im Radio gehört hat.
»Na, da schau her«, sagt eine Stimme hinter ihr. »Lena Dunne. In voller Lebensgröße und doppelt so schön.«
Als Lena sich umdreht, lehnt Johnny Reddy am Gartentor und mustert sie von oben bis unten. Johnny hatte schon immer die Art, Frauen zu beäugen, als würde er sich genüsslich daran erinnern, wie sie mit ihm im Bett waren. Da er nie in Lenas Bett war und auch nie sein wird, geht ihr das gegen den Strich.
»Johnny«, sagt sie und erwidert seinen Paternosterblick. »Hab schon gehört, dass du zurück bist.«
Johnny lacht. »Großer Gott, hier spricht sich noch immer alles rasend schnell rum. Das Kaff hat sich kein bisschen verändert.« Er lächelt sie warm an. »Und du auch nicht.«
»Doch, hab ich«, sagt Lena. »Gott sei Dank. Aber du nicht.« Es stimmt. Abgesehen von den ersten grauen Haaren sieht Johnny noch so aus wie damals, als er regelmäßig Steinchen an ihr Fenster warf und sie mit einem halben Dutzend anderen zur Disco in der Stadt kutschierte, alle zusammengequetscht in dem klapprigen Ford Cortina von seinem Dad. Sie brausten durch die Dunkelheit und kreischten bei jedem Schlagloch. Er steht sogar noch genauso da wie früher, ungezwungen wie ein junger Bursche, was Lenas Theorie bestätigt, dass Taugenichtse am besten altern.
Er grinst, streicht sich mit einer Hand über den Kopf. »Ich hab jedenfalls noch meine Haare. Das ist die Hauptsache. Wie geht’s dir?«
»Gut«, sagt Lena. »Und dir?«
»Besser denn je. Ist toll, wieder zu Hause zu sein.«
»Prima. Schön für dich.«
»Ich war in London«, verrät Johnny ihr.
»Weiß ich. Wolltest da ein Vermögen machen. Hast du?«
Sie rechnet mit einer kunstvoll ausgeschmückten Geschichte, in der er ganz kurz davor war, Millionär zu werden, bis irgendein Halunke aufkreuzte und ihm seine große Chance vor der Nase weggeschnappte, eine Story, die seinen Besuch wenigstens so interessant machen würde, dass er halbwegs ihre Zeit lohnt. Stattdessen tippt sich Johnny verschmitzt an die Nase. »Na, na, ich will nix verraten. Die Sache ist im Bau. Zutritt nur für Mitarbeiter.«
»Mist«, sagt Lena. »Ich hab meinen Helm vergessen.« Sie widmet sich wieder ihrer Wäsche und denkt, Johnny hätte sie ihre Arbeit wenigstens bis zum Ende genießen lassen können.
»Soll ich dir helfen?«, fragt er.
»Nicht nötig«, sagt Lena. »Bin gleich fertig.«
»Sehr gut.« Johnny öffnet das Tor weit und macht eine einladende Handbewegung. »Dann kannst du ja einen Spaziergang mit mir machen.«
»Ich hab noch was anderes zu tun.«
»Das kann warten. Du hast dir ein Päuschen verdient. Wann hast du das letzte Mal einfach einen Tag freigemacht? Früher warst du richtig gut darin.«
Lena sieht ihn an. Er hat noch immer dieses Lächeln, das träge, spitzbübische Mundwinkelkräuseln, das den Leichtsinn in dir weckte und dir weismachte, es würde schon alles gut gehen. Lena achtete darauf, kein Risiko einzugehen, bis auf die halsbrecherischen Fahrten im Cortina. Sie hatte Spaß mit Johnny, doch obwohl er der hübscheste Kerl und der größte Charmeur in Ardnakelty und Umgebung war, löste er nie so viel in ihr aus, dass sie ihn weiter kommen ließ als außen an ihren BH. Johnny Reddy hatte keine Substanz. Da war nichts in ihm, was sie anzog. Aber Sheila Brady, die damals Lenas Freundin war, glaubte daran, dass alles gut gehen würde und irgendwo in ihm etwas Substanzielles versteckt war. Bis sie schwanger wurde. Von da an ging es mit ihr immer nur bergab.
Sheila war alt genug und intelligent genug, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, aber Johnnys Dynamik riss auch ihre gemeinsamen Kinder mit. Lena hat Trey Reddy so lieb gewonnen wie kaum einen anderen Menschen.
»Weißt du, wer gern mal einen Tag freimachen würde?«, sagt sie. »Sheila. Die war auch mal richtig gut darin.«
»Sie ist zu Hause bei den Kindern. Theresa ist irgendwohin – die ist ganz der Vater, die Kleine, hat Hummeln im Hintern. Die anderen sind zu klein, um auf sich selbst aufzupassen.«
»Na dann, ab nach Hause mit dir. Pass du auf sie auf, dann kann Sheila einen Spaziergang machen.«
Johnny lacht, und es ist kein aufgesetztes Lachen. Er schämt sich wirklich nicht, ist nicht mal verärgert. Einer der Gründe, weshalb Lena sich nie zu Johnny hingezogen fühlte, war, dass man ihn glatt durchschauen und ihm das auch sagen konnte, ohne dass es ihm was ausmachte. Wenn du nicht auf sein Gelaber reinfielst, gab es jede Menge andere, die es tun würden.
»Sheila hängt die Aussicht bestimmt längst zum Hals raus. Aber mir hat sie jahrelang gefehlt. Komm schon, ich will sie mit dir genießen.« Er schwenkt das Tor auffordernd hin und her. »Dann kannst du mir erzählen, was du die ganze Zeit so getrieben hast, und ich erzähl dir, was ich in London gemacht hab. Der Typ, der über mir gewohnt hat, war von den Philippinen, und er hatte einen Papagei, der auf Filipino, oder wie das heißt, fluchen konnte. So was findest du nicht in Ardnakelty. Wenn dich das nächste Mal wer nervt, kannst du ihn als Sohn einer Heuschrecke beschimpfen. Ich bring’s dir bei.«
»Ich hab das Land, auf dem du stehst, an Ciaran Maloney verkauft. Das hab ich getrieben«, erwidert Lena. »Wenn der dich da sieht, jagt er dich weg. Dann kannst du ihn ja als Sohn einer Heuschrecke beschimpfen.« Sie hebt ihren Wäschekorb auf und geht ins Haus.
Vorsichtig lugt sie durchs Küchenfenster und schaut Johnny hinterher, der über die Weide davonschlendert, um sich jemand anderen zum Anlächeln zu suchen. Seinen Akzent hat er sich jedenfalls nicht abgewöhnt, das muss sie ihm lassen. Sie hätte gewettet, dass er wie Guy Ritchie redet, wenn er zurückkommt, aber er klingt noch immer wie ein Junge aus Ardnakelty.
Jetzt, wo ihr Zorn abklingt, wird ihr etwas klar, was die ganze Zeit in ihrem Unterbewusstsein rumort hat. Johnny hat immer Wert auf gepflegtes Aussehen gelegt. Wenn er vor ihrem Fenster auftauchte, roch er nach teurem Aftershave – wahrscheinlich geklaut –, seine Jeans war gebügelt, die Frisur saß tadellos, und der Cortina war auf Hochglanz poliert. Er war der einzige Junge, den Lena kannte, der nie abgebrochene Fingernägel hatte. Seine Kleidung heute war nagelneu bis runter zu den Schuhen und auch kein Billigzeug, aber die Haare hingen über die Ohren und fielen ihm in die Augen. Er hatte versucht, sie mit Gel zu bändigen, aber dafür waren sie zu zottelig. Wenn Johnny Reddy es so eilig hatte, nach Hause zu kommen, dass ihm keine Zeit für einen Friseurbesuch blieb, dann nur, weil ihm irgendwelcher Ärger im Nacken sitzt.
Als Trey und Banjo sich auf den Weg zu Lena machen, ist es nach zehn, und der lange Sommerabend hat sich erschöpft. In der endlosen Dunkelheit flattern Motten und Fledermäuse, und auf den Weiden kann man die gemächlichen Bewegungen der Kühe hören, die sich schlafen legen. Die Luft bewahrt noch die Hitze des Tages, die von der Erde aufsteigt. Der Himmel ist sternenklar: Morgen wird wieder ein heißer Tag werden.
Trey überlegt, was sie von ihrem Dad in Erinnerung hat. Sie hat nicht oft an ihn gedacht, seit er fortging, deshalb braucht sie eine Weile, bis ihr etwas einfällt. Er hatte Spaß daran, ihre Mam abzulenken, sie einfach zu umarmen, wenn sie gerade den Herd putzte, und mit ihr durch die Küche zu tanzen. Manchmal, wenn er was getrunken hatte und irgendwas nicht so gelaufen war, wie er wollte, schlug er sie und ihre Geschwister. Dann wiederum spielte er mit ihnen, als wäre er selbst noch ein Kind. Manchmal nahmen er und Treys großer Bruder Brendan die Kleinen auf den Rücken wie reitende Cowboys und jagten Trey und Maeve durch den Garten, versuchten, sie zu fangen. Er versprach ihnen oft irgendwelche Sachen: Er genoss ihre strahlenden Gesichter, wenn er beteuerte, er würde mit ihnen in den Zirkus in Galway gehen oder ihnen ein Spielzeugauto kaufen, das die Wände hochfahren konnte. Er hielt es offenbar für unnötig, seine Versprechen auch zu halten. Tatsächlich wirkte er immer ein bisschen erstaunt und beleidigt, wenn sie ihn daran erinnerten. Nach einer Weile hörte Trey auf, bei den Cowboyspielen mitzumachen.
In Lenas Haus brennt Licht, drei kleine, säuberliche Rechtecke aus Gelb vor den schwarzen Feldern. Ihre Hunde Nellie und Daisy kündigen an, dass Trey und Banjo kommen. Noch bevor sie am Tor sind, öffnet Lena die Tür und bleibt wartend im Licht stehen. Ihr Anblick entspannt Treys Muskeln ein wenig. Lena ist groß und kräftig gebaut, mit ausgeprägten Rundungen, breiten Wangenknochen und einem breiten Mund. Sie hat volles blondes Haar und sehr blaue Augen. Alles an ihr strahlt Verlässlichkeit aus, nichts ist bloß angedeutet. Cal ist genauso: der größte Mann, den Trey kennt, und auch einer der breitschultrigsten, mit dichtem braunem Haar und einem dichten braunen Bart und Händen so groß wie Schaufeln. Trey selbst ist eher für Wendigkeit gebaut und dafür, nicht aufzufallen. Sie hat kein Problem damit, aber sie findet Cals und Lenas Robustheit ungemein beruhigend.
»Danke, dass ich bei dir übernachten kann«, sagt sie auf der Türschwelle und reicht Lena einen Ziplock-Beutel voll Fleisch. »Kaninchen.«
»Besten Dank«, sagt Lena. Ihre Hunde kreisen zwischen Trey, Banjo und dem Beutel. Lena drückt ihre Nasen beiseite. »Hast du es selbst geschossen?«
»Ja«, sagt Trey und folgt Lena ins Haus. Cal hat ein Jagdgewehr und einen Kaninchenbau auf seinem Grundstück. Das Kaninchen war seine Idee: Er meint, es gehört sich, dass man seiner Gastgeberin ein Geschenk mitbringt. Trey findet das richtig. Ihr widerstrebt der Gedanke, in jemandes Schuld zu stehen, selbst in Lenas. »Heute Abend, ist ganz frisch. Muss einen Tag in den Kühlschrank, sonst wird’s zäh. Dann kannst du es einfrieren.«
»Vielleicht ess ich es morgen. Hab schon länger nicht mehr Kaninchen gegessen. Wie bereitet ihr es zu?«
»Mit Knoblauch und so. Und dann kommen noch Tomaten und Paprika rein.«
»Ah«, sagt Lena. »Ich hab keine Tomaten. Die müsste ich bei Noreen kaufen, und dann wird sie wissen wollen, was ich denn koche und woher ich das Kaninchen hab und wieso du bei mir warst. Selbst wenn ich ihr kein Wort sage, würde sie was wittern.« Lenas Schwester Noreen führt den Dorfladen und hat das ganze Dorf im Griff.
»Wahrscheinlich weiß sie’s längst«, sagt Trey. »Das mit meinem Dad.«
»Würde mich nicht wundern. Aber sie braucht nicht noch mehr Wasser auf ihre Mühle. Sie soll sich ruhig ein bisschen anstrengen.« Lena verstaut das Kaninchen im Kühlschrank.
Im Gästezimmer, groß und luftig und weiß gestrichen, beziehen sie das Bett für Trey. Es ist breit und wuchtig mit knorrigen, verschrammten Eichenholzpfosten, die Trey auf siebzig oder achtzig Jahre schätzt. Lena nimmt die Patchworkdecke ab und faltet sie zusammen. »Bei der Hitze brauchst du die nicht.«
»Wer schläft denn sonst hier?«, erkundigt sich Trey.
»Keiner mehr. Früher hatten Sean und ich öfter übers Wochenende Besuch von Freunden aus Dublin. Nach seinem Tod war mir eine Zeitlang überhaupt nicht nach Besuch. Und irgendwie ist es dabei geblieben.« Lena wirft die Decke in eine Kiste am Fußende des Bettes. »Dein Dad war heute Nachmittag hier.«
»Hast du ihm gesagt, dass ich herkomme?«, will Trey wissen.
»Nein, hab ich nicht. Aber ich hab deiner Mam gesimst.«
»Was hat sie geantwortet?«
»›In Ordnung.‹« Lena nimmt ein Laken von dem Stapel auf einem Stuhl und schüttelt es aus. »Ich hab die Bettwäsche auf die Leine gehängt, müsste gut durchgelüftet sein. Was hältst du davon, dass dein Dad wieder da ist?«
Trey zuckt die Achseln. Sie schnappt sich zwei Zipfel des Lakens, als Lena sie ihr zuwirft, und fängt an, sie unter die Matratze zu klemmen.
»Meine Mam hätte ihm sagen können, er soll sich verpissen.«
»Sie hätte alles Recht dazu gehabt«, pflichtet Lena ihr bei. »Aber ich glaube nicht, dass er ihr die Chance dazu gelassen hat. Ich glaube, dass er ganz unverhofft mit einem breiten Grinsen und einem dicken Kuss bei ihr auf der Matte stand und dann reinspaziert ist, ehe sie überhaupt wusste, wie ihr geschah. Und als sie wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, war es zu spät.«
Trey denkt darüber nach. Es klingt nicht unwahrscheinlich. »Sie könnte ihn morgen rausschmeißen.«
»Vielleicht macht sie das«, sagt Lena. »Vielleicht auch nicht. Die Ehe ist eine merkwürdige Angelegenheit.«
»Ich heirate nie«, sagt Trey. Sie hegt ein tiefes Misstrauen gegenüber der Ehe und allem, was ihr ähnelt. Sie weiß, dass Lena manchmal die Nacht bei Cal verbringt, aber Lena hat auch ein eigenes Haus, in das sie zurückkehren kann, wann sie will, und wo niemand sonst was zu sagen hat oder einfach auftauchen kann. Für Trey scheint das das einzig mögliche Arrangement zu sein, das irgendwie Sinn ergibt.
Lena zuckt die Achseln, zieht eine Ecke des Lakens straffer. »Manch einer würde dir sagen, dass du deine Meinung noch ändern wirst. Wer weiß? Für einige Menschen ist die Ehe das Richtige, jedenfalls für einen Teil ihres Lebens. Aber nicht alle sind dafür geschaffen.«
Trey fragt unvermittelt: »Wirst du Cal heiraten?«
»Nein. Ich war gern verheiratet, größtenteils, aber damit bin ich fertig. Ich mag mein Leben, wie es ist.«
Trey nickt. Sie ist erleichtert. Die Frage beschäftigt sie schon eine Weile. Sie findet es gut, dass Cal und Lena zusammen sind – wenn er oder sie mit wem anders zusammenkäme, würde das die Lage verkomplizieren –, aber sie möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, dass sie getrennt wohnen.
»Ich hatte aber durchaus Angebote«, schiebt Lena nach und wirft schwungvoll die Decke aufs Bett. »Vor ein paar Jahren ist Bobby Feeney zu mir gekommen, in Schale geschmissen und mit einem Strauß Nelken in der Hand, und wollte mir erklären, wieso er einen prima zweiten Ehemann abgeben würde.«
Trey stößt unwillkürlich ein schallendes Lachen aus. »Na hör mal«, sagt Lena tadelnd. »Es war ihm todernst. Er hatte sich alles genau überlegt. Er meinte, ich könnte ihm mit den Schafen helfen, weil ich mit Vieh umgehen kann, und er kann gut Sachen reparieren, deshalb müsste ich mich um nichts kümmern, wenn mal eine Sicherung rausfliegt oder ein Türgriff abfällt. Weil ich zu alt zum Kinderkriegen bin, würde ich nicht von ihm erwarten, ein guter Daddy zu sein; und weil er selbst auch nicht mehr der Jüngste ist, würde er nicht dauernd was von mir wollen. An den meisten Abenden ist er sowieso unten im Pub oder oben in den Bergen, um Ausschau nach Ufos zu halten, deshalb würde er mich nicht weiter stören. Seine einzige Sorge war, dass seine Mam was dagegen haben könnte, aber er war zuversichtlich, dass wir sie schließlich doch rumkriegen würden, vor allem, wenn ich gut Milchreis kochen könnte. Bei Milchreis wird Mrs. Feeney anscheinend sofort schwach.«
Trey muss die ganze Zeit grinsen. »Was hast du geantwortet?«
»Bobby ist in Ordnung«, sagt Lena. »Er ist ein furchtbarer Trottel, aber das kann ich ihm nicht vorwerfen. So war er schon, als wir noch in den Windeln steckten. Ich hab ihm gesagt, dass er viele gute Argumente hat, aber dass ich mich zu sehr an mein Leben gewöhnt hab, um irgendwas zu ändern. Dann hab ich ihm ein Glas von meiner Brombeermarmelade geschenkt, die kann seine Mam sich auf ihren Milchreis tun, und hab ihn weggeschickt. Ich würde sagen, die Marmelade hat ihn um einiges glücklicher gemacht, als ich es getan hätte.« Sie wirft Trey einen Kissenbezug zu. »Banjo kann hier bei dir schlafen, wenn du willst.«
»Dann springt er aufs Bett.«
»Von mir aus. Solange er nicht reinpinkelt.«
Trey fragt: »Wie lange kann ich bleiben?«
Lena sieht sie an. »Geh morgen nach Hause. Guck dir ein paar Tage lang an, wie es so läuft. Danach sehen wir weiter.«
Trey versucht gar nicht erst zu widersprechen. Lena lässt sich eigentlich nie umstimmen. »Darf ich dann wiederkommen?«
»Wahrscheinlich, wenn du willst. Warten wir’s ab.«
»Ich werd das hier wachsen«, sagt Trey und deutet mit dem Kinn auf das Eichenbett. »Kann eine neue Beschichtung gebrauchen.«
Lena lächelt. »Würde ihm wirklich guttun. So, jetzt versuch zu schlafen. Ich hol dir noch ein T-Shirt.«
Das T-Shirt riecht sonnengetrocknet und nach Lenas Waschpulver, das ein anderes ist als das von Treys Mam. Eine Zeitlang liegt Trey wach, lauscht den gedämpften Schritten und dem Rascheln von Lena, die sich im Zimmer nebenan bettfertig macht. Ihr gefällt das breite Bett und dass Maeve nicht einen Meter entfernt von ihr schnieft und strampelt und genervte Selbstgespräche führt. Sogar im Schlaf ist Maeve mit fast allem unzufrieden.
Hier unten klingt die Nacht anders. Oben am Berg weht immer ein aggressiver Wind, der gegen die losen Fensterscheiben drückt und die Bäume unruhig rauschen lässt, alle anderen Geräusche übertönt. Hier kann Trey Dinge klar hören: das trockene Knacken eines Zweiges, eine Eule auf Jagd, junge Füchse, die weit hinten auf den Feldern balgen. Am Fußende des Bettes dreht Banjo sich um und stößt einen wohligen Seufzer aus.
Trotz des Bettes und der friedlichen Nacht kann Trey nicht einschlafen. Sie hat so ein Gefühl, als müsste sie bereit sein, nur für alle Fälle. Das Gefühl ist vertraut und zugleich fremdartig. Trey ist gut darin, Dinge um sich herum wahrzunehmen, hat aber kein Interesse daran, Dinge in ihrem Inneren zu registrieren, deshalb dauert es eine Weile, bis sie begreift, dass sie sich die meiste Zeit so gefühlt hat, bis sie vor ein paar Jahren Cal und Lena kennenlernte. Es ist ganz allmählich verblasst, so dass sie es vergessen hat, bis jetzt.
Trey weiß sehr genau, was sie mag und was sie nicht mag, und sie mochte ihr Leben sehr viel mehr so, wie es noch heute Morgen war. Sie liegt still im Bett, lauscht den Geschöpfen, die sich vor dem Fenster bewegen, und dem Nachtwind, der vom Berg herabweht.
2
Der nächste Tag ist wie der vorangegangene. Morgentau verdunstet rasch unter einem blauen leeren Himmel. Cal ruft bei Lena an, die ihm berichtet, dass es Trey gut geht und sie außer Hundefutter alles isst, was das Haus zu bieten hat. Dann verbringt er den Morgen hinten auf seiner Wiese, wo er ein Gemüsebeet angelegt hat. Letztes Jahr wuchs alles mehr oder weniger von selbst, Cal musste lediglich die Krähen, die Schnecken und die Kaninchen in Schach halten, was ihm mit einer Kombination aus Bierfallen, Hühnerdraht, Rip und einer Vogelscheuche gelang. Die Vogelscheuche durchlief verschiedene Phasen. Erst hatten Cal und Trey ihr ein altes Hemd und eine abgetragene Jeans von Cal angezogen. Dann kramte Lena ein paar alte Schals hervor, die für ein bisschen mehr Geflatter sorgen sollten, aber daraufhin beschwerte sich Cals nächster Nachbar Mart, das sähe ja aus, als vollführe sie den Tanz mit sieben Schleiern, und das würde die ganzen alten Junggesellen in der Gegend ablenken, was zu Missernten und einer Vernachlässigung der Schafe führen würde. Er verhinderte die drohende Katastrophe, indem er der Vogelscheuche etwas überstreifte, das wie eine echte Priesterrobe aussah. Als Cal ein paar Wochen später vom Einkaufen nach Hause kam, stellte er fest, dass eine bislang noch unbekannte Person dem Priester Schwimmflügel und einen My-Little-Pony-Schwimmreifen mit einem pinken Einhornkopf verpasst hatte. Die Krähen hatten die Vogelscheuche trotz der Kostümwechsel bis zum Ende des Sommers durchschaut, was sie dadurch deutlich machten, dass sie sie wahlweise als Spielgerät oder als Toilette nutzten.
Als in diesem Frühjahr der erste Salat spross, ließen Cal und Trey sich was einfallen und reaktivierten die Vogelscheuche mit einem Plastikzombie, den Cal online gefunden hatte. Er reagiert auf Bewegungen. Sobald etwas in seine Nähe kommt, blitzen die Augen rot auf, die Zähne klappern, er wedelt mit den Armen und macht Knurrgeräusche. Bislang jagt er den Krähen eine Heidenangst ein. Cal rechnet damit, dass ihre Rache gut durchdacht und raffiniert sein wird, wenn sie erst mal dahintergekommen sind.
In diesem Jahr ist das Wachstum wegen der Hitze anders. Die Pflanzen brauchen furchtbar viel Wasser, und er muss wesentlich häufiger Unkraut jäten. Auch die Erde ist anders als letzten Sommer, weniger satt und fest. Sie rieselt zwischen seinen Fingern hindurch, statt haften zu bleiben, und sie hat einen herberen, fast fiebrigen Geruch. Cal weiß aus dem Internet, dass das Wetter den Geschmack seiner Pastinaken versauen wird, aber die Tomaten gedeihen prächtig. Manche sind so groß wie Äpfel und werden schon rot.
Rip, der an Kaninchenfährten herumgeschnuppert hat, stößt plötzlich ein Bellen aus, das zu einem Bernhardiner passt. Rip hat sich nie mit seiner Größe abgefunden. In seiner Vorstellung ist er ein Hund, der entflohene Häftlinge aufspürt und lebendig zerfleischt.
»Was ist?« Cal dreht sich zu ihm um.
Er rechnet mit einem Jungvogel oder einer Feldmaus, doch Rip hat den Kopf gehoben, reckt ihn bebend vor, fixiert einen Mann, der über die Weide spaziert kommt.
»Bleib.« Cal richtet sich auf und wartet, während der Mann sich nähert. In der hochstehenden Sonne ist sein Schatten ein kleiner schwarzer Fleck, der ihm um die Füße wabert. Die Hitze verwischt seine Konturen.
»Das ist ein Prachtstück von Hund, den Sie da haben«, sagt der Mann, als er nah genug ist.
»Er ist ein guter Hund«, antwortet Cal. Er weiß, der Typ muss etwa in seinem Alter sein, um die fünfzig, aber er sieht jünger aus. Er hat ein nachdenkliches, fein geschnittenes Gesicht, mit dem er nicht gerade wie ein ärmlicher Kerl aus dem hintersten Irland wirkt. Im Film wäre er der Gentleman, dem unrecht getan wurde, der es verdient, sein Vermögen zurückzubekommen und die schönste Frau zu heiraten. Cal ist geradezu bestürzend erleichtert, dass er keinerlei Ähnlichkeit mit Trey hat.
»Johnny Reddy«, sagt der Mann und streckt Cal die Hand entgegen.
Cal hält beide Hände hoch, an denen dicke Erde klebt. »Cal Hooper«, sagt er.
Johnny grinst. »Weiß ich schon. Sie sind die größte Neuigkeit in Ardnakelty, seit PJ Fallons Schaf das Lamm mit zwei Köpfen geworfen hat. Wie ist es Ihnen denn hier so ergangen?«
»Kann nicht klagen«, sagt Cal.
»Irland, wo die Gastfreundschaft zu Hause ist«, sagt Johnny mit einem jungenhaften Lächeln. Cal misstraut erwachsenen Männern mit jungenhaftem Lächeln. »Wie ich höre, muss ich mich bei Ihnen bedanken. Meine Frau sagt, dass Sie furchtbar viel für unsere Theresa tun.«
»Keine Ursache«, sagt Cal. »Ohne ihre Hilfe hätte ich doppelt so lange gebraucht, um mein Haus auf Vordermann zu bringen.«
»Ah, das hör ich gern. Wär mir unangenehm, wenn Sie sich von ihr belästigt fühlen würden.«
»Überhaupt nicht«, sagt Cal. »Sie wird allmählich eine richtig geschickte Schreinerin.«
»Ich hab den Couchtisch gesehen, den ihr beide für meine Frau gemacht habt. Hat schöne, zierliche Beine. So Beine würde ich gern mal an einer Frau sehen.« Johnnys Grinsen wird breiter.
»Hat sie ganz allein gemacht«, sagt Cal. »Ich hab ihr kein bisschen geholfen.«
»Keine Ahnung, von wem sie das hat.« Johnny ändert rasch die Taktik, als er nicht mit dem lauten Lachen unter Männern belohnt wird, auf das er aus war. »Wenn ich mich an so was versuchen würde, würde ich glatt im Krankenhaus landen. Das letzte Mal hab ich in der Schule mit Holz gearbeitet. Und musste mit zehn Stichen genäht werden.« Er hebt einen Daumen, um Cal die Narbe zu zeigen. »Gab außerdem eine Ohrfeige vom Lehrer, weil ich Schulmobiliar vollgeblutet hab.«
»Tja«, sagt Cal. »Wir können nicht alle dieselbe Begabung haben.« Am liebsten würde er Johnny auf Waffen abtasten und ihn fragen, was er vorhat. Es gibt so Typen, die ihm schon verdächtig vorkommen, wenn sie bloß einkaufen gehen. Ein guter Cop muss herausfinden, ob sie tatsächlich gerade dabei sind, irgendein krummes Ding zu drehen oder ob sie das irgendwann später tun werden. Cal ruft sich in Erinnerung, und das musste er lange nicht, dass »krumme Dinger«, aktuelle oder sonstige, nicht mehr sein Problem sind. Rip kann es kaum erwarten, die Lage zu sondieren, und Cal lässt ihm mit einer Handbewegung freie Bahn. Der Hund umkreist Johnny mit einigem Abstand, überlegt, ob er vernichtet werden muss.
»Und jetzt baut Theresa Couchtische«, sagt Johnny, während er Rip eine Hand zum Beschnuppern hinhält. Er schüttelt verwundert den Kopf. »Als ich ein junger Kerl war, hätten die Leute sich darüber kaputtgelacht. Sie hätten gesagt, dass Sie Ihre Zeit damit vertun, einem Mädchen so was beizubringen, dabei sollte es lieber lernen, wie man einen ordentlichen Braten zubereitet.«
»Ach ja?«, fragt Cal höflich nach. Rip, der ein vernunftbegabtes Wesen ist, hat einmal an Johnny geschnuppert und beschlossen, seine Zeit sinnvoller zu nutzen, indem er sein eigenes Hinterteil auf der Suche nach Flöhen abknabbert.
»Ja klar, Mann. Nehmen die Jungs im Pub Sie deswegen nicht ordentlich auf die Schippe?«
»Nicht dass ich wüsste«, sagt Cal. »Die meisten lassen sich bloß gern ihre Möbel reparieren.«
»Die Welt hat sich sehr verändert«, sagt Johnny und wechselt erneut seine Taktik. Cal merkt, was er vorhat: Er will ihn testen, rausfinden, was für ein Mann Cal ist. Cal hat das selbst schon getan, sehr oft. Jetzt hält er es nicht für nötig, weil er auch so jede Menge über Johnny erfährt. »Ist jedenfalls gut für Theresa, dass sie diese Chance bekommt. Für gute Schreiner gibt’s immer Arbeit, damit kommt sie überall auf der Welt zurecht. Haben Sie das auch schon gemacht, bevor Sie hergekommen sind?«
Es ist völlig ausgeschlossen, dass Johnny nicht längst weiß, was Cal früher gemacht hat. »Nee«, sagt Cal. »Ich war bei der Polizei.«
Johnny zieht die Augenbrauen hoch, schwer beeindruckt. »Alle Achtung. Das ist ein Job für harte Kerle.«
»Das ist ein Job, mit dem man die Hypothek abbezahlt.«
»Ist jedenfalls toll, in so einem abgelegenen Dorf einen Polizisten in der Nähe zu haben. Ehrlich, wenn man hier mal die Polizei braucht, wartet man Stunden, bis die Idioten aus der Stadt aufkreuzen – vorausgesetzt, die kriegen überhaupt den Hintern hoch, wenn’s nicht gerade um Mord geht. Ich kannte mal wen – den Namen behalt ich für mich –, der hatte ein bisschen zu viel miesen Selbstgebrannten getrunken und ist total durchgedreht. Hat sich auf dem Nachhauseweg verirrt, ist auf der falschen Farm gelandet, hat jede Menge Zeug zerdeppert und die Hausfrau da angebrüllt, wollte wissen, was sie mit seiner Frau und seinem Sofa gemacht hat.«
Cal spielt seine Rolle und lacht mit. Es fällt ihm leichter, als es sollte. Johnny ist ein guter Geschichtenerzähler, wirkt wie ein Mann mit einem Glas Bier in der Hand und einem Abend in netter Gesellschaft vor sich.
»Schließlich hat er sich unter dem Küchentisch verkrochen. Er hat sie mit einem Salzstreuer bedroht und geschrien, wenn sie oder irgendein anderer Teufel ihm zu nahe käme, würde er sie alle totstreuen. Sie hat sich auf dem Klo eingeschlossen und die Bullen angerufen. Das war morgens um drei. Die hatten erst am Nachmittag die Güte, mal wen rauszuschicken. Bis dahin hatte der Bursche seinen Rausch auf dem Küchenboden ausgeschlafen und flehte die arme Frau an, ihm zu verzeihen.«
»Hat sie?«, fragt Cal.
»Ja klar. Sie kannte ihn ja schließlich, seit sie Kinder waren. Aber den Bullen in der Stadt hat sie nie verziehen. Ich vermute schwer, das Dorf ist überglücklich, dass Sie jetzt hier sind.«
Es ist ebenfalls völlig ausgeschlossen, dass Johnny glaubt, Ardnakelty wäre überglücklich, weil ein Cop hergezogen ist. Wie die meisten Provinznester hat Ardnakelty aus Prinzip etwas gegen Polizisten, selbst wenn gerade niemand etwas macht, was einen Cop aufhorchen lassen würde. Das Dorf duldet Cal, aber nicht wegen, sondern trotz seines früheren Jobs. »Was das betrifft, bin ich für die Leute nicht sehr nützlich«, sagt Cal. »Ich bin im Ruhestand.«
»Ach, kommen Sie«, sagt Johnny mit einem schelmischen Lächeln. »Einmal Polizist, immer Polizist.«
»Hab ich schon mal gehört. Aber ich mache keine Polizeiarbeit, für die ich nicht bezahlt werde. Wollen Sie mich engagieren?«
Johnny lacht ausgiebig darüber. Als Cal diesmal nicht mitlacht, wird er ernst. »Tja«, sagt er, »das beruhigt mich irgendwie. Mir ist lieber, Theresa begeistert sich fürs Schreinern als für die Polizei. Ich will nichts Schlechtes über den Job sagen, ich hab großen Respekt vor allen, die ihn machen, aber er ist riskant – klar, wem sag ich das? Ich würde nicht wollen, dass sie sich in Gefahr bringt.«
Cal weiß, dass er mit Johnny auskommen muss, aber sein guter Vorsatz wird irgendwie von dem Verlangen untergraben, dem Kerl in den Hintern zu treten. Das wird er natürlich nicht tun, aber schon allein die Vorstellung verschafft ihm eine gewisse Genugtuung. Cal ist einen Meter dreiundneunzig groß, und nachdem er die letzten zwei Jahre damit verbracht hat, sein Haus zu renovieren und auf einigen Nachbarfarmen auszuhelfen, ist er besser in Form als mit zwanzig, auch wenn er immer noch einen Bauchansatz hat. Johnny dagegen ist ein schmächtiger kleiner Wicht, der aussieht, als bestünde seine größte Kampfkraft darin, andere Leute zu überreden, sich für ihn zu schlagen. Cal schätzt, wenn er ordentlich Anlauf nimmt und seinen Fuß genau richtig anwinkelt, könnte er den kleinen Scheißer bis ins Tomatenbeet katapultieren.
»Ich passe auf, dass sie sich nicht den Daumen absägt«, sagt er. »Aber garantieren kann ich für nichts.«
»Ja, ja, ich weiß«, sagt Johnny und senkt ein wenig kleinlaut den Kopf. »Ich versuch ja nur, sie zu beschützen, mehr nicht. Wahrscheinlich will ich wiedergutmachen, dass ich so lange weg war. Haben Sie auch Kinder?«
»Eine Tochter«, sagt Cal. »Sie ist erwachsen. Lebt in den Staaten, aber sie kommt mich jedes Jahr Weihnachten besuchen.« Ihm ist nicht wohl dabei, mit dem Mann über Alyssa zu reden, aber er will ihm klarmachen, dass sie nicht den Kontakt zu ihm abgebrochen hat oder so. Der wichtigste Eindruck, den er in diesem Gespräch vermitteln muss, ist der von Harmlosigkeit.
»Ein Besuch hier in der Gegend ist bestimmt ganz schön«, sagt Johnny. »Aber den meisten Leuten ist es ein bisschen zu still, um hier leben zu wollen. Ihnen geht das nicht so?«
»Nee«, sagt Cal. »Mir kann es gar nicht friedlich und still genug sein.«
Ein Ruf schallt über Cals hintere Wiese. Mart Lavin kommt auf sie zugestapft, stützt sich schwer auf seinen Schäferstab. Mart ist klein und drahtig, hat ein paar Zahnlücken und flaumiges graues Haar. Als Cal herkam, war Mart sechzig und ist seitdem um keinen Tag gealtert. Inzwischen vermutet Cal, dass er einer von diesen Typen ist, die mit vierzig aussehen wie sechzig und auch mit achtzig noch aussehen werden wie sechzig. Rip rennt los, um mit Kojak, Marts schwarz-weißem Hütehund, Gerüche auszutauschen.
»Großer Gott«, sagt Johnny. »Ist das Mart Lavin?«
»Sieht so aus«, sagt Cal. In der Anfangszeit schaute Mart jedes Mal, wenn ihm langweilig war, bei Cal vorbei, aber inzwischen kommt er nicht mehr so oft. Cal weiß, was ihn heute herführt, wo er doch eigentlich seine Lämmer entwurmen sollte. Er hat Johnny Reddy gesehen und alles stehen und liegen lassen.
»Hätte mir denken können, dass es den noch immer gibt«, sagt Johnny erfreut. »Den alten Hund könnte nicht mal ein Sherman-Panzer umbringen.« Er winkt, und Mart winkt zurück.