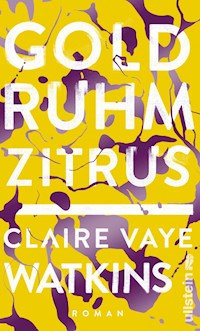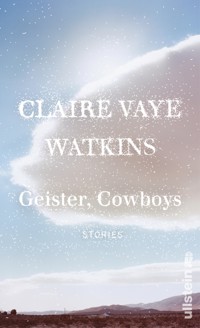
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein alter Mann findet in der Wüste ein junges Mädchen und rettet sie vor dem sicheren Tod, ihre Anwesenheit verändert für eine kurze Zeit sein Einsiedlerleben. Ein Fremder betritt den Mikrokosmos eines Bordells und bringt die fragile Ordnung aus Emotion und Kalkül durch einander. Ein Haus in Nevada wird über Jahrzehnte hinweg Zeuge, wie seine Bewohner lieben und leiden, hoffen und scheitern, sich neu erfinden und gefunden werden. In dieser Erzählung greift die Autorin, Tochter von Charles Mansons rechter Hand Paul Watkins, auch ihre eigene Familiengeschichte auf. In zehn beeindruckenden Stories erzählt Claire Vaye Watkins den Mythos des Wilden Westens neu. Sie handeln von Verlassenden und Zurückgelassenen, Suchenden und Verfolgten, sie spielen vor der gewaltigen Landschaft des Westens, unter dem weiten amerikanischen Himmel, in der Glitzerhölle von Las Vegas und in entlegenen Geisterstädten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel Battleborn bei Riverhead Books, New York.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ISBN 978-3-8437-0306-2
© 2012 by Claire Vaye Watkins © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehalten Satz: LVD GmbH, Berlin
Für meine Eltern
In der Wüste
Sah ich ein Wesen, nackt und wild,
Das, auf der Erde hockend,
Sein Herz in Händen hielt
Und davon aß.
Ich sagte: »Ist das gut, mein Freund?«
»Es ist bitter – bitter«, antwortete es,
»Aber ich mag es,
Weil es bitter ist
Und weil es mein Herz ist.«
Stephen Crane
Geister, Cowboys
An dem Tag, als Mom den Löffel abgab, zog Razor Blade Baby ein. Am Ende kann ich nicht aufhören, über Anfänge nachzudenken.
Die Stadt Reno, Nevada, wurde 1859 gegründet, als Charles Fuller eine Holzbrücke über den Truckee baute und von den Schürfern, die ihr Comstock-Silber über den schmalen, aber reißenden Fluss bringen wollten, Brückenzoll verlangte. Zwei Jahre später verkaufte Fuller die Brücke an den ehrgeizigen Myron Lake. Dieser fügte seinem Silver Queen Hotel and Eating House kurz entschlossen eine Schrotmühle, einen Darrofen und einen Mietstall hinzu, und da er nicht gerade bescheiden war, nannte er den Ort Lake’s Crossing und ließ den Namen in einem Blau, so leuchtend wie der Himmel, auf die Brücke schreiben.
Im Westen des Utah Territory waren die 1860er Jahre eine Zeit des Booms – die Amerikaner hatten noch immer den Geschmack der brackigen Erde rings um Sutter’s Mill auf der Zunge, in ihren Augen glitzerte zehn Jahre altes Gold. Der Fluch der Comstock-Mine war noch nicht aus der Silberader ins Grundwasser eingesickert. Das Silber war noch nicht aus den Bergen gerissen worden, kochendes Wasser war noch nicht in die Stollen geströmt. Henry T. P. Comstock – König der Opportunisten, gieriger Landaneigner, unersättlichster Claimbetrüger aller Zeiten – hatte Adelaide, seine Cousine ersten Grades, die im Lake Tahoe ertrunkene Liebe seines Lebens, noch nicht verloren. Er hatte seinen Anteil an der Mine noch nicht für eine Flasche Whiskey und eine alte blinde Stute verkauft und sich noch nicht in Bozeman, Montana, mit einem geliehenen Revolver das Gehirn rausgeblasen.
Zeiten des Booms.
Lake’s Crossing wuchs. Als Nevada 1864 zum Bundesstaat erklärt wurde, legte man die Bezirke Washoe County und Roop County zusammen. In diesem neuen Bezirk war Lake’s Crossing inzwischen die größte Stadt. Der mit dem ausgegrabenen Silber freigesetzte Fluch hatte durch das schwere Erz an Gewicht gewonnen und legte sich über den jüngsten freien Staat der Nation.
Oder hier:
1881 kam der Architekt Himmel Green aus San Francisco nach Reno, um sich diskret von Mary Ann Cohen Magnin scheiden zu lassen, Inhaberin von I. Magnin & Co., einem Damenoberbekleidungsgeschäft für den gehobenen Geschmack. Himmel gefiel es in Reno. Er beschloss zu bleiben und entwarf Häuser für seine Freunde, neureiche Silberfamilien.
In Renos Viertel Newlands Heights stößt man überall auf Greens Häuser. 1909 wurde das Anwesen Lake Street 315 errichtet, ein solides Backsteingebäude, eines von Himmels ersten Wohnhäusern, mit schlichten Markisen und einer kleinen Veranda nach hinten – ein bescheidener Entwurf und in jeder Hinsicht durch und durch mittelmäßig. Manche sagen, der Bau habe den verfluchten Staub der Comstock-Mine aufgewirbelt. Obwohl dieser Staub alle kontaminierte (und wir Einwohner von Nevada ihn heute noch einatmen), legte er sich, wie es heißt, besonders über Himmel, seine Entwürfe, seine Kleider und bildete eine mikroskopisch dünne Silberschicht auf seiner Haut. Aber ob er nun silbrig glänzte oder nicht – nachdem die Scheidung rechtskräftig war, zog Himmel bei Leopold Karpeles ein, dem Herausgeber des B’nai Brith Messenger. Man sagt, ihre Beziehung sei turbulent gewesen, durchsetzt mit Untreue und Übergriffen. Dennoch blieben sie bis 1932 zusammen, als sie bei einem Brand in Karpeles’ Haus ums Leben kamen – der Rauch, der von dem Feuer aufstieg, wird wohl ähnlich gerochen haben wie die Bergarbeiter, die in den Stollen unter Virginia City bei lebendigem Leib gekocht wurden.
Oder hier. Man könnte ebenso gut hier beginnen:
Im März 1941 überschrieb George Spahn, ein Milchbauer und Amateurimker aus Pennsylvania, seine sechzig Morgen große Farm an seinen Sohn Henry, lud vier Koffer, seine Frau Helen und ihre fünfjährige, ziemlich reizbare gescheckte Katze Bottles in den Wagen und fuhr nach Kalifornien, an den Pazifischen Ozean.
Er wollte sich zur Ruhe setzen, sich von der Landwirtschaft verabschieden und die müden Füße im warmen Sand des Westens vergraben. Aber der Ruhestand gefiel ihm nicht. Nach zwei Monaten trat er in ihre schäbige Mietwohnung am Strand und präsentierte Helen seinen Plan, eine 511 Morgen große Ranch an der Santa Susana Pass Road 1200 in den Santa-Susana-Bergen zu kaufen. Sie wurde von ihrem Besitzer angeboten, dem alternden Stummfilmstar William S. Hart.
Die Santa-Susana-Berge sind trockener als die pittoreskeren Santa-Monica-Berge entlang der kalifornischen Küste. Weil sie nicht von den feuchten Winden profitieren, die vom Meer heranwehen, gibt es dort häufig Buschbrände. Santa Susana Pass Road 1200 liegt nördlich von Los Angeles, tief in den Santa-Susana-Bergen und nicht weit von der Straße, die jetzt Ronald Reagan Freeway heißt. 1941, als George seine Frau überredete, noch einmal umzuziehen, als er ihre knotige Hand nahm und sie bat, die feinen Wurzeln, die sie im losen gelben Sand von Manhattan Beach geschlagen hatte, wieder herauszureißen – Diesmal nur ein paar Kilometer, Schätzchen –, gab es in Chatsworth wenig mehr als eine Baptistenkirche, eine staubige Tankstelle und das Hauptgestüt der Palomino Horse Association of America, Geburtsort von Mister Ed. Jahre später, 1961, legte mein Vater, damals noch ein Junge, ein Buschfeuer in den Hügeln über den Koppeln der PHAA. Er war damals elf, hockte im ausgetrockneten Gebüsch und rauchte eine geklaute Zigarette. Aber wir sollten nicht zu weit vorgreifen.
Das Zentrum der Ranch war eine Filmkulisse, die Hauptstraße eines Wildweststädtchens: Bank, Saloon, Schmiede, Bretterweg, Seitenstraßen und Gassen, ein Gefängnis. Vielleicht ließ Helen sich davon blenden. Vielleicht erinnerte sie – eine Frau, die schon in mittleren Jahren mit Arthritis zu kämpfen hatte – sich an die beißende Kälte der Winter in Pennsylvania. Vielleicht war sie, wie ihre Kinder behaupten, ihrem Mann gegenüber zu nachgiebig. Jedenfalls legte sie ihm die Hand auf die Stirn und sagte: »Na gut, George.« Und obwohl Einigkeit darüber herrscht, dass es Helen im Lauf der Zeit dort gefiel, schrieb sie an dem Tag, an dem George ihr die Ranch zum ersten Mal zeigte, in ihr Tagebuch:
Der Besitz ist sehr groß und von Bergen umschlossen. G. aufgekratzt wie ein kleiner Junge. Die Aussicht ist aber nicht so schön wie am Strand. Die Zufahrtsstraße ist schmal und kurvig, zu beiden Seiten steile Felswände. Wie es aussieht, muss ich mich wieder vom Meer trennen. Was für eine kurze Liebesgeschichte! Ich sah nach Westen und spürte einen Schmerz, als hätte man mir etwas genommen, etwas, das ein Teil von mir war, mir aber nie ganz gehört hat.
In der ersten Woche nach ihrem Umzug in die Santa Susana Pass Road 1200 lief Bottles weg.
George war anpassungsfähiger als Bottles und hatte mehr Glück. 1941 waren Western noch Hollywoods Hauptgeschäft. George betrieb seine Filmranch, wie er seine Milchfarm betrieben hatte: Er baute gute Verbindungen zu Entscheidungsträgern auf und unterbot die Konkurrenz. Es schadete auch gewiss nicht, dass der Trankas Canyon mit seinen zahlreichen Filmkulissen dem offiziellen Naherholungsgebiet von Malibu zugeschlagen wurde, so dass Spahns Ranch im Umkreis von hundert Kilometern der einzige Filmset war, der sich in Privatbesitz befand und wo man daher keinerlei behördliche Drehgenehmigung brauchte. Die Spahns hatten beständige Einnahmen von den größeren Studios, denen sie für Pferde und Kulissen hübsche Sümmchen in Rechnung stellten. Hier entstanden unter anderem 12 Uhr mittags, Die Comstock Boys und David O. Selznicks Klassiker Duell in der Sonne mit Gregory Peck in der Hauptrolle. Auch Fernsehfilme wurden auf der Ranch gedreht, darunter die meisten Folgen von The Lone Ranger und Bonanza – jedenfalls bis Warner Brothers, verlockt durch die steuerlichen Anreize des Bundesstaats Nevada und die Vorlieben ihrer berühmten Regisseure, die Produktion zur Ponderosa Ranch am Lake Tahoe verlegte.
Wir könnten auch bei der frühesten Erinnerung meiner Mutter beginnen:
Es ist 1960, sie ist drei. Sie sitzt auf dem Schoß ihres Stiefvaters auf einem Plastikliegestuhl auf dem Dach ihres Trailers. Ihr Bruder und ihre Schwester, beide älter als sie, sitzen im Schneidersitz auf einem Badetuch, das sie auf dem schäbigen beschichteten Sperrholzdach ausgebreitet haben, der grobe Stoff prägt sich in ihre Haut ein. Jeder hat eine der übergroßen Jackie-O.-Sonnenbrillen ihrer Mutter – meiner Großmutter – aufgesetzt. Der Abend senkt sich herab, am östlichen Himmel kommen die Sterne zum Vorschein – ja, damals konnte man über Las Vegas noch Sterne sehen –, doch die Familie sieht nach Nordwesten, genau wie ihre Nachbarn und die Jungen, die den Rasen auf dem neuen Golfplatz mähen und wässern, wie die Linienbusfahrer, die am Straßenrand angehalten haben, und die Touristen, die in ihren Hotelzimmern stehen und die Gesichter an die Fensterscheiben drücken. Wie die ganze Stadt.
Ihr Stiefvater zeigt in Richtung Wüste. »Da«, sagt er. Ein Lichtblitz von jenseits des Beckens. Eine orangerote, pilzförmige, wallende und wabernde Wolke erhebt sich. Wie bei einem Feuerwerk hört meine Mutter erst Sekunden später den Donner, und der Trailer beginnt zu schwanken. Es erscheint unmöglich, und doch spürt sie die Wärme auf ihrem Gesicht. »Da kommt man ins Nachdenken, was?«, sagt ihr Stiefvater ihr leise ins Ohr. »Vielleicht gibt’s da draußen doch was Göttliches.«
Die Explosion stammt von einer 104-Kilotonnen-Atombombe. Sie sprengt ein Loch in den Felsboden der Wüste und reißt den gewaltigsten der 1021 Bombenkrater auf dem Atomtestgelände von Nevada: hundert Meter tief. Aus dem Loch, einem in die Erde dieses Bundesstaates hinabweisenden Finger, werden siebenhundert Tonnen Gestein und Erde, darunter zwei Tonnen Sedimente aus einer von H. T. P. Comstocks verfluchten Silberadern, in den Himmel geschleudert. Die Julibrise ist sanft und unentschlossen. Sie weht wie immer nach Nordosten und treibt die radioaktive Wolke zukünftigen Krebshäufungen in Fallon und Cedar City und den mitosierenden Zellen anderer in Windrichtung gelegener Kleinstädte entgegen. Doch an diesem Abend weht sie den Fluch auch nach Südosten, nach Las Vegas, zur Kinderbrust meiner Mutter, zu ihrer Lunge, ihrem Herzen. Und sie weht ihn auch nach Südwesten, über die Staatsgrenze, bis zu den trockenen gelben Bergen über Los Angeles. Und dort sinken die Partikel schließlich auf die Ranch an der Santa Susana Pass Road 1200 herab.
Wir könnten mit Georges längstem Jahr beginnen:
Fast zwanzig Jahre lang waren die Briefe, die George an seinen Sohn Henry in Pennsylvania schrieb, in seinem typischen trockenen Ton gehalten: Er fragte nach dem Zuwachs der Herde und gab Tipps für den Umgang mit den Bienenschwärmen bei der Honigernte; die eigene Ranch – die seinem Sohn wohl kaum wie eine Ranch erschienen wäre – erwähnte er kaum.
Doch Anfang der 60er Jahre waren Western immer weniger gefragt, und schuld daran war laut George Spahn unter anderem Alfred Hitchcock. Immer öfter endeten seine Notizen und Ratschläge zur Landwirtschaft mit erbosten Tiraden gegen »Bauchaufschlitzerfilme« und die Fixierung des »sexbesessenen« Publikums auf Horrorstreifen, womit er wahrscheinlich Hitchcocks Psycho meinte, den nach Dschungel der 1000 Gefahren zweiterfolgreichsten Film des Jahres 1960. Am 1. Februar 1966 meldete George Spahn Konkurs an. Zu diesem Zeitpunkt waren die Nieren seiner Frau – was er nicht wusste – bereits von Krebs überwuchert. Sechs Wochen später starb Helen im UCLA Medical Center an Nierenversagen, auf derselben Etage, auf der vierunddreißig Jahre später mein Vater sterben sollte. Der Leichenbeschauer notierte, die Tumore seien sichtbar und sähen im grellen Licht des Mikroskops aus wie »Hunderte haarfeiner silbriger Fäden«.
Nach Helens Tod vernachlässigte George seine wenigen, ohnehin schon spärlicher gewordenen Verbindungen zu den großen Studios. Er schrieb Henry oft, dass die Ranch herunterkomme und in den Koppeln Unkraut wachse.
»Ich bin müde«, schrieb er am 23. Juli 1966. »Ich hab fast alle [drei Teilzeitgehilfen] entlassen. Es ist heiß, so heiß, dass ich bis Sonnenuntergang warten muss, um die Pferde zu füttern. Sie werden ungeduldig in den Ställen und treten gegen die leeren Tröge. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie laut das ist, wenn ihre Hufe gegen das Metall schlagen …«
Letztlich waren es – durstig oder nicht – die Pferde, die Spahns Ranch über Wasser hielten. Er vermietete Pferde an Touristen, die auf eigene Faust über die Hügel reiten wollten. Hin und wieder erinnerten sich seine alten Freunde in den Studios an ihn und mieteten sechs oder acht Pferde für eine Szene, wo eigentlich nicht mehr als zwei gebraucht wurden. Und so wurden die Tiere zur Hauptquelle von Georges Einnahmen, so mager die auch sein mochten. Aus den Steuerunterlagen von Los Angeles County geht hervor, dass Spahns jährliches Einkommen 1967 bloß 13 120 Dollar betrug, weniger als ein Viertel dessen, was er 1956 eingenommen hatte.
Zuvor hatte George seine Frau nur selten erwähnt, und wenn, dann nur am Rande und im Zusammenhang mit dem Alltag auf der Ranch: »Es zieht ein Gewitter auf. Früher wären die Knöchel Deiner Mutter angeschwollen. Weiß der Himmel, wir könnten Regen gebrauchen.«
In jenem Jahr fuhr George fort, Briefe zu schreiben, obwohl sein Sehvermögen nachließ und die Zeilen sich manchmal überlagerten. Er schrieb jetzt häufiger von Helen, manchmal eine ganze Seite über ihren Blaubeerkuchen oder den Duft ihres Puders. Es sind die einzigen Briefe, in denen George, sonst auf Umsicht und Korrektheit bedacht, ins Präsens gleitet.
Im September berichtete George, er habe in den Hügeln oberhalb seines Hauses einen winzigen gebleichten Schädel gefunden. »Bottles. Sauber abgenagt von Kojoten.«
Oder hier. Wir könnten hier beginnen:
Als im Januar 1968 etwa zehn junge Leute auf der Ranch auftauchten, die von San Francisco dorthin getrampt waren – die meisten waren Teenager, einer von ihnen war mein Vater –, war George beinahe blind. Aber gewiss roch er sie, als sie sich seiner Veranda näherten: Schweiß, Benzin, der zähe, würzig-süßliche Geruch von Marihuana. Sie boten George an, ihm bei der täglichen Arbeit zu helfen, wenn sie dafür in den leerstehenden Gebäuden der Westernkulisse wohnen dürften. Obwohl er ein paar Wochen zuvor einen kleinen Unfall gehabt und einen Gehilfen angestellt hatte – einen netten Jungen, der sich vielleicht ein bisschen zu machohaft gab, »Shorty« hieß und natürlich Schauspieler werden wollte –, war George einverstanden, vielleicht weil er ihnen nichts zu bezahlen brauchte. Vielleicht aber auch, weil der Anführer der Gruppe, ein Mann namens Charlie, ihm sagte, ein oder zwei der jungen Frauen würden rund um die Uhr für ihn da sein, für ihn kochen, das Haus in Ordnung halten, seine Wäsche waschen und ihn zu Bett bringen, wann immer er wolle.
Mein Vater hat niemanden umgebracht. Und er ist kein Held. Es ist nicht diese Art von Geschichte.
Später, als alles vorbei war, hat praktisch jeder, der in jenem Sommer auf Spahns Ranch war, ein Buch darüber geschrieben – das von Bugliosi war nur das erfolgreichste. Aus den Büchern derer, die dieses Ereignis bemerkt haben, wissen wir, dass auf Spahns Ranch ein Kind geboren wurde, vermutlich am 9. April, auch wenn die Berichte in diesem Punkt nicht übereinstimmen. Olivia Hall, damals in der Abschlussklasse der Pacific Palisades High School und gelegentliche Teilnehmerin an Gruppensexorgien auf der Ranch, schrieb über die Geburt: »Die Mutter lag auf dem Boden des Gefängnisses fast vierzehn Stunden in den Wehen, die ganze Nacht hindurch bis in den frühen Morgen – und schließlich gab sie auf.« In The Manson Murders: One Woman’s Escape schreibt Carla Shapiro, inzwischen Mutter von vier Jungen: »Die junge Frau ließ den Kopf auf den Schlafsack sinken und wollte nicht mehr pressen. Das war der Augenblick, in dem Manson eingriff.« Im Buch meines Vaters steht: »Charlie hielt ein Feuerzeug an eine Rasierklinge, bis sie heiß war, und schlitzte die Frau von der Scheide bis zum After auf.« Das Kind, ein Mädchen, glitt heraus und schrie in Charlies Armen. Mein Vater: »Es war eine Riesensauerei, überall Blut und Kleidungsstücke. Ich weiß nicht, wo er die Rasierklinge gefunden hatte.«
Charlie duldete keine Paare. Die Gruppe veranstaltete jede Nacht Orgien auf der Ranch, so wie zuvor in Topanga,SantaBarbara, Big Sur, Santa Cruz, Monterey, Oakland, San Francisco – die Liste ließe sich fortsetzen. All das weiß man ja. Die Drogen, der Sex. Leute kamen und gingen. Die Feststellung des Vaters wäre unmöglich gewesen, selbst wenn die Gruppe sich für derlei interessiert hätte. »Es wurde ein Kind geboren, das weiß ich noch«, schrieb Tex Watson mir aus dem Gefängnis. »Hätte glatt meins sein können. Wer weiß das schon? Wir waren ja alle ziemlich neben der Spur.«
Über die Mutter erfährt man nur, sie sei sehr jung gewesen. Keinen Namen, keine Erklärung, wie sie überhaupt auf die Ranch gekommen war. Einmal wird ihr Gesicht als »wie betaut« beschrieben. In seinem Buch gibt mein Vater zu, mehrmals mit ihr geschlafen zu haben. »Sie war ein nettes Mädchen«, schreibt er.
Am 16. August fand auf Spahns Ranch eine Polizeirazzia statt, und das Jugendamt brachte das Kind bei Pflegeeltern unter: Al und Vaye Orlando, Inhaber von Orlando’s Furniture House in Thousand Oaks. Vaye machte sich ständig Sorgen um das Mädchen: Es war so ruhig, es hatte, was sie »diese Leere im Gesicht« nannte. In den ersten fünf Lebensjahren ließ Vaye das Kind siebenmal auf Anzeichen von Autismus untersuchen und misstraute jedes Mal den Ergebnissen. Sie stellte sogar eine Kinderschwester an, die mit der Kleinen spielen und ihre kognitive Entwicklung unterstützen sollte. Al fand, das sei rausgeschmissenes Geld.
Jetzt ist das kleine Mädchen eine erwachsene Frau von vierzig. Sie ist schlank, aber nicht zierlich, und bewegt sich wie etwas Flüssiges. Sie hat dunkles Haar und die kleinen braunen Augen einer Hirschmaus. Es sind nicht die jener Mädchen, die mein Vater in Pacific Palisades aufriss, die er auf Spahns Ranch einlud und Charlie vorstellte, die sich später Kreuze in die Stirnen ritzten, einander unterhakten und singend durch Gerichtsflure spazierten, wobei sie in die Kameras lächelten. Ich habe mir die Archivfilme angesehen. Es sind die braunen Augen meines Vaters. Meine.
Vor zehn Jahren war die Lake Street – der letzte verbliebene Hinweis auf den armen Myron Lake sowie Standort von Renos wahrzeichenhaftem Torbogen (Sie wissen schon: Die größte Kleinstadt der Welt) – von Slums gesäumt: heruntergekommene, baufällige Villen mit angeschraubten Feuertreppen, die Fenster mit Bettlaken verhängt, die meisten billige Absteigen. Doch dann benannte man das Viertel, durch das die Lake Street führte, in Newlands Heights um. Zeitungskommentatoren erörterten die Frage einer Sanierung. 2001 wurde das Anwesen Lake Street 315 als eines der letzten von dem herrschaftlichen Haus, als das Himmel Green es konzipiert hatte, zu sechs Ein- und Zweizimmerwohnungen umgebaut. Newlands Heights (selbstverständlich nach Francis G. Newlands benannt, dem nevadischen Senator, dem klugen Annektierer Hawaiis, dem Bewässerer des amerikanischen Westens, dem großen Zivilisierer der Wilden) war nun gesäumt von Comstock-Boom-Villen im kolonialen oder viktorianischen Stil, deren geräumige Salons und Wintergärten sich in Studioapartments und Eigentumswohnungen mit Parkettboden verwandelt hatten. Sogar der Torbogen wurde abgerissen, mit der Begründung, er sei nur ein Treffpunkt von Teenagern und Vagabunden. Damals, als solche Dinge mir noch wichtig waren, versicherte man mir, die Stadt wolle über der Virginia Street, näher an den großen Casinos, einen mit Neonröhren bestückten Nachbau des Torbogens errichten.
Heute ist ein Haus in Newlands Heights ganz schön was wert, heißt es, und obwohl ich mich sonst immer über Gentrifizierung aufrege, ist mir das egal. Unter Armen fühlt man sich genauso schuldig wie unter Reichen, aber auf die Reichen kann man wenigstens wütend sein. Ich kann es mir nur leisten, in dem Haus Lake Street 315 zu wohnen, weil die Vermieter Ben und Gloria (nette Leute, bürgerlich gewordene Kiffer, Vorbilder für uns alle) meinen Freund J – meinen Exfreund J – für den Innenausbau angeheuert haben. Wie mit vielen seiner Kunden rauchte J mit Ben eine ganze Menge Gras. J ist der Meinung, Marihuana sei der universelle Botschafter des guten Willens und er selbst nur sein bescheidener Diener. Gloria war schwanger, und Ben war ziemlich verzweifelt und steckte Geld in ein Haus ohne Mieter. Eines Nachmittags saßen J und Ben auf einer Palette mit Badezimmerkacheln und ließen einen Joint hin und her gehen, und J überredete Ben, mir einen Sonderpreis für die einzige bereits fertige Wohnung zu machen, ein Studio im Erdgeschoss, Nummer 2. Es war wahrscheinlich der letzte Gefallen, den ich mir von ihm erweisen ließ, bevor er ging.
Ich ertrug neun Monate Baulärm und Lackdünste, der Rest des Hauses war ein leeres Gerippe. Einmal hörte ich jemanden in der Wohnung über mir arbeiten und ging hinauf, um nachzusehen, wer es war. Ich dachte, wenn es Ben sei, könnte ich ihm den Scheck für die Miete geben und ihn fragen, ob er mir ein bisschen Gras verkaufen oder einfach schenken würde. Doch es war Gloria, die in einem zart hellblau gestrichenen Zimmer stand, Farbflecken auf Händen und Overall, Farbspritzer im blonden Haar. Die Plastikfolien vor den offenen Fenstern bauschten sich in der Brise. Sie legte die Hände auf ihren kugelrunden Bauch und drehte sich zu mir um. Ich sah, dass das Zimmer nicht ganz zu Ende gestrichen war. Vor ihr war ein schmutzig beiges Stück Wand, so groß wie eine Spielkarte.
»Das hab ich entdeckt, als ich die Tapete abgerissen habe«, sagte sie. Trauer oder Farbdämpfe oder beides hatten ihr Tränen in die Augen getrieben. In der Rechten hielt sie einen Pinsel. »Seit einer Woche male ich um diese Stelle herum.« Ich beugte mich vor und las, was jemand mit Holzkohle oder einem dicken Zimmermannsbleistift dorthin geschrieben hatte:
H. liebt Leo, 1909
»Wie kann ich so was nur tun?«, sagte Gloria. Und während sie es noch einmal sagte, strich sie mit dem Pinsel hellblaue Farbe über die Stelle.
Das war kurz bevor meine Mom starb. Bevor Razor Blade Baby einzog. Damals wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Jetzt weiß ich es. Ich sehe Gloria im Garten und würde ihr gern eine Antwort geben. Sie hat ihr Kind gekriegt. Sie stellt den Laufstall unter der Weide auf und singt, während sie im Garten arbeitet, ihrer Tochter etwas vor. Sie hat sie Marigold genannt. Ich würde ihr gern sagen: Du tust es, weil du musst. Wie alle.
Und da sind wir nun.
An dem Tag, als Mom den Löffel abgab, zog Razor Blade Baby ein. Oben. In Nummer 4. Genau über mir. Wir sind Nachbarinnen in der Lake Street 315, Newlands Heights, Reno, Nevada. An jenem ersten Tag hörte ich die Dielenbretter über meinem Kopf quietschen, dann Schritte auf der Treppe. Als ich die Wohnungstür öffnete, lud Razor Blade Baby mich zu einer Drei-Dollar-Matinee im alten Hilton Theater ein. Obwohl ich das Popcorn (zäh und leuchtend gelb, so salzig, dass einem die viele Spucke einen Graben in die Gaumenplatte macht) und die Hotdogs (aus reinem Rindfleisch) mag, sagte ich, was ich dann jeden Sonntag sagte: Nein, nein, danke. Ich schloss die Tür, und sie setzte sich, wie sie es dann jeden Sonntag tat, auf die Treppe. Sie blieb den ganzen Tag dort sitzen.
Mein Vater Paul Watkins lernte Charles Manson elf Monate vor Razor Blade Babys Geburt bei einer Party in San Francisco kennen. Er und Charlie schrieben zusammen Songs und kampierten an der Bay, bis sie nach L. A. aufbrachen, weil San Francisco sie langweilte und sie den Regen satthatten. Paul war achtzehn und sah gut aus. Jedenfalls erzählte mir das später meine Mutter.
Auf Spahns Ranch zog Paul in das alte Gefängnis: Schlafsack, Kerzen, seine Gitarre, seine Flöten. Für sein Alter sah er jung aus, jung genug, um sich an der Pacific Palisades High School anzumelden, obwohl er seinen High-School-Abschluss schon im Frühjahr zuvor gemacht hatte, ein Jahr früher als üblich. In Interviews wies er gern auf diese Tatsache hin. (In der Sendung Larry King Live am 23. August 1987 zum Beispiel sagte er zu Maureen Reagan: »Wir waren intelligent, Maureen, keine Kleinkriminellen. Ich war Klassensprecher.« Larry war an dem Tag krank.) Paul ging zwei Monate auf die Pacific Palisade, Heimat der Delphine, um Mädchen kennenzulernen und sie zur Ranch zu bringen. Darin war er gut.
Jahre später, lange nachdem er schließlich dem Hodgkin-Lymphom erlegen war, sagte meine Mutter nach einem ihrer Versuche, zu ihm zu gehen, wo immer er auch sein mochte, er sei »Charlies bester Abschlepper« gewesen. Ich wusste nicht, ob sie stolz auf ihn war oder sich für ihn schämte.
In ihrem Bett im University Medical Center, die mit einem Steakmesser bearbeiteten Unterarme dick verbunden, sagte sie auch: »Wer da ist, wenn man geht – das ist das Einzige, was zählt. Glaub mir. Ich bin oft genug dicht genug dran gewesen, um es zu wissen.«
Ungefähr einmal im Jahr spürt mich jemand auf. Manchmal ist es einer von Charlies Fans, der mal neben der Tochter von Paul Watkins stehen, die letzten Reste aufsaugen und ein Foto auf seine Website – roter Text auf schwarzem Grund – stellen will. Weit häufiger aber sind es Leute mit Drehbüchern. Produzenten, meist echte. Ich gebe sie bei Google ein: Wahre Lügen, Die durch die Hölle gehen. Sie bieten mir an, vom Lake Tahoe herzukommen und mich zum Abendessen einzuladen. Sie wollen nicht meine Erlaubnis, den Film zu drehen, sie wollen nicht wissen, wer mich spielen sollte (Winona Ryder), sie wollen nur sehen, wie ich so bin.
»Wie sind Sie so?«, fragen sie.
»Ich bin Empfangsdame«, sage ich.
»Gut«, sagen sie langsam und gedehnt und nicken, als hätte die Tatsache, dass ich Empfangsdame bin, ihnen alles gegeben, was sie sich von dieser Fahrt erhofft haben.
Am Tag nachdem Razor Blade Baby eingezogen war, fuhr ich mit dem Fahrrad über die Truckeebrücke zur Arbeit. Razor Blade Baby folgte mir. Sie trug einen Blazer und fuhr auf einem violetten Cruiserfahrrad mit Korb, ihr langes Haar bauschte sich im Fahrtwind, als würden hundert winzige Drachen daran zupfen. Sie folgte mir die Stufen zum Gericht hinauf und setzte sich gegenüber von meinem Tisch auf eine Bank in der Eingangshalle. Dort blieb sie bis zur Mittagspause. Wir schlenderten zu einer Bank am Fluss, ich aß einen Burrito, den ich an einem Stand gekauft hatte, und sie dippte Selleriestangen in eine Tupperwaredose voll Thunfischsalat, der nicht mit Mayonnaise, sondern mit Joghurt gemacht war. Nach der Mittagspause ging ich wieder an meinen Tisch, und sie setzte sich wieder mir gegenüber auf die Bank. Um fünf fuhren wir nach Hause.
An manchen Tagen bringt sie eine Rolle Vierteldollarmünzen mit und füttert die Parkuhren vor dem Gebäude. An anderen geht sie auf die andere Straßenseite und stöbert in den Souvenirgeschäften. Ich sehe durch das Fenster im Gerichtsgebäude und das Schaufenster des Geschäfts, wie ihre Hände sich über die ringförmigen Ständer voller T-Shirts bewegen. Wenn es sehr heiß ist, sitzt sie einfach auf der Marmortreppe vor dem Gerichtsgebäude, trinkt einen Kirschshake und drückt die Hand auf den warmen Stein.
Am Wochenende gehe ich manchmal aus, und dann kommt Razor Blade Baby mit. Eines Abends, etwa drei Monate nachdem sie eingezogen war, ging ich zu einer Dinnerparty anlässlich der Einweihung der Wohnung, die sich ein Freund gekauft hatte, hoch oben im entkernten und umgestalteten ehemaligen Flamingo Casino. Auf der Fassade des Gebäudes prangten noch immer in einer Reihe die Silhouetten schlanker einbeiniger Vögel.
Es war eine schöne Party, das Essen war gut. Ich trug ein gebauschtes smaragdgrünes Cocktailkleid, rosarote flache Schuhe und eine rosarote Schleife im Haar. Meine Freunde taten ihr Bestes, so zu tun, als wäre alles normal, nickten manchmal in Razor Blade Babys Richtung und fragten: »Claire, Schätzchen, ist das deine Tante, die du da mitgebracht hast? Ihr seht euch total ähnlich.«
»Nein, nein«, sagte ich dann und schluckte Prosciutto oder Lachs oder was immer es war hinunter. »Das ist Razor Blade Baby. Sie begleitet mich überallhin.«
An jenem Abend gingen Razor Blade Baby und ich zu Fuß zurück zur Lake Street 315. Zwei Tage lang hatte es in der Sierra ununterbrochen geregnet, und der Truckee toste – ich hatte ihn noch nie so wild gesehen. Das Wasser war milchig und trüb und riss große Baumstämme mit, die vermutlich jahrelang im trockenen Flussbett gelegen hatten. Am anderen Ende der Brücke standen zwei Betonstümpfe, aus denen Stahlarmierungen ragten, wie Wachtposten zu beiden Seiten der Straße – das war alles, was von dem Torbogen noch übrig war. Wir standen lange da, Razor Blade Baby und ich, irgendwie hypnotisiert von dem Wasser, das vorbeirauschte. Wir wussten nicht, ob wir die Brücke gefahrlos überqueren konnten und was wir tun würden, wenn wir sie überquert hätten. Ich stellte mir vor, wie ich, die Taschen mit Silber beschwert, mit ganz kleinen Schritten die nasse, schlüpfrige Böschung hinunterging und in den Fluss watete.
Zu Hause rauchte ich einen Joint und überlegte – wie ich es oft tue, nachdem ich mit den Fingerspitzen über das Milchglas der Küchenschränke, über die aus Hirnholz zusammengefügte Arbeitsplatte, die seine Hände geschliffen und lackiert haben, gestrichen habe, über alles, was von ihm noch da ist, in meinem Leben jedenfalls –, ob ich J anrufen sollte. Aber ich war ebenso wenig imstande, ihm zu geben, was er brauchte, wie an dem Tag, als er gegangen war.
Ich rief ihn nicht an. Stattdessen rauchte ich mich immer tiefer ins Vergessen, sah den Rauchschwaden unter der Zimmerdecke zwischen mir und Razor Blade Baby nach und schlief ein.
Ich glaube, in einen dieser Produzenten verliebte ich mich. Er schrieb mir eine E-Mail: Sein Name sei Andrew, er wolle mich zum Abendessen einladen und mit mir über einen Film sprechen, einen Film über meinen Vater und darüber, dass er Charlies rechte Hand gewesen sei (richtig), dass er in einem verlassenen Schuppen in der Wüste gelebt habe (richtig), dass er mit den Drogen aufgehört und gegen Charlie ausgesagt habe, dann aber rückfällig geworden sei, das Bewusstsein verloren habe und in einem brennenden VW-Bus aufgewacht sei (hauptsächlich richtig). Ich war, wie beinahe immer und aus Prinzip, bereit, mich von ihm einladen zu lassen.
Wir verabredeten uns in Louis’ Basque Corner in der Fourth Street. Razor Blade Baby begleitete mich. Ich gehe mit allen Filmfritzen zu Louis’, oder vielmehr: Ich ging mit ihnen dorthin, bis ich Andrew kennenlernte. Jetzt treffe ich mich mit ihnen bei Miguel’s, in einer Seitenstraße der Mt. Rose Street – das ist auch sehr gut.
»Können Sie etwas empfehlen?«, fragte er. Er hatte ein ungezwungenes, entspanntes Lächeln.
»Picon Punch«, sagte ich. »Wenn Sie hier keinen Picon Punch getrunken haben, waren Sie nicht wirklich hier.« Das war mein Spruch. Mein Picon-Punch-Spruch.
Picon Punch ist so tiefbraun wie Lederöl. Nur die Basken wissen, woraus er gemacht ist, aber jeder von uns hat eine Theorie: Rum, Süßholzextrakt und Gin; teurer Rye-Whiskey, Club Soda und ein paar Tropfen Vanilleextrakt; viel Wodka, Gin und ein Spritzer Apfelsaft; Seagram’s, Scotch und gemahlene Ricola-Bonbons. Alle Theorien sind gleichermaßen plausibel, aber keine davon stimmt. Wenn man einen Picon Punch getrunken hat, will man noch einen. Zwei sind schon zu viel. In jener Nacht trank jeder von uns drei.
Zum Abendessen bestellten wir Lammbries und zwei Winnemucca-Coffee. Wir aßen an der Bar und spielten dabei Videopoker. Razor Blade Baby hielt sich im Hintergrund und spielte Ms. Pac Man.
Wir unterhielten uns leise, vertraulich. Hin und wieder kam Razor Blade Baby angeschlendert und stellte sich neben mich. Ich tat mein Bestes, sie wegzuscheuchen. Ich gab ihr noch eine Rolle Vierteldollarmünzen und ertappte mich dabei, dass ich mich an Andrew lehnte. Er roch scharf und prickelnd nach Zimt, wie ein Raucher, der sich große Mühe gibt, es zu verbergen.
Ein Casino kann einen Durchschnittsmann toll aussehen lassen. Das Licht ist gedämpft, die Decken sind niedrig und verspiegelt. Die Automaten beleuchten sein Gesicht von unten und mit einem weichen bläulichen Schimmer. Wenn die Karten auf dem Bildschirm umgedreht werden, spiegeln sie sich als kurze Lichtblitze in seinen Augen. Der dichte Vorhang aus Zigarettenrauch macht alles etwas unscharf, als würde das, was man da tut, gar nicht geschehen. Als wäre es bereits Vergangenheit. Als wäre das Leben nicht das Leben, sondern ein alter nostalgischer Film. Duell in der Sonne vielleicht. Was ein Casino mit einem Mann anstellt, der ohnehin schon toll aussieht, wollen Sie lieber nicht wissen.
Es dauerte nicht lange, und wir wandten uns einander zu. Mein rechtes Bein, das vom Barhocker baumelte, fand seinen Weg zwischen die seinen und schob sich in seinen Schritt. Wir aßen das Lammbries mit den Fingern und tauchten die kleinen, festen Drüsenstückchen in Zwiebelsauce.
Er fragte mich nach meinem Vater. Ich wollte ihm erzählen, was ich Ihnen erzählt habe, aber das ist nichts, was er nicht auch aus einem Buch, einer Zeitung, einem Tagebuch, dem Bericht eines Leichenbeschauers hätte erfahren können. Und es gibt noch immer so vieles, das ich nie wissen werde, ganz gleich, wie viel Geschichte ich auf mich lade. Ich kann Ihnen sagen, welche Form der Fleck hatte, den H. P. Comstocks Gehirnmasse auf der Bretterwand seiner Hütte hinterließ, aber ich weiß nicht, ob er den sauren Geschmack des Fluchs auf der Zunge spürte, bevor er den Abzug drückte. Ich kenne Himmel Greens nach links geneigte Linkshänderhandschrift, aber ich weiß nicht, ob Leo seine Liebe erwiderte. Ich kann den silbrigen Schimmer von Helen Spahns Tumoren schildern, aber ich weiß nicht, ob sie sie in sich wachsen spürte. Ich kann Ihnen die Aussicht von George Spahns Vorderveranda auf das weite gelbe Tal beschreiben, aber ich weiß nicht, was er sah, nachdem er blind geworden war. Ich kann Ihnen verraten, was mein Vater sagte, um die Mädchen auf Spahns Farm zu locken, aber ich weiß nicht, ob sie ihm glaubten. Ich kann die Schnitte in den Handgelenken meiner Mutter beziffern, ich kann ihre Länge und Tiefe beschreiben und die Farbe des Narbengewebes, aber ich hätte nicht sagen können, ob oder wann sie es wieder tun würde. Es gibt nichts, was ich über die Bedeutung des Verlustes, des Mangels, des unzureichenden Gewichts der Vergangenheit sagen könnte, das Sie nicht schon wissen.
Aber der Whiskey in unserem Kaffee tat seine Wirkung. Ich fühlte mich entspannt. Also sagte ich ihm, was ich sagen konnte. Ich erzählte von dem schweren Duft, der drei- oder viermal im Jahr nach einem Regen vom Wüstenboden aufsteigt. Dass es dann so riecht, als würde jede dankbare Wüstenpflanze, jedes Stück nackte Erde, jedes noch nicht entdeckte Körnchen Silber atmen. Dass dieser Duft einen wei- cher macht, verletzlicher. Dass er einen erlösen kann.
Nach dem Essen sahen wir Razor Blade Baby zu, bis sie ihr letztes Leben verloren hatte. Andrew begleitete uns zu unseren Rädern und half uns beim Aufschließen. Dann küsste er mich, oder vielmehr: Wir küssten uns, direkt unter den Augen von Razor Blade Baby. Es war ein unvermeidlicher Kuss. Ein Kuss, als hätte sich mein Rocksaum beim Aufsteigen am Sattel des Fahrrads verfangen, so dass ich das Gleichgewicht verlor. Ein Kuss, als wären wir ineinander hineingefallen – und so war es wohl auch.
Danach fuhren Razor Blade Baby und ich nach Hause in die Lake Street 315. Scheinwerfer beleuchteten uns von hinten. Als ich die Haustür hinter mir schloss, läutete mein Handy.
»Komm raus.« Es war Andrew, ich hörte seinen Atem, seine Stimme klang angenehm verwaschen.
»Was?«
Die Türklingel ertönte. Ich zog den Vorhang am Wohnzimmerfenster beiseite und sah ihn, das leuchtende Handy ans Ohr gedrückt, leicht schwankend auf der Veranda stehen.
»Oder komm und lebe mit mir«, sagte er.
»Du bist betrunken«, sagte ich.
»Du auch. Lass mich rein. Wir ziehen nach L. A., ans Meer. Du kannst mit deinem Fahrrad die Küste rauf- und runterfahren. Oder vergiss L. A., wir können hier leben, in den Bergen, in der Wüste. Was immer das hier ist. Das, was du mir über den Regen erzählt hast. Du und ich, Claire. Lass mich doch rein.«
Und ich wollte ihn reinlassen. Es war nicht so, dass ich nicht wollte. Ich schwankte, ich stützte mich mit dem Arm an der Wand ab und versuchte, das Wirbeln des Picon in meinem Kopf und meiner Brust zu stoppen. Versuchte, nicht an die Worte unter der Farbe zu denken. Wer da ist, wenn man geht – das ist das Einzige, was zählt. Glaub mir. Ich legte die Stirn an die Tür und wollte sie so gern öffnen. Aber die Geschichte war übermächtig, ganz gleich, wo ich begann: bei dem geliehenen Revolver auf dem Boden einer Hütte, nicht weit von Bozeman, Montana; bei dem leisen Zischen von Himmel Greens Haut, als sie mit der von Leopold verschmolz; bei Helen Spahns herausgerissenen, vertrockneten Wurzeln; bei Bottles’ ausgebleichten Knochen; bei der toxischen, versilberten Liebe meiner Eltern; bei Razor Blade Baby und der schlichten Tatsache ihrer Existenz.
»Gute Nacht, Andy«, sagte ich. »Ruf mich nicht mehr an.«
Als ich auflegte, hörte ich ein bereits vertrautes Geräusch: ein kurzes Knarren über mir. Razor Blade Baby hatte sich bewegt. Sie drückte nicht mehr das Ohr an die Dielen.
Als Razor Blade Baby am nächsten Morgen – heute Morgen – an meiner Tür erschien, sagte ich nicht nein, nein, danke. Wir fuhren mit den Fahrrädern die Lake Street hinunter zum alten Hilton Theater. Ihr Haar bauschte sich im Fahrtwind, als würde es von George Spahns pennsylvanischem Bienenschwarm angehoben.
Vor der Matinee kaufte ich an einem Stand einen Hotdog mit Senf, Zwiebeln, Kraut und Jalapeños. Razor Blade Baby fingerte nervös an einem Ziploc-Beutel mit geschälten Karotten herum, den sie in ihrer Tasche versteckte.
Hier, im Kino, weiß ich, dass ich es versuchen müsste, dass ich die Last tragen und die Vergangenheit übermalen sollte. Aber ich kann nicht mehr als mein Bestes tun. Ich halte ihr den Hotdog vors Gesicht. »Willst du mal beißen, Razor Blade Baby?«
»Claire«, sagt sie. »Ich könnte deine Schwester sein.«
Und obwohl wir das wussten, seit sie eingezogen ist – eigentlich schon viel früher –, ist es das erste Mal, dass eine von uns es laut ausgesprochen hat. Und ich muss zugeben: Jetzt klingt es sanfter, als es sich anfühlte. Im Aussprechen liegt etwas, das Dankbarkeit ermöglicht.
Ich nicke. »Halbschwester.«
Langsam erlischt das Licht. Technicolorgestalten – Geister, Cowboys, Gregory Peck – bewegen sich über die Leinwand. In Duell in der Sonne fragt Pearl Chavez: »Ach Vashti, warum bist du nur so langsam?«
»Ich weiß auch nicht, Miss Pearl – ich hab einfach immer so viele Sachen im Kopf.«