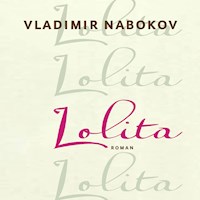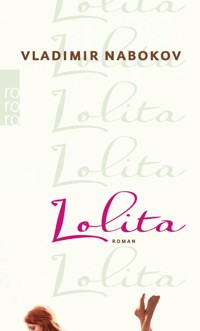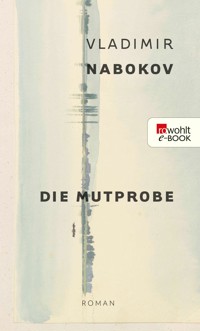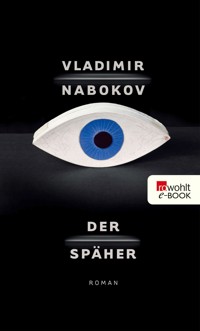9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es war einmal ein Mann, der hieß Albinus und lebte in der deutschen Stadt Berlin. Er war reich, angesehen und glücklich; um eines jungen Mädchens willen verließ er eines Tages seine Frau; er liebte; wurde nicht geliebt; und sein Leben endete in einer Katastrophe... Vladimir Nabokovs berühmter Roman aus dem Berlin der zwanziger Jahre, eins der letzten Werke, die er auf Russisch verfasste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vladimir Nabokov
Gelächter im Dunkel
Roman
Über dieses Buch
Es war einmal ein Mann, der hieß Albinus und lebte in der deutschen Stadt Berlin. Er war reich, angesehen und glücklich; um eines jungen Mädchens willen verließ er eines Tages seine Frau; er liebte; wurde nicht geliebt; und sein Leben endete in einer Katastrophe ... Vladimir Nabokovs berühmter Roman aus dem Berlin der zwanziger Jahre, eins der letzten Werke, die er auf Russisch verfasste.
Vita
Vladimir Nabokov ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er entstammte einer großbürgerlichen russischen Familie, die nach der Oktoberrevolution von 1917 emigrierte. Nach Jahren in Cambridge, Berlin und Paris verließ Nabokov 1940 Europa und siedelte in die USA über, wo er an verschiedenen Universitäten arbeitete.
In den USA begann er, seine Romane auf Englisch zu verfassen, «Lolita» war Nabokovs Liebeserklärung an die englische Sprache, wie er im Nachwort selber schrieb. Nach einer anfänglich schwierigen Publikationsgeschichte wurde «Lolita» zum Welterfolg, der es Nabokov ermöglichte, sich nur noch dem Schreiben zu widmen.
Nabokov zog in die Schweiz, wo er schrieb, Schmetterlinge fing und seine russischen Romane ins Englische übersetzte.
Er lebte in einem Hotel in Montreux, wo er am 2. Juli 1977 starb.
Der Herausgeber, Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, 1959 bis 1999 Redakteur der Wochenzeitung «Die Zeit», seit 2000 freier Autor. Zahlreiche Veröffentlichungen über Themen der Psychologie, Biologie und Anthropologie, literarische Übersetzungen (u.a. Nabokov, Joyce, Borges).
Das Gesamtwerk von Vladimir Nabokov erscheint im Rowohlt Verlag.
Impressum
Die Urfassung dieses Romans wurde 1931/32 in Berlin auf Russisch geschrieben, erschien 1932/33 in vier Folgen in der Emigrantenzeitschrift «Sowremennyje sapiski», Paris, und 1934 unter dem Titel «Kamera obskura» im Verlag Parabola, Berlin. 1937 übersetzte Nabokov in Südfrankreich den Roman unter dem Titel «Laughter in the Dark» ins Englische. Diese Fassung erschien 1938 im Verlag Bobbs-Merrill, Indianapolis. Ihre deutsche Übersetzung, von Renate Gerhardt und Hans-Heinrich Wellmann, erschien 1962 im Rowohlt Verlag, Reinbek. In der Bearbeitung von Dieter E. Zimmer wurde sie 1997, zusammen mit einer Übersetzung der russischen Urfassung, unter dem Titel «Camera obscura» in den Band 3 der Gesammelten Werke übernommen.
Der Text folgt: Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke, Band 3, Frühe Romane, herausgegeben von Dieter E. Zimmer.
Überarbeitete Ausgabe Oktober 2018
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 1962, 1997, 2000, 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Laughter in the Dark» Copyright © 1938 by Bobbs-Merrill Company, New York
Copyright © 1965 renewed by Vladimir Nabokov
Veröffentlicht im Einvernehmen mit The Estate of Vladimir Nabokov
Umschlaggestaltung any.way, Cordula Schmidt
Umschlagabbildung Nikki Smith/Arcangel
ISBN 978-3-644-00230-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Véra
Kapitel 1
Es war einmal ein Mann, der hieß Albinus und lebte in der deutschen Stadt Berlin. Er war reich, angesehen und glücklich; um eines jungen Mädchens willen verließ er eines Tages seine Frau; er liebte; wurde nicht geliebt; und sein Leben endete in einer Katastrophe.
Das ist schon die ganze Geschichte, und wir hätten es dabei bewenden lassen, läge nicht Nutzen und Vergnügen im Erzählen; und wenn auch auf einem Grabstein Raum genug ist, die gekürzte, in Moos gebundene Fassung eines Menschenlebens aufzunehmen, so sind doch Einzelheiten stets willkommen.
Eines Nachts geschah es, dass Albinus ein wunderbarer Einfall kam. Gewiss, es war nicht ganz sein eigener, denn er war ihm beim Lesen eines Satzes von Conrad gekommen (nicht des berühmten Polen, sondern von Udo Conrad, der die Memoiren eines vergesslichen Mannes schrieb und jene andere Geschichte über den alten Zauberkünstler, der sich in seiner Abschiedsvorstellung selbst wegzauberte). Jedenfalls machte er den Einfall zu seinem eigenen, indem er Zuneigung zu ihm fasste, mit ihm spielte, ihn in sich anwachsen ließ, bis er zu seiner zweiten Natur wurde, und in der Freien Stadt des Geistes macht dergleichen eine Sache zum rechtmäßigen Eigentum. Als Kunstkritiker und Bilderkenner hatte er sich oft damit vergnügt, dass er diesen oder jenen alten Meister Landschaften und Gesichter signieren ließ, die ihm, Albinus, im täglichen Leben begegnet waren: Es verwandelte sein Dasein in eine Bildergalerie – jedes Bild eine köstliche Fälschung. Eines Abends dann, als sich sein gelehrter Verstand beim Schreiben eines kleinen Essays erholte (nichts geradezu Brillantes, er war kein besonders begabter Mann), eines Essays über Filmkunst, da kam ihm der wunderbare Einfall.
Er hing mit farbigen Trickfilmen zusammen – die damals gerade aufgekommen waren. Wie faszinierend müsste es sein, dachte er, wenn man diese Technik dazu verwenden könnte, einige bekannte Bilder, vor allem der Niederländer, werkgetreu mit ihren lebhaften Farben auf der Leinwand zu reproduzieren und dann zum Leben zu erwecken – Bewegung und Gestik in vollkommenem Einklang mit ihrem leblosen Zustand auf dem Bild zeichnerisch weiterzuentwickeln, etwa eine Schenke voll kleinen Volks, das fröhlich an Holztischen zecht, mit einem Durchblick auf einen sonnigen Hof mit gesattelten Pferden – alles wird plötzlich dadurch lebendig, dass der kleine Mann in Rot seinen Krug absetzt, das Mädchen mit dem Tablett sich freiwindet und ein Huhn auf der Schwelle zu picken beginnt. Das Ganze könnte fortgesetzt werden, indem man etwa die kleinen Figuren herauskommen und dann durch die Landschaft desselben Malers spazieren lässt, mit einem braunen Himmel vielleicht und einem zugefrorenen Kanal und Leuten, die auf den drolligen Schlittschuhen von damals jene altmodischen Kurven beschreiben, die das Bild andeutet; oder eine nasse Landstraße im Nebel und ein paar Reiter – um schließlich zur Schenke zurückzukehren und die Figuren und das Licht wieder in die alte Ordnung zu bringen, sie sozusagen wieder sesshaft zu machen und alles mit dem ersten Bild abzuschließen. Dann könnte man es auch mit den Italienern versuchen: in der Ferne der blaue Kegel eines Berges, ein weißer gewundener Pfad, kleine Pilger, die bergan ihres Weges ziehen. Und vielleicht sogar religiöse Themen, aber nur solche mit ganz kleinen Figuren. Und der Zeichner müsste nicht nur eine gründliche Kenntnis des betreffenden Malers und seiner Epoche besitzen, sondern auch genügend Talent, um zwischen den erzeugten Bewegungen und jenen, die der alte Meister fixiert hatte, jeden Missklang zu vermeiden: Er müsste sie aus dem Bild selbst entwickeln – machen ließe sich das schon. Und die Farben … natürlich müssten sie viel raffinierter sein als die der Trickfilme. Was für eine Geschichte könnte man erzählen: die Geschichte der Sichtweise eines Künstlers, die glückliche Reise von Auge und Malpinsel, und eine Welt in der Manier dieses Künstlers, getaucht in die Farbtöne, die er selbst gefunden hatte!
Nach einiger Zeit sprach er mit einem Filmproduzenten darüber, aber dieser war nicht im Mindesten angetan: Er sagte, es würde eine unendliche Feinarbeit mit sich bringen, würde neue Verbesserungen in der Animationstechnik erfordern und eine Menge Geld verschlingen; sagte, ein solcher Film könnte wegen seiner mühseligen Herstellung natürlich nicht länger als ein paar Minuten dauern; selbst dann würde er die meisten Leute zu Tode langweilen und sich als eine allgemeine Enttäuschung erweisen.
Dann besprach er die Sache mit einem anderen Filmmenschen, und der rümpfte auch nur geringschätzig die Nase. «Wir könnten mit etwas ganz Einfachem beginnen», sagte Albinus, «ein buntes Glasfenster, das lebendig wird, bewegte Heraldik, ein kleiner Heiliger oder zwei.»
«Ich fürchte, das bringt nichts», sagte der andere. «Phantasiefilme können wir nicht riskieren.»
Aber Albinus gab seine Idee nicht preis. Schließlich hörte er von einem cleveren Burschen, einem Axel Rex, der ein großes Geschick für Extravaganzen besaß – tatsächlich hatte er ein persisches Märchen gezeichnet, das die intellektuellen Snobs von Paris in Entzücken versetzte und den Mann ruinierte, der das Unternehmen finanziert hatte. So versuchte Albinus, ihn zu sprechen, erfuhr aber, dass er gerade in die Staaten zurückgekehrt sei, wo er Cartoons für eine Illustrierte zeichnete. Nach einiger Zeit gelang es Albinus, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, und Rex schien interessiert.
An einem bestimmten Tag im März bekam Albinus einen langen Brief von ihm, aber sein Eintreffen fiel mit einer plötzlichen Krise in Albinus’ privatem – sehr privatem – Leben zusammen, sodass der wunderbare Einfall, der sonst fortgelebt und vielleicht eine Mauer gefunden hätte, an der er emporranken und aufblühen konnte, im Laufe der letzten Woche auf seltsame Weise dahingesiecht und gewelkt war.
Rex schrieb, es sei hoffnungslos, weiterhin die Hollywood-Leute überreden zu wollen, und unterbreitete dann kaltblütig den Vorschlag, als wohlhabender Mann solle Albinus doch seinen Einfall selber finanzieren; in welchem Falle er, Rex, ein Honorar von soundso viel (eine erstaunliche Summe) akzeptieren würde, die Hälfte davon im voraus zu zahlen, um etwa einen Breughel-Film zu zeichnen – die Sprichwörter zum Beispiel oder irgendetwas anderes, das Albinus von ihm in Bewegung gesetzt haben wollte.
«Ich an deiner Stelle», bemerkte Albinus’ Schwager Paul, ein untersetzter, gutmütiger Mann mit den Clips von zwei Bleistiften und zwei Füllfederhaltern auf seiner Brusttasche, «ich würde es riskieren. Gewöhnliche Filme kosten mehr – ich meine solche mit Kriegen und einstürzenden Häusern.»
«Ja, aber die bringen das Geld auch wieder herein, und meiner nicht.»
«Ich glaube mich zu erinnern», sagte Paul und sog an seiner Zigarre (sie beendeten gerade das Abendessen), «dass du bereit warst, eine beträchtliche Summe dafür zu opfern – kaum weniger als das Honorar, das er verlangt. Nun, was ist denn? Du siehst nicht mehr so begeistert aus wie noch vor kurzem. Du gibst die Sache doch nicht etwa auf?»
«Ich weiß nicht. Es ist die praktische Seite, die mich daran stört; an sich gefällt mir mein Einfall immer noch.»
«Was für ein Einfall?», erkundigte sich Elisabeth.
Das war eine kleine Angewohnheit von ihr – Fragen zu stellen über Dinge, die in ihrer Gegenwart bereits erschöpfend erörtert worden waren. Es war reine Nervosität ihrerseits, nicht Stumpfheit oder Mangel an Aufmerksamkeit; und noch während sie ihre Frage stellte und hilflos den Satz hinunterschlitterte, merkte sie meist, dass sie die Antwort die ganze Zeit gewusst hatte. Ihrem Mann war diese kleine Angewohnheit bekannt, und sie ärgerte ihn nicht; im Gegenteil, sie rührte und amüsierte ihn. Er fuhr dann ruhig in der Unterhaltung fort und wusste dabei genau (freute sich sogar darauf), dass sie im nächsten Augenblick die Antwort auf ihre Frage selber geben würde. Aber an diesem besonderen Märztag war Albinus in einem solchen Zustand von Gereiztheit, Verwirrung und Elend, dass seine Nerven plötzlich mit ihm durchgingen.
«Lebst du denn auf dem Mond?», fragte er barsch, und seine Frau sah auf ihre Fingernägel und sagte beschwichtigend:
«O ja, jetzt erinnere ich mich.»
Dann wandte sie sich der achtjährigen Irma zu, die kleckernd und schmierend einen Teller voll Schokoladenpudding in sich hineinschlang, und rief:
«Nicht so hastig, Kind, bitte nicht so hastig!»
«Ich überlege gerade», begann Paul und sog an seiner Zigarre, «dass jede neue Erfindung …»
Von seinen eigenartigen Gefühlen beherrscht, dachte Albinus: ‹Was zum Teufel geht mich dieser Rex an, diese idiotische Unterhaltung, dieser Schokoladenpudding …? Ich bin dabei, wahnsinnig zu werden, und keiner weiß es. Und ich kann es nicht aufhalten, es hat keinen Zweck, es auch nur zu versuchen, und morgen werde ich wieder dort hingehen und wie ein Narr in dieser Dunkelheit sitzen – unvorstellbar.›
Gewiss, es war unvorstellbar – umso mehr, als er sich in all den neun Jahren seines Ehelebens an die Kandare genommen hatte und niemals, niemals … ‹Eigentlich›, dachte er, ‹sollte ich mit Elisabeth darüber sprechen; oder einfach mit ihr eine Weile verreisen; oder einen Psychoanalytiker aufsuchen; oder …›
Nein, man kann nicht einfach eine Pistole nehmen und ein Mädchen abknallen, das man nicht einmal kennt, nur weil man es attraktiv findet.
Kapitel 2
Albinus hatte nie viel Glück gehabt in Herzensdingen. Obwohl er gut aussah, auf eine ruhige, wohlerzogene Art, war es ihm irgendwie nie gelungen, seine Anziehungskraft auf Frauen praktisch zu nutzen – denn sein freundliches Lächeln und die sanften blauen Augen, die ein wenig hervortraten, wenn er angestrengt nachdachte (und da er langsam im Begreifen war, geschah dies öfter als angebracht), hatten etwas durchaus Einnehmendes. Er war ein guter Unterhalter, mit jenem ganz leichten Stocken in seiner Sprechweise, nahezu einem Stottern, das selbst der abgestandensten Phrase frischen Charme verleiht. Last but not least (denn er war in einer gemütlichen deutschen Welt zuhause) hatte ihm sein Vater ein solide investiertes Vermögen hinterlassen; dennoch pflegten Romanzen irgendwie platt zu werden, sobald sie seinen Weg kreuzten.
In seiner Studentenzeit hatte er eine langweilige Liaison der schwergewichtigen Art mit einer traurigen, ältlichen Dame, die ihm später, während des Krieges, purpurrote Socken an die Front schickte, juckende Wollsachen, enorme leidenschaftliche Briefe, mit Höchstgeschwindigkeit in einer wilden, unleserlichen Handschrift auf Pergamentpapier geschrieben. Dann war da die Affäre mit der Frau des Herrn Professors, die er am Rhein getroffen hatte; sie war hübsch, wenn man sie aus einem bestimmten Blickwinkel und in einem bestimmten Licht betrachtete, aber so kalt und spröde, dass er sie bald fallen ließ. Schließlich gab es da in Berlin, kurz vor seiner Heirat, eine magere, trübselige Frau mit hausbackenem Gesicht, die an jedem Samstagabend zu kommen pflegte und ihm dann ihre gesamte Vergangenheit in allen Einzelheiten berichtete, immer wieder die gleichen gottverdammten Sachen, matt in seinen Umarmungen seufzte und stets mit der einzigen französischen Redewendung endete, die sie kannte: «C’est la vie.» Schnitzer, Missgriffe, Enttäuschung; sicher war der Cupido, der ihm zu dienen suchte, ein Linkshänder mit fliehendem Kinn und ohne Phantasie. Und neben diesen blassen Romanzen hatte es Hunderte von jungen Frauen gegeben, von denen er geträumt, die er aber niemals kennen gelernt hatte; sie waren einfach an ihm vorbeigegangen und hatten ein oder zwei Tage lang jenes hoffnungslose Gefühl hinterlassen, das Schönheit zu dem macht, was sie ist: ein ferner einsamer Baum vor goldenen Himmeln; Lichtkringel an der Innenbeuge einer Brücke; etwas, das sich nicht fangen lässt.
Er heiratete, und obwohl er Elisabeth in gewisser Weise liebte, blieb sie ihm jenen Reiz schuldig, nach dem zu verlangen er müde geworden war. Sie war die Tochter eines bekannten Theaterdirektors, ein geschmeidiges, schmächtiges, blondes Fräulein mit farblosen Augen und rührenden Pickelchen genau über einer kleinen Nase von jener Art, die englische Romanschriftstellerinnen «retroussée»[1] nennen (man beachte das sicherheitshalber angehängte zweite e). Ihre Haut war so zart, dass die leichteste Berührung einen rosa Fleck auf ihr hinterließ, der nur langsam verblasste.
Er heiratete sie, weil es sich einfach so ergab. Die Hauptverantwortung für ihre Ehe trug ein Ausflug in die Berge mit ihr samt ihrem fetten Bruder und einer bemerkenswert athletischen Cousine, die sich schließlich in Pontresina gottseidank den Fuß verstauchte. Es war etwas so Zartes, so Ätherisches um Elisabeth, und sie hatte ein so gutmütiges Lachen. Sie wurden in München getraut, um dem Ansturm ihrer zahlreichen Berliner Bekannten zu entgehen. Die Kastanien standen in voller Blüte. Ein sorgsam gehütetes Zigarettenetui ging in einem vergessenen Garten verloren. Einer der Ober im Hotel konnte sieben Sprachen. An Elisabeth zeigte sich, dass sie eine zarte kleine Narbe hatte – die Folge einer Blinddarmentzündung.
Sie war eine anhängliche kleine Seele, fügsam und sanft. Ihre Liebe war von der Lilienart; aber dann und wann entflammte sie, und in solchen Augenblicken wurde Albinus zu dem Glauben verleitet, dass er gar keine andere Liebespartnerin mehr brauchte.
Als sie schwanger wurde, nahmen ihre Augen einen leeren Ausdruck von Zufriedenheit an, als ob sie über jene neue Welt in ihrem Innern nachsänne; ihr achtloser Gang wandelte sich in ein achtsames Watscheln, und gierig verschlang sie eine Handvoll Schnee nach der anderen, die sie eilig zusammenkratzte, wenn gerade niemand hinsah. Albinus versorgte sie, so gut er nur konnte; nahm sie mit auf lange, langsame Spaziergänge; passte auf, dass sie früh zu Bett ging und dass Haushaltsgegenstände mit scharfen Kanten sanft zu ihr waren, wenn sie sich umherbewegte; aber nachts träumte er davon, an einem heißen, einsamen Strand einem Mädchen zu begegnen, das sich im Sande rekelte, und gewöhnlich überfiel ihn in solchen Träumen eine plötzliche Angst, von seiner Frau ertappt zu werden. Am Morgen betrachtete Elisabeth ihren aufgeschwollenen Körper im Spiegel des Kleiderschranks und lächelte ein befriedigtes und geheimnisvolles Lächeln. Dann wurde sie eines Tages in ein Entbindungsheim gebracht, und Albinus lebte drei Wochen lang allein. Er wusste nichts mit sich anzufangen; trank ziemlich viel Brandy; wurde von zwei dunklen Gedanken gequält, jeder von einer anderen Art von Dunkelheit; der eine war, dass seine Frau sterben könnte, und der andere, dass er, wenn er nur ein bisschen beherzter wäre, ein entgegenkommendes Mädchen finden und sie in sein leeres Schlafzimmer mitnehmen könnte.
Würde das Kind je zur Welt kommen? Albinus ging auf und ab in dem langen, weiß gestrichenen, weiß emaillierten Korridor mit der Albtraumpalme im Blumentopf oben auf dem Treppenabsatz; alles war ihm verhasst, die hoffnungslose Weiße des Hauses und die rotbackigen, raschelnden Krankenschwestern mit weiß beflügelten Köpfen, die ihn ständig zu vertreiben suchten. Endlich tauchte der Assistenzarzt auf und sagte düster: «So, es ist alles vorüber.» Vor Albinus’ Augen erschien ein feiner, dunkler Regen, wie das Flimmern eines sehr alten Films (1910, ein munterer, ruckweise gehender Leichenzug, dessen Beine sich zu schnell bewegen). Er stürzte ins Krankenzimmer. Elisabeth war glücklich von einer Tochter entbunden.
Das Baby war zuerst rot und runzlig wie ein Spielzeugballon, dem die Luft ausgeht. Bald jedoch glättete sich sein Gesicht, und nach einem Jahr begann es zu sprechen. Jetzt, im Alter von acht Jahren, war das Mädchen viel weniger zungenfertig, denn es hatte die zurückhaltende Natur seiner Mutter geerbt. Auch seine Heiterkeit war die seiner Mutter – eine seltsam unaufdringliche Heiterkeit. Es war einfach ein stilles Entzücken am eigenen Dasein, mit einem Schuss humorvollen Erstaunens, überhaupt am Leben zu sein – ja, das war der Tenor: todesbewusste Heiterkeit.
Und all diese Jahre hindurch blieb Albinus treu, obgleich ihn die Zwiespältigkeit seiner Gefühle reichlich verwirrte. Er fühlte, dass er seine Frau aufrichtig und zärtlich liebte – sosehr er eben imstande war, ein menschliches Wesen zu lieben; und er war völlig offen zu ihr in allen Dingen, bis auf jenes törichte Verlangen, jenen Traum, jene Begierde, die ein Loch in sein Leben brannte. Sie las alle Briefe, die er schrieb oder erhielt, ließ sich gerne über die Einzelheiten seiner Geschäfte unterrichten – besonders über jene, die den Umgang mit alten, düsteren Bildern betrafen, zwischen deren Rissen man die weiße Kruppe eines Pferdes oder ein dämmerndes Lächeln erkennen konnte. Sie machten ein paar herrliche Auslandsreisen, und es gab viele wunderbar stille Abende zuhause, an denen er mit ihr auf dem Balkon saß hoch über den blauen Straßen, deren Drähte und Schornsteine wie in chinesischer Tusche über den Sonnenuntergang gemalt waren, und darüber nachdachte, dass er tatsächlich glücklicher war, als er es verdiente.
Eines Abends (eine Woche vor dem Gespräch über Axel Rex) bemerkte er auf dem Weg zu einem Café, in dem er eine geschäftliche Verabredung hatte, dass seine Uhr Amok lief (auch dies geschah nicht zum ersten Mal) und dass er noch eine ganze Stunde Zeit hatte, ein Geschenk, das irgendwie genutzt werden musste. Natürlich war es sinnlos, nach Hause zurückzukehren, ans andere Ende der Stadt, doch hatte er auch keine Lust, herumzusitzen und zu warten: Der Anblick anderer Männer mit Freundinnen regte ihn immer auf. So schlenderte er ziellos umher und kam an einem kleinen Kino vorbei, dessen Lichter einen scharlachroten Schein über den Schnee warfen. Er blickte flüchtig auf das Plakat (das einen Mann zeigte, der zu einem Fensterrahmen aufschaute, in dem ein Kind im Nachthemd stand), zögerte – und kaufte eine Eintrittskarte.
Kaum hatte er die samtene Dunkelheit betreten, als auch schon der ovale Strahl einer Taschenlampe auf ihn zuglitt (wie das so üblich ist) und ihn nicht weniger rasch und zügig den dunklen, sacht abfallenden Gang hinabführte. Gerade als das Licht auf die Eintrittskarte in seiner Hand fiel, sah Albinus das geneigte Gesicht des Mädchens, und während er hinter ihr herging, konnte er im Dämmer ihre schmale Gestalt erkennen und die ebenmäßige Schnelligkeit ihrer leidenschaftslosen Bewegungen. Während er sich auf seinen Platz schob, schaute er zu ihr auf, und da zufällig das Licht darauf fiel, sah er wieder den klaren Schimmer ihres Auges und den schmelzenden Umriss einer Wange, die aussah, als wäre sie von einem großen Künstler gegen einen schweren, dunklen Hintergrund gemalt worden. Es war an alldem nichts Außergewöhnliches: Solche Dinge waren ihm schon öfter widerfahren, und er wusste, dass es unklug war, dabei zu verweilen. Sie ging fort, wurde von der Dunkelheit verschluckt, und plötzlich fühlte er sich gelangweilt und traurig. Er war zum Ende des Films hereingekommen: Zwischen umgestürzten Möbelstücken wich ein Mädchen vor einem maskierten Mann mit einer Schusswaffe zurück. Er fand nicht das geringste Interesse daran, Geschehnisse zu betrachten, die er nicht verstand, weil er ihren Anfang nicht kannte.
Als in der Pause die Lichter wieder angegangen waren, sah er sie wieder: Sie stand am Ausgang neben einem scheußlichen, purpurroten Vorhang, den sie gerade zur Seite gezogen hatte, und die hinausgehenden Leute strömten an ihr vorbei. Eine Hand hielt sie in der Tasche ihrer kurzen, bestickten Schürze, und ihr schwarzer Kittel lag sehr eng um Arme und Busen. Fast ehrfürchtig starrte er ihr ins Gesicht. Es war ein bleiches, schmollendes, schmerzlich schönes Gesicht. Er schätzte ihr Alter auf etwa achtzehn.
Als dann fast alle Plätze leer geworden waren und neue Leute sich seitlich in die Reihen schoben, lief sie hin und her, einige Male ganz dicht an ihm vorbei; aber er wandte sich ab, weil es wehtat hinzuschauen und weil er daran denken musste, wie viele Male Schönheit – oder was er Schönheit nannte – an ihm vorbeigegangen und entschwunden war.
Er saß noch eine halbe Stunde im Dunkel, die vorstehenden Augen auf die Leinwand gerichtet. Dann stand er auf und ging. Sie zog den Vorhang für ihn zur Seite, und leise klapperten die hölzernen Ringe.
‹Ah, aber ich will noch einmal hinschauen›, dachte Albinus unglücklich.
Es schien ihm, dass ihre Lippen ein wenig zuckten. Sie ließ den Vorhang fallen.
Albinus trat in eine blutrote Pfütze; der Schnee schmolz, die Nacht war feucht, die Wasserfarben der Straßenlaternen rannen und zerflossen. ‹Argus› – guter Name für ein Kino.
Nach drei Tagen konnte er die Erinnerung an sie nicht länger ignorieren. Er war lächerlich aufgeregt, als er dort aufs neue eintrat – wieder in der Mitte von irgendetwas. Alles war genau wie beim ersten Mal: die gleitende Taschenlampe, die langen luiniesken[2] Augen, der rasche Gang in der Dunkelheit, die schöne Bewegung ihres schwarz bekleideten Armes, als sie den Vorhang zur Seite schob. ‹Jeder normale Mann wüsste, was er zu tun hat›, dachte Albinus. Ein Wagen rollte eine glatte Straße mit Haarnadelkurven zwischen Felswänden und Schluchten hinab.
Als er ging, versuchte er, ihren Blick aufzufangen, doch es misslang. Draußen goss es in Strömen, und das Pflaster glomm karmesinrot.
Wäre er nicht zum zweiten Mal dort hingegangen, wäre es ihm vielleicht gelungen, dieses Gespenst von einem Abenteuer zu vergessen, aber nun war es zu spät. Er ging zum dritten Male hin, fest entschlossen, sie anzulächeln – und was für eine verzweifelte Grimasse wäre es geworden, hätte er es zuwege gebracht. Jedenfalls klopfte sein Herz so stark, dass er die Gelegenheit versäumte.
Und am nächsten Tage kam Paul zum Abendessen, sie besprachen die Sache mit Rex, Irma verschlang ihren Schokoladenpudding, und Elisabeth stellte ihre üblichen Fragen.
«Lebst du denn auf dem Mond?», fragte er, und dann versuchte er, seine Ungezogenheit durch ein verspätetes Kichern wiedergutzumachen.
Nach dem Abendessen saß er neben seiner Frau auf dem breiten Sofa, pickte mit kleinen Küssen nach ihr, während sie in einem Modejournal Gewänder und anderes betrachtete, und dumpf dachte er bei sich:
‹Verdammt noch mal, ich bin glücklich, was brauche ich mehr? Dieses Wesen, das da im Dunkeln umgeht … am liebsten würde ich ihr den schönen Hals umdrehen. Nun ja, sie ist ohnehin tot, denn ich gehe dort nicht mehr hin.›
Kapitel 3
Sie hieß Margot Peters. Ihr Vater war Hauswart und hatte im Kriege einen Nervenschock erlitten: Sein grauer Kopf zuckte unaufhörlich, als wollte er ständig allen Kummer und alles Leid bestätigen, und beim geringsten Anlass geriet er in heftige Erregung. Ihre Mutter war noch recht jung, aber ebenfalls reichlich mitgenommen – eine plumpe, verhärtete Frau, deren rote Hand ein wahres Füllhorn von Schlägen war. Ihr Kopf war gewöhnlich in ein Kopftuch gewickelt, um ihr Haar bei der Arbeit vor Staub zu schützen, aber nach ihrem Großreinemachen am Sonnabend – hauptsächlich ausgeführt mithilfe eines Staubsaugers, der auf geniale Weise am Fahrstuhl angeschlossen war – putzte sie sich heraus und machte sich auf Besuchstour. Bei den Mietern war sie unbeliebt wegen ihrer Frechheit und der unverschämten Art, mit der sie den Leuten befahl, ihre Füße auf der Matte abzuputzen. Die Treppe war das Hauptidol ihres Daseins – nicht als Symbol glorreichen Aufstiegs, sondern als etwas, das schön blank bleiben musste, und ihr schlimmster Albtraum (nach einer zu großen Portion Kartoffeln und Sauerkraut) war somit eine weiße Treppe mit schwarzen Stiefelspuren, erst rechts, dann links, dann wieder rechts und so weiter – bis hinauf zum obersten Treppenabsatz. Wirklich, eine arme Frau und kein Gegenstand des Spottes.
Otto, Margots Bruder, war drei Jahre älter als sie. Er arbeitete in einer Fahrradfabrik, verabscheute das zahme Republikanertum seines Vaters, verbreitete sich in der benachbarten Kneipe über Politik und erklärte, indem er seine Faust auf den Tisch hieb: «Der Mensch muss vor allem einen vollen Bauch haben.» Das war sein Leitmotiv, und obendrein ein recht gesundes.
Als Kind war Margot zur Schule gegangen und hatte dort etwas weniger Ohrfeigen eingefangen als zuhause. Die geläufigste Bewegung eines jungen Kätzchens ist ein in plötzlichen Serien auftretender kleiner Sprung; die ihre war ein rasches Heben des linken Ellenbogens, um ihr Gesicht zu schützen. Trotz alledem wuchs sie zu einem hellen und temperamentvollen Mädchen heran. Als sie kaum acht Jahre alt war, nahm sie mit viel Vergnügen an den schreienden, schurrenden Fußballspielen teil, die Schuljungen mitten auf der Straße mit einem apfelsinengroßen Gummiball spielten. Mit zehn lernte sie auf dem Rad ihres Bruders zu fahren. Mit bloßen Armen und fliegenden Rattenschwänzen sauste sie die Straße auf und ab; hielt dann an, einen Fuß auf dem Bordstein, ruhend, nachdenklich. Mit zwölf wurde sie weniger ungestüm. Jetzt kamen die Tage, an denen sie am liebsten an der Tür stand und in gedämpftem Ton mit der Tochter des Kohlenhändlers schwatzte, Ansichten über die Frauen austauschte, die einen der Hausbewohner besuchten, oder die vorübergehenden Hüte diskutierte. Einmal fand sie auf der Treppe eine schäbige Handtasche, die ein Stück Mandelseife enthielt, an dem ein dünnes, gebogenes Haar klebte, sowie ein halbes Dutzend sehr eigenartige Photos. Bei einer anderen Gelegenheit küsste sie der rothaarige Junge, der ihr beim Spielen immer ein Bein stellte, auf den Nacken. Dann hatte sie eines Abends einen hysterischen Anfall, wofür sie in kaltes Wasser getaucht wurde und eine anständige Tracht Prügel erhielt.
Ein Jahr später war sie bemerkenswert hübsch geworden, trug ein kurzes rotes Kleid und war verrückt auf Kino. Später erinnerte sie sich an diesen Abschnitt ihres Lebens mit einem seltsamen, bedrückenden Gefühl – die hellen, warmen, friedlichen Abende; das Geräusch von Läden, die für die Nacht verriegelt wurden; ihr Vater, der rittlings auf dem Stuhl vor der Tür saß, seine Pfeife rauchte und mit dem Kopf zuckte; ihre Mutter, die Arme in die Seite gestemmt; der Fliederbusch, der über den Staketenzaun hing; Frau von Bock, die ihre Einkäufe in einem grünen Netz nach Hause trug; das Dienstmädchen Martha, das wartete, bis es mit dem Windhund und zwei Drahthaarterriern über die Straße gehen konnte … Es wurde dunkler. Ihr Bruder kam dann mit ein paar vierschrötigen Freunden, die herumstanden, sie anrempelten und ihr in die bloßen Arme kniffen. Einer von ihnen hatte Augen wie der Filmschauspieler Conrad Veidt. Die Straße, deren Häuser in den oberen Stockwerken noch in gelbes Licht gebadet waren, wurde ganz still. Nur gegenüber spielten zwei kahlköpfige Herren auf einem Balkon Karten, und jede Lachsalve und jedes Kartenknallen war zu hören.
Als sie kaum sechzehn war, befreundete sie sich mit dem Mädchen, das als Verkäuferin hinter dem Ladentisch des kleinen Papierwarengeschäfts an der Ecke arbeitete. Die jüngere Schwester dieses Mädchens verdiente schon einen ansehnlichen Lebensunterhalt als Modell bei einem Künstler. So träumte auch Margot davon, Modell zu werden und dann Filmstar. Dieser Übergang erschien ihr ganz einfach: Der Himmel war ja da, bereit für ihren Stern. Etwa um die gleiche Zeit lernte sie tanzen, und hin und wieder ging sie mit dem Ladenmädchen in das Tanzlokal ‹Paradies›, wo ihr ältliche Männer beim Getöse und Gewimmer einer Jazzband außerordentlich freimütige Anträge machten.
Als sie eines Tages an der Straßenecke stand, fuhr plötzlich ein Bursche auf einem roten Motorrad heran, den sie schon ein- oder zweimal bemerkt hatte, und lud sie zu einer Tour ein. Er hatte flachsblondes, zurückgekämmtes Haar, und sein Hemd blähte sich hinter ihm, noch voll von dem Wind, der sich darin gefangen hatte. Sie lächelte, stieg hinter ihm auf, zog ihren Rock zurecht, und im nächsten Augenblick fuhren sie schon mit ungeheurer Geschwindigkeit, während seine Krawatte ihr ins Gesicht flatterte. Er fuhr mit ihr aus der Stadt hinaus und hielt dann. Es war ein sonniger Abend, und ein kleiner Schwarm Mücken stopfte an immer der gleichen Stelle ein Loch in der Luft. Alles war sehr still: die Stille von Kiefern und Heidekraut. Er stieg ab, und während er sich neben sie auf den Grabenrand setzte, erzählte er ihr, dass er letztes Jahr einfach so bis nach Spanien gefahren sei. Dann legte er den Arm um sie und begann sie zu drücken und zu befummeln und sie so heftig zu küssen, dass das Unbehagen, das sie an jenem Tage verspürte, zur Benommenheit wurde. Sie wand sich los und begann zu weinen. «Du darfst mich küssen», schluchzte sie, «aber bitte nicht so.» Der Junge zuckte mit den Schultern, warf seine Maschine an, rannte los, sprang auf, ging in die Kurve, war verschwunden und ließ sie auf einem Kilometerstein zurück. Nach Hause ging sie zu Fuß. Otto, der gesehen hatte, wie sie fortgefahren war, hieb ihr seine Faust in den Nacken und trat sie dann geschickt mit Füßen, sodass sie hinfiel und sich an der Nähmaschine braun und blau schlug.
Im nächsten Winter stellte das Ladenmädchen sie Frau Lewandowski vor, einer ältlichen Frau mit stattlichen Proportionen und feinen Manieren, jedoch entstellt durch eine gewisse Saftigkeit ihrer Ausdrucksweise und einen feurigen handgroßen Fleck auf der Wange: Sie pflegte ihn damit zu erklären, dass ihre Mutter während der Schwangerschaft durch ein Feuer erschreckt worden sei. Margot bezog ein kleines Mädchenzimmer in ihrer Wohnung, und ihre Eltern waren umso dankbarer, sie los zu sein, als sie bedachten, dass jede Arbeit geheiligt wurde durch das Geld, das sie einbrachte; und glücklicherweise war ihr Bruder, der gern in drohenden Worten davon redete, dass die Kapitalisten die Töchter der Armen kauften, für einige Zeit fort, auf Arbeit in Breslau.
Zuerst stand Margot Modell in der Klasse einer Mädchenschule; etwas später dann in einem richtigen Atelier, wo nicht nur Frauen, sondern auch Männer sie zeichneten, von denen die meisten sehr jung waren. Ihr glänzendes schwarzes Haar war hübsch geschnitten, und sie saß auf einem kleinen Teppich, völlig nackt, die Füße unter sich geschlagen, auf ihren blauvenigen Arm gestützt, ihren schlanken Rücken (mit einem Schimmer von feinem Flaum zwischen den schönen Schultern, deren eine an ihre flammende Wange gehoben war) leicht vorgebeugt, in einem Anschein von nachdenklicher Müdigkeit; aus den Augenwinkeln beobachtete sie, wie die Studenten ihre Blicke hoben und senkten, und sie hörte das feine Schaben und Kratzen der Kohlestifte, die diese oder jene Wölbung schattierten. Aus purer Langeweile pflegte sie den bestaussehenden jungen Mann herauszusuchen und ihm einen dunklen, feuchten Blick zuzuwerfen, jedes Mal wenn er das Gesicht mit den geöffneten Lippen und der gerunzelten Stirn hob. Es gelang ihr nie, die Farbe seiner Aufmerksamkeit zu ändern, und das wurmte sie. Wenn sie sich früher vorgestellt hatte, allein in einem Lichtkegel dazusitzen, so vielen Augen ausgesetzt, hatte sie sich eingebildet, dass es sehr erhebend wäre. Aber sie wurde steif davon, das war alles. Um sich zu unterhalten, machte sie ihr Gesicht für die Sitzung zurecht, malte ihren trockenen heißen Mund an, tönte die Augenlider dunkel, obwohl sie weiß Gott schon dunkel genug waren, und einmal malte sie sogar ihre Brustwarzen mit dem Lippenstift an. Dafür wurde sie von der Lewandowski mächtig ausgeschimpft.
So vergingen die Tage, und Margot hatte nur eine sehr vage Vorstellung, worauf sie wirklich hinauswollte, obwohl da immer noch diese Vision war: sie als Filmschönheit in traumhaften Pelzen und ein traumhafter Hotelportier, der ihr unter einem Riesenschirm aus einem traumhaften Auto hilft. Noch immer überlegte sie, wie sie wohl von ihrem verblassten kleinen Teppich im Atelier geradewegs in diese diamantleuchtende Welt hüpfen könnte, als ihr Frau Lewandowski zum ersten Male von einem liebeskranken jungen Mann aus der Provinz erzählte.
«Du brauchst unbedingt einen Freund», erklärte die Dame selbstgefällig, während sie ihren Kaffee trank, «du bist ein viel zu lebhaftes Ding, um nicht einen Gefährten nötig zu haben, und dieser bescheidene junge Mann möchte in dieser schlimmen Stadt eine reine Seele finden.»
Margot hatte Frau Lewandowskis fetten gelben Dackel auf dem Schoß. Sie zog die weichen, seidigen Ohren des Tieres in die Höhe, sodass ihre Spitzen in der Mitte über dem sanften Kopf zusammenstießen (innen ähnelten sie viel benutztem altrosa Löschpapier), und antwortete ohne aufzuschauen:
«Also das hat noch Zeit. Ich bin doch erst sechzehn, oder? Und wozu soll das überhaupt gut sein? Führt es zu was? Ich kenne diese Burschen.»
«Du bist eine Närrin», sagte Frau Lewandowski ruhig. «Ich rede nicht von irgendeinem Taugenichts, sondern von einem freigebigen Herrn, der dich auf der Straße gesehen hat und seither von dir träumt.»
«Irgend so ein alter Tattergreis, schätze ich», sagte Margot und küsste die Warze auf der Hundewange.
«Närrin», wiederholte Frau Lewandowski. «Er ist dreißig, glatt rasiert, distinguiert, mit Seidenkrawatte und goldener Zigarettenspitze.»
«Komm, komm, wir gehen spazieren», sagte Margot zu dem Hund, und der Dachshund glitt mit einem Plumps von ihrem Schoß auf den Boden und trottete durch den Flur davon.
Nun war der Herr, von dem Frau Lewandowski gesprochen hatte, alles andere als ein schüchterner junger Mann vom Lande. Er war durch zwei muntere Handelsreisende mit ihr in Verbindung gekommen, mit denen er im Schiffszug auf der ganzen Strecke von Bremen nach Berlin Poker gespielt hatte. Zuerst war vom Preis nicht die Rede gewesen: Die Kupplerin hatte ihm nur den Schnappschuss von einem lächelnden Mädchen mit Sonne in den Augen und einem Hund in den Armen gezeigt, und Müller (das war der Name, den er angab) hatte nur genickt. Am verabredeten Tag kaufte sie Kuchen und machte reichlich Kaffee. Sie riet Margot umsichtig, ihr altes rotes Kleid anzuziehen. Gegen sechs Uhr läutete es. ‹Ich lasse mich auf kein Risiko ein, ich nicht›, dachte Margot. ‹Wenn ich ihn nicht mag, sage ich es ihr rundheraus, und wenn doch, dann nehme ich mir Zeit, die Sache zu überlegen.›
Leider war es gar nicht so einfach, zu entscheiden, was von Müller zu halten war. Erstens hatte er ein auffallendes Gesicht. Sein glanzloses schwarzes Haar, sorglos zurückgebürstet, etwas zu lang und von seltsam vertrocknetem Aussehen, war sicher keine Perücke, obwohl es ungemein danach aussah. Seine Wangen schienen hohl, weil die Jochbögen so weit vorstanden, und ihre Haut war von einem stumpfen Weiß, als ob eine Schicht Puder auf ihnen läge. Seine stechenden, blinzelnden Augen und diese komischen dreieckigen Nasenlöcher, die an einen Luchs erinnerten, standen keinen Augenblick still, im Unterschied zu der schweren unteren Gesichtshälfte mit den beiden bewegungslosen Furchen an den Mundwinkeln. Seine Kleidung schien sehr fremdländisch: dieses sehr blaue Hemd mit der leuchtend blauen Krawatte, der dunkelblaue Anzug mit den enorm weiten Hosen. Er war groß und schlank, und seine viereckigen Schultern bewegten sich herrlich, als er sich seinen Weg zwischen Frau Lewandowskis Plüschmöbeln suchte. Margot hatte ihn sich ganz anders vorgestellt, und nun saß sie mit fest verschränkten Armen da, fühlte sich recht betreten und unglücklich, während Müller sie mit den Augen verschlang. Mit kratzender Stimme fragte er sie nach ihrem Namen. Sie nannte ihn.
«Und ich bin der kleine Axel», sagte er mit kurzem Lachen, wandte sich dann brüsk von ihr ab und setzte seine Unterhaltung mit Frau Lewandowski fort; sie sprachen in aller Ruhe von Berliner Sehenswürdigkeiten, und er war von spöttischer Höflichkeit zu seiner Gastgeberin.
Dann verfiel er plötzlich in Schweigen, zündete sich eine Zigarette an, und während er ein winziges Stück Zigarettenpapier fortnahm, das an seiner vollen, sehr roten Lippe hängen geblieben war (wo war die goldene Spitze?), sagte er:
«Ein Einfall, Teuerste. Hier ist ein Parkettplatz für dieses Dingsda von Wagner; es wird Ihnen sicher gefallen. Also setzen Sie sich Ihr Hütchen auf und schieben Sie ab. Nehmen Sie sich ein Taxi, ich bezahle es auch.»
Frau Lewandowski dankte ihm, erwiderte aber mit einiger Würde, dass sie lieber zuhause bliebe.
«Kann ich mit Ihnen allein sprechen?», fragte Müller offensichtlich verärgert und stand auf.
«Nehmen Sie noch Kaffee», schlug die Dame kühl vor.