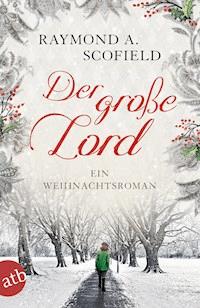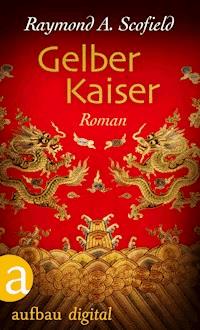
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Pakt von Peking.
Im China der dreißiger Jahre, einem zerrissenen, von Willkür beherrschten Land, wächst der Missionarssohn George Farlane heran. Als die Kulturrevolution das Reich ins Chaos stürzt, müssen Farlane und seine Familie fliehen. Doch die Vergangenheit holt sie ein, als vier mächtige alte Männer in Peking einen teuflischen Plan ausbrüten. Mit der geheimen Operation "Gelber Kaiser" wollen sie Taiwan endlich für China zurückerobern ...
Eine farbenprächtige China-Saga - erzählt von einem Kenner des Landes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Raymond A. Scofield
Raymond A. Scofield heißt eigentlich Gert Anhalt und ist Reporter beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Viele Jahre hat er für das ZDF aus China und Japan berichtet und zahlreiche Romane und Thriller verfasst, darunter »Der Jadepalast« und »Die Tibet-Verschwörung«. Zuletzt erschien von ihm der Bestseller: »Der große Lord« – eine Fortsetzung des Klassikers »Der kleine Lord« von Frances Hodgson Burnett.
Informationen zum Buch
Der Pakt von Peking.
Im China der dreißiger Jahre, einem zerrissenen, von Willkür beherrschten Land, wächst der Missionarssohn George Farlane heran. Als die Kulturrevolution das Reich ins Chaos stürzt, müssen Farlane und seine Familie fliehen. Doch die Vergangenheit holt sie ein, als vier mächtige alte Männer in Peking einen teuflischen Plan ausbrüten. Mit der geheimen Operation »Gelber Kaiser« wollen sie Taiwan endlich für China zurückerobern.
Eine farbenprächtige China-Saga – von einem Kenner des Landes erzählt.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Raymond A. Scofield
Gelber Kaiser
Roman
Für Valeria und Adrian
Von den fünfunddreißig Tugenden eines großen Feldherrn
ist diese die wichtigste: ein liebendes Herz.
Dschingis Khan
Inhaltsübersicht
Über Raymond A. Scofield
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Hauptpersonen
1. Kapitel Yiyang, Provinz Hunan, 1931
2. Kapitel Peking, 23. Dezember
3. Kapitel Yiyang, 1931
4. Kapitel Washington, D.C., 24. Dezember
5. Kapitel Yiyang, 1931
6. Kapitel Peking, 25. Dezember
7. Kapitel Malagash, Nova Scotia, 25. Dezember
8. Kapitel Yiyang, 1931
9. Kapitel Unweit Erlilan, mongolische Grenze, 25. Dezember
10. Kapitel Kaserne der Einheit Rote Fahne, Dafu, 26. Dezember
11. Kapitel Shenzhen, 26. Dezember
12. Kapitel Washington, D.C., 26. Dezember
13. Kapitel Changsha, 1931
14. Kapitel Peking, 29. Dezember
15. Kapitel Washington, D.C., 29. Dezember
16. Kapitel Shenzhen, 30. Dezember
17. Kapitel Dongqiao, 1949
18. Kapitel Peking, 30. Dezember
19. Kapitel Kaserne der Einheit Rote Fahne, Dafu, 30. Dezember
20. Kapitel Shenzhen, 30. Dezember
21. Kapitel Peking, 30. Dezember
22. Kapitel Dongqiao, 1960
23. Kapitel Shenzhen, 31. Dezember
24. Kapitel Washington, D.C., 31. Dezember
25. Kapitel Chicago, Illinois, 31. Dezember
26. Kapitel Peking, 1966
27. Kapitel Guangzhou, 1. Januar
28. Kapitel Peking, 1. Januar
29. Kapitel Auf dem Weg nach Dafu, 3. Januar
30. Kapitel Peking, 3. Januar
31. Kapitel Guangzhou, 3. Januar
32. Kapitel Peking, 3. Januar
33. Kapitel Langley, Virginia, 3. Januar
34. Kapitel Dafu, 3. Januar
35. Kapitel Hongkong, August 1966
36. Kapitel Taipeh, 3. Januar
37. Kapitel Washington, D.C., 3. Januar
38. Kapitel Dafu, Kaserne der Einheit Rote Fahne, 3. Januar
39. Kapitel Dongqiao, August 1966
40. Kapitel Taipeh, 3. Januar
41. Kapitel Peking, 3. Januar
42. Kapitel Berg Taman, südlich von Taipeh, 3. Januar
43. Kapitel Dafu, Kaserne der Einheit Rote Fahne, 3. Januar
44. Kapitel Washington, D.C., 3. Januar
45. Kapitel Im Luftkorridor 27 Ost, 3. Januar
46. Kapitel Peking, 4. Januar
Epilog Malagash, Nova Scotia, 25. Januar
Impressum
Die Hauptpersonen
Bao Ji
Leiter der Volkskommune 8. Juni
Flint Cartlin
Direktor der CIA
Chen Hong
Offizier der Einheit Rote Fahne
George Franklin Farlane
Kleiner Drache, Xiaolong, Sohn von John Farlane
John Farlane
China-Missionar
Stenton Farlane
Professor für chinesische Sprache
Sophia Wong-Farlane
Dolmetscherin im State Department, Frau von Stenton Farlane
Han Changfa
Nachfolger von Bao Ji
Sterling Hewett III
Unterstaatssekretär im State Department
Hong Fansen
Parteikader
Honghua
Rote Blume, Frau von George Franklin Farlane
General Huang Liao
Befehlshaber der Militärregion Shenyang
General Jiang
Befehlshaber der Kriegszone Guangdong
Lao Ding
Wettveranstalter in Peking, Buchbinder und kommunistischer Kader in Changsha
Laohu
»Tiger«, Fallschirmspringer
Jackie Lau Wong-Lam
Geschäftsmann in Shenzhen
Lee Tai Du
Berufskiller, »Der Schatten des Todes«
Li Ling
Stenton Farlanes Jugendliebe
Marco
C-17-Agent, Bereich: China
Professor Pan
Direktor des Militärhospitals Nummer 1
General Pun
Geheimdienstkoordinator Taiwans
Fred Summers
Bereichsleiter Fernost/CIA
General Wang Guoming
Großer Wang, Revolutionsveteran und Kriegsheld
Sherry Wu
Hostess in Peking
Xiao Han
»Rattenjunge« in Zhangs Folterkeller
General Zhang
Kriegsherr von Yiyang
Zhao Zhongwen
Wirtschaftslenker in Südchina
Zhou Hongjie
Sekretär von General Wang
1. Kapitel
Yiyang, Provinz Hunan, 1931
Die beiden Männer, die sich dem General widersetzt hatten, erregten am zweiten Tag ihres Sterbens kaum noch Aufsehen. Es waren Söldner von außerhalb. Niemand in der Stadt kannte ihre Namen, niemand bedauerte sie. Gestern hatte der Vollzug ihrer Strafe die übliche Menge von Neugierigen angelockt, die sich über das Schnappen und Gurgeln amüsiert hatten, nachdem den Männern die Stimmbänder durchtrennt worden waren. Heute aber schenkten ihnen nur noch müde Bauern auf dem Weg zum Markt flüchtig ihre Aufmerksamkeit, und nur die, die das Spielen nicht lassen konnten, schlossen Wetten darüber ab, welcher der beiden wohl als Erster den Geist aufgeben würde. Der raffinierte Foltermeister des Generals hatte ihnen die Haut an Armen und Beinen abgezogen und sie draußen an der gewohnten Stelle unweit des Lagers an Pfählen festgekettet, damit sie dem zerlumpten Heer ein mahnendes Beispiel abgeben konnten. Aber um diese Jahreszeit waren die Söldner nicht mehr sehr empfänglich für Ermahnungen. Einen Monat vor der Reisernte waren die Bäuche der Krieger genauso leer wie die Speicher der Bauern. Unter diesen Umständen ließ die ohnehin niedrige Disziplin der Truppe immer mehr zu wünschen übrig. Die grausame Strafe, die der General den beiden Männern zugedacht hatte, würde keinen vom Plündern, Rauben und Morden abhalten, und so starben die Verurteilten eines qualvollen, langsamen und dabei sinnlosen Todes.
Nur einem stiegen die Tränen des Schmerzes und der Wut in die Augen, als er die Verstümmelten erblickte. Der Mann hieß John Farlane und stapfte voller Empörung zurück in die Stadt, geradewegs zur Residenz des Generals. Es war dies das größte und würdevollste Gebäude in Yiyang, ehemals der Amtssitz des kaiserlichen Mandarins. Umstanden von schattenspendenden Platanen beherrschte es vom Hügel aus die Stadt mit seinem ausladenden Dach, dessen Drachenziegel die bösen Geister fern hielten. Von hier oben aus konnte man ganz Yiyang überblicken, wuchernd und hässlich wie ein Geschwür, das die Landschaft befallen hatte, mit ineinander verzahnten Dächern, den in Unrat und faulendem Kompost versinkenden Gassen, eingepfercht und umgeben vom gewaltigen Ring der jahrhundertealten Stadtmauer.
John Farlane durchmaß mit entschlossenen Schritten den weitläufigen Innenhof, an Stallknechten und Wächtern vorbei zum leuchtend roten Eingangstor und verlangte, den Kriegsherrn zu sprechen.
»Der ehrwürdige Herr General ist sehr beschäftigt«, ließ ihn der Wachposten wissen. »Kommen Sie ein andermal wieder.«
»Ich habe mit ihm zu sprechen!«, schnaubte Farlane und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein stoppelkurzes, blondes Haar hatte ihm bei den Chinesen den Namen yangzimao eingetragen – ausländischer Strohkopf. Farlane wusste sehr wohl, wie viel Spott und Verachtung in diesem Namen mitklang. Aber das war ihm nicht wichtig. Wichtig war allein seine Aufgabe, das Wort Gottes in dieses gottverlassene, schmutzige Land zu bringen und seinen Teil dazu beizutragen, dreihundert Millionen Seelen vor der ewigen Verdammnis zu retten. Und die Menschen, auf die es ihm ankam, nannten ihn nicht yangzimao. Sie nannten ihn mushi – Meister Hirte.
Der Wächter ließ sich von dem jungen, aufgeregten Amerikaner nicht beeindrucken und glotzte stur durch den Fremden hindurch ins Leere.
»Sie werden es bereuen, wenn Sie mich nicht sofort zum General durchlassen«, grollte Farlane und drohte dem Mann mit erhobener Faust.
»Lao Lu! Lass den heiligen Mann herein!«, dröhnte aus dem Innern des Gebäudes der kratzige Bass des Kriegsherrn und Farlane brauste trotzig an dem Wächter vorbei in die Empfangshalle. Der General hockte breit auf seinem Stuhl aus Edelholz, der mit Schnitzereien von feuerspeienden Drachen und kämpfenden Tigern verziert war.
Wie der König der Kröten, dachte Farlane angewidert. Der Anblick des dickleibigen Chinesen ekelte ihn. General Zhang mochte nur wenig älter sein als der Amerikaner, vielleicht dreißig Jahre alt. Aber seine enorme Körperfülle täuschte das Auge und ließ ihn viele Jahre älter erscheinen. Der träge Fettwanst musterte den aufgebrachten Missionar aus Augen, in denen es heiter funkelte. Er kaute dabei schmatzend auf einer Ginsengwurzel, die nach dem Dafürhalten seines Leibarztes Langlebigkeit und Manneskraft spendete. Das Hemd seiner operettenhaften Uniform, die er sich nach dem Muster eines Gemäldes von Napoleon hatte anfertigen lassen, war bis hinunter zum Bauchnabel geöffnet. Farlane erblickte wabbelnde Speckringe.
Der Missionar war lange genug in China, um zu wissen, dass er einen unverzeihlichen Fehler beging und dass er im Begriff war, vor dem General sein Gesicht zu verlieren. Er wusste, dass es in diesem Land zwecklos und sogar gefährlich war, die eiserne, gleichmütige Haltung aufzugeben und seine wahren Gefühle bloßzulegen. Aber das war ihm jetzt einerlei. Dieser gemeine Strolch, der ihn mit seinem überheblichen Blick verhöhnte, hatte ihn hintergangen, und John Farlane war kein Mann, der seinen Zorn verbergen konnte.
»Sie haben Ihr Versprechen gebrochen«, schrie er mit hochrotem Kopf. Wie eine von einem plötzlichen Windstoß ausgeblasene Kerze erlosch der belustigte Ausdruck in des Generals Augen. Er neigte den Kopf leicht zur Seite und spuckte den Wurzelsaft in hohem Bogen auf den steinernen Fußboden.
»Ich weiß nicht, warum Sie sich so ereifern, heiliger Mann.«
Seine Kaltschnäuzigkeit und der Ausdruck »heiliger Mann«, mit dem der General ihn in letzter Zeit gerne neckte, brachten den Mann Gottes zur Weißglut.
»Ich war draußen am Lager!« Farlanes Stimme überschlug sich vor Empörung. »Einer der Männer, die dort sterben, gehört zu mir. Sie hatten kein Recht, ihm das Leben zu nehmen!«
Mit einer Schnelligkeit, die schon vielen seiner Feinde zum Verhängnis geworden war, weil niemand seinem fetten Leib eine derartige Kraft und Geschmeidigkeit zugetraut hätte, sprang der Kriegsherr aus seinem Stuhl auf und setzte Farlane seinen Dolch an die Halsschlagader, noch bevor dieser seinen Satz fertig gesprochen hatte. Das Gesicht des Generals kam bis auf einen Zentimeter an das des Missionars heran, der faulige Wurzelatem drang in Farlanes Nase und erfüllte ihn mit Übelkeit und Angst. Er hatte die heftige Reaktion des Chinesen nicht vorausgesehen und bereute sein unbeherrschtes Verhalten. Er bereute in diesem Augenblick überhaupt alles, was er getan hatte. Dass er diesem Mann jemals geglaubt, jemals vertraut hatte. Aber jetzt kamen Reue und Einsicht zu spät. Ohne eine Miene zu verziehen, bohrte der General die Spitze seines Dolches direkt über Farlanes weißem Kragen in seine weiße Haut. Der Unhold würde ihn hier und auf der Stelle töten! Farlane schloss bibbernd die Augen und betete, dass wenigstens seine Frau und sein kleiner Sohn vom Zorn des Wüterichs verschont bleiben würden.
»Sagen Sie so etwas nie wieder«, knurrte der General mit zusammengebissenen Zähnen. »Ich habe hier alle Rechte, verstehen Sie, was ich sage? Ich habe das Recht über Leben und Tod. Auch über Ihr Leben und das Leben Ihrer Familie. Sagen Sie nie, nie wieder, dass Ihnen hier irgendetwas gehört. Ihnen gehört nichts. Nicht einmal Ihr eigener Hals. Haben Sie das verstanden, Sie kleiner heiliger Mann?«
Er setzte den Dolch ab.
An der Klinge sah Farlane einen Tropfen seines eigenen Blutes hinunterrinnen. Seine Hände zitterten, seine Knie und auch seine Seele bebten. In einem fernen Winkel seines Gehirns hörte Farlane eine Stimme, die ihn dazu aufforderte, seine Ehre, seinen Glauben, seine Religion zu verteidigen und zu retten. Aber er konnte es nicht. John Farlane, der erst fünfundzwanzig Jahre alt war, erkannte in diesem Moment, als er sein Blut über den kalten Stahl einer chinesischen Messerklinge laufen sah, dass er zu sehr an seinem Leben hing und nicht bereit war, für seinen Glauben zu sterben. Das zerbrach ihn in einer Sekunde wie einen Strohhalm, und sein Peiniger spürte es.
»Ich habe verstanden«, brachte Farlane hervor.
»Ich habe verstanden – und …?«
»Ich habe verstanden, ehrwürdiger Herr General.«
Der Kriegsherr rammte seinen Dolch in einen der mächtigen Holzpfeiler, die das schwere Ziegeldach trugen, und versetzte Farlane so einen Hieb auf die Schulter, dass er zwei Schritte nach vorne stolperte.
»Haben Sie mein Haus mit einem Pinkelloch verwechselt, mein frommer Freund?«, polterte Zhang nun plötzlich frohgemut und deutete mit feistem Lachen auf den dunklen Fleck, der sich auf der Hose des Kirchenmannes ausbreitete. Farlane stand mit gesenktem Haupt da und schluchzte vor Erleichterung und Scham.
»Ich bin etwas verwundert über Sie, heiliger Mann. Sie haben mir doch Ihr Ehrenwort gegeben, dass die Fracht aus dem schönen Amerika noch in diesem Monat in Shanghai eintreffen wird. Aber meine Leute dort warten immer noch vergebens. Sie wissen, dass ich eine beträchtliche Stange Gold und Silber im Voraus bezahlt habe, das ich mir bei den geizigen Blutsaugern leihen musste, die sich Kaufleute schimpfen.«
»Ich bin ganz sicher, dass Ihre Geduld bald belohnt wird«, flüsterte Farlane und wünschte, er hätte sich niemals auf den faulen Handel mit diesem Teufel eingelassen.
Wie oft hatte er gebetet, dass sein ehrgeiziges Vorhaben gelingen möge? Aber nun hatte Gott ihn zurechtgewiesen und ihm gezeigt, dass mit dem Tod unschuldiger Menschen keine Seelen gewonnen werden konnten.
In seinem Hochmut hatte John Farlane, der jüngste Chinamissionar in der Geschichte der presbyterianischen Bekehrungskirche, nämlich geglaubt, er könne die größte Gemeinde in China aufbauen, indem er sich mit dem General verbündete. Überall in diesem Land, so wusste er, arrangierten sich die ausländischen Missionare mit den örtlichen Machthabern. In manchen Gebieten waren sogar die Kriegsherren selbst schon zum Glauben übergetreten. Als Farlane vor sechs Monaten in Yiyang eintraf und seinen Antrittsbesuch bei General Zhang machte, da hatte ihn dieser hilfsbereit und überaus freundlich empfangen, hatte ihn zu seiner Arbeit ausdrücklich ermuntert und gestanden, dass er selbst das Christentum studiere und sich sogar mit dem Gedanken trage, die Taufe zu empfangen. Das Hospital, die Schule und das Waisenhaus genossen seine ausdrückliche Unterstützung.
Trotz seines abstoßenden und kriegerischen Aussehens war General Zhang dem jungen Missionar als aufgeklärter und gebildeter Mann erschienen, der seitenweise aus den Werken Rousseaus und Tocquevilles zitieren konnte. Und so verbrachte Farlane, der als einziger Ausländer weit und breit kultivierte Konversation schmerzlich vermisste, manchen Abend in der Gesellschaft des Kriegsherren bei angeregten Gesprächen über Gott, Amerika, das Zhang sehr bewunderte, und über die ungewisse Zukunft Chinas.
Es war bei einer dieser abendlichen Unterhaltungen, als General Zhang ihm ein überraschendes Angebot machte.
»Es wird bald Krieg geben«, hatte Zhang düster prophezeit. »Der gottlose Feng Jian sammelt Truppen aus Räubern und Briganten und bereitet einen Angriff auf Yiyang vor. Nach meinen Berechnungen wird er spätestens im Herbst so weit sein, dass er mich besiegen kann.«
Farlane, der sich nicht für Politik interessierte und sich nicht so gut auskannte im Machtgefüge des zerrissenen China, musste sich erklären lassen, dass General Feng Jian ein rücksichtsloser Banditenführer war, der die Gegend östlich von Yiyang beherrschte und bei seinen Raubzügen und Eroberungen mit ausgesuchter Grausamkeit vorging. Damals wusste der Missionar noch nicht, dass dies auf beinahe jeden Kriegsherren im Lande zutraf, insbesondere auch auf General Zhang selbst. »Ich kann nicht für Ihren Schutz garantieren« hatte Zhang dem Missionar eröffnet. »Das Beste wäre, wenn Sie und Ihre Familie Yiyang im Spätsommer verließen und sich nach Changsha oder besser noch in Shanghai in Sicherheit brächten.«
»Ausgeschlossen!«, hatte Farlane widersprochen. »Ich habe doch meine Arbeit hier gerade erst begonnen. Ich wollte Sie eben bitten, mir beim Bau einer neuen Kirche behilflich zu sein. Unsere bisherigen Räume werden allmählich zu klein.«
»Das wäre ich sehr gerne. Aber ich muss alle meine Kräfte für den Kampf mit Feng Jian aufsparen. Ich werde meinen Besitz nicht widerstandslos in die schmutzigen Hände dieses Barbaren fallen lassen.«
Dann hatte Farlane, genau wie es der General vorausgesehen hatte, die schicksalhafte Frage gestellt: »Kann ich denn irgendetwas für Sie tun?«
»Ich brauche moderne Waffen«, seufzte Zhang nach einer langen Pause. »Die besten, die ich für Geld bekommen kann. Kanonen und Maschinengewehre. Damit wäre uns der Sieg sicher. Aber ich bin nicht viel in der Welt herumgekommen und ich weiß nicht, wo und wie ich die Waffen bekommen kann.«
Farlane hatte sich tatsächlich gefreut, dem Kriegsherrn diesen Dienst zu erweisen. Er stellte über alte Bekannte Kontakt zu einem der großen Waffenhändler an der amerikanischen Ostküste her und fädelte so die Lieferung von zehn französischen 75-Millimeter-Kanonen vom Typ Maxim und siebenundzwanzig Browning-Maschinengewehren nebst reichlich Munition ein. Im Gegenzug, das hatte der dankbare General gelobt, würde er nicht nur den Bau einer neuen Kirche – einer regelrechten Kathedrale – unterstützen. Er stellte auch die Angehörigen von Farlanes Gemeinde mit einem Edikt unter seinen persönlichen Schutz. Mitglieder der Kirche würden nicht verfolgt und nicht gefoltert, versprach der dankbare General. Wer von seinen Soldaten sich an Mitgliedern der Kirche vergriff, der würde unverzüglich und ohne jede Milde bestraft, versicherte der General. Kaum war diese Weisung bekannt gemacht, da stieg die Zahl der Gläubigen in Yiyang sprunghaft an. Gewiss, viele waren darunter, die nicht in die Kirche kamen, um das Wort Gottes zu hören, sondern allein wegen der Sicherheit, die die Kirche verhieß. Aber das war dem Hirten nicht wichtig. Stolz meldete er nach Boston: »Die Kirche von Yiyang hat in dieser Woche ihr zwanzigtausendstes Mitglied getauft. Wir bauen zwei neue Seminare für Laienprediger und haben in zahlreichen Stadtteilen neue, provisorische Gebetshäuser errichtet. In Höfen, Speichern und sogar in einem Wirtshaus. Auf offener Straße und unter freiem Himmel kommen die Menschen zusammen, um die Frohe Botschaft zu hören. Mit dem Bau einer großen Kirche wird in Kürze begonnen. Sogar aus den Reihen der Soldaten haben wir großen Zulauf.«
Mit Anerkennung hatten seine presbyterianischen Glaubensbrüder und Vorgesetzten in Boston Farlanes euphorische Berichte entgegengenommen. Sein Bezirk, obwohl er ihn erst vor so kurzer Zeit übernommen hatte, wurde in Kirchenzeitungen als Musterbeispiel hervorgehoben. Selbst altgediente China-Missionare drückten ihm in glühenden Briefen ihre Bewunderung aus und suchten seinen Rat. Von dem verrotteten Geschäft aber, vom Pakt mit dem Teufel, der dies alles erst möglich gemacht hatte, wusste niemand außer Farlane und dem General. Und dieser hatte sich heute als gewissenloser Lügner und Verräter entpuppt.
Einer der Gemarterten an der Hinrichtungsstätte draußen vor der Stadt war Lu Ping gewesen, ein junger, heller Unterführer in Zhangs Heer, ein gläubiger Christ und vielversprechender Laienprediger, der viele seiner Kameraden zum Glauben gebracht und den Farlane persönlich sehr gemocht hatte. Jetzt hing er, in blasphemischer Weise verstümmelt, an einem Pfahl. Und Farlane musste erkennen, dass das Schutzversprechen des Generals nichts weiter war als ein Hohn. Es sollte ihn einlullen, damit er dem gefährlichen Mörder noch mehr Todeswerkzeuge beschaffte.
»Wenn meine Waffen nicht rechtzeitig eintreffen, werde ich Sie persönlich zur Rechenschaft ziehen«, drohte der General. Seine Worte standen im Widerspruch zu seinem heiteren Gesicht. »Sie können sich jetzt eine frische Hose anziehen, heiliger Mann. Und: Kommen Sie nie wieder in mein Haus ohne meine ausdrückliche Einladung, verstanden?«
»Ich habe verstanden, ehrwürdiger General. Darf ich, bevor ich gehe, noch eine Bitte vorbringen?«
»Aber selbstverständlich. Sie wissen doch: Ich erfülle Ihnen jeden Wunsch.«
»Einer der Männer dort draußen an der Hinrichtungsstätte … er gehörte zu meiner Gemeinde. Darf ich in aller Demut um die Erlaubnis bitten, seinen Leichnam in geweihter Erde auf unserem Friedhof zu bestatten?«
General Zhang verzog seine fleischigen Lippen zu einem breiten hässlichen Grinsen. »Der Mann, von dem Sie sprechen, war ein Aufrührer. Er hat versucht, meine Truppe zu spalten! Er gehörte nicht nur Ihrer, sondern noch einer ganz anderen, gefährlichen Gemeinde an. Den Kommunisten. Er hat tatsächlich versucht, meine Männer dazu zu überreden, einer Bauernarmee beizutreten!« Ein heftiger Lachanfall schüttelte seinen massigen Leib. »Hat man so was schon gehört? Eine Bauernarmee! Bauern sind doch nichts weiter als Vieh. Haben Sie schon mal was von einer Rinderarmee gehört?« Dann wurde er plötzlich wieder ernst. »Der Mann bleibt, wo er ist. Die Würmer und Maden sollen sein Fleisch verzehren und die Fliegen sein Blut trinken. So sterben die Soldaten der Bauernarmee. Vielleicht – ich sage vielleicht! – können Sie hinterher seine Knochen einsammeln und verscharren, wo immer Sie wollen. Aber nur, wenn Ihnen die streunenden Hunde nicht zuvorkommen.«
»Danke, ehrwürdiger General.«
»Sieh mal da, Großer Wang!« Der kleine Junge konnte seinen Blick nicht von den beiden Männern losreißen und starrte wie gebannt auf ihre Arme und Beine, die schwarz waren von Insekten. »Ich habe noch niemals so viele Fliegen auf einem Haufen gesehen!«
Sein chinesischer Begleiter, ein ungewöhnlich hoch gewachsener junger Mann von vielleicht zwanzig Jahren mit ernstem Gesicht, versuchte vergebens, den Jungen für etwas anderes als die beiden Gefolterten zu interessieren. Wenn der Kleine seiner Mutter berichten würde, dass sie trotz ihres strengen Verbotes wieder an der Hinrichtungsstätte gewesen waren, würde sie den Großen Wang mit harten Worten kritisieren. Der Junge war noch zu klein, um zu verstehen, was er sah. Abgetrennte Köpfe belustigten ihn, zerschmetterte, zerhackte Körper erregten seine Neugierde.
Beim Abendessen würde er berichten, wie lustig das ausgesehen hatte, zwei Männer mit Armen und Beinen aus schwarzen Fliegen.
»Lass uns nach Hause gehen, Xiaolong. Es ist die Zeit der Mittagshitze.« So nannten sie den Sohn des Fremden, Xiaolong – Kleiner Drache. Denn er war wild und unbezähmbar. Er war kaum sechs Jahre alt, blond und blauäugig wie sein Vater, der Missionar.
»Meinst du, sie leiden Schmerzen?«, fragte der Junge, nun ernst. Anders als sein Vater, der sein Chinesisch auf der Schule studiert hatte und die reinste, steife Hochsprache beherrschte, hatte der Junge erst hier die fremde Sprache erlernt. Spielend und ohne Anstrengung dank des Umgangs mit seinem Kindermädchen und später dank Da Wang, seinem Beschützer. Der Kleine Drache sprach den trägen, lispelnden Akzent der Bauern aus Hunan, den sein Vater kaum verstand. Vielleicht lag das daran, dass der Kleine mit Vorliebe dieselben Speisen verzehrte wie sie.
Die gefährlichen, roten Chilischoten, die getrocknet und zerhackt jede Fleischsoße und jede Nudelbrühe in ein Fegefeuer für den Gaumen verwandelten, wie der Missionar es ausdrückte – der Kleine Drache konnte sie löffelweise über seine Mahlzeiten streuen.
»Ja, sie leiden«, antwortete Da Wang und sein Blick wurde kalt und böse, als er das sagte. »Komm jetzt. Du hast genug gesehen. Lass uns zurück in die Stadt gehen.«
Aber der Sechsjährige ließ nicht locker. »Gibt es denn keinen Weg, ihnen zu helfen?«
»Doch, den gibt es.« Wang schob den Jungen in den Schatten eines Baumes und ließ ihn auf einem großen Stein Platz nehmen.
»Warte hier und sieh nicht zu mir. Hast du mich verstanden?«
»Warum nicht?«
»Du sollst das nicht sehen.«
»Wirst du sie totschießen?« Der Junge deutete auf die Pistole, die Da Wang in seinem Gürtel trug. Er war der einzige Zivilist in Yiyang, dem das Tragen einer Waffe erlaubt war, um den Sohn des ausländischen Herrn vor betrunkenen Soldaten und Verbrechern zu beschützen. Er hatte seine Waffe noch nie gebraucht. Bis jetzt.
»Bleib hier sitzen und sieh mir nicht zu«, wiederholte der Große Wang und drohte mit erhobenem Zeigefinger. Dann ging er zurück zu der Stelle, an der die Männer festgekettet waren.
Ein Schwarm von Fliegen erhob sich mit einem unheimlichen Summen, als Wang näher herantrat und die Pistole aus seinem Gürtel zog. Der Gestank war überwältigend. Die Köpfe der Männer hingen matt zur Seite, beide hatten ihre Augen geschlossen. Die senkrechten Messerschnitte, mit denen der Foltermeister ihre Kehlköpfe und Stimmbänder entfernt hatte, damit sie nicht schreien konnten, waren grob vernäht und mit Heilpflanzen behandelt worden, denn den beiden sollte die Gnade eines schnellen Todes durch Verbluten nicht zuteil werden. Da Wang konnte in den bloßliegenden Adern ihrer Arme und Beine das Blut pulsieren sehen. Beide waren sie junge und kräftige Männer. Sie würden gewiss noch einen Tag, wenn nicht sogar noch länger hier hängen, bevor der Tod sie erlöste.
»Lu Ping«, flüsterte Wang sanft, als wecke er einen Schlafenden. Unendlich langsam und mühevoll hob der Angesprochene seinen Kopf. Sein Blick durch die halb geöffneten Lider lag jenseits von Verstehen und Schmerz. Seine aufgesprungenen Lippen bewegten sich, als wolle er sprechen. Doch seine Zunge, längst ausgedörrt und aufgedunsen, verweigerte sich ihm.
»Wir werden dich nicht vergessen«, sagte Wang und setzte dem Märtyrer den Lauf seiner Waffe an die Stirn. Ohne ein weiteres Wort drückte er ab und befreite dann auch den zweiten Mann, den er nicht kannte, von seiner Höllenqual.
»Meinst du, es hat ihnen wehgetan?«, begrüßte ihn der Kleine Drache.
»Ich habe doch gesagt, du sollst nicht zusehen!«, zürnte Da Wang.
»Ich habe gar nicht zugesehen!«, log der Kleine. »Ich habe nur das Knallen gehört. Du hast nicht gesagt, dass ich nicht zuhören darf.«
Wang nahm ihn bei der Hand und zog ihn den Weg hinunter in die Stadt.
»Du darfst keinem Menschen erzählen, dass wir hier waren und was ich getan habe!«, sagte der Leibwächter streng. »Auch nicht deinen Eltern.«
»Aber warum denn nicht? Du hast doch nichts Böses getan!«
»Ich habe dem General etwas weggenommen, das ihm sehr wertvoll ist. Wenn er erfährt, wer das getan hat, wird er mich bestrafen. Es gibt in seinem Haus einen Keller, aus dem noch nie jemand lebend herausgekommen ist.«
Als er das sagte, meinte George in seiner Stimme etwas zu hören, das er von Da Wang nicht kannte.
Furcht.
»Was hast du ihm denn weggenommen?«
»Den Tod.«
»Bist du ein Feind des Generals?«
»Stell nicht so viele Fragen!«
»Aber nun sag es mir doch. Ich kann den Fettkloß auch nicht leiden!«
»Du bist noch ein Kind, Kleiner Drache. Misch dich nicht in die Angelegenheiten der Erwachsenen ein.«
Beleidigt schwieg der Junge, bis er seine Neugier nicht mehr zügeln konnte.
»Meinst du, es hat ihnen wehgetan?«
»Nein.«
»Aber ihre Köpfe sind auseinandergeflogen, und alles, was drin war, ist in der Gegend herumgespritzt!«
Da Wang strafte ihn mit einem bitterbösen Blick. »Wenn du nicht zugesehen hast, wie kannst du das dann wissen? Hat dir dein Vater denn nie gesagt, dass Lügen kurze Beine haben? Man kommt nicht weit mit Lügen. Da habe ich dich schon wieder bei einer Lüge ertappt.«
George Franklin Farlane bewunderte ihn sehr, den Großen Wang. Sein Vater durchschaute seine kleinen Lügen niemals. Aber Da Wang konnte man nichts vormachen. Der war wachsam und schlau wie ein Fuchs.
Schweigend trottete der Sohn des Missionars neben seinem Beschützer her durch die spätsommerliche Landschaft Hunans. In den goldfarbenen Reisfeldern arbeiteten die mit nicht viel mehr als Fetzen bekleideten Bauern. Magere, sonnenverbrannte Gesichter unter breiten Strohhüten. Einzelne, aus Lehm errichtete Gehöfte schmiegten sich schutzsuchend in den Schatten der Pinienhaine. Schieferfarbene Wasserbüffel glotzten dem ungleichen Paar mit blöden Blicken hinterher, bis es hinter den Stadtmauern von Yiyang verschwunden war.
2. Kapitel
Peking, 23. Dezember
Die Stimmung in der Delegation war gedrückt. Keiner verlor ein Wort, als sie ihre Sitze in der ersten Klasse einnahmen. Das Lächeln der Stewardessen, die offenbar die Nachrichten nicht verfolgten, verpuffte unerwidert. Sophia Wong, die Dolmetscherin, hatte ihr Gesicht hinter irgendwelchen Unterlagen verborgen. Olweight Sarsikian, Referatsleiter Fernost, saß neben ihr und starrte beleidigt vor sich hin.
Unterstaatssekretär Sterling Hewett III faltete mit einer geübten, ruckartigen Handbewegung die heutige Ausgabe der China Daily zusammen. »Chinesisch-amerikanische Kurzgespräche erfolgreich beendet«, spottete das englischsprachige Staatsorgan auf der Titelseite. Hewett blickte aus dem Fenster der Boeing 747, die im Steigflug über den Sommerpalast hinwegglitt. Es war ein klarer Winternachmittag, und er konnte jedes Detail der riesigen Parkanlage erkennen, die er so oft durchwandert hatte. Den Kunming-See, die Pagoden und Pavillons, den Berg des langen Lebens, den Garten der Freude und Harmonie. Im Benennen von Dingen waren die Chinesen schon immer große Meister gewesen, dachte er. Die glanzvollsten und blumigsten Namen waren natürlich den kaiserlichen Dingen vorbehalten. Die Herrscher hatten in China schon immer alles Schöne für sich beansprucht, sogar die schönsten Worte. Die Mächtigen besaßen alle Harmonie, Wohlgerüche und Langlebigkeit. Das einfache Volk aber lebte kurz in Streit und Gestank wie eh und je.
Große Worte, dachte er bitter. Sie machten gerne große Worte, die Chinesen. Aber dahinter steckte nichts. Die chinesisch-amerikanischen Kurzgespräche waren ein Fiasko.
»Haben Sie das hier gelesen, Sir?«, ließ sich Williams vernehmen, sein eifriger Referent, der neben ihm saß und sich gleich beim Start in die Lektüre der Pressemappe vertieft hatte, die ihm die zuständige Abteilung der US-Botschaft aus den Artikeln der wichtigsten amerikanischen Tageszeitungen zusammengestellt hatte. Unterstaatssekretär Hewett wandte ihm sein Gesicht zu und zog milde interessiert seine aristokratischen Augenbrauen zusammen.
»Wird mal wieder Zeit, dass wir diesen Zecken von der Washington Post kräftig eins auf den Deckel geben, Sir«, zischte es aus Williams’ bebrilltem Strebergesicht, das, verkniffen, auf lächerliche Weise ernst wirkte. »Sehen Sie doch mal hier: ›Unterstaatssekretär Hewett lässt sich in Peking vorführen wie ein tapsiger Tanzbär.‹«
»Der Kommentar ist mir bekannt«, unterbrach ihn der Diplomat frostig. »Sie brauchen ihn mir nicht noch einmal vorzulesen.«
»Gewiss. Ich meine ja nur, Sir. Was zu weit geht, geht zu weit!«
»Ja. Sicher …« Dabei hatte der bissige Kommentator den Nagel auf den Kopf getroffen. Hewett hatte auf ganzer Linie versagt. Der Präsident hatte ihn als Sonderunterhändler nach Peking entsandt, um der dortigen Führung eine chinesische Lieferung von Nukleartechnologie an Pakistan auszureden. Es ging um irgendwelche Magnetkolben, deren Funktion weder Hewett noch irgendeiner in seiner Delegation genau verstand. Sie waren als Teile für ein Atomkraftwerk deklariert, aber sie konnten, das sagte die CIA, auch für den Bau von Kernwaffen verwendet werden. Der Kongress, der ohnehin unablässig China im Visier hatte, war hysterisch geworden, die Presse sprang dankbar auf, die indische Regierung dachte laut über einen präventiven Erstschlag nach, kurz, die US-Administration musste dringend etwas unternehmen. Hewett wurde losgeschickt und sollte die Chinesen von dem anrüchigen Deal abbringen.
»Als ob das jemals was gebracht hätte«, hatte Hewett gegenüber Außenminister Hooper geseufzt. »Es wissen doch nun inzwischen wirklich alle, was passiert. Wenn wir sie bitten, das Zeug nicht zu liefern, dann werden sie es erst recht tun. Selbst dann, wenn die Pakistani es inzwischen abbestellt hätten! Nur um aller Welt und vor allem sich selbst zu zeigen, dass sie sich von Amerika nichts sagen lassen!«
Doch der Außenminister ließ in dieser Sache keinen Widerspruch gelten. »Der Präsident hat diese Mission persönlich angeordnet, Sterling. Tun Sie Ihr Bestes!« Dann war der Minister davongesegelt, um sich für einen Fernsehauftritt in Meet the Press schminken zu lassen und über den Nahen Osten zu schwadronieren, von dem er auch nichts verstand.
Auch Sterling Hewett III verstand die Chinesen nicht. Aber er kannte sie. Im Krieg, als junger Pilot, hatte er ein paar Mal mit den legendären »Flying Tigers« Nachschub für Chiang Kai-sheks Truppen aus Indien in die Provinz Yunnan geflogen. Aus dieser Zeit hatte er viele enge Kontakte zu den Nationalchinesen in Taiwan, wo er später seine diplomatische Laufbahn begann. Er hatte die chinesische Sprache gründlich erlernt und war einer der Diplomaten, die Präsident Nixons epochemachenden Chinabesuch im Jahr 1972 vorbereitet hatten. Danach war er zwei Jahre Botschafter in Peking gewesen. Hewett kannte die Chinesen wie sonst kaum einer in Washington und er wusste von vornherein, dass seine Reise nichts bewirken würde. Aber dass sie zu einem derartigen Eklat führen würde, das hatte nicht einmal er vorhergesehen.
Was, zum Teufel, war bloß in die Chinesen gefahren?
Sie hatten ihn, wie der Kommentator der Washington Post bemerkt hatte, tatsächlich vorgeführt. Aber das war nicht alles. Sie hatten ihn gedemütigt wie noch keinen hochrangigen Delegierten zuvor. Sie ließen ihn in der Großen Halle des Volkes warten. Sie ließen – entgegen allen Gepflogenheiten – die amerikanische Presse in den Warteraum! Die Reporter waren über ihn hergefallen wie eine Horde ausgehungerter Hyänen. Kameralichter hatten ihn geblendet. Die Reporter hatten ihn mit hochsensiblen Fragen überrumpelt, die er alle mit einem hilflosen »Wir werden unser Bestes tun!« beantwortete. Genauso erschien Unterstaatssekretär Sterling Hewett III in den amerikanischen Abendnachrichten. Eine lange, dürre Gestalt mit etwas zu zerknittertem Anzug und etwas zu wirren, ergrauten Haaren. Irritiert in die Kameras blinzelnd wie eine Vogelscheuche, die selbst Angst hatte. Schon da hätte er einen Schlussstrich ziehen und zornig abbrausen müssen – das wusste er jetzt. Aber er wollte ihnen nicht den Triumph gönnen, ihn brüskiert zu haben. Er wusste, wie wichtig in China das »Gesicht« war und er wollte vor den Chinesen nicht sein Gesicht verlieren.
Ein unverzeihlicher Fehler. Denn es war noch schlimmer gekommen.
Mit halbstündiger Verspätung erschien irgendein unbekannter Vizeminister aus dem Ministerium für Technologie. Der Außenminister, den Hewett eigentlich zu sprechen gewünscht hatte, sei leider verhindert, wurde ihm lapidar mitgeteilt. Hewett hatte eine Weile mit wachsender Ungeduld zugehört, wie der Technologievizeminister einen schwer verständlichen Vortrag über Atomtechnologie hielt, und war überhaupt nicht zu Wort gekommen. Nach vierzig Minuten beendete er abrupt das »Kurzgespräch« und ließ sich durch einen Hinterausgang zu seiner wartenden Limousine lotsen. Aber da warteten bereits die Presseleute, die aus unbekannter Quelle einen heißen Tipp bekommen hatten, mit laufenden Kameras, und Sterling Hewett III sah nun vollends aus wie ein Versager – noch dazu einer, der sich heimlich verdrücken will. In vierzig Jahren Dienst im State Department, in vierzig Jahren voller schwieriger, kitzliger und manchmal unmöglicher Missionen war ihm solches nie widerfahren. Das galt nicht nur für ihn: Kein anderer amerikanischer Diplomat war jemals derartig behandelt worden. Selbst die Iraker, die Iraner, die Syrer und sogar die Libyer hatten sich etwas Vergleichbares nie erlaubt. Selbst ihnen war die Integrität und Würde eines Sonderbotschafters heilig gewesen. In der Welt der Diplomatie, in der er zu Hause war, kam solches einer schallenden Ohrfeige gleich, oder, wie er selbst es bitter nannte, einem »Tritt in die Eier«.
Am Abend, in der Suite 2002 des China World Hotel, nachdem er den Außenminister am Telefon vom unerfreulichen Verlauf seiner Reise unterrichtet hatte, der allerdings die wesentliche Nachricht bereits aus dem Fernsehen kannte, goss sich Hewett einen doppelten Whisky ein und blickte aus dem Fenster hinab auf das nächtliche Peking. Erstaunt stellte er fest, dass Chinas Hauptstadt heute ein Lichtermeer war. Damals, als er hier Botschafter war und als Ehrengast zur Einweihung des benachbarten China World Trade Centre geladen war, da hatte man von hier oben auf eine relativ trostlose Lichterwüste geblickt. Die wenigen bunten Tafeln waren einem sofort ins Auge gefallen, alles andere versank in breiiger, sozialistischer Tristesse. Aber jetzt blinkten und strahlten Werbebotschaften, bekannte und unbekannte Slogans und Firmenlogos von Dächern und Hauswänden, der Autoverkehr wälzte sich zähflüssig durch weltstädtisch verstopfte Straßen, mächtige Flutlichter beleuchteten unzählige Hochhausbaustellen, auf denen rund um die Uhr gearbeitet wurde. Selbst in den fernen Vororten, einst nicht mehr als eine graue Masse einstöckiger Häuser, waren mächtige Wolkenkratzer emporgewachsen, deren rote Dachlichter in einem unergündlichen Takt aufleuchteten. Eine geschlagene Stunde stand Hewett nachdenklich am Fenster, dann setzte er sich an den Schreibtisch und verfasste sein Rücktrittsgesuch. Dies war nicht mehr seine Zeit und das da unten war nicht mehr sein China. Und im State Department konnte er sich ohnehin nicht mehr blicken lassen. Sie würden ihn auslachen. Mister »Wir-werden-unser-Bestes-tun« nannten ihn die Zeitungen. Natürlich – sie prügelten ihn, aber sie meinten den Präsidenten und seine ganze verkorkste China-Politik. Aber deswegen schmerzten ihn die Schläge nicht weniger.
»Diese miesen Läuse«, schimpfte Williams, der immer noch die Pressemappe studierte. »Da werde ich gleich morgen mal ein paar Anrufe machen.«
Hewett wandte sein scharfkantiges Südstaatenprofil wieder dem Fenster zu. Sie überquerten jetzt die rauen, abweisenden Bergkuppen, über die die Große Mauer verlief. Williams suchte die Schuld wie immer bei den Medien. Wie wenig doch die jungen Leute im diplomatischen Dienst von Politik verstehen, dachte Hewett. Für sie ist Politik nur das, was sie abends in den Fernsehnachrichten sehen. Sie messen ihren Erfolg daran, wie viel Sendezeit ihnen CNN für ihr Statement einräumt und ob sie gut rüberkommen.
Na ja, dachte er resigniert. Vielleicht haben sie damit ja recht.
Die Arena tief unten im Keller der Großbaustelle, die in wenigen Monaten das Golden Dragon Plaza werden sollte, war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Wie das bedrohliche Surren eines riesigen Bienenstocks hallten die im Flüsterton geführten Gespräche des erwartungsvollen Publikums von den nackten Betonwänden wider. Weit über dreihundert Gäste hatten sich versammelt, hockten auf Obstkisten, Baumaterial und Brettern. Nur für das ehrbare Logenpublikum standen Stühle bereit. Wenn in diesem Augenblick ein Polizeikommando hereingestürmt wäre, hätte es einige schlagzeilenträchtige Verhaftungen vornehmen können. Mindestens ein Viertel der Zuschauer waren gesuchte Gangster, Zuhälter, Schmuggler, Entführer und Dealer, die eigens aufgefordert worden waren, ihre BMWs, Mercedes und Cadillacs unauffällig in den Seitenstraßen abzustellen, um kein Aufsehen zu erregen. Aber diesmal würde die Polizei ohnehin nicht kommen, denn in der Ehrenloge saß ein hoher Offizier des Büros für öffentliche Sicherheit. Der Rest des Publikums setzte sich aus der üblichen Mischung aus Selbstständigen, Unternehmern und reichen Auslandschinesen zusammen, die sich nicht damit abfinden konnten, dass ihr geliebtes Glücksspiel in der sittenstrengen Volksrepublik offiziell verboten war und die das Eintrittsgeld von 500 Kuai und den Mindesteinsatz von 300 Kuai mit einem müden Lächeln entrichteten.
Ein Tausend-Watt-Strahler, der eigentlich draußen auf der Baustelle der Nachtschicht leuchten sollte, war zweckentfremdet worden und tauchte den fünf mal fünf Meter großen Ring in ein gleißendes, unwirkliches Licht.
»Wie stehen die Wetten?«, erkundigte sich Jackie Lau, der schmächtige Südchinese, der den Fallschirmspringer mitgebracht hatte.
»Zehn zu eins für unseren Wujing-Mann«, gab Lao Ding zurück und zupfte sich trotzig den billigen Anzug über seinem birnenförmigen Bauch gerade. Lao Ding, dessen breites Gesicht seine mongolische Herkunft verriet, konnte den Südchinesen nicht leiden. Der brachte zwar immer mal wieder interessante Kämpfer nach Peking, aber er war trickreich und verschlagen wie ein Wiesel. Und er war ein Geck. »Jackie« nannte er sich. Wie dieser dämliche Hongkonger Filmschauspieler, dem er glaubte ähnlich zu sehen. Jackie Lau aus Shenzhen, der sich für etwas Besseres hielt, weil seine Papiere ihm erlaubten sooft er wollte rüber nach Hongkong zu reisen, um dort seine damenhaften Socken zu kaufen und Sex mit teuren britischen Huren zu haben. Weil er eine goldene Geldspange besaß und mit Hundert-Yuan-Scheinen um sich warf wie ein verdammter Ausländer.
»Gut so!«, freute sich Jackie und zeigte herausfordernd eine Reihe schiefer Zähne. »Der Fallschirmspringer wird ihn allemachen.«
»Das werden wir ja sehen«, gab Lao Ding zurück, den das Protzgehabe des Südchinesen nervte. »Wie viel willst du denn auf deinen Fallschirmspringer setzen?«
»Ich denke, ich setze mal …«, Jackie fischte aus der Tasche seines karierten Jacketts seine Geldspange heraus und ließ die Scheine durch seine Finger gleiten, »… 20000 Kuai.«
»Zwanzigtausend? Du scheinst dir deiner Sache ja sehr sicher zu sein!«
»Ist das etwa zu viel für dich? Sprengt das deinen Topf?«
»Von mir aus kannst du gerne das Doppelte setzen, wenn du willst!«, gab Lao Ding etwas zu unbekümmert zurück, und der Südchinese setzte sich kichernd in Richtung des improvisierten Wettschalters in Bewegung, um seinen außergewöhnlich hohen Einsatz loszuwerden. Tatsächlich würde, sollte der Fallschirmspringer gewinnen, ein großer Teil des Umsatzes an den schmierigen Südchinesen fallen, dachte Lao Ding widerwillig und sah sich den Herausforderer genauer an. Der hockte auf seinem niedrigen Schemel in der Ecke des Ringes und massierte geistesabwesend seine Fingerknochen. Er war gut einen Kopf kleiner als der baumlange Wujing-Mann. Aber durch Körpergröße allein, das wusste Lao Ding, war so ein Kampf nicht zu gewinnen. Die Wujing, die bewaffnete Volkspolizei, eine paramilitärische Sondertruppe, bildete ihre Leute knallhart im Nahkampf aus. Der hünenhafte Unteroffizier war ein ausgezeichneter Kung-Fu-Meister. Lao Ding hatte ihn vier Mal kämpfen sehen, und keiner seiner Gegner war ihm auch nur annähernd ebenbürtig. Der Wujing-Mann war schnell, dabei stark wie ein Ochse und jung. Der Fallschirmspringer, den Jackie mitgebracht hatte und der sich soeben seines Hemdes entledigte, mochte Ende dreißig, Anfang vierzig sein, schätzte Lao Ding. Sein Oberkörper war sehnig und hart, ebenso sein Gesicht, das ausdruckslos und trocken war wie ein Stück Dörrfleisch. Der Mann war gewiss kein Weichling. Aber gegen den athletischen Wujing-Mann nahm er sich aus wie ein unterernährtes Männlein. Und doch: Die kühle Gewissheit des Südchinesen hatte Lao Ding misstrauisch gemacht. Er winkte einen seiner Mitarbeiter heran.
»Ich will, dass du zehnmal 1000 Kuai auf den Fremden setzt«, sagte er, ohne den Kämpfer aus den Augen zu lassen. Das war das Gute an illegalen Wettgeschäften. Wer wollte sich beschweren, wenn der Veranstalter selbst mitspielte? Lao Ding war ein nüchterner Rechner, kein Spieler. Sollte er verlieren, reichten seine Einnahmen des heutigen Abends aus, um seinen Verlust abzufedern. Für den unwahrscheinlichen Fall aber, dass der Fallschirmspringer tatsächlich gewinnen sollte, hatte er neben dem Wettgewinn die süße Gewissheit, Jackie Lau um einen guten Teil seiner Prämie geprellt zu haben. Zufrieden ließ er sich auf dem Platz neben Jackie Lau in der ersten Reihe nieder, direkt neben der mit Sägespänen ausgestreuten Arena.
Das Publikum wurde allmählich unruhig. Es litt an einer Art Entzugserscheinung, dachte Lao Ding. Sie waren blutsüchtig. Dies war der erste Kampf seit drei Wochen. So lange hatten Lao Ding und seine Leute gebraucht, um diesen neuen Kampfplatz zu finden, nachdem die Polizei ihren alten Schlupfwinkel in einer stillgelegten Fabrik im Pekinger Südosten ausgehoben hatte. Die Flotte von verdammten Luxuskarossen, die diese neureichen Idioten direkt vor der Tür abgestellt hatten, waren einer Patrouille verdächtig vorgekommen. Diese närrischen Angeber! Lao Ding hatte ebenso viel, wenn nicht vielleicht sogar mehr Geld als die meisten von ihnen. Aber er würde es sich niemals einfallen lassen, derartig damit zu protzen. Das lockte nur die Neider und die Polizisten auf den Plan, die immer ihre Hand aufhielten. Es hatte jedenfalls in dieser Nacht eine Schießerei und zwei Tote gegeben – zwei tote Polizisten, die nur einmal nach dem Rechten sehen wollten. Lao Ding musste danach alle seine Beziehungen im Behördenapparat aufbieten, unzählige Gefallen einfordern und sich tiefer in die Schuld einiger korrupter Bürokraten begeben, als ihm lieb war, um diesen Vorfall halbwegs unbeschadet zu überstehen.
»Wo hast du den eigentlich aufgestöbert?«, fragte er nun den Südchinesen und deutete auf den Fallschirmspringer, der mit geschlossenen Augen im Lotossitz verharrte, um sich geistig für den Kampf zu sammeln.
»Berufsgeheimnis«, beschied ihn lächelnd der schmächtige Mann. »Ich sage nur so viel: Er hat unten in Shenzhen einen Kampf gewonnen.«
»Einen Kampf?« Lao Ding sank plötzlich wieder der Mut, und er bereute, dass er soeben ein Vermögen verspielt hatte. Jeder Lahme konnte in Shenzhen einen Kampf gewinnen. Die Südchinesen waren keine großen Kämpfer. »Er hat also nur einen Kampf gewonnen, und du redest daher, als sei er unbesiegbar!«
»Wenn du Zweifel hast, dann warte nur, bis du ihn kämpfen siehst!«
»War er schon mal in Peking?«
»Soweit ich weiß einmal.«
»Zu einem Kampf?«
»Sozusagen.«
»Du hast gesagt, er sei Fallschirmspringer. Also ist er Soldat. Ist er noch aktiv im Dienst der Volksbefreiungsarmee?«
Der Südchinese lächelte dünn. »Macht das einen Unterschied?«
»Für mich schon. Nur mal angenommen, er gewinnt diesen Kampf – was ich nicht glaube –, bleibt er dann für eine Weile in Peking oder muss er wieder in die Kaserne? Kann ich ihn für den nächsten Kampf buchen oder verdrückt er sich?«
»Das musst du ihn schon selbst fragen.«
»Du hast ihn mir nicht einmal richtig vorgestellt! Wie ist überhaupt sein Name?«
»Er nennt sich Laohu – der Tiger.«
Ein Raunen ging durch die Reihen der Zuschauer, als die beiden Kämpfer an gegenüberliegenden Ecken des Ringes in Stellung gingen und sich gegenseitig musterten. Beide waren nur mit ihren Unterhosen bekleidet, beide hatten kurzgeschorenes Haar und braungebrannte Haut.
»He, da vorne – hinsetzen!«, brüllte jemand von den hinteren Rängen, als die Aufregung einige Gäste weiter vorne nicht auf ihren Sitzen hielt. Ein Mann in weißem Anzug, eine Art Ringrichter, trat ins Scheinwerferlicht und blickte streng in die Runde.
»Es kämpfen heute der Eiserne Wang gegen den Mann namens Tiger«, verkündete er knapp. »Der Sieger erhält 10000 Kuai in bar. Hier ist der Umschlag mit dem Preisgeld. Es gibt bei diesem Kampf keine Regeln. Sieger ist der, der den Ring lebend verlässt. Der Kampf ist eröffnet.«
Der Eiserne Wang kam sofort mit erhobenen Fäusten auf den Mann namens Tiger zugetänzelt. Jeder Muskel in seinem gestählten Körper war angespannt und wartete nur darauf, in Richtung des Gegners loszuschlagen. Der kleinere Mann namens Tiger verhielt sich defensiv. Er wich zwei blitzschnellen Fausthieben aus, die rechts und links neben seinem schmalen Kopf ins Leere gingen, und erwarb sich den Respekt des Publikums, als er einen üblen Tritt des Kung-Fu-Meisters mit dem rechten Arm parierte. Stimmung kam auf.
»Los, Wang. Zerschmettere ihn!«, brüllte einer. Der Mann namens Tiger gab sich überhaupt keine Mühe mit der Verteidigung. Sein Gesicht und sein Oberkörper waren ungeschützt. Nur durch die Flinkheit seiner Kopf- und Rumpfbewegungen entging er den fürchterlichen Schlägen und Tritten des Eisernen Wang. Es schien, als könne er sie allesamt vorausahnen. Denen, die ihr Geld auf den Wujing-Mann gesetzt hatten, und das waren fast alle, wurde mit einen Mal mulmig. Es sah so aus, als schlage sich der Eiserne Wang mit einem Gegner aus Luft. Lao Ding grunzte. Er hatte mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Verstohlen beobachtete er den Südchinesen, der das Schauspiel mit größter Gelassenheit verfolgte.
Der Eiserne Wang stellte seine Taktik auf den Gegner ein. Er versuchte höher zu treten, um das ungedeckte Gesicht des Mannes namens Tiger zu treffen, und er tat damit genau das, was dieser ihm aufzwingen wollte. Die kraftraubenden Tritte erschöpften den Wujing-Mann. Seine Bewegungen verloren ihre spielerische Eleganz, wurden schwerfälliger. Man bemerkte, wie nach minutenlangem Kampf die Kräfte aus seinem Körper flossen, ohne dass er seinen Gegner auch nur ein einziges Mal zu Boden gebracht hatte. Seine gefürchteten Tritte wurden unachtsamer. Verzweifelter. Der Fallschirmspringer bewegte sich unverändert behände und leicht, hatte noch keinen einzigen Schlag und keinen Tritt gelandet. Doch als er endlich angriff, tat er es blitzschnell und erbarmungslos. Er erwischte den Eisernen Wang in einer Halbdrehung, mit der dieser Schwung für einen weiteren Fußtritt sammeln wollte. Der Tiger sprang den Riesen an wie eine Katze und schloss seine Armbeuge um Wangs Hals, brachte ihn mit einer raschen Zangenbewegung der Füße zu Fall. Als Wangs erstauntes Gesicht auf dem sägemehlbestreuten Boden aufschlug, war er bereits tot. Das Bersten seines Genicks war trotz des Geschreis bis in die letzte Reihe vernehmbar. Mit einem Mal wurde es totenstill in der unterirdischen Halle. Niemand schrie, niemand applaudierte. Niemand machte seinem Ärger über das verlorene Geld Luft. Niemand machte auch nur eine Bewegung. Der Mann namens Tiger holte sich wortlos vom Ringrichter das Kuvert mit dem Geld und begab sich zu seinem Schemel, um seine Kleidung anzulegen.
Der Leichnam des Eisernen Wang lag im Ring, als sei er plötzlich aus großer Höhe heruntergestürzt.
»Alle Achtung!«, schnaufte Lao Ding bewundernd. »So was habe ich noch nicht gesehen. Wo lernt man denn so zu töten?«
»Mir scheint, als hätte ich soeben 200000 Kuai gewonnen«, freute sich der Südchinese.
»Ich glaube, es ist nicht ganz so viel. Soweit ich weiß, haben doch noch ein paar Gäste auf deinen Fallschirmspringer gesetzt«, bedauerte Lao Ding ölig.
Jackie Lau bedachte ihn mit einem besonders schiefen Krokodilsgrinsen. »Du Sohn einer Schildkröte.«
»Was meinst du, Jackie … wird der Mann mir den Gefallen tun und nächste Woche noch einmal antreten?«
»Selbst wenn – ich bezweifle, dass du jemanden finden wirst, der gegen ihn kämpft.«
»Ach, was. Es findet sich immer einer. 10000 Kuai bar auf die Hand – das ist mehr, als diese Kerle in zehn Jahren verdienen.«
»Das haben die in Shenzhen auch gedacht, aber nachdem er seinen Kampf gewonnen hatte, wollte niemand mehr.«
Lao Ding verkniff sich eine abfällige Bemerkung über die Kampfmoral der Südchinesen und zupfte Jackie an seinem karierten Ärmel. »Bring mich zu ihm. Mach uns bekannt. Bitte.«
Während das Publikum dem Ausgang zuströmte, stieg der Mann namens Tiger in seine unauffällige Straßenkleidung und legte einen langen, grünen Armeemantel an.
»Tiger – das hier ist Lao Ding, der Veranstalter. Er möchte, dass du noch einmal hier kämpfst.«
Lao Ding schüttelte die Hand, die so mühelos das Genick seines besten Gladiators gebrochen hatte, und ging unter dem starken Zugriff beinahe in die Knie.
»Es wäre mir wirklich eine große Ehre, Sie noch einmal hier begrüßen zu dürfen«, stammelte er, mit der linken Hand seine zermatschte Rechte massierend. »Wir sehen hier nicht sehr oft Männer von Ihren Fähigkeiten.«
»Was meinen Sie dazu, Jackie Lau?«, fragte der Kämpfer.
Jackie Lau klopfte dem Fallschirmspringer gönnerhaft auf die Schultern. »Es war ein weiter Weg nach Peking. Wo du schon einmal hier bist, solltest du nehmen, was immer du kriegen kannst.«
Lao Ding brüstete sich manchmal damit, dass er in die Seele jedes Mannes blicken konnte. Das musste er auch, denn als erfolgreicher Geschäftsmann musste er seiner Kundschaft jeden Wunsch von den Lippen ablesen, abwägen und mit einem angemessenen Preisschild versehen. So wie er am Verhalten Jackie Laus rechtzeitig erkannt hatte, dass der Fallschirmspringer kein gewöhnlicher Kämpfer war, so erriet er nun, dass dieser Mann dringend Geld brauchte. Viel Geld.
»Ich würde das Preisgeld sogar ausnahmsweise erhöhen!«, schlug Lao Ding vor, nachdem er einen Blick in die Seele des Mannes geworfen hatte.
»Wie wäre es mit verdoppeln!«, mischte sich Jackie Lau ein und erntete dafür einen spitzen Blick des geizigen Lao Ding.
»Aber ich kann nicht mehr lange in Peking bleiben.« Der Fallschirmspringer zuckte bedauernd die Achseln. »Ich muss wieder zurück.«
»Wie wäre es dann, wenn wir den Kampf statt in einer Woche schon übermorgen austragen würden? Das wäre für mich kein Problem. Übermorgen, dieselbe Uhrzeit, derselbe Ort? 20000 Kuai.«
Der Mann namens Tiger nickte. »Einverstanden.«
Lao Ding wollte ihm die Hand reichen, die aber von der Begrüßung immer noch schmerzte. So machte er nur eine knappe Verbeugung und ließ die beiden Männer allein.
Der Ringrichter war damit beschäftigt, die Leiche des Eisernen Wang in einem schwarzen Plastiksack zu verstauen. Er würde sie im Laufe der Nacht in einem der schlammigen Kanäle der Hauptstadt versenken. Es waren noch einige Gäste zurückgeblieben, die ihm schweigend bei seiner Arbeit zusahen. Ihnen näherte sich Lao Ding.
»Übermorgen wird dieser Tiger hier noch einmal zu einem Sonderkampf antreten«, erklärte er. »Siegesprämie sind 20000 Kuai, Eintritt 1000, Mindesteinsatz 600. Gebt die Nachricht weiter.« Wenn die Kunde von diesem sensationellen Kampf in den einschlägigen Kreisen umging, dann würden übermorgen sicherlich 500 bis 600 Zuschauer erscheinen, vielleicht sogar mehr. Lao Ding rieb sich die Hände bei dem Gedanken an einen Rekordgewinn. Jetzt blieb nur noch eine Frage zu klären: Wer war leichtsinnig oder gefährlich genug, es mit dem Tiger aufzunehmen?«
»Dein Geld war gut angelegt, Tiger«, sagte Jackie Lau und gab dem Fallschirmspringer seine Geldtasche zurück, die nun 60000 Kuai enthielt. Ein Teil des Wettgewinns gehörte verabredungsgemäß dem Südchinesen.
»Ich danke Ihnen, dass Sie mich hierhergebracht haben, Jackie Lau!« Der Tiger verbeugte sich vor dem Südchinesen, der ihn stolz angrinste. Er mochte den Fallschirmspringer. Der war trotz seiner todbringenden Kräfte ein bescheidener, leiser Mann. Die beiden schlenderten durch dunkle Gassen nebeneinander von der Baustelle zurück zum Changan-Boulevard, der Hauptschlagader Pekings.
»Nichts zu danken«, wehrte Jackie Lau ab. »Ich habe eine Menge Geld gewonnen durch dich. Ich habe zu danken.«
»Aber Sie wollten nur einen Kampf mitmachen und dann aufhören, weil Sie Angst hatten. Und nun helfen Sie mir, noch einen zweiten Kampf zu machen. Dafür danke ich Ihnen. Jackie Lau – ich möchte Sie etwas fragen. Ich brauche noch mehr Geld. Ich brauche mindestens 500000. Ich besitze aber jetzt erst 60000. Wenn ich das nun beim nächsten Kampf alles setzen würde …«
»… würde nicht viel dabei herausspringen. Du bist der klare Favorit. Alle werden auf dich setzen. Da kannst du höchstens ein paar tausend machen.«
»Ja. Aber wenn ich es auf meinen Gegner setzen würde?«
»Aber nein – das geht doch nicht. Das ist unmöglich!«
»Könnte ich dann genug Geld verdienen?«
»Ja, sicher«, antwortete Jackie Lau zögernd. Jetzt dämmerte ihm, was der Mann namens Tiger vorhatte. »Wenn die Wetten wieder zehn zu eins stehen, dann bekommst du das Zehnfache deines Einsatzes. Aber hör mal, Tiger, das ergibt doch keinen Sinn.«
»Ich brauche das Geld nicht für mich, Jackie Lau. Ich habe nur noch fünf Tage Zeit, bis ich wieder bei meiner Einheit sein muss. Es gibt keinen anderen Weg, in dieser kurzen Zeit an so viel Geld heranzukommen.«
»Doch. Du könntest eine Bank ausrauben«, sagte Jackie Lau, halb im Scherz. »Hier haben sie außerdem neuerdings diese gepanzerten Geldtransporter.«
»Ich meine ehrlich an so viel Geld heranzukommen«, sagte der Tiger, als hätte Jackie Lau ihn in seiner Ehre verletzt.
Sonderbare Leute, diese Soldaten, dachte Lau. Da bringt er ohne zu zögern einen Menschen um für 10000 Kuai, aber eine Bank würde er nicht überfallen.
»Ich werde einfach mein ganzes Geld auf meinen Gegner setzen und ihn gewinnen lassen. Sie sind der einzige Mensch, den ich außerhalb meiner Einheit kenne. Können Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie das Geld an sich nehmen und nach meinem Ende an eine bestimmte Person überbringen?«
Sie hatten den Changan-Boulevard erreicht und wandten sich nach rechts in Richtung Tiananmenplatz. Ein scharfer Wind pfiff ihnen entgegen. Jackie Lau blieb stehen, um ein Taxi heranzuwinken. Er war verwirrt. Er kannte den Fallschirmspringer erst seit wenigen Tagen. Er hatte ihn in Shenzhen kämpfen sehen und spontan beschlossen, ihn auf seine lange geplante Geschäftsreise nach Peking mitzunehmen, wo Lao Ding immer auf der Suche nach neuen Talenten war. Er hatte einen guten Eindruck von der Persönlichkeit des Soldaten bekommen. Eigentlich hatte er ihm sogar anbieten wollen, sein Leibwächter zu werden. Aber dann erfuhr er etwas über den Mann namens Tiger, das ihn schnell von dieser Idee abbrachte.
Der Fallschirmspringer hatte ihm seine Nöte anvertraut. Er hatte weniger als zwei Wochen – der aufgesparte Urlaub aus vier Jahren –, und er musste in dieser kurzen Zeit so viel Geld wie möglich verdienen. Und nun wollte er sogar sein Leben verkaufen. Jackie Lau war kein Mann der großen Gefühle. Er hatte viele Menschen sterben sehen, einige von seiner eigenen Hand. Er war ein Schieber und Schmuggler, ein Überlebenskünstler. Einer der ganz wenigen unabhängigen Ganoven, die außerhalb der gefährlichen Shenzhener Triaden operierten, und stand deswegen immer mit einem Bein im Grab. Aber als er den Fallschirmspringer in dieser selbstverständlichen Art von seinem makabren Vorhaben reden hörte, überflog ihn unter seinem Pelzmantel ein kalter Schauer, der nicht vom Dezemberwind herrührte. Ein Taxi kam neben den beiden Männern zum Stehen, aber Jackie hatte es sich anders überlegt und winkte dem fluchenden Fahrer ab. Er wusste selbst nicht, warum er es tat, aber er machte dem Tiger ein Angebot, von dem er niemals gedacht hätte, dass es über seine Lippen kommen würde.
»Wenn du in Schwierigkeiten steckst … ich könnte dir vielleicht mit ein paar tausend aushelfen. Leihweise, versteht sich. Du zahlst es mir in Raten wieder zurück.«
Der Tiger schüttelte den Kopf. »Nein. Ich brauche so viel, dass ich es niemals zurückzahlen könnte. Ich sagte doch, 500000 Kuai, oder sogar mehr.«
»Aber was zum Teufel willst du denn mit so viel Geld anfangen? Ein Auto kaufen? Willst du heiraten? Hast du Spielschulden? Was ist es ?«
»Werden Sie mir helfen?«
»Wenn ich kann – ja. Ich werde dir helfen«, sagte Jackie Lau und verletzte damit wiederum eines seiner Prinzipien.
»Nehmen Sie das Geld und bringen es der Frau Chen Yilai in der Stadt Duan nördlich von Nanning. Das ist meine Heimat. Sagen Sie ihr, dass ich das Geld schicke und dass sie es annehmen muss. Sagen Sie ihr auf gar keinen Fall, auf welche Art ich es verdient habe. Sonst würde sie es nicht annehmen.«
»Und?« Jackie Lau konnte noch immer nicht verstehen, warum der Mann sein Leben wegwerfen wollte. »Wer ist das? Deine Geliebte? Hast du ihr ein Kind gemacht? Abtreibungen sind kostenlos, weißt du? Wenn sie es richtig anstellt, bekommt sie sogar noch ein paar Kuai Prämie dafür!«
»Es ist meine jüngere Schwester. Sie ist sehr krank. Sie braucht eine Operation, und ihre einzige Hoffnung ist ein Arzt in Amerika. Mit dem Geld kann sie einen Pass beantragen, die Kaution hinterlegen, die Bestechungsgelder bezahlen und auch die Reisekosten bestreiten. Ich weiß nicht, ob es auch für die Operation reichen wird, aber mehr als das bekomme ich niemals zusammen.«
Der Mann namens Tiger blieb stehen und sah Jackie Lau zum ersten Mal direkt in die Augen. Jackie verspürte Angst und Bewunderung zugleich. »Werden Sie das für mich tun?«
»Ich werde es tun«, versprach der Südchinese feierlich und fühlte sich als Mitwirkender an einer so noblen und selbstlosen Tat mit einem Mal wie ein besserer Mensch. »Ich werde es tun«, wiederholte er. Aber da klang es schon nicht mehr so gut.
Keine zweihundert Meter von dem Ort entfernt, wo die beiden Männer standen, auf der anderen Seite des Changan-Boulevard, hinter einer hohen Mauer in Zhongnanhai, dem abgeschlossenen und bewachten Regierungsviertel, saßen fünf Männer in einem abhörsicheren Besprechungsraum zehn Meter unter der Erde, zu dem nur eine kleine Gruppe von handverlesenen Führungspersönlichkeiten Zutritt hatte. Drei von ihnen trugen Uniformen mit den höchsten Rangabzeichen, die die Volksbefreiungsarmee zu vergeben hatte. Zwei waren in schlichte,, graue Mao-Anzüge gekleidet. Ihr einziger Schmuck war die Anstecknadel mit dem Wappen der Kommunistischen Partei. Zusammen hatten diese fünf Männer, die sich »Patrioten« nannten, mehr Macht und Einfluss als jede andere Fraktion im China nach Deng Xiaoping. Der kleine Steuermann hatte die Führung zusammengehalten, in Loyalität oder in Furcht. Aber nach seinem Tod hatten ideologische Grabenkämpfe und Machtintrigen die Elite gespalten.
»Der Staatspräsident macht sich Sorgen wegen der Amerikaner. Er fragt sich, ob es wirklich weise war, sie derartig zu verletzen, wo doch gerade die Zeichen auf Verständigung stehen«, berichtete Genosse Hong Fansen mit einem Naserümpfen. Sein eierförmiger Schädel glänzte kahl, umschimmert von einem Kranz schütterer, weißer Haare. Sein habichthaftes Gesicht, das von einer Brille mit enorm dicken Gläsern regiert wurde, verriet einen Ausdruck des Ekels. »Offenbar haben die Schwächlinge vom Außenministerium ihm wieder Vorhaltungen gemacht.«
»Auch der Staatspräsident wird noch lernen, dass die Amerikaner nur eine Sprache verstehen, und das ist unsere Sprache. Wir haben uns wahrhaftig lange genug von denen herumschubsen lassen«, erwiderte der zweite Parteimann, Genosse Zhao Zhongwen. Sein schwerer Akzent deutete auf seine südchinesische Herkunft. Der Siebenundsechzigjährige, dessen breites Gesicht mit den hervortretenden Augen und dem vorgeschobenen Unterkiefer unweigerlich an einen Fisch erinnerte, war der ehemalige Parteichef von Kanton und seit vielen Jahren im Ruhestand. Aber immer noch mischte er in den Angelegenheiten der reichsten chinesischen Provinz kräftig mit. Sein wichtigstes Betätigungsfeld war die Wirtschaft. Als einer der ersten Reformer Chinas hatte Zhao das Wunder von Shenzhen und Zhuhai, der blühenden Sonderwirtschaftszonen bei Hongkong und Macao, erst möglich gemacht. Er hatte unzählige Joint Ventures, Gemeinschaftsunternehmen mit reichen Auslandschinesen, eingefädelt und abgesegnet, hatte unzählige Genehmigungen verkauft und unschätzbaren persönlichen Reichtum angehäuft. Zhao war den Amerikanern ein Dorn im Auge, seit die CIA ihn als Besitzer von mehr als einem Dutzend CD-Fabriken identifiziert hatte, die fröhlich amerikanische Ton- und Filmträger kopierten, ohne sich um solchen Kleinkram wie Lizenzen und Urheberrechte zu kümmern. Dass die Zentralregierung ihn dennoch gewähren ließ und sogar in Schutz nahm, zeigte, wie groß seine Macht tatsächlich war. Zhao Zhongwen war der Vater des Wirtschaftsaufschwungs, und wenn er gereizt wurde, dann könnte er gewiss Wege finden, den Pekingern den Geldhahn zuzudrehen oder andere Unannehmlichkeiten zu verursachen. Für die Amerikaner hatte Zhao nichts als Spott und Verachtung übrig. »Die kamen noch immer wieder angekrochen und wollten ihre Coca-Cola verkaufen«, schnaufte er.
»Trotzdem dürfen wir unsere Karten nicht gleich alle auf den Tisch legen. Wenn die Konfrontation zu früh außer Kontrolle gerät, dann ist das schlecht für den ganzen Plan«, bemerkte General Huang Liao, dessen Gesicht von einer verheerenden Narbe entstellt war, die wie die Verwerfung eines schweren Erdbebens von der Stirn über die rechte Wange bis zum Kinn verlief. Er trug sie mit Stolz, denn es war ein weithin sichtbares Ehrenmal seines Einsatzes im Koreakrieg. Ein amerikanisches Schrapnell hatte ihn erwischt. Seine Einheit, damit prahlte er noch heute gerne, hatte mehr Amerikaner getötet und mehr Waffen erbeutet als jede andere. Selten erwähnte er, dass ein Großteil dieser Beutewaffen noch immer im Einsatz war. Huang befehligte die Truppen im Nordosten des Landes, den Militärbezirk Shenyang. Neben ihm saß General Jiang, der jüngste in der Runde, der die Truppen im Süden anführte. Der Befehlshaber der sogenannten Kriegszone Guangdong war ein gutaussehender, wenngleich kleiner Mann mit fein geschnittenem Gesicht, das einem beliebten Schnulzensänger gehören könnte. Er wirkte in seiner Uniform wie ein Filmschauspieler, der das idealisierte Bild eines hohen Militärs abgab. Unter seinem Befehl standen zur Zeit knapp 50000 Mann, denn er führte den Oberbefehl für ein geplantes Großmanöver, das in wenigen Tagen beginnen sollte.
»Ich teile die Ansicht des Staatspräsidenten, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist. Wir brauchen, wenn es so weit ist, seine Mitarbeit und dürfen ihn nicht durch voreilige Züge befremden«, sagte der Schönling.
»Ich denke, Genosse Zhao hat recht«, befand Hong dennoch. »Die Amerikaner sind Kapitalisten und Geschäftsleute und sie sind hart im Nehmen. Sie werden uns die unfeine Behandlung ihrer Delegation nicht nachtragen. Ich werde dafür sorgen, dass das Handelsministerium wieder ein Dutzend Flugzeuge bei Boeing bestellt, und schon wird sich der Wind wieder drehen.« Ein kurzes, humorloses Lachen folgte dieser Aussage.