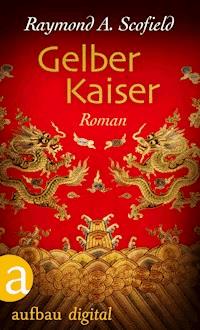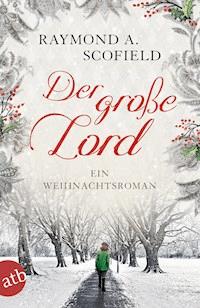Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Pakt gegen den Dalai Lama.
Das Unglaubliche scheint wahr zu werden: Gewisse politische Kreise Chinas unterbreiten Tibet ein Friedensangebot und laden den Dalai Lama zu Gesprächen ein. Doch zwei Amerikaner entdecken, daß es sich um eine Falle handelt. Es gibt nur eine Möglichkeit, eine Katastrophe zu verhindern. Der Schlüssel dazu ist ein tibetisches Heiligenbild ...
Ein atemberaubender, hochbrisanter Roman von einem Kenner Tibets.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raymond A. Scofield
Raymond A. Scofield heißt eigentlich Gert Anhalt und ist Reporter beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Viele Jahre hat er für das ZDF aus China und Japan berichtet und zahlreiche Romane und Thriller verfasst, darunter »Der Jadepalast« und »Die Tibet-Verschwörung«. Zuletzt erschien von ihm der Bestseller: „Der große Lord“ – eine Fortsetzung des Klassikers „Der kleine Lord“ von Frances Hodgson Burnett.
Informationen zum Buch
Ein Pakt gegen den Dalai Lama.
Das Unglaubliche scheint wahr zu werden: Gewisse politische Kreise Chinas unterbreiten Tibet ein Friedensangebot und laden den Dalai Lama zu Gesprächen ein. Doch zwei Amerikaner entdecken, daß es sich um eine Falle handelt. Es gibt nur eine Möglichkeit, eine Katastrophe zu verhindern. Der Schlüssel dazu ist ein tibetisches Heiligenbild.
Ein atemberaubender, hochbrisanter Roman von einem Kenner Tibets.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Raymond A. Scofield
Die Tibet-Verschwörung
Roman
Für
Akira Dschinghis
Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden,
als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio.
Shakespeare, Hamlet
Inhaltsübersicht
Über Raymond A. Scofield
Informationen zum Buch
Newsletter
Die Hauptpersonen
Vorwort
1. Kapitel Potala-Palast, Lhasa, Tibet
2. Kapitel Boston, Massachusetts
3. Kapitel Südwestliches Tibet, Erdochsenjahr (629)
4. Kapitel Providence, Rhode Island
5. Kapitel West Hollywood
6. Kapitel Südwestliches Tibet, Eisenhahnjahr (838)
7. Kapitel Peking
8. Kapitel Cambridge, Massachusetts
9. Kapitel Beverly Hills
10. Kapitel Lhasa, Feuerdrachenjahr (846)
11. Kapitel Cambridge, Massachusetts
12. Kapitel Grenze Tibet – Nepal
13. Kapitel Kathmandu, Nepal
14. Kapitel K’aip’ing, südwestliche Mongolei, Eisenaffenjahr (1260)
15. Kapitel Lhasa
16. Kapitel West Hollywood
17. Kapitel Peking
18. Kapitel Peking
19. Kapitel Kloster Dreglug, Feuertiger jähr (1618)
20. Kapitel Peking
21. Kapitel Chengdu, Provinz Sichuan
22. Kapitel Lhasa
23. Kapitel Dreglug, Tibet, 1953
24. Kapitel Lhasa
25. Kapitel Dreglug, 1956
26. Kapitel Lhasa
27. Kapitel Shigatse, Tibet
28. Kapitel Tibet, 1959
29. Kapitel Lhasa
30. Kapitel Tibet, 1966
31. Kapitel Lhasa
32. Kapitel Flugfeld Mustang, Nepal, August 1966
33. Kapitel Kambala-Pass, Tibet
34. Kapitel Kloster Dreglug, August 1966
35. Kapitel
36. Kapitel Yatung-Tal, Grenze Tibet – Nepal, 1966
37. Kapitel Dorf Kangtog, Tibet
38. Kapitel Lhasa
39. Kapitel Lhasa
40. Kapitel Lhasa
41. Kapitel Grenze Tibet – Nepal
Impressum
Die Hauptpersonen
Catherine Laurell
Harvard-Studentin
Robert Laurell
Vater von Catherine Laurell, Manager in Indien
Artie Myzinski
Hollywoodagent
Paul McGregor
Filmstar, Artie Myzinskis Klient und Freund
Matthew Tanner
Tibetologe an der Brown-Universität, Providence
Dr. Nyima Gyatso
Jurist und Exiltibeter
Vicky Jocelyn
Sekretärin von Dr. Nyima Gyatso
Tutseleg Gampo
Vertrauter des Dalai Lama
Targa
Dolmetscher des Dalai Lama
Tsentse
Spitzel der chinesischen Sicherheitsbehörden in Lhasa
Feng Lizhao
Tibet-Sekretär des chinesischen Staatsrates
Hu Banguo
Vizedirektor des Büros für Öffentliche Sicherheit in Lhasa
Prof. Li Rongwu
Tibetologe am Pekinger Minderheiteninstitut
Li Xiao Zhi
Fotograf, Sohn von Prof. Li Rongwu
Zhao Dawa
Xiao Zhis tibetische Frau
Tenzin Gyatso
Mönch und Widerstandskämpfer
Zonia van Kerke
Aktivistin aus Amsterdam
Vorwort
Autoren, die sich beim Schreiben ihrer Bücher auch selbst die Spannung erhalten wollen, berufen sich gerne auf William Faulkner, der einfach ein Stück Weges neben seinen Helden ging und zuhörte, was sie zu berichten hatten.
Ich hatte mich bereits ein wenig in die schöne, schnippische Catherine Laurell verschossen, und Artie Myzinski, der fahrigchaotische Hollywoodagent, brachte mich immer wieder zum Lachen. Doch als die beiden mir ihre Geschichte erzählten, erklärte ich sie erst einmal für übergeschnappt.
Gewohnt Quellen zu überprüfen, ging ich ihrer wilden Story dennoch nach – man kann ja nie wissen. Ich ließ mir stapelweise Bücher kommen, reiste nach Tibet und Nepal, graste das Internet ab, und je mehr ich las, hörte und sah, desto glaubwürdiger erschienen mir die beiden, desto weniger verrückt und phantastisch ihre Erlebnisse. Vielleicht hatten sie hier und da ein wenig übertrieben oder waren dort ihrer allzu abendländischen Sichtweise erlegen – aber der Dämon, von dem sie voller Grauen berichteten, bekam tatsächlich eine Fratze, eine Vergangenheit und einen mörderischen Zukunftsplan.
Viele Leute haben mir geholfen, die Geschichte von Catherine und Artie, vom smarten Nyima Gyatso, dem tragischen Prof. Li und den vielen anderen Helden und Schurken, Königen, Weisen, Politkommissaren und Partisanen, Hollywoodschauspielern und radikalen Studenten aufzuschreiben. Wissend oder unwissentlich, als Interviewpartner oder Buchautoren.
Der größte Dank – für nur zwei Worte – gebührt vielleicht dem Vertreter des Dalai Lama in Kathmandu, Tashi Namgyal, dem ich, selbst noch voller Zweifel, bei einer langen Tasse Buttertee die abenteuerliche Geschichte von Catherine und Artie vortrug und der nur bedächtig nickte und sagte: »Durchaus denkbar.«
Johannes B. Tümmers (»… Gott sei Dank ist es keine wissenschaftliche Arbeit …«), Tibetologe an der Uni Köln, half mir, dem Unbewanderten, durch die komplizierte Welt des tibetischen Buddhismus.
Von den Professoren der Tibetischen Akademie für Sozialwissenschaften in Lhasa erfuhr ich wichtige Details über Asketen, Beschwörungsformeln und die geisterabweisende Wirkung von Nudelmehl.
Sofia Ames aus Hollywood und David Smith aus Brooklyn haben mir Artie vorgestellt, Rachel Urkowitz die Brown-Universität.
Meinen Pekinger Freunden und Kollegen habe ich zu danken für ihre Unterstützung, ihre Anregungen und ihre Kritik: Andreas Landwehr, Jürgen Kremb, Lutz Mahlerwein und vielen anderen. Für Hilfe, Zuspruch und Vertrauen danke ich Dirk Meynecke. Nicht zu danken habe ich dagegen dem Pekinger Minderheiteninstitut, das sich trotz mehrmaliger Anfragen durchaus nicht auskunftsbereit zeigen wollte. Aber das passt …
Von den Büchern, die ich zu Rate zog und jedem Interessierten zur Lektüre empfehle, gehören: Warren W. Smith: Tibetan Nation; René de Nebesky-Wojkowitz: Oracles and Demons of Tibet; Alexandra David-Néel: Magic and Mystery of Tibet; Thubten Jigme Norbu/Colin Turnbull: Tibet; Jamyang Norbu: Warriors of Tibet; Mary Craig: Tears of Blood; Dawa Norbu: Red Star over Tibet; Austine Waddell: Buddhism and Lamaism of Tibet. Und als Nachschlagewerk die Encyclopaedia of Eastern Philosophy and Religion.
Peking im Frühjahr 1998
Raymond A. Scofield
1. Kapitel
Potala-Palast, Lhasa, Tibet
Tsentse musste sie verraten haben. Tsentse, der spindeldürre Kerl mit dem speckigen Strohhut und der viel zu großen Brille, der ihm als absolut zuverlässiger Mann empfohlen worden war und dem er doch von Anfang an nicht vertraut hatte, allein schon wegen der schrägen Blicke, die er Dawa zuwarf. Tsentse, der Mitarbeiter des Büros für Öffentliche Sicherheit in Lhasa, der ihnen über seine guten Kontakte Zutritt zum Potala verschafft hatte und der gesagt hatte, er würde oben auf sie warten und sie mit dem Thangka sicher wieder aus dem Palast und aus der Stadt bringen.
Die Gänge hallten wider unter dem Donnern der Stiefeltritte, die steilen Holztreppen, die hinab in die Säulenhalle führten, krächzten unter den stahlbesetzten Sohlen, als er gerade den Elefantenstoßzahn, in dem das Schwarze Thangka seit vielen Jahren verborgen war, wieder an seinen Platz gehängt hatte. Die Soldaten schnitten ihnen den Weg ab. Es waren mindestens zehn Leute, und sie gaben noch nicht einmal einen Warnruf ab, sie feuerten unverzüglich los.
Dawa erkannte früher als er, dass sie es unmöglich bis zum Ausgang schaffen konnten. Sie versuchte, ihn zurückzuhalten, aber er tauchte in den Kugelhagel der Sturmgewehre, das Gebell der Waffen dröhnte in seinen Ohren, Querschläger zirrten knapp neben seinem Kopf vorbei, als er hinter einem baumhohen, hölzernen Stützpfeiler Deckung suchte. Die beiden Mönche, die den Altar beaufsichtigten und die Opferkerzen am Brennen hielten, waren noch vor ihm in Panik in die äußere Halle hinausgerannt, direkt in das Feuer. Stöhnend lagen sie in ihrem eigenen Blut, durchsiebt von den Salven des chinesischen Greiftrupps. Seine Frau Dawa hatte sich im Schatten des vierzehn Meter hohen goldenen Grabmals des fünften Dalai Lama verkrochen. Er gewahrte flüchtig im Flackerlicht der Butterdochte, dass sie beide Arme schützend über ihren Kopf verschränkt hatte, und er hoffte gegen alle Vernunft, sie möge überleben. Sie schrie seinen Namen, schrie, er solle zurückkommen.
Das geheime Schwarze Thangka, das Heiligenbild aus einer anderen Zeit, das einen grässlichen Dämon darstellte, hatte er wieder zusammengerollt und an seine Brust gepresst. Wenn er es nur verstehen würde, wenn er nur wüsste, warum es so dringend gesucht wurde, dann wäre ihm wenigstens klar, warum er sterben musste. Der Dalai Lama müsse es unbedingt sehen, hatte Dawa nur gesagt. Nur der Dalai Lama könne es verstehen. Dawa, die Tapfere, die er liebte und die fürchterliche Träume hatte, die sie nicht verstand und über die sie noch nicht einmal sprechen wollte. In Furcht verschlossen, wie er sie nie erlebt hatte.
Die chinesischen Soldaten schienen ihren Auftritt zu genießen, hatten nebeneinander Stellung bezogen und schritten auf den verwaisten Audienzthron am Kopfende der Halle zu; dabei spuckten ihre Kalaschnikows weiter mörderische Salven, die Geschosse zerrissen die Opfergaben, die vor dem leeren Thron niedergelegt worden waren, ließen das Holz der Pfeiler und die kostbaren Malereien und Knüpfarbeiten an den Wänden zerbersten.
Es gab keinen Weg zurück. Er würde hier sterben, und wenn die Chinesen mit ihm fertig waren, dann würde er genauso aussehen wie ein Toter, dessen sich ein tibetischer Leichenbestatter angenommen hat: kleingehackt. Dann konnten die Geier sein Fleisch in die Lüfte tragen, und die Seele in einem neuen Körper auf die Erde zurückkehren. Er hatte verloren, dieses Leben gehörte ihnen. Aber das Thangka würde er nicht in ihre Hände fallen lassen. Diesen einen Triumph würde er mit in seine nächste Existenz nehmen. Für Dawa. Für Tibet.
Sie hatten das langgezogene Gewölbe erst zur Hälfte durchmessen, waren noch immer zwanzig Schritte von ihm entfernt. Er nahm allen Todesmut zusammen, sprang hinter der schützenden Holzsäule hervor und rannte, das Heiligenbild wie einen Schild vor sein Herz haltend, geradewegs den Schützen entgegen. Sofort richteten sich die Läufe von zehn Gewehren auf ihn wie auf ein fliehendes Wild, Projektile trafen ihn wie Hammerschläge an Schulter und Hüfte, warfen ihn mit dem Rücken gegen die Wand. Er sah nichts außer dem weiß blitzenden Mündungsfeuer und spürte nichts außer den dumpfen Schlägen, die seine Beine trafen und seine Brust. Spitze Bolzen aus Metall, die ihn durchbohrten und das Schwarze Thangka in Fetzen rissen.
»Ihr verdammten, hirnlosen Hurensöhne!« Vizedirektor Hu Banguo von der Behörde für Öffentliche Sicherheit in Lhasa pflegte schon unter normalen Umständen keine besonders gewählte Ausdrucksweise, aber wenn ein Befehl derartig danebenging wie die Verhaftung eines Kunsträubers und Verräters und die Bergung eines extrem wichtigen Dokuments, dann vergaß er sich vollends. Die Gescholtenen, allesamt junge, nervöse Milchgesichter, standen stramm in Reih und Glied, die tannengrünen Uniformen schlackerten an ihren schmalen Gliedern. Sie blickten stur und stumm geradeaus, Hände an die Hosennaht, wie sie es gelernt hatten. Sie hofften, der Ausbruch ihres Vorgesetzten möge vorübergehen, ohne dass ihnen der Heimaturlaub gestrichen oder die Essensrationen gekürzt würden. Der hünenhafte Vizedirektor Hu Banguo, dem seine Untergebenen ehrfurchtsvoll den Spitznamen Wildes Yak verpasst hatten, war ein muskulöser und robuster Mann Mitte Fünfzig, dessen bulliger Kopf fast übergangslos auf seine breiten Schultern gepflanzt war. Hätte es unter seinen Untergebenen einen Mann mit Mut und Humor gegeben, so hätte dieser sicherlich den viel zutreffenderen Spitznamen Wilde Kaulquappe erfunden, denn Hus Schädel war nicht nur fast kahl, auch seine hervorstehenden Augen und sein breiter Mund erinnerten eher an eine werdende Amphibie denn an das zottelige Hochlandrind. Aber nicht Mut und schon gar nicht Humor waren bei der Behörde für Öffentliche Sicherheit in Lhasa gefragt. Und ganz besonders galt dies unter Hus strengem Regiment. Hu Banguo war vor einigen Monaten aus Shandong, einer idyllischen Provinz an Chinas Ostküste, nach Lhasa versetzt worden. Strafversetzt, wie man sagte. Mit seinen tellergroßen Händen hatte er in seinem Jähzorn einen ungeständigen Häftling tot geprügelt. Dieser Tatbestand allein hätte unter normalen Umständen zwar möglicherweise zu einer Rüge, jedoch noch nicht zu ernsten Disziplinarmaßnahmen geführt. Allerdings handelte es sich bei dem Erschlagenen um den Neffen einer lokalen Parteigröße in Qingdao, und Hu bekam seinen Denkzettel: prompte Versetzung nach Lhasa – ganz so, als sei ein Mann von seinem ungestümen Temperament und seiner Neigung zur Gewalt in Tibet grundsätzlich besser aufgehoben als im zivilisierten Teil des Mutterlandes. Der Vizedirektor machte kein Geheimnis daraus, wie sehr er die Autonome Region und ihre Bevölkerung hasste und verachtete, mokierte sich bei jeder Gelegenheit über die dünne Luft, das lausige Essen und den verdammten Dreck überall. De facto leitete Hu zwar die hiesige Polizeitruppe, führte aber dafür nur den Titel und bekam nur das Gehalt eines Vizedirektors, weil der Direktor nach den Bestimmungen ein Mann tibetischer Abstammung sein musste. Auch wenn dieser eigentlich keine Macht hatte. Das machte sich politisch einfach besser.
»Wisst ihr Söhne von Schildkröten überhaupt, was ihr da angerichtet habt?« grollte Hu, seine fleischigen Wangen in seiner Erregung tatsächlich wie eine Kaulquappe aufblähend. »Ich will ja gar nicht von den Wandteppichen reden, die ihr zerballert habt. Und von den beiden toten Mönchen ganz zu schweigen.« Er schrie sie an, eine Stimme wie ein vorbeiratternder Güterzug. Die Unglücklichen, die nahe genug bei ihm standen, konnten den würzigen Geruch von Maotai-Schnaps in seinem Atem riechen. »Ich rede noch nicht einmal von dem chinesischen Verbrecher, der jetzt aussieht wie Hackfleisch. Ich rede von dem verdammten Thangka, das der Mann bei sich trug und das jetzt nichts weiter ist als ein beschissener Putzlappen. Davon rede ich!« Hu fuchtelte mit den spärlichen Überresten des buddhistischen Gemäldes vorwurfsvoll vor ihren Augen hin und her und schlug es ihnen nur deswegen nicht um die Ohren, weil er befürchten musste, dass es sich dann vollends auflösen würde. Hätte man ihnen in ihrer Ausbildung neben dem Schiessen auch das Denken beigebracht, dann würden die Milizionäre sich nun vielleicht fragen, wie es sein konnte, dass sich Vizedirektor Hu, Wildes Yak, plötzlich als Schutzpatron der buddhistischen Künste entpuppte. Aber sie dachten nichts, blinzelten nur blöde, ihre Köpfe ebenso leer wie die Magazine ihrer Gewehre. Und Hu, als er kochend vor Zorn aus dem Appellraum stürmte, blieb ihnen die Erklärung dafür schuldig, warum das Thangka ihm denn wohl so viel bedeutete. Tatsache war, dass er es selbst nicht so genau wusste.
Er wusste nur, dass diese unfähigen, grünschnabeligen Bastarde, die hier auch noch als Elitetruppe geführt wurden und die doch nichts weiter konnten als draufhalten und abdrücken, seine Karriere vernichtet hatten! Kein Geringerer als Feng Lizhao, der mächtige Tibetbürokrat des Staatsrates und Sekretär des Staatspräsidenten für Minderheitenfragen, hatte diesen Einsatz persönlich angeordnet. Er wolle das Thangka, hatte Feng gesagt. Ein seltenes Sammlerstück. Und weil er es sehr dringend wollte, hatte er Hu für seine Hilfe die baldige Versetzung nach Südchina in Aussicht gestellt. Mit etwas Glück und wenn alles gut über die Bühne gehe, winke Hu der Posten des Polizeichefs von Haikou auf der Tropeninsel Hainan, hatte Feng versprochen. Dafür müsse er nur dieses Schwarze Thangka besorgen und noch ein, zwei weitere Gefälligkeiten verrichten. Er sei überdies an vorderster Front mit dabei, wenn Geschichte geschrieben werde, hatte Feng ihn wissen lassen. Das Mutterland und die Partei würden seine Unterstützung ganz gewiss nicht vergessen.
Doch Hu hatte nun von dem Sammlerstück nichts weiter in den Händen als ein zerschossenes, bluttriefendes Stückchen Stoff. Er hätte die Verantwortung für dieses Fiasko gerne auf Tsentse abgewälzt, dieses tibetische Wiesel. Aber das ging nicht. Tsentse hatte keine bewaffnete Unterstützung angefordert und war von ihrem Eintreffen selbst überrascht worden. Hu persönlich hatte die Sondereinheit in den Potala beordert, weil er keinem Tibeter, auch Tsentse nicht, traute und weil er ganz sichergehen wollte, dass ihm das Sammler-Thangka für Feng Lizhao nicht durch die Finger ging. Er musste jetzt dringend jemanden finden, einen Experten, der dieses nutzlose Ding wieder zusammenflickte. Und wenn ihm dies nicht gelang, dann würde er jemanden brauchen, der ihn selbst wieder zusammenflickte.
Hu steuerte seinen japanischen Jeep aus dem Tor der Polizeigarnison im Osten Lhasas, seinen Fuß hielt er niedergedrückt auf das Gaspedal, so als zertrete er damit die kümmerlichen Spatzenhirne, die ihm diese Blamage eingebrockt hatten. Das zerstörte Thangka lag, in einer Plastiktüte verstaut, auf dem Beifahrersitz, und er konnte nicht aufhören, immer wieder hinzuschielen und unflätig zu fluchen.
Er bemerkte die Frau erst, als es zu spät war. Die Mittlere Peking-Straße war unterhalb des Potala-Palastes um diese Uhrzeit wenig befahren und schlecht beleuchtet. Ein jäher, dumpfer Schlag, das Kreischen blockierender Reifen. Der kleine Körper flog durch die Luft wie eine Puppe, landete im Rinnstein. Hu sprang aus dem Auto, untersuchte die Schäden. Der rechte Scheinwerfer zerbrochen, Stoßstange und Kotflügel merklich eingedellt. Sein Zorn richtete sich sofort gegen die Tibeterin, er wollte sich ihr zuwenden und sie beschimpfen. Es war eine Greisin. Sie lag regungslos da, den Kopf weit, viel zu weit nach hinten gebogen. Genickbruch.
Hu hämmerte wütend mit seiner Faust auf die Motorhaube und verfluchte die trägen, primitiven und unbelehrbaren Tibeter. Konnten sie nicht einmal nach links und rechts sehen, bevor sie eine verdammte Straße überquerten? War das schon zuviel verlangt? Er stieg in den Wagen und ließ den Motor an, brauste davon, nach Hause oder in eine Kneipe. Jedenfalls zur nächsten Flasche Maotai. Über Mobiltelefon ließ er sich mit der Einsatzleitung der Verkehrspolizei verbinden.
»Es liegt eine Tote auf der Straße. Unfall mit Fahrerflucht. Sorgen Sie dafür, dass sie schleunigst weggeräumt wird, bevor ein Ausländer vorbeikommt und sie sieht.«
Niemand war um diese späte Uhrzeit auf der Mittleren Peking-Straße gewesen, kein Wagen hatte die Unfallstelle passiert. Es würde voraussichtlich Schwierigkeiten und einigen lästigen Papierkrieg geben, wenn er den Schaden an Scheinwerfer und Kotflügel meldete und die Kosten zurückerstattet haben wollte. Wegen der toten Tibeterin war ihm nicht bange. Es hätte ihn auch dann nicht gestört, wenn er gewusst hätte, dass er eben keine Tibeterin, sondern eine Chinesin getötet hatte, namens Zhao Bian, die seit vielen Jahren in Lhasa lebte. Selbst wenn ihn jemand gesehen haben sollte, bekleidete er ein Amt, das ihm immer und in jedem Falle recht gab. Sollte sich irgendein vorlauter Zeuge melden, dann würde er diesen sehr schnell darüber unterrichten, was gut für ihn war. Niemals wieder wollte Hu an die Greisin denken, die er durch seine Unachtsamkeit getötet hatte.
Niemals wieder sollte ihn jemand an diesen Unfall erinnern.
Er setzte seine rasante Fahrt fort und blickte sich nicht um.
Hätte er sich umgeblickt, so hätte er vielleicht die Umrisse einer Person bemerkt, die aus dem Mondschatten des Potala-Palastes huschte und zu der Toten eilte, sie hochnahm und in beide Arme schloss. Die den kleinen, gebrochenen Körper dann aufhob und wegtrug, bevor die Streife, die Hu alarmiert hatte, eintraf. Es war eine Frau, Ende Dreißig, die Hu noch nie zuvor gesehen hatte und die er niemals sehen würde. Hu Banguo würde nie ihren Namen hören, nie ihre Geschichte kennen und nie erfahren, dass sie es gewesen war, die ihm und seiner Behörde schon früher einigen Ärger verursacht hatte. Es waren Flugblätter gewesen und Plakate unbekannter Herkunft mit antichinesischen Hetzparolen. Separatistische Slogans gegen die Kommunistische Partei und die Volksbefreiungsarmee waren hastig im Vorbeigehen auf Wände gesprüht worden. Und sogar eine kleine Bombe war vor einigen Monaten in der Nähe des Hauptquartiers der Polizei hochgegangen, ohne jedoch großen Schaden anzurichten.
All das war das Werk dieser Frau gewesen.
Aber all das, obschon lästig, stand in keinem Verhältnis zu der Tragödie, die nun folgte, weil die Frau schlecht, sehr schlecht träumte. Und weil sie an diesem Abend in Lhasa die einzigen zwei Menschen sterben sah, die ihr alles bedeuteten. Den Mann, den sie liebte, und die Frau, der sie ihr Leben verdankte.
2. Kapitel
Boston, Massachusetts
Der Besucher aus Peking erschien pünktlich um 10.30 Uhr in der fünfzehnten Etage des Union-Hochhauses, in der geschmackvoll eingerichteten Kanzlei von Dr. Nyima Gyatso, in der postmodernes amerikanisches Büromobiliar und alte tibetische Kunst sich auf bemerkenswert natürliche Weise ineinanderfügten. Die Wände über den schlanken, lederbezogenen Designermöbeln waren verziert mit farbenprächtigen Thangkas, Heiligenbildern und Mandalas; in einer effektvoll beleuchteten Glasvitrine waren Vasen, Teekannen und Buddhastatuetten aufgestellt und zeugten von Kunstverstand sowie von der ungewöhnlichen Herkunft ihres Besitzers, Dr. Gyatso, der von Geburt und von ganzem Herzen Tibeter war und seiner Erziehung nach, sowie aus Überzeugung, Amerikaner.
Der Chinese stellte sich in äußerst holprigem Englisch als Feng Lizhao vor, ließ sich von Ms. Jocelyn seinen Mantel abnehmen, zog räuspernd seinen dunklen Anzug gerade. Das gute Stück war zerknittert und verrutscht vom langen Überseeflug. Offenbar war Feng direkt vom Flughafen hierhergekommen, und er bat auch gleich, Ms. Jocelyn, Dr. Gyatsos Sekretärin, möge ihm einen Platz auf der Nachmittagsmaschine reservieren. Er müsse unverzüglich wieder zurück. Er überprüfte im Spiegel den Sitz seines schwarzen Toupets, das ölig und straff auf seinem eckigen Schädel saß, und zwang sich ein unverbindliches Lächeln ab, als die Sekretärin ihn in das kleine Konferenzzimmer führte, in dem Dr. Nyima Gyatso und Targa, der Dolmetscher, ihn erwarteten. Zwischen den beiden jüngeren Männern, die ebenfalls westliche Anzüge und Krawatten trugen, saß – wie ein Gast von einem fernen Planeten – Tutseleg Gampo, einer der ersten Berater und Vertrauten des Dalai Lama. Sein magerer Kopf, schneeweiß umflort von stoppelkurzem Haar, ragte aus den Kragenfalten seiner tiefroten Mönchsrobe heraus wie der Schädel einer Schildkröte.
Der Chinese schüttelte ihre Hände. Ein kurzer, dynamischer Druck.
»Tee, Kaffee?« fragte Ms. Jocelyn pflichtbewusst mit einer säuerlichen Miene, als würde sie dem Gast das Getränk am liebsten ins Gesicht schütten.
Feng winkte dankend ab, als ahne er die Gefahr, und ließ seinen Aktenkoffer aufschnappen. Es bedurfte keiner langen Vorrede. Die drei Tibeter kannten Feng Lizhao und schätzten ihn ungefähr so, wie man einen lästigen, juckenden Hautausschlag schätzt. Vor allem kannten sie Feng, den zweiten Sekretär des Staatsrates in Peking und Tibet-Beauftragten des chinesischen Staatspräsidenten, als Autor von feindseligen Presseerklärungen, die den Dalai Lama als Separatisten und Scharlatan schmähten. Auch als aufwiegelnder Redner bei verlogenen Jubelfeiern in ihrer chinesisch besetzten Heimat trat er gelegentlich in Erscheinung und als unermüdlicher Verfechter einer harten, kompromisslosen Linie gegen die tibetische Exilregierung. Außerdem hatten sie recherchiert, dass Feng Lizhao als politischer Kommissar an der gewaltsamen Eroberung Tibets teilgenommen hatte und sich in seinem Bezirk, Dreglug, durch besondere Rücksichtslosigkeit den Respekt seiner chinesischen Vorgesetzten erworben hatte, die ihn danach zum Dank in die Verwaltung nach Peking beriefen.
»Nyima Gyatso, Sie wurden uns empfohlen als Vertrauensperson und juristischer Berater des Dalai Lama«, kam Feng unverzüglich zur Sache, während er verschiedene Aktenstücke aus seinem Koffern heraussuchte und vor sich auf dem Tisch ausbreitete. Er war ein schmaler Mann Mitte Sechzig, hatte kantige, straffe Gesichtszüge, wie mit einem Lineal gezogen. Er redete mit zusammengebissenen Zähnen, bewegte nur seine Unterlippe, bemüht, die perfekte Geometrie seines Antlitzes nicht zu zerstören.
Targa übersetzte die Worte des Chinesen ins Englische.
»Korrekt«, gab Nyima knapp zurück. Der Jurist hatte sich zurückgelehnt, die Fingerspitzen beider Hände aneinandergelegt und musterte den Chinesen aus schwarzen Augen, denen man ansah, dass ihnen Heiterkeit nicht fremd war. Seine fein gewölbten Lippen, von denen Mädchen und Frauen seit seinen Schultagen in Chicago, während seines Studiums in Harvard und einer Berufslaufbahn als Experte für Völkerrecht und internationale Beziehungen geschwärmt hatten und in dessen Winkeln ein gewinnendes Dauerschmunzeln wohnte, regten sich erwartungsvoll.
»Sie wissen, weswegen ich gekommen bin?« wollte der Chinese wissen.
»Es gab Andeutungen, aber nichts Konkretes.«
Die Pekinger UNO-Vertretung hatte sich durch einen Mittelsmann, einen gewissen Ma, an Nyima Gyatso herangemacht. Hatte unverbindlich vorgefühlt, ob er wohl eventuell bereit sein würde, einen Sondergesandten des chinesischen Staatspräsidenten in ungewöhnlicher und absolut geheimer Mission zu empfangen. Strengste Vertraulichkeit sei zwar oberstes Gebot, hatte Ma ihn wissen lassen. Allerdings sei gegen die Anwesenheit eines hohen Vertreters der tibetischen Exilregierung nichts einzuwenden. Im Gegenteil sei diese sogar erwünscht. Auch werde ein Dolmetscher gebraucht, denn der Gesandte aus Peking sei weder des Englischen noch des Tibetischen mächtig. Nyima sorgte dafür, dass Tutseleg Gampo aus dem nordindischen Dharamsala anreiste, wo der Dalai Lama im Exil lebte. Der alte Mönch galt vielen als die rechte Hand Seiner Heiligkeit. Und Nyima bat auch darum, dass Targa mitkommen sollte, der persönliche Dolmetscher des Dalai Lama für Chinesisch und Englisch. Mit beiden Männern verbanden den Juristen enge, persönliche Beziehungen. Targa hatte nach seiner Flucht aus Tibet drei Jahre in Boston studiert und war seinerzeit so etwas wie Nyimas Schützling gewesen. Gampo dagegen hatte dem damals sechsjährigen Waisen Nyima das Leben gerettet, als sie im Spätsommer 1966 aus ihrer Heimat flohen. Nyimas Zwillingsschwester hatte damals die Strapazen der Flucht nicht überstanden und war unterwegs gestorben.
»Ich bin als Direktor des Büros für Belange der Autonomen Region Tibet vom Staatspräsidenten der Volksrepublik China beauftragt, dem Dalai Lama durch Sie ein Angebot zukommen zu lassen«, sagte der Chinese und breitete vor sich auf dem Tisch seine Sammlung von Dokumenten mit bedeutsamen roten Siegeln, Stempeln und Unterschriften aus, so wie es ein Tapetenhändler mit seiner Musterkollektion macht. »Es ist ein Gesprächsangebot.«
Nyima hob ironisch seine gezupften Augenbrauen. »Ich fürchte, Sie haben den weiten Weg umsonst gemacht«, sagte er. »Wir kennen die Gesprächsangebote der chinesischen Führung zur Genüge; deswegen lehnen wir sie ja immer ab.«
Die Tür zu Verhandlungen über die Rückkehr des Dalai Lama aus seinem Exil in Indien auf den leeren Löwenthron in Lhasa stehe jederzeit offen, ließen die Chinesen sich immer mal wieder vernehmen – meist dann, wenn der internationale Druck wegen krasser Menschenrechtsverletzungen sich erhöhte und es galt, die Gemüter zu beschwichtigen. Aber, so ihre Bedingung, das geistige Oberhaupt der Tibeter müsse seine »spalterischen und politischen Aktivitäten« aufgeben, wie sie es nannten, und endlich die Herrschaft Chinas über Tibet anerkennen. Auch müsse er aussagen, dass Tibet schon immer ein Teil Chinas gewesen sei, und damit die altbekannte Position Pekings übernehmen. Wenn dies geschehe, dann sei er in Peking jederzeit willkommen. Die Chinesen erwarteten von Seiten des tibetischen Gottkönigs nichts weiter als eine Geste der Unterwerfung, mit der sie ihren Klammergriff um das gestohlene und vergewaltigte Land rechtfertigen und vergangenes Unrecht endlich vor aller Welt legitimieren konnten, um sich aus den negativen Schlagzeilen zu retten.
Targa, der Dolmetscher, dessen Augen aus irgendeinem Grund immer unter Wasser standen und dessen kurzgeschorene Haare wie ein schwarzer Kamm in die Luft ragten, setzte sich jedoch ruckartig auf, als Feng nun zu einem längeren Vortrag anhob. Der Dolmetscher kritzelte hastig Notizen auf einen Block, unterstrich die eine oder andere Stelle mit ungläubigem Staunen und begann, sichtlich betroffen, seine Übersetzung.
»Es ist ein Angebot, das einige neue Aspekte enthält«, stotterte er, den Blick ungläubig auf seine Kritzeleien geheftet, als hätten die Buchstaben begonnen zu tanzen. Und während er sprach, ließ Nyima seine Hände sinken und umfasste die Armlehnen seines Stuhles, als sitze er in einem Flugzeug, das gerade mit Getöse zum Start ansetzt. Gampo führte ein Glas Wasser zum Mund, setzte es wieder ab, ohne zu trinken, nur um es sogleich wieder aufzunehmen.
Dieses Angebot war in der Tat eine Neuigkeit.
»Erstens, der Dalai Lama muss zu Gesprächen nicht nach Peking reisen. Der chinesische Präsident würde sich mit ihm an einem neutralen Ort treffen und hält Nepal, das er in wenigen Tagen besuchen wird, für den geeigneten Ort einer geheimen Zusammenkunft. Zweitens, der Dalai Lama und der Präsident werden dort gleichrangig als die höchsten Vertreter ihrer Völker auftreten. Ziel der Gespräche ist ein Abkommen, das die Rückkehr des Dalai Lama nach Lhasa zum schnellstmöglichen Zeitpunkt vorsieht. Als religiöses und« – hier schluckte Targa schwer, als habe er einen trockenen Kieselstein im Halse – »und als politisches Oberhaupt des tibetischen Volkes …«
»Du musst dich verhört haben«, unterbrach ihn Nyima erstaunt und ungeduldig. »Ein Chinese, noch dazu einer wie er, würde doch niemals die Bezeichnung ›tibetisches Volk‹ in den Mund nehmen!«
»Das hat er aber getan. Und warte! Es kommt noch besser: Für die Verfehlungen und Exzesse der chinesischen Politik gegenüber Tibet und den Tibetern bietet der chinesische Staatspräsident eine formelle, öffentliche Entschuldigung an und schlägt vor, die Beziehungen zwischen Lhasa und Peking auf die Grundlage der Formel Ein Land – zwei Systeme zu stellen, also wie im Falle Hongkongs. Die Tibeter können zu einem Zeitpunkt, der ihnen selbst als richtig erscheint, über ihre – jetzt halt dich fest! – über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Nyima, Gampo – das muss eine Falle sein … das würden die Chinesen doch niemals zulassen.« In Targas feuchten Augen glänzten Ratlosigkeit und Verblüffung. Nyima kritzelte stirnrunzelnd nun seinerseits Notizen auf einen Zettel.
Gampo, der alte Geistliche, schüttelte langsam seinen Schildkrötenkopf. Aus vielen verschiedenen Quellen hatte er gehört, dass der Präsident in Peking anders als seine stocksteifen und konservativen Vorgänger ein liberaler und weltgewandter Mann sei. Ein Reformer, den manche »Chinas Gorbatschow« nannten. Nur hatte es bisher niemand für möglich gehalten, dass dieser Mann tatsächlich so weit gehen würde wie damals der Russe, nämlich die Auflösung des Staatsgebietes zuzulassen.
Feng Lizhao, der ihr Misstrauen witterte, baute flink eine Erklärung ein. »Der Präsident, meine Herrschaften, geht davon aus, dass die Tibeter ihren Vorteil erkennen und weiterhin im chinesischen Staatsverband verbleiben. Aber er ist der unumstößlichen Auffassung, dass sie diese Frage selbst entscheiden sollen. Ein ähnliches Angebot wurde übrigens auch in aller Verschwiegenheit den Taiwanesen unterbreitet.« Feng Lizhao, ihre Verwirrung auskostend, gönnte sich nun seinerseits ein feines Lächeln, das sein spitzwinkeliges Gesicht vorübergehend in Unordnung brachte. »Die Tibeter im Exil haben in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass sie mit einem strengen China umgehen können. Ihr Dalai Lama hat dafür sogar den Nobelpreis bekommen. Nun wollen wir einmal sehen, ob Tibet auch mit einem offenen und demokratischen China umgehen kann. Vielleicht wird ja auch unser Präsident mit dem Friedenspreis ausgezeichnet.« Nun lachte er sogar: »Das wäre wirklich ein schwerer Schlag für unsere Feinde, nicht wahr …«
Eine undenkbare Vorstellung, hätte Gampo vor einer halben Stunde noch bitter aufgelacht. Aber nun schien ihm, als sei alles möglich. Wenn China tatsächlich Taiwan und Tibet von der Kette ließ, dann wäre die Welt nicht mehr die alte. Und wenn er es recht bedachte: Vielleicht würden sich die Tibeter in einer freien Abstimmung einem solchen freundlichen China tatsächlich freiwillig anschließen. Sie waren – zumindest in politischen Belangen – ein naives, weltfremdes Volk. Mit ein wenig Überredungskunst konnte man sie sicherlich überzeugen, dass sie eigentlich zu Dänemark gehörten. Möglicherweise war dies ja gerade das Kalkül der Besatzer. Die Chinesen, das hatte er in jahrzehntelangem Umgang mit ihnen gelernt, taten nie etwas ohne Kalkül. Dies galt besonders für ihre Friedensangebote.
»Ich muss diesen Vorschlag erst eingehend prüfen und mit Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, genauestens durchsprechen«, sagte Nyima ausweichend, blätterte durch die in Englisch und Chinesisch bedruckten Seiten, die ihm der Chinese über den Tisch zugeschoben hatte.
»Gewiss. Bitte beachten Sie auch die Passagen, in denen eine gründliche Kontrolle aller unserer Vorschläge und Zugeständnisse in den Bereichen Menschenrechte und Religionsfreiheit durch unabhängige, internationale Organisationen gewährleistet wird. Und lesen Sie auch sorgfältig den Abschnitt über die Rückführung aller entwendeten Kunstgegenstände und kulturellen Schätze. Der Präsident meint es sehr ernst, meine Herren. Aber lassen Sie mich noch eine Warnung anfügen: Es gibt in unserer Führung und sicherlich auch in Ihren Kreisen einige Kräfte, die eine derartige friedliche Einigung nicht hinnehmen wollen. Wir haben, das kann ich hier ganz offen sagen, große Probleme mit Teilen der Armee und dem linken Parteiflügel. Ich nehme an, auch Sie werden mit manchen Gruppierungen der Exilgemeinde Schwierigkeiten bekommen. Nicht alle stehen hinter dem Dalai Lama und würden seine Rückkehr begrüßen. Ich denke besonders an die Kamdhar-Gyor-Sekte. Wir beide, die chinesische Regierung und die tibetische Exilregierung, bewegen uns in dieser Frage auf sehr dünnem Eis. Zumindest so lange, bis es den ersten erfolgreichen Kontakt zwischen unserem Präsidenten und dem Dalai Lama gegeben hat und wir mit einem positiven Ergebnis vor die Weltöffentlichkeit treten können. Ich bitte Sie also noch einmal und mit allem Nachdruck, dieses Angebot und unser Gespräch mit der allergrößten Diskretion zu behandeln.«
»Natürlich«, beruhigte ihn Nyima. »Sie können sich auf uns verlassen.« Nie hätte er gedacht, jemals einem Vertreter der chinesischen Regierung diese Worte zu sagen. Und nie hätte er erwartet, folgende Worte von einem Chinesen zu hören:
»Und Sie sich auf uns.« Feng Lizhao erhob sich und reichte jedem der drei Männer die Hand. Kurz und geschäftsmännisch.
»Lassen Sie uns über unseren Kollegen Ma in New York wissen, ob Sie dem Treffen in Kathmandu zustimmen. Und zögern Sie nicht zu lange. Der Staatsbesuch wird in wenigen Tagen beginnen.«
Damit schritt er, gefolgt von Nyima und Targa, zur Tür hinaus, ließ sich von Ms. Jocelyn in seinen Mantel helfen und vergewisserte sich durch einen Blick in den Spiegel, dass das Toupet immer noch perfekt auf seinem Schädel saß.
Nyima schloss hinter dem Chinesen die Tür und atmete tief durch. »Keine Anrufe, Ms. Jocelyn, ich bin für niemanden zu sprechen. Targa – tut mir leid, aber aus unserem Abendessen wird nichts –, ich muss das hier Buchstabe für Buchstabe durcharbeiten« – er winkte erklärend mit der Mappe.
»Was meinst du, Gampo?«
Der Vertraute des Dalai Lama saß in dem Bürosessel, der ihm viel zu komfortabel schien, um bequem zu sein, und schüttelte wieder sein greises Haupt. »Ich denke, Seine Heiligkeit wird das Angebot annehmen, wenn es auch nur halbwegs ehrlich gemeint ist. Er ist nicht mehr der Jüngste, weißt du. Er spricht oft davon, wie gerne er nach Lhasa zurückkehren würde … aber ich weiß nicht, Nyima. Es kommt alles so plötzlich …«
»Ja, sicher …«, sagte der junge Rechtswissenschaftler. Für die entrückten Lamas, deren Denken noch immer nicht den Sprung aus dem alten Tibet in die Gegenwart vollzogen hatte, kam schließlich immer alles so plötzlich, weil sie eben nichts von Realpolitik verstanden. Aus diesem Grund hatten die Chinesen ja damals ihre Heimat mit Leichtigkeit an sich reißen können. Weil sie es so plötzlich taten und die ahnungslose tibetische Regierung einfach überrumpelten. Aber heute gab es zum Glück Tibeter wie Nyima. Solche, die sich auskannten. Sein Name stand unter Gutachten und Expertisen, die die amerikanische Regierung oder die Vereinten Nationen in Auftrag gegeben hatten. Seine Vorträge waren die Glanzpunkte jeder Tagung von Völker- und Handelsrechtsspezialisten. Ein Dutzend international operierende Konzerne führten ihn, der nicht mal vierzig Jahre alt war und fit aussah wie ein frischer Dreißiger, auf ihren Gehaltslisten. Seine Telefonnummer fand sich im Adressbuch jedes Nachrichtenproducers, wenn mal dringend ein fachkundiger O-Ton zur Situation am Persischen Golf, in Lateinamerika, Afrika oder natürlich zu China und Tibet gebraucht wurde. Denn Dr. Nyima Gyatso kannte sich in den Paragraphen dieser Welt aus wie kaum ein zweiter, und er war ein begnadeter Redner sowie ein unterhaltsamer, gewinnender Interviewpartner.
Auch Nyima Gyatso wäre wie seine Schwester bei ihrer abenteuerlichen Flucht aus dem Schneeland beinahe gestorben. Fiebernd rang der damals Sechsjährige mit dem Tode, nachdem Tutseleg Gampo ihn mit letzten Kräften über die Grenzberge nach Nepal gerettet hatte. Die Ärzte im Flüchtlingslager hatten den Jungen schon aufgegeben, als Agnes Moriarty in sein Leben trat. Eine wohltätige, steinreiche Amerikanerin, die den Waisenjungen adoptierte und mit sich nach Chicago nahm, wo er unter Aufsicht der besten Ärzte tatsächlich bald genas, bald die besten Schulen besuchte, um schließlich mit Bravour in Harvard zugelassen zu werden. Er war Amerikaner geworden, aber niemals hatte er seine tibetische Heimat vergessen; er hatte seine stattliche Erbschaft zur Verfügung gestellt, um der tibetischen Exilgemeinde zu helfen, ein ganzer Flügel in der Schule von Dharamsala trug seinen Namen. Nyima Gyatso hatte vor allem deswegen Jura studiert, weil er das Unrecht, das seinem Volk widerfahren war, nicht hinnehmen wollte. Weil er wusste, dass irgendwann der Tag der Rückkehr kommen würde.
Er ließ den alten Gampo im Konferenzraum mit seinen Gedanken allein und zog sich in sein Studierzimmer zurück.
Targa, der Dolmetscher, trat, kaum dass Nyima die Tür hinter sich geschlossen hatte, schnell hinaus, um den Chinesen noch zu erwischen, bevor dieser im Aufzug verschwand.
»Was ist mit dem Thangka? Haben Sie es mitgebracht?«
»Es ist etwas schief gelaufen«, erwiderte Feng Lizhao, dessen Gesicht bereits hinter einer großen, dunklen Sonnenbrille verschwunden war. Seine innere Anspannung war ihm auf diese Art nicht anzumerken. »Das Thangka wurde zerstört.«
»Sind Sie sicher?« fragte Targa.
»Vollkommen.«
Feng hatte diesem Moment der Wahrheit mit größter Besorgnis und Furcht entgegengesehen. Der Moment, in dem er das unentschuldbare Versagen von Vizedirektor Hu, Wilde Kaulquappe aus Lhasa, eingestehen und noch dazu verantworten musste. Der ganze Handel mit den Kamdhar-Leuten hing doch schließlich daran, dass sie um jeden Preis das Schwarze Thangka haben wollten. Feng sollte ihnen helfen, das Thangka zu bekommen, und sie würden ihm dafür etwas zurückgeben, das ihm vor vielen Jahren abhanden gekommen war.
»Hören Sie, Targa, ich weiß sehr wohl, wie wichtig dieses Thangka Ihnen und Ihren Leuten war, und ich habe wirklich alles darangesetzt, es zu bekommen. Aber das Thangka ist leider durch ein Versehen zerschossen worden. Es ist zerfleddert, zerrissen und völlig unbrauchbar …«
Feng erwartete einen hysterischen Anfall, erwartete, dass Targa tobte und schrie, den Handel widerrief und ihre Abmachung für ungültig erklärte. Aber nichts dergleichen geschah. Es breitete sich auf Targas Gesicht ein seliges Lächeln aus. Im gleichen Moment erklang das dezente Pling des ankommenden Fahrstuhls.
»Ihre Belohnung wartet auf Sie in Tibet, Feng xiansheng. Die Sachen sind genau dort, wo sie damals abhanden kamen. Wir halten unser Wort. Ich hoffe, alles Weitere verläuft ebenso reibungslos.«
Feng verschwand im Lift. Sprachlos. Was, zum Teufel, war denn hier los? Erst setzte die verrückte Kamdhar-Gyor-Sekte, der Targa angehörte, Himmel und Hölle in Bewegung, um dieses Schwarze Thangka zu bekommen, und jetzt, wo es kaputt war, atmeten sie beglückt auf! Fengs scharfer Politikerverstand arbeitete schneller als die rotleuchtenden Zahlen des Countdowns auf der Liftanzeige. Bevor der Aufzug das Erdgeschoss erreichte, hatte Feng Lizhao beschlossen, dass hier noch mehr zu holen war, als er bisher vermutete. Sehr viel mehr. Hatte der glücklose Hu Banguo nicht unter Bücklingen versprochen, dass er einen namhaften Experten aufsuchen wolle, der das Bild sicherlich wieder zusammensetzen könne? Wenn die Kamdhar-Sekte ihm offenbar aus purer Erleichterung einen Sack voller Gold und Edelsteine dafür überließ, dass das Schwarze Thangka nicht mehr existierte, wie viel würden sie dann – aus Furcht – erst herausrücken, wenn das Schwarze Thangka wiederhergestellt war?
»Du willst mir weh tun? Dann hast du also das Schwarze Thangka«, so hatte einst eine Stimme zu ihm gesagt, die er, nüchtern zurückblickend, für ein Produkt seiner zu jenem Zeitpunkt reichlich alkoholbenebelten Phantasie hielt. Jetzt erst, mehr als dreißig Jahre später und in einem Lift in den Vereinigten Staaten, wurde ihm klar, dass dieses schmutzige tibetische Kind damals tatsächlich diese Worte gesprochen hatte. Weiter zu denken gestattete Feng sich nicht. Denn jeder weitere Gedanke hätte zu der völlig absurden Schlussfolgerung geführt, dass er in seinem Rausch tatsächlich einem leibhaftigen bösen Geist gegenübergestanden hatte.
Feng Lizhao, als er voller neuer Pläne das Hochhaus in Boston verließ und ein Taxi bestieg, wirkte wie ein Mann in Eile, der etwas zu verbergen hatte. Jedoch wusste er, dass im selben Moment ein Fotograf Aufnahmen von ihm machte und später auch die Mitarbeiter des Dalai Lama an derselben Stelle fotografieren würde. Die Fotos würden, zusammen mit den Kopien der streng geheimen Dokumente, zum gegebenen Zeitpunkt der Presse zugespielt und sollten beweisen, dass die chinesische Führung den Exiltibetern einen großzügigen und versöhnlichen Gesprächsvorschlag unterbreitet hatte. Feng ging mit dieser Sache ein hohes, persönliches Risiko ein. Was er tat, konnte ihm selbst bei wohlwollender Auslegung ein Verfahren wegen Hochverrats einbringen. Denn selbstverständlich hatte der chinesische Staatspräsident durchaus nicht die Absicht, einen Dialog mit dem Dalai Lama zu beginnen, diesem Verräter, Magier und Erzspalter des Mutterlandes. Der Staatspräsident hatte weder die Absicht, Versöhnung zu stiften, noch wusste er von Fengs Reise. Aber sobald er davon erfuhr – und davon, dass der tapfere, scharfsinnige Feng das leidige Tibet-Problem sozusagen im Handstreich gelöst hatte –, dann würde der Präsident ihm einmal mehr dankbar sein.
Denn die Fotos und die Kopien »seines« Angebotes würden sehr bald wichtiges Entlastungsmaterial sein, wenn die Welt sich die Frage stellte, wer den Dalai Lama ermordet hatte.
»Was sagt der Chinese?« fragte Ms. Jocelyn, als Targa triumphierend in die Kanzlei des Nyima Gyatso trat.
»Das Schwarze Thangka ist vernichtet«, flüsterte er und ergriff ihre Hände. »Der Weg ist frei für Kamdhar Gyor.«
3. Kapitel
»Mein Schüler und, ich darf das wohl sagen: mein Freund! Ich bin unendlich besorgt um Dich. Ich habe viele Jahre mit der Erforschung des Kamdhar Gyor verbracht, und nach allem, was ich daraus gelernt habe, muss ich Dich warnen: Wenn Du Dich ihm anschließt, dann begibst Du Dich in eine finstere Höhle, aus der nur wenige je wieder lebend herausgefunden haben. Ich weiß nicht, wo er herkommt, und ich verstehe nicht, was ihn antreibt, aber ich glaube, eines verstanden zu haben: Gyor ist ein Lügner und Betrüger. Er ist böse, er kennt keine Liebe und keine Vergebung, und er hat nur ein Ziel: Er will beherrschen.«
Prof. Li Rongwu in seinem letzten Brief
an Matthew Tanner
Südwestliches Tibet; Erdochsenjahr (629)
Örsö, Sohn des Pyul, der Schamane, kauerte die ganze Nacht neben der Quelle im Gras. Versunken in seinem weiten schwarzen Yakfellmantel, eine Kapuze bedeckte sein Gesicht, nur seine Nase und sein malmendes Kinn waren dem eiskalten Wind ausgesetzt. Er kaute getrocknete Raupenpilze und spuckte sie, vermischt mit seinem Speichel, in die vier Himmelsrichtungen, um den Klu anzulocken.
Als die ersten Sonnenstrahlen die schneebedeckten Gipfel der himmelhohen östlichen Berge in ein rosafarbenes Licht tauchten und die Umrisse der davorliegenden Hügel wie die Körper schlafender Tiere aus dem Schatten rückten, spürte er den giftigen, heißen Atem des Klu. Der Schlangengeist, der die Quelle und den Bachlauf beherrschte, beschnüffelte die ausgespuckten Raupenpilze und streifte leicht wie ein Lufthauch über die Grashalme, die sich unter seiner erdrückenden Präsenz beugten.
»Mächtiger Klu«, brummte der Schamane in einer Sprache, die nur er und der Wasserdämon verstanden, »ich bin gekommen, um deine Milde zu erflehen und Vergebung für die Unwissenden, die deinen Frieden gestört und deinen fürchterlichen Zorn herausgefordert haben.«
Der Klu antwortete nicht. Bedrohlich, feindselig umrundete er den Schamanen, der den Bewegungen des Wesens mit den Augen folgte und dabei auf das Murmeln und Glucksen des Baches lauschte, durch das der Klu zu ihm sprechen würde. Aus den Tiefen seines Ärmels holte er den phurba, den Geisterdolch, der aus dem Geweih eines Opferhirsches geschnitzt war, und rammte ihn tief in den Boden. Es war ein besonderes Stück, das seit Generationen im Besitz seiner Vorfahren war. In den Griff war der Kopf eines Yaks eingeschnitzt. Daneben legte Örsö einen Klumpen Yakbutter und die Schalen mit der Milch einer weißen Ziege und einer weißen ’bri, einer Yakkuh, die der Häuptling des vom Fluch heimgesuchten Dorfes ihm mitgegeben hatte, um den wütenden Dämon zu beschwichtigen sowie Bann und Krankheit von den Tieren und von seiner Sippe zu nehmen. In fünfhundert Schritt Entfernung, hinter einer aus grauem Gestein errichteten Mauer, beobachteten die Hirten, wie der sitzende Körper des Schamanen vom Quellnebel eingehüllt wurde.
Der Klu hielt inne.
»Du hast in deinem gerechten Zorn Elend über die Unwissenden gebracht«, fuhr der Schamane fort. »Sie haben ihren Fehler erkannt und mich gebeten, dich zu besänftigen. Ich bitte dich, nimm die Butter und die heilige Milch als Zeichen ihrer Unterwerfung.« Der Schamane erzitterte vor der unbeschreiblichen Kraft und der Bösartigkeit, die dieser Klu ausstrahlte. Ihm war, als würden die unsichtbaren Augen, die ihn musterten, Löcher in seine Seele brennen, als zermalme der Nebelleib des Wesens seine Brust. Dies war gewiss keiner von den kleinen, den untergeordneten Geistern, mit denen er es üblicherweise zu tun hatte, dachte Örsö alarmiert. Er wünschte, er hätte den zweiten Phurba, den mit dem Leopardenkopf, nicht dem Inder geschenkt. Er wünschte, er hätte ein größeres Stück Butter mitgebracht. Doch er wusste schon, dass nicht einmal die Geweihe aller dreitausend Opferhirsche, die zur Herbstfeier geschlachtet wurden, und nicht ein ganzer Berg von Yakbutter ihn retten konnten. Der gewaltige Klu hatte ihn in seine tödliche Umarmung genommen, sein gestaltloses Haupt lag ihm genau gegenüber, lauernd wie ein sprungbereites Raubtier. Der Geisterseher war ganz dem Mitleid eines Dämons ausgeliefert, der kein Erbarmen kannte.
Seit dem Anbeginn der Erde, noch bevor die Seelen der alten Könige sich zu hohen Bergkuppen verwandelten, bevor noch das erste Yak durch das erste Tal trottete, bevor noch der erste Adler seine Schwingen ausbreitete, bewohnte der Klu diese Quelle und bewachte den Eingang zur Schattenwelt. Er beherrschte den Lauf des Baches, der die Ebene bewässerte und die Menschen anlockte, die Nomaden, die nach und nach ihre Tuchzelte mit Lehmwänden befestigt hatten und in diesem Tal sesshaft geworden waren. Sie hatten mit ihrer Siedlung den Klu gestört, hatten das Wasser seines Laufes abgezweigt, um ihre Felder zu speisen und die Ställe zu versorgen. Einige hatten sogar im Wasser des Baches gebadet. Aber der Klu hatte bittere Rache genommen.
Zuerst starben die Tiere.
Schafe und Ziegen wanden sich in erbärmlichen Krämpfen, ihre Beine ausstreckend und anziehend, als wehrten sie sich verzweifelt gegen eine unsichtbare Kraft, die ihre Körper auseinanderreißen wollte. Die Yaks, die eben noch friedlich auf den Auen am Fluss grasten, sprangen plötzlich herum, warfen ihre mächtigen Schädel hin und her und stürzten stöhnend zu Boden. Die Hunde rannten wie toll um die Häuser, bellend, bis ihre Kehlen wund waren, bis sie winselnd vor Erschöpfung zusammenbrachen und krepierten, ihre Augen weit aufgerissen in Furcht. Noch ehe das letzte Huhn sich kreischend und scharrend in seinen Tod gefügt hatte, noch ehe das letzte Schwein unter entsetzlichen, in ihrer Verzweiflung fast menschlichen Schreien im Stall verendete, ergriff das Unheil auch die Menschen. Es belegte ihre Körper mit Fäulnis und schwärenden Beulen, die die Hände zerfraßen und die Augen austrockneten, bis sie ihre Lebenskraft verloren und ihre Seelen sich der grausamen Herrschaft des Klu unterwerfen mussten, zu Bachkieseln und Ufergestrüpp wurden. Viele niedere Schamanen und Beschwörer hatten bereits ihre Zauberkräfte an diesem Klu gemessen, waren aber erfolglos wieder ihrer Wege gegangen. Der Geist hatte sich ihnen noch nicht einmal offenbart. Da schickte der verzweifelte Häuptling Dakpo, dessen eigene Glieder bereits von der Fäulnis befallen waren, einen Boten zu Örsö, dem bedeutendsten aller Flussgeisterseher, von dessen magischen Fähigkeiten die durchreisenden Barden sangen und der zwei Tagesmärsche vom Dorf in einer Felshöhle am Berg von Dreglug wohnte, hoch über dem Fruchtbaren Tal.
Doch der mächtige Örsö erkannte nun, dass auch seine Kräfte nicht ausreichen würden, um es mit diesem furchterregenden, immensen Klu aufzunehmen, der sich vor ihm ausbreitete wie ein dunstiger Teppich und dessen übelriechende Aura das ganze Tal vergiftete bis hinüber zu den Hügeln. Zum ersten Mal seit er von seinem Vater die besonderen Rituale erlernt hatte, die ein Bönpo, ein Geisterseher, kennen muss, verspürte Örsö so etwas wie Angst, einen Schauer vor den Mächten, mit denen er sich hier eingelassen hatte. Diesen Klu konnte man mit noch so üppigen Opfergaben nicht besänftigen. Nicht mit den magischen Werkzeugen bannen. Dieser Klu war ein hoher Fürst der Unterwelt, der einen Weg nach oben suchte. Es musste, dessen war er sich nun sicher, das eifersüchtige Zornwesen sein, vor dem er den indischen Gelehrten gewarnt hatte. Es war der fürchterliche Klu Gyor, der Unbezwingbare, den nur eine Macht im ganzen Universum zähmen konnte: der zweite große Herrscher des Schattenreiches unter den Bergen, Zhidag, mit dem der finstere Gyor seine Macht teilen musste. Aber Zhidag war fern, bewohnte einen See im Tal des Königs. Örsö wusste, wie man ihn rufen konnte, aber er konnte dies nicht an diesem Ort. Er war in eine Falle geraten.
Das Plätschern des Wassers wurde wilder. Der Bach begann zu schäumen, Kiesel rieben sich aneinander. Endlich sprach der Klu zu ihm.
»Ich habe auf dich gewartet.«
»Mächtiger Klu«, begann Örsö. Weiter kam er nicht.
Die Hirten sahen, wie der Körper des sitzenden Schamanen emporgehoben wurde, wie er zwei Handbreit über dem Erdboden schwebte, wie der Flussnebel sich zusammenballte, für einen kurzen Augenblick die Gestalt einer riesigen Schlange annahm, um dann, als folge er einem unwiderstehlichen Sog, in den Leib des Bönpo zu fahren.
Häuptling Dakpo, um dessen Mund ein verfilzter Bart wie Unkraut wucherte, lag matt auf seinem Lager aus Wolfsfellen. Blinzelnd aus geröteten Augen sah er Örsö durch die niedrige Tür den runden Raum betreten. Er vermochte nicht zu sagen wie, doch der Schamane schien verändert. Größer vielleicht, kräftiger, sein Gang nicht mehr so gebeugt, seine Augen heller. Im Schatten der tief in die Stirn gezogenen Kapuze schienen sie zu glühen.
»Bönpo!« röchelte der Häuptling freudig. »Wie froh ich bin, dich in guter Verfassung zu sehen! Meine Hirten berichten voller Angst, der Klu sei in dich gefahren!«
»Deine Hirten sind noch dümmer als die Ziegen, die sie hüten.« Örsö baute sich vor dem Lager des verlotterten Anführers auf, der sich anmaßte, den Titel gyalpo – König – zu führen, und stemmte die Arme in die Seiten. Auch das stille und feierliche Wesen, das der Schamane gestern bei seiner Ankunft gezeigt hatte, war einer kühnen, beinahe feindseligen Haltung gewichen.
»Komm und teile eine Mahlzeit mit mir, Örsö. Ich lasse ein Schaf schlachten zu deinen Ehren.« Eine junge Frau in buntem Schürzenkostüm, reich geschmückt mit Lapislazuli, eilte herbei und half dem kranken Clanführer, sich aufzusetzen.
»Bemüh dich nicht. Ich bin auf dem Weg zur Festung des Königs. Ich kann mich nicht lange aufhalten.« Es war rüde, die Einladung eines stolzen Häuptlings abzulehnen, der über zweihundert berittene Krieger gebot. Selbst wenn der Häuptling krank und geschwächt war und tief in der Schuld des Bönpo stand. Einen Geringeren als den Seher Örsö hätte Dakpo sofort auf der Stelle erschlagen und sein Fleisch an die Hunde verfüttert. Doch er stand in der Schuld des Schamanen, der einen schrecklichen Fluch von seinem Land genommen hatte, und wenn er ihn hier tötete, würde sein ruheloser Geist für immer in seinem Haus bleiben.
»Und was ist mit deinem Lohn? Zwei Silberstücke habe ich dir versprochen!«
»Ich brauche dein Silber nicht.« Damit rauschte Örsö hinaus, sein langer Mantel kroch hinter ihm über die Schwelle wie ein gehorsames Tier.
Dakpo kam stöhnend mit Hilfe der jungen Frau auf die Beine und humpelte ins Freie, blickte der hochaufgerichteten Gestalt des Sehers nach, der sich auf den Pfad nach Westen begeben hatte. Die Sonne hatte die Hügel überwunden und übergoss das Tal des Dakpo mit strahlendem Morgenlicht. Eingerahmt von grauem Geröll und Sandhängen schimmerten grün die Weiden, auf denen die Yaks wieder grasten. Der Bach, der soviel Leid über das Tal gebracht hatte, glitzerte wie eine silberne Schlange.
»Sendet ihm zwei Krieger nach und bringt mir seinen Schädel«, befahl Dakpo. »Ich will aus seiner Hirnschale einen Feiertrunk nehmen.«
Hätten die beiden Krieger ihrem Herrn je Bericht erstatten können, so wäre ihre Erzählung höchst sonderbar ausgefallen. Aber sie kamen nie zurück. Nur ihre Pferde trabten am Ende des Tages mit hängenden Köpfen zur Koppel zurück. Der vermeintlich wehrlose Bönpo, in dessen Rücken die Angreifer mit gezückten Kurzschwertern herangaloppiert waren, warf, als sie eben zum Schlage ausholten, seinen Mantel ab, fuhr herum und ergriff die Klingen mit bloßen Händen. Er riss die Reiter zu sich hinab und zerschmetterte ihre Köpfe mit seinem Fuß. Gleichmütig, als habe er sich eines lästigen Ungeziefers entledigt, setzte er seinen Weg nach Lhasa fort, das er am Abend des folgenden Tages erreichte. Die Stadt war umlagert von siegreichen Armeen, die entlang des Flusses ihre Feuer entfacht hatten und sich grölend mit Hochlandgerstenwein berauschten. Ihre Pferde grasten am Flusslauf. Der Klu im Körper des Schamanen beschleunigte seine Schritte in der Nähe des Gewässers. Weiter ostwärts, in einem Teich im Schatten des Felsens, wohnte einer, dessen Aufmerksamkeit er auf keinen Fall erregen wollte.
Er marschierte durch das unbewachte Tor des Befestigungswalles und bestieg den Berg Marpori, den Roten Berg, der wie ein Turm aus der Talebene ragte und auf dessen Kuppe die Festung des 33. Königs Srongtsan Gampo stand.
»Ich will euren König sehen!«
Die Wächter hielten ihn für einen der Stammesältesten, die dem neuen Herrscher Tibets in diesen Tagen ihre Aufwartung machten, denn obwohl er ohne Krieger und zu Fuß eintraf, umgab ihn die Aura eines vornehmen Clanfürsten. Sie geleiteten den wortkargen Ankömmling in die mit roten Teppichen ausgelegte, niedrige Versammlungshalle, wo Srongtsan Gampo und seine Minister üblicherweise die Huldigungen und Treueschwüre der Unterworfenen entgegennahmen. Im Schein der Butterlampen kauerte die Elite des Staates um den Thron des Srongtsan Gampo, der unter wallenden Umhängen aus edlen, seiden- und brokatdurchwirkten Stoffen einen prunkvoll mit indischen Motiven verzierten Schmuckpanzer trug. Als Örsö eintrat, führte der König gerade gedankenvoll einen silbernen Kelch an den Mund. Der Besucher überragte die Wächter, die ihn flankierten, um Haupteslänge. Nicht nur seine Gestalt, auch sein dunkles Gesicht, die scharfe Nase, der breite Mund und vor allem die unheimlich blitzenden Augen geboten Respekt. Der König, ein Jüngling noch, unterbrach mit einem knappen Winken den Vortrag eines Ministers und blickte den Fremden amüsiert an.
»Wer bist du?«
»Mein Name ist Gyor Tongtsan«, sagte der Klu im Körper des toten Schamanen. »Ich bin gekommen, dem König von Tibet meine Dienste anzubieten.«
»Und welches sind deine Dienste? Ich habe Priester, habe Hellseher, habe Generäle, und wie du siehst, habe ich auch Minister.«
»Ich bin in der Tat ein Minister. Aber keiner wie diese da!« Eine abfällige Kopfbewegung ließ ein empörtes Tuscheln durch den Raum gehen.
Die Wachen horchten bei seiner beleidigenden Rede auf und traten näher an den Besucher heran, wagten es jedoch nicht, ihn zu berühren.
Der junge König lächelte befremdet. »Sprich schnell und sag, was du damit meinst, denn ich werde dir nicht lange zuhören.«
Der Mann erwiderte das Lächeln. »Ich meine damit, ich bin kein Minister wie Grompa, der deinen Vater vergiftete, oder wie Gsungbsang, der den Aufständischen von Zhangzhung deine Schlachtordnungen verkauft, oder wie Gsalsag, der deine zweite Frau beschläft.« Die Angesprochenen erblassten.
»Tötet den Lügner!« platzte Grompa heraus, der als erster seine Fassung wiedergewonnen hatte.
Die Wachen machten keine Bewegung, warteten auf ein Signal des Königs. Doch Srongtsan Gampo rührte sich nicht, blickte die angeklagten Minister der Reihe nach lange an. Dann wandte er sich wieder dem Mann namens Gyor Tongtsan zu. »Du scheinst viele Dinge zu wissen. Wenn du alles über meine Minister weißt – was weißt du dann über mich?« fragte er.
»Du willst ganz Tibet regieren und im Land der Berge ein mächtiges Reich errichten, das deinem Befehl gehorcht. Ich bin gekommen, um dir dabei zu helfen.«
Srongtsan Gampo nickte. »So sei es.«
Die Wachen stürzten sich auf seinen Fingerzeig auf die drei Minister, die sich unter den Augen der applaudierenden Versammlung verdattert zu ihrer Hinrichtung abführen ließen.
Nur einer saß in der Halle, der nicht in den Jubel einstimmte. Pandit Trichna, der indische Gelehrte, der den König und seine Gefolgschaft in den Lehren des Buddha unterwies und bei der Ausarbeitung der tibetischen Schrift und bei der Übersetzung der großen indischen Klassiker behilflich war, sah gebannt zu, wie Gyor Tongtsan sich seinen Weg zum Thron bahnte und sich zu Füßen des Herrschers niederkniete. Er kannte den Mann, wenn auch unter anderem Namen. Pandit Trichna war vor einiger Zeit ins Land aufgebrochen, um mit dem größten Bönpo, mit Örsö, Sohn des Pyul, Rat zu halten. Denn es herrschte Unruhe unter den Zaubermeistern des Schneelandes, seit der König sich zum Buddhismus bekannt hatte. Viele fürchteten um ihre Macht, ihr Ansehen und ihr Einkommen und machten, wo immer es ging, Stimmung gegen die Buddhisten. Der indische Lehrer hatte, darüber besorgt, den Schamanen in seiner Höhle aufgesucht und einige Tage bei ihm verbracht, mit ihm meditiert. Örsö war für tibetische Verhältnisse ein kluger und verständiger Mann. Er sah in den Lehren Buddhas keine Gefahr, sondern eine Bereicherung. Auch hatte er bereits eingesehen, dass es keinen Sinn machte, sich der Verbreitung dieses starken neuen Glaubens zu widersetzen, und er hatte vorausgesagt, dass sich auch die anderen Bönpo früher oder später in ihr Los fügen würden. Aber er hatte davor gewarnt, dass die Wesen der Unterwelt nicht stillhalten würden, wenn die Sterblichen sich von ihnen abkehrten, um andere, fremde Gottheiten anzubeten. Ganz besonders hatte er vor einem gewarnt: vor Gyor, dem Herrscher der unterirdischen Meere. Ein eifersüchtiger und böser Gott, der von nichts anderem getrieben wurde als von Hass und Gier und dessen Bosheit die Welt schon längst vernichtet hätte, wenn es nicht einen zweiten furchtbaren Geist, Zhidag, gegeben hätte. Einer uralten Legende nach waren sie Bastarde, hervorgegangen aus der Paarung einer Wölfin und eines Drachen; sie hassten und bekriegten sich, und ihre Kämpfe ließen die Erde erzittern und Feuerbälle vom Himmel regnen. Gyor suchte ständig nach einem Weg, um hinauf auf die Erde zu gelangen, und Zhidag hielt ihn immer wieder zurück in den schwarzen Gewässern eines unermesslichen, unterirdischen Ozeans, den sie beide bewohnten. Die Schneeländer opferten diesen beiden Geistern und beteten, dass es niemals dem Gyor gelingen würde, sein Gefängnis zu verlassen, denn wenn er kam, dann war das Ende der Welt nicht mehr fern.
Der Inder hatte seinem Gastgeber freundlich zugehört, bedächtig genickt und die Warnung aber letztendlich doch als das Geschwätz eines ahnungslosen, schneeländischen Magiers abgetan. Jetzt sah Pandit Trichna ein, dass er sich geirrt hatte. Jetzt wusste er, dass der Gyor seinen ungeliebten Bruder überlistet hatte und in die Welt der Menschen aufgestiegen war, wo er als erstes den größten aller Schamanen verschlungen und von seinem Körper Besitz ergriffen hatte.
Gyor Tongtsans sternenhelle Augen funkelten suchend über die Versammlung der Minister, Generäle und Geistlichen, als habe er die Witterung eines Feindes aufgenommen, als spüre er, dass irgendwo in diesem Raum jemand saß, der ihm gefährlich werden konnte. Pandit Trichna gewahrte in den Blicken des Fremden eine unbändige Kraft, die fähig war, die menschliche Seele zu entkleiden, ihr jedes Geheimnis zu entreißen und sie dann zu zerschmettern. Sterbliche waren für ihn nichts weiter als Puppen. Schnell verbarg der Inder sein Gesicht in die Falten seiner safranfarbenen Robe, beugte sich wie in tiefer Ehrfurcht vor, bis seine Stirn den Fußboden berührte, und zog sich schnell zurück, als Srongtsan Gampo die Versammlung auflöste, um sich allein mit seinem neuen Minister zu beraten. Pandit Trichna eilte in seine fensterlose Klause und kramte aus der Truhe, die seine wenigen Habseligkeiten barg, den Geisterdolch aus Hirschhorn hervor. Diesen hatte Örsö, der Schamane, ihm zum Abschied überreicht. Trichna wollte den Phurba bei seiner Rückkehr an die ehrwürdige Universität von Vikramashila im Norden Indiens den Studenten zeigen, wo er gewiss einige Heiterkeit und Kopfschütteln erregen würde. Aber als er den Dolch, in dessen Griff ein Leopardenkopf geschnitzt war, nun in die Hand nahm, wusste er mit einem Mal, dass es kein abergläubischer Hokuspokus war, mit dem er es hier zu tun hatte. Der Dolch war heiß wie ein glühendes Stück Kohle, und er zuckte, als zerre eine innere Kraft an ihm.
Der Dolch spürte die Nähe des Gyor. Und er war unfehlbar.
Die Tür flog auf, und das Wesen in der Gestalt des Örsö betrat den Raum. Hoch aufgerichtet stand es vor dem geduckten heiligen Mann.
Pandit Trichna war fast bewusstlos vor Schmerz. Der rotglühende Leopardendolch, den seine Faust umklammerte, verbrannte die Innenseite seiner Hand; er roch den widerwärtigen Geruch von versengter Haut. Der böse Quellgeist betrachtete ihn kalt aus bernsteinfarbenen Reptilaugen. Aber er konnte ihn nicht töten. Nicht solange er den Dolch des Örsö fest in der Hand hielt. Der Inder sammelte seine ganze Kraft. Er richtete sich auf, setzte sich dem todbringenden Blick des Dämons aus. Wenn er nun versagte, wären das letzte, was er in diesem Leben sehen würde, die schmalen gelben Augen des Gyor. Aber er versagte nicht. Pandit Trichna fühlte neue Kraft in sich aufbranden, sein eiserner Glaube und der Bann des Phurba verfehlten ihre Wirkung nicht.
»Ton shu ima – geh weg!« keuchte er. Plötzlich ergriffen von verzweifeltem Mut machte er einen Schritt auf das Wesen zu – es wich zurück! Der glühende Dolch hatte das Fleisch seiner Hand beinahe weggebrannt. Pandit Trichna wusste nicht, wie lange er dem betäubenden Schmerz noch widerstehen konnte. »Ton shu ima«, wiederholte er.
Ein schauerlicher Ton entfuhr der Kehle des Wesens, ein Knurren, ein Fauchen, ein widerwärtiges Rülpsen – plötzlich verschwand es und ließ den Inder allein.
Schluchzend vor Angst und Pein sank Pandit Trichna in die Knie. Nichts, nichts konnte ihn mehr in diesem Land halten. Er sehnte sich nach der kultivierten Umgebung der Universität. Nach den gelehrten Disputen der Äbte und nach Sicherheit, weit weg von diesem Dämon.
Nur eines war er den Schneeländern noch schuldig. Er musste ihnen das Vermächtnis des toten Schamanen hinterlassen. Denn Örsö hatte prophezeit, dass eines Tages dieser Geist fürchterlich zu wüten beginnen würde, und wer immer es mit ihm aufnehmen wollte, habe nur diese eine Chance: den Zhidag herbeizurufen, denn nur dieser könnte Gyor wieder in die Unterwelt ziehen.
Die ganze Nacht über arbeitete er an seiner letzten, verzweifelten Nachricht. Ungeschickt und unter entsetzlichen Schmerzen in seiner Hand fertigte er ein Thangka in Schwarz. Darin schlug er den Geisterdolch ein, fest entschlossen, ihn nie wieder zu berühren.
Er verließ Lhasa am nächsten Tag im Morgengrauen.