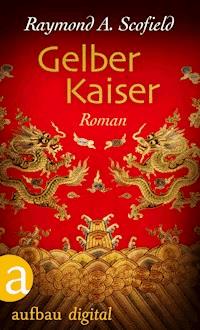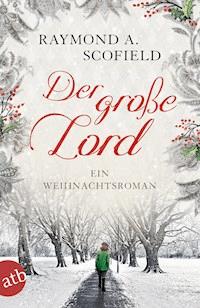8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die junge Ma Li von einem Mädchenhändler im Jahr 1919 nach Shanghai gebracht wird, hat sie einen großen Traum. Sie will in einem Jadeplast wohnen, wie ihn ihre Mutter oft beschrieb. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus: Ma Li gerät an einen Gangsterboss, verliebt sich in einen Revolutionär und heiratet einen reichen Fabrikbesitzer. Doch nie verliert sie ihren Traum aus den Augen ...
Eine faszinierende Saga um Liebe, Macht und den Glauben an die eigenen Ziele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Raymond A. Scofield
Raymond A. Scofield heißt eigentlich Gert Anhalt und ist Reporter beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Viele Jahre hat er für das ZDF aus China und Japan berichtet und zahlreiche Romane und Thriller verfasst, darunter »Der Jadepalast« und »Die Tibet-Verschwörung«. Zuletzt erschien von ihm der Bestseller: »Der große Lord« – eine Fortsetzung des Klassikers »Der kleine Lord« von Frances Hodgson Burnett.
Informationen zum Buch
Als die junge Ma Li von einem Mädchenhändler im Jahr 1919 nach Shanghai gebracht wird, hat sie einen großen Traum. Sie will in einem Jadeplast wohnen, wie ihn ihre Mutter oft beschrieb. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus: Ma Li gerät an einen Gangsterboß, verliebt sich in einen Revolutionär und heiratet einen reichen Fabrikbesitzer. Doch nie verliert sie ihren Traum aus den Augen.
Eine faszinierende Saga um Liebe, Macht und den Glauben an die eigenen Ziele.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Raymond A. Scofield
Der Jadepalast
Roman
Inhaltsübersicht
Über Raymond A. Scofield
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
1. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
2. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
3. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
6. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
3. Kapitel
3. Kapitel
Epilog
Impressum
Prolog Shanghai
Die drei schwarzen, amerikanischen Limousinen mit den abgedunkelten Scheiben fuhren achtlos über rote Ampeln, durchtrennten wie scharfe Messerklingen das unentwirrbare Knäuel aus Bussen, Lastwagen, Personenwagen, Motorrädern, Fahrrädern und Fußgängern, die zu dieser Vormittagsstunde alle Kreuzungen der Stadt hoffnungslos verstopften. Hälse reckten sich neugierig oder erbost aus der Menge der Aufgehaltenen. Vier schwere, weiße Polizeimotorräder japanischer Bauart bahnten den schwarzen Luxusschiffen den Weg durch die Fluten des Montagmorgens – mit ihren grellrot blitzenden Warnlichtern und Sirenenkreischen, unterstützt von ohrenbetäubenden Lautsprecheransagen: »Weg da! Bahn frei! Der blaue Audi – rechts ranfahren – sofort!«
Fast verzweifelt tönte ihnen das atemlose Konzert von Trillerpfeifen der Verkehrspolizisten hinterher, die – beide Arme ausgestreckt – bemüht waren, sich den Wogen des Berufsverkehrs so lange in Todesverachtung entgegenzustemmen, bis die Ehrengäste der Stadtregierung unbehelligt an ihrem Kontrollpunkt vorbeigerast waren und Kurs auf die Brücke hinüber nach Pudong genommen hatten.
Ein dunstiger, schwüler Sommermorgen in Shanghai. Eine im grauen Nebel unsichtbare Sonne schien die feuchten Wolken und den Smog herunter auf das Häusergetümmel zu drücken, als wolle sie die ganze Stadt noch vor der Mittagsstunde ersticken.
»Jesus Christus! Haben Sie das gesehen? Da haben nur zwei Fingerbreit gefehlt!« kreischte der furchtsame Dennis Marshall auf, als der wuchtige Kühler eines Lastwagens hinter der getönten Scheibe ihrer Limousine vorbeiwischte. Marshall, Diplom-Übersetzer für Wirtschaftschinesisch, hatte während dieser haarsträubenden Reise vom Hotel durch die morgendliche Großstadt angstvoll seinen Hintern zusammengekniffen wie sonst nur während des Startens und Landens im Privatjet seines Arbeitgebers. Er saß kerzengerade auf seinem Platz – was eine Leistung war, denn die Polster der Sitze waren so weich und vereinnahmend, als würde man in einem riesigen Marshmellow hocken. »Das ist ja wie eine Fahrt mit der Achterbahn!« rief er. »Entsetzlich!«
»Unsere chinesischen Gastgeber wollen uns offenbar zeigen, daß wir etwas Besonderes sind«, stellte Chalmers Dixon fest, der neben ihm saß und dessen massiger Körper den gesamten Rest der Rückbank ausfüllte. »Nette Show, die sie da bieten. Ich weiß so was zu schätzen. Das hat Stil, wirklich. So und nicht anders hätte ich das von der Drachenlady erwartet …« Er dachte an das bemerkenswerte Gesicht dieser Frau, Lucy Wang, mit der er den epochalen Deal ausgehandelt hatte.
Sie war eine zugeknöpfte, strenge Person. Eine Frau, der keine Leidenschaft fremd war, weil sie alle gekostet, besiegt und unterworfen hatte. Körperlich klein – zerbrechlich fast wollte sie erscheinen. Ihre Stimme war hoch und dünn, beinahe zart, aber diese Frau war hart und scharf geschliffen wie ein Diamant, und wer sich vor ihr nicht in acht nahm, der zahlte teuer. Ihre Grazie war Berechnung, ihr Charme ein schleichendes Gift, ihre Blicke waren mal sanft wie das neckische Kitzeln einer Feder, mal scharf wie Skalpelle. Diese Frau hatte nichts weiter im Sinn als das Wohl ihres Imperiums. Derjenige, der ihr dabei im Weg stand, hatte nichts zu lachen. Die Drachenlady Lucy Wang, Gebieterin über schätzungsweise 450 000 Arbeiter, Angestellte, Manager und Ingenieure. Chinas reichste Frau und bei weitem bedeutendste Unternehmerin.
Chalmers Dixon hatte sie lange umgarnt und umworben, und schließlich hatte er sie gewonnen. Oder sie ihn? Gleichviel – der fette Amerikaner war zufrieden. Der Vertrag wartete unterschriftsreif im 45. Stockwerk des Wang-Buildings. Heute würde eine glanzvolle, neue Ära der internationalen Handelsgeschichte beginnen. Dixon Inc., der Handelsgigant, der weltbeste Discounter, der gefürchtete Killerhai aus Des Moines, Iowa, war bereit für seine Vermählung mit WIS, Wang Industries Shanghai, dem 800-Pfund-Gorilla des modernen Orients. Wangs Fabriken, unter anderem eine ganze Stadt von Fabriken flußaufwärts am Yangtze, waren die Werkstatt der Welt. Es gab nichts irgendwo auf diesem Planeten, das nicht WIS schneller, besser und vor allem billiger herstellen konnte, gleichgültig, ob Schuhe, Autoreifen oder Microchips. Wenn die Unterschriften geleistet und die Dokumente ausgetauscht waren, würde ein neues Zeitalter im pazifischen Raum beginnen. Ein goldenes Zeitalter.
»Ich kann das nicht mit ansehen!« wimmerte Dennis Marshall nach einem weiteren, mörderischen Überholmanöver ihres chinesischen Fahrers.
»Wir sind ja gleich da!« ließ sich ungeduldig Dr. Trescott vernehmen, Dixons Advokat, der den beiden gegenübersaß und auf seinem Schoß die Unterlagen der geplanten transpazifischen Firmenehe balancierte und sie ebenso hartnäckig wie erfolglos ein allerletztes Mal nach versteckten Fallstricken durchforstete. Chinesen, so seine tiefsitzende Überzeugung, konnte man nicht trauen. Chinesen logen. Chinesen hatten immer ein verstecktes As im Ärmel – besonders die aus Shanghai. Doch wohin er auch sah – er fand keine Ungereimtheit, keine Zweideutigkeit. Der Deal war sensationell und bahnbrechend. Er brachte Zugang für Dixon und seine Partner zum chinesischen Cybermarkt inklusive E-Commerce, er brachte die verlockende Aussicht von Dixon-Discount-Stores im Land der 1,4 Milliarden Konsumenten. Er bot den Chinesen dafür Lizenzen, Importvergünstigungen und Vertriebswege für WIS in Amerika. Die chinesische Drachenlady und der amerikanische Killerhai waren – jedenfalls vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen – das perfekte Liebespaar des 21. Jahrhunderts. Die Chinesen produzierten konkurrenzlos billig die Ware, von der die Amerikaner nicht genug bekommen konnten – Schuhe, Spielzeug, Mobiltelefone, Computer –, und die Amerikaner verkauften den Chinesen Autos, Filme für ihre DVD-Player und Software für ihre Computer. Dixon Inc. und WIS wurden dabei reich und immer reicher.
Die drei Limousinen verlangsamten ihr Tempo und bogen in eine elegante, von Palmen gesäumte Zufahrt ein. Sie hatten das WIS-Hochhaus erreicht – ein imposantes, futuristisches Gebilde aus Glas, Stahl und Beton inmitten der Hochhaussiedlung von Pudong, dem modernen Geschäfts- und Finanzbezirk Shanghais. Vorneweg fuhren die Repräsentanten der Stadtverwaltung. Im Wagen hinter ihnen befanden sich die beiden Vertreter der Zentralregierung aus Peking, die das Abkommen mit dem Siegel der höchsten Autorität im Lande zu versehen hatten. Mitreden durften sie nicht. Madame Wang bestimmte allein und ohne Einmischung. Funktionäre und Bürokraten aller Gewichtsklassen fraßen der Drachenlady dankbar aus der Hand. Türen flogen auf, livrierte Diener huschten herbei, um die illustren Herrschaften aus den Limousinen zum Glasportal zu geleiten.
»Let’s Boogie«, sagte Dixon, was er immer sagte, wenn eine wichtige Herausforderung vor ihm lag, und wuchtete sich aus seinem Sitz empor. Doch da drückte eine Hand ihn unversehens und unsanft zurück in seinen Sitz, und auch Dolmetscher Dennis Marshall, der auf der anderen Seite endlich aus dem Wagen steigen wollte, fand den Ausgang blockiert.
»Was, zum Teufel, ist denn jetzt los?« protestierte Anwalt Trescott. »Werden wir gekidnappt?«
»Sorry«, radebrechte der chinesische Boy, während er die Tür der Limousine wieder zuschlug und eine militärisch stramme Haltung einnahm. »Important – wichtig!«
»Was hat das zu bedeuten?« grunzte mißmutig und alarmiert Chalmers Dixon und blickte sich ungeduldig um. Die uniformierten Türsteher, die eben noch diensteifrig den Ausländern den Weg ins Wang-Gebäude weisen wollten, hielten die Gäste nun in ihrer Limousine unter Verschluß, erstarrten und rissen sodann ihre Mützen vom Kopf, um sich tief zu verbeugen.
»Was soll das, Marshall?« fragte ein nervöser Dixon. »Sehen Sie was?«
»Sie nehmen uns gefangen!« quiekte Anwalt Trescott. »Wir sind Geiseln der Chinesen. Ich wußte doch, daß der Deal einen Haken hatte!«
»Ich weiß auch nicht, was das soll!« stammelte Marshall.
Dann sah er die Gestalt.
Unendlich langsam einen Fuß vor den anderen setzend und schwer auf einen Gehstock gestützt, schritt sie die palmengesäumte Auffahrt zum hochmodernen Wang-Gebäude hinauf wie eine Besucherin aus einer anderen Zeit. Langsam und voller Würde wie eine müde Schildkröte. Beinahe im rechten Winkel nach vorne gebeugt, in die einfache, blaue Arbeitskleidung einer fernen Epoche gekleidet, welche die meisten Chinesen schon längst vergessen hatten. Ihr wirres Haar schimmerte schlohweiß unter einem Kopftuch aus grobem Stoff.
»Was ist los?« drängelte Chalmers Dixon, der nichts sehen konnte.
»Es ist nur eine alte Frau«, sagte Marshall.
»Eine alte Frau?« wiederholte Dixon verständnislos. »Was für eine alte Frau?«
»Ich weiß es nicht! Die Chinesen verehren das Alter. Ahnenkult, Sie verstehen doch …«, jammerte Marshall, der sich wünschte, er hätte eine bessere Erklärung. »Sie verehren eben ihre Vorfahren.«
»Aber ihre Vorfahren sind tot!« protestierte Trescott, als hochbezahlter Jurist ein Ausbund an Vernunft und Rationalität.
»Nicht diese! Offensichtlich.«
»Das ist doch unglaublich! Sie schleusen uns wie Staatsgäste durch den Verkehr, legen dabei die halbe Stadt lahm und sperren uns dann hier wegen einer alten Frau ein?« wunderte sich Dixon. »Das ergibt für mich keinen Sinn.«
Die alte Frau trug keine Schuhe, sondern Sandalen aus Reisstroh. Ihr Gesicht, soweit man unter den Falten des Kopftuches überhaupt erkennen konnte, war verrunzelt und eingefallen.
»Die muß schon über hundert Jahre alt sein«, sagte Dennis Marshall.
»Älter!« korrigierte Trescott, der schon aus beruflichen Gründen kaum eine Aussage gelten lassen konnte.
Die Alte schien nichts um sich herum zu bemerken und reagierte nicht auf die Verbeugungen des Personals. Zwei junge Männer sprangen herbei, öffneten ihr die Tür und verbeugten sich so lange, bis die Frau das Foyer des Wang-Gebäudes betreten hatte.
Erst als die schmächtige, gespenstergleiche Gestalt in der klimatisierten Marmorhalle verschwunden war, traten die jungen Männer beiseite und ließen die Gäste aussteigen. Mit einem halb amüsierten, halb verwirrten Gesichtsausdruck zupfte Chalmers Dixon seinen Anzug über dem massigen Bauch gerade und wandte sich dem Shanghaier Bürgermeister Xiang zu, der mit strahlendem Lächeln auf ihn zukam.
»Sie haben wirklich Glück gehabt«, sagte Xiang in passablem Englisch. »Ich selbst hatte sie bisher nur einmal mit eigenen Augen gesehen …«
»Wen? Die Alte da?« wunderte sich Dixon.
»Ja, die alte Frau.« Bürgermeister Xiang senkte den Blick, und seine Stimme begann ein wenig zu flattern. »Das war Wang Ma Li …«
Dixon blickte fragend auf Marshall, doch der Dolmetscher zog nur betroffen die Mundwinkel nach unten.
»Sie sind im Begriff, Wang Ma Lis Haus zu betreten«, erklärte der Bürgermeister. »Sie wollen einen Vertrag mit Wang Ma Lis Firma abschließen. Sie verhandelten mit Wang Ma Lis Urenkelin, Lucy Wang.«
»Die alte Frau ist also die eigentliche Chefin hier?« Dixon riß die Augen auf und deutete auf die Tür.
»Nein. Sie kümmert sich nicht mehr um die Geschäfte. Sie ist mehr als die Chefin. Viel mehr. Sie ist die Kaiserin im Jadepalast.« Xiang schüttelte den Kopf, als befreie er sich aus einem Traum. »Kommen Sie, wir wollen doch unsere Gastgeberin nicht warten lassen …«
Die drei Ausländer folgten ihm leicht verwirrt und bemerkten, daß sich die Türsteher vor ihnen nicht einmal halb so tief verbeugten wie vor der alten Frau.
1. Buch 1919Die Feuerpferde
1. Kapitel Xiezhuang, Provinz Shandong, Mai 1919
»Dein Haar ist so dünn. Es ist wie das erste Gras im Frühling, aber ganz trocken, ganz schwach.« Ma Li ließ die spröden Haarsträhnen immer wieder durch ihre Finger gleiten, führte sie an ihren Mund und küßte sie. Tränen liefen in brennenden Bahnen über ihre Wangen, erreichten ihren Mund und benetzten die Lippen. »Bitte, Lingling, laß mich nicht alleine. Laß mich nicht alleine mit der bösen Frau. Ich werde immer für dich da sein, das schwöre ich bei meinem Leben, aber du mußt auch für mich da sein!«
Linglings kleiner Kopf und ihr verwachsener Körper glühten wie ein Ofen. Ihr Atem war heiß und stank faulig wie der giftige Feueratem eines Höllendrachens. Manchmal stöhnte sie in ihrem todesähnlichen Schlaf auf, als griffen die Dämonen der Schattenwelt mit ihren schauerlichen Klauen nach ihr, um sie mit sich zu reißen. Ma Li hielt die Schwester in ihren Armen und drückte den fiebernden Körper an sich. »Ich gebe dich nicht her!« weinte sie. »Sollen sie doch kommen. Ich werde dich nicht loslassen. Da müssen sie mich schon zuerst holen.«
Sie wußte selbst nicht, woher sie den Mut nahm, denn nichts fürchtete die scheue Zwölfjährige mehr als die grausige Geister- und Höllenbrut, die nach Sonnenuntergang um die Häuser schlich, um die Alten und Kranken zu ergreifen und zu sich in die ewige Nacht zu zerren. Nicht einmal die böse Frau konnte ihr solche Schrecken einjagen wie die dunklen Wesen, die bluttriefenden Löwen, die häßlichen Hunde und die kopflosen Schlächter, die Raubvögel und Schlangen des Totenreiches, die ihre Mutter geholt hatten und lange davor auch ihren Vater. Ma Li war aber trotzdem fest entschlossen, ihre Schwester vor jeder noch so abscheulichen Ausgeburt der Hölle zu beschützen, denn Lingling war alles, was sie noch hatte auf der Welt. Zusammengekauert, in muffige Decken gewickelt, hockte Ma Li auf dem festgetretenen Lehmboden in der dunklen Küche, mit dem Rücken an den Ofen gelehnt, den sie die ganze Nacht am Brennen halten mußte. Wenn das Feuer erlosch, würde die böse Frau sie übel bestrafen. Einmal war das bereits passiert. Schläge hatten sie getroffen wie Blitze. Mit einem Holzscheit drosch die böse Frau auf sie ein, und vielleicht hätte sie das Mädchen gar erschlagen, aber da begann Lingling zu schreien. Vor Lingling, wenn sie schrie, hatte selbst die böse Frau Angst.
»Lingling, wir beschützen uns gegenseitig, nicht wahr?« flüsterte Ma Li ihrer fiebernden Schwester ins Ohr. Es war wie eine Beschwörung: »Niemand kann uns etwas anhaben. Wir sind stark. Wir sind die Kaiserinnen im Jadepalast. Wir spielen im Pfirsichgarten, du und ich. Wir tanzen mit den Schmetterlingen des Wohlergehens im Pavillon der tausend köstlichen Düfte. Bitte, Lingling, hör nicht auf zu leben …«
Auch diese Fiebernacht ging vorüber. Das graue Licht des Morgens sickerte durch die Mauerritzen. Hinter dem Vorhang im Stall begannen die Schweine zu grunzen, und die Enten regten sich – beruhigendes, vertrautes Geschnatter. Die Grimassen und Fratzen, die Klauen und Hufe der Dämonen verwandelten sich zurück in Töpfe, Kochwerkzeuge und zum Trocknen aufgehängtes Gemüse.
Schließlich flog die Tür auf, und die dicke Köchin polterte herein.
»Aufgestanden, faules Stück! Ofenholz holen!« brüllte sie ihren Morgengruß. Die Köchin war eine grobe, ruppige, aber dabei doch liebenswerte Frau. Jedenfalls war sie nicht böse – oder zumindest nicht so böse wie die böse Frau, und jeder, der nicht diese Bosheit besaß, wollte Ma Li beinahe liebenswert vorkommen. Die dicke Köchin hatte rötliche, fleischige Hände, die ganz rauh und voller Narben und Furchen waren, Hände, die lustvoll Teig walkten, mit bewundernswerter Geschicklichkeit das Hackmesser herumwirbelten und die fest und ohne Zögern zupackten, wenn ein Ferkel, ein Huhn oder eine Ente unter eben dieses Messer kommen sollten. Vor der Köchin, obwohl sie laut war und sie oft verprügelte, hatte Ma Li keine Angst. Im Gegenteil – sie wußte, daß auch die dicke Köchin Angst vor der bösen Frau Zhuang hatte, und das machte sie irgendwie sogar zu einer Verbündeten.
»Was liegst du da noch untätig herum?« kläffte die Köchin und machte sich in der Vorratskammer zu schaffen. Sie holte Mehl, Eier, Reis und Kohl für das Frühstück – die Dampfbrötchen und die Reissuppe.
»Lingling ist wieder krank«, erklärte Ma Li. Nicht, daß sie Trost oder gar Hilfe erwartete. Sie freute sich nur lediglich darüber, nach dieser schrecklichen Nacht mit einem leibhaftigen Menschen reden zu können und nicht mit einem feuerspuckenden Höllenfürsten.
»Ach, die Kleine ist doch immer krank«, grunzte die Dicke leichthin. »Irgendwann wird sie sterben. Das ist auch besser so. Niemand kann ihr helfen.«
»Ich kann ihr helfen!« protestierte Ma Li. »Und bevor ich sie sterben lasse, werde ich gegen jeden kämpfen, der ihr etwas zuleide tun will. Das habe ich heute nacht beschlossen.«
»Halt den Mund und geh Feuerholz holen, sonst kann ich den Gästen das Frühstück nicht zeitig richten, und du weißt, was dann passiert …«
Ma Li erhob sich und drückte Lingling wie ein Bündel fest an sich. Eine Weile stand sie so da und blickte ihre Schwester liebevoll an. Linglings Temperatur war zurückgegangen. Sie glühte nicht mehr und schlief nun friedlich. Vorsichtig, um sie nicht zu wecken, bettete Ma Li den winzigen Körper auf dem Lager neben dem Ofen.
»Sieh bloß zu, daß sie mich nicht wieder von der Seite angafft!« keifte die Köchin. »Ich kann das nicht vertragen.«
»Aber sie schläft doch!« entgegnete das Mädchen.
»Gleichviel! Sie soll mich nicht ansehen. Sie hat den bösen Blick.«
»Sie hat nichts Böses in sich«, widersprach Ma Li leise und eilte hinaus zum Holzlager.
»Diese Mißgeburt«, grollte die Köchin in sich hinein und vermied es, das schlafende Teufelskind auch nur anzusehen, sondern spuckte aus und vergrub ihre Hände im Mehl. »Weiß der Himmel, mit welchem Gnom, welchem Fuchsgeist, welchem ziegenköpfigen Dämon sich deine unselige Mutter eingelassen hat, um dieses kleine Monstrum zu empfangen.«
Zehn Jahre alt war das unheimliche Kind, aber es war so klein wie ein zweijähriges. Sein Körper, fahl und zerbrechlich, war mißgebildet und krank. Die Haut, ständig befallen von eitrigen Pusteln und Ausschlägen, war an manchen Stellen so dünn, daß man mit bloßem Auge das Blut in den Adern pulsieren sehen konnte. Der Kopf, unverhältnismäßig groß auf dem winzigen Leib, hatte stechende Augen und war voller Dellen und so häßlich wie die Schnitzereien der gräßlichen Drachenfratzen im daoistischen Tempel. Die Köchin hatte keinen Zweifel daran, daß von dem zwergenhaften Geschöpf eine Gefahr für jeden ausging, der es auch nur ansah. Es war überhaupt keine gute Idee, ein solch aberwitziges Wesen ausgerechnet in der Küche zu halten. Die mächtigen Küchengötter, die sich Respektlosigkeiten aller Art nicht gerne bieten ließen, hatten schon aus geringerem Anlaß ganze Großfamilien vergiftet und ausgerottet.
Aber zum Glück war ja bald alles vorbei! Die Köchin seufzte erleichtert. Die Wirtin, die listenreiche Frau Zhuang, hatte endlich dafür gesorgt, daß die Mißgeburt und ihre vorlaute, große Schwester auf eine lange, lange Reise gehen würden, und zwar noch an diesem Tag. Die fetten Hände der Köchin formten die mantou – die trockenen Dampfbrötchen – für die sieben Gäste, die diese laue Mainacht in der Herberge von Xiezhuang verbracht hatten. Einer dieser Gäste war ein Stammkunde, ein Herr aus Shanghai, der großen Stadt im Süden, und der hatte angeboten, das freche Gör und seine fürchterliche Schwester mitzunehmen und für immer aus ihrer Umgebung zu entfernen.
Der Moment war günstig.
Der Wirt war für ein paar Tage geschäftlich in der Provinz unterwegs. Er hätte es gewiß nie zugelassen, daß seine Frau die beiden Mädchen weggab. Noch dazu an einen Fremden mit fragwürdigen Absichten. Nicht, daß der Wirt so durchdrungen von Pflichtgefühl und Güte gewesen wäre. Wahrscheinlich machte sich der geile Bock schon heimlich Hoffnungen darauf, das Mädchen Ma Li in naher Zukunft als blutjunge Nebenfrau in Besitz zu nehmen – obwohl sie doch die Tochter seiner verstorbenen Base war. Frau Zhuang, deren eigene Schönheit längst verblichen war und deren einst anmutiges Gesicht nunmehr nichts weiter darstellte als eine Maske der Mißgunst auf alle Welt, hegte wohl ganz ähnliche Befürchtungen, aber sie war keine Frau, die wartete, bis andere handelten. Sie war resolut und skrupellos und entschlossen, sich diese Laus nicht in ihren Pelz setzen zu lassen. Deswegen hatte sie mit dem Herrn aus Shanghai die Abmachung getroffen, daß er Ma Li und Lingling mitnehmen sollte. Auf einen Preis von zwei silbernen, mexikanischen Dollarstücken für Ma Li und zwei billige Schnüre chinesisches Metallgeld für Lingling hatten sich die beiden Parteien spät am Abend geeinigt. Der vornehme Stadtmensch wollte versuchen, Ma Li in Shanghai als Haushaltshilfe zu vermitteln. Gute Haushaltshilfen würden in der großen Stadt immer gesucht, versicherte er. Die Köchin, die den unheiligen Handel belauscht hatte, konnte sich sehr gut vorstellen, was das zu bedeuten hatte. Es gab überall im Land, sogar im kleinen, provinziellen Xiezhuang, besondere Gasthäuser, in denen »Haushaltshilfen« vom Kaliber der kleinen Ma Li sich nützlich machen konnten. Ihre vermeintlichen Dienste als Haushaltshilfe waren sehr begehrt bei gewissen Herrschaften, die meinten, es komme ihrer eigenen Gesundheit zupaß, wenn sie sich an einer Kindfrau vergingen. Sogar für die mißgestaltete Lingling würden sich irgendwelche krankhaft veranlagte Interessenten finden. In einer großen Stadt gab es schließlich alle möglichen Abarten der menschlichen Begierde und des Aberwitzes. In den großen Städten und ganz besonders in Shanghai tummelte sich der gesamte Abschaum Chinas. All das und noch viel mehr wußte die Köchin, weil sie gute Ohren hatte und weil sie nicht vorhatte, Frau Zhuang diesen Handel tätigen zu lassen, ohne sich eine saftige Provision zu sichern.
Während Ma Li, schwer bepackt mit Feuerholz, in die Küche zurückkehrte, malte sich die Köchin aus, wie sie der Hexe Zhuang gegenübertreten und ihren rechtmäßigen Anteil fordern würde, da ansonsten der Herr Wirt leider erfahren mußte, daß seine beiden Nichten durchaus nicht durchgebrannt waren, wie Frau Zhuang ihrem Gatten weismachen wollte. Die Köchin allein würde dem Ahnungslosen berichten können, auf welchem Wege und mit welchem Ziel seine beiden Pflegetöchter das Haus, das Dorf und die Provinz verlassen hatten. Das war gewiß ein fettes Schweigegeld wert …
»Du lächelst so glücklich!« stellte Ma Li fest, als sie das Holz abgeladen hatte und Wasser holen ging.
»Kümmere dich um deinen eigenen Kram«, fauchte die Köchin. Ob sie sich mit den beiden Geldschnüren zufriedengeben sollte oder ob sie es wagen konnte, auch einen der begehrten Silberdollars zu beanspruchen?
»Ist dir etwas Lustiges passiert? Bitte erzähle es mir.«
»Schwatz nicht und mach deine Arbeit!«
Lingling erwachte und rappelte sich in ihrem Deckenlager hoch. Sie rieb sich die für den kleinen Kopf viel zu großen Augen und gähnte. Sofort lief Ma Li zu ihr und nahm sie in die Arme. Ihre Schwester erwiderte die Umarmung. Sie kniff dabei ihre Augen fest zusammen, denn sie wußte, daß es ihr verboten war, die Köchin anzusehen.
»Wahrscheinlich ist es das Beste für euch beide«, sagte die Köchin mehr zu sich selbst, als sie ihre mantou fertig geformt hatte und den Bastkorb herbeiholte, in dem sie über dem kochenden Wasser gedämpft wurden.
»Was ist das Beste für uns?« erkundigte sich Ma Li unschuldig.
»Das Beste«, echote Lingling. Sie sprach nicht mehr als vielleicht hundert Worte, aber auch wenn sie es sich nicht merken konnte, wiederholte sie begierig jedes neue Wort, das sie aufschnappte.
»Ich habe nichts gesagt«, wehrte die Köchin ab. »Wo ist das Wasser? Hol sofort das Wasser herbei!«
»Warte!« rief Lingling und folgte ihrer Schwester mit wackeligen Schritten. Ma Li nahm sie bei der Hand und führte sie hinaus. Es sah aus, dachte die Köchin, während sie den in Lumpen gekleideten Mädchen nachspähte, als ginge eine Zwölfjährige mit ihrer ausnehmend häßlichen Puppe spazieren.
Von hohen Mauern umfriedet und geschützt stand die Herberge des Herrn Wang am Rande der Kleinstadt Xiezhuang, die sich wuchernd wie ein Geschwür aus grauen Ziegeldächern und stinkenden Gassen auf dem alten Handelsweg hinauf zur Hauptstadt Peking ausgebreitet hatte. Als vor ein paar Jahren die Eisenbahn kam, war aus dem ehemals verschlafenen Marktflecken ein vibrierender Bienenstock geworden – eine Stadt von fünfzigtausend Einwohnern, weit genug entfernt von den grauen Bergen und dem Moor um einigermaßen sicher zu sein vor den Banditen und Mördern, die dort ihr Unwesen trieben. Die alten Stadtmauern, die in Zeiten des Krieges den feindlichen Armeen und plündernden Horden getrotzt hatten, waren längst zu klein für die stetig wachsende Bevölkerung geworden. In ihrem Schatten waren neue Behausungen gewachsen – die Hütten und Verschläge der Landflüchtigen, der Ausgeraubten und Verjagten. Auch Ma Li und ihre Mutter waren aus dem Hinterland nach Xiezhuang gekommen; Flüchtlinge aus einem Dorf unweit der großen Stadt Qingdao, das es nicht mehr gab. Auf der Flucht nicht vor Räubern und Mördern, sondern vor Chinas ältestem und erbittertstem Feind: dem Hunger. Wo Hunger herrschte, so hatte Ma Li erfahren, da erlosch alles. Freundschaft, Mildtätigkeit, Güte, Freundlichkeit und am Ende sogar Liebe. Wo Hunger herrschte, gab es keine Menschlichkeit mehr, statt dessen herrschte nur noch nackte Gier. Hunger trieb die Menschen zu Verbrechen und Bosheit. Es kam einem Wunder gleich, daß ihre Mutter, geschwächt und vom Tode gezeichnet, weil sie am Schluß nichts anderes mehr aß als nackte Erde, ihre Töchter noch in Sicherheit bringen konnte. In das Haus ihres Vetters Wang in Xiezhuang, den sie seit Ewigkeiten nicht gesehen hatte und den sie niemals um Hilfe gebeten hätte, wenn nicht der Hunger sie getrieben hätte.
Sie starb am Tag nach ihrer Ankunft. Das war im vergangenen Sommer gewesen, dem Sommer der Not und der sengenden Hitze, als die Ernte auf den Feldern verdorrte und die Flüsse und Kanäle austrockneten und sich der Staub des Todes darin sammelte.
Vetter Wang, der Herbergswirt, war alles andere als erfreut gewesen über die Ankunft seiner entfernten Verwandten und die Tatsache, daß sie ihm als allererstes die Kosten für ihre Bestattung auferlegte. Doch wo er nur unfreundlich und abweisend gegen ihre beiden Waisentöchter war, da war seine Frau boshaft. Wo er gleichgültig war, war sie gemein. Wo er Milde zeigen wollte, riß sie das Ruder an sich und zeigte blanken Haß.
»Deine sogenannte Mutter war nichts weiter als eine Schlampe«, griff sie, wenn es ihr gefiel, Ma Li an. »Du und deine Mißgeburt von einer Schwester, ihr seid die Brut einer sittenlose Hure, die sich für Geld jedem dahergelaufenen Strolch hingab. Wo ist denn euer Vater? Ihr habt keinen, weil es keinen gibt!«
Ma Li schwieg, auch wenn es sie innerlich fast verbrannte. Sie wußte, daß nichts von dem stimmte, was die böse Frau Zhuang geiferte. Ihre Mutter war eine zärtliche und fürsorgliche Frau gewesen. Sie hatte ihre Töchter in Liebe aufgezogen und hatte Ma Li sogar zur Schule geschickt. Sie hatte obendrein ihr letztes Geld für einen Arzt in Qingdao ausgegeben, der Lingling allerdings auch nicht helfen konnte. Ihren Vater hat Ma Li nie kennengelernt – da hatte die böse Frau Zhuang recht, aber sie hatte einst ihren Vater gefühlt. Seine Hände, große, starke Hände um die sich ihre kleinen, blassen Finger schlossen. Das war Ma Lis einzige Erinnerung an ihren Vater – nein, es war nicht einmal eine Erinnerung, eher ein Gefühl von Wärme, Liebe und Sicherheit. Sie trug dieses Gefühl in sich und würde ihr Leben lang nicht aufhören, danach zu suchen. Vielleicht kam es auch von diesem Gefühl: das einzige Geschenk, das sie von ihrem Vater je erhalten hatte – sie konnte Hände lesen.
Die Hände der bösen Frau Zhuang etwa waren knochig, hart und voller spitzer Winkel. Hände, die nichts erschaffen konnten – nur zerstörten.
»Und als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre«, grollte die böse Frau Zhuang weiter, »bist du auch noch ein Feuerpferd. Das ist das schlimmste Sternzeichen, das es gibt. Feuerpferde verbrennen alles. Ihre eigene Familie. Was immer deinen Eltern zugestoßen ist – du bist schuld. Feuerpferde denken nur an sich selbst und niemals an andere!«
»Ich denke an Lingling!« hatte Ma Li widersprochen und es sofort bereut, denn die strafende Hand der Frau Zhuang traf sie hart am Hinterkopf. »Ich tue alles für Lingling!«
»Du weißt doch gar nicht, was es heißt, Opfer zu bringen«, kreischte die böse Frau. »Hier, ich zeige dir, was es heißt …« Sie riß sich die dünnen Seidenschläppchen von den winzigen Füßen und entblätterte aus den stinkenden Bandagen die Überreste zerschmetterter Knochen und verkrüppelter Zehen, eingebettet in geschundenes, faulendes Fleisch. »Das ist mein Opfer!« schrie sie. »Und als meine Schwiegermutter alt und gebrechlich wurde, da habe ich mir selbst mit dem Beil einige Zehen abgehackt und habe mein Fleisch für sie aufgekocht, damit sie es essen und genesen möge. Das ist ein Opfer!«
Manchmal, wenn sie ihr zuhörte, dann wollte Ma Li so etwas wie Mitleid verspüren für diese bittere, betrogene Frau. Mitleid jedoch ist eine Tochter der Stärke, und Stärke kannte Ma Li nicht. Lingling und sie lebten wie Küchenschaben – sie liefen gebückt und immer auf der Hut, nicht plötzlich heimtückisch zertrampelt zu werden. Sie ernährten sich von den Essensresten der Herbergsgäste und mußten sich diese magere Kost noch mit den Schweinen nebenan teilen, deren Wohlbefinden ihren Pflegeeltern ungleich wichtiger war. Ma Li, die sich nichts so sehr wünschte, wie zurück in die Schule gehen zu dürfen, hatte sich mit der Rolle einer Magd zu bescheiden – Holz und Wasser holen, Teller waschen, fegen und putzen. Sie durfte das Haus nicht verlassen und keinen anderen Bereich der Herberge betreten als die Küche und den Hof. Lingling war nur deswegen geduldet, weil nicht nur die dicke Köchin, sondern selbst die böse Frau Zhuang Angst vor ihr und ihrem angeblich bösen Blick hatten. Medikamente, Kräuter und Wurzeln, ärztliche Hilfe, welche die Zwergin so sehr brauchte, gab es nicht. Wenn sie einen ihrer Fieberanfälle erlitt, dann kämpften ihre winzigen Lebensgeister einen verzweifelten Kampf gegen die bösen Wünsche und Flüche aller Erwachsener im Haus, die nichts mehr erfreut hätte als der schnelle Tod dieses Koboldwesens, dessen bloße Existenz die Geister der Gesundheit und des langen Lebens zu beleidigen schien. Nein, mit der bösen Frau Zhuang hatte Ma Li kein Mitleid. Einen Hauch davon verspürte sie gegenüber Herrn Wang, Onkel Wang, wie sie ihn nennen durfte, wenn Frau Zhuang nicht in der Nähe war. Er war ein reicher Mann und hatte vier Söhne gehabt. Zwei waren jedoch im letzten Krieg gefallen, einer war im Ausland verschollen, und der Jüngste lebte als radikaler Künstler – was immer das nun war – in Peking. Er schrieb nur gelegentlich um Geld und erschien noch nicht einmal zum Neujahrsfest bei seinen Eltern. Auch drei Töchter hatte Onkel Wang, aber die galten weniger als nichts, denn sie waren verheiratet und wie Schmetterlinge in fremde Familien davongeflattert.
»Meine Söhne sind mir wie Sand zwischen den Fingern zerronnen, und meine Frau ist nun zu alt, um noch Früchte zu tragen«, hörte Ma Li ihn eines Nachts flüstern, als er sich an ihr Lager neben dem Küchenofen geschlichen hatte. Sein Atem roch nach scharfem Schnaps, und sie spürte seine Hand auf ihrem Rücken, eine feuchte, gierige Hand, die geplagt war von Ängsten und Sorgen und der Furcht vor dem Tod. Ihre Nackenhaare stellten sich auf, als sie begriff, daß der Mann ihren Körper streichelte. Nie hatte eine andere Hand als die ihrer Mutter sie gestreichelt. Onkel Wangs war keine Berührung, die sie ertragen wollte. Sie wollte schreien, kratzen, weglaufen – aber das konnte sie nicht. Zum Glück hatte Lingling, ihre Beschützerin, einen leichten Schlaf und begann mit einem Mal zu schreien. Lingling mochte zwergenhaft und mißgebildet sein, aber wenn sie schrie, erschütterte dies das ganze Haus. Wie der Schatten aus einem üblen Traum verschwand die Gestalt ihres Onkels in der Dunkelheit und kehrte dorthin zurück, wo er hergekommen war, um nicht den Verdacht seiner Gattin, der bösen Frau Zhuang, zu wecken.
Oder gar die böse Frau Zhuang selbst.
Die Küche und der Hof der Herberge waren seit fast einem Jahr ihre Welt, und die Mauern der Herberge waren ihr Gefängnis. Oft hörte Ma Li Stimmen von draußen. Manchmal sah sie am Himmel die bunten Drachen und verfolgte mit scharfem Blick die Schnüre zurück zur Erde hinter der Mauer und stellte sich die Hände vor, in denen die Schnüre zusammenliefen. Manchmal wartete sie in einem Versteck darauf, daß sich das rote Tor zur Herberge öffnete. Dann erspähte sie für einen Moment die Fremden, die Gäste, die für eine Nacht unter dieses Dach gespült wurden, und roch ihre Freiheit. Da waren Händler mit Ballen von Seide, Tabak, Opium oder Tierfellen, oder es kamen vornehme Beamte, deren Frauen und Töchter in Sänften getragen wurden. Es kamen Offiziere und Polizisten in dunklen Uniformen mit wertvoll glänzenden Knöpfen. Es kamen auch Unholde und Gesindel, laut und grob, die tranken und gröhlten, und einmal tauchten sogar zwei unheimliche Ausländer in schwarzen Roben mit langen Bärten und durchdringenden, hellen Augen auf.
Den Mann aus Shanghai hatte Ma Li schon mehrmals in der Herberge gesehen. Es war ein schlanker, feiner Herr in einem schwarzen Wams mit goldenen Stickereien und weiten Hosen. Er trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf und eine runde Brille auf der Nase.
Nun stand dieser Herr im gleißenden Licht des neuen Morgens plötzlich vor ihr. Ma Li ließ vor Schreck den Eimer in den Brunnen fallen und spürte, wie sich Linglings Arme von hinten in krampfhafter Umarmung um ihre Beine schlossen.
»Bist du Ma Li?« fragte der Mann aus Shanghai. Seine Stimme klang hoch wie die einer Frau und durchaus nicht bedrohlich.
Sie senkte den Blick, was als Antwort reichen mußte, da sie nicht mit Fremden sprechen durfte.
»Und das ist gewiß deine Schwester Lingling, nicht wahr?«
Der Mann war offenbar gut unterrichtet.
»Möchtet ihr beide mich in die große Stadt Shanghai begleiten?«
Ma Li wünschte sich weit weg – oder daß zumindest der Eimer aus dem Brunnen wieder rasch auftauchen möge. Dann könnte sie mit dem Wasser schnell zur dicken Köchin zurückkehren.
»Frau Zhuang hat mir erlaubt, mit dir zu sprechen«, erklärte der Fremde.
Ma Li spürte, wie der eiserne Griff ihrer Schwester um ihre Beine sich lockerte und wie ihr Kopf sich bewegte. Lingling wollte wissen, woher diese sanfte, freundliche Stimme kam. Es waren die ersten freundlichen Worte seit langem, die sie aus einem fremden Mund hörte.
»Mit mir reist eine andere junge Dame namens Zhang Yue. Ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen.«
»Sie irren sich, feiner Herr. Ich bin keine junge Dame«, erwiderte Ma Li und erschrak selbst über ihre vorlaute Art.
Der Mann lachte. »Bist du schon mal mit der Eisenbahn gefahren?«
»Nein.«
»Du möchtest doch sicher die große Stadt Shanghai sehen, oder?«
»Gibt es da eine Schule für mich? Und einen Arzt für Lingling?«
Der Mann lächelte noch breiter. »Sicherlich. In Shanghai gibt es alles. Alles, was du willst.«
Ma Li spürte, wie Lingling an ihrer Lumpenhose zerrte. Sie drehte sich um und ging in die Knie.
»Was ist?« fragte sie ungeduldig, während sie den Blick des Fremden in ihrem Nacken spürte.
»Das Beste«, flüsterte Lingling angestrengt.
»Was?« Ma Li verstand nicht sofort.
Als sie sich umdrehte, sah sie, wie der fremde Mann ihr seine Hand reichte, eine falsche und geschickte Hand, flink darin, Mahjong-Steine zu mischen und heimlich zurechtzulegen oder unbemerkt Schmuck und Geld zu stehlen. Eine Hand, die immer und immer wieder fälschte und log und die eine sonderbare gelblich-braune Verfärbung an den Fingerkuppen aufwies. Ma Li konnte nicht ahnen, daß diese Spuren vom Opium herrührten. Außerdem waren da noch die roten Punkte, die einen Halbkreis unterhalb des kleinen Fingers beschrieben – Bißspuren, von denen Ma Li nicht wissen konnte, daß sie von Zhang Yue stammten.
Bevor sie wußte, was sie tat, streckte sie auch ihre Hand aus.
»Dann wollen wir aufbrechen«, sagte der Mann. »Aber zuvor müssen wir zusammen in mein Zimmer gehen.«
»Ich darf nicht in die Zimmer gehen!« widersprach Ma Li. »Frau Zhuang hat das ausdrücklich verboten.«
Sie wollte ihre Hand aus dem Griff des Mannes befreien, doch er ließ sie nicht los. Lingling schluchzte verzweifelt auf, als sie bemerkte, daß etwas gegen den Willen ihrer Schwester geschah.
»Es wird dir nichts zustoßen«, beruhigte der Mann. Seine Stimme klang nun eher ungeduldig als sanft und angenehm. Lingling begann zu schreien, als der Mann Ma Li kurzerhand emporhob, ihr seine betrügerische Hand auf den Mund legte und das wild zappelnde Mädchen ins Haus trug.
»Sag deiner Schwester, daß sie still sein soll! Die Kleine weckt ja die ganze Stadt auf!« herrschte er Ma Li an. Doch selbst wenn sie gewollt hätte – mit seiner Hand fest auf ihren Mund gepreßt, brachte sie nichts als ein dumpfes Stöhnen hervor. Linglings markerschütternde Schreie schienen die Mauersteine aus den Fugen bringen zu wollen, als er Ma Li unsanft auf den Brettern seines Bettes absetzte und ihr ins Gesicht schlug, hart genug, um sie erstarren zu lassen, aber nicht so heftig, daß ihre wohlgeformte Nase oder ihre makellosen Zähne Schaden nahmen.
»Ausziehen!« herrschte er sie an.
Zitternd folgte sie seinem Befehl.
Bao Tung erkannte einen Diamanten, wenn er ihn sah, selbst wenn das gute Stück, wie in diesem Falle, schmutzig und ungeschliffen war. Ein gründliches Bad, vermutlich das erste seit Jahren, ein kleiner Tanz mit einer von fachkundiger Hand geführten Schere und ein roter Chipao mit goldenem Saum – das knielange, hochgeschlossene Schlitzkleid, das bei den Damen in Shanghai gerade in Mode gekommen war – und dieses Mädchen könnte ihrem Besitzer ein Vermögen einbringen. Feingliedrig, mit edlem Gesicht und samtschwarzen Haaren war es etwas ganz Besonderes. Allein der erste Kunde, der das Privileg genoß, ihre Blume zu pflücken, würde für dieses besondere Vergnügen eine stattliche Summe hinblättern müssen. Nachdem sich Bao Tung davon überzeugt hatte, daß die Kleine tatsächlich noch unberührt und ihre kostbare Blume unversehrt war, zahlte er der Wirtin die vereinbarte Summe.
»Wer sollte sie denn auch gepflückt haben?« kläffte die Wirtin, ihre lange Pfeife trotzig zwischen die braunen Zähne geklemmt. »Mein nutzloser Mann vielleicht? Das hätte ich ja wohl zu verhindern gewußt. Und die Knechte? Das sind Eunuchen. Alle vier. Also? Wo ist meine Bezahlung?«
»Ich habe schon viele Haushaltshilfen nach Shanghai vermittelt«, erklärte Herr Bao Tung wichtig, während er die Münzen aus seiner Tasche fischte. Zwei mexikanische Silberdollar für die Prinzessin und zwei Schnüre billiges Blechgeld für ihre verwachsene Schwester. Teuer, aber für solche Qualitätsware doch nicht zu teuer. »Da lernt man, nicht den Beteuerungen der Verkäufer, sondern nur seinen eigenen Augen zu trauen.«
Die Frau riß ihm förmlich das Geld aus der Hand.
»Danke. Und noch fünf Tael für die Übernachtung, bitte sehr.«
Er lächelte überlegen und zahlte auch diese Summe. Dann war sie zufrieden und grinste ihn breit an.
Schauerliche Schlange, dachte er.
»Ein Frage hätte ich noch, rein aus Neugierde«, neckte sie ihn listig. »Wenn es doch nur Haushaltshilfen sind, wie Sie behaupten, mein Herr … Wie kommt es dann, daß sie Jungfrauen sein müssen?«
»So will es das Gesetz. Bis zum nächsten Mal …«
Bao Tung deutete eine Verbeugung an und ließ die Wirtin stehen, nicht ohne zu bemerken, wie sich aus dem Schatten des Korridors, der in die Küche mündete, eine fette Gestalt löste, die mit entschlossenen Schritten auf die Wirtin zuging.
»Ich hätte da etwas mit Ihnen zu besprechen, ehrenwerte Frau Zhuang …«, hörte er die kratzige Stimme der Köchin.
Ma Lis Tränen waren getrocknet, aber der Schrecken und die Erniedrigung würden sie für immer begleiten. Der fremde Mann, der sich auf sie warf und mit grober Gewalt ihre Beine spreizte und festhielt, damit er sie einer unerklärlichen Prüfung unterziehen konnte, war ihr mit einem Schlag verhaßt wie der Teufel selbst. Sie sprach nicht mehr mit ihm, sah ihn nicht einmal mehr an, sondern klammerte sich an Lingling, deren wildes Angstgeschrei die unendlichen Minuten der peinsamen Prüfung begleitet hatte und die nun stumm neben ihr auf der Ladefläche der Kutsche neben den Koffern, Ballen und Schachteln des Reisenden hockte. Ihre erste Fahrt mit einer Maultierkutsche hatte Ma Li sich anders vorgestellt. Wie oft hatte sie aus ihrem Versteck die Gefährte am Herbergstor vorfahren sehen und sich gewünscht, daß sie und Lingling auch irgendwann in solch einem vornehmen Fahrzeug sitzen würden und irgendwo hinfahren würden! Egal wohin, Hauptsache weg aus der nach Kohl stinkenden Küche und dem Reich der bösen Frau. So hatte sie sich ihre Befreiung nicht ausgemalt, so schmutzig und gemein. Sie hatte kaum Augen für das bunte Treiben neben der schlammigen Fahrrinne, durch die das brave Maultier ihre Kutsche quer durch die Stadt zog. Händler, die aus den weit offenen Eingängen ihrer Häuser Waren anpriesen. Garköche, die kreischten und dazu scheppernde Gongs schlugen, um die Kunden an ihre dampfenden Töpfe und Bastkörbe zu locken. Bettler, denen ganze Gliedmassen fehlten und die ihre verdreckten Arm- und Beinstümpfe mitleidheischend den Passanten unter die Nasen hielten. Hungrige, schmutzige Kinder, die, kaum zu glauben, noch schlimmer dran waren als sie und Lingling hinter ihrem Ofen. Gemüsebauern, die mit Lauch und Rettich wedelten, Geflügelverkäufer mit Stangen über den Schultern, an denen kopfüber die Enten baumelten und schauerlich schnatterten. Ein Schweinemetzger, der mitten im Getümmel einem Tier die Kehle durchschnitt – das Blut schwallte über den Matsch und versickerte zwischen Obstschalen und Holzsplittern. Irgendwo brannte jemand, der wohl ein neues Geschäft eröffnete und die bösen Geister verjagen wollte, eine Kette von Knallfröschen ab.
Plötzlich entstand in dieser Unruhe ein Tumult. Schreie wurden laut. Einzelne Worte hallten anklagend von den Mauern wider. »Verrat!« »Unterdrückung!« »Schande!« »Steht auf und wehrt euch, wenn ihr Chinesen seid!«
»Was ist denn da los?« Bao Tung tippte unsanft mit seinem Fuß den Kutscher an, der vor ihm auf dem Bock saß.
»Haben Sie es nicht vernommen, ehrwürdiger Herr? Die Ausländer haben uns Chinesen wieder einmal schmählich verraten. Die Deutschen haben den Krieg verloren, und nun soll ihr sogenannter Besitz in China, unser schönes Shandong, den Japanern überlassen werden. Ausgerechnet den Japanern, diesen zwergenwüchsigen Piraten! Statt das Land seinen rechtmäßigen Besitzern – uns Chinesen – zurückzugeben!«
»Ich interessiere mich nicht für Politik«, brummte mißmutig Bao Tung und ließ sich zurück in den gepolsterten Sitz sinken.
Eine wogende Menschenmenge hatte den zentralen Platz der Stadt erobert, die große Kreuzung vor dem alten Yamen, dem Behördensitz mit seinem prachtvollen Tor, den roten Wänden und dem schwerem Dach aus grauen Ziegeln, unter dem bis vor einigen Jahren noch der kaiserliche Mandarin regierte wie ein kleiner König. Weiße Totenfahnen wehten über der aufgebrachten Menge in der Frühlingsbrise. Darauf standen die Namen verachtenswürdiger Politiker, die den verhaßten Japanern gefällig waren. Außerdem waren Parolen zu lesen: China – wohin? Diese Worte konnte selbst Ma Li entziffern, die sich, vom Lärm neugierig geworden, aufgerichtet hatte und die Demonstration für eine ausgelassene Feier wilder, junger Männer in schwarzen Jacken hielt.
Erst viele Jahre später würde sie erfahren, daß der Tag, an dem ihr neues Leben begann, der 4. Mai 1919 war. Der Tag, an dem China sich auflehnte und an dem jeder aufrechte Chinese Wut verspürte, weil die Welt da draußen sein Land, das Reich der Mitte, achtlos herumstieß. Ein paar arrogante, zumeist weiße Herren in einer fernen Stadt namens Versailles hatten mit einem Federstrich den Japanern einen Teil Chinas zugesprochen. Der Kaiser war vom Thron gestoßen, nichtsnutzige Politiker stritten um ihre eigenen Vorteile, bewaffnete Banden terrorisierten das Land, Ausländer spielten sich auf wie die wahren Herren, und nun begannen sie auch noch, China zu verteilen wie einen Lotteriegewinn.
»Ja, richtig!« wetterte der Kutscher, den das patriotische Fieber der Demonstranten ergriffen hatte. »Wir dürfen uns so etwas nicht gefallen lassen!«
Ein weiterer Tritt des Herrn Bao Tung brachte ihn abrupt zum Schweigen.
»Fahr weiter, du Trottel, sonst kommen wir nicht rechtzeitig zum Bahnhof.«
»Sehr wohl, ehrwürdiger Herr«, erwiderte kleinlaut der Gescholtene.
»Und vergiß nicht, daß wir zuerst am Lagerhaus halten müssen. Ich habe dort noch Gepäck abzuholen.«
Das Gepäck des Herrn Bao Tung bestand aus zwanzig Bastkäfigen, in denen wie gefangene Vögel kleine Kinder kauerten. Der Einfachheit halber hatte Herr Bao sein menschliches Gepäck für diese eine Nacht in der Herberge von Xiezhuang am Bahnhof zurückgelassen. Mädchen und Jungen hockten in den fest geflochtenen Waben, zusammengesunken und geschwächt. Ihre Augen waren tränenleer, doch voller Unverständnis und Furcht. Ihre Gesichter, mager und schwarz vor Dreck, erzählten Geschichten von Hunger, Mißhandlung und Tod. Einige waren in Ma Lis Alter, andere viel jünger. Ein kleiner Junge, der immer noch die Kraft zum Wimmern hatte, mochte vielleicht sechs Jahre alt sein. Müde, dunkle Augen verfolgten jede Bewegung der Neuankömmlinge. Zwei leere Bastkäfige standen für die beiden Mädchen aus Xiezhuang bereit. Ma Li widerstrebte es, in den Käfig zu steigen, aber sie fügte sich doch. Schließlich sollten sie mit der Eisenbahn reisen. Vielleicht war dies die Art, wie Kinder in der Eisenbahn transportiert wurden. Außerdem wollte sie nicht noch einmal den Zorn und die Brutalität des fremden Mannes mit den betrügerischen Händen herausfordern. Solange niemand Lingling etwas antat, bestand kein Grund zur Auflehnung. Nur nicht zurück zu der bösen Frau, dachte Ma Li. Nichts konnte schlimmer sein als deren Schläge und Demütigungen. Allein der kurze Weg von der Herberge in das Lagerhaus hatte sie gelehrt, daß es hier draußen eine Welt gab, in der ihre kleine Schwester und sie allemal besser aufgehoben waren als hinter dem Ofen in der Küche.
»Das Beste«, krächzte Lingling und verschwand in ihrem Käfig, als wäre er ein warmes Nest, das sie lange vermißt hatte.
»Verhaltet euch ruhig und macht keine Dummheiten«, ermahnte Bao Tung die Kinder. »Ihr alle bekommt unterwegs zu essen und zu trinken, dafür ist gesorgt. Wir sehen uns in Shanghai wieder.«
Dann zahlte er den Kutscher aus und winkte die Träger herbei, die sein eigentümliches Gepäck an Schulterstangen zum Bahnsteig schleppten. Niemand hielt es für nötig oder wagte es gar, den feinen Herrn auf die unglücklichen menschlichen Wesen in ihren Käfigen anzusprechen. Es gab zwar in der Republik inzwischen Gesetze, gegen die solches Handeln verstieß – aber wer sollte sich um deren Einhaltung in einem Land kümmern, dessen Territorium an Tischen in fremden Städten verteilt wurde? Alle Polizisten der Stadt waren ohnehin bei der Demonstration vor dem alten Yamen im Einsatz, und selbst wenn es einem übermütigen Ordnungshüter gefallen hätte, den Reisenden auf seine ungesetzliche Fracht aufmerksam zu machen – ein paar Tael auf die Hand hätten ihn sehr schnell zum Schweigen gebracht. Außerdem hielt Bao Tung wasserdichte Papiere mit beeindruckenden Stempeln parat, die ihn als Beschützer der ihm anvertrauten Waisenkinder auswiesen, welche er zu einer Missionsstation im Shanghaier Stadtteil Honkou bringen sollte. Diese Papiere benötigte er für die mißtrauischen Polizisten in Shanghai.
Der Zug nach Süden rollte mit den üblichen dreizehn Stunden Verspätung in den Bahnhof von Xiezhuang ein, als es schon längst dunkel war. Herr Bao bezog seine Kabine in der Ersten Klasse und streckte sich aus, um in Ruhe seine Opiumpfeife zu stopfen.
Goldene Jungs und Jademädchen zu suchen – das war, wenn man ein gutes Auge und die entsprechende Berufserfahrung hatte, ein sehr einträgliches Geschäft. Bao Tung verstand sich besonders gut auf die Auswahl von vielversprechenden Talenten. Jahrelang war er mit der bunten Operntruppe seines Schwagers durch die Provinzen gezogen und hatte sich um die Rekrutierung neuer Darsteller verdient gemacht. Sein Schwager war nun tot, und Bao Tungs Schwester hatte die Truppe übernommen und sich weitsichtig im Amüsierviertel der Foochow Road in Shanghai niedergelassen. Zwar nahm das Opernensemble nach wie vor nur Jungen auf, und Bao Tung konnte hin und wieder einen seiner Schützlinge für wenig Geld dort loswerden, aber der Handel mit frischen Mädchen war weitaus verlockender und einträglicher. Der Hunger dieser verruchten Stadt nach neuen »wilden Hühnern« war kaum zu befriedigen. Es wollte ihm scheinen, als reichten alle Mädchen Chinas nicht aus, um die Betten, die Gassen und die Gossen von Shanghai zu füllen.
Mit vierundzwanzig Käfigen kehrte er diesmal heim. Seine Kosten beliefen sich insgesamt auf acht mexikanische Silberdollar und sechzehn Münzschnüre, zuzüglich 87 Tael Reisespesen. Selbst bei vorsichtiger Schätzung und nach Abzug der Unkosten konnte er sich auf einen Gewinn von mindestens 70 Silberdollar einstellen.
Und dann waren da noch die Juwelen unter den Kindern: Zhang Yue, diese kleine Teufelin, die ihn in die Hand gebissen hatte. Zhang war ein Goldstück, dreizehn Jahre alt, ein Feuerpferd dem Geburtsjahr nach und wild wie eine Tigerin. Dabei bereits gut ausgebildet – starker Knochenbau, ausgeprägte, weibliche Gesichtszüge, lodernde Augen und vielversprechende Brustansätze. Madame Lin, die Königin des Nachtlebens von Shanghai, würde allein für dieses Mädchen zehn Silberdollar auf den Tisch legen, denn sie hatte bekanntlich etwas übrig für Mädchen mit Feuer und Temperament. Zwar war das kleine Luder dank ihres dummen, versoffenen Vaters keine Jungfrau mehr, aber mit einer Portion Hühnerblut konnte man für die ohnehin meist angetrunkenen Kunden die Illusion leicht herstellen. Madame Lin kannte sich mit all diesen Tricks bestens aus.
Den größten Gewinn aber versprach Ma Li, dieser Rohdiamant, diese kleine Prinzessin. Auch sie ein Feuerpferd des Jahrgang 1906. Ma Li würde er nicht unter zwanzig Dollar hergeben. Ihr Gesicht war bereits so schön, unschuldig und ebenmäßig wie das einer Göttin. Dieses Mädchen würde niemanden kaltlassen. Sie war aus dem Stoff, aus dem in den Straßen um die Foochow Road Legenden gewoben wurden. Sie war klug und würde ihre Kunden nicht nur im Bett beglücken, sondern eines Tages auch singen und Gedichte rezitieren und schöne Kalligraphien erstellen können. Ma Li hatte, wie der erfahrene Talentjäger Bao Tung sofort erkannt hatte, das Zeug zu einer ganz großen Kurtisane.
Er führte das Feuer an den Opiumball und sog das süße, berauschende Gift tief in seine Lungen.
Schließlich hatte er noch die Zwergin. Körperlich hinfällig zwar, aber ihre Möglichkeiten waren dennoch nicht zu unterschätzen. Sie könnte mit der entsprechenden Reklame Tausende von Gaffern in das große Varieté Dashijie – »Neue Welt« – locken.
Hereinspaziert, hereinspaziert: sehen Sie hier – und nur hier – die kleinste Jungfrau der Welt! Die Nacktschau heute abend zum doppelten Preis.
Fünfzehn Dollar für die Zwergin, dachte Bao Tung, als der Opiumnebel seine Sinne umwaberte und der immer gleiche träge Takt der Eisenbahngleise ihn in den Schlaf rief. Das machte zusammen fünfunddreißig Dollar für die beiden Schwestern.
Fünfunddreißig Dollar oder sogar noch mehr …
Ma Li hockte, den Kopf zwischen den Schultern eingezogen und die Stirn auf den Knien, in ihrem Bastkäfig in der Dunkelheit des Gepäckwaggons. Hin und her geworfen von der unsteten, langsamen Fahrt über grobe Schienenwege. Sie erforschte ein neues Gefühl, das in ihr entstanden war und das sie nie zuvor gespürt hatte. Nicht einmal gegenüber der bösen Frau war sie zu diesem Gefühl fähig gewesen, und es erschreckte sie selbst ein wenig. Doch zur gleichen Zeit nährte sie es, ließ es wachsen und betrachtete es mit wachsender Faszination – wie einen wilden Wolf, der seine Lefzen hochzog und seine scharfen Zähne bleckte. Haß war es, den sie verspürte und der sie ermächtigte, an etwas zu denken, das ihr bisher völlig fernlag: Sie mußte aufstehen und sich wehren – mit aller Kraft, mit allen Mitteln. Sie war ein Feuerpferd – das hatte ihr die böse Frau immer wieder eingebleut. Sie wußte zwar nicht, was genau ein Feuerpferd war, aber der Gedanke allein spendete ihr Kraft und Mut. Sie würde immer ein Feuerpferd sein und kämpfen. Nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für Lingling. Ihre kleine Schwester, die im Jahr des Affen geboren war, schlummerte nebenan tief und fest in ihrem Käfig, in dem sie sich fast ausstrecken konnte, und ahnte nichts von der großen Gefahr. Der Mann, der sie in die Stadt Shanghai brachte, war verdorben und schmutzig, dachte Ma Li. Sie rechnete nunmehr fest damit, daß er sie zu anderen Männern bringen würde, die nicht weniger verdorben und schmutzig waren. Es gab nun in ihrer Welt etwas, das noch furchteinflößender und widerwärtiger war als die Dämonen der Schattenwelt. Das waren fremde Männer mit geifernden Blicken und groben Händen. Onkel Wangs Schnapsatem und seine Hand an ihrem Körper gaben nur eine blasse Vorahnung von dem, was vor ihnen lag.
Ma Li ballte ihre Hände und schloß die Augen. Sie schwor im Namen ihrer toten Mutter: Niemand wird uns anfassen. Niemand wird uns weh tun. Ich werde kämpfen. Dein kleines Feuerpferd wird kämpfen bis zum letzten Atemzug.
Sie wiederholte diese Worte so oft, bis aus der Dunkelheit des Waggons der Schlaf scheinbar auf sie zugekrochen kam. Doch bevor der Schlaf sie erreichte, riß sie eine rauhe Stimme zurück, die gar nicht zu einem jungen Mädchen passen wollte.
»Wie ist dein Name?«
»Ich heiße Ma Li«, antwortete sie verwundert und spähte schlaftrunken in die Richtung, aus der die Stimme kam.
»Ich bin Zhang Yue. Ist das deine Tochter?«
»Unsinn. Das ist meine Schwester. Sie ist zehn Jahre alt.«
»Ist sie eine Zwergin oder sogar ein Affe?«
»Nein, sie ist ein Mensch wie du und ich. Sie ist nur im Jahr des Affen geboren. Aber ich bin ein Feuerpferd.«
»Ha. Das bin ich auch! Mein Vater hat immer gesagt, daß Feuerpferde das Unglück anziehen.«
»Rede nicht so laut, sonst weckst du meine Schwester auf.«
Das gesichtslose Mädchen namens Zhang Yue wollte sich nichts sagen lassen und sprach noch lauter. »Weißt du, was er mit uns vorhat?«
»Wer – der Mann mit der runden Brille?«
»Er will uns weiterverkaufen – an andere Männer.«
Ma Li erschauerte. »Darüber hatte ich gerade nachgedacht.«
»Weißt du, was diese Männer mit uns machen werden?«
»Ich will es nicht wissen.«
»Ich weiß es und gebe dir einen guten Rat: Tu alles, was sie von dir wollen, sonst bekommst du fürchterliche Schläge. Ich weiß, wovon ich rede, aber ich kenne einen Trick. Wenn einem alles zuviel wird, dann kann man sich einfach hinfallen lassen und so tun, als sei man ohnmächtig. Oder auch tot. Das hilft meistens.«
Ma Li wollte von alledem nichts hören, doch das Mädchen hörte nicht auf zu reden. Sie erzählte von ihrem Dorf, ihrem Haus und von ihrem Vater, davon, was er mit ihr gemacht hatte und daß man sich besser nicht wehrte, wenn es geschah.
»Mein Vater lebt nicht mehr«, sagte Ma Li, nachdem sie schweigend und verängstigt zugehört hatte.
»Da hast du aber Glück gehabt.«
Mein Vater war aber nicht wie deiner, wollte sie sagen, besann sich jedoch. Sie wollte das fremde Mädchen aus der Dunkelheit nicht verletzen. Sie hatte wahrhaftig schon genug Unglück erlitten. Ma Li wollte nicht an den Schmutz und den Schmerz und das Ziel ihrer Reise denken, sondern an etwas Schönes, etwas Tröstendes.
»Kennst du die Geschichte vom Jadepalast?« fragte sie. Das Wort allein, laut ausgesprochen, schien die Finsternis ihres Gefängnisses aufzuhellen.
»Nein. Was soll das sein?«
»Unsere Mutter hat meiner Schwester und mir oft vom Jadepalast erzählt. Es ist ein geheimnisvoller Ort, weit hinter den Kunlun-Bergen. Nur wenige Menschen haben ihn bisher betreten, und noch weniger kamen zurück, um davon zu berichten. Denn wer einmal dort angekommen ist, will um keinen Preis mehr zurück in diese Welt. Der Jadepalast ist ein Ort des ewigen Lebens und der Schönheit. Nichts Böses und Gemeines gibt es dort. Alles glänzt im grünen Schein der Jade, aus dem der ganze Palast gebaut ist. Überall riecht es ganz köstlich, und alles, was die Kaiserin im Jadepalast bestimmt, wird Wirklichkeit …«
»Das ist doch ein Märchen für dumme Kinder.«
»Ist es nicht«, widersprach Ma Li kraftlos. Sie war viel zu müde, um ihren himmlischen Traum gegen irdische Zweifel zu verteidigen. »In der Mitte der großen Halle steht ein großer Springbrunnen, und Schmetterlinge tanzen den ganzen Tag zwischen den Blumen. Draußen ist ein Pfirsichgarten, der das ganze Jahr über blüht …«
Ma Lis Stimme wurde leiser und leiser, bis sie im metallischen Takt der Gleise verstummte und ihr die Lider zufielen. Im Traum flogen die grünen Jadetüren weit auf, und sie lief lachend zwischen mächtigen Säulen immer tiefer hinein in die Säle des Palastes. Lingling mit ihr – nicht klein und verwachsen, sondern groß und schön wie alles an diesem magischen Ort des Glücks, der so weit weg war und doch nur einen Traum entfernt.
2. Kapitel Shanghai, Mai 1919
»Das ist dein Palast! Und? Sieh dich nur gut um! Habe ich dir zu viel versprochen?« Pearson hatte die weiße Flügeltür aufgestoßen, die in den großen Salon führte. Er legte den Arm um Marthas Taille, führte sie sanft in den Raum, der sich lichtdurchflutet und geschmackvoll möbliert vor ihr ausbreitete wie eine wunderbare Landschaft. »Hier kannst du Hof halten wie eine Königin.«
Glänzender Parkettboden, ein Kamin, ein großer Tisch aus tropischem Edelholz. Stühle mit ausgesuchten Schnitzereien, silberne Leuchter, weiße Fensterrahmen, die bis unter die Decke reichten, und hinter dem feingeschliffenen Glas ein Garten, aus dem heraus die Blüten sie freundlich anblinzelten. Ein weiterer Springbrunnen sogar, etwas kleiner als der vor dem Portal. An Blumen hatte Pearson nicht gespart. Drei prachtvolle Gebinde zierten den Raum.
Willkommen daheim, stand in goldenen Buchstaben auf der samtroten Schleife, die sich von einer Seite des Raumes zur anderen spannte.
Daheim? Martha schluchzte auf.
In dieser Ecke eine würdige Chaiselongue, in jener ein lederner Ohrensessel, an der Wand ein Diwan, mit köstlichem Stoff bespannt. Eine vornehm verglaste Schrankwand von Büchern und aktuellen Journalen. Dazu diese unwirkliche, erlösende Stille – nichts drang durch in ihren verborgenen Palast –, nichts von dem Geschrei, dem Fluchen, Rotzen und dem widerlichen Brodeln jenseits der hohen Gartenhecke. Schon das Äußere ihres Anwesens, schon der erste Blick darauf hatte Martha bei allem Widerwillen gegen diese gotteslästerliche Stadt ringsherum sofort eingenommen und ein wenig versöhnt. Nach all dem Schmutz, den sie auf dem kurzen Weg vom Hafen bis hierher hatte betrachten und ertragen müssen, war ihr das herrschaftliche Gebäude sogleich vorgekommen wie eine rettende Insel der Vertrautheit. Innerhalb der Umfriedung der haushohen Hecke schienen aller Unrat und alles Elend, durch das sie soeben angereist war, wie ein verblassender Alptraum. Sobald sich die schweren, gußeisernen Tore hinter ihrem Wagen geschlossen hatten, konnte Martha endlich wieder durchatmen.
Sie erblickte Heimatliches: einschmeichelndes, ebenmäßiges Fachwerk, steile Dächer, spitze Giebel und lauschige Erker, eine gepflegte Grünanlage. Vor dem Eingang ein Springbrunnen, der von einer Fortuna-Statuette gekrönt wurde, aus deren Füllhorn Wasser floß. Es war ein Tudor-Haus, wie sie es daheim in England nicht prachtvoller und üppiger hätte vorfinden können. Sie war verwirrt und sprachlos.
Erleichtert umarmte Martha ihren Gatten. »Pearson, es tut mir so leid. Denke bitte nicht, daß ich zimperlich und damenhaft sei. Doch ich dachte zuerst, ich sei in der Hölle gelandet!« schluchzte sie. »Es war so furchtbar …«
Er streichelte ihr Haar und nahm sie in den Arm, wiegte ihren schmalen Körper verständnisvoll hin und her
»Sieht so die Hölle aus?« fragte er schelmisch. »Wenn man genau hinsieht, ist es ein Paradies, unser Paradies, Martha.«
»Aber dort draußen … diese Stadt! Widerwärtig, einfach widerwärtig …«, wimmerte sie. Der Schrecken, den Shanghai ihr eingejagt hatte, legte sich nur langsam. Kein Wunder, daß die meisten Gattinnen der hier tätigen Kaufleute es vorzogen, daheim zu bleiben.
Aus der luxuriösen Beschaulichkeit ihrer Schiffskabine war Martha ohne Vorwarnung in den stinkenden Mahlstrom einer Stadt gestoßen worden, die schon aus Prinzip nicht viel Schminke trug. Halbnackte Kulis hatten ihre Gepäckstücke befingert, gierige schwarze Augen voller Heimtücke hatten ihr das weiße Kleid förmlich vom Leib gerissen. Tausend lüsterne Blicke folgten der goldhaarigen, hellhäutigen Frau mit ihren blauen Augen und ihrem roten Mund. Grinsende, schielende Schurken in verdreckten Uniformen hatten mit Fettfingern ihre Reisedokumente durchblättert. Schwüle Hitze und der unerträgliche Gestank von Hafen, Armut und unaussprechlichen Krankheiten raubten ihr fast die Besinnung. Als sie endlich Pearson sah, freudig winkend hinter der Schranke, hatte sie schon dreimal beschlossen, mit dem nächsten Dampfer zurück nach England zu fahren und nie wieder einen Fuß in den Orient zu setzen. Sie liebte ihren Mann in diesem schrecklichen Moment nicht mehr. Seine Umarmung war ihr erschienen wie der Todesgriff eines Leprakranken. Er hielt sie umschlungen, als wolle er sie tatsächlich für immer hier festhalten – in diesem Nest voller Schmutz und Fäulnis.
In Kairo, in Aden, in Madras, Bombay und in Singapur hatte das Schiff unterwegs Station gemacht, aber keine dieser Städte – jede für sich eine auszeichnungswürdige Würmergrube aus Wundbrand und Abschaum – war Martha McLeod-Palmers so verdorben und abstoßend erschienen wie dieses Monstrum namens Shanghai. Wenn Martha es unterwegs vom Hafen in die Stadt dann doch gewagt hatte, den Vorhang ihres Wagens nur ein wenig zur Seite zu schieben und hinauszuspähen in diese fremde Welt Chinas, dann hatte sie nichts als Huren, Bettler und halbnackte, schweißglänzende Körper gesehen.
Dieser Müllplatz Gottes also war das berufliche Sprungbrett für ihren geliebten Pearson? Die Bewährungsprobe, die ihr strenger Vater dem Schwiegersohn auferlegt hatte? Wenn Pearson drei Jahre lang das China-Geschäft erfolgreich geleitet hatte, dann wäre er würdig, einen wichtigen Posten in der Zentrale des McLeod-Handelshauses zu übernehmen. Nicht vorher – das waren die Worte ihres Vaters gewesen. Drei Jahre