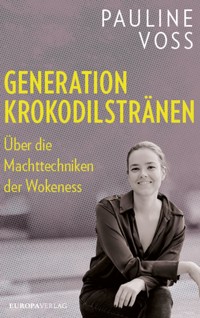
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Europa VerlagHörbuch-Herausgeber: Ohrenschmauss Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die junge woke Generation dominiert die gesellschaftspolitischen Debatten. Aufgewachsen in einer unpolitischen Zeit, überzieht sie die Öffentlichkeit heute mit einem hyperpolitischen Befindlichkeitswahn. Wie konnte es so weit kommen? Pauline Voss' Debattenbuch entschlüsselt die Machttechniken dieser Generation und nimmt zu diesem Zweck eine Neuinterpretation des Philosophen Michel Foucault vor: Darin zeigt sie auf, warum Foucaults Theorien keineswegs als Legitimation für die totalitäre Wokeness dienen können, sondern – im Gegenteil – diese vielmehr delegitimieren. Die "Generation Krokodilstränen" wird auf diese Weise erstmals mit ihren eigenen philosophischen Waffen geschlagen. Dabei verwebt die Autorin allgemeine gesellschaftliche Phänomene mit persönlichen Erfahrungen zu einem lebendig geschriebenen Generationenporträt, das Antworten auf Fragen gibt wie: Wie konstituiert sich das neue Spießertum? Warum versucht die Generation Krokodilstränen, die Sexualität zu kontrollieren? Worin zeigt sich der Verlust des Physischen? Und wie wirkt sich all das auf die Kultur und den Fortschritt unseres Landes aus? »Keine Zone unseres Privatlebens lässt die politische Korrektheit im Schatten. Alles scheint einem Tribunal der Moral zu unterstehen, zu dessen Richter sich jeder beliebige Fremde aufschwingen darf. Gleichzeitig ist es kaum möglich, diesen indiskreten Zugriff als solchen zu benennen: Die Prozesse der Disziplinierung laufen so diskret ab, dass häufig gar ihre Existenz geleugnet wird. Allein die Beschwerde über den disziplinierenden Zugriff auf unsere Privatsphäre wird oftmals als Beweis einer ›rechten‹ Geisteshaltung gewertet, der eine noch intensivere Disziplinierung rechtfertigt.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAULINE VOSS
GENERATION KROKODILSTRÄNEN
Über die Machttechniken der Wokeness
INHALT
PROLOG: Eine Generation entdeckt den Aktivismus
KAPITEL I: A Well Respected Man
Die Wurzel des Spießertums
Foucaults Werkzeugkasten
Die digitale Nachbarschaft
Beziehungsnetz der Überwachung
Die Peitsche bleibt im Stall
Im Netz der Schrift
Winzigkeit mit Wirkung
KAPITEL II: Das Herbarium der Lüste
Die Unaussprechlichen
Kreisende Bewegungen
Die Repressionshypothese
Die sexuelle Revolution
Die Diskriminierungshypothese
Das Herbarium der Lüste
Das Geständnis
Die Unersättlichen
Die Befreiung
KAPITEL III: Die Macht der Krokodilstränen
Macht durch Ohnmacht
Diskriminierung ist Wahrheit
Canceln als Kultur
Die Kausalmacht des Nationalsozialismus
Latenz und Interpretation
Die Delinquenz
Selbstbestimmung im Kerkerarchipel
Die formalisierende Diskursdemokratie
KAPITEL IV: Die Verleugnung des Physischen
Sterben und Gebären
Der strategische Kategorienfehler als Instrument der Politik
Wokeness – ein antikonservatives Projekt
Vakuen der Macht
KAPITEL V: Bilder von gestern
Das Klischee als Rebellion
Der ausgelagerte Konservatismus
The 1950’s Shit
Die totale Umkehr
KAPITEL VI: Wir verlernen das Spielen
Die Furcht vor der Metapher
Das Regime des Authentischen
Foucault und der Fortschritt
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN
»In Gegenwart der Moral soll eben, wie angesichts jeder Autorität, nicht gedacht, noch weniger geredet werden: hier wird – gehorcht!«
Friedrich Nietzsche, »Morgenröte«
PROLOG
EINE GENERATION ENTDECKT DEN AKTIVISMUS
Es muss Mitte der Nullerjahre gewesen sein – wir waren zwölf oder dreizehn Jahre alt –, da unterhielt ich mich mit einer Freundin über Politik, und sie sagte: »Ich wäre gerne gegen irgendetwas. Aber es gibt ja nichts, wogegen man sein kann.« Insgeheim sah ich auf ihre Haltung herab: Wenn sich keine Ansatzpunkte für politische Rebellion boten, dann musste man sich diese eben suchen. Und das tat ich.
In unserer Klasse an einem Frankfurter Gymnasium hatte es sich eingebürgert, dass die Clique jüdischer Schüler von allen »die Juden« genannt wurde. Das missfiel mir. Es klang antisemitisch. Also versuchte ich, meine Freunde davon abzubringen. Natürlich sprachen sie weiterhin von »den Juden«, nur mir gegenüber zählten sie fortan umständlich die einzelnen Namen der jüdischen Schüler auf, wodurch jedes Mal eine beklemmende Gesprächssituation entstand, weil jeder von uns heimlich dachte: »die Juden eben«. Mein Gefühl moralischer Überlegenheit wurde dadurch aufgefressen und meine Begeisterung für Sprachregeln getrübt. Die Juden reagierten derweil pragmatisch und nannten sich selbst »die Juden«.
Noch schwieriger gestaltete sich mein Kampf gegen Rassismus. Im Französischunterricht sahen wir antirassistische Kurzfilme und dachten uns Szenen aus, die sich mit Rassismus auseinandersetzten. Ich wollte aber mehr tun. In meiner Fantasie ereigneten sich rassistische Vorfälle, die mein heroisches Einschreiten erforderten. In der Realität ergaben sich solche Gelegenheiten kaum – abgesehen von einer Freundin, die ich beharrlich davon abzubringen versuchte, einen Mitschüler als »Japsen« zu bezeichnen. Und einer Hakenkreuzschmiererei auf dem Korridor, die ich mit Filzstift durchstrich.
Ich sehnte mich nach einem Ventil für mein Interesse an Politik, das einen in jenen Jahren zu einem Alien machte. Die politische Sedierung fühlte sich beklemmend an; als müsse ein nachfolgender Sturm um jeden Preis hinausgezögert werden, auch um den Preis der Selbsttäuschung. Das wichtigste Anliegen der Schülervertretungen waren Kakaoautomaten für die Aufenthaltsräume. Es blieb nichts weiter zu tun, als unseren Lebensstandard »in Afrika« zu verbreiten. Auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte, hatte meine Freundin recht gehabt: Es schien nichts zu geben, wofür es sich wirklich zu kämpfen lohnte.
Seit meiner Jugendzeit hat sich einiges verändert. Während ich meinen missionarischen Eifer mit den Jahren abstreifte, entwickelte sich das Missionieren von einem Rand- zu einem Massenphänomen. Wir erleben heute eine Politisierung, vor der es kein Entkommen gibt: Sprache, Essen, Freizeit, Liebe, Sex, Kindererziehung, Fortbewegung, Konsum – alles steht unter Beobachtung. Wo wir früher private Entscheidungen trafen, lastet heute das gesamte Gewicht der politischen Gegenwart auf uns und presst noch der unbedeutendsten Alltagshandlung ein politisches Bekenntnis ab. Sogar die Produkte selbst stellen inzwischen Forderungen auf, wie ich bemerkte, als ich beim Abrollen des Küchenpapiers zwischen aufgedruckten Herzen und Blättchen immer neue Imperative entdeckte: »Do something green today«, stand dort, und: »Kleine Taten verändern die Welt.«
Eine solche Politisierung engt ein. Sie öffnet dem Individuum keinen Raum für politische Forderungen, sondern stellt Forderungen an das Individuum. Es ist ein Zugriff der Politik auf unser Privatleben. Warum aber beteiligen sich so viele junge Menschen an diesem Zugriff? Wie wurde aus einer Generation, die sich für nichts und gegen nichts positionieren wollte, eine Generation von Missionaren?
Ich erinnere mich an eine Demonstration für bessere Bildung, an der ich als Jugendliche teilnahm. Es war ein großer Spaß; nur bei der Parole »Eine Schule für alle, sonst Krawalle!« schwieg ich: Die Drohung mit Krawallen wirkte inmitten der damaligen zuckerwattierten Gedämpftheit lächerlich. Auch wollte mir nicht einleuchten, wie die Abschaffung des Gymnasiums das Bildungssystem verbessern würde. Dass aber politisches Engagement sogar hätte bedeuten können, mich für meine ureigenen Interessen einzusetzen – zum Beispiel für den Ausbau der Begabtenförderung –, wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Es stand außer Frage, dass es beim Demonstrieren darum ging, die Chancen für weniger Privilegierte zu verbessern. Rückblickend erscheint mir dies als Kernproblem unserer heutigen Politisierung: An die Stelle der eigenen Interessen ist die Scham als Leitmotiv für politisches Handeln getreten. Wenn ich die politischen Kämpfe meiner Generation betrachte, frage ich mich: Sind es wirklich die eigenen Interessen, die hier verteidigt werden?
So idealisieren Vertreter meiner Generation die sexuelle Emanzipation in einem Maße, als seien sie sämtlich in Klosterinternaten aufgewachsen. Sie sehnen die Auflösung der Geschlechter herbei, um sich von den vermeintlichen Fesseln gesellschaftlicher Konventionen zu befreien. Doch wenn ich mich umsehe, wie meine Generation ihr soziales Umfeld gestaltet – oft in hermetischen Paarbeziehungen, ergänzt um die Familie und wenige enge Freunde – und wie sie sich fast manisch in immer neue sexuelle und geschlechtliche Kategorien einsortiert, dann erscheint es mir, als lege sie sich selbst die Fesseln an, die sie immer vermisst hat. Denn die Ehe schien schon in meiner Kindheit ein eher loser Bund zu sein: Gehe ich die Familien meiner früheren Freundinnen durch, fällt mir kaum eine Familie ein, in der die Eltern nicht seit Langem getrennt sind. Auch Geschlechterrollen wurden schon in den Neunzigerjahren hinterfragt, Eltern verbannten Barbiepuppen aus dem Kinderzimmer, Väter kümmerten sich um die Erziehung. Und während manche von uns als Teenager von einer Hochzeit in Weiß träumten, zeigten sich andere in sozialen Netzwerken knutschend mit ihrer besten Freundin oder outeten sich als bisexuell. Über gesellschaftliche Repression klagten wir nicht.
Ob es die eigenen Interessen sind, die verteidigt werden, frage ich mich auch, wenn sich Frauen meiner Generation durch das generische Maskulinum stärker angegriffen fühlen als durch das patriarchale muslimische Männerbild. Ich erinnere mich nicht, dass wir Mädchen es als ausgrenzend empfanden, wenn wir in Schulbüchern als »Schüler« angesprochen wurden. Die Klassenbesten waren ohnehin meist Mädchen, und sie träumten davon, Ärztin, Architektin oder Schauspielerin zu werden. Schwieriger als die Karriereplanung gestaltete sich damals der Weg zum Sprungturm im Schwimmbad oder zur Schaukel auf dem Spielplatz. Diese wurden oft von muslimischen Jungs besetzt, die noch heute, zu Männern gereift, mit derselben patriarchalen Selbstverständlichkeit den öffentlichen Raum besetzen und Frauen meiner Generationen zwingen, Strategien des Selbstschutzes zu entwickeln. Warum sprechen viele junge Feministinnen lieber über die Diskriminierung, die männliche Migranten angeblich erlitten, als über die Diskriminierung, die von ebendiesen ausgeht?
Auch das Misstrauen meiner Generation gegenüber dem Kapitalismus erstaunt angesichts der Erfolge, die im Westen wie in der ganzen Welt dank der freien Marktwirtschaft erzielt wurden. Junge Menschen, die in einem wohlhabenden liberalen Rechtsstaat aufwuchsen und ihre ganze Jugend der Selbstverwirklichung widmen konnten, untergraben so das Fundament ihrer eigenen Freiheit.
Nicht einmal die Pandemie animierte die Jugend in besonderem Maße dazu, sich politisch für die eigenen Interessen einzusetzen. Im Zweifel plädierten prominente junge Stimmen eher für eine Verschärfung der Maßnahmen als für eine Lockerung. Dabei litt kaum eine Generation so sehr unter den staatlich verordneten Einschränkungen wie diese. Ein Problem, das die junge Altersgruppe besonders betraf, führte also kaum zu ihrer politischen Mobilisierung1, während die etwa zeitgleich aufkommenden weltweiten »Black Lives Matter«-Proteste vor allem von jungen Menschen getragen wurden – von denen in Deutschland einige gar nicht selbst von Rassismus betroffen waren.
Warum widmet sich meine Generation Problemen mit wachsender Dringlichkeit, je weiter diese von der eigenen Realität entfernt sind? Man bezeichnet uns als »Generation Schneeflocke«: so zart, dass wir uns nur mit eigenen Befindlichkeiten und der Befriedigung unserer Bedürfnisse beschäftigen. Ich halte diese Interpretation für eine Täuschung. In den meisten Fällen handelt es sich um die Simulation von Bedürfnissen, deren Erfüllung dann mit Furor eingefordert wird. Viele der Tränen, die meine Generation öffentlich weint, sind Krokodilstränen. Für unseren eigenen Schmerz haben wir noch kaum eine Ausdrucksform gefunden.
Dieser Generation fehlt der Zugang zu vielen ihrer Probleme, weil sie politisches Engagement nicht primär als Artikulation von Interessen erlebt hat, sondern als Bewirtschaftung des schlechten Gewissens. Als eine Art moralische Steuer auf den Wohlstand und die Sicherheit, inmitten derer sie aufgewachsen ist. Ihr wurde nicht beigebracht, wie man Wohlstand und Sicherheit verteidigt, sondern wie man sich dafür schämt. Diese Scham aber macht sie anfällig für den ideologischen Zugriff von außen.
Die Lücke zwischen einer völlig entpolitisierten Kindheit und Jugend und dem späteren missionarischen Eifer ist kleiner, als sie erscheint. Wer sich als Teenager für Kakaoautomaten einsetzte, kämpft heute eben dafür, dass der Kakao mit Hafermilch zubereitet wird: Die Besessenheit vom Unwesentlichen ist dieselbe geblieben. Beide Haltungen folgen der Grundannahme, dass Politik bloße Oberfläche ist. Was sie unterscheidet, ist die Agitation, die in der Zwischenzeit im Bildungssystem, vor allem an den Universitäten stattgefunden hat. Gerade weil meiner Generation der Glaube an die politische Selbstwirksamkeit so früh und erfolgreich ausgetrieben wurde, lässt sie sich heute umso leichter für die politischen Zwecke anderer einspannen.
Was wie eine Selbstermächtigung aussieht, ist darum oftmals das Ergebnis einer politischen Instrumentalisierung. Wer aber sind die Nutznießer dieser vermeintlichen Befreiungskämpfe? Wie gelingt es, den kontrollierenden Zugriff als Emanzipation zu tarnen? Warum lassen sich die Weinenden von den eigenen Krokodilstränen überzeugen? Wie verändern diese das politische Gefüge? Und welche Bedürfnisse verbergen sich hinter dem Gefühlsspektakel; wonach sehnt sich diese Generation wirklich? All diesen Fragen wollen wir im Folgenden nachgehen.
KAPITEL I
A WELL RESPECTED MAN
DIE WURZEL DES SPIESSERTUMS
’Cause he gets up in the morning,
And he goes to work at nine,
And he comes back home at five-thirty,
Gets the same train every time.
’Cause his world is built ’round punctuality,
It never fails.
And he’s oh, so good,
And he’s oh, so fine,
And he’s oh, so healthy,
In his body and his mind.
He’s a well respected man about town,
Doing the best things so conservatively. […]
And he likes his own backyard,
And he likes his fags the best,
’Cause he’s better than the rest,
And his own sweat smells the best,
And he hopes to grab his father’s loot,
When Pater passes on. […]
And he plays at stocks and shares,
And he goes to the regatta,
And he adores the girl next door,
’Cause he’s dying to get at her,
But his mother knows the best about
The matrimonial stakes. […]
The Kinks, »A Well Respected Man«
Der junge Mann, den die britische Band »The Kinks« 1965 besingt, genießt in seiner Nachbarschaft hohes Ansehen: Er ist pünktlich, er besucht die richtigen Veranstaltungen, er strebt nach dem Erstrebenswerten: »Er ist ein sehr respektierter Mann in der Stadt, tut die besten Dinge auf konservative Weise.«
Fast sechzig Jahre später ist der Typus des »Well Respected Man« noch immer präsent: Statt um Pünktlichkeit allerdings bemüht er sich um Korrektheit, indem er diskriminierungsfrei spricht. Statt zur Regatta geht er zur »Black Lives Matter«-Demonstration, und wenn er mit Geld spielt, dann investiert er in klimaschonende Aktien. Vielleicht hält er seinen eigenen Schweiß noch immer für den wohlriechendsten, doch begehrt er neben den »girls next door« auch Boys und alle dazwischen, denn er ist pansexuell. Er genießt den Respekt seiner Nachbarschaft, wenn auch nicht als Konservativer: Die angesehenen Männer der Gegenwart werden »progressiv« genannt.
Das Gedankenspiel zeigt: Die Wurzel des Spießertums liegt nicht im Konservatismus, sondern im Konformismus. Der »Well Respected Man« verschafft sich, heute wie damals, Respekt durch Anpassung. Nicht individuelle Entscheidungen mehren sein Ansehen, sondern die Unterdrückung seiner Individualität. Die Kontrollinstanz ist eine unsichtbare: Hinter den Gardinen stehen die Nachbarn, selber nicht einzusehen, und beobachten, ob der Anstand gewahrt wird. Dem »Well Respected Man« bescheinigen sie geistige und körperliche Reinheit. Noch heute dokumentiert man seine Reinheit durch die Unterwerfung unter den Zeitgeist. Mit der gleichen Gewissenhaftigkeit wie damals werden gesellschaftliche Regeln erfüllt, um das Ansehen zu steigern. Es geht um das Bild, das man vor der Außenwelt abgibt.
Die »Kinks« allerdings teilten den Respekt für ihren Protagonisten schon damals nicht: Die Band mokierte sich mit ihrem Lied über die Aufrechterhaltung der bürgerlichen Fassade, die gegenüber der Nachbarschaft die eigene Durchschnittlichkeit beweist. Der stolze junge Mann ist in den Augen der »Kinks« ein Unfreier. Schon kurze Zeit darauf wird es der Mainstream ähnlich bewerten. Spätestens in den Siebzigerjahren entwickelt sich die individuelle Entfaltung der Persönlichkeit zum Ideal. Die gesellschaftlichen Normen sind die Front, an der eine ganze Generation ihre Freiheitskämpfe ausficht. Es ist auch die Freiheit der Minderheiten und unterdrückten Gruppen, die dort erkämpft wird: von Frauen, Schwarzen, Schwulen und Lesben.
Ab den Neunzigerjahren verschiebt sich der Freiheitskampf jedoch: Nicht mehr nur die Verhältnisse sollen verändert werden, sondern auch die gesellschaftlichen Diskurse, die diese Verhältnisse beschreiben und sie durch die Beschreibung angeblich prägen. Die unterdrückenden Diskurse müssen dekonstruiert werden; erst durch eine veränderte Sprache könnten sich die Verhältnisse wandeln: Dieser Schluss wird aus der Lektüre jener französischen Philosophen gezogen, die dem Poststrukturalismus zugerechnet werden. Als »French Theory« finden die Ideen von Michel Foucault, Jacques Derrida und anderen Denkern Eingang in die akademischen Debatten der Vereinigten Staaten. Dort entsteht, was heute als »Identitätspolitik« bezeichnet wird und längst auch in Europa die Debatten bestimmt. Wissenschaftszweige wie die Genderstudies, Critical Race Theory oder Postcolonial Studies befassen sich mit der Diskriminierung von Minderheiten, verfolgen dabei aber eine Agenda, die weit über eine bloße Untersuchung der Welt hinausgeht: Die Wissenschaftler wollen die Welt verändern.
Die Theorien der Dekonstruktion werden dabei in einen Imperativ der Rekonstruktion umgewandelt. Die Kräfte, die noch immer für sich in Anspruch nehmen, die Rechte von Minderheiten zu vertreten, haben längst die Deutungshoheit erlangt. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich in gleichem Maße die Verhältnisse für Minderheiten verbessert haben, denn darauf zielt die Identitätspolitik nicht ab: Sie strebt die Kontrolle über das Gesagte an. Viele Angehörige von Minderheiten sind darum über die rigiden Regeln, die in ihrem Namen verhängt werden, nicht erfreut.
Es scheint, als hätte sich die Entwicklung der Gesellschaft seit 1965 einmal im Kreis gedreht. Junge Menschen werden heute wieder in ein Korsett des korrekten Verhaltens und einer vermeintlich reinen Weltanschauung gepresst. Nicht die abweichende, sondern die angepasste Meinung wird sozial honoriert. Wer nicht mitmachen will, braucht eine stabile psychische Konstitution, um mit der Isolation zurechtzukommen, mit der ihn »progressive« Kreise strafen. Der »Well Respected Man« von heute darf sich outen, aber frei ist er nicht.
FOUCAULTS WERKZEUGKASTEN
Wie frei ist der »Well Respected Man« aus dem Lied der »Kinks«? Fragte man ihn selbst, würde er sich wohl als frei bezeichnen: Er entscheide selbst, wohin er gehe, wen er liebe, für welche Werte er einstehe. Dennoch wirkt seine Freiheit von außen betrachtet schal: Sein Leben erscheint wie das Produkt der sozialen Zwänge, denen es unterliegt.
Auch heute ist diese Frage nach der Freiheit des Einzelnen innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges zentral. Die Anhänger der politischen Korrektheit beharren darauf, dass sie deren Regeln freiwillig befolgten, dass es ihnen gar eine Freude sei, durch eine inklusive Sprache und rücksichtsvolles Verhalten Diskriminierung zu verringern. Die Mechanismen der Cancel Culture empfinden sie als normale und keineswegs repressive Vorgänge innerhalb kontroverser Debatten. Beschwerden über einen verengten öffentlichen »Meinungskorridor«, der definiere, was gesagt werden dürfe und worüber geschwiegen werden müsse, halten sie für übertrieben. Schließlich herrsche im Westen Meinungsfreiheit: Kein Gesetz verpflichte zu einer politischen korrekten Haltung oder Sprache.
Diese Argumentation erstaunt: Ausgerechnet jene, die durch die Dekonstruktion der Diskurse die Verhältnisse verändern wollen, die also das Durchbrechen sozialer Zwänge als ultimatives Machtinstrument propagieren, verleugnen – wenn ihr eigenes Verhalten hinterfragt wird – das Wirken sozialer Zwänge. Dabei zeigte ihr eigener philosophischer Säulenheiliger auf, welche Macht diese Zwänge ausüben: Der französische Philosoph Michel Foucault untersuchte den Einfluss von Normen auf jene Sphären, in die Gesetze nicht hineinreichen. Er entschlüsselte die versteckten Formen dieser normierenden Macht, die den Diskurs lenkt, wo keine übergeordnete Autorität ihn reguliert. Doch obwohl die Denkschule der Wokeness sich auf diese Analysen stützt, blenden ihre Verfechter den repressiven Charakter der Normierung aus, sobald es um ihre eigenen woken Normen geht.
»Alle meine Bücher«, erklärte Foucault 1976 in einem Interview, »sind […] kleine Werkzeugkästen. Wenn die Leute sie öffnen und sich dieses Satzes, jener Idee, einer bestimmten Analyse als Schraubenzieher oder Maulschlüssel bedienen möchten, um die Machtsysteme kurzzuschließen, zu disqualifizieren, eventuell sogar die eingeschlossen, aus denen meine Bücher hervorgegangen sind – gut, umso besser.«2 Die woken Aktivisten machen sich die Werkzeuge Foucaults in einer Weise zunutze, die seine Theorien entstellt: Anstatt seine Untersuchung totalitärer Machtmechanismen als Analyse zu verstehen, verwenden sie sie als Anleitung zu totalitärem Denken. Darum wollen wir uns Foucaults Werkzeugkasten in diesem Buch zurückerobern: um die Prozesse dieser Entstellung aufzudecken und jene Systeme zu durchleuchten, die aus der Interpretation seiner Bücher hervorgegangen sind. Mit Foucaults Maulschlüsseln wollen wir die Machttechniken der Wokeness auseinandernehmen.
DIE DIGITALE NACHBARSCHAFT
Man darf annehmen, dass der »Well Respected Man« von 1965 alle Straßen seiner Nachbarschaft kannte, ebenso wie ihre Einwohner – zumindest vom Sehen beim sonntäglichen Kirchgang. Seither hat seine Nachbarschaft eine unerwartete Entwicklung genommen: Sie hat sich mit der Erfindung des Internets explosionsartig ausgedehnt. Die sozialen Netzwerke haben die Bedeutung der physischen Nachbarschaft geschmälert und durch eine Weltöffentlichkeit ersetzt, in der jeder zum Publizisten werden kann. Alle menschlichen Regungen, in Bild oder Schrift festgehalten, werden zur Verfügungsmasse in dieser aus unterschiedlichsten Weltregionen verschmolzenen Giganachbarschaft.
Dennoch ähneln die Mechanismen dieser neuen Nachbarschaft jenen der alten, deren gesellschaftliches Korrektiv der Blick durch die Gardine war. Heute ermöglicht das anonyme Nutzerkonto, zu beobachten, ohne selbst gesehen und erkannt zu werden. Wer im digitalen Raum gegen die Regeln des Anstands verstößt, kann sicher sein, bei seinem Fehltritt beobachtet zu werden. Er weiß nur nicht immer, von wem. Die Weiten des Internets verwandelten sich darum von einer Spielwiese für Individualisten in eine Zone des sozial erzwungenen Konformismus. Die digitale Öffentlichkeit wirkt immer öfter wie eine spießige Ansammlung von Gardinenspähern.
Foucault bezeichnete diese sozialen Dynamiken als »Panoptismus«. Er orientierte sich dabei am britischen Philosophen Jeremy Bentham, der im 18. Jahrhundert das sogenannte Panopticon als ideales Gefängnis entwarf: Ein Überwachungsturm in der Mitte eines ringförmigen Gebäudes ermöglicht den Wärtern Einsicht in alle Zellen. Die Gefangenen jedoch haben keine Einsicht in den Turm der Wärter. Bentham, schreibt Foucault in seinem Buch »Überwachen und Strafen«, habe »das Prinzip aufgestellt, dass die Macht sichtbar, aber uneinsehbar sein muss; sichtbar, indem der Häftling ständig die hohe Silhouette des Turms vor Augen hat, von dem aus er bespäht wird; uneinsehbar, sofern der Häftling niemals wissen darf, ob er gerade überwacht wird; aber er muss sicher sein, dass er jederzeit überwacht werden kann.«
Der Druck, den die permanente Sichtbarkeit und die damit einhergehende potenzielle Überwachung auf den Gefangenen ausüben, führe viel effizienter zu seiner Unterwerfung, als ihn in ein dunkles Kerkerloch einzusperren, denn: »Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.«3
Das Panopticon ist für Foucault aber viel mehr als ein bloßes Gefängnis. Es bilde modellhaft die Machtstrukturen der Gesellschaft ab. Foucault schreibt, dass die Mechanismen der Sichtbarkeit des Einzelnen und seiner Überwachung nach und nach die Institutionen und ihre Mitglieder diszipliniert hätten, etwa in Krankenhäusern und Irrenanstalten, in Schulen, beim Militär und der Polizei, im Verwaltungsapparat. Am Ende dieses Prozesses stehen für Foucault die modernen Disziplinargesellschaften, deren Funktionieren wesentlich davon abhinge, dass der Einzelne die Machtverhältnisse internalisiere und sich ihnen unterwerfe.
Den Regeln des Panoptismus unterliegt auch das Internet: Der Druck der Sichtbarkeit hat sich im Alltag erhöht, seitdem sich ein Teil der Privatsphäre durch die Digitalisierung in den öffentlichen Raum verlagert hat. Zwar entsteht diese Sichtbarkeit nicht unter gesetzlichem Zwang, wie es im Gefängnis der Fall ist, denn es ist theoretisch möglich, sich dem digitalen Raum zu entziehen. Dennoch ist der Druck, sich sichtbar und damit für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen, groß; besonders unter jungen Menschen: Wer sich digital isoliert, isoliert sich auch sozial. Während wir uns also zeigen, freiwillig die eigene Sichtbarkeit gewährleisten, sind wir der Silhouette des Wachturms gewahr. Die Überwachung ruft sich uns ins Bewusstsein, sobald jemand gegen die Regeln der politischen Korrektheit verstoßen hat und sein Verhalten öffentlich angeprangert wird. In den Netzwerken verbreiten sich die Namen der Regelbrecher als Schlagwort und werden in den »Trends« gelistet, als würde nach ihnen gefahndet.
Es schmälert die Macht der Überwachung nicht, dass nicht jeder Verstoß gegen die Regeln der politischen Korrektheit geahndet, dass nur ein Bruchteil davon überhaupt entdeckt wird. Foucault schreibt über das Panopticon: »Die Wirkung der Überwachung ist permanent, auch wenn ihre Durchführung sporadisch ist.«4 Im Grunde ist es gleichgültig, ob in einem bestimmten Augenblick der Überwachungsturm besetzt ist oder nicht; allein die Tatsache, dass der Häftling überwacht werden könnte, zwingt ihn zu permanentem Gehorsam. Das heute vielfach vorgebrachte Argument, dass es, gemessen an der Menge aller öffentlichen Äußerungen, nur sehr wenige Fälle von Cancel Culture gebe, zielt darum ins Leere: Es ist gerade diese Unberechenbarkeit, die den Einzelnen dazu zwingt, permanent die eigene Einhaltung der Regeln zu kontrollieren, oder in den Worten von Foucault: die Zwangsmittel der Macht gegen sich selbst auszuspielen.
So wird der Einzelne zum »Prinzip seiner eigenen Unterwerfung«: Verzicht und Selbstkontrolle sind seine Ideale. Seine Sprache unterwirft er selbst dann den Regeln der Korrektheit, wenn er damit den Sinn entstellt. Bereitwillig lässt er sich diktieren, zu welchen Themen er grundsätzlich den Mund halten soll, weil er als persönlich nicht Betroffener kein Recht habe zu urteilen.
BEZIEHUNGSNETZ DER ÜBERWACHUNG
Wenn Foucault schildert, wie die Mechanismen der Disziplin die Gesellschaft durchwirken, erscheint es mitunter, als hätte er beim Schreiben unsere Gegenwart vor Augen gehabt.
»Die Überwachung beruht zwar auf Individuen«, schreibt Foucault, »doch wirkt sie wie ein Beziehungsnetz von oben nach unten und bis zu einem gewissen Grade auch von unten nach oben und nach den Seiten. Dieses Netz ›hält‹ das Ganze und durchsetzt es mit Machtwirkungen, die sich gegenseitig stützen: pausenlos überwachte Überwacher.«5
Die regulierende Wirkung dieses Beziehungsnetzes erleben wir im Alltag: etwa, wenn wir uns schämen, weil wir ein Wort verwendet haben, das nicht dem neuesten Stand der politischen Korrektheit entspricht. Oder weil wir etwas konsumiert haben, das als besonders umweltschädlich gilt. Fast jeder wird in solchen Situationen schon einmal irritierte oder missbilligende Blicke und Kommentare auf sich gezogen haben von Menschen, denen er eigentlich gar nicht nahe genug steht, um sich in Privatangelegenheiten ihrem Urteil unterziehen zu müssen. Wenn wir einmal eine solch demütigende Erfahrung gemacht haben, ist es verlockend, uns von dieser Scham zu entlasten, indem wir jemand anderen beschämen. Bei nächster Gelegenheit mahnen wir selbst die korrekte Verwendung der Sprache oder bewussten Konsum an.
Dieses normierende Beziehungsnetz wirkt, wie von Foucault beschrieben, in allen Richtungen: nach den Seiten, wenn sich Freunde, Kollegen, Nachbarn belehren. Nach oben, wenn Prominente, Politiker, Wissenschaftler oder Amtsträger durch öffentliche Kritik, mitunter gar Ächtung, ihren Posten oder ihren guten Ruf verlieren. Nach unten, indem Institutionen und Behörden auf direktem oder indirektem Wege Verhalten und Sprache der Bevölkerung normieren.
Zwischen den Ebenen entstehen mit der Zeit Wechselwirkungen: So setzt das Publikum bisweilen Veranstalter unter Druck, Auftritte von Gesprächsgästen oder Musikern abzusagen, weil diese gegen die Regeln der politischen Korrektheit verstoßen haben. Beugen sich die Veranstalter, geht dies meist mit einer öffentlichen Beschämung der vormals eingeladenen Gäste einher: Diesen wird dann vom Veranstalter Transphobie oder kulturelle Aneignung und damit Rassismus unterstellt. Die disziplinierende Macht geht hier verschlungene Wege: Zunächst werden die Regeln der politischen Korrektheit von institutioneller Ebene (etwa durch Universitäten oder Behörden) nach »unten« durchgesetzt. Dort werden sie, zum Beispiel von Studenten, aufgegriffen und nach »oben«, also gegen Veranstalter oder Institutionen, gerichtet. Diese wenden die Regeln nun wieder nach »unten« gegen ihre Gäste, was eine Breitenwirkung nach sich zieht und jenem Teil des Publikums, dem die Regeln bisher unbekannt waren, die Grenzen des Erlaubten aufzeigt.
Auf Dauer braucht es gar keine Missbilligungen mehr, um uns auf politisch korrektem Kurs zu halten. Es reicht aus, dass jemand über seinen eigenen umweltbewussten Lebensstil spricht, um uns die Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Oder dass jemand uns im Wettrennen um korrekte Sprache voraus ist und eine neue, noch korrektere Wortschöpfung kennt – denn in jedem neuen Wort steckt auch die Unterstellung, dass das alte Wort diskriminierend sei. Längst denken wir im Voraus mit, welche Aussagen oder Ausdrucksweisen auf Ablehnung stoßen könnten. Jetzt ist es nicht mehr das Gegenüber, das uns kontrolliert, sondern wir selbst.
Unsere Loyalität gilt also nicht mehr nur jenen, die die Regeln aufstellen, sondern vielmehr den sich stetig neu konstituierenden Regeln selbst. Foucault beschreibt es so: »In der hierarchisierten Überwachung der Disziplinen ist die Macht keine Sache, die man innehat, kein Eigentum, das man überträgt; sondern eine Maschinerie, die funktioniert. Zwar gibt ihr der pyramidenförmige Aufbau einen ›Chef‹; aber es ist der gesamte Apparat, der ›Macht‹ produziert und die Individuen in seinem beständigen und stetigen Feld verteilt.«
»Das erlaubt es der Disziplinarmacht«, so Foucault weiter, »absolut indiskret zu sein, da sie immer und überall auf der Lauer ist, da sie keine Zone im Schatten lässt und da sie vor allem diejenigen pausenlos kontrolliert, die zu kontrollieren haben; und zugleich kann sie absolut ›diskret‹ sein, da sie stetig und zu einem Gutteil verschwiegen funktioniert.«6 Ebendiese Asymmetrie erleben auch wir: Keine Zone unseres Privatlebens lässt die politische Korrektheit im Schatten. Alles scheint einem Tribunal der Moral zu unterstehen, zu dessen Richter sich jeder beliebige Fremde aufschwingen darf. Gleichzeitig ist es kaum möglich, diesen indiskreten Zugriff als solchen zu benennen: Die Prozesse der Disziplinierung laufen so diskret ab, dass häufig gar ihre Existenz geleugnet wird. Allein die Beschwerde über den Zugriff auf unsere Privatsphäre wird als Beweis einer »rechten« Geisteshaltung gewertet, der eine noch intensivere Disziplinierung rechtfertigt.
DIE PEITSCHE BLEIBT IM STALL
Wir haben es also mit einer Form der Machtausübung zu tun, die so elegant ist, dass sie schwer erkannt und kaum benannt werden kann. Foucault schreibt über die »Kunst der ›guten Abrichtung‹«: »Anstatt einheitlich und massenweise alles zu unterwerfen, was ihr untersteht, trennt sie, analysiert sie, differenziert sie, treibt sie ihre Zersetzungen bis zu den notwendigen und hinreichenden Einzelheiten.«7
Zersetzen bis zu den Einzelheiten: Dies scheint die Devise vieler Debatten zu sein, die heute öffentlich geführt werden. Oft steht dabei eine einzelne Person im Fokus, deren Fehlverhalten sich jedoch auf solch spezifische und alltagsfremde Regeln bezieht, dass der Durchschnittsbürger zunächst eine Hintergrundrecherche durchführen muss, um die Vorwürfe überhaupt zu verstehen. Manchmal wirken diese Regeln, als wären sie von einem Zwangscharakter erdacht, der jetzt eben nicht mehr nur wahnhaft die Hände wäscht und dreimal auf die Stuhllehne klopft, um die Welt im Lot zu halten, sondern auch Mitmenschen mit »toxischen« Gedanken meidet und die richtigen Silben an Wörter anhängt.
Wie aber funktionieren die Machtmechanismen des Trennens, des Analysierens, des Differenzierens? Foucault sieht hier ein »System von Vergütung und Sanktion« am Werk: »Die Disziplinarstrafe hat die Aufgabe, Abweichungen zu reduzieren. Sie ist darum wesentlich korrigierend. Neben den Strafmitteln, die direkt der Justiz entliehen sind (Geldbuße, Peitsche, Karzer), bevorzugen die Disziplinarsysteme Bestrafungen, die in den Bereich des Übens, des intensivierten, vervielfachten, wiederholten Lernens fallen.«8
Auch im Namen der politischen Korrektheit werden juristische Mittel selten eingesetzt, da es sich eher um Verstöße gegen die öffentliche Moral als um solche gegen das Gesetz handelt – die Peitsche bleibt im Stall. Regelverstöße werden mit sogenannten Shitstorms geahndet, dem Pranger im Netz, oft begleitet von medialer Berichterstattung. Manchmal verlieren die Regelbrecher ihre Anstellung, manchmal nur ihr Renommee. Dieser Bestrafungsmechanismus erscheint weniger brutal als Körperstrafen, wirkt sich aber auf perfide Weise auf die Psyche aus, weil der Regelbrecher sozial isoliert und seine Vertrauenswürdigkeit in Zweifel gezogen wird.
In der Regel wird ihm allerdings ein Hintertürchen offengelassen, eine Aussicht auf teilweise Rehabilitation: Durch Üben und Lernen kann er sich bessern. In den letzten Jahren bildete sich ein ganzer Geschäftszweig um diese Rituale der Besserung herum. Einzelpersonen oder Unternehmen können sich beibringen lassen, wie sie den angeblich tief in ihnen und ihrer Kultur verwurzelten Rassismus oder die Misogynie überwinden können. Auch gegen Transphobie, Diskriminierung von Übergewichtigen oder Behinderten hilft professionelles Vokabeltraining: Wer die korrekten Wörter und verbotenen Fragen auswendig kennt, ist beruflich im Vorteil.
Foucault beschreibt die Scheinheiligkeit solcher Disziplinarprozesse: »Der erwartete Besserungseffekt resultiert weniger aus Sühne und Reue als vielmehr direkt aus der Mechanik einer Dressur. Richten ist Abrichten.«9
Auch heute gleichen die Rituale der Sühne einer Dressur. Das wichtigste Element des Besserungsvorgangs stellt die Entschuldigung dar, ursprünglich ein Ausdruck der Reue. Doch die Entschuldigungen der Gegenwart beruhen selten auf Freiwilligkeit. Die Öffentlichkeit oder einzelne Nutzer fordern sie ein, wenn jemand sich kontrovers äußert. Wer sich mit einer solchen Entschuldigung zufriedengibt, die nicht in einem inneren Prozess der Reflexion gereift ist, sondern durch die Anpassung an äußeren Druck zustande kommt, der sehnt sich im Grunde gar nicht nach einer Entschuldigung: Er will, dass das Gegenüber den Kotau macht. Die Bedeutung der Entschuldigung wandelt sich. Sie ist kein Eingeständnis von Reue mehr, sondern von Unterwerfung.
Weil dies inzwischen auch den Anhängern der politischen Korrektheit aufgefallen ist und zudem der Wert der Entschuldigung mit ihrer inflationären Verwendung sinkt, wenden sie auch hier die Techniken des Analysierens und Differenzierens an. Beim Entschuldigen kann man mittlerweile einiges falsch machen, sich aber auch durch eine besonders gelungene Entschuldigung von der Masse abheben. Eine missratene, weil unehrliche Entschuldigung, die zum Beispiel ein einschränkendes »Es tut mir leid, aber





























