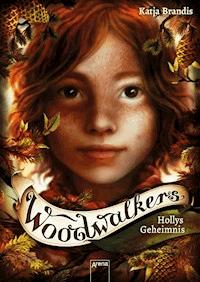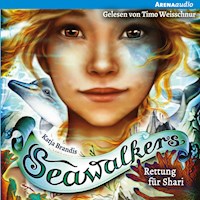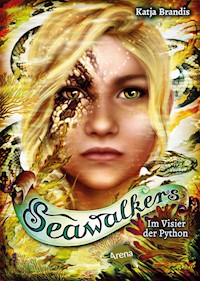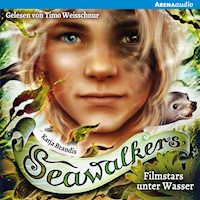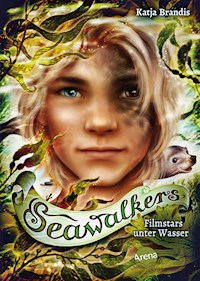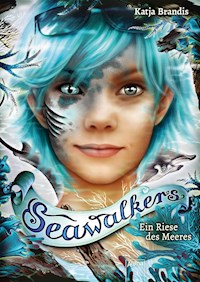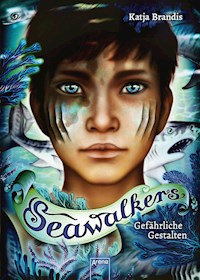7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn aus einem Abenteuertrip eine Reise zu sich selbst wird! Für alle Leserinnnen, die dem Ruf der Freiheit in die weite Welt folgen wollen. Vor allem aber für alle größer gewordenen Woodwalkers-Fans. Auf Lilly wartet ein unvergessliches Erlebnis: Sie darf auf einer Farm in Namibia mitarbeiten, die sich dem Schutz der bedrohten Geparden widmet. Dort soll die deutsche Tierarzttochter bei der Pflege verletzter Großkatzen, der Aufzucht verwaister Jungtiere und der Feldforschung im Busch mithelfen. Ein Traum wird für sie wahr! Lillys Aufenthalt klappt so lange gut, bis sie sich in Erik verliebt, den Sohn eines benachbarten Farmers. Seine seltsame Familie und seine Geheimnisse stürzen ihr Leben völlig ins Chaos. Katja Brandis, die mit ihrer Woodwalkers-Serie regelmäßig die Bestsellerliste stürmt, mit einem naturverbundenen Roman über den Schutz von Geparden in Namibia. Authentisch, sympathisch und völlig frei von kitschigem Sonnenuntergangspathos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Weitere Bücher von Katja Brandis im Arena-Verlag:
Woodwalkers. Carags Verwandlung
Woodwalkers. Gefährliche Freundschaft
Woodwalkers. Hollys Geheimnis
Woodwalkers. Fremde Wildnis
Woodwalkers. Feindliche Spuren
Woodwalkers. Tag der Rache
Seawalkers. Gefährliche Gestalten
Seawalkers. Rettung für Shari
Seawalkers. Wilde Wellen
Khyona. Im Bann des Silberfalken
Khyona. Die Macht der Eisdrachen
Katja Brandis, Jahrgang 1970, hat Amerikanistik, Anglistik und Germanistik studiert und als Journalistin gearbeitet. Schon in der Schule liehen sich viele Mitschüler ihre Manuskripte aus, wenn sie neuen Lesestoff brauchten. Inzwischen hat sie zahlreiche Romane für Jugendliche veröffentlicht, unter anderem Ruf der Tiefe, Floaters – Im Sog des Meeres und White Zone. Mit ihren Bestsellerreihen Woodwalkers und Seawalkers begeistert sie Jungen und Mädchen gleichermaßen. Sie lebt mit Mann, Sohn und drei Katzen in der Nähe von München.www.katja-brandis.de
Für Sofia
1. Auflage als Arena-Taschenbuch 2020
© 2020 Arena Verlag GmbH
Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Dieser Roman erschien erstmals in anderer Ausstattung 2009
im Verlag Carl Ueberreuter, Wien.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und
Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Umschlaggestaltung: ZERO unter Verwendung von Bildmaterial
von FinePic®, München; Gettyimages / Photolibrary /
© Martin Harvey; Stocksy / © Carey Sha
E-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
ISSN 0518-4002
E-Book ISBN 978-3-401-80891-8
Besuche den Arena-Verlag im Netz:
www.arena-verlag.de
PROLOG
Ein kräftiger Wind war aufgekommen und die Luft schmeckte nach Staub.
Geduldig bewegte sich der Wanderer nach Osten; seine Vorderpfote schmerzte, wo sich ein Dorn hineingebohrt hatte. Doch das war vergessen, als er in der Ferne die hellbraunen Rücken von Springböcken erkannte.
Das hohe Gras verbarg ihn, während er sich anschlich. Er merkte kaum, wie es seine Flanken streichelte; geduckt kroch er weiter. Doch er setzte zu früh zum Lauf an, die Antilopen sahen ihn und preschten davon. Er rannte mit ganzer Kraft und schaffte es doch nicht, sie einzuholen. Enttäuscht blieb er stehen und blickte den Springböcken nach. Wie hatte seine Mutter es nur geschafft, sie zu erwischen? Bei ihr hatte es immer so leicht ausgesehen.
Seine Pfote schmerzte jetzt noch stärker und der Hunger wühlte in seinem Bauch, stahl ihm die Kraft aus dem Körper. Seit seine Mutter gestorben war, getötet von dieser großen hellgrauen Antilope mit den furchterregenden Säbelhörnern, hatte er keine richtige Mahlzeit mehr gehabt. Nur dieses junge Warzenschwein, und das war auch schon ein paar Sonnenumläufe her.
Es war kein schlechtes Revier, kein anderes Männchen in der Gegend, aber länger als ein paar Tage würde er nicht mehr durchhalten. Vielleicht sollte er doch versuchen, eine dieser weiß-braunen, durchdringend meckernden Ziegen zu erwischen, vor denen seine Mutter ihn gewarnt hatte.
Was konnte schlimmer sein als dieser Hunger?
EIN UNFALL UND EIN GESCHENK
Wäre ich in diesem Winter zu einer Wahrsagerin gegangen, hätte sie mir – wenn sie etwas taugte – ziemlich seltsame Dinge erzählt. Dass für mich die Sonne bald aus dem Norden scheinen würde statt aus dem Süden. Dass ich Dutzende Raubkatzen persönlich kennenlernen würde … und einen Jungen, der es sogar wert war, dass ich für ihn das Gesetz brach.
Nur die wenigsten Wahrsagerinnen hätten sich getraut, mir zu sagen, dass erst jemand sterben musste, bevor all diese Dinge geschehen konnten.
Es war Frodo, der starb. Nicht der Hobbit natürlich, der ist immer noch irgendwo in Mittelerde dabei, seine haarigen Füße zu kämmen. Frodo war mein Kater. Ich hätte nie gedacht, dass er überfahren werden würde, weil er ein Stadtkater und so klug war, dass er ungelogen einmal nach rechts und links guckte, bevor er eine Straße überquerte. Aber diesmal hatte es ihn erwischt und ich kniete auf der Straße neben ihm, streichelte ihn zum letzten Mal und sah kaum noch etwas vor lauter Tränen.
»Es ist bestimmt schnell gegangen, Lilly, er hat sicher kaum was gemerkt«, versuchte mich meine Mutter zu trösten.
Was für eine dämliche Bemerkung. Wie kann man »kaum was merken«, wenn einem ein Metallmonster das siebte Katzenleben aushaucht? Frodo würde mich nie wieder wecken, indem er morgens auf der Bettdecke herumtrampelte und mir zärtlich ins Ohr prustete. Und das wahrscheinlich nur, weil jemand unbedingt austesten musste, ob sein blöder BMW es auf einer Landstraße im Odenwald bis hundertsechzig schafft, auch wenn Schnee liegt und jeder vernünftige Mensch die Karre sowieso in der Garage lässt.
Ich verzog mich zu Harry, unserem Eichhörnchen, das in einem hohlen Baum hinter unserem Haus lebt. Harry könnte jederzeit in den Wald zurück, bleibt aber bei uns, weil er süchtig nach Cashewnüssen ist. Außer ihm tummeln sich bei uns noch drei Border Collies, zwei Schildkröten, ein Papagei, fünf Wüstenspringmäuse und ein pensioniertes Springpferd namens Silver. Aber die Schildkröten hatten sich für den Winter irgendwo eingegraben und eigneten sich sowieso nicht zum Knuddeln und Trösten, Silver lebte in einem Stall auf der anderen Seite von Michelstadt, der Papagei schlief noch und Harry und die Springmäuse hatten eher Grund zum Feiern – sie waren immer in Gefahr gewesen, als Frodos Snack zu enden.
Harry turnte von einem Ast herunter, sprang mir auf die Schulter und untersuchte meine Hand mit den winzigen Pfötchen, um herauszufinden, ob ich ihm eine Cashew mitgebracht hatte. Traurig kraulte ich sein samtweiches rotes Fell und ging gleichzeitig das Telefon holen, um Sofia anzurufen.
»Ach du große Scheiße«, sagte sie, als sie hörte, was passiert war. »Ich komme gleich rüber.«
Sofia hat eine Menge dunkler Locken, ganz liebe Augen und einen ihrer Meinung nach viel zu großen Hintern. Sie gehört zu denjenigen, die den Test bestanden haben – den Test, bei mir daheim einzulaufen und weder das Gesicht zu verziehen noch nach einer Viertelstunde zu flüchten. Als Sofia zum ersten Mal zu Besuch kam, war ihre Hose nach fünf Minuten von Frodos Haaren übersät, eine der Schildkröten lief stur wie ein Panzer immer wieder gegen ihren Schuh und Harry machte sich daran, in ihren Locken ein Nest zu bauen. Sofia verzog keine Miene. Alles, was sie sagte, war: »Kann ich ihn mitnehmen, falls er in meiner Frisur einschläft?«
Dann mussten wir beide furchtbar lachen.
Jetzt gerade war mir aber nicht nach Lachen zumute. Sofia nahm mich in den Arm und versprach: »Wir organisieren ein tolles Begräbnis für Frodo.«
Ich nickte und wieder stieg die Traurigkeit in mir hoch, erstickte mich fast. Geduldig reichte Sofia mir noch ein paar Taschentücher.
»Hoffentlich versuchen meine Eltern nicht, mir eine neue Katze zu besorgen«, presste ich hervor.
»Sag ihnen doch einfach, dass du das nicht willst«, meinte Sofia und gab mir gleich die ganze Packung.
In drei Wochen war mein sechzehnter Geburtstag und nebenbei auch noch Weihnachten. Ich habe das Pech, am zweiundzwanzigsten Dezember geboren worden zu sein. Das bedeutet, dass die Geschenke alle eine Nummer kleiner ausfallen, weil kein Mensch es sich leisten kann, gleich zweimal hintereinander etwas schön Teures zu schenken. Also bekomme ich immer nur Sachen wie ein neues Gesellschaftsspiel oder ein paar Bücher und kann den Rest des Jahres schauen, wie ich über die Runden komme.
Meine Eltern nickten, als ich ihnen sagte, dass sie mir bitte keine Katze schenken sollten. »Hätten wir sowieso nicht gemacht«, meinte mein Vater. »Oder hältst du uns für so unsensibel?«
Ich musste zugeben, dass sie das nicht waren. Das könnten sie sich gar nicht erlauben, weil sie sonst ernsthafte Probleme mit ihren Kunden bekämen. Meine Mutter ist Psychologin und mein Vater Tierarzt, beide haben ihre Praxis im Haus. Wenn man so aufwächst, härtet das enorm ab. Ich mache mir schon seit Jahren einen Spaß daraus zu raten, mit welchen Problemen die Leute wohl zu meiner Mutter kommen. Dass ich anfing, sie im Wartezimmer auszufragen, kam bei meiner Mutter allerdings nicht sonderlich gut an. Seither helfe ich lieber bei meinem Vater in der Praxis mit, was nicht nur Spaß macht, sondern auch den Vorteil eines zusätzlichen Taschengelds mit sich bringt.
Ich hätte nie damit gerechnet, was mir meine Eltern schließlich schenken würden. Erst war ich verblüfft, weil auf dem Tisch außer einem kerzengespickten Erdbeercremekuchen nicht gerade viel lag. Ein Buch und ein neuer Rucksack, aber das war es auch schon. Na toll, noch weniger als sonst. Dabei ging es meinen Eltern beruflich blendend, denn Tiere hören nicht einfach auf, krank zu werden, und Krisen sind für Psychologen auch nicht gerade schädlich, weil in solchen Zeiten alle ihren Zuspruch umso dringender brauchen.
Auf den zweiten Blick sah ich den kleinen Umschlag neben dem Kuchen. Aha, ein Gutschein. Meine Eltern strahlten, als ich ihn nahm und mit dem Fingernagel aufriss. Meine Güte, die waren ja stolz auf sich. Ein klein bisschen misstrauisch zog ich das Blatt daraus hervor. Las es mir durch, was ziemlich schnell ging, weil nur ein Satz darauf stand. Dann wurde ich ziemlich blass, glaube ich. Vor Freude und vor Schock.
»Dafür gibt es aber nicht viel zu Weihnachten, Lilly«, sagte meine Mutter und spielte an ihrer Holzperlenkette herum.
»Die ganze Familie hat zusammengelegt«, erzählte mein Vater bestens gelaunt. »Tante Betty und Onkel Klaus, deine beiden Omas und wir. Um dich ein bisschen zu trösten wegen Frodo.«
»Du hast zwar gesagt, keine Katze, aber die hier sind ja auch ein paar Nummern größer …«, nahm meine Mutter den Faden auf.
Ich glotzte noch einmal auf den Gutschein in meiner Hand. Darauf stand:
In den nächsten Sommerferien darfst du vier Wochen lang auf der Farm OUNENE EÚLU in Namibia mitarbeiten – bei einem Projekt, das sich dem Schutz der bedrohten Geparden widmet.
»Du sagst ja gar nichts.« Mein Vater klang besorgt. »Gefällt es dir nicht?«
Gerade in diesem Moment hatte ich den Schock überwunden und stieß einen gellenden Schrei aus, der unsere Border Collies in Deckung gehen ließ. Geparden! Ich mag zwar Hunde, Hamster und Wellensittiche – all die Wesen, die mein Vater tagtäglich behandelt – sehr. Aber wilde Tiere sind noch mal etwas anderes. Einfach toller. Und es ist erstaunlich, dass Harry bei seinen Besuchen in meinem Zimmer noch keinen Herzanfall bekommen hat, weil die Wände mit Bildern von Tigern, Jaguaren und Geparden dekoriert sind.
Dass mich meine Eltern vier Wochen allein nach Afrika lassen wollten, wunderte mich nicht besonders. Ihre Vorstellung von einem erholsamen Urlaub ist Trekking im Himalaja. Das ganze Jahr sparen sie, wo sie können – ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt etwas gegessen habe, was nicht von ALDI war –, um im Sommer ihre Praxen zumachen und in irgendeinen entlegenen Winkel der Welt aufbrechen zu können. Unfairerweise ohne mich – ich werde gewöhnlich in irgendein Jugendzeltlager am Plattensee oder zu meinen Großeltern nach Lübeck abgeschoben. Aber es sah so aus, als wäre ich jetzt endlich auch mal dran mit den Abenteuern!
Sofia hatte die Weihnachtsferien blöderweise bei ihrem Familienclan verbracht, ich konnte ihr erst nach den Feiertagen von dem Gepardengeschenk erzählen. Schon in der ersten Pause suchte ich nach ihr – und fand sie bei den Schließfächern. Mit ihrem neuen Freund Marco, den sie bei einem Zirkusprojekt kennengelernt hatte. Die beiden küssten sich und sahen nicht mehr, was um sie herum vorging. Das gab mir einen kleinen Stich ins Herz. Auf irgendeine geheime Art wusste Sofia, wie das mit dem Flirten funktionierte. Obwohl sie kein Modelgesicht hatte, gab es immer Jungs, die sich für sie interessierten. Ich gönnte es ihr, fragte mich aber, warum das bei mir nie klappte.
Freunde hatte ich jede Menge. Jonas Thompson zum Beispiel, der mich für den einzigen Menschen hielt, der seine surrealen Theaterstücke verstand, und Fabian, der ständig versuchte, mich auf Konzerte von irgendwelchen schrecklichen Indie-Bands mitzuschleppen. Aber verlieben? Ich war nicht mal sicher, ob Jonas oder Fabian mich überhaupt als Wesen wahrnahmen, in das man sich verlieben könnte.
Lautlos machte ich mich aus dem Staub und ließ Sofia und Marco allein. Zum Glück erwischte ich Sofia und meine andere Freundin Ricarda noch mal vor Ende der Pause und endlich konnte ich meine Neuigkeiten loswerden. Wie ich mir schon gedacht hatte, freuten sich beide für mich, starben aber fast vor Neid. »So viel zum Thema verwöhntes Einzelkind«, stichelte Sofia, spielte mit ihren großen roten Ohrringen und seufzte theatralisch. Sofia hat zwei Brüder, der eine studiert schon und liegt seinen Eltern, wie man so schön sagt, ordentlich »auf der Tasche«, der andere ist eine zehnjährige Nervensäge.
Es war nicht sehr nett von Sofia, mir vorzuwerfen, dass ich keine Geschwister habe. Ich hätte gerne welche, nur haben meine Eltern die Kurve nicht mehr gekriegt, wahrscheinlich, weil sie zu viel mit ihrer Selbstverwirklichung beschäftigt waren.
»Ja genau«, sagte ich zu Sofia. »Als verwöhntes Einzelkind habe ich eine gesellschaftliche Verantwortung und die praktiziere ich, indem ich Geparden rette!«
»Tun’s normale Katzen nicht auch? Du könntest im Tierheim aushelfen.«
»Hab ich doch schon! Gib’s auf, du schaffst es nicht, mir ein schlechtes Gewissen zu machen.«
Ricarda hatte nachdenklich zugehört. »Und … äh, hast du keine Angst? Ich meine, Raubkatzen sind nun mal gefährlich … und sie wissen vermutlich nicht, dass du sie nur retten willst.«
»Na, das muss ich ihnen eben vorher erklären.« Es wunderte mich, dass gerade Ricarda so etwas fragte. Sie ist zwar schüchtern und verträumt, aber sie hat ein Faible für große Tiere. Drachen. Anakondas. Wale. Und Elefanten, weil sie so viel Persönlichkeit haben.
»Vielleicht verstehen die Geparden kein Deutsch«, wandte Sofia ein.
Bevor ich antworten konnte, klingelte es schon zur nächsten Stunde. Physik, Sofias Lieblingsfach; meins ist Biologie und Ricarda freut sich unerklärlicherweise besonders auf Französisch und Kunst.
Am Nachmittag – es war erst vier Uhr, aber schon fast dunkel – jagte ich mit meinem Rennrad erst zur Klavierstunde bei der immer viel zu stark parfümierten Madame Joliet, danach zur Bibliothek. Um mir einen Stapel Bücher über Namibia zu besorgen. Denn bisher wusste ich zu meiner Schande nur ganz grob, wo das in Afrika lag. Sorgfältig in eine Plastiktüte eingepackt, reisten die Bücher zu mir nach Hause, denn es begann schon wieder zu regnen, eine eklige Mischung aus Schnee und Regen, nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ich zog mich in meine Dachkammer zurück, warf mich aufs Bett und schlug das erste Buch auf. Der warme Schein meiner Leselampe fiel auf apricotfarbene Wüste, Sträucher, Antilopen.
In einem halben Jahr ist es so weit, dachte ich ehrfürchtig. Dann füttere ich keine Eichhörnchen mehr, sondern Raubkatzen.
Es fiel mir noch ein wenig schwer, daran zu glauben.
DIE KATZEN VON OTJIWARONGO
Nein, die Geparden verstanden kein Deutsch. Aber dafür Englisch. Und das war gut so, sonst hätte ich sie an meinem ersten Tag auf Ounene eúlu vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommen.
»Come heeeeere, come heeeere«, sang die junge schwarze Helferin, sie hieß Dessie Amathila, wenn ich es richtig verstanden hatte. Ich ließ den Blick gespannt über das gelbbraune Gras schweifen, über die niedrigen, knorrigen Bäume, die hier und da aufragten, über die Pfotenspuren im rötlich braunen Sand auf der anderen Seite des Maschendrahts. Das Gepardengehege, vor dem wir standen, war so groß, dass man den Zaun auf der anderen Seite nicht sehen konnte. Herrlich viel Platz für Katzen, die in Freiheit den ganzen Tag herumstreifen, rastlose Wanderer auf der Suche nach Beute. Aber was, wenn sie sich den ganzen Tag irgendwo auf der anderen Seite des Geheges herumtrieben und wir nicht mal ein Schnurrhaar von ihnen zu Gesicht bekamen? Das kannte ich aus dem Wildpark. Da durfte man ein Waldstück bewundern, in dem sich angeblich Wölfe oder Elche herumtrieben, aber zu sehen waren sie doch nie. Dann witzelte man, dass sie wahrscheinlich Urlaub machten, und ging enttäuscht weiter zu den Kamerunschafen.
Normalerweise war das völlig okay. Aber nicht jetzt. Ich war übermüdet, die afrikanische Sonne schälte mir gerade die Haut von der Nasenspitze, die vollen Futterschüsseln in meinen Händen wurden immer schwerer und ich wollte jetzt sofort einen Geparden sehen. Oder noch besser, gleich mehrere.
Nichts rührte sich im Gehege.
»Macht nichts«, sagte Dessie und grinste, als sie meine enttäuschte Miene sah. »Wahrscheinlich sind sie gerade ziemlich weit weg. Aber wenn wir reingehen, kriegen sie das mit und sind schnell da. Sie wissen, dass wir ihr Fresschen dabeihaben.«
»Äh, Moment mal – wir gehen da rein?«
Jetzt lachte Dessie über das ganze Gesicht. Das war ein toller Anblick. Ihre Haut hatte einen warmen dunklen Braunton und ihre runden Backen glänzten. »Ja, klar gehen wir da rein. Oder willst du die Schüsseln lieber über den Zaun werfen? Davon kriegen sie Dellen.«
»Das wäre mir aber lieber, als irgendwas abgebissen zu kriegen …«
»Ach, keine Sorge. Hock dich im Gehege nur nicht hin und mach keine unerwarteten Bewegungen. Sonst sehen sie dich, wenn du Pech hast, als Beute.«
Dessie entriegelte das erste Tor und winkte mir zu, ihr zu folgen. Eingeschüchtert tappte ich hinter ihr her und klammerte mich an den Blechschüsseln fest. Was wahrscheinlich keine gute Idee war. Vielleicht kamen die Geparden gleich aus dem Nichts angerast und stürzten sich auf ihr Futter und damit gleichzeitig auf mich.
Sorgfältig schloss Dessie das erste Tor wieder und entriegelte dann das zweite Tor.
O mein Gott, wir waren drin.
Es war nicht so, dass mein ganzes Leben wie ein Film vor mir ablief, aber immerhin die letzten Monate, seit meine Eltern mir diesen Gutschein geschenkt hatten. Erst mal war alles so weitergegangen wie gewohnt und das mit Namibia blieb völlig unwirklich, auch wenn ich so vielen Leuten davon erzählte, dass ich schließlich sogar von Unbekannten in Papas Praxis darauf angesprochen wurde.
Dann, auf einmal, waren es nur noch drei Tage bis zum Abflug. Ich packte meinen Koffer, packte ihn gleich wieder aus, um einen größeren zu nehmen, entschied mich doch für eine abgewetzte Reisetasche und stopfte meine Sachen dort hinein. Wuselte hektisch in der Wohnung herum, um Mückenspray und eine Nagelschere und meine Trinkflasche zu suchen. Hatte Albträume, in denen ich mein Flugzeug verpasste, und war am Tag der Abreise ein nervliches Wrack.
Sofia kam mit, als Papa mich zum Flughafen fuhr, und ihr war es offensichtlich nicht ganz geheuer, wie ich mich benahm. »Bist du sicher, dass du nicht schon einen Herzinfarkt hast, bevor du die ersten Raubkatzen siehst?«, fragte sie und legte mir fürsorglich den Arm um die Schultern.
»Ich glaub’s nicht – jetzt habe ich doch tatsächlich den Ersatzakku für meine Kamera vergessen!«, jaulte ich auf.
»Können wir am Flughafen kaufen«, sagte mein Vater und seufzte.
Ich glaube, sie waren alle froh, als ich endlich im Flugzeug saß und auf dem Weg nach Afrika war.
Viele Stunden später gab der Pilot durch, dass wir jetzt über Namibia flogen, und ich beugte mich halb über meinen Sitznachbarn, damit ich mal aus dem Fenster schauen konnte. Und bekam einen Schreck. Das sah richtig schlimm aus! Wie eine Mondlandschaft. Zerfurchtes, karges Land. Die Berge hellbraun, umbrafarben, rötlich braun, ocker, graubraun. Nur hier und da eine Spur von staubigem Graugrün. Man sah, dass die Regenzeit schon eine Weile her war.
Die Landebahn des Flughafens Windhoek war ein schmaler grauer Streifen in einem unendlich weiten, sonnenverbrannten Nichts.
Aufgeregt hastete ich durch das kleine Flughafengebäude und entdeckte gleich meine Abholerin – eine rundliche, gut gelaunte junge Frau, die ein Schild mit Lilly Jonassen hochhielt. Meine erste Begegnung mit Dessie. Sie lotste mich in einen Jeep, auf dessen Seite Cheetah Foundation stand und ein rennender Gepard aufgemalt war, und dann ging es mit quietschenden Reifen los. Erst huschte draußen die Savanne vorbei, danach die Hauptstadt Windhoek und schon waren wir wieder draußen auf einer schnurgeraden, geteerten Straße nach Norden. Dort wartete eine Polizeikontrolle auf uns, aber nach einem kurzen Blick auf unsere Ausweise winkte uns der Uniformierte gelangweilt durch.
»Danke, dass du mich abgeholt hast«, sagte ich zu Dessie, sie verstand und sprach zum Glück richtig gut Englisch. »Wie lange brauchen wir bis Ounene eúlu?«
»Ach, so drei Stunden, schätze ich – es ist in der Nähe von Otjiwarongo«, meinte Dessie und steckte sich eine getrocknete Aprikose und ein paar Cashewnüsse in den Mund. Ich merkte mir gleich, wie der Ort richtig ausgesprochen wurde: »Otschiwarongo« hatte Dessie gesagt.
Sie erzählte mir, dass Ounene eúlu in einer der Ovambo-Sprachen Großer Himmel bedeutete, aber warum die Farm so hieß, hörte ich nur halb mit, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, die Landschaft anzuglotzen. Wir kamen gerade an einem dreieckigen Warnschild vorbei. Es war kein springender Hirsch darauf, sondern ein Warzenschwein. Doch das, was kurz darauf über die Straße lief, war kein Warzenschwein.
»Cool – das sind ja Paviane!«, jubelte ich, kurbelte eiligst das Fenster herunter und steckte den Kopf hinaus. Es war ein ganzer Affenclan, der auf allen vieren über die Straße schlenderte – Männchen mit graubrauner Mähne, Weibchen mit Babys, die sich an ihren Bauch klammerten, übermütig herumgaloppierende Jungtiere.
»Steig besser nicht aus, die beißen«, sagte Dessie und ich nahm die Hand wieder vom Türgriff.
Ja, ich war endlich angekommen. Das hier war Afrika. Als Dessie wieder aufs Gas trat und mich die Beschleunigung in meinen Sitz drückte, hatte ich ein seliges Lächeln auf dem Gesicht.
Es war immer noch da, als wir am späten Nachmittag in Ounene eúlu eintrafen und in einer Staubwolke durch das Eingangstor mit dem Gepardenlogo brausten. Das flache, braun getünchte Hauptgebäude mit dem geschwungenen Dach schmiegte sich in die Buschsavanne, als wäre es eines Nachts aus dem Boden gewachsen. Gewaltig und tiefblau wölbte sich der Himmel Namibias darüber und ich musste nicht weiter fragen, wie die Farm zu ihrem Namen gekommen war.
Ich wuchtete mir meine Reisetasche über die Schulter und taumelte hinter Dessie her, am Hauptgebäude vorbei und immer weiter in den Busch hinein bis zu einer runden Hütte mit einem Solarkollektor auf dem Dach. Es gab zwei Betten mit schwarz-rot-weißen Wolldecken, darüber an der Decke befestigt Moskitonetze. Klo und Waschbecken, das war’s auch schon. Eine Dusche sichtete ich zum Glück auch – draußen unter freiem Himmel, in einer gemauerten Nische.
»Warmes Wasser?«, fragte ich hoffnungsvoll.
Dessie grinste. »Wenn die Sonne scheint, schon. Macht sie hier meistens.«
»Strom?«
»Ja klar. Aber nur bis neun Uhr abends.«
Wir gingen wieder rein. Neugierig beäugte ich das zweite Bett und die Besitztümer in der anderen Ecke des Raumes. Ein kleiner Stapel Tops und Hosen, eine dürre Giraffenstatue aus honigfarbenem Holz, ein Buch über Bestellungen beim Universum und eins mit dem Titel »Sorge dich nicht – lebe!«, ein Notizbuch, das über und über mit Gesichtern beklebt war, alle aus Zeitschriften herausgerissen.
»Wer wohnt hier noch?«, erkundigte ich mich.
»Teresa. Sie ist auch Praktikantin. Aber gleich für ein ganzes Jahr.« Dessie strahlte mich an. »Was ist, magst du die Geparden begrüßen? Du kannst bei der Fütterung mithelfen. Im Gehege West, bei den Weibchen.«
»Sind sie eigentlich zahm?«
»Nein, das kann man nicht sagen. Die Geparden sind alle aus der Wildnis zu uns gekommen, weil sie in Freiheit nicht überleben konnten. Manche sind schon zu alt oder zu krank, um wieder ausgewildert zu werden, andere sind noch zu jung und unerfahren.«
Und jetzt stand ich hier, mitten im Gehege, und fühlte mich ein bisschen überrumpelt von all den neuen Erfahrungen und den vielen Raubkatzen um mich herum. Konnte es wirklich sein, dass Geparden weniger bissig waren als Affen, oder handelte es sich um ein schreckliches Missverständnis?
»Come heeeere, come heeere«, lockte Dessie noch einmal und dann waren sie da. Huschten wie gelbbraune Schatten aus dem Gebüsch. Glitten leichtfüßig über den Sandboden. Lugten aus dem hohen Gras mit ihren bernsteinfarbenen Augen und den schwarzen Tränenspuren auf den Katzengesichtern. Keine zehn Meter von mir entfernt. Weglaufen war sinnlos. Schließlich hatte ich es hier mit dem schnellsten Säugetier der Erde zu tun.
»Na, hab ich’s nicht gesagt?« Zufrieden blickte Dessie sich um. »Die Hübsche da ist Ohani. Neben ihr schleicht sich gerade Njika an. Das da vorne ist Elai. Und die beiden dahinten, die sich nicht aus den Büschen trauen, sind Muina und die kleine Jola. Bisschen schüchtern, unsere Muina.«
Hastig tat ich es Dessie nach und stellte die Blechschüsseln mit dem Fleisch auf den Boden. Dann stand ich so steif da wie eine Playmobilfigur, während eines der Weibchen sehr nah an mir vorbeiging. Elai? Ich glaubte schon. Wie groß und langbeinig sie war. Ich hätte mich nicht mal bücken müssen, um sie zu streicheln. Aber das kam mir in diesem Moment sowieso nicht in den Sinn.
»Wie schaffst du es, sie zu unterscheiden?«, flüsterte ich Dessie zu. »Für mich sehen sie alle gleich aus.« Ich staunte über die perfekt kreisrunden Flecken auf ihrem Fell, bewunderte die sehnigen Vorderläufe, die pelzigen Ohren, die jedem Teddybären Ehre gemacht hätten.
Dessie zuckte die Schultern. »Ach, sie auseinanderzuhalten, ist reine Übung. Die Flecken sind bei jedem unterschiedlich und die Augen und schwarzen Streifen im Gesicht sowieso.«
Wie aufs Stichwort blickte Elai hoch und sah mich forschend an. Ich verliebte mich auf der Stelle in sie, auch wenn ich immer noch ein bisschen Angst vor ihr hatte. Oh, wie herrlich sie war! Gelassen, ohne jede Scheu vor uns Menschen, kauerte die riesige Katze sich hin und begann, ihre Schüssel leer zu fressen.
Muina dagegen war das alles nicht geheuer. Halb geduckt, kroch sie näher, fauchte mich an und zeigte ihre dolchartigen Eckzähne. Befahl mir wahrscheinlich in Gepardisch, mich wegzuscheren, damit sie endlich an ihr Futter herankam. Nichts lieber als das. Langsam machte ich einen Schritt rückwärts, dann noch einen.
»So, während die Katzen abgelenkt sind, machen wir das Gehege ein bisschen sauber«, meinte Dessie und marschierte durch das Gras, begann, mit einer Zange irgendetwas vom Boden aufzuheben und in einen Eimer fallen zu lassen. Vorsichtig folgte ich ihr und sah, was Dessie da einsammelte: große, blank abgenagte Knochen.
»Aha, jetzt weiß ich endlich, was ihr mit den letzten Praktikanten gemacht habt«, unkte ich.
Dessie blickte mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und holte dann eine kleine Schaufel aus ihrer Ausrüstungstasche. »Ja, und du wirst gleich merken, was wir mit den jetzigen Praktikanten machen. Rat mal, wofür das gut ist.«
Ich musste nicht lange raten, weil ich gerade reingetreten war. Und ja, es stank ganz ähnlich wie das, was mein Kater Frodo immer so gründlich im Garten vergraben hatte.
Auf dem Rückweg sah ich meine neue Chefin – allerdings nur aus der Ferne. Sie streifte, ein Stück vom Hauptgebäude entfernt, durch kniehohes Steppengras, an ihrer Seite war ein Gepard, er ging ruhig und frei neben ihr.
»Jamie Edwards und King«, sagte Dessie. »Sie hat ihn mit der Hand aufgezogen, seither sind die beiden ein Herz und eine Seele.«
Ich hätte die beiden gerne kennengelernt, aber schon ging Dessie weiter, wir waren auf dem Weg zum Abendessen. Der Speisesaal war ein einfaches Gebäude mit Strohdach; hinter einer hölzernen Theke dampften die Töpfe, zwei schwarze Köchinnen arbeiteten dort. »Setz dich schon mal, ich muss noch was erledigen und komme gleich nach«, sagte Dessie und tätschelte mir aufmunternd die Schulter.
Ich war schon sehr neugierig auf meine anderen Kollegen. Aber es waren erst zwei da, ein rothaariger junger Mann mit Tausenden von Sommersprossen und eine schmächtige, hübsche Frau.
Die beiden lehnten sich halb über den Tisch und redeten lautstark aufeinander ein.
Na wunderbar. Sollte ich mich jetzt dazusetzen und sie stören oder mir irgendwo alleine einen Platz suchen und ungesellig wirken? Schließlich entschied ich mich für das geringere Übel und stellte meinen Teller neben sie auf den schlichten Holztisch.
»Ihr könnt ruhig weiterstreiten, das stört mich nicht«, meinte ich freundlich. »Aber bitte keine Schusswaffen, okay?«
Niemand lachte. Ups. War wohl doch nicht so witzig gewesen. Verständnislos blickte die junge Frau mich an, meinte dann »Ach, du bist die Neue« und lächelte. »Ich bin Karla. Hier zuständig für Organisatorisches.« Sie reichte mir eine schmale Hand, die sich zerbrechlich anfühlte. Karla hatte ein puppenhaftes, von dunklen Haaren umrahmtes Gesicht mit einer Nase, die man nur als niedlich bezeichnen konnte. Aber wenn ich ihr das gesagt hätte, dann wäre wahrscheinlich eine Faust in meinem Gesicht gelandet. Karla wirkte wie jemand, der sich nichts bieten lässt, von niemandem.
»Wir haben eigentlich gar nicht gestritten«, erwiderte der junge Mann und grinste. »Karla will nur nicht einsehen, dass ich mal wieder recht habe, das ist alles. Ach ja, ich bin übrigens Rob, ich mache mit Jamie zusammen die Forschung hier.«
Karla schnaubte und säbelte an ihrem Steak herum. »Recht? Haha. Aber reden wir ein andermal drüber.«
»Dann habt ihr doch sowieso wieder ein neues Thema.« Ein schlaksiges Mädchen mit langen dunklen Haaren und braunem Teint setzte sich mir gegenüber und stellte ihren Teller ab. Sie hatte sich ein rot-weißes Piratentuch über den Kopf geknotet, und als sie meinen Blick bemerkte, erklärte sie mit einem schüchternen Lächeln: »Gegen die Sonne.«
Aus irgendeinem Grund war sie mir sofort sympathisch und ich hoffte, dass es sich um Teresa handelte, meine Zimmergenossin. Wie sich herausstellte, stimmte das.
Rob hatte sich anscheinend einen Nachschlag geholt, denn er widmete sich einem zweiten vollen Teller. Seiner Figur nach tat er das wahrscheinlich jeden Tag – er war nicht wirklich dick, aber man sah, dass er gegen einen Bierbauch ankämpfte.
»Aus welchem Land kommst du?«, fragte ich Teresa und sie erzählte, dass ihre Familie aus Mexiko stammte, aber schon seit längerer Zeit in den USA lebte. »Und zwar ausgerechnet da, wo es kalt ist!« Teresa zog eine Grimasse. »Dabei brauche ich das. Die Wärme. Die Farben. Ich mag die Wüste unheimlich gern, ich hab mich sofort zu Hause gefühlt hier in Namibia.«
»Oje, hoffentlich geht mir das nicht auch so«, rutschte es mir heraus. »Ich will mich lieber fremd fühlen. Zu Hause war ich lange genug.«
Teresa schwieg und widmete sich ihrem Essen. Ich war nicht sicher, ob ich sie mit meiner blöden Bemerkung gekränkt hatte, aber bevor ich fragen konnte, schob Rob geräuschvoll seinen Stuhl zurück. »Muss noch ein paar Forschungsberichte fertig schreiben.« Er rülpste, sah auf putzige Art verlegen aus und winkte uns zum Abschied zu.
»Wie geht es eigentlich morgen weiter, was soll ich alles mithelfen und so?«, fragte ich Teresa und wurde ganz hibbelig bei dem Gedanken, dass ich morgen wieder mit den Geparden arbeiten würde.
»Auf einer Schiefertafel vor dem Büro steht jeden Morgen, wer wofür eingeteilt ist«, erklärte mir Teresa. »Jamie, unsere Chefin, knobelt das aus – wahrscheinlich nachts, manchmal habe ich das Gefühl, sie schläft gar nicht.«
Wir quatschten in unserer Hütte noch die halbe Nacht lang und ich erfuhr zwar nicht wirklich viel über Teresa, aber dafür eine Menge über Jamie Edwards. Sie war früher Musikerin gewesen, Cellistin genauer gesagt, hatte sich aber beim Skifahren die Hand gebrochen und ihre Karriere aufgeben müssen. Danach hatte sie eine erfolgreiche Eventagentur aufgezogen und viel Geld verdient. Nebenbei hatte sie begonnen, sich für den Umweltschutz zu engagieren. Zehn Jahre später, nach einer Safari in Afrika, hatte sie dann spontan entschieden, sich in Zukunft ganz dem Schutz von Geparden zu widmen, ihren Lieblingstieren.
»Dafür hat sie ganz nebenbei noch ihren Masterabschluss in Wildtierbiologie gemacht, stell dir vor«, sagte Teresa; ihr Gesicht leuchtete.
»Wahnsinn«, meinte ich. »Aber wieso hat sie alles aufgegeben? Einfach so? Steckte sie gerade in der Midlife-Crisis?«
Teresa wirkte überrascht, als hätte sie nie darüber nachgedacht. »Wie meinst du das?«
»Na ja, Männer in mittleren Jahren bekommen oft die Krise, wenn sie ihr Leben genauer unter die Lupe nehmen, meist kaufen sie dann einen Sportwagen oder legen sich eine jüngere Geliebte zu. Bei Frauen sind die Symptome anders, die meisten entdecken sich auf einmal selbst.« Meine Mutter hatte Scharen solcher Patientinnen.
»Hm, kann schon sein.« Teresa zögerte. »Jamie hat mir mal erzählt, dass sie sich damals gerade von ihrem Mann getrennt hatte und in einer schweren Phase steckte. Vielleicht hat sie einen neuen Sinn im Leben gesucht.«
Irgendwann gegen Mitternacht passte in meinen Kopf wirklich gar nichts mehr Neues hinein, nicht mal der Name eines einzelnen Geparden. Ich entschuldigte mich, kroch in mein Bett und war sofort weg.
Als ich am nächsten Morgen wach wurde, blieb ich einen Moment lang liegen und blinzelte in die Dunkelheit. Auf dem Nachbarbett bewegte sich noch nichts, dort lag nur ein Deckenbündel, aus dem oben ein verwuschelter dunkler Haarschopf herauslugte. Ich schlüpfte aus dem Bett, tappte mit einem Handtuch bekleidet zur Dusche und zog erwartungsvoll an der Eisenkette, die das Wasser in Gang setzte. Ein eiskalter Schwall prasselte auf mich herab und ich japste vor Schreck. Mist, ich hatte vergessen, was Dessie mir gesagt hatte. Eins war klar: Ab jetzt war ich schlauer und duschte abends, wenn die Sonne das Wasser angewärmt hatte!
Bibbernd lief ich zurück in die Hütte und zog mich an. Teresa schlief immer noch und so schlich ich mich nach draußen. Es war richtig kalt und ich freute mich über meinen dicken roten Fleecepulli. Der große Himmel über mir war heute mit fedrigen Wolken dekoriert, die von der aufgehenden Sonne rötlich angeleuchtet wurden. Ich hörte das Meckern von Ziegen und sah aus der Ferne zwei schwarze Arbeiter vorübergehen, sonst schien noch niemand unterwegs zu sein. Ein leichter Geruch nach Holzrauch hing in der klaren Luft.
Meine Neugier war stärker als der Hunger. Noch vor dem Frühstück pilgerte ich zum Hauptgebäude, um einen Blick auf die Tafel mit den täglichen Aufgaben zu werfen. Schräg darüber hatte eine Kolonie Webervögel in einem Baum ihr Nest gebaut. Es hing wie ein hellbrauner, unregelmäßig geformter Kokon zwischen den Ästen und Dutzende von Vögeln schwirrten durch die Einfluglöcher ein und aus. Ihr Zwitschern hörte man von Weitem.
Im Büro dagegen war es noch ruhig. Still und dunkel kauerten die Computer auf den Schreibtischen. Aber die Chefin war schon hier gewesen, auf der Tafel stand das Datum von heute und in bunter Kreide hinter jedem Namen eine Notiz.
LILLY
9 UHR ANATOLIANS VERSORGEN
14 UHR FÜTTERUNG GEHEGE OST (JEEP)
16 UHR BÜROHILFE
verkündete der Plan.
Aber es kam dann doch ganz anders.
RETTER VOM DIENST
Ich hatte keine Ahnung, wer oder was Anatolians waren. Klang wie der Name einer türkischen Rockband. Kurz nach neun Uhr war ich schlauer und hatte erfahren, dass es sich um eine Rasse großer hellbrauner Hunde handelte. Irgendwann mal aus der Türkei importiert, wo ihr Job darin bestand, Herden zu hüten. Sie lebten mit den Geparden hier auf der Farm und vermehrten sich fleißig. Das stellte genau ihre Aufgabe dar. Denn ihr Nachwuchs wurde dringend gebraucht, um Ziegen- und Schafherden vor wilden Geparden zu schützen.
»Das ist enorm wichtig«, informierte mich Dessie. »Jeder Gepard, der sich an einer Herde vergreift, ist ein Gepard, der bald von einem Farmer abgeknallt wird.«
»So schlimm?« Ich tätschelte eine Hundemama, deren Nachwuchs gerade auf Entdeckungsreise im Stroh herumkugelte. Mir wurde langsam klar, warum mein Witz mit den Schusswaffen gestern nicht richtig gezündet hatte. Anscheinend hatte hier wirklich jeder eine Knarre.
Weit weg im Büro klingelte ein Telefon. Kurz darauf hörte ich Schritte, die eilig näher kamen. Der Anatolian hob wachsam den Kopf und ich drehte mich um.
»Dessie, hast du Zeit, bei einer Rettung mitzumachen?« Jemand lugte in die Box. Eine drahtige blonde Frau mit einem klaren, fast scharf geschnittenen Gesicht. Ich ahnte sofort, dass ich es mit Jamie Edwards zu tun hatte, meiner Chefin für die nächsten Wochen. Sie sah mich an, lächelte mir zu und vergaß mich wahrscheinlich im selben Moment wieder.
Dessie zögerte. »In eineinhalb Stunden muss ich in der Elementary School sein … nee, das schaffe ich nicht. Aber wie wär’s mit unserer Neuen aus Deutschland?«
Strahlend blaue Augen richteten sich auf mich, blickten mich zum ersten Mal richtig an.
»Okay«, sagte Jamie Edwards und dann ging alles ganz schnell. Bevor ich zum Nachdenken kam, saß ich auf dem Rücksitz eines Jeep Wrangler und war unterwegs. Teresa war im letzten Moment auch noch eingestiegen.
Es war brüllend heiß im Auto, weil die Klimaanlage nicht funktionierte, und es roch nach Benzin. Ein bisschen eingeschüchtert saß ich da und staunte die Ausrüstung im Laderaum hinter mir an. Hoffentlich wurde mir nicht schlecht, es musste nicht sein, dass ich gleich an meinem ersten Arbeitstag den Dienstwagen vollkotzte. War der Sitz vielleicht deswegen so klebrig, weil das schon mal jemand vor mir getan hatte? Nein, es schien eher ein Marmeladenfleck zu sein.
»Äh, wo genau fahren wir eigentlich hin?«, fragte ich Rob, der am Steuer saß und mit zusammengekniffenen Augen über die Schotterstraße hinwegspähte. »Wen retten wir?«
»Angeblich hält jemand zwei junge Geparden unter miesen Bedingungen auf seiner Farm«, meinte Rob und wischte sich mit einem karierten Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Aber derjenige, der es uns gemeldet hat, hat sie nicht selbst gesehen. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht ist es in Wirklichkeit ein altersschwacher Leopard.«
»Kann man die denn mit einem Geparden verwechseln?«
»Na ja, beide haben eine ähnliche Farbe und Flecken«, meinte Teresa, »aber Geparden sind schlanker, nicht so schwer und kräftig wie Leoparden.«
Rob nickte, nahm eine Hand vom Steuer und begann, Sonnenmilch auf seiner hellen Haut zu verteilen. Mit Lichtschutzfaktor fünfzig!
Nach zwei Stunden hatten wir die Farm erreicht. Meine verschwitzten Beine waren auf dem Kunstleder des Sitzes festgepappt und es gab ein schmatzendes Geräusch, als ich sie hochzog. Die Luft draußen war nur etwa fünfundzwanzig Grad warm, aber die Sonne knallte grell und gnadenlos auf mich herab. Aus dem Norden, weil wir uns jetzt auf der Südhalbkugel befanden. Früher hatte ich mich immer gefragt, warum die Leute hier nicht einfach vom Erdball herunterfielen. Jetzt wusste ich es. Sie klebten sich mit Schweiß und Marmelade fest.
Still lagen die heruntergekommenen Ziegelgebäude der Farm vor uns, ein halbes Dutzend graugrüne Bäume wuchsen um sie herum. Irgendwo in der Ferne hörte ich das Meckern von Ziegen und das Klingeln von Glöckchen. Ein Hund bellte. Es klang gelangweilt, nicht sehr aufgeregt. Anscheinend gab es hier keinen Wachhund, der sich für Besucher – ob gebetene oder ungebetene – zuständig fühlte.
»Hallo! Jemand da?«, brüllte Rob in die Stille.
Eine Fliege summte mir um das Ohr, dann waren es auf einmal zwei, dann drei Fliegen. Hm, seltsam. Ich wandte den Kopf, versuchte herauszufinden, wo sie herkamen – und sah etwas Schreckliches. Einen Drahtkäfig mit einem dunklen Etwas darin, das sich nicht bewegte.
»O nein!«, sagte ich und Rob und Teresa folgten meinem Blick.
Gleichzeitig stürzten wir zu dem winzigen Käfig hin. Darin lagen apathisch zwei junge Geparden, ihr flaumiges beigesilbriges Fell war verfilzt und dreckig. Zwar stand eine Blechschüssel in ihrem Minigehege, aber sie war leer. Es stank nach Kot und verwesendem Fleisch.
»Die haben bestimmt schrecklichen Durst!« Teresa kniete sich neben den Käfig.
Ich hockte mich ebenfalls hin und versuchte, Einzelheiten zu erkennen. »Müssen Geparden auch täglich trinken? Ich dachte, weil sie Wüstentiere sind …«
»Sie brauchen trotzdem Wasser. Gerade wenn sie noch so jung sind wie die beiden Weibchen hier, die sind höchstens drei Monate alt.« Rob nahm seine Trinkflasche, goss sich etwas Wasser in die Hand und zwängte sie durch das Gitter. Eines der Weibchen quälte sich auf die Füße, kam schwankend heran und begann, das Wasser gierig aufzuschlecken. Die Schwester war nicht so mutig und wich leise fauchend in die entfernte Ecke des Käfigs zurück.
»Sieh an, Besuch! Was führt Sie hierher?«
Ich sah einen in staubige Kakisachen gekleideten Mann auf mich zukommen, klobige Schnürstiefel an den Füßen und eine Schaufel in der Hand. Mit seinem dichten braunen Haar im Bürstenschnitt und seiner massigen Figur sah er aus wie ein Bär.
Teresa hatte ein nervöses Lächeln aufgesetzt, aber Rob wirkte zum Glück nicht im Geringsten unsicher. »Hallo, Mr de Niekerk«, sagte er freundlich. »Wir sind von der Cheetah Foundation. Jemand hat uns gemeldet, dass Sie hier Geparden halten.«
»Ja, ich hab ihre Mutter in der Nähe meiner Herde gesehen und bin lieber kein Risiko eingegangen.«
»Das heißt, Sie haben sie geschossen?«
»Genau, genau. Meine Hunde haben dann die Jungen in der Nähe aufgespürt. Tja, meine Frau war dafür, sie zu behalten.« Mit einem schiefen Lächeln zuckte de Niekerk die Schultern.
Mir war elend zumute. Es war nicht mal nötig, dass die Geparden eine Ziege rissen … sie brauchten sie nur schief anzusehen! Das reichte für ein Todesurteil.
Rob ließ sich nicht anmerken, was er dachte. »Wenn so was noch einmal passiert, rufen Sie uns am besten gleich an, wir fangen das Tier ein und Sie sind es los. Aber jetzt sind wir erst einmal da, um die Jungen abzuholen.«
»Jungen? Wer? Ach, meine Geparden?« Der Mann wirkte verdutzt, aber nicht feindselig. »Abholen? Wieso denn das? Es geht ihnen doch gut hier.«
Das verschlug uns allen erst mal die Sprache. Konnte es sein, dass er das ernst meinte?