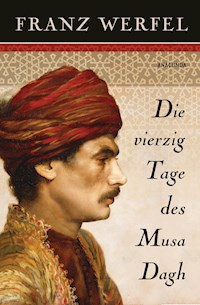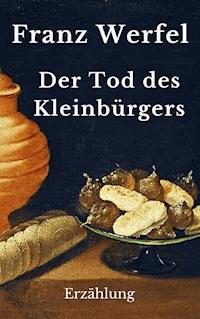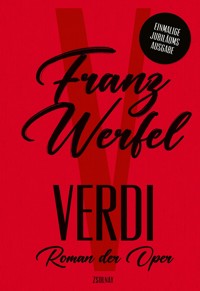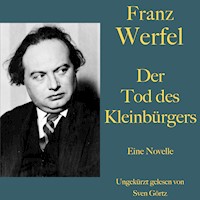Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 'Gesammelte Gedichte' präsentiert der renommierte Autor Franz Werfel eine umfangreiche Sammlung von über 200 Gedichten, die sein literarisches Talent und seine Vielseitigkeit zeigen. Werfels Gedichte spiegeln sein tiefes Verständnis für menschliche Emotionen und Lebenserfahrungen wider, während er gleichzeitig mit einer präzisen und poetischen Sprache spielt. Sein literarischer Stil zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus Lyrik, Romantik und Realismus aus, die die Leser fesselt und inspiriert. Diese Sammlung gibt Einblick in Werfels künstlerisches Schaffen und seinen bemerkenswerten Beitrag zur deutschsprachigen Poesie des 20. Jahrhunderts. Franz Werfel, ein bedeutender österreichischer Schriftsteller und Dichter, hat mit seinen Werken eine dauerhafte Wirkung in der Literaturgeschichte hinterlassen. Sein tiefes Verständnis für die menschliche Natur und seine Fähigkeit, komplexe Emotionen in Worte zu fassen, machen ihn zu einem unvergesslichen Poeten. 'Gesammelte Gedichte' ist ein Meisterwerk, das sowohl Liebhaber der Poesie als auch Kenner der deutschen Literatur begeistern wird. Die Vielfalt und Tiefe seiner Gedichte machen dieses Buch zu einem zeitlosen Klassiker, der die Leser dazu ermutigt, über die Grenzen der Sprache hinauszudenken und die Schönheit der Poesie zu erkunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Gedichte
Inhaltsverzeichnis
Der Gerichtstag
Der Mensch ist so groß, daß seine Größe sogar darin sich zeigt, daß er sich als elend erkennt. Es ist wahr, sich als elend erkennen, heißt elend sein; aber es heißt ebensogut groß sein, wenn man sich als elend erkennt. So beweist all dieses Elend des Menschen Größe.
Pascal
Erstes Buch Die Geburt der Schatten
Ballade von Wahn und Tod
Im großen Raum des Tags, – Die Stadt ging hohl, Novembermeer, und schallte schwer Wie Sinai schallt. Vom Turm geballt Die Wolke fiel. – Erstickten Schlags Mein Ohr die Stunde traf, Als ich gebeugt saß über mich zu sehr. Und ich entfiel mir, rollte hin, und schwankte da auf einem Schlaf.
Wie deut ich diesen Schlaf, – Wie noch kein Schlaf mich je trat an, da ich verrann In Dunkelheit, als mich eine Zeit In mein Herz traf!? Und als ich kam empor, In Traum auftauchend Atemgang begann, Trat ich in mein vergangnes Haus, in schwarzen Flur durchs winterliche Tor.
Nun höret, Freunde, es! Als ich im schwarzen Tage stand, schlug mich eine leichte Hand. Ich stand gebannt an kalter Wand. Oh schwarzes, schreckliches Gedenken, da ich ihn nicht fand, Den Leichten, der mich so ging an, Und mich im schwarzen Tag des Tors geschlagen leicht mit seiner leichten Hand!
Es fügte sich kein Schein, Und selbst das kleine schnelle Licht, das sich in falsche Rosen flicht, Und unterm Bild verschwimmt und schwillt, Das kleine Licht ging ein. Es trat kein schwarzer Engel vor, Kein Schatten trat, kein Atem trat aus dem kalten Stein! Doch hinter mir in meinem Traum, aufschluchzend kaum versank das Tor.
Und auch kein Wort erscholl. Doch ganz mit meiner Stimme rief ein Wort in meinem Orkus tief. Und wie am Eichen-Ort ein Blatt war ich verdorrt. Weh! Trocken, leicht und toll Fiel ich an mir herab und fuhr in Herbst und großem Stoß. Mich nahm ein Wort und Wind mit fort, Das Wort, das durch mich stieß, das Wort mit dreien Silben hieß, das Wort hieß: rettungslos!
Oh letzte Angst und Schmerz! Oh Traum vom Flur, oh Traum vom Haus, aus dem die Frau mich führte aus! Oh Bett, im Dunkel aufgestellt, auf dem sie mich entließ zur Welt! Ich stand in schwarzem Erz, Und hielt mein Herz und konnte nicht schrein, Und sang ein – Rette mich – in mich ein. Der Raum von Stein baute mich ein. Ich hörte schallen den Fluß und fallen, den Fluß: Allein.
Und da es war also, Tat sich mir kund mein letztes Los, und ich stieg auf aus allem Schoß. Im schwarzen Traum vom Flur zerriß und klang die Schnur. Und ich erkannte so, Warum da leicht und fein die Hand mich schlug, Die schwach an meine Stirne fuhr, Und meinen Gang geheim bezwang, daß ich nicht wankte mehr und kaum mich selber trug.
Und als ich ihn erkannt, Den Augenblick, der mich trat an, da war ich selbst der andre Mann, Und der mir hart gebot, ich selber war mein Tod. Und nahm mir alles unverwandt, Und wand es fort aus meiner Hand und hielt's gepackt: – Genuß und Liebe, Macht und Ruhm und jammernd die Dichtkunst zuletzt. Und stand entsetzt und ausgefetzt und ohne Wahn und aufgetan und völlig nackt.
Oh Tod, oh Tod, ich sah Zum erstenmal mich wahrhaft sein, mich ohne Willen, Wunsch und Schein, Wie Trinker nächtlich spät sich gegenüber steht. – – Er lacht und bleibt sich fern und nah – – Ich stand erstarrt in erster Gegen-Wart, allein, zu zwein. (Ach, was wir sagen, lügt schon, weil es spricht.) Ich fand mich, ohne Wahn mich sein, und starb in mein Erwachen ein.
Im großen Raum des Tags Hob ich mein Haupt auf aus dem Traum und sah auf meinen Fensterbaum. Die Stadt ging hohl, Novembermeer, und schallte schwer, Der Himmel glühte noch kaum. Ich aber ging hinab mit großem Haupt und Hut, Und ging durch Straßen, rötliches Gebirg und Paß ... Mein Haupt vom Traum umlaubt noch. Ging mit dumpfem Blut.
Ich ging, wie Tote gehn, Ein abgeschiedner Geist, verwaist und ungesehn.
Ballade von einer Schuld
Am Rande Oktoberwalds, – Der Morgen, alternder Schlaf, Verfallen seufzte herbei. Nachttiere wischten, eins, zwei. Specht war noch nicht da. Weiß schwang sich die Straße vorbei, Ich fuhr mit der Straße vorbei. Baum rührte mich an wie ein Ahn, Verwelkender Abraham Aus Blättern sang greise: Es sei! Im Kreuz hing mir ein schwer Blei. Mich führte ein Bann ohne Schritt. Da fuhr aus dem Waldort ein Schrei, Und zweimal und dreimal ein Schrei, Ich weiß nicht, wer da Tod litt. Es war eines Kindes Schrei, Der mich entzweiriß, zerschnitt. Es war von viel Männern Schrei, Schrei war wie von Weibern mit. Wie der Haufe, den Hufschlag zertritt, Schreit, war da ein Schrei, Wie flehenden Volkes Schrei, Und doch nur wie Kindes Schrei, Das den Tod von Würgern erlitt. Daß Gott mir verzeih, Mich führte die Straße mit. Ich lief nicht, ich half nicht herbei! Schnell machten die Winde es quitt. Ich sagte: Du träumst nur vorbei, Auf dieser Straße vorbei. Es war nur ein Schreck und kein Schrei, Und der Tag ist da, eins, zwei, – Die Schleier schleifen schon mit. Die Felder voll leichten Geschneis, – Das Zwielicht schneit leicht ohne Schrei, Die Felder weiß schweifen herbei. Ich sagte: Du wachst dich schon frei.
Ballade von Nachtwandel
Nachtwandelnder Gesang, Gesang von Wandel und Nacht! Gesang aus Blindheit! Sang nicht mein und dein! Gesang im Rollen, Gesang im Altertum der Nacht! Wir gleiten über Schollen Mit Flügelfüßen, Schritten ungefühlt und überwacht. Wie unser Wandel sich hebt, wie unser Schritt sich lebt, ist von Gewicht Das Obere behängt, die Brust bedrängt, der Atem überfrachtet Von Last, die wie schlafendes Kind um uns sich flicht. Von Last, die wir einst als für nichts erachtet.
Was ist, daß wir wandeln mit allzu großem Haupt, Doch leichten Fußes vor uns das Unbekannte tragen? Von fern, den wir nicht sehn, ein Baum naht halbentlaubt, Uns groß mit Hundeblick, nur daß er sei, zu sagen. Was ist, das nun von oben eingeflößt – – Nacht, die hinsingt, und ein Gesang, der nachtet – Ertönt, und schwerer sich von unseren Lippen löst Gesang, den wir einst als für nichts erachtet.
Warum, ist dieser Nacht Erde wie Traum und Rauch, Daß wir wie Geister was uns unten hält nicht fühlen? Wir sind so leicht und schwer, wenn große Blum' und Strauch Vorbei geschlossenen Augs in unser Wehen kühlen. Leicht hinter uns fällt Rohr und Lattich zu Wie Totes, das sich zu verbergen trachtet, Die Nachtwelt leer erweht von leerem Du, Vom Du, das wir so sehr für nichts erachtet.
Und doch, warum die Last auf uns, Last wie von Mord, Als hätten altes Urteil wir längst vergessen. Wir wollen uns erinnern, doch der Ort, Ort aller Nacht versagt, was wir besessen. Verließ ich eine Frau, die starr nach mir ergraut, Verriet den Freund, der in Katorgen schmachtet? Durch Leere und Raum uns kein Gedenken taut Nach dem, was wir zu sehr für nichts erachtet.
Nachtwandle Ballade den Gang, Sang deine Bahn! Ich weiß nicht, wer du bist und ob ich dich hinsagte. Bist du, bin ich wie Totenreich ein Wahn, Der in der Nacht durch Kraut und Strauche klagte?
Ballade von zwei Türen
Ich ruhe in einer Pagode von Traum. Meine Feinde schleichen am Waldsaum. Sie sind wie von Nebel, gespitzt und schief. Ich schlief mich in Weihrauch tief. Meine Hand rührt sich ein Jahrtausend nicht, Ich fühl keinen Leib, nur ein dunkles Licht. Mein Gesicht ist von blinder Schau versteint, Fern stößt in sein Horn ein reitender Feind. Ich hebe mein Bein nicht aus dem Moor, Eine Glockenblume kitzelt und streift Wie der Kuß eines Kindes mein rauschendes Ohr. Ein Glockenwind in meine Krone greift. Es atmet in mir ein Schallen lang, Und Gesang ist mein Starren, mein Starren Gesang.
Ich ruhe in einer Pagode von Traum. Tiefsinnige Flecken durchflicken den Raum. Zwei Türen sehe ich offen stehn, Den rechten Himmel zerschwärzen Krähn, Den linken goldrote Störche verwehn. Die eine Türe heißt: Lügnerin, Die andere Türe heißt: Wahnsinn. Ich ruhe inmitten und rühre mich nicht.
Kleine Ballade an die Schwester
Liebe Schwester, liefen wir durch große Wiesen? Ist es wahr, daß wir den Löwenzahn Selbst versonnen in die Sonne bliesen? Lachten wir uns unter Reisig an? Knirscht im Park noch immerdar der Kies? War einmal ein Leierkastenmann, der Pan Radecky hieß? Wuchsen einst vor unsern ganz zerschlafenen Blicken Leise Gletscherberge auf wie weiße weite Blechmusiken?
Saßen wir an sonnentollen Tischen Mit dem Lachen großer Gliederfraun? Kruzifixe schreckten uns in Lampennischen, Tief aus unserm Traum trat der Fluß Traun. Standen wir, zwei Seelchen, an den Seen? Sahen Liebe ahnend wir den Rauch der kleinen Dampfer wehn? Lebten wir ins Klingeln einer Heimfahrt urverloren? Aßen wir am Abend unter Hirschgeweih bei den Drei Mohren?
Ach, warum, wenn Bäume mich mit Schmerzenslaub berühren, Eine Fichte mich durchraucht mit lang verwirktem Dunst, Müssen böse Hände meine Kehle schnüren, Geister häufen falschen Schrei und Worte zwischen uns? Und ich weiß nicht, wer ich war und wer ich bin!
Gesang der Memnons-Säule
Oh Zeitlichkeit, Die wiederkehrt zu zeitlicher Stunde! Oh sagenhafte Höhlung, von alter, Erfüllt von Urverwirrung noch! Noch ist der Atem Im unbestechlichen Horn, Noch steht der Tonstrahl, Sehne des Bogens, Unabgelöset, unverrückt dahin. Nun aber, Ah! Nun aber Rollt schon der Donner den Himmel aus. Die Dämmerung, leise Lawine, dahin im Kreis ... Oh Zeitigkeit, Die den Bogen erweckt! Ernst ist der Rand und streng. Die Höhe grünt wie Knabentum, Doch in der Kuppel Schon stehn die Adler golden. Die jammernde Wüste wirft sich, Das Böse seufzt. Denn was sich wachend selbst liebt, Haßt sich im Morgenschlaf. Nun aber, Ah, nun aber Nun aber ist es da mit einemmal. Und wie es mich anhaucht Mit rötlichem Wind, Und ansteckt mit mildem Phosphor, Mich verläßt, Und anschüttet immer mehr! Wie es fährt über meinen Knauf Mit hauchendem Gefieder, Und wie es taucht um meinen Fuß Mit kühlen, vielen Mädchen ... Jetzt aber, Jetzt stampft es auf, Unhörbar, stolz und neu, Mit unverbrauchten Feuern!
Oh Hoffnung, Daß wir nicht umsonst sind, Oh Reinheit, Oh Vergebung, Morgendlich entzündend dich und mich! Oh Morgen, Morgen, Brüder, Oh täglich neu tauendes Haupt! Oh täglich neu erschaffener Mensch!
Ich aber verfalle vor Gesang. Denn mich tötet die Stimme in mir. Leicht hat ein Singen der nichtige Stoff. Wer aber Stein ist und dauernd, Den erwürgt der Sang, Den zertrümmert das Lied. Doch wenig ist und klein die Stimme innen, Und alles ist die Erweckung, Die Göttin Geschüttet über mich hin.
Säule bin ich Im Mittag, Schattenwerfend, stumm.
Novembergesang
Das ist November. Jahrzeit der Mühlen, Wind der schwarzen Frühmessen, Friedhof, Und Tausendnächtlichkeit Der kindischen Lichtlein Und ihre Angst. Nun sind die Stapfen schwer Im Straßensumpf. O, wie wir atmen, Wir armen Tiere! Aber es errötet schon Unser Ofenrost, Wenn draußen das zweifelnd freie, Verhöhnende Rabenvolk Fährt über den Tod der Gottsbäume, Über Schollen und schlotterndes Moor.
Nun sagt November: Das ist eure Welt! – Und schnaubt in den Rauch Des schnaufenden Gauls, Und schnaubt in den Qualm Der qualvollen Erd'. Nun tragen wir Geheimnisvollen Strohkranz Und Distelschmuck. Nun vergessen wir euch, Ihr Freunde, lieben Freunde, Da unser Atem pilgert Durch keuchenden Acheron. Nebel zwischen Bergen und Wäldern, Nebel Zwischen unseren Häuptern, Freunde! Vergessen unser Blick, Und daß wir uns anrührten, Und lachten bei den Wahrsagern, Und tanzten unterm Kronenlicht, Und abwärts stürzten Im Abendprunk die Triumphfahrt! Verloren die Lüge unserer Lust. Da wir doch lügen mußten!
Es schärft sich der Tag. Und streng wird die Nacht. Arm sind wir und ohne Brot. Niemand holt uns Wasser vom Brunnen. In unserer innerlichen Stadt Schon wächst das Spital. Und die Irren Keifen im kreischenden Garten. Der Gott des alten Stroms Benagt die Selbstmörder, Wenn alle Dome brummen. Doch die Dämonen, Unsere unausweichlichen Schutzengel, Schutzteufel, Würfeln über den Häusern,
Dezembergesang
Dezember ist braun. Frost rostet die Felder. Umstarrt sind die Stangen, Die Bäume umbaut. Die Menschen gehn Hinter trübem Kristall. In sich verstorben Besteigen sie flirrend die Hügel, Jeder nach innen gerichteter Tod.
Tod aber ist Leben der Seele. Wir klirren an unsere Grenze. – Dies ist ein Geheimnis der Gemeinschaft.
Sturm, Nordöstlicher Khan Reißt den Kranz vom Wegkreuz, Kreischt: Stirb, stirb! Aber ein weißes Wiesel Zückt über den Hang, Letzte Freundlichkeit, Das Lächeln eines vereisten Fakirs Zu Häupten des schlafenden Kindes.
Weg, Baum, Haus, Kreuz, Geschlossener Füße Einwärts schaukelnd Chinesenschritt Rennen, rennen Immer schneller In Nacht, in Nacht. Wie ein keuchender, dampfender Strom Will alles zur Nacht. Denn dort ist noch Heimat Und dort sind noch Feuer.
Dezember macht Fremdlinge Mit weißen Bartspitzen.
Ich aber, Fremdling, Ich aber weiß ein Feuer In Urheimat, In von allen Seiten schief Anwachsendem Tempel. Über offener Kuppel steht Niemals nachtendes, Niemals tagendes Blau. Aus scheinenden Brunnen Gleichmäßig wachsen die weißen Zacken, Biegen und bäumen sich leicht. Die Priesterin aber, Jetzt hebt sie langsam
Fragment der Eurydike
Wie gut, daß ich von deinen Fersen ließ, Und wieder durch den Schlaf der Tale fließ. Nun bin ich an den alten Bach gebannt, Ich kleine Flamme, wandelnd im Gewand. Und weil ich von den hellen Kernen aß, Neigt mich der leichte Wind auf Schilf und Gras. O weise Müdigkeit, o Müdigkeit, die weiß, – Wie weise weh ich durch den Schlafenskreis. Nicht kann ich, Freund, dich halten an der Hand, Da wachend du verkennst, was schlafend ich erkannt. Und die mit fernem Lächeln dir entglitt, Merk auf, sie weiß von Tor und Weg und Schritt. Und die in tiefster Wolkenfremde geht, Das Heimische ihr ziemt, daß sie's versteht: Was sich im Licht begegnet fremd und groß, Hier ist es nah und wie aus meinem Schoß.
Der Ruf
So stand sie schon vor dem großen Nachmittagstor Und hielt mit ihrer Hand den Durchblick zu. Ihr Kleid sang westlich im tiefen Wind. Dort aber war der Tag, Wo Munde abwärts ernster werden, Und Hände hart, die nicht mehr streichelnden. Des Auges Wille geht dort nicht mehr aus vor Herz. Nicht rast das Antlitz mehr dort, Die süße Fläche ebbet, weh, flieht in sich. Der Schritt verwaltet keinen Tanz mehr dort. Schritt schreitet Arbeit, Arbeit dort und Verlust.
Ihr Fuß stand auf dem Schwellenstein. Doch ihre Hand vor ausblickendem Aug. Das Haar im Westwind leicht ... Ich rief sie an.
Doch wie sie sich wandte, Wie sie horchte nach dem Rufenden hin, Hob in den Lüften um sie ein Kampf an. Die ernsten Dämonen des Ausgangs taten sich in Wind, Rafften mahnend vorwärts Kleid ihr und Haar. Aber die jauchzenden Götter des Aufgangs Warfen sich in die Saiten der Sonne, Töneten, sangen die Leichte zurück.
Da aber wankte ihr Antlitz unter den Schatten, Und sie sah mich stehn im rollenden Tag, Sah mich unter den brüllenden Festen: Ruhm, Mittag, Lüge, Gesang und Blauheit!
Verlust
Dich noch verlieren, Der ich dich schon verlor in mancher Mitternacht! Dich noch verlieren, Der ich dich scheiden sah so oft im frühen Fünf-Uhr-Licht! Ich liebte dich, Also starbst du mir stündlich. Ich bin vertraut mit dem Schreck meines Erschreckens, Vertraut mit meinem Wanken im Traum. Noch glänzest du über den Weg dahin, Ich aber sah dich sinken schon zur Seite. Noch dämmst du wandelnd den Sommer mit deinem Sommer, Ich aber saß schon an deiner Stätte. Noch lachst du die Treppe hinab, Ich aber füllte schon die öde Lampe auf. Noch bist du da, noch schiedest du nicht ab, noch atmest du das liebe Zugeteilte, Ich aber verlor dich oft in strengen Frühen, ich kenne mein Witwertum.
Vergessen
An dieses Flusses Walten wachend, Hinüberruhend Nach des Eilands, nach des Schilfes nördlichem Drang, Habe ich dein vergessen. Vergaß dein Antlitz, Deiner Züge Niederwehn In die offenen harten armen Hände. Vergessen hab ich deinen Schmerz in diesem Abend ... Niedrige Möwen schnellen über Wirbel hin.
An eine Lerche
Heil Dir, zarter Lied-Geist, Vogel warst Du nie!
Shelley
Du heiliges Zittern unter dem toten Oben! Du geistiges Schwirren über dem tödlichen Unten! Du immer fruchtbare, fruchtbare Seele! Oh Hoffnung, nicht unser, Inmitten dieses tränenlosen Abgrunds! Wir heben die harten Füße Zu Trommel und Sträflingsmarsch. Trompete, Peitsche im offenen Fleisch, Ätzt uns und reißt uns voran.
Doch dich fühlen wir Überm Sklavennacken, Dich Wärme klein, Dich Gottesflämmlein Lieds.
Oh du Leben, einfältiger Punkt, Du bist nicht unser! Denn wir lügen, Wir brüllen und stieren, Stößt uns der Wächter zur Suppe. Viel fürchten wir Unsern Herrscher, den Hieb. – Und so nicht sind wir, was wir sind.
Trinklied
Wir sind wie Trinker, Gelassen über unsern Mord gebeugt. In schattiger Ausflucht Wanken wir dämmernd. Welch ein Geheimnis da? Was klopft von unten da? Nichts, kein Geheimnis da, Nichts da klopft an.
Laß du uns leben! Daß wir uns stärken an letzter Eitelkeit, Die gut trunken macht und dumpf! Laß uns die gute Lüge, Die wohlernährende Heimat! Woher wir leben? Wir wissen's nicht ... Doch reden wir hinüber, herüber Zufälliges Zungenwort.
Wir wollen nicht die Arme sehn, Die nachts aus schwarzem Flusse stehn.
Ist tiefer Wald in uns, Glockenturm über Wipfeln? Hinweg, hinweg! Wir leben hin und her. Reich du voll schwarzen Schlafes uns den Krug! Laß du uns leben nur, Und trinken laß uns, trinken!
Doch wenn ihr wachtet! Wenn ich wachte über meinem Mord! Wie flöhen die Füße mir! Unter den Ulmen hier wär ich nicht. An keiner Stätte wäre ich. Die Bäume bräunten sich, Wie Henker stünden die Felsen! In jedes Feuer würf ich mich, Schmerzlicher zu zerglühn!
Trinker sind wir über unserem Mord. Wort deckt uns warm zu. Dämmerung und in die Lampe Sehn!
Der Gerichtsherr
Es schritten aus die Schöffen Und hielten vor dem Sitz. Es verbeugten sich die Alten Vor dem nickenden Kaiser. Das aber war der Herr von Huai-Nan, Der vielweinende Kaiser, Liu-Han der Fürst.
So brachten sie nun, Es brachten die Alten Die großen Insignien: Das Buch und die Tafel, Den Pinsel und Griffel, Das Beil und die Peitsche, Die Pfanne der wartenden Flamme.
Fallen aber ließ Liu-Han Das Buch und die Tafel, Den Pinsel und Griffel, Das Beil und die Peitsche, Die Pfanne aus langsamer Hand. Nicht trennte der Kaiser Die weilende Lippe Vom vorwärts erstarrten Auge, Nicht den schon singenden Mund Vom vorwärts gefrorenen Blick: Ich kenne das Schicksal des Schlafes, Nachtatem, Schlafodem, Atem der Menschen In den Asylen, In den Kasernen, Gesänge des Atems In den Spitälern, Schicksal der Schlafe Unter dem wimmernden Licht. Atemgesänge Hochtönend, tieftönend, Die Welle der Knaben, Den Absturz der Alten, Schlafantlitz, Nachtantlitz, Den kindischen Mund Des träumenden Mörders, Des Steuerpächters Verdorbene Lippen ... Ich kenne den Atem Der wehenden Hallen, In den Asylen, In den Kasernen Das Schicksal des Schlafs.
Ich kenne das Welken der Sünd'rin, Das Welken vor meinen Schranken. Immer stürzen die Wangen, die jungen, guten. Nacht sammelt sich unter dem Aug, Die Haare beginnen zu dämmern. Ich kenne die Stunde der Sünd'rin, der jungen, guten. Nicht wird sie mehr verwüstet von ihrem Liebsten.
Ich kenne den Triumph des Gehenkten. Wie höflich wankt er im Winde!