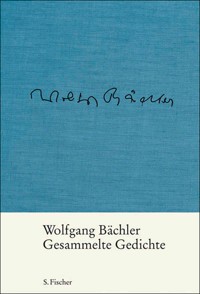
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Er war das jüngste Gründungsmitglied der Gruppe 47, hochgelobt von Dichtern wie Thomas Mann, Gottfried Benn und Heinrich Böll. Er schrieb Liebesgedichte, in denen die Liebe nicht benannt wird, und die vorsichtigsten und zerbrechlichsten Verse der deutschen Nachkriegsliteratur. Zeit seines Lebens blieb er ein Autor für Kenner und Eingeweihte, ein immer im Verschwinden begriffener Riese. Sein lyrisches Werk wuchs in die Tiefe statt in die Breite und liegt nun – ergänzt um bisher unveröffentlichte Gedichte und ein Nachwort von Albert von Schirnding – mit diesem Band erstmals gesammelt vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wolfgang Bächler
Gesammelte Gedichte
Mit einem Nachwort von Albert von Schirnding
Über dieses Buch
Er war das jüngste Gründungsmitglied der Gruppe 47, hochgelobt von Dichtern wie Thomas Mann, Gottfried Benn und Heinrich Böll. Er schrieb Liebesgedichte, in denen die Liebe nicht benannt wird, und die vorsichtigsten und zerbrechlichsten Verse der deutschen Nachkriegsliteratur. Zeit seines Lebens blieb er ein Autor für Kenner und Eingeweihte, ein immer im Verschwinden begriffener Riese. Sein lyrisches Werk wuchs in die Tiefe statt in die Breite und liegt nun – ergänzt um bisher unveröffentlichte Gedichte und ein Nachwort von Albert von Schirnding – mit diesem Band erstmals gesammelt vor.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Wolfgang Bächler, geboren 1925 in Augsburg, gestorben 2007 in München, gilt als einer der wichtisten deutschsprachigen Lyriker; auch seine Prosa, darunter die »Traumprotokolle«, wurde hochgerühmt. Nach Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft studierte er in München Literatur- und Theaterwissenschaft und war der jüngste Mitbegründer der Gruppe 47. 1956 ging er nach Paris und später ins Elsaß; seit 1967 lebte er in München.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401732-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Die Zisterne
Gedichte 1942 bis 1949
Oh, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt … Hölderlin,HYPERION I, 1
Das Allerweichste auf Erden überholt das Allerhärteste auf Erden. Das Nichtseiende dringt auch noch ein in das, was keinen Zwischenraum hat. Lao-tse
Die Fontäne
Kühn steige ich und falle
zerstäubt vom Überschwalle
nur immerzu in mich.
Ich baue Zaubertürme.
Durch Wind und Wetterstürme
aufwirbelnd tanze ich.
Zersprühende Gewalten
sich neu in mir gestalten,
und Sonnen spiegeln sich.
Als ich Soldat war
Als ich Soldat war, schrieb ich kein Gedicht.
Auf Schmerz und Tod gab’s nur den alten Reim.
Mir schnitt der Stahlhelmriemen ins Gesicht.
Und daß ich lebte, wußte ich es nicht?
Die Verse schliefen irgendwo daheim.
Das Blut floß stumm, gerann zu schwarzem Seim.
Als ich Soldat war, schrieb ich kein Gedicht.
Als ich Soldat war, sprach ich kein Gebet.
Die ersten schrillen Kugeln trafen Gott.
Die Stimmen starben, die zu ihm gefleht.
Geruch der Toten hat ihn zugeweht.
Befehle jagten mich in irren Trott.
In tausend leeren Fratzen hing der Spott.
Und Gott? – Wir hoffen, daß er aufersteht.
Geliebte Sprache
Für Hans Georg Brenner
Verlassen im Sturz der Gestirne stand
die Sprache. Ich tastete mich heran.
Ich strich ihr spielend über die Haut
und löste sie aus zerfetztem Gewand.
Da fing sie wieder zu tönen an
und manchmal schrie sie laut.
Ich griff ihr ins Haar – die Spange sprang –
Sie goß es über mich hin.
Es floß mir dunkel die Sinne entlang.
Ich tauchte hinein, in den Strom von Gesang
und badete mich darin.
Ich hob den Mund, den trunkenen Mund,
schon satt von der blühenden Brust.
Sie ließ mich nicht, sie saugte und biß
mir stöhnend die Lippen auf, als wund
im Taumel entfesselter Lust
das letzte Geheimnis zerriß.
In zuckenden Armen lag sie mir, bloß.
Ihr warf sich die Glut ins Gesicht.
Und nächtig quoll’s aus entsiegeltem Schoß
Ich ging in ihr auf und sie wuchs groß.
Wir zeugten die Welt als Gedicht.
Immer noch trägt uns die ewige Strömung
Für Stephan Hermlin
Immerfort trägt uns die ewige Strömung,
trägt uns des weißen Gewässers
friedlicher Schwall.
Nur wer sich einsam hob
mit durchlichteter Schwinge
taumelnd in Sphären der Helle
mit lohender Stirn,
fiel mit durchsengtem Gefieder
steinschwer und tönend hinab,
stieß auf die splitternden Gründe,
dunkel das Wasser verfärbend,
und staute den Strom,
saugten ihn nicht
die Kräfte der Sonnen in sich,
zog es ihn nicht
in den Strudel der Sterne,
wo er ein leuchtender auch
kreisend die Himmel durchmißt.
Immerfort trägt uns die ewige Strömung.
Jahrelang, unheilverhangene Jahre,
trugen uns schwarzrot die Wogen
schäumenden Bluts.
Männer warfen sich
tausendfach gegen die Fluten,
– stählern die Muskeln,
grün vor Haß die Gesichter,
Gier nach der Macht
in den zuckenden Lenden –,
schlürften wie Wein auf der Zunge
die Lust der Zerstörung,
türmten Leiber auf Leiber
der Toten wider den Strom.
Jauchzten und wollten es zwingen, das Wasser,
zwingen, das Schicksal, in ihre Bahn.
Sie stürzten die alten Werte
zwischen erstarrte Glieder.
Wind blies den Sand in die Fugen.
Standarten des Rausches brannten.
Himmelwärts wuchs
das Wehr der Vernichtung.
Über die Ufer schwollen
gurgelnd die Fluten,
löschten die Blumen, die sanften,
und brachen den Wald,
brachen die Tore der Stillen.
Sie peitschten im Aufschrei der Glocken
berstende Türme
und schlugen die Stufen des Doms.
Wolken rauschten herab,
und Gewitter fingen sich rollend
im Dunste des Bluts.
Tanzend, von Woge zu Woge geworfen,
rissen die Opfer die Trotzenden mit
in die Wirbel des Todes,
sprengten das Wehr
und die äußersten Dämme.
Letzte Zerstörer sanken dahin,
und die Fluten ergossen sich
schmutzig ins Meer,
ins unendliche.
Immer noch trägt uns die ewige Strömung
Wieder stehn lichtere Wolken
auf den Gewässern.
Und von den Sternen fällt
und durch die Wogen fließt
dunkel Gesang.
Verlassenes Schlachtfeld
Stümpfe und Strünke weisen zerschlissen
in die Gefilde erstarrter Gewalt.
Noch sind die Wiesen aufgerissen.
Spuren von tausend wütenden Bissen
sind in die Äcker eingekrallt.
Wassergefüllte Trichter gähnen,
die in der Erde wie Augen stehn.
Ist es der Tau, oder sind es die Tränen,
die auf den wehenden Gräsermähnen
wie zwischen zuckenden Wimpern zergehn?
Siehst du den Schrei in den Bäumen hängen?
Sieh, wie das Blut aus den Blüten tropft,
wie sich die Wolken in Äste zwängen,
wo sich die Hügel zusammendrängen!
Horch, wie der Wind an die Kreuze klopft!
Stimmen der Toten furchen die Lüfte.
Sieh, wie der Himmel die Bläue schluckt!
Helle des Tags versinkt in die Grüfte.
Dicht an des Berges zersprungene Hüfte
haben sich angstvoll die Dörfer geduckt.
Hörst du die Halme leise schauern,
dort, wo die Erde noch Blumen trägt?
Siehst du den Blitz in den Wolken lauern?
Horch wie der Donner gegen die Mauern
wachsender Horizonte schlägt!
Vögel taumeln wie Mücken und beben
saugend in Falten des Erdengesichts,
bis sie die Flügel des Sturmes heben.
Siehe, sie tragen einsam das Leben
brausenden Flugs in die Hallen des Lichts.
Die Erde bebt noch
Die Erde bebt noch von den Stiefeltritten.
Die Wiesen grünen wieder Jahr für Jahr.
Die Qualen bleiben, die wir einst erlitten,
ins Antlitz, in das Wesen eingeschnitten.
In unsren Träumen lebt noch oft, was war.
Das Blut versickerte, das wir vergossen.
Die Narben brennen noch und sind noch rot.
Die Tränen trockneten, die um uns flossen.
In Lust und Fluch und Lächeln eingeschlossen
begleitet uns, vertraut für immer, nun der Tod.
Die Städte bröckeln noch in grauen Nächten.
Der Wind weht Asche in den Blütenstaub
und das Geröchel der Erstickten aus den Schächten.
Doch auf den Märkten stehn die Selbstgerechten
und schreien, schreien ihre Ohren taub.
Die Sonne leuchtet wieder wie in Kindertagen.
Die Schatten fallen tief in uns hinein.
Sie überdunkeln unser helles Fragen.
Und auf den Hügeln, wo die Kreuze ragen,
wächst säfteschwer und herb der neue Wein.
Jugend der Städte
Auf den Balkonen des Lebens
stehn wir, hinabgebeugt,
und lauschen, ob uns vergebens,
vergebens die Eltern gezeugt.
Wir haben das Blut gerochen,
die schweißige Angst, den Haß.
Die Brücken liegen zerbrochen
im trägen, fauligen Naß.
Kamine bohren geborsten
hinein ins zerschlissene Grau.
Nur noch die Geier horsten
in ungetrübtem Blau.
Die Fenster sind eingeschlagen,
durch die wir ins Leben geschaut.
Die Häuser sind abgetragen,
die man um uns erbaut.
Die Welt sind für uns die Fassaden,
aus denen das Dunkel grinst.
Die Not zieht über Kaskaden
von Schutt ihr dichtes Gespinst.
Es hängen noch manchmal Altanen
mit Blumen verloren im Raum.
Die Schwalben ziehen die Bahnen
wie einst. Doch der lächelnde Traum
von Künftigem in den Gesichtern
der Kinder erlischt, wenn es hellt
und mit gierigen nackten Lichtern
der Tag in die Stille gellt.
Auf den Balkonen des Lebens
stehn wir, hinabgebeugt,
und lauschen, ob uns vergebens,
vergebens die Eltern gezeugt.
Wintergang
Der Himmel stürzt sternlos
ins weiße Feld.
Schnee sinkt, das Land sinkt.
Der Weg steigt, die Spur steigt
braun ins Grau.
Ich falle, ich stapfe, ich steige.
Gewölk reißt mich hoch.
Der Schuh klingt, der Wind tönt.
Schnee kränzt mir die Stirn.
Häuser ducken sich
krumm ins Weiß.
Flüsse erstarren,
umfrieren das Land.
Ein Strauch tritt
mir in den Weg.
Bäume nahen
schwarz und bittend
und neigen sich.
Ich sinke, ich stapfe, ich steige.
Das Eis singt, der Wald schreit.
Den Spiegel verhängt,
schwindet der See.
Dunkle Frucht rollt
mir vor den Schuh.
Die Frucht birst, Schnee fällt,
Das Land fällt, der Wind höhnt,
verweht den Weg,
verwischt die Spur,
verlöscht meinen Tritt,
glättet die Welt.
Im Föhnwind
Wenn der Föhn von Süden streicht,
fühl ich mich so leicht.
Gehen muß ich, gehen,
fort, wo die Alleen
in den Himmel stehen.
Schritt für Schritt fällt eine Last,
Schritt für Schritt wächst neue Hast,
Gehen, immer gehen,
in die Wolken sehen,
die vorüberwehen.
Wenn der Föhn von Süden streicht,
fühl ich mich so leicht.
Abstraktion
Schwer fällt mir die Nacht auf die Lider
und stürzt das Gestaltete ein.
Die Farben, sie sinken wieder
zum Ursprung, in mich hinein.
Der Abglanz des Tages, zerronnen,
sich tönend zu Bildern rafft,
gestaltlos dem Dunkel entsponnen,
und zwingt mich in zaubrische Haft.
Ins Licht meiner brennenden Sinne
sind leuchtend die Farben gestellt.
Die Sonne versank, nun beginne
der Rausch meiner eigenen Welt.
Nächtliches Spiel
Einer Tänzerin gleich
schreitet die Wolke
über die Bühne der Nacht,
grün schillernd
im Rampenlichte des Monds,
von tausend Sternen umschwärmt.
Verzückt, in wilder Gebärde,
entfaltet sie ihr Gewand,
wirft in den Nacken
das lockenumspielte Haupt
und jauchzend im Wind
erhebt sie die Arme.
Da rieselt ein Schauer
durch den erzitternden Leib.
Jäh lösen sich Haupt und Glieder,
rollen zu Flocken sich
und entschweben,
gefolgt vom geballten Rumpf.
War sie die Tochter des Monds?
Kehrt, im Taumel entseelt,
zurück in den Schoß sie,
zerrissenen Leibs? – –
In schaudernd erkaltendem Blau
erbleichen die Sterne.
Es tagt
Die müden Sterne und der Mond erblinden
am kühlen Himmel, der noch nächtlich droht,
und Wolken ballen sich in grauer Not,
das Licht, das quellende, zu überwinden.
Den Osten zeichnet eine Reihe Linden.
Aus wirren Ästen wächst das Morgenrot,
das glimmend in die Wolkentürme loht.
Die Blässe weicht, die Nebelstreifen schwinden.
Die Farben klären sich, und die Konturen
verdichten sich zu gültiger Gestalt.
Und alles, was in Schemen sich verloren,
das dämmrig Fließende der weiten Fluren
erstarrt zur Form. Erahntes wird Gehalt.
Die Sonne steigt, es ist der Tag geboren.
Das Moor
1943 im Reichsarbeitsdienstlager
Wolken lasten über schwerer Erde.
Nackte Birken tanzen wild im Wind.
An den Säumen meiner schmalen Fährte
trübes Wasser durch die Gräben rinnt.
Bohlen knirschen unter meinen Tritten.
Wütend schluckt und ächzt das träge Naß.
Von den Stürmen längst zu Tod geritten
liegt wie hingepreßt das bleiche Gras.
Schwarzen Bodens weit verstreute Splitter
einen sich vor mir zum dunklen Band.
Birken drängen sich zum fernen Gitter,
dicht umsperrend das verborgne Land.
Frühling?
Vorwärts hast ich den Weg
zwischen den Gärten.
Mauern, Hecken und Zäune!
Staub schlägt mir ums Knie,
und der Stein rollt vor dem Tritt.
Im Blut nur der eine Akkord,
der dunkle und starke,
der laut in den Adern tost.
Von fernen Balkonen nicken
Blumen und Mädchen.
Blüten flammen
aus saftigem Laub der Kastanien,
und über die Mauern quillt
duftend der Flieder.
Durch morschende Planken
tastet schmeichelndes Grün,
und über die Latten schimmern
wollüstig die Dolden
weißgelben Holunders.
Mauern, Hecken und Zäune!
Aufschauend mit rotem Aug,
ob sich der Himmel nicht weite,
seh ich nur Wolken
sinken auf mich,
schwer, schwer wie die Erde,
düster, gewittergeschwellt.
Ich ducke das Haupt,
daß es nicht an die Wölbung stoße,
und taumle zum Pfahl,
der sich in Himmel und Erde bohrt,
und rüttle, bis mir der Regen
den Schweiß auf der Stirne süßt
und mir das nasse Haar
Augen und Sinne verhängt.
Im Park
Ich lehne gelassen am morschen Zaun
und schau in den Park hinein:
Vor flüsternde Büsche tritt lächelnd ein Faun
aus grauem verwittertem Stein.
Als hätte ihn einst aus kreißendem Schoß
die Gartenerde gezeugt,
so steht er da, als ihr ältester Sproß,
von Regenstürmen gesäugt.
Die Bocksfüße klettert Moos hinan,
das wärmend die Mutter ihm lieh.
Lichtnelken, Schaumkraut und Löwenzahn
liebkosen streichelnd das Knie.
Die Schultern der blühende Flieder streift.
Die Hand liegt im Barte verkrallt.
Ein neckischer Zweig durch die Hörner greift
ins Haar, das den Nacken umwallt.
Im zottigen Fell eine Schnecke klebt.
Sie kriecht wohl schon lange Zeit
und spürt, wie hinauf sie den Götterleib strebt,
ein Stück Unermeßlichkeit.
Liebeslied
Wenn nur immerzu der Baum
diese weißen Blüten trüge,
wenn nur immer so der Schaum
roter Sonne in den Traum
deiner sanft erregten Züge
zitternd flösse und dein Haar
über meine Stirne wehte,
wenn sich nur das ganze Jahr
um das lichte Sternenpaar
deiner frohen Augen drehte,
wenn nur immer deine Hand
so an meinem Herzen lehnte,
wenn bis an den steilsten Rand
allen Lebens sich der Brand
dieser Stunde glühend dehnte,
wenn auf jedem Weg der Klang
deiner Stimme mich umhüllte,
wenn nur immer der Gesang
dieses Abends neu den Gang
meines Blutes jubelnd füllte,
dann zerschlüge sich die Nacht,
die das Nichts verbirgt im Kerne,
und sie stürzte in den Schacht
zwischen uns und hell entfacht
übertanzten uns die Sterne.
Moments Musicaux
Für Gudrun
Wie Farben fallen Töne in den Raum
und fließen selig klingend ineinander,
bald dunkel quellend, bald wie lichter Schaum
zerrieselnd, flüchtig schillernd wie ein Traum.
Auf blühen Stimmen dann wie Oleander,
wenn pralle Sonnenstrahlen den Balkon
am Mittag treffen und die Wände leuchten,
und taumeln, sich entblätternd wie der Mohn
im Abendwind, und sinken Ton um Ton
wie Blüten auf den Grund, den regenfeuchten.
Türflügel schlagen auf und fallen
zurück im Schwung.
Ein Mädchen flattert aus den Hallen
in leichtem Sprung.
Sie rauscht die breiten Treppen nieder.
Ein Vogel flieht.
Auf ihren Lippen kehrt es wieder,
sein buntes Lied.
Sie löst von ihrer Brust den hellen
Lichtnelkenstrauß
und wirft ihn in die grünen Wellen
des Sees hinaus.
Ein Kobold sprang
ins Stimmenmeer.
Baßdunkle Woge warf ihn her.
Hellgrünen Tang
flocht er ins Blau
der klingend kühlen Luft.
Aus braunem Duft
steigt eine Frau
auf lichtem Silberton.
In schrillem Hohn
spritzt er den Schaum
der Wellen an die weiße Brust.
Sie lacht vor Lust
und spürt es kaum,
wie er sie um die Hüfte faßt.
Ein irrer Tanz
im Wellenkranz.
Aus seinen Armen taumelnd sinkt
die süße Last.
Das Meer verschlingt
sie, doch der Bold entspringt.
Musik erklingt, Musik, die quirlt wie Sekt.
Den vollen Kelchen, die kristallen schimmern,
entsteigt des Südens farbensattes Flimmern.
Geläut von Herden Vogelstimmen weckt.
Und fern das Murmeln kühler Wasserfälle.
Fontänen in der Sonne silbern blitzen,
ein Sprühen, Schäumen und ein schrilles Spritzen
und Blumenwerfen und das Spiel der Bälle.
Und dann die Satyrsprünge, Rausch und Tanz,
erst anmutsvoll und wilder dann und wilder,
ein Sturz der Klangfiguren und der Bilder,
und Wirbel, Aufschrei und zerrißner Kranz.
Der Zauberspuk verweht, ein Echo irrt,
so liedhaft zart, daß alle Stimmen lauschen,
und dann nur noch der Wasserfälle Rauschen,
in dem sich letzte Melodie verliert.
Aus ihrer Hände weißem Fluß
stieg matt ein Klang,
und im Genuß
der blauen Stunde sang
der Baum,
der blütenweiße.
Ganz leise
zitterte im Kuß
ihr Mund.
Der Saum
des Kleides hob sich bunt,
und Blütenschaum
fiel in den Wind.
Es läutete ihr Haar
wie Gold, das durch die Finger rinnt.
Das Tönen schwand,
das um uns war,
versank ins Blut
und in die Glut,
die hell in ihren Augen stand.
Die Nacht sinkt matt, die Nacht stürzt schwer
in sonnenmüde Mauern.
Von Fenstern strömen gelb wie Wein
die Lichter auf den dunklen Stein
und hüpfen um mich her.
Die Schatten, die in Toren kauern,
sie springen auf und lauern
und fallen in die Straße ein.
Der Mond setzt sich aufs Dach hinauf.
Die Fenster klirren leise.
Sie öffnen sich wie Zaubertüren,
die traumweit in die Ferne führen,
und schließen Welten auf.
Akkorde fluten warm. Die Weise
schwingt wehend aus dem Kreise
Verzückter, die die Saiten rühren.
Von Frauenlippen fällt Gesang
auf mondberauschte Wände.
Nachtvögel streichen scheu durchs Lied.
Ein Ball, ein Pfeil, ihr Schatten flieht
den hellen Sims entlang.
Stumm reicht ein Kind mir seine Hände,
sieht in die Sternenbrände
und taumelt weg und jauchzt und kniet.
Frühsommer
Matt vom Jasmin
die Blüte fällt.
Der Traum zersprüht.
Die Bienen taumeln satt.
Es bleicht das Gras.
Ein schwüler Duft
steigt hoch ins Grau.
Die Sonne hängt im Dunst.
Auf blüht der Mohn.
Sein Rot ist heiß.
Die Erde glüht.
Die Mücken tanzen wild.
Die Luft steht still.
Schwer ballt sich Kraft.
Es reift das Korn.
Die Sonne hängt im Dunst.
Heimweg durch Gewitter
Lampen biegen sich
schlapp in die Nacht.
Dampf steigt vom Asphalt.
Hundert Spiegelungen tanzen.
Berstend zerbricht das Gewölk.
Ein Blitz schreit auf,
daß Bäume erbeben.
Blüten springen vom Ast.
Ein Turm steilt hoch und versinkt.
Gemäuer zuckt in weißer Angst.
Ein irrender Stern erbleicht.
Atemzuglang – bis wieder Schwärze
das Leben verschlingt.
Der Sturm lacht im Park.
Irgendwo grinst noch Licht
hämisch durch schmutziges Glas.
Irgendwo weint ein Kind …
Sommer 1945
Pflück mir den Mohn!
Ich fass’ es kaum,
daß wieder Sommer,
daß Sommer ist
und wieder Wärme
die Glieder hüllt,
in Adern fließt
und in die Herzen.
Daß wieder Kinder
wie bunte Falter
auf Gassen tollen
in Spiel und Streit!
Daß wieder Vögel
im Himmel hängen
und helle Lieder
tief in uns fallen!
Oh, daß das Eis
in dunklen Wimpern
und Brauen schmolz,
daß wieder Glanz
im Auge steht
und wieder Sonne
auf Straßen schläft
und auf der Haut!
Und daß wir wieder
in Flüsse springen,
aus Seen tauchen,
nackt an den Ufern
im Grase liegen,
die Hand in Blumen,
das Haar im Wind.
O blaue Zeit!
Daß wieder Licht
von Mauern rinnt,
von Bäumen trieft,
auf Körpern spielt,
durch Wellen schießt,
in Brunnen fällt
und in die Herzen!
Spürst es auch du?
Mittag auf dem See
Heißer Wind hält seinen Atem an.
Wasservögel bergen sich im Schweigen
dichten Schilfs. Die Wellenfurchen zeigen
silberspurig unsres Bootes Bahn.
Tiefer tauche ich die Ruder ein.
Stummes Wasser trägt des Mittags Schwere.
Weiche Ufer taumeln matt ins Leere.
Sonne liegt im Blut wie dunkler Wein.
Sonne spiegelt glühend dein Gesicht.
Sonne fließt aus deinen losen Haaren
über mich. Du lächelst traumerfahren
und wir saugen tief in uns das Licht.
Warum hast du dennfortgehen müssen?
Warum hast du denn fortgehen müssen?
Mein Gesicht, mein waches Gesicht,
das brennt noch von deinen Küssen
und der Mund, der Zerbrochenes spricht,
und die Sinne, die sind nicht erschlafft.
Wie ein Brückenbogen in Flüssen
lieg ich in die Nacht gestrafft.
Ich fühle die Wogen schlagen
in mir und über mich hin.
Nur dich, nur dich will ich tragen
und das Licht, das über uns schien.
Hoch über den purpurnen Wellen,
gedehnt in den glühenden Raum,
aus dem die Gesänge quellen,
wo der Sternenstaub und der Schaum
allen Lebens sich lodernd ballen,
dort wollen wir einsam stehn,
bis wir fallen müssen, dann fallen
wir tiefer und tiefer und sehn …
Warum hast du denn fortgehen müssen?
Warum, warum bliebst du denn nicht?
Komme wieder mit deinen Küssen!
Auf dem Mund, der Sinnloses spricht,
ersticke das matte Gedicht!
Staub
Für Günter Eich
Ungereifte Johannisbeeren
verrinnen mir grün in der Hand.
Regenträchtige Wolken gären
tief über erstarrtem Land.
Licht verliert sich in schrägen Strahlen
auf Rindern am Rasensaum.
Von Mäulern, die träge das Gras zermahlen,
trieft weißlich flockender Schaum.
Die Flügelschläge der Vögel knistern
erregter im Heckenlaub.
Auf Halmen und Blättern verschwistern
sich Blüten- und Straßenstaub.
Der Waldweiher
Als wäre einst ein dunkler Wolkenball
in diesem Waldtal am Geäst verhängt
und hätte sich in mählichem Zerfall
zerfließend in die Tiefen eingedrängt
und auseinanderquellend sich gedehnt,
so liegt der Weiher, finster, regengrau
an sanfte Hügel zitternd angelehnt.
Der trübe Spiegel schwärzt das Tannenblau.
Ins Braun verdüstert er der Buchen Grün.
Ums Ufer sich zerzaustes Schilfgras flicht,
darin versteckt die Wasserrosen blühn.
Vom Himmel sickert mattes, weißes Licht.
Licht
Licht rinnt an Stämmen des Hains,
fließt wie an Säulen des Seins
bis in die Schale des Quells,
leuchtet hinab in den Grund,
bricht sich dort wirbelnd und bunt,
fängt sich und steigt auf den Fels,
spielt über schlafendes Moos,
träumt in den dämmrigen Schoß
schattenversunkener Welt.
Undurchdringliches Laub,
blind von der Helle und taub,
irrende Strahlen hält.
Die Boote
Verstreut liegt da und dort ein Boot am Strand.
Die Ruder und das Steuer sind zerschlagen,
am morschen Boden schwarze Lachen nagen.
Die Planken glühn und weithin glüht der Sand.
Und andre schaukeln draußen in der Bucht.
Sie schnellen vor, bis sich die Seile straffen
in stetem Spiel, und stoßen dann im schlaffen
Zurück an ihren Pflock in matter Wucht.
Nur eines fliegt, den Mastbaum hochgestellt,
mit windgeschwelltem Segel durch die Wogen.
Vom Himmel überspannt in blauem Bogen
durchstößt es kühn den Schleier vor der Welt.
Der Gast der Erde
Hingelagert unter die Himmel,
hingelagert über das Nichts,
ruht trächtig die Erde.
Lichtfarbene Halme
schwanken ährenschwer,
und in endlosem Grün
dehnt sich in Fernen das Laub,
tausendsäulig und tausendarmig gestützt.
Und sie trägt auch mich,
diese Erde,
mich, den Gewittergebornen.
Der Halm zittert
bei meinem Tritt.
Bäume biegen sich seitwärts.
Schluchten klaffen auf.
Und in herber Rundung
locken mich Brüste,
sonnenbebende Hügel.
Sprühenden Laufs
schäumen mir Flüsse entgegen,
und die Stille des Sees
birgt mein vergangnes Gesicht.
Der Wind schmiegt sich
mir um den Leib.
Tau glänzt am Schuh
und am klingenden Stab.
Wolken kühlen
die heißen Schläfen,
und der Strahl des Gestirns
fällt mir schräg übers Haar.
Zwielicht im Aug
trink ich der Sonne Glut.
Dröhnenden Gangs
wandelt die Trotzende
durchs zerfallende Blau.
Auf meinen Schultern
türmt sich Gewölk.
Feuchte durchzittert die Luft.
Fern fängt sich der Donner.
Regen kost mir die Stirn.
Blitze grüßen mich
blaustrahlig, straff.
In Wehen zuckt
der Erde dunkler Leib
und bäumt sich
im fahlen Licht.
Von Himmel zu Himmel
wirft die Sonne
den schimmernden Bogen.
Ich eile und schreite hinaus
durchs siebenfarbige Tor.
1. Fassung
Rot
Für Otmar Lederer
Nur in den roten Farben ist Gott,
im Blut, das das Herz in die Adern stößt,
unter den brennend vereinigten Lippen
und auf der Haut, die in Scham sich rötet.
Nur in den roten Blumen wächst Gott,
im flüchtigen Brand des Mohns,
in der Rosen wütender Glut,
im herbstlichen Feuer der Astern.
Nur in den roten Früchten reift Gott,
unter der prallen Haut der Tomaten,
im rosigen Fleisch der Wassermelone,
in der Kirschen Süße, der bitteren Vogelbeere.
Nur in der roten Sonne brennt Gott,
in den wehenden Fackeln der Frühe
und im tieferen Glutball des Abends,
im Flammenstrich auf des Wassers gelöster Haut.
Miß die Zeit am rinnenden Blute der Frauen!
Schmecke am Rot der Blumen die Lust!
Sauge die Reife aus glühender Frucht!
Spüre den Wandel am Röten der Sonne!
Nur in den roten Farben ist Gott.
1. Fassung
Abgeerntet
Die Stoppelfelder starren sonnenfarben.
Ein letzter Wagen harrt mit prallen Garben.
Die Halme glühn.
Verstreut liegt zwischen stillen Ackerkrumen
manch rotes Blatt. Und auch die blauen Blumen
sind im Verblühn.
Ein graues Band, zerfurcht von tiefen Rinnen,
sucht unbeirrt die Weite zu gewinnen.
Es wölkt der Staub.
Am Graben stechen Pappeln auf ins Leere.
Die Erde ruht im Zwang der eignen Schwere.
Schlaff hängt das Laub.
Ein Wandrer zieht des Wegs mit lahmen Schritten.
Den müden Augen ist das Ziel entglitten.
Sie suchen bang.
Vor seinem Blick sich tote Äcker weiten.
Bald irrt er unstet in Unendlichkeiten.
Der Weg ist lang.
Nachmittagsstunde
Für Hanns und Odette Arens Herrlingen, September 1948
Auf blendender Mauer hocken
schwarzschattende Vögel. Drei
dumpfe Schläge der Glocken
ersticken das Kindergeschrei.
Vom Kirchensims fallen die Raben
in blaue Septemberglut.
Die eschernen Speere der Knaben
schwirren ins schwarzrote Blut
gereifter Holundertrauben.
Der Wind hat sich schläfrig gedreht.
Am Kirchensims sonnen sich Tauben,
vom Bachgrund emporgeweht.
Helles und dunkles Gefieder
schwimmt in das sumpfige Braun.
Sein leuchtendes Rad schlägt wieder
der Pfau vor dem Friedhofszaun.
2. Fassung
Kastanien
Für Anna Margarete
Ich sitze nach herbstkühlem Bade am Fluß
und schleudre Kastanien wie einst als Knabe,
bis ich die Schritte vernommen habe,
das knisternde Kleid und den raschelnden Fuß.
Ich tauche die Finger in offenes Haar
und sehe die Wolken im Winde schäumen.
Leise entblättert sich mit den Bäumen,
was ich erlebt im verflossenen Jahr.
Ich sehe die Wolken sich dichter ballen
und knote die Locken mit spielender Hand.
Geflügelte Früchte wehn sonnenverbrannt
von Eschenzweigen. Kastanien fallen
mir über die Schulter und ihr in den Schoß.
Ich breche die Stacheln und löse die Schale
und werfe die Kerne zum zweiten Male
über den Fluß mit weicherem Stoß.
1. Fassung
So kam die Nacht
So kam die Nacht: Sie stieg vom Tal herauf
und hing das Dunkel in die lichten Wipfel.
Die spielten’s höher, warfen’s über Gipfel
und droben fing’s der weite Himmel auf.
Die Schatten krochen aus Gebüsch und Tann,
aus Tobeln, Schluchten, die die Hänge queren,
und löschten sanft das Rot der Vogelbeeren,
den Schein des Wassers, der vom Felsen rann.
Sie traten aus das feuergelbe Laub,
die matte Glut, die in den Gründen träumte.
Nur drüben, wo der Wasserfall sich bäumte,
da schimmerte noch hell der Silberstaub.
Die Kühle wehte hoch und wischte sacht
des Tages Wärme von den müden Halmen,
und tiefer, tiefer sanken rings die Almen
und schmiegten sich in Arm und Schoß der Nacht.
Bergabend
Wetterwände stürzen ein.
Nebel zieht die Schleier dichter,
und im Spiel der letzten Lichter
lächelt schmerzlich das Gestein.
Wolken knien auf bleichem Hang.
Himmelgreifend beten Tannen,
um die Geisterflut zu bannen.
Eine Latsche duckt sich bang.
Schon entsinkt der nahe Grat.
Farben sind ins Grau zerronnen,
und ich suche eingesponnen
durch die Dämmerung den Pfad.
Herbstmorgen
Der wache Tag hebt strahlend sein Gesicht
aus grauem Dunst ins dünne Blau empor.
Die Bäume fangen den zerrißnen Flor,
der wallend sich um ihre Äste flicht.
Die Äste greifen sich verschränkend aus
und scheinen Kuppeln wölbend hochzuschwellen.
Sie seufzen auf wie tragendes Gebälk.
Und draußen schimmern Teppiche des Taus,
bis Wolken doldig aus der Bläue quellen.
Das Licht wird überreif und matt und welk.
Oktobertag
Der Nebel fällt, aus grauen Fluten steigt





























