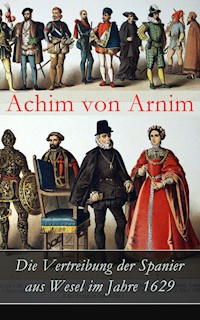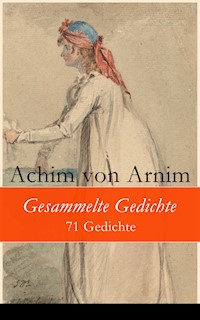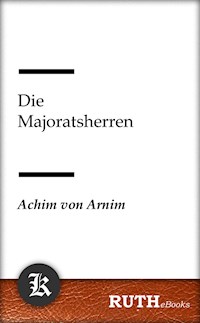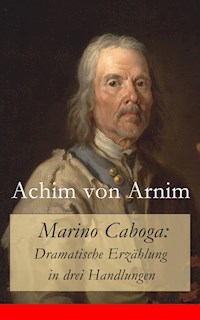Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die 'Gesammelten Novellen' von Achim von Arnim präsentieren eine Sammlung von faszinierenden Erzählungen, die die Leser in die Welt des 19. Jahrhunderts entführen. Von Arnims literarischer Stil ist geprägt von Romantik und Realismus, wodurch er eine einzigartige Atmosphäre schafft, die seine Leser verzaubert. Die verschiedenen Erzählungen in diesem Band decken eine Vielzahl von Themen ab, darunter Liebe, Schicksal und die dunklen Seiten der menschlichen Natur. Von Arnims Fähigkeit, komplexe Charaktere und Situationen zu präsentieren, macht dieses Werk zu einem Meisterwerk der deutschen Literatur. Achim von Arnim, ein bedeutender Vertreter der deutschen Romantik, war nicht nur ein begabter Schriftsteller, sondern auch ein aktiver Teilnehmer an intellektuellen und politischen Diskursen seiner Zeit. Seine Erfahrungen und Beobachtungen spiegeln sich deutlich in seinen Novellen wider, die einen Einblick in die Gesellschaft seiner Ära geben. Von Arnims Leidenschaft für Literatur und sein Streben nach Wahrheit und Schönheit sind in jedem seiner Werke spürbar. Für Liebhaber der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts und alle, die sich für die Romantik interessieren, ist 'Gesammelte Novellen von Achim von Arnim' ein Muss. Die meisterhaften Erzählungen, kombiniert mit von Arnims poetischer Sprache und tiefgreifenden Einsichten, machen dieses Buch zu einer inspirierenden Lektüre, die den Lesern sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Novellen von Achim von Arnim
Books
Inhaltsverzeichnis
Die Verkleidungen des französischen Hofmeisters und seines deutschen Zöglings
Löwen
Heute war mein Geburtstag, ich bin nun 19 Jahre alt und habe meine Rechtsstudien, mit denen andre kaum in ihrem 24sten Jahr fertig werden, fast beendigt. Ich hoffte jetzt von aller Aufsicht frei zu sein, als mir mein Vater vor vier Wochen den seltsamen französischen Hofmeister schickte, der mir zu beweisen sucht, daß ich noch gar nichts wisse, daß ich noch gänzlich unerzogen sei und meine Lehrjahre nun erst anfangen müsse. Ich berichtete dagegen an meinen Vater, dieser aber zerschmettert alle meine Gründe mit väterlicher Allmacht, befiehlt, mich ganz der Führung des Franzosen zu überlassen, mit dem ich in die Welt eintreten sollte. Der Hofmeister spricht von dieser Welt, als ob sie ganz das Eigentum König Ludwigs XIV. und seiner Franzosen sei, als ob ich dazu noch einmal geboren werden müßte, und ich freue mich gar nicht darauf. Ich soll mich nun besinnen, soll bestimmte Absichten verfolgen und mich nicht fortreißen lassen von Lüsten zu wissenschaftlichen Beschäftigungen. Zu diesem Behufe hat er mir heute das Versprechen abgenommen, alle Abende treulich aufzuschreiben, was ich gedacht und erlebt habe, darüber Betrachtungen anzustellen, was wahr, was falsch, was versäumt oder übereilt sei. Er wußte mir das Unternehmen eines solchen Tagebuchs als höchst nützlich, als sehr unterhaltend darzustellen, heute kann ich aber keins von beiden darin finden. Ich habe nichts erlebt, und gedacht habe ich auch nicht viel, der Vetter führte mich zur Feier des Geburtstages zu den Landsleuten, es wurde viel Bier getrunken. Zu Hause habe ich wieder meine Institutionen geritten und das Buch des Hofmeisters über die Lebensart der großen Welt und die Kunst, Liebesbriefe zu schreiben, aufzuschlagen vergessen. Tue ich daran unrecht, so tue ich es doch nicht mehr als er selbst, wenn er die Zeit des Schlafengehens vergißt und seine Begierde, über Indien etwas zu erfahren, aus tausend vergessenen Büchern befriedigt. Dieser Götzendienst wird ihn in seinen geistlichen Studien als Abbé nicht weiterbringen, die Welt wird sich auch um dergleichen tolles Zeug nicht viel kümmern. Jene Völker scheinen mir nach allem, was er erzählt, eher eine Art Affen, denn vernünftige Menschen, und fänden sich dort nicht die kostbaren Steine und Gewürze, so möchte wohl kein vernünftiger Mensch dahinziehen, mein Herr Hofmeister ausgenommen, der den festen Vorsatz dazu hegt, wenn er meine Erziehung beendigt hat. Ich darf hier dreist über ihn schreiben, der Horcher an der Wand hört seine eigne Schand, und er hat mir bei seiner Ehre geschworen, dieses mein Tagebuch so heilig zu achten, als wäre es die Beichte, die ich meinem Pater Bonifaz ablegte, er will mich auch in der besten Absicht nicht belauschen und nicht in dieses mir dazu geschenkte rote Buch blicken, auch wenn ich es offen neben ihm liegenließe. Er ist ein Mann von Wort, das habe ich schon an ihm achten lernen, ein Mann von sicherem, festem Betragen, den ich nicht wie seinen Vorgänger zu bewachen brauche gegen den Mutwillen der Studenten und gegen eigne dumme Streiche. Was der Abbé die Welt nennt, ist freilich nicht viel anders, als was Pater Bonifaz als den Teufel schilderte, seine Welt ist Paris, und unsre gute Stadt Köln mit allen ihren Heiligtümern ist ihm nicht so viel wert als die Vorzimmer der berühmten Pariserinnen, aus denen er jeden Einfall mit listigem Behagen wiederholt. Immer spricht er von Komödien, worin er mit andern Liebhabern spielte, wie er in Maskenverkleidung die Leute angeführt hat. Er kann es nicht ertragen, daß mir die jetzt lebenden berühmten französischen Schriftsteller langweilig sind. Wie sprang er auf, als ich die Tragödien der Herren Corneille und Racine bei der Zusammenstellung mit den alten Originalen dem schlechten seidnen Zeuge ähnlich fand, das meine Mutter mir zum Schlafrock aus geflickten bunten seidnen Lappen weben ließ; es hält zwar, aber es ist schlechter als jeder einzelne Lappen, der dazu verwendet worden. Er behauptete, der Anstand fordere es, das Anerkannte zu loben, in Frankreich stehe das Urteil fest, und ich würde mir selbst am meisten durch dergleichen Einfälle schaden. Er hat Augen, als ob er einem ins Herz sehen könnte, er plagt sich mit vielen Sorgen für mich, er scheint es gut mit mir zu meinen, daß ich aber dieses Tagebuch zur Sprachübung französisch schreiben muß, ist eine verdammte Plage, die er mir aufgelegt hat. Ich habe ihm darauf mein Wort gegeben, er stellte es mir so leicht vor, und nun schreibe ich doch manchmal etwas andres, als ich schreiben wollte. Brüssel
Mein Herr Hofmeister ist verrückt. Heute läßt er mich aus dem Kollegio zu sich rufen und sagt mir, daß mein Vater mich in Brüssel erwarte, wohin ihn eilige Geschäfte gerufen. Ich finde schon alles Nötige gepackt, ja noch viel mehr, als zu einer so kleinen Reise mir notwendig geschienen hätte, kaum habe ich noch einen Augenblick Zeit, zum Vetter zu laufen, um von ihm Abschied zu nehmen. Der will es kaum glauben und versichert mir, er habe auf mich gar sehr gerechnet bei einer Streitigkeit, welche die Studenten mit den Soldaten anfangen wollten, um einen derselben zu befreien, der zum Tode verurteilt worden, weil er sich von ihm und andern Studenten von seinem Posten fort zu einem Trinkgelage habe führen lassen. Ich war in Verzweiflung, daß ich nicht dabei sein sollte, aber der Vetter rät, die Reise nicht auszusetzen, weil er den Ernst meines Vaters kennt. Sulpiz drängt sich dazu, mich als Bedienter zu begleiten, obgleich ich auf die paar Tage keinen nötig zu haben glaube. Wir reiten, so schnell wir können, hierher, mein Vater ist nicht zu finden, und aus der Ruhe des Hofmeisters sehe ich deutlich, daß er auch nicht kommen wird. Welche Absicht er dabei hat, kann ich nicht erraten, seine Verschwiegenheit ist undurchdringlich. Ich bin auf der Universität hinlänglich gewitzigt, um ihm begegnen zu können, wenn er etwas Böses mit mir vorhaben sollte. Kann ich sein Tagebuch finden, vielleicht gibt es mir Belehrung über seine geheime Geschichte und Absichten. Zum Glück hat er mir kein Versprechen abgenötigt, es nicht anzusehen, und rechnet mehr auf seine Vorsicht, es immer sorgfältig zu verschließen, vielleicht auch auf meine Scheu vor fremdem Gut, denn aufrichtig gesprochen, so etwas von Dieberei ist allerdings dabei, sich in das Geheimnis eines andern zu stehlen. Notwehr ist erlaubt, und hier, wo ich ganz unbekannt bin, während er schon mit einem Dutzend Reisenden Bekanntschaft, ja Freundschaft erneut zu haben scheint, muß ich mich der Selbsthilfe überlassen. – Diesmal habe ich mich umsonst dem Teufel übergeben. Ich benutzte den Augenblick, als er hinausgegangen, blickte auf das Blatt und fand gar nichts als die unbedeutenden Worte: »Wieder ein Tag vergangen, ohne eine Nachricht von dir, liebe Laura.« Wie ich durchs Vorzimmer gehe, bemerke ich zu meinem Erstaunen, daß der dumme Schlingel, der Sulpiz, auch ein Tagebuch schreibt, worin er genau aufzeichnet, wie viele Meilen wir gemacht, was der Hofmeister und ich mit ihm gesprochen. Zu meinem Ärger muß ich da lesen, daß der Hofmeister ihm befohlen, von allen meinen Gängen ihm Nachricht zu geben, auch wer mich besucht, denn ich sei neu in der Welt und gutmütig und könne leicht in die Hände bösartiger Menschen fallen. Nun bin ich gerechtfertigt wegen meiner Neugierde. Er sucht mich auf unwürdigem Wege durch den Bedienten zu belauern, ich belausche künftig seine Tagebücher, indem ich beide unter allerlei Vorwand abends zu entfernen suche. Wer ist nun der Klügste, der Franzose oder der Deutsche?
Brüssel
Mailge gespielt, gewonnen, Oper gesehen, mit den Franzosen gegessen, grobes Volk, viel getrunken. Ich kann nicht mehr schreiben, es dreht sich alles mit mir herum, und ich meine mit einer doppelten Feder zu schreiben. Das Löwener Bier ist hier stärker als am Ort selbst. Der Franzose ...
Brüssel
Mein Hofmeister mag ganz recht haben, daß ich nichts von französischer Sitte habe, aber warum soll ich ein Franzose werden? Mein Vater verlangt es, weil er selbst daher noch eine Erbschaft erwartet, und ich muß mich fügen. Heimlich muß ich dabei eingestehen, daß in diesen Sitten doch viel Erfahrung verborgen ist von dem, was die Geselligkeit stören, und ein Sinn für alles, was ihren Reiz erhöhen kann. Der Hofmeister kam morgens mit ernstem Gesicht an mein Bett, erkundigte sich nach meiner Gesundheit, freute sich, daß mir der Rausch nichts geschadet, und versicherte mir, daß er den gestrigen Tag in der größten Qual verlebt habe. Ich fragte nach der Ursache, er habe sehr heiter geschienen. Er antwortete, daß er aus Schonung gegen mich seinen Ärger über die Unschicklichkeiten nicht habe sichtbar werden lassen, zu denen ich mich aus Unkunde geselliger Verhältnisse hätte verleiten lassen. Ich war sehr verwundert, denn ich war vollkommen mit mir zufrieden und wollte nicht eher glauben, bis er mir alles genau vorgetragen hätte. Beim Mailgespiel, sagte er, waren Sie zu heftig auf den Gewinn; sahen Sie nicht, wie sich die beiden französischen Offiziere über jeden guten Wurf freuten, wem er zugute kommen mochte. Wir gewannen ihnen die Oper und ein Abendessen ab, und jene freuten sich, daß Ihr Ungeschick ihnen die Annehmlichkeit verschaffe, uns zu bewirten, sie wünschten sich alle Tage einen gleichen Verlust. Welche entsetzlichen Mienen, welche Blicke mit den Augen machten Sie, um mir zu verstehen zu geben, daß dies kein Ernst der Leute sei. Glauben Sie denn Ihre Mienensprache so verschieden von der andrer Menschen, daß jene Herren nicht auch etwas davon verstanden? Warum mußten Sie nachher sich beständig Ihres Gewinns rühmen, war das nicht gemein, und waren jene Herren nicht viel besser daran, die sich, wie es die Gesellschaft fordert, um ihren Verlust nicht kümmerten, sondern ihn als einen kleinen Beitrag zur geselligen Unterhaltung aufnahmen? Ich müßte ihm recht geben, ich sah, daß er es hierein gut meinte, und erinnerte mich, wie manchmal ich unter meinen Freunden die ärgerlichsten Händel ausbrechen sah, bloß weil einer sich im Gewinn nicht mäßigen, der andre seinen Verlust nicht verschmerzen konnte. Er fuhr fort in seiner Entwickelung meiner Unschicklichkeiten, wie ich in der Oper Scherze, die nur meinen Kameraden kundig, überlaut vorgetragen, als ob nicht genug Leute sie hören könnten, und wie er mir deswegen zugeflüstert, daß man in der Oper nicht sprechen dürfe. Besonders hätten sich meine Zitate aus dem Cicero wie eine rechte Schulfuchserei ausgenommen, zusammengestellt mit meiner Verwunderung über Theatersachen, die allen ändern längst bekannt wären. So sei es gar nicht lächerlich, daß das gemalte Laub an den Bäumen bei dem künstlichen Gebrause, welches den Sturm auf dem Theater vorstelle, sich nicht bewege, noch törichter sei aber mein Haß gegen den einen Schauspieler gewesen, der den Tyrannen der beiden Liebenden gespielt, als ich ihn nach Endigung des Stücks auszuprügeln gedroht, kurz, meine Albernheit habe alle seine Vorstellung überstiegen. Ich sah das ein, ich hätte nach meiner Einsicht am wenigsten im Theater reden sollen, und war der lauteste Zuschauer. Aber warum waren Sie nachher nun so still in der Abendgesellschaft? fragte der Hofmeister. Ich versicherte ihm, daß ich bei den beständigen Witzeleien der Franzosen nicht habe zu Worte kommen können, dann hätten mich ihre Lügen verdrießlich gemacht, und zuletzt hätten sie keinen ordentlichen Bescheid aus meinem Bierkrug trinken wollen. Er zuckte mit den Achseln und fragte: Warum brachten Sie Ihre Einfälle nicht auch zu Markte, aber Sie ärgerten sich, weil nicht gleich die ersten den Beifall an sich rissen. Zuerst begnügen Sie sich, die Unterhaltung mitgeführt zu haben, ehe Sie Mittelpunkt derselben werden wollen, und gewöhnen Sie sich, in derselben alles als Ihr Eigentum, als ein Gemeingut anzusehen, so werden Sie sich viel reicher durch den Geist andrer als durch Ihre eignen Beiträge fühlen. Was sollten ferner die Fragen bei lustigen Geschichten, wann und wo sie sich ereignet hätten, ob sie wohl zu glauben wären? Heißt das nicht eine Geschichte durch solche leeren Mißverständnisse oder Zusätze totmachen, liegt nicht ihr Glauben, ihr Leben, ihre Zeit in den guten Einfällen und der Erfindung, die gar nichts verlieren, wenn auch die Geschichte gänzlich unmöglich wäre? Bei Küchenrezepten ist die Ausführung die Hauptsache, aber mancher gute Einfall, der sich erzählt des Beifalls erfreut, würde im Leben mit Ohrfeigen bezahlt werden. Darum ist die Erzählung soviel reichhaltiger als die Wirklichkeit, sie kennt unzählige Schranken und Rücksichten nicht, selbst die Belehrung dringt freier zu uns, als wenn sie sich unmittelbar an unsre Erfahrung anschließt: vielleicht wenn Ihre Bildung für die Welt mir dazu Zeit ließe, ich würde eindringlicher durch Erzählung ähnlicher Vorfälle, die andern geschehen, auf Sie gewirkt haben, als eben jetzt durch diese unmittelbare Beschämung. Ich gestand ihm ein, daß in den Geschichten, die ich gestern so hochmütig von oben her wie leeres Geschwätz angesehen, eine reiche Quelle von Geist und Erfahrung sich eröffnet habe, und bat ihn, mir ohne Umschweife alles zu erklären, was ich in der Gesellschaft der Trinker versehen. Sie nennen diese gescheiten Männer Trinker und waren der einzige, der sich im Trunk übernommen. Warum verachten Sie Weine, die Sie nicht kannten, warum forderten Sie durchaus Löwener Doppelbier und zuletzt Wacholderbranntwein? Wollen Sie in Paris wieder nur Löwener Bier trinken, so müssen Sie verdursten, hier fand es sich durch Zufall, überhaupt aber schickt es sich nicht, als Gast eines andern, was er gibt, zu verachten, oder zu fordern, was er nicht aus eignem Antrieb vorgesetzt hat. Sie wollten kein Glas Champagner annehmen und beschweren sich, daß jene den Krug Bier nicht nach Ihnen zur andern Hälfte geleert und ihn mir kredenzt haben, wie es in Löwen die Sitte der Studenten sein mag. Ländlich, sittlich, in Frankreich trinkt niemand gern mit einem andern aus demselben Glase, um Ansteckung böser Krankheiten zu vermeiden. – Ich geriet in Verzweiflung über meine dummen Streiche, ich schämte mich, die Leute wiederzusehen, und ich bat ihn, wenn mein Vater noch nicht gekommen, die Rückreise nach Löwen sogleich anzutreten. Bei diesen Worten zeigte er mir das Schreiben des Rektors der Universität Löwen, in welchem derselbe seine Klugheit rühmte, mich wegen der zu erwartenden Studentenunruhen noch vor der Zeit fortgeführt zu haben, zugleich übersandte er ein rühmliches Zeugnis meines Fleißes und mehrere Empfehlungsschreiben an französische Gelehrte. Ein andrer Brief des Vetters, den er mir dann übergab, erzählte mit Reue und Verzweiflung, wie er in dem Augenblick flüchten müsse und sich bei einem deutschen Regiment in Frankreich wolle anwerben lassen, da er von seinem Vater keine Verzeihung zu erwarten habe. Er habe zwar den gefangenen Soldaten, der zum Richtplatz geführt, glücklich befreit, aber in der Hitze den Wachtmeister erstochen, der ihn begleitete. Die Soldaten, die sonst wohl ein Auge zugedrückt hätten, weil der Auflauf zur Rettung eines ihrer Kameraden geschehen, hätten dadurch ihre Ehre gekränkt geglaubt, auf die Studenten eingehauen, viele verwundet, zwei getötet, und all das Unglück mache man ihm nun zum Vorwurf. Er freue sich nur allein darüber, daß ich fern gewesen und nicht durch ihn in dies Unheil mit verwickelt sei.
Ich war durch diese Briefe betrübt und beschämt. Ich betrauerte das Schicksal meines Vetters, so nahe hatte mich noch kein Unglücksfall berührt, ich kannte das Unglück bis daher nur als einen Reiz meiner Neugierde, als eine milde Erregung des Mitleides. Beschämt war ich durch den falschen Verdacht gegen meinen Hofmeister, aber ich vermochte es nicht, ihm den bösen Verdacht zu bekennen, den ich gegen ihn gehegt. Er schien es aber wohl zu ahnen, denn er zeigte mir zuletzt noch einen Brief des Vaters, worin ihm dieser Wechselbriefe für mich schickte, und mir zwar Freiheit ließ, selbst zu wirtschaften mit meinem Geld, doch nicht ohne vorhergehende Beratung mit dem Hofmeister. Er empfahl schnelle Abreise nach Paris, weil jetzt wegen der Hoffeste alle Leute von Stand dort versammelt wären, und befahl mir das Geheimnis seines Freundes, meines Hofmeisters, wohl zu bewahren, der sich in Paris vielleicht einen andern Namen geben würde, dem ich durchaus wie ihm selbst Folge leisten sollte. Dies wunderbare Vertrauen meines sonst so vorsichtigen Vaters brachte mich zum Gipfel der Verwunderung, ich sagte dem künftigen Herrn Vater offen, ich empfände eine
peinliche Neugierde, seine Geschichte zu hören. Er versicherte mir, daß er diese Neugierde befriedigen wolle, wenn es Zeit sei.
Brüssel
Das ärgste Unglück, dem ich mich in Löwen entzogen, gleicht nicht dem Unstern, der mich hier in Brüssel verfolgt. Eben wollten wir fort, die Postpferde warteten, die der Hofmeister selbst bestellt hatte. Da fehlte der Sulpiz beim Aufpacken. Wir vermuteten, ihm sei ein Unglück geschehen. Der Hofmeister ging zu den Leuten, welche für die Sicherheit der Stadt sorgen, ich durchsuchte sein Tagebuch, ob darin keine geheime Verbindung mit den Töchtern der Stadt aufgezeichnet wäre. Statt dessen fand ich eine Reihe Betrachtungen über mich, die mein Blut in Bewegung setzten. Aus Ärger und Langeweile trank ich mich noch mehr in Hitze. Endlich kam der Sulpiz, nachdem ich so drei Stunden zugebracht, über den Markt geschwankt, von einem Soldaten bis zur Tür des Wirtshauses geführt. Seine verkehrten Reden, auch der Geruch überzeugten mich gleich, daß er sich betrunken. Kaum konnte ich die Zeit abwarten, daß er auf mein Zimmer kommt, um ihm eine gute Belehrung auf den Rücken zu schreiben. Ich will zugeben, daß ich in meiner Hitze nicht genug beachtet, wohin ich geschlagen, aber seine Schläge hatte er verdient. Leider ist er am Kopf verwundet, ja es tut mir leid, auch wenn er noch mehr Schläge verdient gehabt, da er mehr aus Neigung zu mir und aus Anhänglichkeit zu den Meinen mitgegangen, als des Lohnes wegen. Aber es war nun einmal geschehen, als der Hofmeister kam, und darum hatte er unrecht, mir Vorwürfe zu machen, daß ich mich an einem so guten Menschen vergriffen, der zum erstenmal sich einen Vorwurf zugezogen. Er führte mich zum Spiegel und bat, daß ich mich ansehen möchte. Freilich kein sonderlicher Anblick, in einer Hand hielt ich einen Busch ausgeraufter Haare, meine Perücke war mir abgefallen, meine Manschetten voll Blut, meine Halsbinde aufgelöst, der Schaum stand vorm Mund, und über die Backen hatte mich der Kerl in der Angst gekratzt wie eine Katze. Das machte mich noch zorniger, ich beteuerte, daß ich mir in Hinsicht meines Betragens mit Bedienten nicht einreden lasse, und eilte in ein Nebenzimmer, weil ich meine Wut aufkochen fühlte. Mein Entschluß war gefaßt, ich wollte mich unabhängig machen von den Einreden des Hofmeisters, es koste was es wolle. Ohne mich um ihn zu bekümmern, ging ich zu dem Handelsherrn, auf welchen mein Vater den Kreditbrief gestellt hatte, der Name ist mir entfallen. Er zahlte mir die hundertundfünfzig Pistolen ohne zu säumen aus. Ich sah den Hofmeister in der Entfernung auf der Straße und trat in ein nahes Cafehaus, um ihm auszuweichen. Es wurde da gespielt, ich schämte mich, von diesem Vergnügen ausgeschlossen zu scheinen und wagte ein paar Pistolen. Ich verlor und verdoppelte meinen Satz. Nach einer Stunde war mein Geld verloren, und ich hatte den Ärger, zu vermuten, ich sei betrogen. Ich war im Begriff, die Karten dem Spieler an den Kopf zu werfen, als ich mich der Warnungen meines Hofmeisters erinnerte; es war mir, als stünde er neben mir und redete mir zu, wie ein Mann von Stand den Verlust im Spiel nicht achten müsse. Mit erheuchelter Freundlichkeit nahm ich Abschied, indem ich mir die Karten als ein kleines Andenken meines Verlustes erbat. Der Spieler wollte zwar eine Einwendung machen, er schien verlegen, und ich wußte mir das nicht gleich zu erklären, aber aus Eigensinn wegen meines Verlustes nahm ich die Karten fort, ohne mich an alle Einwendungen zu kehren. Ich eilte in das Gehölz vor die Stadt mit halbem Willen, meinem Leben ein Ende zu machen, aber zehnerlei Hinderungen traten zwischen, zuerst konnte ich den Degen erst nach vieler Anstrengung aus der Scheide bringen, die bei dem Kampf mit dem Bedienten verbogen war, dann begegneten mir Leute. Endlich nach ein paar Stunden glaubte ich allein zu sein, als der Hofmeister an mir in großer Eile vorüberstreifte, und mir nur die wenigen Worte sagte: Mein Diener sei sehr schlecht, und er gehe eben nach einem Beichtvater. Eine große Angst wegen dieser Sündenschuld, die mich belasten könne, vertrieb alle Sterbelust aus meiner Seele. Ich eilte nach Hause, des festen Entschlusses, gleich am nächsten Tage fortzueilen nach Köln, meinen Vater anzuflehen, daß er der Familie des armen Sulpiz alles vergüte, was sie durch den Tod des Menschen verlieren könnte. Hier erfuhr ich, daß es sich ein wenig mit ihm bessere. Das bestärkte mich in meinem Entschluß, fortzureisen. Als ich dies dem Hofmeister sagte, lachte er mich aus und meinte, es sei ebenso unrecht, von einem Unfall übermäßig ergriffen zu werden, wie es unrecht gewesen, gar kein Mitleid bei dem Leiden des armen Sulpiz zu äußern. Er riet mir, die Sache ruhig zu beschlafen, er selbst habe Hunger und wolle erst noch mit ein paar Bekannten zu Nacht essen.
Ich kann mich in diesen Mittelzustand von Beruhigung und Sorge, den er mir mitzuteilen sucht, nicht versetzen. Er ist teilnehmend, und kann dabei so leichtsinnig sein, wegen des Geschwätzes von ein paar Franzosen sich mir zu entziehen. Er hat heute viel geschrieben, ich bin sehr neugierig, ob es mich angeht.
Seltsame Sachen mußte ich da entdecken. Also doch ein Betrüger ist dieser Mann, der immer so beherzt von seiner Ehre spricht, dem mein Vater alles Zutrauen schenkte, ein Ketzer, und was viel schlimmer, ein Ketzer, der sich verstellt, als ob er zur alleinseligmachenden Kirche gehöre, der auch mich auf diesem Schleichwege verführen will. Und doch habe ich nie eine Spur dieser Absicht in seinen Reden bemerken können. Er spricht im Tagebuch von einer verstorbenen Frau, er ruft sich ihr ganzes Wesen zurück, er sagt, sie sei vollkommen gewesen, denn selbst ihre unüberwindliche Abneigung, seinem Rate zu folgen und den äußeren Schein des katholischen Glaubens anzunehmen, sei eine Tugend gewesen, obgleich sie ihr das Leben, ihm und seinem Kinde jedes Lebensglück gekostet habe. Der arme Mann mag viel gelitten haben unter dem verruchten Ludwig XIV, aber warum kann er es nicht lassen, von dem liederlichen Hofstaat dieses gemeinen Menschen, der nicht einmal mit seinen Geliebten sich edel zu betragen versteht, mir immer vorzuerzählen? Ich bin kein Eiferer für meinen Glauben, mein Vater hat immer viele Protestanten in seinem Hause gesehen, aber ich will doch nicht um meinen Glauben wie ein Kind betrogen sein. Ich habe Logik gehört und weiß selbst zu prüfen.
Auch den armen Sulpiz habe ich heimlich besucht und ihm viel Geld versprochen, wenn er wieder genesen, doch müsse er meinen Besuch dem Hofmeister nicht wiedersagen. Sein Tagebuch lag aufgeschlagen. Ich blickte hinein und fand keinen Vorwurf, sondern viele herzliche und unverdiente Liebe gegen mich; könnte ich diesen Unglückstag aus meinem Leben verwischen!
Antwerpen
Mein Hofmeister ist der edelste, der beste, der klügste und mutigste Freund, ihm zuliebe möchte ich Ketzer werden. Ich schäme mich meiner Übereilungen, aber er bot mir selbst die Entschuldigung an, weil ich noch so jung sei und mich doch für erfahren gehalten. Der Zusammenhang und mein Gelübde fordern von mir, daß ich mit meinen Torheiten anfange. Als ich aufwachte, war der Hofmeister schon ausgegangen, und ich ärgerte mich ziemlich, daß ihm die beiden französischen Schwätzer, die er nach meiner Meinung so früh besucht, mehr wert wären als mein Geschick. Ich eilte zu dem Wechselladen, wo ich gestern die 150 Pistolen ausgezahlt erhalten. Der Herr war in seinem Laden und aß ein Butterbrot. Er bot mir davon an, ich wußte, daß dies das höchste Zeichen von Gastfreundschaft bei den Flamländern sei, und vermutete daher, daß die Zahlung der kleinen Summe zur Bezahlung im Wirtshause und zur Reise nach Hause keinen Anstand finden würde. Aber ganz freundlich antwortete der Mann, daß mein Vater mich auf keine höhere Summe, als ich erhalten, bei ihm akkreditiert habe. Da half keine Bitte. Ich zog ihm in der Hitze ein paar Ohrfeigen und ließ ihn ganz verwundert mit dem Butterbrot im Mund stehen. Zum Glück war er allein, sonst hätte ich mir einen gefährlichen Handel zuziehen können. Jetzt hat er sich durch Vermittlung des Hofmeisters dabei genügen lassen, zehn Pistolen mehr dem Vater anzuschreiben, nachdem ihm dieser vorgestellt, daß er keine Zeugen habe, und ich die Sache ableugne. In meinem Zorn ging ich zu einem Hause, wo ein Goldschmied sein Schild ausgehängt hatte. Ich zeigte ihm meinen Diamantring, das schöne Andenken von meiner Großmutter, und war zufrieden, als er mir zehn Pistolen dafür bar ausgezahlt hatte. Nun ließ ich Pferde bestellen, wollte auch einen Bedienten mieten, fand aber keinen, weil sich alle durch die Behandlung, die der Sulpiz erfahren, abschrecken ließen. Während ich selbst einpackte, kam mein Hofmeister und legte stillschweigend meinen Diamantring und einen Beutel mit Geld auf den Tisch. Dann zählte er das Geld auf, und ich fand hundertunddreißig Pistolen vor mir liegen. Ich sah ihn verwundert an. Er lachte und versicherte mir, es sei mein Geld, das ich im Spiel verloren, ich möchte es einstreichen. Die zwanzig Pistolen, welche ich daran vermisse, habe er zur Hälfte angewendet, die von mir verschenkte Ohrfeige einzulösen und den Diamantring, der mehr als das Vierfache wert sei, wiederzuerhalten. Ich fragte beschämt nach dem Zusammenhang, aber er bat mich, erst die Pferde um ein paar Stunden später zu bestellen, ich müsse mich noch ehrenhalber öffentlich zeigen. Nachdem ich die Pferde ein paar Stunden später bestellt, berichtete er mir ausführlich, wie er meinen Verlust durch die beiden Franzosen erfahren, zugleich auch die allgemeine Meinung, daß in dem Hause unehrlich gespielt werde. Zum Glück habe er auf meinem Tisch Karten gefunden, die deutlich gezeichnet gewesen an der Rückseite. Da ich nirgend sonst gespielt, so konnte ich sie nur aus dem Spielhause mitgenommen haben. Mit diesen Karten sei er wie ein Feldherr in ein fremdes Land zu dem Spieler in Begleitung der beiden Franzosen eingedrungen. Die Karten hätten den frechen Kerl in Verlegenheit versetzt, obgleich er am Anfang ihn mit der Forderung ausgelacht habe, ihm den Gewinn zurückzugeben. Er habe die Verlegenheit benutzt, die Franzosen hätten gedacht, die Sache unter ihren Bekannten weiterzuverbreiten, so habe der arglistige Schelm endlich andre Saiten aufgezogen, habe bedauert, daß so oft junge Leute zu ihm an den Spieltisch träten, denen er gern ihr Geld zurückschübe, wenn es sich schicke, und da dies wirklich nach ihrer Versicherung ein junger unmündiger Mensch gewesen, der über sein Geld noch nicht frei disponieren könne, so mache er sich ein Vergnügen daraus, die Kleinigkeit zurückzuzahlen, indem ihm dieses Ereignis zur Warnung dienen könne. Nachdem er ausgezahlt, ließ er Champagner und Pasteten bringen, und so leichtsinnig sind unsre Franzosen, daß sie aus Artigkeit nicht widerstehen konnten, ein Pikett mit ihm anzunehmen. Ich aber hielt mich bei dem Nichtswürdigen nicht länger auf, sondern eilte, nun ich Geld hatte, zum Goldschmied, dessen Name mir aus früheren Verhältnissen sehr bekannt war, obgleich ich ihn nie gesehen, auch aus mancherlei Gründen bei meiner Anwesenheit zu besuchen vermieden hatte. Ich trat ein, als er eben im Begriff war, den Ring zu zerbrechen, um den Wert der Steine durch eine neue Fassung zu erhöhen. Ich griff stillschweigend zu, um diese Zerstörung zu hindern, ich wußte, daß mehrere Familientage in den Ring eingeschnitten waren. Was soll er kosten? fragte ich dann. Hundert Louisdor, antwortete jener. Er ist mein, sagte ich, und zahlte zehn Pistolen auf. Er sah mich verwundert an, und ich sagte ihm, ohne den Ring angesehen zu haben, die Inschrift her, welche darauf stand: Dem Mittelpunkt sind wir Buchstaben alle gleich nahe. Dann nannte ich ihm die ausgezeichneten Buchstaben, welche die Namen der Kinder bezeichneten. Er gestand ein, daß ich den Ring sehr genau zu kennen scheine, aber selbst, wenn er mein gewesen, wenn er mir entwendet sei, könne ich ihn nach Landesgesetzen nicht anders zurückfordern, als wenn ich den Dieb zur öffentlichen Bestrafung überlieferte. – Aber woher wußten Sie, unterbrach ich ihn, daß ich meinen Ring diesem Goldschmied verkauft hatte? – Ich vergaß es Ihnen zu sagen, fuhr er fort, daß der Spieler nach Spitzbubenart, die einander nichts gönnen, wenn sie selbst dabei nichts gewinnen, mir mit der Miene eines Biedermanns anzeigte, daß der Goldschmied an der Ecke die Unwissenheit des jungen Mannes, der meiner Obhut anvertraut, gemißbraucht, ihm einen Diamantring für den zehnten Teil seines Wertes abgekauft habe. Ich sah nun, fuhr er in seiner Erzählung fort, daß der Goldschmied sich nicht so leicht wie der Spieler ergeben würde, und ich mußte schon das äußerste wagen, ihn an ein bedeutendes vorteilhaftes Geschäft zu erinnern, daß ich ihm in früheren Jahren zur Erreichung eigner Vorteile zugewiesen hatte. – So sind Sie wohl gar Herr Chardin, denn niemand anders weiß von dieser Handelsspekulation, als der totgeglaubte Herr Chardin? – Freilich, sagte ich, was ist dabei zu verwundern in einer Zeit, wo sich die Hälfte der Menschen in Frankreich vor der andern Hälfte verkriechen muß. – Behalten Sie den Ring, fuhr er fort, und wählen Sie in meinem Laden, was Ihnen gefällt, ich bin Ihnen viel schuldig bei dem glücklichen Fortgang meines Geschäfts. Mein Gott, wären Sie nur vier Wochen früher hier eingetroffen! – Warum? fragte ich betroffen. Er öffnete ein Nebenzimmer, er fragte mich, ob ich an niemand in dem Augenblick gedächte? – Meine verstorbene Frau fällt mir ein, antwortete ich, doch weiß ich auch warum; damals als ich Ihnen den ersten Brief in Geschäften schrieb, war es auf dem Zimmer meiner Frau. – Unglücklicher, rief er, hier hat sie noch vor wenigen Stunden gewohnt, hier ist sie einem andern vermählt worden, weil Sie für tot gehalten wurden. Kaum weiß ich, ob ich recht tue, ihren Aufenthalt Ihnen anzuzeigen, Ihr gerechter Zorn könnte den beiden edelsten Wesen verderblich werden.
Ich war erschüttert, schweigend gingen wir mit heftigen Schritten auf und nieder. Unerwartet überraschte ich ihn mit der Frage: Können Sie verschweigen, daß ich lebe, so ist uns allen geholfen. – Dieselbe Frage wiederhole ich Ihnen, junger Freund, können Sie mir Ihr Ehrenwort darauf geben? Ich tat es, und er fuhr fort: In demselben Augenblick, als der Goldschmied mir dies Versprechen ablegte, trat meine Frau ein, fast schwindelte mir, mein Plan war vergebens, ihr alle Kenntnis von der unglücklichen Fortdauer meines Lebens zu entziehen. Ich deckte einen Augenblick mein Gesicht, während sie erzählte, daß sie wegen einer vergessenen Kiste, welche sehr wichtige Papiere des Marquis, ihres Mannes, enthielt, auf ihrer Fahrt nach Antwerpen habe umkehren müssen. Sie ergriff das Kistchen, wollte eben mit schnellem Abschied hinaustreten, als sie auf mich blickte, mich erkannte, mir in die Arme sank. Nach langem Kampf mit allen streitenden Gefühlen ward durch die Klugheit des Handelsmanns uns eine treue Erzählung unsrer Ereignisse verordnet. Meine Frau erzählte, es beruhigte sie, ich erkannte ihre Unschuld; um sie zu beruhigen, sagte ich ihr, ich sei auch vermählt. Der Handelsmann riet jetzt, meine Frau solle ihren Weg nach Antwerpen verfolgen, ich sollte ihr nacheilen, dort sei sie niemand bekannt, wir könnten ruhig überlegen, was die Umstände notwendig machten. Wahrscheinlich sah der gute Mann mich schon mit dem Marquis in blutigen Händeln und wollte sein Haus nicht gern dadurch beunruhigen lassen, doch war der Rat gut. Meine Frau ist in ihrem Wagen abgereist, niemand ahnt etwas in Brüssel von dem Vorgang. Wir eilen in ein paar Stunden ihr nach, welche Zeit ich benutzen will, um Ihrem Vater alles anzuzeigen. – Und Sulpiz? fragte ich. – Er folgt uns, wenn er genesen, für ihn soll gesorgt werden. – Ich konnte in diesem Augenblick die Frage nicht unterdrücken, ob er ein Hugenotte sei, wie ich dies aus seinen Klagen über Verfolgung in Frankreich schließen müsse. – Und wenn ich es wäre? antwortete er, und sah mit gespannter Aufmerksamkeit mich an. – So müßte ich dies Geheimnis wenigstens meinem Vater mitteilen, sagte ich. – Er umarmte mich und versicherte mir, dies sei das erste kluge Wort, wie es einem sich bildenden Weltmann gezieme, das aus meinem Munde geboren sei, aber es sei überflüssig, da er aus einem Blatte, welches er mir einhändigte, mir dartun könne, wie mein Vater sehr wohl mit seiner Glaubensansicht bekannt sei. Er ging dann seinen Geschäften nach und überließ mich der Betrachtung bei dieser Erklärung meines Vaters, für mich aufgesetzt, wenn mein Hofmeister mich zum Verständnis fähig glaube. Er berichtete darin, daß diese geheime Lehre aus den Verfolgungen hervorgegangen, welche aus dem offenen Bekenntnis des Glaubens ihre Schrecken über ganze Völker verbreitet hätten. Da hätten dann viele eingesehen, daß diese Welt die Wahrheit nicht verdiene und nicht ertrage, daß die Übermacht immer bei der Lüge sei und daß diese Waffe auch zum Schatz der Wahrheit zu gebrauchen und dem Frommen ein falscher Schein als eine Art Prüfung für dieses Leben zu gestatten sei, insbesondere, da es sich erweisen lasse, daß die verwerflichen Kirchenübungen und Glaubensgeheimnisse der Andersgläubigen, aus einem solchen höheren Standpunkt betrachtet, teils völlig gleichgültig würden, teils eine würdige Bedeutung anzunehmen imstande wären. Er selbst habe auf diesem Wege äußerer Verleugnung seinen protestantischen Glauben in der Mitte von Katholiken unangetastet bewahrt, ja er könne versichern, daß bei weitem der größere Teil der katholischen Geistlichkeit mit ihm übereinstimmend handele und diesem neuen Verhältnis den Namen Glauben der Sakristei beigelegt habe. Am Schlusse ward mir geboten, das Blatt zu zerreißen, weil es ihr Grundsatz sei, nie etwas Schriftliches über ihre Meinungen aufzusetzen.
Das vollbrachte ich, wie es mir geheißen, jedes Wort war mir eingeprägt. Der Hofmeister kam wieder, mir schien keine Zeit vergangen, und ich hatte ein paar Stunden bei dem wunderbaren Blatt geträumt. Die Pferde waren bereit, unsere Sachen aufgepackt, ich vermochte es über mich, Sulpiz um Verzeihung zu bitten, er mußte mir versprechen, nachzukommen. Erst in weiter Entfernung von der Stadt, als wir unsren Pferdeknecht vorausgeschickt hatten, fragte der Hofmeister: Was sagen Sie zu dem Blatt? Ich gestand ihm, daß ich nichts Festes darüber zu denken vermöge, ich hätte es in meinem Gedächtnis aufgenommen wie eine nicht abzuweisende feindliche Einquartierung. Ich hätte noch so wenig Haltung zu dieser Falschheit gegen die Welt, wie zu allen den Rücksichten, welche die gute Gesellschaft fordere. Der Hofmeister fragte weiter, ob ich nicht das Geheimnis eines Freundes bewahren würde, wenn dieser in Gefahr käme, durch weitere Verbreitung dieses Geheimnisses verkannt zu werden. Hätten Sie einen Blick in fremde Papiere getan, fuhr er fort, würden Sie die erlauerten Geheimnisse andern wiedererzählen? – Eine Blässe überzog mich, ein Zittern durchwallte mich, ich stammelte wie ein überraschter Sünder: Nein, nein! – Nun, fuhr der Hofmeister fort, wer ist Ihr wahrster Freund, wer gestattet den Begünstigten zuweilen einen tiefen Blick in seine Geheimnisse? Kann er es wollen, daß diese bessere Erkenntnis rohen Völkern mitgeteilt werde, die nur Mord zur Ausgleichung verschiedener Überzeugungen anzustiften wissen? In unserm Kreise pflanzt sich die Weisheit rein fort, denn sie kommt nicht zu den Unwürdigen. Ich war dieser Überzeugung, noch ehe ich den Kreis Ihres Vaters kannte. Als unter Ludwig XIV. die ersten Zeichen von Verfolgung gegen die Reformierten bemerkt wurden, fand ich es in Paris angemessen, meinen Glauben zu verheimlichen, die Messe zu besuchen und bessere Zeit abzuwarten. Dazu kam, daß ich in der Zeit, als das Edikt von Nantes aufgehoben wurde, den größten Teil meines Geldes katholischen Händen in Frankreich anvertraut hatte. – Als ich ihn bei dieser Veranlassung nach seinem Geschäft, welches er früher getrieben, fragte, antwortete er: Ich hieß in ruhigen Zeiten Chardin, war einst Handwerker und Hofmaann zu gleicher Zeit, nämlich Goldschmied in Lyon und Juwelenhändler in Paris; ich verfertigte, warum die Hohen einander beneiden, was manchmal über ihre Kräfte kostbar war, aber ihre Sehnsucht reizte, weil es ihnen die Gunst der schönsten Frauen zuwandte, und so kam es, daß ich mit vielen Hohen schon wegen der Mitteilung solcher Wünsche in einer Vertraulichkeit stand, wie sie sonst nur dem Rang gewährt wird. Eine gewisse Anlage zur höheren Geselligkeit entwickelte sich unter diesen Umständen sehr schnell, insbesondere, seit ich reich genug war, vielen Schmuck auf Kredit den Vornehmen anzuvertrauen. Ich galt in Paris für einen Katholiken, obgleich ich von anderer Religion war, denn ich besuchte, wie ich gesagt habe, die Messe, noch ehe dies geboten war, und meine Frau, die mir dies leicht hätte verargen können, erfuhr davon nichts bei meiner Heimkehr nach Lyon, wo ich mein Geschäft trieb. Bald werdet Ihr sie sehen und mir aufrichtig versichern können, ob meine Zuneigung mich nicht verblendet, wenn ich sie noch jetzt für eine der schönsten Frauen halte. Ihre feste Gesundheit hatte den Wandel gehemmt, den die Jahre sonst unerbittlich über das Theater der Schönheit hinführen. Wir hatten eine Tochter, die diesen Glanz von ihr geerbt hatte, ohne sie zu verdunkeln. Ihre ruhige treue Seele widerstand ungeachtet der langen Abwesenheit, zu der mich oft mein Geschäft zwang, und bei mancher kleinen Untreue von meiner Seite allem Andrang zahlreicher Verehrer; ihre Klugheit wußte ihnen meist früh genug jede Hoffnung zu nehmen, und diese ist das Öl der Flamme. Nur ein Verehrer, ein junger Dragonerrittmeister, der Marquis G., ließ sich von seinem verliebten Unsinn nicht heilen. Er war liebenswürdig und seine andern Erfahrungen hatten ihn dreist gemacht. Er wagte einen Versuch, meine Frau auf einer Lustfahrt von der Gesellschaft zu trennen, sie zu entführen. Meine Frau entging nur mit Mühe dem Plan und sah sich bei seinen Drohungen genötigt, den Obersten des Regiments um Sicherheit anzusprechen. Dieser war kein Freund des Marquis, er brachte die strengen Befehle des Königs mit Ernst zur Anwendung, der Marquis kam zu seiner Besserung auf unbestimmte Zeit in die Bastille. Unleugbar hatte meine Frau aus Notwehr ihn sehr unglücklich gemacht, er war durch Gunst und Verdienst zu den größten Hoffnungen auf seiner Bahn berechtigt, dennoch schien er kein Gefühl der Rache zu hegen; er war es unleugbar, der ihr auf tausend Wegen, ohne seinen Namen zu nennen, zärtliche Lieder, artige Geschenke aufdrängte. Meine Frau wollte nichts davon annehmen, aber ich befreite sie bei meiner Ankunft von dieser Prüderie, indem ich mich lachend der Gaben bemächtigte, die Bänder unter meine goldenen Ketten legte, die Dragees in den Mund steckte, die Lieder aber einer Dame bei Hofe schickte, der ich aus Rücksicht selbst den Hof machte, die eingemachten Früchte der Tochter für ihre Spielküche verehrte. Solch eine Liebschaft kam mir damals vor wie ein Puppenspiel, das ich nicht ernsthaft nehmen konnte; ich sah mein Geschick manchmal an die glückliche Ankunft einer Kiste mit Diamanten geknüpft, die Treue meiner Frau bewunderte ich, obgleich ihre Untreue mich auch nicht gekränkt haben würde. In so heiterer Laune überraschte mich das harte Gesetz des Königs, ich sah meine Frau unerschütterlich, nicht die Messe besuchen zu wollen, und sah mich dadurch gezwungen, von Lyon, wo wir als Hugenotten bekannt waren, nach Metz zu ziehen, wo ich mich einstweilen unter anderm Namen für einen wandernden Doktor ausgab, und mich durch Ankauf eines Hauses, das dem Bürgermeister gehörte, diesem beliebt machte. Das schützte uns längere Zeit, ich bewirtete alle Leute von Ansehen, und diese schienen gar nicht zu beachten, daß meine Frau die Messe nicht besuche. Aber noch ein Umstand war mir höchst günstig: eben der Marquis, der durch meine Fraiu in die Bastille gekommen, war nach einem Jahr daraus entlassen und dort als Kommandant über die Dragoner eingerückt, die zur Bekehrung der Reformierten ausgeschickt worden. Er hatte meine Frau sehr bald auch unter dem fremden Namen erkannt und unser Unglück erraten, aber seine Großmut wußte seine Liebe zu beschwichtigen, er schien meine Frau nicht zu kennen, und wies die Anzeigen der Religionsspione mit dem angenommenen Einwand zurück, als ob er meine Frau selbst sehr andächtig in der Messe gesehen. Während nun die Häuser unsrer Glaubensgenossen verwüstet wurden, hatte ich Zeit, meine Forderungen einzuziehen und mein Geld nach Holland zu schicken. Ruhig trat ich meine letzte Reise nach Paris an, die letzten Kapitalien einzukassieren, um dann in Holland oder in Berlin bei dem Großen Kurfürsten ein neues Geschäft anzuknüpfen und mit freier Religionsübung meine Frau zu erfreuen. Aber der Neid der unglücklichen Glaubensgenossen war mir inzwischen gefährlicher geworden als der Haß meiner Glaubensfeinde; sie hatten ihren Ärger nicht verbeißen können, daß ich mit den Meinen in Wohlleben ungestört bestanden, sie rechtfertigten ihren Ärger, indem sie mich als einen Angeber ausschrien, der bloß verreise, um zu verraten, was noch an Vermögen der Reformierten verborgen geblieben. So kam die Nachricht, daß ich ein heimlicher Hugenotte sei, an den Intendanten der Provinz, durch diesen, der keinen Scherz in solchen Sachen verstand, an den Gouverneur, und dieser schrieb dem Marquis, daß er den König benachrichtigen werde, wenn ich mich nicht bis zum nächsten Posttag im guten oder bösen zum Katholizismus bekannt hätte. Das war zu meinem Verderben hinlänglich, an Untersuchung war nicht zu denken in jener Zeit, die Gewalt eilte voraus, und die von Gott sichtbar begünstigten kleinen Haufen der Cevennen erschütterten allein in Strömen von Blut, die sie vergossen, das Gebäude des Religionsfrevels, welches über Frankreich lastete. Der Marquis kam eines Abends verkleidet zu meiner Frau, zeigte ihr den Befehl des Gouverneurs, fragte, ob sie in Güte sich zum katholischen Glauben bekennen würde, und als sie es mit den heiligsten Schwüren ablehnte, so ergriff ihn innige Verzweiflung, er schwor, daß er ihr nicht zu helfen wisse, er müsse das Haus am ändern Tage seinen Dragonern überlassen. Meine Frau sagte ihm, er möge handeln, wie ihm befohlen, sie erkenne die lange Schonung, die sie ihm danke, sie bedaure ihn, daß er ein Werkzeug ihrer Glaubensfeinde sei. Am andern Morgen, ehe noch jemand im Hause aufgestanden, ließ der Brigadier der Dragoner, weil ihm beim ersten Anpochen nicht gleich aufgemacht war, die Haustür mit einem Stück Holz einrennen, das zufällig angefahren ward. Die erwachten Mägde traten den Eindringenden nicht entgegen, sondern flüchteten sich fort über den Gartenzaun. Als meine Frau herunterkam, fand sie die Dragoner, wie sie ihre Pferde im Gesellschaftssaal fütterten; das eine Pferd hatte schon einen Aufsatztisch mit schönem Porzellan umgeworfen, die Dragoner putzten ihre Stiefel auf den seidnen Stühlen mit den Vorhängen von Damast ab, denn die Straßen waren an dem Tage sehr unrein. Welch ein Schrecken für eine Hausfrau; die ihre Sachen immer in schönster Ordnung zu erhalten gewohnt war, was hatte sie selbst von so unholden Gästen zu fürchten! Aber es schien doch, als ob der Marquis in Hinsicht ihrer persönlichen Behandlung dem Brigadier einen Wink gegeben, denn, obgleich er sie dringend aufforderte, das Geläute der Messe zu beachten, das eben erschallte, und ihr zuschwor, daß er sogleich ihr Haus räumen würde, wenn sie mit ihm zur Messe und Beichte gehen wolle, dennoch ließ er es bei Drohungen bewenden, als sie den Vorschlag ablehnte, schützte sie vielmehr gegen die Zudringlichkeit der Kameraden. Aber sie wußte aus den Erfahrungen andrer, wie wenig auf diese Großmut zu zählen, und fürchtete besonders für unsre Tochter, die dem einen dieser boshaften gestiefelten Bekehrer in die Augen zu stechen schien. Eine treue Magd übernahm es, sie mit einem sicheren Fuhrmann zu mir nach Paris zu bringen, und diese Abfahrt wurde unter tausend Tränen noch am Abend des Tages zustande gebracht. Schon am folgenden Tage ward diese Entfernung dem Intendanten berichtet, er kam selbst in das Haus um sich von der Wahrheit zu überzeugen, tobte dann wie ein Rasender gegen meine Frau und gab alles den Dragonern preis. Wenig Menschliches hatten sie in so schändlichen Bekehrungsversuchen bewährt, dies wenige nahm der Rausch meiner guten Weine hinweg. Sie zerhieben mit ihren Säbeln meine teuer mit dem Hause erkauften gewirkten Tapeten, um sich daraus Pferdedecken zu schneiden. Bald aber putzten sie sich damit aus wie in Meßgewändern, schmückten den Schenktisch wie einen Altar und befahlen meiner Frau, davor niederzuknien, sie sei Witwe, ich sei in Paris umgebracht, und sie müsse einen von ihnen heiraten. So wenig Glauben sie der Nachricht schenkte, so sah sie doch auch wenig Möglichkeit zur Rettung aus diesem Kreise von Bekehrern. Zum Glück fiel ihr ein, daß keine Ringe vorhanden, sie wolle gehen, diese zu holen, weil sonst ihr Wort keinen Glauben habe. Das schien ihnen einzuleuchten, sie sprang zur Tür hinaus, durch eine Seitentür auf die Straße und in einem Lauf zum Marquis. Erst wollte sie der Bediente nicht einlassen, weil der Marquis schon zu Bett, doch besann er sich, als er ihre Schönheit beleuchtet hatte und führte sie zur angenehmen Überraschung in das Schlafzimmer seines Herrn, wo dieser im ersten Schlaf lag, ohne von dem Geräusch der Eintretenden erweckt zu werden. Die Tür wurde hinter ihr zugeschlossen, und die arme Frau fand sich in der Verlegenheit, entweder den Schläfer zu erwecken und dadurch vielleicht neuen Andrang sich zuzuziehen oder bis zum Morgen auszuharren, wo bei aller Unschuld ihr Ruf für immer verloren sein könnte. Zweifelhaft, wozu sie sich entschließen soll, halb ohnmächtig läßt sie sich auf einen Ruhesessel nieder, neben welchem ein Tisch mit Papieren und eine brennende Lampe stand. Der Marquis hatte wahrscheinlich noch spät darin gelesen, ehe er sich ins Bett geworfen. Wie nun einmal weibliche Augen sind, sie schauen auch im Unglück nach etwas sich um, das sie zerstreuen kann. So las sie, fast ohne es zu wollen, einen Erguß süßer Zärtlichkeit, den der Abend dem Marquis entlockt hatte. Sie wußte mir nur noch die ersten Worte zu sagen:
Du jammerst, du Geliebte, Und kennst noch nicht dein Leiden,
denn bei den nächsten Zeilen durchfuhr sie die schreckliche Nachricht, daß jene Rede des Dragoners, als sei ich gestorben, nicht etwa ein boshafter Scherz der Trunkenheit gewesen, sondern eine von dem Marquis voll Überzeugung aufgenommene Gewißheit. Der Ausbruch ihres Schmerzes löste jede Rücksicht auf den Ort, wo sie sich befand, meine arme Frau schrie auf, dann erstickten Tränen ihre Stimme. Der Marquis, aus tiefem ersten Schlaf erweckt, sprang aus dem Bett, griff nach einer Pistole, so taumelte er zu ihr hin und ließ die Pistole wieder, fast erstarrend, sinken, indem er ein weibliches Wesen und in diesem seine Geliebte erkannte. Töten Sie mich, rief sie, aber sagen Sie mir, lebt mein Mann? – Der Marquis hatte sich gefaßt, er zögerte, aber sie drang auf Entscheidung. Er reichte ihr den eingegangenen Brief aus Paris, vom Chef der Polizei, welcher nähere Nachricht forderte von der Familie eines in Paris wahrscheinlich ermordeten Juwelenhändlers Chardin, der nach eingegangener Nachricht von Lyon nach Metz gezogen sei; er habe bedeutende Zahlungen in Empfang genommen und sei dann verschwunden, ohne Nachricht zu hinterlassen, nachdem er am Morgen noch sehr heiter gefrühstückt und sich zu einer Abendgesellschaft eingeladen hätte. Es wurde große Sorgfalt empfohlen, da mehrere Prinzen, sogar die Frau von Maintenon, die größte Teilnahme für den Mann bezeugten, auch die Ausstattung für ein Kloster übernehmen wollten, insofern er die Seinen hilfsbedürftig zurückgelassen habe. Ich will hier meiner guten Frau Zeit zum Weinen lassen, unterbrach sich der Hofmeister, und dem Marquis, sich anständig anzukleiden, um Ihnen zwischendurch die Veranlassung dieses Gerüchtes zu erklären. Ein Freund, der auch zu den versteckten Bekennern meines Glaubens gehörte, warnte mich unerwartet, daß der Chef der Polizei Nachforschungen über mich anstelle, vielleicht bloß wegen der Gunst, worin ich bei Hofe stehe, vielleicht aber auch aus Ungunst derer, denen ich meine Gelder in der letzten Zeit etwas streng abgefordert hätte. Ich dankte dem Freund und benutzte augenblicklich den Wink, ließ die kleineren Forderungen in Stich, die Hauptsummen waren eingegangen, und machte meine Reise zu Fuß von Paris aus, ohne alle Begleitung, um jedem Verrat zu entgehen. Aber zufällige Verwundung eines Fußes hielt mich in einem elenden Wirtshaus zurück, von wo aus mir jede sichere Gelegenheit fehlte, meiner Frau Nachricht zu senden. Wie konnte ich alle Gefahren ahnen, die sich über meinem Hause gewitterhaft zusammengezogen hatten! Als ich ausreiste, waren wir von der ganzen Stadt geehrt, von den Vornehmsten wegen unsres Aufwandes gesucht, aber welche Güter bestehen, wo das einzige fehlt, das allein die Dauer und den Wert verleiht, die Freiheit des Glaubens und der Gesetze? Zwar ergriff mich in jener Nacht eine seltsame Bangigkeit, aber ich dachte nur der Gefahr, die mich bedrohte, wenn ich erkannt würde, und in diesem Sinn schrieb ich mir, als ich aus dem Wirtshaus fortschlich, folgende Reime auf, wie ich deren gar viele in müßigen Stunden verfaßt habe.
An Madame Chardin. Wer wacht in dieser hellen Nacht Und ringt um mich die Hände, Und reißt mich aus des Schlafes Macht? Ich seh' nur weiße Wände, Die rings der Mondenglanz bescheint, Am Fenster manches Tröpfchen weint; Gern küßte ich die Tränen auf, Ich eil' zu dir im raschen Lauf.
Wie eisig kalt ist diese Nacht, Nach solchem warmem Tage! Wer hat die Wärme angefacht? Wer bringt der Kälte Plage? Doch Dank sei ihr, sie treibt mich fort, Bald wärmet mich dein erstes Wort, Bald wärmet mich dein Händedruck, Und deiner Lippen roter Schmuck.
So schleich' ich wie ein Nachtdieb hin, Und geh' auf rechten Wegen, Die Treue ist mir kein Gewinn, Der Glauben gibt nicht Segen, Und selbst der Reichtum mich nur quält Im armen Land, dem Freiheit fehlt; Die Liebe einzig lohnet mir, Was ich durch Tugend hier verlier'.