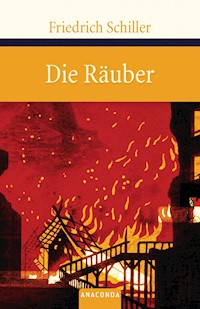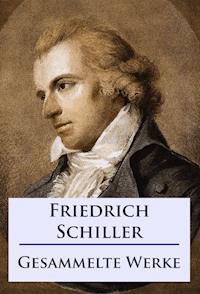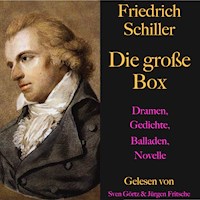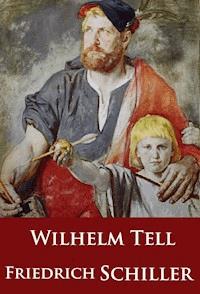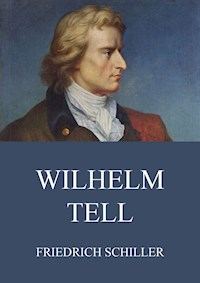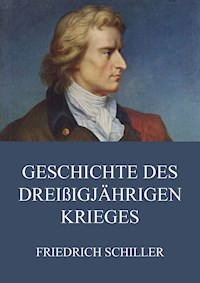
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im 18. Jahrhundert beschäftigte sich Friedrich Schiller als Historiker und Dramatiker mit dem Krieg. 1792 veröffentlichte er eine "Geschichte des Dreißigjährigen Krieges". Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war ein Konflikt um die Hegemonie in Deutschland und Europa und zugleich ein Religionskrieg. In ihm entluden sich sowohl die Gegensätze zwischen der Katholischen Liga mit den kaiserlichen Truppen und der Protestantischen Union innerhalb des Heiligen Römischen Reiches als auch der habsburgisch-französische Gegensatz auf europäischer Ebene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichte des dreißigjährigen Kriegs
Friedrich Schiller
Inhalt:
Friedrich von Schiller – Biografie und Bibliografie
Geschichte des dreißigjährigen Kriegs
Erster Theil
Erstes Buch.
Zweites Buch.
Zweiter Theil.
Drittes Buch.
Viertes Buch.
Fünftes Buch.
Geschichte des dreißigjährigen Kriegs , F. Schiller
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849635039
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich von Schiller – Biografie und Bibliografie
Der populärste und gefeiertste deutsche Dichter, geb. 10. Nov. 1759 in Marbach am Neckar, gest. 9. Mai 1805 in Weimar. Sein Großvater Johannes S. lebte in dem bei Waiblingen gelegenen Dorfe Bittenfeld als Bäcker und Schultheiß, sein Vater, Johann Kaspar (1723–1796), nahm, noch Jüngling, als Feldscher in bayrischen Diensten am Österreichischen Erbfolgekrieg teil und ließ sich dann 1749, nach dem Frieden heimgekehrt, in Marbach als Wundarzt nieder. Hier heiratete er im Juli d. J. die Tochter des Bäckers und Löwenwirts Kodweis, Elisabeth Dorothea (1732–1802; vgl. E. Müller, Schillers Mutter, Leipz. 1894). Schillers Vater (vgl. Brosin, Schillers Vater, Leipz. 1879) war eine aufstrebende Willensnatur, tief religiös, von unantastbarem Charakter, rastlos tätig. Die Dürftigkeit seines Einkommens ließ den Chirurgus S. 1757 wieder Kriegsdienste nehmen und als württembergischer Fähnrich gegen den großen Preußenkönig nach Schlesien mitziehen. Während er, nach der Heimkehr 1759 zum Leutnant befördert, nahe bei Kannstatt im Übungslager stand, schenkte ihm seine Gattin im Hause ihrer Eltern zu Marbach den ersten und einzigen Sohn, unsern Dichter. Der Militärdienst des Vaters führte die Familie während der nächsten Jahre an verschiedene Orte, endlich 1763 nach Lorch. Hier erhielt der Knabe bei dem Ortspfarrer Moser (dem ein Erinnerungszeichen in den »Räubern« gilt) den ersten regelmäßigen Unterricht. Ende 1766 wurde der Vater zur Garnison nach Ludwigsburg berufen, wo unser Dichter die Lateinschule besuchte, bis ihn der Herzog zu Anfang 1773 als Zögling in seine mit einer Abteilung für künftige Zivildiener verbundene militärische Pflanzschule auf der Solitüde kommandierte, die, noch 1773 zu einer herzoglichen Militärakademie erweitert, 1775 nach Stuttgart verlegt und Ende 1781, nach Schillers Austritt, als »Hohe Karlsschule« (s. Karlsschule) zu einer Art Universität erhoben wurde. S. hegte ursprünglich den Plan, Theologie zu studieren, mußte ihn aber nach seinem Eintritt in die Akademie aufgeben und entschied sich für die Rechtswissenschaft, später für die Medizin. Daß der in beschränkten Verhältnissen geborne Knabe eine freie Weltbildung erwarb, war wesentlich der halb militärischen, halb wissenschaftlichen Lieblingsanstalt des Herzogs zu danken. Unter den Lehrern befanden sich mehrere begabte und anregende, in die Gedankenwelt der Jugend liebevoll eingehende Männer, wie z. B. der von S. hochverehrte J. F. v. Abel (vgl. Aders, J. F. Abel als Philosoph, Berl. 1893); daß an der Anstalt die philosophischen Disziplinen gegenüber den klassisch-philologischen entschieden bevorzugt wurden, war ein Umstand, dessen Folgen in der weitern Entwickelung Schillers noch lange nachwirkten. Die kasernenartige Disziplin mit allen ihren Kleinlichkeiten konnte freilich bei Naturen wie S. nur den ungestümen Freiheitsdrang fördern. Schillers Neigung zur Poesie war zunächst durch Klopstocks »Messias« genährt worden. Tiefer und unmittelbarer wirkten die dramatischen Produkte der Sturm- und Drangperiode auf ihn ein; Leisewitz' »Julius von Tarent«, Klingers Erstlingsdramen und Goethes »Götz« regten ihn zur Nacheiferung an. Den stärksten Einfluß auf Schillers Richtung und Bildung gewannen aber Plutarch und J. J. Rousseau: ob er schon damals Schriften Rousseaus gelesen hat, ist ungewiß; aber mit dessen Grundanschauungen wurde er vertraut, und sie erweckten seinen ungestümen Freiheitsdrang (vgl. Johannes Schmidt, S. und Rousseau, Berl. 1876). Seit 1776 erschienen im »Schwäbischen Magazin« einzelne Proben seiner Lyrik. 1777–78 begann die Ausarbeitung seines Trauerspiels: » Die Räuber«. Um den literarischen Bestrebungen freier huldigen zu können, ersehnte S. seine alsbaldige Entlassung aus der Militärakademie. Aber die 1779 eingereichte Abhandlung »Philosophie der Physiologie« wurde um ihres »zu vielen Feuers« willen vom Herzog abgelehnt; erst im Dezember 1780 erreichte S. auf Grund seiner Abhandlung »Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen« (Stuttg. 1780) das ersehnte Ziel. Er wurde zum Medikus ohne Portepee beim Grenadierregiment des Generals Auge mit 18 Gulden Monatsgage ernannt und erfuhr damit, da Herzog Karl eine gute Versorgung in Aussicht gestellt hatte, eine neue Enttäuschung. Von Dichtungen entstanden in dieser Zeit hauptsächlich noch die überschwenglichen Oden »An Laura«, zu denen eine Stuttgarter Hauptmannswitwe, Frau Vischer, den ersten Anlaß gegeben haben mag. Es herrscht in ihnen wie in fast allen Jugenddichtungen Schillers jene ungeläuterte Kraftgenialität, die am gewaltigsten in den »Räubern« zum Ausbruch kam. Seit Goethes »Götz« und »Werther« hatte kein dichterisches Erzeugnis solchen Eindruck auf die Zeitgenossen gemacht. Ganz von Rousseauschen Ideen erfüllt, hinreißend durch die Wucht dramatischen Lebens, erzielte das Werk bei der ersten Aufführung, die im Januar 1782 auf der Mannheimer Hof- und Nationalbühne mit Iffland in der Rolle des Franz Moor stattfand, auch in der von dem Intendanten H. v. Dalberg beeinflußten, manche Verschlechterung aufweisenden Bühnenbearbeitung Schillers einen großartigen Erfolg. Beglückt hierdurch, widmete sich der Dichter bald der Vollendung seiner zweiten Tragödie: »Die Verschwörung des Fiesco zu Genua«. Gleichzeitig gab er aus Opposition gegen F. G. Stäudlins »Schwäbischen Musenalmanach« eine »Anthologie auf das Jahr 1782« heraus, die zum größten Teil Dichtungen von ihm selbst darbot.
Aber während seine literarische Tätigkeit in diesem Aufschwung begriffen war, zogen schwere Wetter über S. heraus. Im Mai hatte er einer Wiederholung der »Räuber« mit Frau v. Wolzogen, der Mutter zweier ihm befreundeten Karlsschüler, beigewohnt und war deshalb heimlich nach Mannheim gereist. Diese Reise und der Umstand, daß eine Stelle in den »Räubern« in Graubünden Anstoß erregt hatte, zogen ihm außer einer Arreststrafe (während deren Abbüßung er »Kabale und Liebe« konzipierte) das Verbot des Herzogs zu, fernerhin »Komödien« oder sonst dergleichen zu schreiben. Das gab den Anstoß zu dem Plan Schillers, sich durch die Flucht dem Druck des heimischen Despotismus zu entziehen. In der Nacht vom 22. zum 23. Sept. 1782, während die ganze Bevölkerung durch ein glänzendes Hoffest in Anspruch genommen war, verließ der Dichter in Begleitung seines treuen Freundes, des Musikers Andreas Streicher, Stuttgart, am 24. traf er in Mannheim ein (vgl. A. Streicher), Schillers Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim von 1782–1785, Stuttg. 1836; Neudrucke von Hans Hofmann, Berl. 1905, in Landsbergs »Museum«, das. 1905, und in Reclams Universal-Bibliothek). Er brachte den »Fiesco« fast vollendet mit, der aber bei den Mannheimer Theaterleitern zunächst wenig Beifall fand. Auch fühlte sich S. in Mannheim nicht sicher genug; Ende September wanderte er daher mit Streicher weiter nach Frankfurt, dann nahmen die Freunde im Dorf Oggersheim bei Mannheim in armseliger Wirtsstube Wohnung und hausten dort sieben entbehrungsreiche Wochen hindurch, während deren größere Bruchstücke des bürgerlichen Trauerspiels »Luise Millerin« (später »Kabale und Liebe« betitelt) ausgeführt und der »Fiesco« umgearbeitet wurde, ohne aber auch jetzt zur Ausführung angenommen zu werden. Anfang Dezember öffnete sich dem Dichter ein besserer Zufluchtsort. Einer schon in Stuttgart an ihn ergangenen Einladung der Frau v. Wolzogen folgend, begab er sich auf deren Gut Bauerbach bei Meiningen. »Fiesco« war inzwischen von dem Mannheimer Buchhändler Schwan in Verlag genommen worden und erschien alsbald (1783). Der Plan dieses Werkes, dessen Stoff dem Dichter durch eine Empfehlung Rousseaus anziehend geworden war, hatte während der Ausarbeitung erhebliche Veränderungen erfahren: aus einem republikanischen Freiheitsdrama war ein »Gemälde des wirkenden und gestürzten Ehrgeizes« geworden, eine Schöpfung ungleichen Wertes, in der Charakterzeichnung teils sehr gelungen (Fiesco, Mohr), teils verfehlt, im Aufbau anfechtbar, in der Sprache oft kraftvoll, oft bombastisch. In der winterlichen Stille des Bauerbacher Aufenthalts, wo S. von Liebe zu Charlotte v. Wolzogen, der Tochter seiner Gönnerin, ergriffen wurde, gelang ihm die Vollendung der »Luise Millerin«, und im März 1783 entwarf er den »Don Carlos«. Der freundschaftliche Verkehr mit dem Meininger Bibliothekar Reinwald, der später Schillers Schwester Christophine heiratete, brachte dem Dichter Unterhaltung und Förderung in seine oft beklemmende Einsamkeit. Im Juli 1783 kehrte er nach Mannheim zurück, wo er im August von dem Intendanten Dalberg, der sich jetzt wieder entgegenkommend zeigte, zum Theaterdichter für die dortige Bühne engagiert wurde. Im April 1784 ging »Kabale und Liebe« zuerst über die Mannheimer Bretter und fand begeisterten Beifall. In diesem Stück hatte S. die vollendetste seiner Jugendtragödien, das höchste Meisterwerk in der neuen Gattung des bürgerlichen Trauerspiels geschaffen. Es stellte Zustände der traurigsten damaligen Wirklichkeit dar mit gelegentlich greller Zeichnung, aber doch mit echt poetischer Leidenschaft und Kraft der Charakteristik. Der Erfolg hob Schillers Lebensmut, ohne den materiellen Bedrängnissen des auch von Krankheit oft heimgesuchten Dichters ein Ende zu bereiten. Erfreulich war ihm die Aufnahme in die vom Kurfürsten protegierte Kurpfälzische Deutsche Gesellschaft (Februar 1784), in der er sich (26. Juni) durch den Vortrag seiner noch ganz in moralisierenden Anschauungen befangenen Abhandlung: »Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet«, einführte. Inzwischen war S. an die Ausarbeitung des »Don Carlos« gegangen, wobei er sich zum erstenmal im Drama des fünffüßigen Jambus bediente (vgl. Zarncke, Über den fünffüßigen Jambus etc., in den »Goethe-Schriften«, Leipz. 1897). Den ersten Akt des Werkes, von dem S. größere Bruchstücke in seiner Zeitschrift »Rheinische Thalia« (später einfach »Thalia«, zuletzt »Neue Thalia«) veröffentlichte, las er Weihnachten 1784 am Darmstädter Hof in Gegenwart des Herzogs Karl August von Weimar vor, der ihm darauf den Titel eines herzoglichen Rates verlieh. Nur langsam gedieh die Fortsetzung des Dramas, besonders auch infolge der leidenschaftlichen Wirren, in die S. durch die Liebe zu Charlotte v. Kalb geriet; hiervon legen die Gedichte »Freigeisterei der Leidenschaft« und »Resignation« interessantes Zeugnis ab. Dazu kam drückende Geldnot. Aber auch Unannehmlichkeiten mit den Schauspielern und dem Intendanten verleideten ihm den Aufenthalt in Mannheim, so daß S. gern der Einladung mehrerer Verehrer (die ihm schon im Juni 1784 Beweise ihrer hingebenden Bewunderung gegeben hatten), nach Leipzig zu kommen, folgte. Ende April traf S. dort ein, wo die Schwestern Minna und Dora Stock sowie deren Verlobte Ferd. Huber und später Gottfried Körner, die Seele dieses ideal gesinnten Kreises, ihm mit feinsinnigem Verständnis entgegenkamen und Körner ihm Befreiung von seiner materiellen Not bereitete. Nach Monaten voll enthusiastischen Glückes, während deren S. in dem nahe bei Leipzig gelegenen Dorfe Gohlis wohnte, folgte er dem neuvermählten Freunde Körner im September nach Dresden, wo er das Lied »An die Freude« schrieb und den »Don Carlos« langsam zum Abschluß brachte. Diese Dichtung, deren Plan während der Ausarbeitung wesentliche Veränderungen erfahren hatte (vgl. Elster, Zur Entstehungsgeschichte des »Don Carlos«, Halle 1889), offenbarte des Dichters pathetisches Freiheitsgefühl in hinreißender Vollendung und enthielt in der Schilderung von Liebe und Freundschaft eine Reihe ergreifender Szenen, die das früher von S. Geleistete wesentlich übertrafen; doch die Einheit der Handlung war während der langen Entstehung verloren gegangen. In den Erzählungen »Der Verbrecher aus Infamie« (später »Der Verbrecher aus verlorner Ehre«) und »Der Geisterseher« (gedruckt 1789; vgl. A. v. Hanstein, Wie entstand Schillers »Geisterseher«?, Berl. 1903) bewies S., daß ihm auch die Gabe des Erzählers keineswegs abging, und in den durch die Gespräche mit Körner angeregten »Briefen des Julius an Raphael« setzte er die philosophischen Erörterungen seiner akademischen Jahre mit größerm Erfolg fort. Während des Dresdener Aufenthalts wurde der Dichter abermals in ein leidenschaftliches Herzensverhältnis gezogen, aus dem er sich nur unter schweren Kämpfen befreite. Ein Fräulein Henriette v. Arnim hatte ihn in ihre Fesseln geschlagen. Im Juli 1787 riß S. sich von Dresden los. Eine Aufforderung Schröders, sein Talent für dessen Bühne zu verwerten und nach Hamburg zu kommen, lehnte er ab; Frau v. Kalb wünschte ihn in Weimar zu sehen, wohin ihn noch andre Interessen zogen.
So langte S. im Juli 1787 in der Musenstadt an, wo er achtungsvolle Aufnahme fand und die herzlichen Beziehungen zu Charlotte v. Kalb erneuerte. Ende 1787 besuchte er in Rudolstadt die Witwe des Oberjägermeisters v. Lengefeld, die er nebst ihren geistvollen und liebenswürdigen Töchtern Karoline und Lotte bereits 1784 in Mannheim flüchtig gesprochen hatte. Im Mai 1788 siedelte er in das nahe bei Rudolstadt gelegene Dorf Volkstedt über; am 9. Sept. lernte er im Lengefeldschen Hause Goethe kennen, zu dem sich aber einstweilen noch kein näheres Verhältnis herausbildete. Inzwischen hatte S. die »Geschichte des Abfalls der Niederlande« auszuarbeiten begonnen, deren erster und einziger Teil 1788 erschien, eine Schrift, die bei unzulänglicher Quellenkritik doch überall die geistvolle Auffassung und Darstellung des Dichters verrät. Daneben entstanden mehrere Gedichte, so im März 1788 »Die Götter Griechenlands«, jene berühmte Klage um die heimgegangene »Religion der Schönheit«, deren elegische Wahrheit die Polemik F. Leop. v. Stolbergs nicht aufzuheben vermochte; und durch die Lektüre Homers und die Übertragung Euripideischer Stücke versuchte S., das Griechentum sich trotz mangelnder Sprachkenntnis näherzubringen. Im November kehrte er nach Weimar zurück. Sein Herz jedoch blieb in Rudolstadt, wo er den Schwestern Karoline v. Beulwitz (die in ihrer Ehe nicht glücklich war) und Lotte v. Lengefeld gleich lebhafte Neigung widmete.
Im Dezember erhielt er durch Goethes Vermittelung einen Ruf als außerordentlicher (zunächst unbesoldeter) Professor der Geschichte nach Jena, dem er trotz einiger Bedenken gern folgte. Nachdem er im Winter sein inhaltreiches Gedicht »Die Künstler« unter Wielands Anteil und nach mannigfaltigen Änderungsvorschlägen Wielands langsam abgeschlossen hatte, trat er sein Lehramt im Mai mit der Vorlesung »Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?« an und wurde von der Studentenschaft mit Jubel begrüßt. S., der im ganzen nur fünf Semester Vorlesungen gehalten hat, übte auch als Dozent auf einen engern Kreis von Zuhörern, unter denen Friedrich v. Hardenberg (Novalis) besonders genannt sei, einen starken Eindruck aus. Seit 1790 gab er eine Sammlung historischer Memoiren heraus und bald, 1791–93, trat er in Göschens »Historischem Damenkalender« mit einer neuen, umfangreichen Arbeit, der »Geschichte des Dreißigjährigen Krieges«, hervor, in der namentlich die ausgezeichneten Charakterbilder Wallensteins und Gustav Adolfs neben der durchweg fesselnden Darstellung zu rühmen sind. Im Juli 1789 hatte sich das Verhältnis des Dichters zu Lotte v. Lengefeld zum völligen Herzensbund gestaltet, und nachdem der Herzog Karl August zu Ende des Jahres einen kleinen Jahresgehalt (von 200 Tlr.) bewilligt hatte, schritten die beiden 22. Febr. 1790 in dem Dorfe Wenigenjena bei Jena vor den Altar. Das reiche, wenn auch durch fast erdrückende Arbeitslasten etwas beeinträchtigte Glück, das S. an Lottens Seite fand, erfuhr aber schon nach wenigen Monaten durch die schwere Erkrankung Schillers eine tiefgreifende Störung. Ein Brustleiden, von dem sich S. niemals wieder ganz erholen sollte, kam Anfang Januar im Hause des Koadjutors Karl v. Dalberg in Erfurt in einem Besorgnis erregenden Anfall zum Ausbruch, ein Rückfall im Mai ließ das Schlimmste befürchten, auch eine Erholungsreise nach Karlsbad, die S. im Sommer antrat, brachte keine Genesung; und besonders bedrückend für den leidenden Dichter war es, daß er, aller Erwerbsmittel beraubt, dem grauen Gespenst der Not entgegensah. In dieser Lage kam unerwartete Hilfe aus weiter Ferne. Ein eifriger Verehrer Schillers, der dänische Dichter Jens Baggesen, hatte auf die falsche Nachricht von Schillers Tod in Hellebeck auf Seeland eine empfindsame Gedächtnisfeier veranstaltet; als er erfuhr, daß S. noch lebe, aber unter materieller Bedrängnis schwer leide, veranlaßte er zwei hochgestellte Teilnehmer jener Feier, den Grafen Ernst Heinrich v. Schimmelmann (geb. 1747, seit 1784 dänischer Finanzminister) und den Prinzen Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Augustenburg (geb. 1765, Schwiegersohn des Königs, seit 1790 Leiter des Unterrichtswesens in Dänemark), den gefühlvollen Worten die edle Tat folgen zu lassen und dem großen Dichter über seine Not hinwegzuhelfen. Sie taten es, indem sie S. in der denkbar zartesten Form, ohne irgendeine Gegenforderung und allein von reinster Menschenliebe getrieben, für drei Jahre eine jährliche Unterstützung von 1000 Tlr. (3600 Mk.) anzunehmen baten. S. griff bewegten Herzens zu, und unabsehbar reich war der Segen jener Gabe. Denn sie setzte den Dichter instand, seinem Genius in stiller Sammlung die Klärung und Bereicherung zuteil werden zu lassen, an der ihn die Hast des Gelderwerbes behindert hätte: er vertiefte sich in die Kantsche Philosophie, durch die seine Weltanschauung und seine Kunstübung eine wesentliche Umgestaltung erfuhr und erst zu jener Höhe emporstieg, die wir in den nun bald folgenden Meisterwerken Schillers bewundern. Vor allem den ästhetischen Problemen zugewandt, legte er die Ergebnisse seines Nachdenkens in einer Reihe gehaltvoller Abhandlungen nieder, die einen dauernden Gewinn der Kunstlehre bedeuten. Auf die noch sehr anfechtbaren Aufsätze »Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen« und »Über die tragische Kunst«, die er 1792 in der »Thalia« veröffentlichte, folgten interessante, aber in der Hauptsache gleichfalls noch mißlungene Versuche, die von Kant gegebene subjektive Grundlegung des Schönen durch eine Charakteristik des ästhetischen Objekts zu ergänzen; sie sollten in einer unvollendet gebliebenen Schrift »Kallias« genauere Erörterung finden, für die uns die ausführlichen Briefe an Körner vom Februar 1793 Ersatz bieten dürften. Schön sind nach S. die Objekte des Lebens dann, wenn sie, in Analogie zu dem transzendentalen Freiheitsbegriff der Kantschen Lehre, auf freier Selbstbestimmung zu beruhen scheinen, wenn sie also, obwohl der Erscheinungswelt angehörend, an jener transzendentalen Freiheit teilnehmen, kurz: schön ist nach S. die Freiheit in der Erscheinung. Über diese keineswegs einwandfreie Formel hinaus gelangte S. in der Abhandlung »Über Anmut und Würde« (1793), in der er eine wertvolle Kennzeichnung zweier ästhetischer Lebensbegriffe gibt: er erblickt die Anmut dort, wo sich Neigung und Pflichtgebot in der Seele zu vollkommener Harmonie zusammengefunden haben, Würde dagegen in dem Sieg der Vernunft über die sinnliche Regung. Sein Bestes bot er aber in der Schrift »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«, die aus Briefen, die S. an den Herzog von Augustenburg richtete, hervorgegangen sind (die Originale sind durch eine Feuersbrunst verloren gegangen, eine Abschrift wurde von Michelsen, Berl. 1876, veröffentlicht; vgl. Breul, Die ursprüngliche und die umgearbeitete Fassung der Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, in der »Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur«, Bd. 28, das. 1884). Eine vollständige Wiedergeburt der in politischen Wirrnissen verkommenen Menschheit (S., anfangs ein Freund der französischen Revolution, hatte sich seit der Hinrichtung Ludwigs XVI. mit Abscheu von ihr abgewandt) erwartet er hier allein durch eine ästhetische Veredelung der Gefühle und Triebe; er findet, zu Kants subjektivistischer Auffassung zurückkehrend, den ästhetischen Zustand dort, wo der Mensch die Eindrücke der den Lebensstoff uns darbietenden Sinnlichkeit frei auf sich wirken läßt, ohne ihn durch die Eingriffe seines Begehrens und seiner Vernunft zu verändern, wo er sich an ihnen wie an einem freien Spiel ergötzt; S. erblickt in dem von ihm genauer charakterisierten Spieltrieb das Bezeichnende des ästhetischen Verhaltens. Von gleichgroßer Bedeutung wie diese Schrift ist die Abhandlung »Über naive und sentimentalische Dichtung«, die er in den »Horen« 1795 und 1796 veröffentlichte: in ihr sucht er namentlich in der Beschreibung der subjektiven (sentimentalischen) Auffassungsweise eine Reihe charakteristischer Grundstimmungen (das Pathetische, Satirische, Elegische und Idyllische) in sehr fruchtbringender Weise zu unterscheiden.
Schillers Gesundheit besserte sich langsam; eine mit der Gattin unternommene Reise in die schwäbische Heimat (vom August 1793 bis Mai 1794) tat ihm wohl, erfreute ihn durch das Wiedersehen mit den geliebten Eltern und brachte ihm die für die Folge wertvolle geschäftliche Verbindung mit dem Buchhändler Cotta. Mit ihm einigte er sich über die Herausgabe der Monatsschrift »Die Horen« (1795–97) und des »Musenalmanachs« (1795–1800), und die Sorge für jene Zeitschrift veranlaßte ihn, auch Goethe als Mitarbeiter zu werben und damit eine Verbindung anzuknüpfen, die für seine geistige Entwickelung noch bedeutsamer wurde als das Studium der Kantschen Philosophie. Goethe sagte seine Beteiligung zu, und S. gewann den größten Mann der Zeit durch den an ihn gerichteten, von tiefstem Verständnis zeugenden Brief vom 23. Aug. 1794 sowie durch die bei einem längern Besuch in Goethes Haus im September ausgetauschten Gespräche zum innigst teilnehmenden Freunde. Es stellte sich bei der jetzigen Entwickelung von Schillers Geistesleben eine weitgehende Übereinstimmung der Grundanschauungen der beiden Dichter heraus. Der Segen dieses Bundes war unermeßbar: Goethes stockende Produktion wurde durch Schillers anfeuernde Teilnahme zu reichster Betätigung angeregt, S. fand in dem anschaulichen Denken und der rastlosen Vielseitigkeit des neuen Freundes ein immer aufs neue tief von ihm bewundertes Vorbild. So erblühte denn beiden ein neuer Lenz des Lebens und der Dichtung. Bald sich abwendend von den abstrakten Begriffsgespinsten der Philosophie, eröffnete S. gemeinschaftlich mit Goethe in den scharfgeschliffenen Epigrammen der »Xenien«, die im »Musenalmanach« für 1797 erschienen (beste Ausg. von Erich Schmidt und Suphan, Weim. 1893), ein glänzendes Strafgericht gegen die charakterlose Minderjährigkeit der meisten Führer der zeitgenössischen Poesie und Wissenschaft, und im nächsten Bande des Almanachs bot S. (ebenso wie Goethe) einen großen Teil jener eindrucksvollen Balladen dar, die seine Beliebtheit beim Publikum steigerten und befestigten (vgl. Elster im »Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts«, 1904): durch geistvolle Behandlung des Schicksalsproblems, sittliche Hoheit, bewegt dramatisches Leben und eine weitgehende Deutlichkeit der Darstellung schuf S. hier einen ganz neuen Typus dieser poetischen Gattung. Vor allem aber betrat er nach jahrelangem Zögern jetzt als ein völlig Veränderter wiederum das Gebiet der dramatischen Dichtung: nachdem er den schon 1791 entworfenen Plan des »Wallenstein« 1796 gänzlich umgearbeitet hatte, führte er das Werk 1799 zu glorreichem Abschluß. Bereichert durch die Ideen von Realismus und Idealismus, die er in der Abhandlung »Über naive und sentimentalische Dichtung« ausgeführt hatte, seine geistvollen Gedanken über das Problem des Schicksals mannigfach verwertend und allein mit der reinen Liebe des Künstlers, ohne einseitige Parteinahme für die Gestalten seiner Dichtung schaffend, entwarf er ein dramatisches Charaktergemälde von tiefgreifender tragischer Gewalt, das alle seine bisherigen Leistungen in den Schatten stellte (vgl. Kühnemann, Die Kantischen Studien Schillers und die Komposition des »Wallenstein«, Marb. 1889). In dem nächsten Drama, »Maria Stuart« (1800), erweiterte er die historische Überlieferung durch glückliche Erfindungen, wählte unter Anlehnung an den »König Ödipus« des Sophokles einen eigenartigen, an die analytische Technik sich anlehnenden Bau und zeichnete namentlich in dem packenden dritten und dem hoheitsvollen fünften Akte das zu Herzen greifende Bild einer durch die Schläge des Schicksals geläuterten liebenswerten Sünderin. Auch in dem nächsten Werke, der »Jungfrau von Orleans« (1801), wich er in der Gestaltung der von vielen Dichtern behandelten Geschichte der Jeanne d'Arc in wesentlichen Zügen von der Überlieferung ab, hob aber den Kern der romantisch wunderreichen Vorgänge in stimmungsvollster Poesie eindrucksvoll heraus, wenn auch die Fülle der an sich sehr gelungenen lyrischen Einlagen, die Kampfszenen und der große Aufzug etwas opernhaft erscheinen und die tragische Schuld der plötzlich von Liebe zum Feinde des Vaterlandes ergriffenen Heldin nicht überzeugend herausgearbeitet ist. Vollends in der an Leisewitz' »Julius von Tarent« und an einzelne antike Motive (Herodot, Hygin) angelehnten »Braut von Messina« (1803) geht S. in kühner Neubelebung der antiken Schicksalsauffassung und des Chors der griechischen Tragödie in der Nichtachtung der Norm des zeitgemäßen Lebensgehaltes recht weit und verstößt auch öfters gegen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit; aber die Tragik dieses Werkes ist erschütternd, und die Sprache, namentlich in den Chorgesängen, von hinreißendem Zauber. Von allen ästhetischen Experimenten frei hielt er sich bei der Behandlung des von Goethe ihm überlassenen Stoffes des »Wilhelm Tell« (1804). Unter engem Anschluß an die poetisch brauchbare Überlieferung (namentlich Tschudi), erschloß er in dem durch köstliche Milieuschilderung ausgezeichneten Werke die gewaltige Freiheitsbewegung des nationalen Gesamtbewußtseins, machte, pedantischen Regeln zum Trotz, das ganze Volk der Eidgenossen zum Helden des Dramas, isolierte (Goethes Winken folgend) die Person des Tell in einer bedeutsamen Parallelhandlung und erfüllte das durch glänzende Einzelheiten hervorragende Drama mit dem hinreißenden Pathos seiner großen und liebenswerten Seele. Auch in den Fragmenten seines »Demetrius« (beste Ausg. von Kettner, Weim. 1894), in denen er einen dem lange gehegten Plan des »Warbeck« nahe verwandten Gegenstand behandelte, bewährte er in der psychologischen Vertiefung des Hauptproblems (Demetrius erfährt erst im Verlauf der Handlung, daß er nicht der berechtigte Erbe des Thrones ist, und spielt gleichwohl seine Rolle weiter), in der glänzenden Bühnenszene des polnischen Reichstags, dem Monolog der Marfa etc. die höchste Vollendung seiner Kunst.
Neben diesen Meisterdramen verfaßte S. eine Reihe tiefsinniger Reflexionsgedichte (»Das Ideal und das Leben«, »Das Glück«, »Der Tanz«, »Nänie« etc.), großartige lyrische Kulturgemälde von zum Teil welthistorischen Perspektiven (»Das Eleusische Fest«, »Der Spaziergang«, »Das Lied von der Glocke« etc.), übersetzte und bearbeitete mehrere Dramen, wie Picards »Der Neffe als Onkel« und »Der Parasit«, Gozzis »Turandot«, Racines »Phädra«, Shakespeares »Macbeth« u.a., und schrieb das zierliche höfische Gelegenheitsstück »Die Huldigung der Künste«. Er war, nachdem er 1798 zum ordentlichen Honorarprofessor ernannt worden war, 1799 nach Weimar übergesiedelt, wo er an der idealistischen Bühnenreform Goethes tätigen Anteil nahm und die letzten Jahre seines Lebens sorgenfrei ganz ausschließlich seinen poetischen Arbeiten sich zuwenden konnte. 1802 wurde er auf Veranlassung des Herzogs Karl August vom Kaiser geadelt; der Jahresgehalt, den der Herzog 1799 auf 400 Tlr. erhöht hatte, wurde dem Dichter, als er 1804 eine Aufforderung, nach Berlin überzusiedeln, abgelehnt hatte, auf das Doppelte bemessen; von Jahr zu Jahr steigerte sich die Liebe und Verehrung, die S., soweit die deutsche Zunge klang, entgegengebracht wurde. Aber seine von früher Jugend an zarte Gesundheit erholte sich nicht wieder von den schweren Erschütterungen der 1790er Jahre; am 9. Mai 1805, zwischen 5 und 6 Uhr abends, endete ein sanfter Tod das Leben des Dichters, ehe er noch das 46. Jahr vollendet hatte. Der Trauer, die ganz Deutschland ergriff, wollte Goethe in einem Entwurf gebliebenen dramatischen Spiel Ausdruck geben; ausgeführt wurde von ihm der Epilog zu einer am 10. Aug. 1805 in Lauchstädt veranstalteten dramatischen Ausführung der »Glocke«; nach vielen Jahren, 1826, schrieb er noch das Terzinengedicht »Im ernsten Beinhaus war's, wo ich erschaute«, das der Erinnerung an den edlen Freund tiefsinnigen Ausdruck verleiht.
Neben der Wucht der Affekte und der unbeirrbaren Klarheit des sittlichen Willens zeichnet sich S. von Jugend an durch die Kraft des abstrakt begrifflichen Denkens aus; der deduktive, nicht der induktive Verstand war bei ihm stark entwickelt; in seiner Phantasietätigkeit überwiegt die Kombinationsgabe: die Fülle neuer Einfälle zerstört ihm gelegentlich, namentlich in den Werken der Jugend, die Einheit der Komposition; die Anschaulichkeit seiner Phantasie ist geringer bei ihm entwickelt, nimmt aber in den Jahren seiner Reise unter bewußter Beherzigung von Goethes Vorbild bedeutend zu. Der am meisten hervorragende Zug seines Wesens ist aber der unvergleichliche Idealismus seiner Weltanschauung, durch den er als die hehrste Lichtgestalt der deutschen Literatur der edelste Erzieher und der von hoch und niedrig gleich innig verehrte Liebling der Nation geworden ist.
Seit dem Anfang des Religionskriegs in Deutschland bis zum Münsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwürdiges geschehen, woran die Reformation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herflossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einfluß derselben empfunden.
Beinahe der ganze Gebrauch, den das spanische Haus von seinen ungeheuren politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen oder ihre Bekenner gerichtet. Durch die Reformation wurde der Bürgerkrieg entzündet, welcher Frankreich unter vier stürmischen Regierungen in seinen Grundfesten erschütterte, ausländische Waffen in das Herz dieses Königreichs zog und es ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplatz der traurigsten Zerrüttung machte. Die Reformation machte den Niederländern das spanische Joch unerträglich und weckte bei diesem Volke das Verlangen und den Muth, dieses Joch zu zerbrechen, so wie sie ihm größtenteils auch die Kräfte dazugab. Alles Böse, welches Philipp der Zweite gegen die Königin Elisabeth von England beschloß, war Rache, die er dafür nahm, daß sie seine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schutz genommen und sich an die Spitze einer Religionspartei gestellt hatte, die er zu vertilgen strebte. Die Trennung in der Kirche hatte in Deutschland eine fortdauernde politische Trennung zur Folge, welche dieses Land zwar länger als ein Jahrhundert der Verwirrung dahingab, aber auch zugleich gegen politische Unterdrückung einen bleibenden Damm aufthürmte. Die Reformation war es großenteils, was die nordischen Mächte, Dänemark und Schweden zuerst in das Staatssystem von Europa zog, weil sich der protestantische Staatenbund durch ihren Beitritt verstärkte, und weil dieser Bund ihnen selbst unentbehrlich ward. Staaten, die vorher kaum für einander vorhanden gewesen, fingen an, durch die Reformation einen wichtigen Berührungspunkt zu erhalten und sich in einer neuen politischen Sympathie an einander zu schließen. So wie Bürger gegen Bürger, Herrscher gegen ihre Unterthanen durch die Reformation in andre Verhältnisse kamen, rückten durch sie auch ganze Staaten in neue Stellengen gegen einander. Und so mußte es durch einen seltsamen Gang der Dinge die Kirchentrennung sein, was die Staaten unter sich zu einer engern Vereinigung führte. Schrecklich zwar und verderblich war die erste Wirkung, durch welche diese allgemeine politische Sympathie sich verkündigte – ein dreißigjähriger verheerender Krieg, der von dem Innern des Böhmerlandes bis an die Mündung der Schelde, von den Ufern des Po bis an die Küsten der Ostsee Länder entvölkerte, Ernten zertrat, Städte und Dörfer in die Asche legte; ein Krieg, in welchem viele Tausend Streiter ihren Untergang fanden, der den aufglimmenden Funken der Cultur in Deutschland auf ein halbes Jahrhundert verlöschte und die kaum auflebenden bessern Sitten der alten barbarischen Wildheit zurückgab. Aber Europa ging ununterdrückt und frei aus diesem fürchterlichen Krieg, in welchem es sich zum erstenmal als eine znsammenhängende Staatengesellschaft erkannt hatte; und diese Theilnehmung der Staaten an einander, welche sich in diesem Krieg eigentlich erst bildete, wäre allein schon Gewinn genug, den Weltbürger mit seinen Schrecken zu versöhnen. Die Hand des Fleißes hat unvermerkt alle verderbliche Spuren dieses Kriegs wieder ausgelöscht; aber die wohlthätigen Folgen, von denen er begleitet war, sind geblieben. Eben diese allgemeine Staatensympathie, welche den Stoß in Böhmen dem halben Europa mittheilte, bewacht jetzt den Frieden, der diesem Krieg ein Ende machte. So wie die Flamme der Verwüstung aus dem Innern Böhmens, Mährens und Oesterreichs einen Weg fand, Deutschland, Frankreich, das halbe Europa zu entzünden, so wird die Fackel der Cultur von diesen Staaten aus einen Weg sich öffnen, jene Länder zu erleuchten.
Die Religion wirkte dieses alles. Durch sie allein wurde möglich, was geschah, aber es fehlte viel, daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden wäre. Hätte nicht der Privatvortheil, nicht das Staatsinteresse sich schnell damit vereinigt, nie würde die Stimme der Theologen und des Volks so bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre so zahlreiche, so tapfere, so beharrliche Verfechter gefunden haben. Ein großer Antheil an der Kirchenrevolution gebührt unstreitig der siegenden Gewalt der Wahrheit, oder dessen, was mit Wahrheit verwechselt wurde. Die Mißbräuche in der alten Kirche, das Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, das Uebertriebene in ihren Forderungen mußte nothwendig ein Gemüth empören, das von der Ahnung eines bessern Lichts schon gewonnen war, mußte es geneigt machen, die verbesserte Religion zu umfassen.
Der Reiz der Unabhängigkeit, die reiche Beute der geistlichen Stifter mußte die Regenten nach einer Religionsveränderung lüstern machen und das Gewicht der innern Ueberzeugung nicht wenig bei ihnen verstärken; aber die Staatsräson allein konnte sie dazu drängen. Hätte nicht Karl der Fünfte im Uebermuth seines Glücks an die Reichsfreiheit der deutschen Stände gegriffen, schwerlich hätte sich ein protestantischer Bund für die Glaubensfreiheit bewaffnet. Ohne die Herrschbegierde der Guisen hätten die Calvinisten in Frankreich nie einen Condé oder Coligny an ihrer Spitze gesehen; ohne die Auflage des zehenten und zwanzigsten Pfennigs hätte der Stuhl zu Rom nie die vereinigten Niederlande verloren. Die Regenten kämpften zu ihrer Selbstverteidigung oder Vergrößerung; der Religionsenthusiasmus warb ihnen die Armeen und öffnete ihnen die Schätze ihres Volks. Der große Haufe, wo ihn nicht Hoffnung der Beute unter ihre Fahnen lockte, glaubte für die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es zum Vortheil seines Fürsten verspritzte.
Und Wohlthat genug für die Völker, daß diesmal der Vortheil der Fürsten Hand in Hand mit dem ihrigen ging! Diesem Zufall allein haben sie ihre Befreiung vom Papstthum zu danken. Glück genug für die Fürsten, daß der Unterthan für seine eigene Sache stritt, indem er für die ihrige kämpfte! In dem Zeitalter, wovon jetzt die Rede ist, regierte in Europa kein Fürst so absolut, um über den guten Willen seiner Unterthanen hinweggesetzt zu sein, wenn er seine politischen Entwürfe verfolgte. Aber wie schwer hielt es, diesen guten Willen der Nation für seine poetischen Entwürfe zu gewinnen und in Handlung zu setzen! Die nachdrücklichsten Beweggründe, welche von der Staatsräson entlehnt sind, lassen den Unterthan kalt, der sie selten einsieht, und den sie noch seltener interessieren. In diesem Fall bleibt einem staatsklugen Regenten nichts übrig, als das Interesse des Cabinets an irgend ein anderes Interesse, das dem Volke näher liegt, anzuknüpfen, wenn etwa ein solches schon vorhanden ist, oder, wenn es nicht ist, es zu erschaffen.
Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil derjenigen Regenten befand, die für die Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermutlich eine ganz andere Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses Oesterreich, welche die Freiheit Europens bedrohte, und der thätige Eifer dieses Hauses für die alte Religion. Das Erste weckte die Regenten, das Zweite bewaffnete ihnen die Nationen.
Die Aufhebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die höchste Gewalt in geistlichen Dingen, der gehemmte Abfluß des Geldes nach Rom, die reiche Beute der geistlichen Stifter waren Vortheile, die für jeden Souverän auf gleiche Art verführerisch sein mußten; warum, könnte man fragen, wirkten sie nicht eben so gut auf die Prinzen des Hauses Oesterreich? Was hinderte dieses Haus, und insbesondere die deutsche Linie desselben, den dringenden Anforderungen so vieler seiner Unterthanen Gehör zu geben und sich nach dem Beispiel Andrer auf Unkosten einer wehrlosen Geistlichkeit zu verbessern? Es ist schwer zu glauben, daß die Ueberzeugung von der Unfehlbarkeit der römischen Kirche an der frommen Standhaftigkeit dieses Hauses einen größern Antheil gehabt haben sollte, als die Ueberzeugung vom Gegentheil an dem Abfalle der protestantischen Fürsten. Mehrere Gründe vereinigten sich, die österreichischen Prinzen zu Stützen des Papstthums zu machen. Spanien und Italien, aus welchen Ländern die österreichische Macht einen großen Theil ihrer Stärke zog, waren dem Stuhle zu Rom mit blinder Anhänglichkeit ergeben, welche die Spanier insbesondere schon zu den Zeiten der gothischen Herrschaft ausgezeichnet hat. Die geringste Annäherung an die verabscheuten Lehren Luthers und Calvins mußte dem Beherrscher von Spanien die Herzen seiner Unterthanen unwiederbringlich entreißen; der Abfall von dem Papstthum konnte ihm dieses Königreich kosten. Ein spanischer König mußte ein rechtgläubiger Prinz sein, oder er mußte von diesem Throne steigen. Den nämlichen Zwang legten ihm seine italienischen Staaten auf, die er fast noch mehr schonen mußte, als seine Spanier, weil sie das auswärtige Joch am ungeduldigsten trugen und es am leichtesten abschütteln konnten. Dazu kam, daß ihm diese Staaten Frankreich zum Mitbewerber und den Papst zum Nachbar gaben; Gründe genug, die ihn hinderten, sich für eine Partei zu erklären, welche das Ansehen des Papstes zernichtete – die ihn aufforderten, sich letztern durch den thätigsten Eifer für die alte Religion zu verpflichten.
Diese allgemeinen Gründe, welche bei jedem spanischen Monarchen von gleichem Gewichte sein mußten, wurden bei jedem insbesondere noch durch besondere Gründe unterstützt. Karl der Fünfte hatte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an dem König von Frankreich, dem dieses Land sich in eben dem Augenblick in die Arme warf, wo Karl sich ketzerischer Grundsätze verdächtig machte. Gerade an denjenigen Entwürfen, welche Karl mit der meisten Hitze verfolgte, würde das Mißtrauen der Katholischen und der Streit mit der Kirche ihm durchaus hinderlich gewesen sein. Als Karl der Fünfte in den Fall kam, zwischen beiden Religionsparteien zu wählen, hatte sich die neue Religion noch nicht bei ihm in Achtung setzen können, und überdem war zu einer gütlichen Vergleichung beider Kirchen damals noch die wahrscheinlichste Hoffnung vorhanden. Bei seinem Sohn und Nachfolger Philipp dem Zweiten vereinigte sich eine mönchische Erziehung mit einem despotischen finstern Charakter, einen unversöhnlichen Haß aller Neuerungen in Glaubenssachen bei diesem Fürsten zu unterhalten, den der Umstand, daß seine schlimmsten politischen Gegner auch zugleich Feinde seiner Religion waren, nicht wohl vermindern konnte. Da seine europäischen Länder, durch so viele fremde Staaten zerstreut, dem Einfluß fremder Meinungen überall offen lagen, so konnte er dem Fortgange der Reformation in andern Ländern nicht gleichgültig zusehen, und sein eigener näherer Staatsvortheil forderte ihn auf, sich der alten Kirche überhaupt anzunehmen, um die Quellen der ketzerischen Ansteckung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spitze des katholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls des Fünften und Philipps des Zweiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die folgenden Gesetz; und je mehr sich der Riß in der Kirche erweiterte, desto fester mußte Spanien an dem Katholicismus halten.
Freier schien die deutsche Linie des Hauses Oesterreich gewesen zu sein; aber wenn bei dieser auch mehrere von jenen Hindernissen wegfielen, so wurde sie durch andere Verhältnisse in Fesseln gehalten. Der Besitz der Kaiserkrone, die auf einem protestantischen Haupte ganz undenkbar war (denn wie konnte ein Apostat der römischen Kirche die römische Kaiserkrone tragen?) knüpfte die Nachfolger Ferdinands des Ersten an den päpstlichen Stuhl; Ferdinand selbst war diesem Stuhl aus Gründen des Gewissens und aufrichtig ergeben. Ueberdem waren die deutsch-österreichischen Prinzen nicht mächtig genug, der spanischen Unterstützung zu entbehren, die aber durch eine Begünstigung der neuen Religion durchaus verscherzt war. Auch forderte ihre Kaiserwürde sie auf, das deutsche Reichssystem zu beschützen, wodurch sie selbst sich als Kaiser behaupteten, und welches der protestantische Reichstheil zu stürzen strebte. Rechnet man dazu die Kälte der Protestanten gegen die Bedrängnisse der Kaiser und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren des Reichs, ihre gewaltsamen Eingriffe in das Zeitliche der Kirche und ihre Feindseligkeiten, wo sie sich als die Stärkeren fühlten; so begreift man, wie so viele zusammenwirkende Gründe die Kaiser auf der Seite des Papstthums erhalten, wie sich ihr eigner Vortheil mit dem Vortheile der katholischen Religion aufs genauste vermengen mußte. Da vielleicht das ganze Schicksal dieser Religion von dem Entschlusse abhing, den das Haus Oesterreich ergriff, so mußte man die österreichischen Prinzen durch ganz Europa als die Säulen des Papstthums betrachten. Der Haß der Protestanten gegen letzteres kehrte sich darum auch einstimmig gegen Oesterreich und vermengte nach und nach den Beschützer mit der Sache, die er beschützte.
Aber eben dieses Hans Oesterreich, der unversöhnliche Gegner der Reformation, setzte zugleich durch seine ehrgeizigen Entwürfe, die von einer überlegenen Macht unterstützt waren, die politische Freiheit der europäischen Steten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gefahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit aufschrecken und auf ihre Selbstverteidigung aufmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Hilfsmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrengungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Kräfte entlehnen und durch Bündnisse unter einander eine Macht aufzuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden.
Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten hatten, sich den Fortschritten Oesterreichs zu widersetzen, hatten ihre Unterthanen nicht. Nur gegenwärtige Vortheile oder gegenwärtige Uebel sind es, welche das Volk in Handlung setzen; und diese darf eine gute Staatskunst nicht abwarten. Wie schlimm also für diese Fürsten, wenn nicht zum Glücke ein anderes wirksames Motiv sich ihnen dargeboten hätte, das die Nation in Leidenschaft setzte und einen Enthusiasmus in ihr entflammte, der gegen die politische Gefahr gerichtet werden konnte, weil er in dem nämlichen Gegenstande mit derselben zusammentraf! Dieses Motiv war der erklärte Haß gegen eine Religion, welche das Haus Oesterreich beschützte, die schwärmerische Anhänglichkeit an eine Lehre, welche dieses Haus mit Feuer und Schwert zu vertilgen strebte. Diese Anhänglichkeit war feurig, jener Haß war unüberwindlich; der Religionsfanatismus fürchtet das Entfernte; Schwärmerei berechnet nie, was sie aufopfert. Was die entschiedenste Gefahr des Staats nicht über seine Bürger vermocht hätte, bewirkte die religiöse Begeisterung. Für den Staat, für das Interesse des Fürsten würden sich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Religion griff der Kaufmann, der Künstler, der Landbauer freudig zum Gewehr. Für den Staat oder den Fürsten würde man sich auch der kleinsten außerordentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben; an die Religion setzte man Gut und Blut, alle seine zeitlichen Hoffnungen. Dreifach stärkere Summen strömen jetzt in den Schatz des Fürsten; dreifach stärkere Heere rücken in das Feld; und in der heftigen Bewegung, worein die nahe Religionsgefahr alle Gemüther versetzte, fühlte der Unterthan die Schwere der Lasten nicht, die Anstrengungen nicht, von denen er in einer ruhigeren Gemüthslage erschöpft würde niedergesunken sein. Die Furcht vor der spanischen Inquisition, vor Bartholomäusnächten eröffnet dem Prinzen von Oranien, dem Admiral Coligny, der brittischen Königin Elisabeth, den protestantischen Fürsten Deutschlands Hilfsquellen bei ihren Völkern, die noch jetzt unbegreiflich sind.
Mit noch so großen eignen Anstrengungen aber würde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigsten Fürsten, wenn er einzeln stand. überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politik konnten aber nur zufällige Umstände entfernte Staaten zu einer wechselseitigen Hilfsleistung vermögen. Die Verschiedenheit der Verfassung, der Gesetze, der Sprache, der Sitten, des Nationalcharakters, welche die Nationen und Länder in eben so viele verschiedene Ganze absonderte und eine fortdauernde Scheidewand zwischen sie stellte, machte den einen Staat unempfindlich gegen die Bedrängnisse des andern, wo ihn nicht gar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schadenfreude reizte. Die Reformation stürzte diese Scheidewand. Ein lebhafteres, näher liegendes Interesse als der Nationalvortheil oder die Vaterlandsliebe, und welches von bürgerlichen Verhältnissen durchaus unabhängig war, fing an, die einzelnen Bürger und ganze Staaten zu beseelen. Dieses Interesse konnte mehrere und selbst die entlegensten Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen des nämlichen Staats konnte dieses Band wegfallen. Der französische Calvinist hatte also mit dem reformierten Genfer, Engländer, Deutschen oder Holländer einen Berührungspunkt, den er mit seinem eigenen katholischen Mitbürger nicht hatte. Er hörte also in einem sehr wichtigen Punkte auf, Bürger eines einzelnen Staats zu sein, seine Aufmerksamkeit und Theilnahme auf diesen einzelnen Staat einzuschränken. Sein Kreis erweitert sich; er fängt an, aus dem Schicksale fremder Länder, die seines Glaubens sind, sich sein eigenes zu weissagen und ihre Sache zu der seinigen zu machen. Nun erst dürfen die Regenten es wagen, auswärtige Angelegenheiten vor die Versammlung ihrer Landstände zu bringen, nun erst hoffen, ein williges Ohr und schnelle Hilfe zu finden. Diese auswärtigen Angelegenheiten sind jetzt zu einheimischen geworden, und gerne reicht man dem Glaubensverwandten eine hilfreiche Hand, die man dem bloßen Nachbar, und noch mehr dem fernen Ausländer verweigert hätte. Jetzt verläßt der Pfälzer seine Heimath, um für seinen französischen Glaubensbruder gegen den gemeinschaftlichen Religionsfeind zu fechten. Der französische Unterthan zieht das Schwert gegen ein Vaterland, das ihn mißhandelt, und geht hin, für Hollands Freiheit zu bluten. Jetzt sieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüstet, um an den Ufern der Loire und der Seine die Thronfolge in Frankreich zu entscheiden. Der Däne geht über die Eider, der Schwede über den Belt, um die Ketten zu zerbrechen, die für Deutschland geschmiedet sind.
Es ist sehr schwer zu sagen, was mit der Reformation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wohl geworden sein würde, wenn das gefürchtete Haus Oesterreich nicht Partei gegen sie genommen hätte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen führten. In keinem andere Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich, die außerordentlichen Anstrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der österreichischen Macht widerstanden; in keinem andern Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.
Höher war die österreichische Macht nie gestanden, als nach dem Siege Karls des Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte wieder auf in Moritz von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges gehen auf dem Congreß zu Passau und dem Reichstag zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistlichen Unterdrückung endigen in einem nachgebenden Frieden.
Deutschland zerriß auf diesem Reichstage zu Augsburg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jetzt erst zerriß es, weil die Trennung jetzt erst gesetzlich war. Bis hieher waren die Protestanten als Rebellen angesehen worden; jetzt beschloß man, sie als Brüder zu behandeln, nicht als ob man sie dafür anerkannt hätte, sondern weil man dazu genöthigt war. Die Augsburgische Confession durfte sich von jetzt an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine geduldete Nachbarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande war das Recht zugestanden, die Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden zur herrschenden und einzigen zu machen und die entgegengesetzte der freien Ausübung zu berauben; jedem Unterthan vergönnt, das Land zu verlassen, wo seine Religion unterdrückt war. Jetzt zum erstenmal erfreute sich also die Lehre Luthers einer positiven Sanktion, und wenn sie auch in Bayern oder in Oesterreich im Staube lag, so konnte sie sich damit trösten, daß sie in Sachsen und in Thüringen thronte. Den Regenten war es aber nun doch allein überlassen, welche Religion in ihren Landen gelten und welche darnieder liegen sollte; für den Unterthan, der auf dem Reichstage keinen Repräsentanten hatte, war in diesem Frieden gar wenig gesorgt. Bloß allein in geistlichen Ländern, in welchen die katholische Religion unwiderruflich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen (welche es damals schon waren) die freie Religionsübung ausgewirkt; aber auch diese nur durch eine persönliche Versicherung des römischen Königs Ferdinand, der diesen Frieden zu Staude brachte – eine Versicherung, die, von dem katholischen Reichstheile widersprochen und mit diesem Widerspruch in das Friedensinstrument eingetragen, keine Gesetzeskraft erhielt.
Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, was die Gemüther trennte – wie gleichgültig hätte man dieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Meinungen hingen Reichthümer, Würden und Rechte; ein Umstand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Von zwei Brüdern, die das väterliche Vermögen bis hieher gemeinschaftlich genossen, verließ jetzt einer das väterliche Hans, und die Notwendigkeit trat ein, mit dem daheimbleibenden Bruder abzutheilen. Der Vater hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung nichts ahnen konnte. Aus den wohlthätigen Stiftungen der Voreltern war der Reichthum der Kirche innerhalb eines Jahrtausends zusammengeflossen, und diese Voreltern gehörten dem Weggehenden eben so gut an, als Dem, der zurückblieb. Haftete nun das Erbrecht bloß an dem väterlichen Hause, oder haftete es an dem Blute? Die Stiftungen waren an die katholische Kirche geschehen, weil damals noch keine andere vorhanden war; an den erstgebornen Bruder, weil er damals noch der einzige Sohn war. Galt nun in der Kirche ein Recht der Erstgeburt, wie in adeligen Geschlechtern? Galt die Begünstigung des einen Theils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte? Konnten die Lutheraner von dem Genuß dieser Güter ausgeschlossen sein, an denen doch ihre Vorfahren mitstiften halfen, bloß allein deßwegen ausgeschlossen sein, weil zu den Zeiten der Stiftung noch kein Unterschied zwischen Lutheranern und Katholischen stattfand? Beide Religionsparteien haben über diese Streitsache mit scheinbaren Gründen gegen einander gerechtet und rechten noch immer; aber es dürfte dem einen Theile so schwer fallen, als dem andern, sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen für denkbare Fälle, und vielleicht gehören geistliche Stiftungen nicht unter diese; zum wenigsten dann nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Sätze erstreckt – wie ist es denkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Meinung zu machen?
Wenn das Recht nicht entscheiden kann, so thut es die Stärke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; der andere verteidigte, was er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachten Bisthümer und Abteien verblieben den Protestanten; aber die Papisten verwahrten sich in einem eigenen Vorbehalt, daß künftig keine mehr weltlich gemacht würden. Jeder Besitzer eines geistlichen Stiftes, das dem Reich unmittelbar unterworfen war, Kurfürst, Bischof oder Abt, hat seine Beneficien und Würden verwirkt, sobald er zur protestantischen Kirche abfällt. Sogleich muß er seine Besitzungen räumen, und das Kapitel schreitet zu einer neuen Wahl, gleich als wäre seine Stelle durch einen Todesfall erledigt worden. An diesem heiligen Anker des geistlichen Vorbehalts, der die ganze zeitliche Existenz eines geistlichen Fürsten von seinem Glaubensbekenntniß abhängig machte, ist noch bis heute die katholische Kirche in Deutschland befestigt – und was würde aus ihr werden, wenn dieser Anker zerrisse? Der geistliche Vorbehalt erlitt einen hartnäckigen Widerspruch von Seiten der protestantischen Stände, und obgleich sie ihn zuletzt noch in das Friedensinstrument mit aufnahmen, so geschah es mit dem ausdrücklichen Beisatz, daß beide Parteien sich über diesen Punkt nicht verglichen hätten. Konnte er für den protestantischen Theil mehr verbindlich sein, als jene Versicherung Ferdinands zum Vortheil der protestantischen Unterthanen in geistlichen Stiftern es für die katholischen war? Zwei Streitpunkte blieben also in dem Frieden zurück, und an diesen entzündete sich auch der Krieg.
So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geistlichen Gütern; mit den Rechten und Würden war es nicht anders. Auf eine einzige Kirche war das deutsche Reichssystem berechnet, weil nur eine da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden – und doch soll das ganze Reichssystem ausschließend einer einzigen folgen? Alle bisherigen Kaiser waren Söhne der römischen Kirche gewesen, weil die römische Kirche in Deutschland bis jetzt ohne Nebenbuhlerin war. War es aber das Verhältniß mit Rom, was den Kaiser der Deutschen aufmachte, oder war es nicht vielmehr Deutschland, welches sich in seinem Kaiser repräsentierte? Zu dem ganzen Deutschland gehört aber auch der protestantische Theil – und wie repräsentiert sich nun dieser in einer ununterbrochenen Reihe katholischer Kaiser? – In dem höchsten Reichsgerichte richten die deutschen Stände sich selbst, weil sie selbst die Richter dazu stellen; daß sie sich selbst richteten, daß eine gleiche Gerechtigkeit allen zu Statten käme, war der Sinn seiner Stiftung – kann dieser Sinn erfüllt werden, wenn nicht beide Religionen darin sitzen? Daß zur Zeit der Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, war Zufall, – daß kein Stand den andern auf rechtlichem Wege unterdrücken sollte, war der wesentliche Zweck dieser Stiftung. Dieser Zweck aber ist verfehlt, wenn ein Religionstheil im ausschließenden Besitz ist, den andern zu richten – darf nun ein Zweck aufgeopfert werden, wenn sich ein Zufall verändert? – Endlich und mit Mühe erfochten die Protestanten ihrer Religion einen Sitz im Kammergerichte, aber noch immer keine ganz gleiche Stimmenzahl. – Zur Kaiserkrone hat noch kein protestantisches Haupt sich erhoben.
Was man auch von der Gleichheit sagen mag, welche der Religionsfriede zu Augsburg zwischen beiden deutschen Kirchen einführte, so ging die katholische doch unwidersprechlich als Siegerin davon. Alles, was die lutherische erhielt, war – Duldung; alles, was die katholische hingab, opferte sie der Noth, und nicht der Gerechtigkeit. Immer war es noch kein Friede zwischen zwei gleichgeachteten Mächten, bloß ein Vertrag zwischen dem Herrn und einem unüberwundenen Rebellen! Aus diesem Princip scheinen alle Proceduren der katholischen Kirche gegen die protestantische hergeflossen zu sein und noch herzufließen. Immer noch war es ein Verbrechen, zur protestantischen Kirche abzufallen, weil es mit einem so schweren Verluste geahndet wurde, als der geistliche Vorbehalt über abtrünnige geistliche Fürsten verhängt. Auch in den folgenden Zeiten setzte sich die katholische Kirche lieber aus, alles durch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Vortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben; denn einen Raub zurückzunehmen, war noch Hoffnung, und immer war es nur ein zufälliger Verlust; aber ein aufgegebener Anspruch, ein den Protestanten zugestandenes Recht erschütterte die Grundpfeiler der katholischen Kirche. Bei dem Religionsfrieden selbst setzte man diesen Grundsatz nicht aus den Augen. Was man in diesem Frieden den Evangelischen preisgab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausdrücklich, sollte nur bis auf die nächste allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche sich beschäftigen würde, beide Kirchen wieder zu vereinigen. Dann erst, wenn dieser letzte Versuch mißlänge, sollte der Religionsfriede eine absolute Gültigkeit haben. So wenig Hoffnung zu dieser Wiedervereinigung da war, so wenig es vielleicht den Katholischen selbst damit Ernst war, so viel hatte man dessen ungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieden durch diese Bedingung beschränkte.
Dieser Religionsfriede also, der die Flamme des Bürgerkriegs auf ewige Zeiten ersticken sollte, war im Grunde nur eine temporäre Auskunft, ein Werk der Noth und der Gewalt, nicht vom Gesetz der Gerechtigkeit dictiert, nicht die Frucht berichtigter Ideen über Religion und Religionsfreiheit. Einen Religionsfrieden von der letzten Art konnten die Katholischen nicht geben, und wenn man aufrichtig sein will. einen solchen vertrugen die Evangelischen noch nicht. Weit entfernt, gegen die Katholischen eine uneingeschränkte Billigkeit zu beweisen, unterdrückten sie, wo es in ihrer Macht stand, die Calvinisten, welche freilich eben so wenig eine Duldung in jenem bessern Sinne verdienten, da sie eben so weit entfernt waren, sie selbst auszuüben. Zu einem Religionsfrieden von dieser Natur waren jene Zeiten noch nicht reif und die Köpfe noch zu trübe. Wie konnte ein Theil von dem andern fordern, was er selbst zu leisten unvermögend war? Was eine jede Religionspartei in dem Augsburger Frieden rettete oder gewann, verdankte sie der Gewalt, dem zufälligen Machtverhältniß, in welchem beide bei Gründung des Friedens zu einander gestanden. Was durch Gewalt gewonnen wurde, mußte behauptet werden durch Gewalt; jenes Machtverhältniß mußte also auch fürs künftige fortdauern, oder der Friede verlor seine Kraft. Mit dem Schwerte in der Hand wurden die Grenzen zwischen beiden Kirchen gezeichnet; mit dem Schwerte mußten sie bewacht werden – oder wehe der früher entwaffneten Partei! Eine zweifelhafte schreckenvolle Aussicht für Deutschlands Ruhe, die aus dem Frieden selbst schon hervordrohte!
In dem Reiche erfolgte jetzt eine augenblickliche Stille, und ein flüchtiges Band der Eintracht schien die getrennten Glieder wieder in einen Reichskörper zu verknüpfen, daß auch das Gefühl für die gemeinschaftliche Wohlfahrt auf eine Zeitlang zurückkam. Aber die Trennung hatte das innerste Wesen getroffen, und die erste Harmonie wieder herzustellen, war vorbei. So genau der Friede die Rechtsgrenzen beider Theile bestimmt zu haben schien, so ungleichen Auslegungen blieb er nichtsdestoweniger unterworfen. Mitten in ihrem hitzigsten Kampfe hatte er den streitenden Parteien Stillstand auferlegt, er hatte den Feuerbrand zugedeckt, nicht gelöscht, und unbefriedigte Ansprüche blieben auf beiden Seiten zurück. Die Katholischen glaubten zu viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beide halfen sich damit, den Frieden, den sie jetzt noch nicht zu verletzen wagten, nach ihren Absichten zu erklären.
Dasselbe mächtige Motiv, welches so manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre zu umfassen, die Besitznehmung von den geistlichen Stiftern, war nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Händen war, mußte bald in dieselben wandern. Ganz Niederdeutschland war in kurzer Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhaftesten Widerstande der Katholischen, die hier das Uebergewicht hatten. Jede Partei drückte oder unterdrückte, wo sie die mächtigere war, die Anhänger der andern; die geistlichen Fürsten besonders, als die wehrlosesten Glieder des Reicht, wurden unaufhörlich durch die Vergrößerungsbegierde ihrer unkatholischen Nachbarn geängstigt. Wer zu ohnmächtig war, Gewalt durch Gewalt abzuwenden, flüchtete sich unter die Flügel der Justiz, und die Spolienklagen gegen protestantische Stände häuften sich auf dem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, den angeklagten Theil mit Sentenzen zu verfolgen, aber zu wenig unterstützt, um sie geltend zu machen. Der Friede, welcher den Ständen des Reichs die vollkommene Religionsfreiheit einräumte, hatte doch einigermaßen auch für den Unterthan gesorgt, indem er ihm das Recht ausbedung, das Land, in welchem seine Religion unterdrückt war, unangefochten zu verlassen. Aber vor den Gewalttätigkeiten, womit der Landesherr einen gehaßten Unterthan drücken, vor den namenlosen Drangsalen, wodurch er dem Auswandernden den Abzug erschweren, vor den künstlich gelegten Schlingen, worein die Arglist, mit der Stärke verbunden, die Gemüther verstricken kann, konnte der todte Buchstabe dieses Friedas ihn nicht schützen. Der katholische Unterthan protestantischer Herren klagte laut über Verletzung des Religionsfriedens – der evangelische noch lauter über die Bedrückungen, welche ihm von seiner katholischen Obrigkeit widerfuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen vergiftete jeden Vorfall, der an sich unbedeutend war, und setzte die Gemüther in Flammen; glücklich genug, wenn sich diese theologische Wuth an dem gemeinschaftlichen Religionsfeind erschöpft hätte, ohne gegen die eignen Religionsverwandten ihr Gift auszuspritzen.
Die Einigkeit der Protestanten unter sich selbst würde doch endlich hingereicht haben, beide streitende Parteien in einer gleichen Schwankung zu erhalten und dadurch den Frieden zu verlängern; aber, um die Verwirrung vollkommen zu machen, verschwand diese Eintracht bald. Die Lehre, welche Zwingli in Zürich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boden zu gewinnen und die Protestanten unter sich selbst zu entzweien, daß sie einander kaum mehr an etwas anderm als dem gemeinschaftlichen Hasse gegen das Papstthum erkannten. Die Protestanten in diesem Zeitraume glichen denjenigen nicht mehr, welche fünfzig Jahre vorher ihr Bekenntniß zu Augsburg übergeben hatten, und die Ursache dieser Veränderung ist – in eben diesem Augsburgischen Bekenntniß zu suchen. Dieses Bekenntniß setzte dem protestantischen Glauben eine positive Grenze, ehe noch der erwachte Forschungsgeist sich diese Grenze gefallen ließ, und die Protestanten verscherzten unwissend einen Theil des Gewinns, den ihnen der Abfall von dem Papstthum versicherte. Gleiche Beschwerden gegen die römische Hierarchie und gegen die Mißbräuche in dieser Kirche, eine gleiche Mißbilligung der katholischen Lehrbegriffe würden hinreichend gewesen sein, den Vereinigungspunkt für die protestantische Kirche abzugeben; aber sie suchten diesen Vereinigungspunkt in einem neuen positiven Glaubenssystem, setzten in dieses das Unterscheidungszeichen, den Vorzug, das Wesen ihrer Kirche und bezogen auf dieses den Vertrag, den sie mit den Katholischen schlossen. Bloß als Anhänger der Confession gingen sie den Religionsfrieden ein; die Confessionsverwandten allein hatten Theil an der Wohlthat dieses Friedens. Wie also auch der Erfolg sein mochte, so stand es gleich schlimm um die Confessionsverwandten. Dem Geist der Forschung war eine bleibende Schranke gesetzt, wenn den Vorschriften der Confession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Vereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die festgesetzte Formel entzweite. Zum Unglück ereignete sich Beides, und die schlimmen Folgen von Beidem stellten sich ein. Eine Partei hielt standhaft fest an dem ersten Bekenntniß; und wenn sich die Calvinisten davon entfernten, so geschah es nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzuschließen.
Keinen scheinbarern Vorwand hätten die Protestanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben können, als diese Uneinigkeit unter sich selbst, kein erfreuenderes Schauspiel, als die Erbitterung, womit sie einander wechselseitig verfolgten. Wer konnte es nun den Katholischen zum Verbrechen machen, wenn sie die Dreistigkeit lächerlich fanden, mit welcher die Glaubensverbesserer sich angemaßt hatten, das einzig wahre Religionssystem zu verkündigen? wenn sie von Protestanten selbst die Waffen gegen Protestanten entlehnten? wenn sie sich bei diesem Widerspruche der Meinungen an die Autorität ihres Glaubens festhielten, für welchen zum Theil doch ein ehrwürdiges Alterthum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit sprach? Aber die Protestanten kamen bei dieser Trennung auf eine noch ernsthaftere Art ins Gedränge. Auf die Confessionsverwandten allein war der Religionsfriede gestellt, und die Katholischen drangen nun auf Erklärung, wen diese für ihren Glaubensgenossen erkannt wissen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformierten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gewissen zu beschweren; sie konnten sie nicht davon ausschließen, ohne einen nützlichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. So zeigte diese unselige Trennung den Machinationen der Jesuiten einen Weg, Mißtrauen zwischen beide Parteien zu pflanzen und die Eintracht ihrer Maßregeln zu zerstören. Durch die doppelte Furcht vor den Katholiken und vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, versäumten die Protestanten den nimmer wiederkehrenden Moment, ihrer Kirche ein durchaus gleiches Recht mit der römischen zu erfechten. Und allen diesen Verlegenheiten wären sie entgangen, der Abfall der Reformierten wäre für die gemeine Sache ganz unschädlich gewesen, wenn man den Vereinigungspunkt allein in der Entfernung von dem Papstthum, nicht in Augsburgischen Confessionen, nicht in Concordienwerken gesucht hätte.