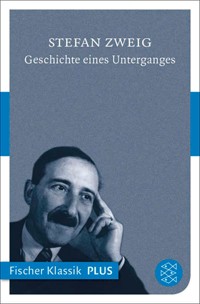
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Gerade noch einflussreichste Mätresse am Hofe von Louis XV., muss die scharfsinnige, intrigante und schöne Mme de Prie sich nun aufs Land zurückziehen, wo ihre manipulativen Spiele ins Leere laufen und ihr Gesellschaftshunger keine Nahrung erhält. Mit allen Mitteln kämpft sie um einen Platz in der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der übersättigten Pariser High Society. Doch der Preis ist schier unbezahlbar … Stefan Zweig beschreibt mit psychologischem Feinsinn und großer sprachlicher Suggestivkraft, wie unmenschliche Erfahrungen, innere Zwänge und misslingende Kommunikation den Menschen zum Äußersten treiben können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 76
Ähnliche
Stefan Zweig
Geschichte eines Unterganges
Fischer e-books
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Geschichte eines Unterganges
Als Madame de Prie an jenem Tage, da der König ihrem Geliebten, dem Herzog von Bourbon, die Leitung der Staatsgeschäfte entzog, von ihrer morgendlichen Spazierfahrt zurückkehrte, fing sie gleichzeitig mit dem devoten Bückling der beiden Türsteher ein unterdrücktes Lächeln auf, das sie irritierte. Sie ließ zunächst nichts merken, schritt gelassen an ihnen vorbei und die Treppe hinauf, wandte aber, als sie zum ersten Absatz der Stufen kam, jäh den Kopf zurück, und nun sah sie das Lachen breit auf den geschwätzigen Lippen der beiden schmatzen, rasch freilich untertauchend in einen erschreckten neuerlichen Bückling.
Jetzt wußte sie genug. Und oben in ihrem Salon, wo ein betreßter Offizier der königlichen Leibgarde sie mit einem Brief in der Hand erwartete, zeigte sie ein so unbesorgtes und fast übermütiges Wesen, als ob sie nur einen konventionellen Besuch in einem befreundeten Hause machte. Wiewohl sie das königliche Siegel auf dem Briefe sah und die ein wenig verwirrte Art des Offiziers, der seiner peinlichen Botschaft bewußt war, verriet sie weder Neugier noch Besorgnis. Ohne den Brief zu öffnen oder nur näher anzusehen, plauderte sie mit dem jungen und adeligen Soldaten, erzählte ihm, als sie an der Aussprache einen Bretonen in ihm erkannte, von einer Dame, die partout die Bretonen nicht leiden mochte, weil einer einmal gegen ihren Willen ihr Liebhaber wurde. Sie war frivol und übermütig, halb aus Berechnung, ihre Sorglosigkeit zu zeigen, halb aus Gewohnheit, wie überhaupt eine vergeßliche und unbeschwerte Leichtfertigkeit jede ihrer Verstellungen natürlich scheinen ließ und sie sogar wirklich in Aufrichtigkeit verwandelte. Sie plauderte so lange, bis sie wirklich an den königlichen Brief vergaß, den sie knitternd in den Händen hielt. Aber schließlich brach sie doch das Siegel auf.
Der Brief enthielt kurz und mit bedenklich geringem Aufwand an Höflichkeit den königlichen Befehl, unverzüglich den Hof zu verlassen und sich auf ihr Landgut Courbépine in der Normandie zurückzuziehen. Sie war in Ungnade, ihre Feinde hatten endlich gesiegt: am Lächeln ihrer Türhüter hatte sie das schon gewußt, ehe die königliche Botschaft kam. Aber sie verriet sich nicht. Der Offizier beobachtete sorgsam ihre Augen, wie sie den Zeilen auf und nieder folgten. Sie zuckten nicht, und nun, da sie sich ihm wieder entgegenwandte, funkelte ein Lächeln darin. »Seine Majestät ist sehr besorgt um meine Gesundheit und wünscht, daß ich die heiße Stadt verlassen und mich auf mein Schloß zurückziehen solle. Melden Sie Seiner Majestät, daß ich seinem Wunsche unverzüglich Folge leisten werde.« Sie lächelte bei den Worten, als sei geheimer Sinn in ihrer Rede. Der Offizier schwenkte den Hut und trat mit einer Verbeugung ab.
Aber kaum, daß die Tür sich hinter ihm schloß, fiel das Lächeln von ihren Lippen wie ein welkes Blatt. Sie zerknitterte zornig den Brief. Wie viele solcher Briefe, jeder ein Schicksal, waren mit dem königlichen Namen in die Welt gegangen, denen sie die Feder geführt hatte! Und nun wagte man sie, die durch zwei Jahre ganz Frankreich regiert hatte, mit einem solchen Blatt vom Hof zu verbannen: so viel Mut hatte sie von ihren Feinden nicht erwartet. Freilich, der junge König hatte sie nie geliebt, er war ihr übel gesinnt; aber hatte sie dazu Maria Leszińska zur Königin von Frankreich gemacht, daß man sie exilierte, nur weil ein Volkshaufe vor ihren Fenstern gelärmt hatte und irgendeine Hungersnot im Lande war? Sie überlegte einen Augenblick, ob sie Widerstand leisten sollte: der Regent von Frankreich, der Herzog von Orleans, war ihr Geliebter gewesen, wer heute Macht und Stellung bei Hof besaß, dankte es einzig ihr. An Freunden fehlte es ihr nicht. Aber sie war zu stolz, um als Bettlerin zu erscheinen, wo man sie als Herrin kannte, niemand in Frankreich sollte sie je anders als lächelnd gesehen haben. Die Verbannung konnte ja nur Tage dauern, bis die Gemüter beruhigt waren, dann würden ihre Freunde die Rückberufung durchsetzen. Sie freute sich schon voraus im Gedanken der Rache und betrog ihren Ärger damit.
Madame de Prie betrieb ihre Abreise mit der größten Heimlichkeit. Sie gab niemandem Gelegenheit, sie zu bedauern, und empfing keinen Besuch, um nicht ihre Abreise ankündigen zu müssen. Sie wollte plötzlich, geheimnisvoll, abenteuerlich verschwunden sein, ein Rätsel mit ihrem Fortsein dauernd verbinden, das den ganzen Hof verwirren sollte: denn diese merkwürdige Eigenschaft war ihrem Charakter eigen, immer betrügen zu wollen, immer eine Lüge über ihr wirkliches Tun zu breiten. Der einzige, den sie besuchte, war der Comte de Belle-Isle, ihr Todfeind, derjenige, der ihre Verbannung erwirkt hatte. Sie suchte ihn auf, um ihm ihr Lächeln zu zeigen, ihre Unbesorgtheit, ihre Sicherheit. Sie erzählte ihm, wie willkommen es ihr sei, einmal von den Anstrengungen des höfischen Lebens ausruhen zu dürfen, sie log und zeigte ihm durch die Offenkundigkeit ihres Lügens all ihren Haß, ihre Verachtung. Der Comte lächelte nur kühl und meinte, sie würde die lange Einsamkeit schwer ertragen können, und betonte das Wort »lange« so merkwürdig, daß sie erschrak. Aber sie hielt sich zusammen und lud ihn höflich zur Jagd auf ihr Gut. Nachmittags traf sie sich noch in ihrem Häuschen in der Rue Apolline mit einem ihrer Geliebten, beauftragte ihn, sie genau von allen Vorgängen bei Hofe zu benachrichtigen. Abends reiste sie ab. Sie wollte nicht bei Tage in der offenen Chaise durch die Stadt fahren, weil das Volk ihr seit jenem Aufstande, der Menschenleben gekostet hatte, feindlich gesinnt war, und dann, weil sie das Geheimnis ihres Verschwindens zäh festhielt. Sie wollte bei Nacht fortreisen, um bei Tag wiederzukehren. Ihr Haus ließ sie unverändert, als bliebe sie nur ein oder zwei Tage aus, und sagte im Augenblicke, wo der Wagen sich in Bewegung setzte, vernehmlich – denn sie wußte, die Worte würden den Weg zu Hofe finden – sie beabsichtige eine kurze Reise zu ihrer Erholung und käme bald zurück. Und so sehr hatte sie sich eingelernt, Masken der Verstellung zu tragen, daß sie durch ihre eigene Lüge tatsächlich beruhigt in der holpernden Karosse bald in unbesorgten Schlummer versank und erst weit hinter Paris, bei der ersten Relaisstelle, erwachte, erstaunt, sich in einem Wagen zu finden und in einem neuen Schicksal, von dem sie noch nicht wußte, ob es ihr gut oder böse war. Sie fühlte nur, daß Räder unter ihr rollten und sie ihnen nicht gebieten konnte, daß sie hinglitt in ein Unbekanntes, aber sie war zu leichtfertig, um ernstliche Besorgnis zu haben, und schlief bald wieder ein.
Die Fahrt in die Normandie war lästig und lang gewesen, aber schon der erste Tag in Courbépine gab ihr die Heiterkeit ihres Wesens wieder. Ihr unruhiger, verspielter, ständig nach Neuem lüsterner Sinn entdeckte einen ungewohnten Reiz darin, sich der kristallenen Reinheit eines ländlichen Sommertages hinzugeben. Sie verlor sich an tausend Torheiten, belustigte sich damit, mit blassen Schleifen im Haar in einem blühweißen Kleid wie das kleine Mädchen, das sie einst war und das sie in sich längst schon gestorben meinte, durch die Alleen zu laufen, über Hecken zu springen und schwirrenden Schmetterlingen nachzuhaschen. Sie ging und ging und empfand seit Jahren zum erstenmal, welche Wollust darin liegt, seine Glieder im Schreiten rhythmisch zu entspannen, wie sie überhaupt all die Dinge des primitiven Lebens, die sie in den höfischen Tagen vergessen hatte, mit Entzücken wiederentdeckte. Sie lag im smaragdenen Gras und sah den Wolken zu. Wie seltsam das war, seit Jahren hatte sie niemals eine Wolke angesehen, und sie fragte sich, ob sie über den Häusern von Paris auch so schön gerändert, so weißgebläht, so rein und schwebend seien. Zum erstenmal sah sie den Himmel wie ein wirkliches Ding an, und seine blaue, mit seinen weißen Flecken durchsprenkelte Wölbung erinnerte sie an die wundervollen chinesischen Vasen, die ihr jüngst ein deutscher Fürst zum Geschenk gemacht hatte, nur daß er noch schöner war, voller und blauer und gefüllt mit milder, duftender Luft, die wie Seide weich anzufühlen war. Das Nichtstun ergötzte sie, die in Paris immer von einem zum anderen Divertissement gejagt war, und die Stille um sie war köstlich wie ein frischer Trunk. Es kam ihr jetzt zum erstenmal zu Bewußtsein, daß alle die Menschen, die sie in Versailles umringten, ihr gleichgiltig seien, daß sie keinen liebte und keinen haßte, alle waren ihr gleichgiltig wie dort die Bauern, die am Waldrand mit großen blitzenden Sensen standen und manchmal mit überschattetem Auge neugierig zu ihr herübersahen. Immer übermütiger ward sie: sie trieb loses Spiel mit den jungen Bäumen, sprang hoch, bis sie die niederhängenden Zweige fing, ließ sie abschnellen und lachte laut, wenn ein paar weiße Blüten wie pfeilgetroffen herabfielen, in ihre haschende Hand, in ihr seit Jahren zum erstenmal wieder freies Haar. Mit jener wunderbaren Vergeßlichkeit, die leichtfertige Frauen an jeden Augenblick ihres Lebens haben, verlor sie das Erinnern, daß sie verbannt sei und daß sie vordem Herrscherin in Frankreich war, mit Schicksalen so lässig spielen durfte wie jetzt mit Schmetterlingen und flimmernden Bäumen, sie verlor fünf, zehn, fünfzehn Jahre und war nur mehr Mademoiselle Pleuneuf, die Tochter des Genfer Bankiers, ein kleines, mageres, übermütiges Mädchen von fünfzehn Jahren, die im Klostergarten spielte und nichts wußte von Paris und der ganzen Welt.





























