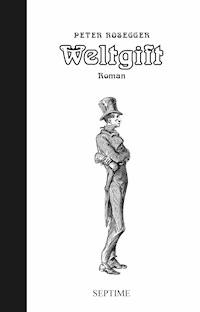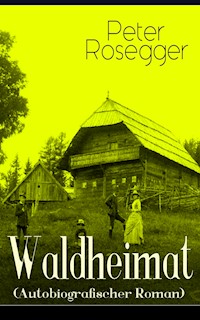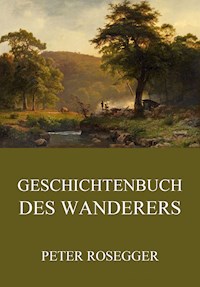
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Novellen und Skizzen aus dem Weltleben. Peter Rosegger war ein österreichischer Schriftsteller und Poet, bekannt für seine "Waldheimat", der 1918 in Krieglach verstorben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Geschichtenbuch des Wanderers
Peter Rosegger
Inhalt:
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Das Geschichtenbuch des Wanderers
Wenn Dämonen spielen.
Meister Hermann.
Ein moderner Hellespont.
Die Gattin meines Freundes.
Aus dem Tagebuch einer Ehefrau.
Das verkehrte Laternlein.
Ein Gerichtstag zu Alt-Abelsberg.
Fiat justitia – pereat mundus!
Der Kammerdiener.
Das Bekenntnis eines Verurtheilten.
Scheintodt.
Herr Florin.
Die Kokette.
Ein Jünger Darwin's.
Ein Mann, ein Wort!
Auf dem Herrenabende.
Das Geheimniß von Defregger's Erfolgen.
Wie der Abelsberger Gesangverein preisgekrönt worden ist.
Auf der Wacht.
Die Vierzehnte.
Der Taubstumme.
Die Rede des Vertheidigers.
Die Tafelrunde der Berühmten.
Das Ereignis in der Schrun
Der Herrensepp
Der Höllbart
Das Geschichtenbuch des Wanderers, P. Rosegger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849653156
www.jazzybee-verlag.de
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Namhafter österr. Volksschriftsteller, geb. 31. Juli 1843 in Alpl bei Krieglach in Obersteiermark als Sohn armer Bauersleute, verstorben am 26. Juni 1918 in Krieglach. Erhielt nur den notdürftigsten Unterricht und kam, weil er für einen Alpenbauer zu schwach war, mit 17 Jahren zu einem Wanderschneider in die Lehre, mit dem er mehrere Jahre lang von Gehöft zu Gehöft zog. Dabei kaufte und las er, von Bildungsdrang getrieben, Bücher, namentlich den »Volkskalender« von A. Silberstein, dessen Dorfgeschichten ihn so lebhaft anregten, daß er selbst allerlei Gedichte und Geschichten zu schreiben anfing. Durch Vermittelung des Redakteurs der Grazer »Tagespost«, Svoboda, dem R. einige Proben seines Talents zusandte, ward ihm endlich 1865 der Besuch der Grazer Handelsakademie ermöglicht, an der er bis 1869 seiner Ausbildung oblag; später wurde ihm zu weitern Studien vom steirischen Landesausschuß ein Stipendium auf drei Jahre bewilligt. Er ließ sich dauernd in Graz nieder, wo er seit 1876 die Monatsschrift »Der Heimgarten« herausgibt, und wo der freundschaftliche Verkehr mit Hamerling, der auch seinen Erstling mit einem Vorwort in die Literatur einführte, auf seine Bildung bestimmend einwirkte. Seiner ersten Veröffentlichung: »Zither und Hackbrett«, Gedichte in obersteirischer Mundart (Graz 1869, 5. Aufl. 1907), folgten: »Tannenharz und Fichtennadeln«, Geschichten, Schwänke etc. in steirischer Mundart (das. 1870, 4. Aufl. 1907), dann fast jährlich gesammelte Schilderungen und Erzählungen, die vielfach aufgelegt wurden (meist Wien), nämlich: »Das Buch der Novellen« (1872–86, 3 Bde.); »Die Älpler« (1872); »Waldheimat«, Erinnerungen aus der Jugendzeit (1873, 2 Bde.); »Die Schriften des Waldschulmeisters« (1875); »Das Volksleben in Steiermark« (1875, 2 Bde.); »Sonderlinge aus dem Volk der Alpen« (1875, 3 Bde.); »Heidepeters Gabriel« (1875); »Feierabende« (1880, 2 Bde.); »Am Wanderstabe« (1882); »Sonntagsruhe« (1883); »Dorfsünden« (1883); »Meine Ferien« (1883); »Der Gottsucher« (1883); »Neue Waldgeschichten« (1884); »Das Geschichtenbuch des Wanderers« (1885, 2 Bde.); »Bergpredigten« (1885);»Höhenfeuer« (1887); »Allerhand Leute« (1888); »Jakob der Letzte« (1888); »Martin der Mann« (1889); »Der Schelm aus den Alpen« (1890); »Hoch vom Dachstein« (1892); »Allerlei Menschliches« (1893); »Peter Mayr, der Wirt an der Mahr«, (1893); »Spaziergänge in der Heimat« (1894); »Als ich jung noch war« (Leipz. 1895); »Der Waldvogel«, neue Geschichten aus Berg und Tal (das. 1896); »Das ewige Licht« (das. 1897); »Das ewig Weibliche. Die Königssucher« (Stuttg. 1898); »Mein Weltleben, oder wie es dem Waldbauernbuben bei den Stadtleuten erging« (Leipz. 1898); »Idyllen aus einer untergehenden Welt« (das. 1899); »Spaziergänge in der Heimat« (das. 1899); »Erdsegen. Vertrauliche Sonntagsbriefe eines Bauernknechtes«, Kulturroman (das. 1900); »Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben« (das. 1901); »Sonnenschein« (das. 1901); »Weltgift« (das. 1903); »Das Sünderglöckel« (das. 1904); »J. N. R. J. Frohe Botschaft eines armen Sünders« (das. 1904; neu bearbeitete Volksausgabe 1906); »Wildlinge« (das. 1906). Diese Werke erschienen auch mehrmals gesammelt (zuletzt in Leipzig). In steirischer Mundart veröffentlichte R. noch: »Stoansteirisch«, Vorlesungen (Graz 1885, neue Folge 1889; 4. Aufl. 1907); ferner in hochdeutscher Sprache: »Gedichte« (Wien 1891), das Volksschauspiel: »Am Tage des Gerichts« (das. 1892), »Persönliche Erinnerungen an Robert Hamerling« (das. 1891) und »Gute Kameraden, Erinnerungen an Zeitgenossen« (das. 1893). Genaue Kenntnis des Dargestellten, Gemüt und Humor zeichnen die Erzählungen Roseggers aus; seine Stärke liegt in der kleinen Form der Skizze und kurzen Erzählung; in eine Reihe solcher hübschen kleinen Bilder zerfallen auch die besten seiner größern Romane, wie »Jakob der Letzte«, »Der Waldschulmeister«. Vgl. Svoboda, P. K. Rosegger (Bresl. 1886); Ad. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart (Dresd. 1895); O. Frommel, Neuere deutsche Dichter in ihrer religiösen Stellung (Berl. 1902); Hermine und Hugo Möbius, Peter R. (Leipz. 1903); Seillière, R. und die steirische Volksseele (deutsch von Semmig, das. 1903); Kappstein, Peter R., ein Charakterbild (Stuttg. 1904); Latzke, Zur Beurteilung Roseggers (Wien 1904).
Das Geschichtenbuch des Wanderers
Novellen und Skizzen aus dem Weltleben
Wenn Dämonen spielen.
Aus dem Leben eines Freundes.
Es war das reizendste Erkerzimmer, das ich je bewohnt habe. – Es war mit mattfarbigem Sammte tapeziert, mit meisterhaften Jagd- und Genrebildern geschmückt, mit echt orientalischen Teppichen belegt, mit kunstvoll geschnitzten Eichenholzmöbeln bestanden, und es hatte an der Wand einen elfenbeinernen Telegraphentaster, der nach der Versicherung des Hausherrn bereit war, neu auftauchende Wünsche des Gastes promptest zu erfüllen. Und das war noch das Wenigste, denn derlei besitzt in irgend welcher Stadt jeder reiche Schlucker.
Aber zwei Fenster waren da, deren Spiegelscheiben so hell und rein waren, daß man meinte, sie stünden offen und die reine Nordlandsluft wehe aus und ein. Das eine Fenster zeigte die hellgrünen Buchen- und Eichenwälder von Jasmund und die weißen Strandfelsen von Stubbenkammer, das andere die blaue, unabsehbare Fläche des Meeres. Die sinkende Nachmittagssonne legte Gold auf die Wälder, Silber auf die Kreidefelsen, und ein Segelschiff am Horizont leuchtete wie ein aufsteigendes Sternlein. Ich hatte an jenem Tage zum erstenmale das Meer gesehen. Ich war erst vor zwei Stunden von der Reise gekommen, die von Wien bis Rügen zwei Tage und Nächte ununterbrochen gedauert hatte. Die Neugierde, den alten Freund zu sehen und wie sich der einstige arme Zimmermalerjunge als Gutsbesitzer ausnehme, hatte mir weder ein Interesse an den malerischen Elbe-Ufern der sächsischen Schweiz, noch an der stolzen Kaiserstadt Berlin aufkommen lassen. In Stralsund hatte er mich erwartet – es war sonst noch der alte Bursche, aber Welt hatte er nun, als wäre er geborner Majoratsherr gewesen auf diesem zauberhaften »Edelsitz« Zurkow. In drei Stunden hatten wir mit den feurigsten Hengsten, die mich je durch die Luft gerissen, die ganze Insel Rügen von Westen nach Osten durchschnitten.
Auf Zurkow angelangt, erwartete uns ein Mahl, welches zwei weißbehandschuhte Diener servierten, die so stumm waren, wie der Fisch im Wasser. Mein Gastherr wußte auch nicht gleich, wo und wie er das vor sechs Jahren durch eine plötzliche Studienreise nach Italien unterbrochene Gespräch wieder anknüpfen sollte und glaubte es am schicklichsten damit zu thun, daß er die Abwesenheit seiner Frau entschuldigte, die einer unaufschiebbaren Familienangelegenheit wegen nach Putbus gefahren sei.
Und ich? Fürwahr, mit einem Millionenmann, den man in der Künstlerblouse eines Wandmalers so oft gesehen und so liebgewonnen hat, spricht sich's etwas unglatt. Ich konnte nicht leugnen, daß Alles sehr gütig und wohlgemeint war, was mir in diesem Hause zu widerfahren begann, und doch blickte ich immer wieder mit verstohlenem Mißtrauen auf den Gastherrn hin, ob er's denn wirklich sei, der gute Wendel Blees. Daß er's gewesen war, konnte man hie und da noch spüren, aber ob er's noch sei, das schien mir in der That zweifelhaft. Ein hübscher Junge war er immer gewesen, aber sein Schnurrbärtchen war nun entschiedener, seine Gesichtszüge ausdrucksvoller und vornehm blaß, sein Mund höflicher und sein braunes Auge lebhafter geworden. Daß er seine Absicht, Künstler zu werden, nicht bewerkstelligt hatte, war aus seinem ganzen Wesen unschwer zu ersehen. Nirgends der schöpferische, idealbeschwingte Geist; überall der formenängstliche, emporgekommene, reiche Mann. An dem überladenen Aufputz der Tafel, an der Auswahl der ziemlich auffallenden Leckerbissen und an der etwas barschen Art, womit er die Dienerschaft behandelte, war zu erkennen, daß er in diesen Verhältnissen nicht immer heimisch gewesen und das rechte Maß nicht ganz leicht zu treffen wisse.
Nachdem ich meine Reise-Erlebnisse zur Noth skizzirt und meinem Freunde über mein allgemeines Befinden die geziemende Mittheilung gemacht hatte, schloß Wendel, daß ich von der Reise ermüdet sein würde und wies mir mein Zimmer an, »um mich auszuruhen«.
Ich hatte nun unersättlich zu den Fenstern hinausgeschaut in die mir so seltsame, zauberhaft schöne Gegend. Ich hatte eine der vortrefflichen Cigarren angebrannt und mich auf das Ruhebett hingestreckt und den mich umgebenden Luxus betrachtet und in die stille leere Luft hinein gefragt: Wendel Blees, du leichtsinnig Wienerkind, wie kommst du zu diesem Herrensitz im Inselreiche der Hünen?
Es war damals kaum neun Jahre her, als ein aufgeschossenes Bürschchen ziemlich selbstsicher in meine Arbeitsstube getreten war, meine Bilder scharf angeblickt und mich gebeten hatte, daß ich ihn in seiner Absicht unterstützen möge, er wolle Maler werden. Wer er wäre? fragte ich. »Nichts«, war seine Antwort, »ich bin ein Waisenkind, das ein entfernter Verwandter aufgezogen und dann im städtischen Rechnungsamte untergebracht hat, wo ich Ziffern zeichnen soll. Das ist aber nichts, ich bin durchgegangen, denn ich will Maler werden.« Ob er mir Proben von seinem Talente zeigen könne? Da hatte er schon mehrere Papierblätter aus der Tasche gezogen; dieselben enthielten Zeichnungen aus dem Schönbrunner Thiergarten, aus dem Militärleben und eine Auffahrt bei Hofe; Manches war mit ziemlich grellen Farben bemalt. Nachdem ich diese Bilder besehen hatte, sagte ich zu dem jungen Mann, daß ich aus diesen Proben nichts zu erkennen vermöge und ihm doch rathe, sich einem Beruf zuzuwenden, der weniger trügerisch sei, als das Künstlerthum. Er verwies auf Maler, die so klein wie er angefangen, es aber zum Ruhm gebracht hätten. Ich blieb bei meiner Ansicht, lud ihn aber ein, wenn er in seinen freien Stunden neue Bilder versuchen sollte, mir dieselben seinerzeit wieder zu bringen. Das war das erste Begegnen mit Wendelin Blees. Wir sahen uns von diesem Tage an oft. Obwohl ich gar nichts für ihn zu thun vermochte, schloß er sich an mich. Da er bei einem Maler nicht unterkommen konnte, so ging er zu einem Anstreicher in die Lehre, denn die Farbe hatte ihm's angethan. Die freien Stunden, die er hatte, war er bei mir, sah meinen Arbeiten zu und übte sich selbst. Er eignete sich eine gewisse Technik an, aber es war kein Schwung da, keine Originalität – überhaupt kein Talent.
Ich sagte es ihm, er glaubte mir nicht.
Indeß gewann ich ihn lieb, anfangs seines Interesses für die Kunst wegen, später, weil er ein offener, herzens- und geistesfrischer, fröhlicher Junge war. Schrullen hatte er freilich, oft so wunderliche Schrullen, daß ich mir dachte: das wächst sich zu einem Narren oder doch zu einem großen Manne aus. Er war um ein Bedeutendes jünger als ich, aber wir wurden Freunde. Er hatte eigentlich keine Bildung genossen, aber er hatte liebenswürdige Naturanlagen, und wenn in seinem Wesen auch ein gewisser Trotz lag, so diente derselbe mehr zur Stählung seines Charakters, als um anderen Menschen unangenehm zu sein. Es hat sich manch strenge geschulter Mann als mein Freund bekannt, der mir nicht so viel war, als der kleine Wendel. Er hat, in Bezug auf das, während unseres zweijährigen Beisammenseins nur eine einzige Dummheit gemacht. Auf mehreren Ausstellungen erregte ein Bild von mir besonderes Aufsehen. Als Folge des Beifalls erwuchsen – wie das immer so geht – auch die Widersacher. Einen solchen Widersacher, es war ein Zeitungsredacteur, forderte der kleine Wendel meines Bildes wegen zum Duell. Der Redacteur machte ihn abtreten und lachte ihn aus. Nun kam er wüthend zu mir und ich lachte ihn auch aus.
Seinem Meister, dem Anstreicher und Zimmermaler, war er ein fleißiger Gehilfe, aber Niemand als ich wußte, mit welchem Widerwillen er das Handwerk betrieb. Und eines Tages trat er aufgeregter als sonst in meine Stube und sagte, daß er nun komme, um von mir Abschied zu nehmen. Er habe sich so viel erspart, daß er nach Italien gehen könne, um sich an den berühmten alten Meistern zu unterrichten.
Ich fragte, ob er wohl ermesse, was er gesagt habe. Er antwortete, daß ich noch von ihm hören würde und daß er auch als Künstler meiner Freundschaft, die ihm das Theuerste auf dieser Welt sei, würdig werden wolle. Ich suchte ihm in der Eile ein paar Empfehlungsschreiben aufzudrängen, dann ging er. Ging ohne Geld – denn sein Erspartes half ihm kaum bis über die Grenze – ohne Kenntnisse, ohne Freunde und ohne Plan nach Italien.
Von dem Tage seiner Abreise an war er verschollen. Und war's jahrelang, so daß mein Gedenken an ihn voll Wehmuth wurde, wie man eines Todten gedenkt. Mein Leben ging in der Stille fort, aber jedes Jahr machte mich um mehrere Jahre älter, weil mit dem Wachsen meiner Einsicht mich meine künstlerischen Erfolge, so lärmend dieselben auch sein mochten, immer weniger und weniger befriedigen wollten. Die Ehre, welche mir die durch Effect leicht zu bestechende Menge zollte, vermochte meinen inneren Unmuth nicht aufzuwiegen und so zog ich mich sachte zurück in die Beschaulichkeit, lebte der Natur und machte Reisen von Gallerie zu Gallerie, um das an Anderen mit Ehrfurcht zu bewundern, was mir selbst nicht gelingen wollte. Von Wendel fand ich auch nicht die leiseste Spur. Da erhielt ich eines Tages in Wien das folgende Schreiben:
»Geschätzter Freund!
Für den Fall Du einmal Lust nach malerischen Landschaften hast, so reise nach der Insel Rügen. Und wenn Du dort sein wirst, so versäume ja nicht, nach dem Landgute Zurkow zu fragen, denn der Besitzer desselben ist ein alter Freund von Dir, der Dich bittet, es Dir bei ihm recht wohl ergehen zu lassen. Er hofft, daß Du seiner nicht vergessen haben wirst und freut sich sehr, Dich nach sechs Jahren endlich wieder zu sehen. Es ist Dein alter
Wendelin Blees.«
Die Schrift war glatter geworden als sie einst gewesen, aber es war die seine. Mein Erstaunen war fast grenzenlos. Zur alten Neigung kam nun auch die Neugierde. Leicht mobil gemacht war ich überhaupt und schon an einem der nächsten Tage saß ich auf der Nordbahn.
Von Anklam bis Stralsund hatte ich Gelegenheit, mich bei einem Passagier, der aus Bergen, dem Hauptorte der Insel Rügen, war, nach dem Landgute Zurkow und seinem Besitzer zu erkundigen. Da erfuhr ich, daß Zurkow zwar kein Edelsitz sei, wohl aber eines der schönsten und reichsten Güter der Insel. Es wäre ein Edelsitz gewesen, aber der letzte Edelmann hätte ihn am Spieltisch eines rheinischen Bades verloren und sich flink darauf erschossen. Hierauf sei ein pommerscher Holzhändler gekommen, Markeitze geheißen, der habe das zerfahrene Zurkow gekauft und in einen Stand gesetzt, wie es seit Menschengedenken nicht erhört worden. Der Landbau und die Waldwirthschaft, die Jagd und die Fischerei blüheten nun. Auch habe der neue Eigenthümer von Jurkow Bergwerke in England besessen und Schiffe, die zwischen Stettin und Kopenhagen verkehrten. Und das Schloß habe er herstellen und einrichten lassen, daß es nun einer königlichen Residenz ähnlich sehe. Das habe ihm aber Alles nichts geholfen; mit seinem Sohne sei er unglücklich gewesen und so sei er, nachdem das Gut so fürtrefflich hergestellt war, aus Gram gestorben. Es sei aber ein junger Mensch aus dem Süden dagewesen, der habe die Tochter von Markeitze gefreit und sei nun Herr auf Zurkow und sei gut für drei Millionen. Man erzähle sich von dieser Familie Mancherlei, aber da nichts Bestimmtes zu sagen sei, so thue man am besten, zu schweigen.
So war ich vorbereitet worden und so lag ich nun auf dem Ruhebette des Schlosses Jurkow – ich konnte nicht sagen, daß mir gerade wohl zu Muthe war.
Nun dämmerte es und als ich wieder zum Fenster hinausblickte, war das Meer nicht blau, sondern lichtgrau und in seinem Quecksilberschimmer am Horizonte scharf abgeschnitten von der aufsteigenden Nacht. Das Schiff, welches früher fern wie ein Sternchen gefunkelt, war näher gekommen, es war das einzige Fahrzeug auf der unmeßbaren Fläche. Auf den Felsen von Stubbenkammer glühte der Widerschein des Abendrothes und sie spiegelten sich im Meere wie blutige Schatten.
Als ich träumend so zum Fenster hinaus schaute, legte sich sachte eine Hand auf meine Achsel. Wendel stand hinter mir.
»Wenn Du ausgeruht hast,« sagte er, »so lade ich Dich ein, mit mir zum Abendbrot zu kommen.«
»Hier hast Du eine merkwürdige Welt um Dich,« lautete meine Entgegnung, »ich habe diesen stillen, meerumschlungenen Hain als Knabe im Traume gesehen, zur Zeit, da wir die nordische Mythologie studirten.«
»So ist es,« antwortete er rasch, »so ist es. Darum kann dieser Ort so anheimelnd und so schrecklich sein.«
»So schrecklich?«
Jetzt faßte mich Wendel an meinen beiden Händen und sagte: »Geliebter Freund, ich danke Dir tausend-, viel tausendmal, daß Du zu mir gekommen bist.«
Seine Hände zitterten, sein Stimme war so seltsam bewegt, daß es mir durch Mark und Bein ging.
Die Kruste war nun gebrochen, bei ihm, bei mir. Arm in Arm gingen wir auf das Zimmer, in welchem unser Abendtisch gedeckt war. Es war ein anderes, als jenes, in welchem wir das Mittagmahl genommen hatten, es war viel einfacher und viel heimlicher. An der Wand fiel mir ein technisch mit Meisterschaft gemachtes, aber an Aehnlichkeit nicht besonders gelungenes Oelporträt meines Gastherrn auf. Wir saßen uns bei etwas gedämpftem Lampenlichte an einem kleinen Tisch gegenüber; sonst war Niemand da, und der Mann, der uns bediente, erschien nur, wenn er mit dem Glöcklein gerufen wurde. Die Speisen waren nach Wiener Art zubereitet, und anstatt des aufgeblasenen Champagners stand eine Flasche jenes ehrlichen, männlich herben Rothweines da, wie er in den gottgesegneten Thalungen der tirolischen Etsch wächst, und wie ich ihn in Gemeinschaft mit Wendel einst so gerne getrunken hatte.
»Nun haben wir uns wieder,« sagte mein Freund und schaute mir mit feuchtem Auge in's Gesicht.
»Ich kann mich immer noch kaum fassen vor Verwunderung, Dich so wiederzufinden,« bemerkte ich.
»Mir erging es nicht besser,« sagte er, »aber ich bin in den letzten Stunden, während Du Dich von den Reisestrapazen für den ersten Augenblick ein wenig erholtest, nicht müßig gewesen. Ich habe nach der Art gesucht, die uns wieder zusammenbringen soll, wie wir dazumal beisammen gewesen sind. Offen herausgesagt: mit den ersten Stunden unseres Wiedersehens war ich nicht zufrieden.«
»Ich auch nicht. Aber nun sage mir endlich, Wendel, was um Alles in der Welt ist mit Dir vorgegangen?«
»Du siehst es,« antwortete er mit einer wehmüthigen Miene, »ein reicher Mann bin ich geworden.«
»Das passirt Manchem und geht es gewöhnlich mit so natürlichen Dingen zu, daß man weiter gar nicht darüber spricht. Aber bei Dir ist's was Anders. Du warst stets unpraktisch, hast weder Schick gehabt zum Spiel noch zum Speculiren, hast weder ein Los besessen noch einen reichen Onkel. Du hast auch meines Wissens nie ein Interesse gehabt an Geld und Herrlichkeit – Künstler werden wolltest Du, diesen Weg sah ich Dich von mir fortziehen, nun finde ich einen Millionär. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, mein Freund!«
»Du hast eine naheliegende Eventualität nicht erwähnt.«
»Ich weiß es, die reiche Heirat. Doch der Gedanke ist mir zu trivial.«
»So decorire ihn mit der Liebe.«
»Wirklich? Nun, die Liebe rentirt eine reiche Heirat immerhin.«
»Und meinst Du, daß eine reiche Heirat nicht auch die Liebe rentiren könnte?«
Der Ton und der Blick, mit dem diese Worte gesprochen wurden, war etwas verblüffend. Ich schwieg.
»Du hattest damals Recht,« fuhr er fort, »ich bin kein Künstler geworden.«
»Aber Du bist Mann geworden, das ist mehr.«
»Es mag mehr sein, aber es ist nicht so schön. Freund, wann war ich glücklicher, als damals, als ich mich wie ein Bettelvagabund durch die Alpenländer nach Italien schlug! Ich war fest überzeugt, daß meine Rückkehr ein Triumphzug sein würde und daß die abenteuerliche Wanderschaft des Zimmermalers einst ein interessantes Capitel in der Biographie des berühmten Künstlers geben müsse. Ein junger Idealist, und wäre es auch nur ein eitler Tropf, nimmt im Reigen irdischer Seligkeit den ersten Platz ein. Ich habe diesen Platz bald verloren. In der schönen Stadt Mailand sah ich das Abendmahl – ein Triumph der Zimmermalerei,« setzte Wendel lächelnd hinzu. »Ich griff dort aus Noth wieder nach dem alten Gewerbe. Ein Zufall verschlug mich mit einem Arbeitsgeber nach Genua und vor dem baroken Denkmale des Columbus kam mir der Gedanke, ob ich mich nicht etwa doch der Bildhauerei zuwenden solle. Auf jeden Fall wollte ich von hier aus zur See nach Rom gehen, dort weht alte, echte Künstlerluft, die wollte ich erst athmen, das Weitere konnte nicht fehlen. Da trat ich eines Tages in ein Gasthaus der Via nuova. Das, Freund, war der erste Schritt nach dem Herrengute Zurkow auf Rügen.«
»Im Gasthofe lerntest Du sie kennen, nicht wahr?«
»Wen?«
»Die schöne Maid, die mit dem Vater auf Reisen war und die hernach Deine Frau wurde.«
»Du dichtest,« sagte Wendel Blees, »meine Geschichte ist noch viel romanhafter – fast unheimlich romanhaft.«
»Bin ungeduldig, sie zu hören,« sagte ich.
»So werde ich rasch und kurz erzählen. – In einer Weinlaube des Gasthausgartens setzte ich mich ermüdet hin und musterte die Speisekarte. Ich suchte nicht nach dem feinsten Braten, sondern in der Preisrubrik nach der kleinsten Ziffer – nun, das kannst Du Dir ja denken. Es war für die Italiener noch nicht die Zeit des Mittags, so war der Garten noch fast leer, nur hinter einem Citronenbaum saß ein Herr mit weißem Backenbart und schaute zwischen den grünen Blättern zu mir herüber. Er schob endlich seinen Teller beiseite und blickte noch schärfer auf mich her. Endlich stand er auf, kam an meinen Tisch und drückte mir die Hand. Er that es, ohne ein Wort zu sagen, dann trat er wieder an seinen Tisch zurück und brütete vor sich hin. Dann zog er aus seinem Ledertäschchen eine Photographie und sah sie an und schaute auf mich – und stützte sein Haupt traurig auf die Hand. Jetzt mußte auch ich immer wieder auf ihn hinblicken und ich wurde dabei ganz unruhig; ich bildete mir ein, das wäre ein großer Künstler und habe an mir vielleicht das Genie entdeckt; Du siehst, ich hatte nicht mehr weit zum letzten Ziele manchen Künstlers – zum Narrenhaus. Es gehörte ein Wunder dazu, um mich davon zu retten – und das Wunder geschah.« »Als ich,« fuhr mein Freund Wendel fort, »mich zur Noth gesättigt hatte, erhob ich mich, um meine nebelhaften Wege weiter zu wandeln. Da sprang der Mann am Citronenbaume auf, hielt mich zurück, er wolle wissen, wer ich wäre.«
»Also ein Polizeiorgan!« rief ich aus.
»Mein Bester,« sagte Wendel, »wenn Du in meiner Geschichte die Wahrheit errathen willst, so mußt Du Dich gerade an die größten Unwahrscheinlichkeiten halten. Der Mann hörte meine Geschichte, kaufte mir neue Kleider und ich war tagelang sein Gast. Er war liebevoll und fast zärtlich mit mir, und er war doch nur ein Fremder. Mehrmals sah ich ihn weinen. Er lud mich ein, mit nach Rügen zu kommen, wo er ein Gut habe, er wolle für mein Fortkommen sorgen helfen.«
»Er hatte Dich so plötzlich lieb gewonnen?«
»Und weißt Du, warum? Weil ich große Aehnlichkeit mit seinem verstorbenen Sohne hätte.«
»Du gingst mit ihm?«
»Natürlich, ich ging nicht mit ihm, ich ging nach Rom. Und als ich dort meine Künstlergelüste gründlich ausgehungert hatte, und in dem Gemäuer des Colosseums bei den Fledermäusen mein Nachtlager hielt, fiel mir wieder die Einladung des greisen Mannes ein. Ich schrieb ihm, daß ich nun kommen wolle und ob er für mich einen Erwerb hätte; wäre es was immer, nur ein ehrlich Brot. Er schickte mir Geld, ich reiste auf dem kürzesten Wege nach Rügen. Als ich nach Zurkow kam – auf dieses schöne, reiche Zurkow, ja – da hat er mich wie einen lieben Anverwandten empfangen, hat seine Tochter gerufen, mich ihr vorgestellt und ausgerufen: Nun Freda, ist er's nicht? – Ja, sagte Freda, und doch wieder nein, Albin war nicht so schlank. Aber er hatte dasselbe nußbraune Haar, das ihm gerade so in die Stirn stand, denselben Mund, das, ganze Gesicht; schau sein Aug' an, Freda, schau sein Aug' an! O Gott, mein Albin! – Er hat geweint, sie hat ihn mit Mühe beruhigt –«
»Und Dein Auge?«
»Das hat sie angeschaut.«
»Dann verliebt?«
»O nein,« antwortete mein Freund Wendel, »so schnell ging das nicht. Wir mußten uns erst aneinander gewöhnen. Der Alte gab uns zu schaffen, der wollte – höre es! – er wollte uns schon in den nächsten Wochen zusammenhaben. Er war durch den plötzlichen Verlust seines Sohnes verwirrt und schwachsinnig geworden.«
Wendel führte mich dann zum Fenster: »Du siehst dort die weißen Felsen?«
Ich sah sie in des Mondenscheines nebelhafter Blässe schroff aus dem Meere aufragen.
»Von jenem Felsen,« fuhr mein Freund fort, »ist Albin Markeitze, der einzige Sohn des reichen Mannes, in seinem dreiundzwanzigstcn Lebensjahre auf einer geologischen Excursion, bei welcher er sich zu tollkühn an die Hänge hinauswagte, in das Meer gestürzt und zu Grunde gegangen. Der Vater war trostlos, seine Tochter, nun sein einziges Kind, suchte ihn umsonst zu zerstreuen, er gab sie zu Verwandten nach Putbus, überließ das Gut einem Verwalter und ließ sich von seinem Grame ziellos in der Welt herumtreiben. So war er auch nach Genua gekommen, wo wir uns begegneten. Ich kann ihm die Liebe, die er mir schenkte, nimmer vergelten, der kranke Greis sah in mir seinen verstorbenen Sohn. – Hast Du dieses Bild schon betrachtet?« Wendel wies auf das Oelgemälde an der Wand. »Das scheint ein gewandter Künstler geschaffen zu haben,« bemerkte ich, »es ist viel Individualität in dem Bilde und doch stört mich ein Etwas in den Zügen, ohne daß ich mir sagen könnte, worin es liegt. Durch die wohlbekannte Form schaut mich eine fremde Psyche an.«
»Im Ganzen leugnest also auch Du die Aehnlichkeit nicht. Und siehe, das ist das Porträt des verunglückten Albin.«
Das fand ich denn doch merkwürdig und nun fing ich an, das besondere Interesse des alten Markeitze für Wendel zu begreifen.
»Da mir,« fuhr mein Freund fort, »die Lust, Maler zu werden, begreiflicherweise vergangen war, wenigstens einstweilen vergangen, so fügte ich mich gerne den fürsorglichen Wünschen meines Gönners, ich gab mich, anfangs gleichgiltig, später mit Interesse, der Landwirthschaft hin und machte in derselben Fortschritte. Außerdem geschah Manches zur Vermehrung meiner sonstigen Kenntnisse, damit wuchs auch – möchte ich sagen – mein Herz und ich schloß mich warm und dankbar meinem Wohlthäter an. Ich war kaum drei Jahre auf Zurkow, als mir Markeitze eines Tages zu verstehen gab, daß es ihm lieb wäre, wenn noch vor seinem Tode meine Verbindung mit seiner Tochter zu Stande käme. Freda war um einige Monate älter als ich, sie war mir nicht unangenehm gewesen. Es hatten sich, wie leicht erklärlich, reiche Bewerber eingefunden, allein –«
»Sie hat den frischen, guten Jungen vorgezogen,« unterbrach ich in meiner vorwitzigen Ungeduld, »reich war sie selbst, gesellschaftliche Rücksichten war sie nicht schuldig, so nahm sie sich einen Herzensmann. Ich habe mir oft gedacht, Wendel, daß in Dir Trotz und Geschmeidigkeit, Männlichkeit und Weichheit gerade so gemischt sind, wie es die Weiber gerne haben.«
»Genug. Als der Vater starb, waren wir ein Ehepaar und ich habe mich wohl oder übel mit meiner neuen Würde und Herrlichkeit abfinden müssen.«
»Aufrichtig gesagt, hoffe ich, daß Dir die Kunst, ein reicher und glücklicher Mann zu sein, besser gelingen wird, als Dir jemals ein gutes Gemälde gelungen wäre.«
Eine Weile nach dieser Bemerkung antwortete Wendel: »Es gehört zum Einen wie zum Andern ein großes Talent. Wenn sich der reiche Mann in seine Lage nicht zu schicken weiß, so ist er ein armer Mann – ein sehr armer Mann.«
Derlei besprachen wir, da begann allmählich das Gespräch zu stocken. Wir machten noch manchen stillen Schluck aus unseren Gläsern, dann wünschten wir uns in freundlicher Höflichkeit gute Ruhe und ich wurde hierauf in mein Zimmer geführt.
Ich stand noch lange am Fenster und blickte in die Nacht hinaus. Auf dem Meere lag der Schimmer des Mondes und die zackigen Kreidefelsen von Stubbenkammer standen wie Gespenster da. Jetzt legte sich auf meine Schulter wieder die Hand. Wendel stand neben mir und war bleich und verstört, wie ein Nachtwandler.
»Verzeihe mir, mein Freund, daß ich Deine Ruhe störe,« sagte er mit unsicherer Stimme, »ich wollte Dich heute noch fragen, wann Du von hier abreisest?«
Mit Befremden entgegnete ich: »Wann ich abreise? Ich glaube, Du könntest es ebenso gut erfahren, wenn Du mich gefragt hättest, wie lange ich denn zu bleiben gedächte. Du weißt, daß ich auf Deine Einladung aus Wien komme, um Dich zu besuchen.«
»Ich danke Dir, daß Du gekommen bist!« stieß er hervor, »aber ich verreise morgen und wünsche in Deiner Gesellschaft zu reisen.«
Ich starrte ihn an.
»Du hältst mich für verrückt,« sagte er.
»Allerdings – «
»So muß ich Dir's denn gestehen, Freund, mein geliebter einziger Freund – ich bin unglücklich, sehr unglücklich. Ich ertrage es nicht mehr länger, ich will fliehen, ich will nach Wien zurück. Mein Weib und ich, wir lieben uns nicht. Sie behandelt mich mit Hochmuth, sie hat ihre Freunde, mit denen sie sich herumtreibt, fischt und jagt; ihrem Reitpferde schenkt sie mehr Aufmerksamkeit als mir. Von einem Familienleben ist in diesem Hause nicht der Schatten, entweder sie zieht ihre junkerlich faden oder aufgeblasenen Sportgenossen herbei und giebt laute Feste, wobei ich offen und verstohlen die Zielscheibe ihrer Launen bin, oder sie reitet davon und läßt mich allein in diesem Schlosse, das mir unheimlich geworden ist, wie eine Gruft. Ich hätte mit ihr für mein Leben gern einmal eine Reise nach Oesterreich gemacht; sie schlug mir's ab, ich möge allein reisen, wenn es mir auf Zurkow nicht behage, sie sei keine Freundin der vielgerühmten österreichischen Gemüthlichkeit. Das einzige Glück ist, daß ich sie nicht liebe, denn sonst müßte ich mich von jenem Felsen dort, welcher die erste Ursache meiner Leiden ist, in das Meer stürzen. Ich habe nichts und will nichts, ich bin frei, ich verlasse Zurkow noch in den nächsten vierundzwanzig Stunden, arm wie ich gekommen bin. Ich gehe mit Dir nach Wien.«
»Du mußt Deine Aufregung vorübergehen lassen, armer Freund,« sagte ich, »wenn Du ruhig geworden sein wirst, wollen wir es überlegen.« »Diese Ceremonie ist nicht mehr nöthig. Ich habe es längst überlegt und heute mich entschlossen. Ich habe sie von Deiner Ankunft unterrichtet und sie gebeten, daß sie zu Hause bleibe, um Dich zu empfangen; sie weiß, daß Du mein liebster Freund bist, der aus der Ferne zu mir kommt, und sie konnte das Haus verlassen, und sie konnte mir das lieblose Wort sagen.«
»Welches Wort?«
»Wen ich eingeladen, den möge auch ich bewirthen, sie könne sich denken, wie mein bester Freund aus der Zeit der Farbenkleckserei aussehe, sie sei auf derlei vagabundirendes Künstlervolk nicht neugierig. Tiefer hätte sie mich nicht mehr verletzen können. Ich trenne mich von ihr.«
»Ich danke Dir,« sagte ich, »also mich willst Du zur Ursache eines unsinnigen Schrittes machen! Dann empfehle ich mich.«
»Bleib', Hans!« schrie er auf und packte mich an beiden Armen, »von Dir ist keine Rede. Es handelt sich um mich! Mir hat sie den Schlag versetzt, sonst wollte sie nichts, als mich, mich beleidigen, aber das wollte sie. Meiner überdrüssig ist sie, den Bruch wünscht sie zu vollziehen. Der Wunsch kann erfüllt werden.«
Der Mann schoß wildsprühende Blicke um sich und knirschte mit den Zähnen.
»Du hassest sie also?« war meine Frage.
Hierauf antwortete Wendel: »Wenn ich sie haßte, so würde ich ihr diesen Wunsch nicht erfüllen, ich würde Herr auf Zurkow bleiben und das Leben des Reichen genießen und ihr im Wege stehen und mich an ihrem ohnmächtigen Aerger belustigen. Nein, ich hasse sie nicht, sie ist mir gleichgiltig.«
»Gleichgiltig? Deine Aufregung straft Dich Lügen.« »Bin ich aufgeregt? Dann bin ich's nicht ihretwegen, sondern meinetwegen. Mein Unglück, ich schleudere es von mir, ich nehme wieder die Armuth und Nichtigkeit auf mich. Seit ich Dich sehe, mein Freund, habe ich wieder Muth, ich gehe mit Dir nach Wien!«
Das kam mir nun etwas verworren vor; da fragt er mich: »Könntest Du an meiner Stelle bleiben? Es mögen Gesetze und Sitten hundertmal für Dich sprechen, wenn die Thatsache zeigt, daß Du überflüssig bist, so wirst Du auf alle Rechte verzichten und lieber mit Stolz und Ehren wieder der arme Anstreichergeselle sein, als auf Zurkow ein – was weiß ich! Es war ja nichts, ein toller Traum, nichts als ein Roman, aber ein Roman ohne Liebe. Eine fixe Idee, geschmeichelte Eitelkeit und der Kitzel, reich zu sein, waren die Helden! Könntest Du mich denn noch achten, wenn ich so noch hier sitzen bliebe?«
»Ich gebe keine Antwort, so lange ich nicht Deine Frau gesehen habe.«
»Die wirst Du nicht sehen,« sagte Wendel Blees, »wie ich sie kenne, kehrt sie erst zurück, wenn sie die Gewißheit hat, daß Du nicht mehr im Hause bist.«
»Dann erlaube mir, daß ich jetzt einige Stunden ruhe. Bevor die Sonne aufgeht, werde ich dieses Haus verlassen.«
»Thue so, mein Freund, und schlafe wohl.«
Rasch hatte sich mein Gastherr nun entfernt. Unsere Unterredung hatte einen fast trotzigen Charakter gehabt. Ich schlief schlecht in derselben Nacht. Reue, daß ich hierhergekommen, Mitleid mit dem armen Wendel, Rathlosigkeit, was nun anzufangen, peinigten mich. Es kam mir der Gedanke, Frau Freda aufzusuchen und den Vermittler zu spielen; diesen Gedanken schleuderte ich rasch von mir – zwischen Eheleute dränge sich kein Dritter, am wenigsten ein Fremder. Er würde es unter allen Umständen noch schlechter machen. Als der erste Schimmer des Morgens aus dem Meere stieg, war ich entschlossen. Ich packte hastig meine Sachen zusammen, schrieb auf ein Blättchen Papier die Worte: »Wendel, ich bin aus Wien hierher gekommen, um Dir auf dieses Stück Papier das Wort zuschreiben: Sei ein Mann. Lebe wohl.
Dein treuer Hans.«
Als ich durch den Hof eilen wollte, fuhren zwei Bullenbeißer auf und ließen mich nicht weiter. Ich mußte umkehren in mein Zimmer, warf mein kleines Gepäck zum Fenster hinaus und kletterte selbst nach. Das Schloß und das naheliegende Gehöfte lagen noch in Ruhe da; ich huschte durch Gestrüppe hin und bog erst eine Strecke weiter hin zum Wege.
Ich war auf demselben etwa dreihundert Schritte gegangen, als von einer Eichengruppe ein Mann auf mich zusprang und mich mit dem Worte: »Da bist Du ja schon!« an der Hand faßte.
Wendel war's, der Herr auf Zurkow: Und doch nicht mehr der Herr auf Zurkow, in dem Kleide eines fahrenden Gesellen stand er da.
»So, Kamerad,« sagte er, »nun wollen wir einmal mitsammen wandern.«
Dagegen ließ sich nun nichts einwenden. Wir trabten wortkarg nebeneinander her. Als wir eine Stunde gegangen waren, machte mein Begleiter plötzlich einen Juchschrei, wie er so frisch und laut auf Rügen vorher wohl kaum erklungen sein mochte.
»Sieh da, dieser Stein ist mir noch auf dem Herzen gelegen,« sagte er hernach und deutete auf einen bemoosten Grenzstein, »hier endet das Gut Zurkow, hier beginnt die weite Welt. Freund, nun bin ich wieder Dein!« Da dachte ich: Wenn ich nur wüßte, was ich mit Dir anfangen soll!
So begann die Wanderschaft. Den Sund übersetzten wir auf einer abseits gelegenen Fischerbarke, Stralsund umgingen wir, weil Wendel sich vor dem Erkanntwerden fürchtete. Und dann wollte er zu Fuß nach Wien reisen. Er hatte von dem Schlosse ja nichts mit sich genommen, als was er einst dahin mitgebracht hatte, ein abgeschabtes Ledertäschchen und einen Hagenstock. Ich hatte viele Mühe, um ihm die Eisenbahnfahrt anzuzwingen. Endlich, als es in's Oesterreich hereinging, fanden wir uns und waren harmlos heiter, wie einst; ich suchte seine Verhältnisse mit Ruhe und Erwägung zu besprechen, allein er war dazu viel zu nervös aufgeregt; bei ihm ging Alles im Ueberschwunge und sein ganzes Wesen wurde mit fortgerissen.
Als er die alte Kaiserstadt sah, war er überglücklich. So saßen wir nun endlich wieder in meiner Stube, wo wir vor Jahren oft froh beisammen gesessen und ich fragte ihn: »Wenn Du jetzt zurückdenkst auf Zurkow, wie ist Dir zu Muthe?«
»Unsäglich wohl!« rief er, »hast Du einen zweiten Freund, Hans, der im Stande ist, ein Herrenschloß und ein reiches Weib von sich zu schleudern, wie eine faule Birne?«
»Du bist der einzige,« sagte ich, »und nun suche ich mir noch einen, der im Stande ist, ein Herrenschloß und ein reiches Weib zu beherrschen.«
»Da wird sie zurückgekehrt sein auf Zurkow,« sagte Wendel, »ausgerüstet mit neuen Mitteln, mich zu demüthigen, und wird selbst die größte Demüthigung erlebt haben, die ein reiches Weib erleben kann: von dem Bettler abgelehnt zu sein.«
Schon am nächsten Tage war Wendel Blees so glücklich, in einem Vororte Wiens als Zimmermaler Beschäftigung zu finden. Er besuchte mich häufig, aber für meine Bilder und ästhetischen Studien hatte er kein Interesse mehr, er saß zumeist still da und blickte zum Fenster hinaus auf die alten Ulmen und Eichen eines verwahrlosten Parkes. Von seinem abenteuerlichen Gutsherrnleben sprachen wir nicht mehr; ich aber dachte daran und mir kam die ganze Geschichte nicht geheuer vor.
Ich wußte nur, daß er seiner Gattin nicht schrieb und ihr absichtlich seinen Aufenthaltsort verheimlichte. Umso eifriger las er ein Pommer'sches Wochenblatt und in demselben einmal eine Feilbietung des Gutes Zurkow auf Rügen. Er zeigte mir mit dem Finger die Stelle; wir haben nicht ein Wort darüber gesprochen.
Mittlerweile bemerkte ich, daß die Farben – die grünen sollen besonders schädlich sein – dem Wendel Blees nicht mehr so wohl bekamen, als einst, er wurde bleich und bekam eingefallene Wangen. Seine Besuche bei mir verminderten sich, er strich in seinen freien Stunden allein umher in den Vorstädten oder er saß in seiner Dachkammer und brütete vor sich hin. Als ich von einer größeren Reise zurückgekehrt war, gedachte ich wieder einmal seiner und suchte ihn auf. Ich fand ihn auf dem Fußboden kauernd, wo er eben ein paar Patronen (Formen für Zimmermalerei) aneinanderzuheften vorhaben mochte, aus Erschöpfung aber rasten mußte. Ich erschrak vor der herabgekommmen, krankhaften Gestalt, vor dem stieren Blick, der mich völlig unheimlich anglotzte.
»Bist Du krank, Wendel?« fragte ich.
»Was habt Ihr denn mit mir?« fuhr er jetzt auf, »warum soll ich krank sein?« Dann setzte er wehmüthig und sanft bei: »So hast Du doch nicht ganz auf mich vergessen. Du kannst mir aber nicht helfen.« »Willst Du nicht bisweilen mit mir einen kleinen Spaziergang machen? Das zerstreut und erfrischt.«
»Wenn Du recht langsam gehen willst,« versetzte er, »ich war schon lange nicht mehr auf der Gasse und habe das Gehen verlernt.«
Als ich von ihm fortging, hastete mir die alte Frau, die ihn pflegte, zur Thüre nach und fragte: »Wie lang' kann er's denn noch machen, Herr Doctor?«
Es waren freundliche Spätherbsttage. Ich führte den armen Wendel mehrmals auf den Ring; er sprach wenig, nur einmal, als er stehen blieb und sich an mich stützte, sagte er, mit großen Augen hinschauend: »Es ist eine herrliche Stadt!« Dann saßen wir auf einer stillen Bank des Stadtparkes und er schaute die gilbenden Blätter an, wovon eins um's andere langsam zu Boden sank.
Da war's eines Tages, als wir über den Schwarzenbergplatz schritten, daß mein Begleiter plötzlich einen Schrei ausstieß. Ein Fiaker rollte vorüber, in welchem eine schwarzgekleidete Dame saß. Wendel riß sich von mir los und mit ausgestreckten Armen lief er dem Wagen nach. Ich suchte ihn zurückzuhalten, aber er eilte, als wären seine Arme Flügel, er verfolgte den Wagen bis zur Brücke, dort stürzte er zusammen.
Allsogleich waren wir von einem Menschenhaufen umringt. Wir hoben ihn auf. Seinem Mund entströmte Blut; er schlug die Augen weit auf, und stierte um sich und murmelte: »Sie ist fort.«
»Wen meinst Du, Wendelin?«
»Freda!« hauchte er matt. –
Man trug ihn in einem geschlossenen Lederkasten in's nächste Lazareth; als sie ihn in der Halle niederließen und ich die Klappe öffnete, um zu fragen, wie er sich befinde, da waren die blassen Lippen für immer verstummt.
Man erinnert sich vielleicht noch an eine Zeitungsnotiz, daß an jenem Octobertage ein Mann einem Fiaker nachgelaufen, auf der Schwarzenbergbrücke mit dem Rufe: »Freda!« zusammengebrochen und bald darauf verschieden sei.
Aber man weiß wohl nicht, daß diese Notiz einen seltsamen Besuch in der Leichenhalle zur Folge gehabt hat. Eine fremde Dame fand sich ein, bat sich die Leiche des Zimmermalers Wendelin Blees aus, bekränzte sie mit Eichenlaub, überführte sie auf einen still und lieblich gelegenen Friedhof des Wienerwaldes und begrub sie in einem eigenen Grabe.
Ich versuchte, sie zu sprechen, aber sie war unzugänglich und ist seither nicht wieder gesehen worden. Auf Wendel's Grabstein stehen die Worte: »So groß ist meine Liebe zu Dir, daß ich Dir verzeihe und sterbe.«
Ob sich diese Worte auf ihn beziehen oder auf sie?
Weitere Erkundigungen, die ich einholte, haben nur ergeben, daß das Gut Zurkow auf Rügen von einem Engländer gekauft worden sei, worauf seine frühere Besitzerin aus Gram über ein trauriges Familiengeschick in's Ausland gezogen wäre.
Ich schließe meinen Bericht und drücke nur noch die Vermuthung aus, daß mein armer Wendelin und seine Freda zu jenen Paaren gehören, welchen es der Tod erst sagen muß, daß sie sich liebten.
Meister Hermann.
Die Geschichte des Gerbermeisters Hermann beginnt mit der Ochsenhaut. Diese lag mit ihren aufgefalteten Rändern auf dem Werkstisch ausgebreitet und der Meister war just im Begriffe, sie für den Kleinverkauf in Stücke zu trennen.
Er wurde bei dieser ledernen Arbeit anmuthig unterbrochen. Sein junges munteres Weibchen flatterte herbei Er stemmte das scharfgespitzte Messer auf den Tisch und hielt seine muskulöse Gestalt stramm, daß sich das warmherzige Wesen recht weich daran schmiegen und das apfelrothe Wänglein an seinen Arm legen konnte, an welchem das Hemd der Arbeit wegen bis hinter die Ellbogen zurückgestreift war.
Eveline wurde von Tag zu Tag huldvoller. Sonst war sie seinem gutmüthigen Ernste halb schüchtern und fast kindlich fromm gegenüber gestanden, hatte ihn Meister, oder Alter, oder Mann genannt, oder höchstens Väterchen, obgleich gar keine Ursache für dieses reizende Wörtlein da war. Die liebe Junisonne des Frauenjahres schien erst in den letzten Wochen hervorzubrechen, da hieß sie den Gatten in unverhüllter Zärtlichkeit ihr Männlein, ihren Schatz, ihr Herz, ihren kleinen Engel, ihr weißes Lämmchen, was der stattliche, derbknochige Gerbermeister mit besonderem Wohlgefallen vermerkte. Er war ein Mann von vierzig Jahren; sie hätte seine Tochter sein können, sagten die Leute.
Jetzt war eben der Knabe von der »goldenen Rose« dagewesen, von der Tischgesellschaft geschickt, dieselbe verlange nach dem Meister: Er möge sich diesen Abend im Wirthshause zu einem Spielchen einfinden. Die Anderen säßen schon beisammen und mischten die Karten.
»Mir kommt's nicht ungelegen heute,« sagte Hermann, »da besorge ich zeitig den Häute-Einkauf beim Fleischhauer.« Und steckte die Geldtasche in das Wams. »Aber,« setzte er bei und schaute schmunzelnd auf Eveline: »Was wird das Weibchen sagen?«
»Was kann ich denn machen, wenn sie mir mein Männlein wegnehmen? Ihrer sind Viele, ich bin allein. Ich muß warten, was sie übrig lassen.« So sagte Eveline betrübt, wie es von einem jungen Frauchen nicht anders zu erwarten, und ergeben, wie es einer Ehefrau geziemt.
»Komm' mit!« rief er und breitete seine Arme vor ihr aus, als wollte er sie um die Mitte fassen und davontragen.
Sie wich einen Schritt zurück und sagte: »Gott verhüt's! In der Herrengesellschaft! Ich bin einmal dabeigewesen – und nicht wieder! Niemals wieder, mein Goldherz. Weiß ich nur, Du zerstreust Dich von Deiner Müh' und Sorg', so bin ich schon zufrieden.«
»Aber es wird sicherlich Unterhaltung geben,« warf der Meister ein.
»Geh' nur, Ihr spielt Karten. Soll ich etwa daneben hocken und Finger nutschen?«
»Ist der Geometer dort, so wird ja gar nicht gespielt. Der erzählt wieder Geschichten.« »Was geht mich der Geometer mit seinen Geschichten an!« sagte Eveline fast unwirsch, »geh' Schatz. Ich lege mich bald in's Bett und schlafe.«
So nahm er Rock und Hut, sagte einen guten Abend und ging durch die lange Gasse des Städtchens hinab gegen die »goldene Rose«.
Dort im Extrazimmer saßen etliche Bürger und kartelten. Der Eintretende grüßte, sie knurrten den Gruß zurück, er setzte sich zu ihnen und kartelte mit. Die Kerze brannte trüb und Einer schob sie mit dem Ellbogen dem Andern zu, daß er sie putze, denn Keiner hatte die Hände leer. Der Wein war heute nicht gerade süffig. Es flog kein munteres Wort; ein Einziger machte zwei Witze rasch nacheinander, sie verpufften, ohne daß Einer lachte, das verdroß ihn und er schwieg. Es waren die Rechten noch nicht beisammen. Auch war's dumpfig schwül im Zimmer. Ein Fenster auf, und es streicht die kalte Nachtluft durch Mark und Bein. Die Kellnerin sitzt im Winkel, scheinbar der Wünsche gewärtig, aber es sinken ihr die Augen. Die ganzen Nächte keine Ruhe. Noch am besten rastet sie, wenn die Gäste karteln.
»Gestochen!« rief Meister Hermann und warf ein Aß aus.
»Dasmal nicht gestochen, Gerber,« sagte der Nebenmann, »der Herzbub ist Trumpf.«
»Gestochen, sag' ich!« rief der Meister nochmals, »ich will einmal stechen!«
»So stich Deine Katz',« gab ein Anderer halb scherzhaft d'rauf. Ein zurechtweisendes Hinwort, ein bissiges Herwort.
»Ich pfeif' Euch heut' auf die Karten,« sagte der Gerber und legte das Spiel weg. »Ich bin nicht aufgelegt.«
Er zahlte den Wein und ging nach Hause. – Diese Hohlberger Bürger, so dachte er unterwegs, lauter Sauertöpfe sind es. Wer gewandert ist und die Welt gesehen hat! – Manchen Tag meint man, das Hirn friere ihnen im Kopf.
Da ist der Geometer ein Anderer!
Der Geometer! Freilich, das war ein junger, munterer, witzsprudelnder Spanier, der vor einem halben Jahre mit einer »geometrischen« Gesellschaft in die Gegend gekommen war, um Berg und Thal abzumessen. Seine Genossen waren abgezogen, nachdem sie der schönen Umgebung von Hohlberg das Maß genommen; der schwarzbärtige Spanier blieb sitzen und wurde durch seine gefälligen Manieren, durch sein stets aufgewecktes, feuriges Temperament und seine tollen Anekdoten der Liebling von Hohlberg und der unentbehrliche Zechgenosse in der »goldenen Rose«. Die Frauen wußten von ihm auch zu erzählen, daß er ein schönes Auge habe und eine interessante Stimme. Er sprach etwas gebrochen deutsch, was ihn aber nicht hinderte, seine Gedanken und Wünsche auf die eleganteste Weise auszudrücken. Gewißlich lebten Etliche im Städtchen, die es gerne hätten wissen mögen, was in seinem Taufscheine stand. Wenn man darauf anspielte, so zeigte er den Schein stets auch mit der größten Bereitwilligkeit, aber allemal von hinten, wo nichts d'raufstand. Er erzählte fortweg aus seinem Leben, von seinen Abenteuern und Plänen die heitersten Stücke, aber die griffen nie so tief, daß auch nur ein Einziger aus ihm klug geworden wäre. Geld schien er zu haben, das war einstweilen den Männern genug; galant war er, das ließen sich die Frauen gern gefallen, und so gehörte er in das Städtchen Hohlberg hinein, als wäre er daselbst geboren und wolle daselbst sein Leben beschließen – was noch lange gute Weile habe. Der Geometer hatte sich in der »goldenen Rose« ein Zimmer genommen, in welches er sich manchen Abend einschloß, um seinen Studien zu obliegen, denn er war nicht allein Lebemann, sondern auch ein Mann der Arbeit und der That, und da ließ er denn die Tischgesellschaft im Extrazimmer, die stets mit Sehnsucht seiner harrte, manchen Abend allein sitzen.
So auch an diesem Abende, und darum war heute die »goldene Rose« so welk gewesen. Der Fleischermeister war ebenfalls langweiligerweise daheim sitzen geblieben und so konnte der Gerbermeister nicht einmal die Hauteinkäufe besorgen. Kurz, es war ein verlorener Abend und Hermann ging verdrießlich seinem Hause zu. Wenn der Aerger einmal da ist, dann sucht er sich nicht just immer den richtigen Gegenstand aus, dann bindet er mit Allem an. – Was nur dieser Stein da zu liegen hat, mitten auf der Straße? Verfluchter Stein! Müssen denn die Müllers just am Weg hin ihren spießigen Gartenzaun haben? Sollen Laternen dazu setzen. Daheim wird auch wieder kein Licht sein, daß man sich den Schädel einstoßen könnt'. Was sie allemal schon so früh in's Bett zu kriechen hat! Wäre sie mit gewesen, hätt's anders sein können, aber das ist ihre neue Art: bleib' ich zu Haus, so will sie gehen, und gehe ich, so ist ihr um's Schlafen. Nicht einmal die Hausthür ist heute noch geschlossen – brummte er weiter, als er an sein Haus gekommen war. – Soll man dem Gesindel den Thürhaken in den Buckel schlagen, daß sich's merkt: nächtig muß das Hausthor versperrt sein!
Der Hausgang war finster, das Gesinde schon zur Ruhe gegangen. Der Meister bekämpfte seinen Unmuth, leise schritt er durch die Werkstatt, in welcher eine Lampe halb niedergedreht brannte. Leise drückte er an der Thürklinke des Schlafzimmers, um das Weib nicht zu wecken. Sie soll nur schlafen, sie hat ganz recht, wenn sie schläft. Die Thür ging nicht auf, war versperrt. Ein derber Druck des Armes, das Schloß sprang entzwei, die Thür war offen, hart an ihm stand im Nachtkleide Eveline, mit Hast im Begriffe, das Lampenlicht auszutilgen. Er schleuderte sie an die Wand, ergriff an der Lederbank das Messer, stürzte auf einen Mann, der zum Fenster hinausspringen wollte, und stieß ihm das Eisen in die Brust. Der Spanier – lautlos sank er zu Boden. Eveline fiel mit einem heiseren Schrei in Ohnmacht – Hermann lief zum Hause hinaus in die finstere Nacht. – –
Da war der Baumgarten, da standen die schwarzen Ulmen. Weiter unten waren die dunklen Dächer der Stadt, oben funkelten die Sterne.
Jetzt kam er zu sich, jetzt fragte er: »Was ist da geschehen Ist das wahr, daß Du jetzt Einen erstochen hast? – Rosenwirth, was hast Du mir heute in den Wein gethan? Wahnsinnig werden! So auf einmal wahnsinnig werden! – Das Weib untreu! Der Spanier! – Das kommt davon, weil Du Salpeter in dem Wein thust. – Jetzt muß ich geschlafen haben, da auf dem Rasen. Im thaunassen Gras liegen! Das ist nicht gesund. Dann hat man das Hämmern im Kopf und die Träume. Untreu. Man soll so tollwitzigen Gedanken niemals Gehör geben, sonst stellen sie sich im Schlaf ein. Ach, das Hämmern, das Hämmern im Kopf! – Wie ich nur auf den Geometer gekommen bin? Auf den lustigen Geometer? Das wird ein Gelächter beim Rosenwirth, wenn ich's erzähle demnächst, daß der Geometer – – – – daß ich den Geometer! ... hat, 's ist toll, 's ist toll, ich bin nicht gesund. Eveline.«
Er wollte in's Haus gehen und einmal recht zanken mit seiner Frau, daß sie ihn im feuchten Garten schlafen lasse, und ihr dann den Traum erzählen und ihr abbitten, daß er so von ihr geträumt habe. Schon der Traum ist ein Verbrechen. O Gott, wenn die Weiber allemal so schlecht wären, als sie die Männer träumen! Von jetzt an will er sie nicht mehr halten, wie ein munteres Kind; er will sie verehren wie eine Frau, der er einmal tief Unrecht gethan. Er will zu ihr gehen. – Da stürzte zur Thür schon eine Magd heraus, händeringend, zeternd, es waren Räuber und Mörder im Hause, Meister Hermann liege ermordet in seiner Schlafstube. Mehr wollte er nicht hören. Jetzt war er wach, jetzt träumte er nicht mehr, daß er geträumt hatte. Jetzt war er wach. Er eilte quer durch den Garten, sprang über den Zaun hinaus auf das Feld und lief dem Walde zu. Als er aber zum Kreuze kam, welches sie das Armensünderkreuz nennen, weil auf diesem Platze einst die Verbrecher gerichtet worden waren, stand er still und sagte: »Was soll das unsinnige Laufen? Das sieht ja ganz aus wie eine Flucht! Wer wird denn fliehen? Dort drüben liegt die Straße, die zur Kreisstadt führt, morgen Früh, bis die Richter aufwachen, bin ich dort. Es läßt sich bequem mit ihnen reden. – Ihr Herren Richter! Der Gerbermeister Hermann aus Hohlberg bin ich. Ein fleißiger, braver Mann, wie die Leute sagen, auch nicht über Gebühr trinkend, auch nicht rachsüchtig und nicht jähzornig. Ein gutmüthiger Mensch, der gern lacht, wenn Einer lustige Geschichten erzählt. Der Gerbermeister Hermann. Geboren zu Hestritz in Schlesien, vierzig Jahre alt. Verheiratet, Ihr Herren. Unbeanstandet bisher, nur wegen ehrlicher Zeugenschaft einmal vor Gericht gestanden. Der Gerber Hermann, Ihr Richter! Schaut ihn nur einmal an, der gehört jetzt Euch. Den Spanier hat er niedergestochen, heute Nacht. – Den Arm hat mir Einer hingestoßcn, ich weiß nicht wer. Aber gethan habe ich's. Der Kopf weiß nichts davon, und wird's doch büßen müssen. Sputet Euch, daß das Henken auch so schnell vor sich geht, als das Zustoßen! – Nehmt Euch aber in Acht, Ihr Herren Richter! Was ich heute vollbracht habe, das kann Einer von Euch morgen vollbringen. Geglaubt hätte ich's mein Lebtag nicht, daß so wenig Schlechtigkeit dazu gehört, um ein Verbrecher zu werden. Aber das nutzt Alles nichts. – Thut nicht lang' um mit Schreiben und Verhandeln. Untersucht, wenn Ihr wollt, ob ich bei Sinnen bin, und nachher macht's kurz, ich bitt' Euch.« –
Auf der Straße ging er jetzt still und gleichmäßig hin und ließ die Aufregung seines Blutes vertoben. Er hörte das Wasser rauschen, er sah manche Sternschnuppe vom Himmel fallen. Dann stand er einmal still und schaute um sich und dachte: Ich habe oftmals gehört, daß den Schuldigen nach der bösen That Furcht und Angst erfasse. Ich merke nichts dergleichen. Meine Ahne hat mir doch auch erzählt, was die Sternschnuppen bedeuten. Ich hätte immer gemeint, ein Weniges dürfte sich das Gewissen doch rühren, wenn man in die Sterne aufschaut. Ich merke nichts, 's ist wohl wahr, ich hab's vollbracht, ohne zu denken; ganz als ob plötzlich ein Blitz losgesprungen wäre aus meiner Brust, so ist's gewesen. Wenn ich's aber jetzt überdenke, und wenn ich sie noch einmal so finden sollte, sie und ihn, gerade so, und ich könnte mit Bedacht handeln – ich stieße ihn noch einmal nieder. Beim Herrgott im Himmel, ich stieße ihn noch einmal nieder. Dann ginge ich zum Gerichte wie ich jetzt gehe und wollte sagen: Gericht, ich habe meine Ehre vertheidigt, das ist meine Schuldigkeit. Und jetzt henkt mich, das ist Eure Schuldigkeit. Es geht seinen geraden Weg. –
Als er in die Kreisstadt kam, war es noch eitel Nacht. So in der kalten Stille dahin gehen zwischen den Häusermassen, und drinnen schlafen sie und legen sich einander den Arm um den Hals, wie sie sich lieb haben. – Als er den Hammer an das Thor des Gerichtsgebäudes fallen ließ, einmal und zweimal, da Hub drinnen der Pförtner gotteslästerlich zu fluchen an, daß denn in dieser vermaledeiten Nacht die höllischen Nachtschwärmer wieder gar keine Ruhe gäben! Daß er sie aber, so wahr er eine höchst unsterbliche Seele habe, mit Hunden zum Teufel Hetzen lasse, wenn sie das Thor noch einmal auch nur mit einem krummen Finger berührten! Der wahrlich genugsam geplagte Christenmensch wolle in der Nacht schlafen, keiner möge sich versündigen, sondern Jeder möge Gott danken, der an diesem Thore nichts zu thun habe.
Jetzt, da Meister Hermann wieder eine Menschenstimme hörte, brach sich seine heroische Büßerstimmung. – So, dachte er sich, da wird nicht aufgethan? Gut, du stolzes Haus, so lebe wohl. Mögen wir uns nicht mehr sehen. Ich habe meine Schuldigkeit gethan und bin zum Gericht gegangen. – Hernach eilte er mit leichten Füßen, als hätte er ein neues Leben gestohlen, zur Stadt hinaus, und als er durch die Auen zog, wo sich die Pappeln und die Birken in nebelichtem Morgenschimmer zu lichten begannen, hub er an, sich folgendermaßen selbst freizusprechen: Wo liegt's denn eigentlich? Ich bin Herr meines Hauses und meines Weibes und werde den Räuber wohl unschädlich machen dürfen. Es sind ja Gesetzparagraphen dafür da, daß ich's darf – und soll. Hätte ich nicht zugestoßen, so hatte es er gethan. Das Gericht ändert nichts mehr; der Ankläger hätte einen Teufel und der Vertheidiger einen Engel aus mir gemacht und das Rechte hätte Keiner getroffen. Alles in einen Topf und laugen, wie der Gerber die Häute. Das kennt man. Und für's Weitere unschädlich machen, das gilt bei mir nicht. Der Spanier steht nicht mehr auf, und einem Andern thue ich nichts. Weib hab' ich kein's mehr und nehme mir kein's. Mein Haus und Geschäft in Hohlberg ist das Lehrgeld, das ich zahle für meinen gestrigen Schultag. Ich bin als Bursch in Bremen gewest und finde wieder hin. Dort stehen die Schiffe und in der neuen Welt giebt's auch zu gerben.
Als die Sonne aufging, war er schon so weit von der Kreisstadt entfernt, daß er von ihr nur mehr die höchsten Thürme sah. Dort säße er nun im finstern Gewölbe und sähe nichts mehr von der schönen Welt. Es ist besser so. Der Mensch muß manchmal eine Reise thun.
Als die heißen Mittagsstunden kamen, legte er sich in einen Kiefernwald zu einer mehrstündigen Rast. Das ist ja ganz wieder, wie in der Burschenzeit. Wenn man diese fünfzehn Jahre in Hohlberg herausschnitte, wie den brandigen Fleck aus der Kuhhaut! Es wäre gut, aber ein Loch bliebe doch zurück. Manche Leute füllen solche Löcher mit Schnaps und anderem Gebräu. Mögen es thun, ein braver Bursch denkt an die Gesundheit. – Hernach kehrte er in einem Bauernwirthshaus zu, welches schon so weit von Hohlberg stand, daß man ihn nicht mehr erkennen konnte. Aber die Wirthin erzählte ihm zur Neuigkeit, daß in der vergangenen Nacht unten im Hohlbergerstädtlein ein schreckbarer Mord geschehen sei. Ein fremder Geselle, der sich schon längere Zeit im Orte aufgehalten, habe den Gerbermeister Hermann erstochen.
»Das wird wohl nicht so sein,« antwortete Hermann auf solche Nachricht, denn er hatte die leidige Gewohnheit, alle Unwahrheiten berichtigen zu wollen. Also, der fremde Geselle würde den Gerbermeister nicht erstochen haben!
»Aber ich sag's!« rief die Wirthin schneidig.
»So sagt Ihr eine Unwahrheit.« »Ich?!« begehrte sie auf, »also bei einer Lügnerin wollt Ihr jetzt was essen und trinken? – Geht mir, geht, ich hab' nichts für solche Leut'!«
Er hatte Hunger und mußte es also nachgerade gelten lassen, daß der Gerber zu Hohlberg erstochen worden sei. Aber nach dem kleinen Mahle ging er rasch davon.
Und nun trat er seine weite Wanderung an. Er reiste als Gerber, nahm aber nirgends Arbeit. »Ich habe mich fremd gemacht,« sagte er nach Handwerkers Art. Er hat sich fremd gemacht. – – –
Nach Wochen war es, daß er krank und abgehärmt in Bremerhaven ankam. Da war der graue feuchte Nebel und durch denselben schimmerten verschwommen die Masten der Schiffe. Noch einmal stieß Hermann seinen Fuß zornig auf die Erdscholle, die zu einem Welttheile gehört, auf welchem der Rächer seiner Ehre Verbrecher heißt. Dann bestieg er das Auswandererschiff die »Hoffnung«. Das Geld, welches er an jenem unseligen Abende für den Häute-Einkauf zu sich gesteckt hatte, sollte ihm jetzt hinüberhelfen über das große Meer. Erschöpft, wie er war, wurde er in eine dunkle Cajüte gebracht, wo er nach den Aufregungen und Strapazen in eine Krankheit verfiel. Tagelang lag er bewußtlos dahin oder phantasirte von Mord und Blut. Aber in einer Nacht, da kam er so viel zu sich selbst, daß er darüber nachdachte, warum denn fortwährend seine Bettstatt schaukle und was nur das immerwährende Geräusch außerhalb an der Wand bedeute? Das war oft, als ob man ganze Lasten von Sand an die Wand werfe, der dann wieder langsam abriesele. – »Es ist doch der Kerker!« sagte er sich, »es ist nichts als der Kerker, den sie mit Schutt und Erde zuwerfen, um mich lebendig zu begraben.« Aber sein Nachdenken regelte sich allmählich, und es kam ihm dunkel in Erinnerung, daß er ein Schiff bestiegen habe. Er wollte Gewißheit haben. Er erhob sich von seinem Lager und taumelte die Eisenblechtreppe hinan auf das Verdeck. Er stieß an Masten, er stieß an Geländer, er klammerte sich an einen Balken und schaute hinaus und sah nichts als unendliches Gewässer. Es war die graue, belebte Meerfluth im ersten Morgenschein. Im Bauche des Schiffes schnob die Dampfmaschine, auf den Takelwerken saßen ein paar Matrosen, die von Zeit zu Zeit eintönige Laute ausstießen. Am Oberraume, wo das warme Rohr des Rauchfanges emporstieg, saß ein dicht in den Mantel gehüllter Mann, der gedankenvoll hinauszublicken schien auf die weiten Wasser.
Hermann fühlte das Bedürfnis nach einem Menschen und nahte sich dem Manne. Dieser starrte ihn fragend an, und Hermann taumelte entsetzt zurück und floh angstvoll in seine Cajüte hinab. »Ich bin sehr krank!« wimmerte er auf seinem Lager und preßte die Hände an sein Haupt.
»Selbstverständlich, wenn Ihr in der kalten Nachtluft herumgeht, daß Euch wieder schlechter wird,« rief ihm ein Cajütengenosse zu.
»Seinen Geist habe ich gesehen!« stöhnte Hermann.
»Gesehen!« spottete ein Genosse, »es scheint eher, daß Ihr welchen getrunken!«
»Seinen Geist habe ich gesehen!« wimmerte der Kranke.
»Wessen Geist?«
»Den Geist des Spaniers, den ich erschlagen habe.«
»Geht in's Bett.«