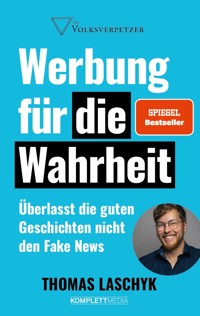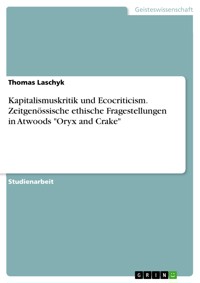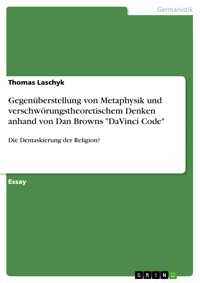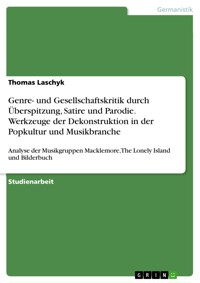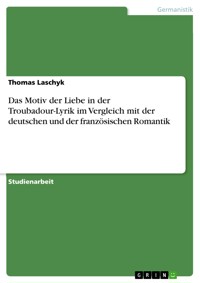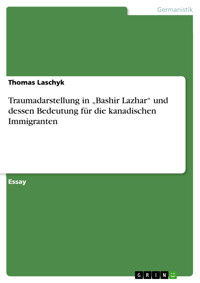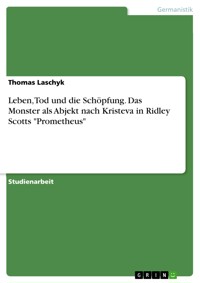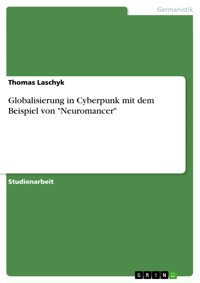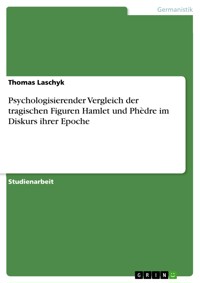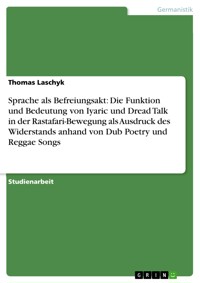Gewaltdarstellungen in Dystopien und ihre moralischen Bewertungen. Von "1984" bis zu "The Hunger Games" E-Book
Thomas Laschyk
18,99 €
Mehr erfahren.
In dieser Arbeit werden die "kanonischen Dystopien" "1984" von George Orwell und "Wir" von Jewgeni Samjatin mit einem der kürzlich erschienenen dystopischen Werke, "The Hunger Games" von Suzsanne Collins in ihren Gewaltdarstellungen und deren moralischen Bewertungen verglichen, um etwaige Unterschiede und ihre Implikationen für den Wandel von Bewertung von Gewalt in der Gesellschaft festzustellen. Dazu wird zunächst der Begriff der Dystopie von anderen, verwandten Begriffen abgegrenzt, um anschließend auf die genaue Differenzierung des Gewaltbegriffs und die Ästhetisierung von Gewalt einzugehen. Danach werden an den betreffenden Werken die unterschiedlichsten Ausprägungen und Formen von Gewalt untersucht und miteinander verglichen. Anschließend werden die Ergebnisse im Kontext der gesellschaftlichen Bewertungen von Gewalt interpretiert. Aus dem Inhalt: – Die soziologische Debatte über die menschliche Gewalt – Gewaltdarstellung in Dystopien und ihre moralische Bewertungen – Definition und Abgrenzung des Begriffs „Dystopie“ – Definition von Gewalt und Gewaltästhetik – Arten von Gewalt und Gewaltdarstellung Die Geschichte der Gewaltdarstellungen in der Literatur lässt sich so weit zurück verfolgen, dass man nicht einmal mehr sagen könnte, welches Phänomen das erste war: "Die Gewalt oder das Sprechen über Gewalt?". Im Gegensatz zu real verübter Gewalt ist es jedoch unsinnig, lediglich die Anzahl an Gewaltdarstellungen zahlenmäßig gegeneinander aufzuwiegen, um so Schlüsse auf die etwaige Veränderung der menschlichen Natur ziehen zu können. Viel entscheidender ist die bewusste, wie auch unbewusste, textimmanente Bewertung der dargestellten Gewalt und ihre zeitgenössische und gegenwärtige Interpretation. Für diesen besonderen Analysepunkt eignen sich aufgrund ihrer strukturellen Besonderheiten und außerfiktionalen Intentionen die Dystopien, die eben genau diesem Anspruch entsprechen. Diese "spiegeln und extrapolieren geistige Strömungen und Denkweisen, sozio-politische Ereignisse, Entwicklungen und Tendenzen [...], die die zeitgenössische außerliterarische Gegenwart in eine diesen fiktiven Gesellschaftsentwürfen ähnliche Zukunft verwandeln könnten."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
I. Die soziologische Debatte über die menschliche Gewalt
II. Gewaltdarstellung in Dystopien und ihre moralischen Bewertungen
1. Definition und Abgrenzung des Begriffs "Dystopie"
1.1. Historischer Utopie-Begriff
1.2. Andere Gattungsbezeichnungen
1.3. Merkmale der Dystopie
2. Defintion von Gewalt und Gewaltästhetik
2.1. Das Verhältnis von Macht, Zwang und Gewalt
2.2. Darstellungen von Gewalt und Ästhetisierungen
3. Arten von Gewalt und Gewaltdarstellungen
3.1. Physische und psychische Gewalt
3.2. Staatsgewalt
3.3. Gegengewalt
4. Fazit
III. Der Triumph der humanistischen Tradition
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Sekundärliteratur
I. Die soziologische Debatte über die menschliche Gewalt
Einige Philosophen und Soziologen unserer Zeit beschäftigen sich vermehrt mit der Frage, ob Gewalt und Gewalttätigkeit noch zeitgemäß ist. Ob heutige Phänotypen von Krieg, Mord und Vergewaltigung lediglich Rudimente der primitiveren menschlichen Natur sind, welche sich auf dem Rückzug befinden, oder ob die Ausprägungen menschlicher Grausamkeit ein unauslöschlicher Teil der Menschheit bleibt und bleiben wird. Kürzlich veröffentlichte der Psychologe und Soziologe Steven Pinker "The Better Angels of Our Nature: A history of Violence and Humanity"[1] In diesem Beststeller kam er, gestützt von vielen Graphiken und Statstiken, zum Schluss, dass die Menscheit nach vielen Jahrtausenden der Gewalt beginnt, in einen "Langen Frieden" überzugehen. Pinker stellt fest, dass in den moderneren Teilen der Welt Krieg praktisch verschwunden sei, da die Verbreitung der Demokratie, der steigende Wohlstand und die Etablierung moderner Wertvorstellungen zur Veränderung zu einer friedlicheren und gewaltfreieren Welt beitragen. Zwar sei das letzte Jahrhundert besonders gewaltvoll wahrgenommen worden, insbesondere in Anbetracht der großen Zahlen an Todesopfern, jedoch entspringt dies lediglich einer subjektiven Wahrnehmung, da niemand die gewalttätigen Konflikte der vorangegangenen Jahrhunderte miterlebt habe, um diese adäquat vergleichen zu können. Auch sind die Opferzahlen im Vergleich zur explosionsartig angestiegenen Weltgesamtbevölkerung statistisch nachgewiesen geschrumpft. Insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg fällt die Anzahl der Toten in gewaltsamen Konflikten immer weiter. So ist Pinker und viele seiner Kollegen der Meinung, dass die Menschheit als Ganzes gewaltfreier und altruistischer wird. Auch Joshua L. Goldstein präsentiert eine ähnliche Dastellung in "Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide"[2] Im Jahr 1989 hat Francis Fukuyama auch bereits "Das Ende der Geschichte" verkündet – Das Verschwinden der großen, gewaltvollen Konflikte zwischen politischen Systemen.[3] Auch der bekannte Philosoph und Utilitarist Peter Singer beschreibt Altruismus als "an emerging movement", welches sich spätestens seit der Aufklärung immer stärker durchsetzt und wodurch besonders Gewalt gegen Frauen, Kinder und nichtmenschliche Tiere zurück geht.[4] Kritiker wie John N. Gray halten dies jedoch für Wunschdenken.[5] In einem im Guardian erschienen Artikel argumentiert Gray, dass die scheinbar verschwundenen großen Kriege lediglich der Angst vor der Atombombe zu verdanken sind und nicht eines gestiegenen altruistischen Bewusstseins. Auch habe sich nur die Art der gewaltsamen Konflikte von staatlich organisierten Kriegen zu Bürgerkriegen, Terrorismus und Gegenterrorimus gewandelt, die von den so genannten fortgeschrittenen Nationen lediglich in andere Länder "exportiert" wurden, nämlich in die ärmeren, ehemaligen Kolonien der westlichen Welt. Gray kritisiert, dass der Tod von Zivilisten, direkt oder indirekt durch Hunger, physische und psychische Krankheiten, Vergewaltigung und Folter außen vor gelassen wird. Sein Schluss ist, dass die Menschheit immer noch so gewalttätig ist, wie sie es stets war und dass eine andere Sicht der Dinge unwissenschaftliches Utopiedenken darstelle.[6] Gray wirft Pinker und seinen Mitstreitern vor, Statistiken und Indizien nach Gutdünken zu produzieren und unterstellt ihnen im Wesentlichen, dass sie versuchen, ihren haltlosen Glauben an eine positive Zukunft mit Fakten zu untermauern. Dabei unterlässt er es jedoch, selbst Fakten oder Statistiken zu bemühen, die wiederum seine Behauptungen des Gegenteils stützen könnten.
Im Grunde genommen handelt es sich hierbei um den alten Streit zwischen Calvin Hobbes und Jaques Rousseau, welcher sich um das Verhältnis von Zivilisation und Kultur in Bezug auf die menschliche Gewalt dreht. Rousseau war der Ansicht, dass die Zivilisation den friedlichen Urzustand des Menschen verdirbt, wohingegen Hobbes das Gegenteil annahm: Dass die Zivilisation die rohe, gewaltsame Natur des Menschen bändige. In diesem Kontext wird gerne das bekannte Zitat "homo homini lupus" verwendet. [7] Offensichtlich scheint es jedoch zumindest kurzfristig kein zufriedenstellendes Ende dieser Debatte zu geben. Sinnvoller und zielführender, als die schwer festzustellende real verübte Gewalt zu untersuchen, scheint es, sich stattdessen der Literatur zu zu wenden und die Gewaltdarstellungen zu betrachten. Doch warum sollte fiktive, erzählte Gewalt überhaupt für diese Betrachtung relevant sein? Stephanie Jed verweist darauf, dass die Literatur nicht völlig losgelöst von realpolitischen Ereignissen ist, wie oft angenommen wird. Die Literatur stellt die Reflexionsebene der Gesellschaft dar. Jed zitiert Cantimori mit den Worten: "Politics draw their sap from literature which in turn they fertilize."[8] Sie verweist auf ein intensives Wechselspiel zwischen Politik und Literatur, welches in Narration und deren Umsetzung, sowie Ereignissen und deren Kommentar resultiert.[9] Durch dieses Wechselspiel jedoch ergibt es sich, dass man den Eindruck bekommt, dass Gewalt ein "prädominantes Merkmal modernen Lebens ist," welches in einer "hohen Verfügbarkeit von Gewalt- und Schreckensbildern"[10] gerade auch in der Literatur resultiert. Es lässt sich leicht der Schluss ziehen, dass Gewaltdarstellungen in der Literatur eine "teils evidente, teils heimliche Herrschaft" über unsere Alltagsrealität haben [11] und damit maßgeblich für unsere gesellschaftliche Gegenwart sind. Der Hinweis auf die gegenwärtige Alltäglichkeit von Gewalt in der Literatur und in den Medien jedoch ist "selbst Alltäglichkeit."[12] Gewalt war schon immer "ein zentrales Thema und Motiv in der Literatur und den bildenden Künsten"[13] und "zieht sich wie eine Blutspur durch die Literaturgeschichte."[14] Die Geschichte der Gewaltdarstellungen in der Literatur lässt sich so weit zurück verfolgen, dass man nicht einmal mehr sagen könnte, welches Phänomen das erste war: "Die Gewalt oder das Sprechen über Gewalt?".[15] Corbineau-Hoffmann und Niklas sind der Ansicht, dass Gewalt "allen literarischen Manifestationen [...] gleichermaßen archetypisch" ist.[16] Im Gegensatz zu real verübter Gewalt ist es jedoch unsinnig, lediglich die Anzahl an Gewaltdarstellungen zahlenmäßig gegeneinander aufzuwiegen, um so Schlüsse auf die etwaige Veränderung der menschlichen Natur ziehen zu können. Viel entscheidender ist die bewusste, wie auch unbewusste, textimmanente Bewertung der dargestellten Gewalt und ihre zeitgenössische und gegenwärtige Interpretation. So sind "literary images of the future [...] among the most significant expressions of the beliefs and expectations we apply in real life to the organizations of our attitudes and actions,"[17] also die beste Quelle für eine gesellschaftliche Evaluation von Gewalt, insbesondere wenn sie die "threats, dangers und risks of modernity"[18] zum Ausdruck bringen. Für diesen besonderen Analysepunkt eignen sich aufgrund ihrer strukturellen Besonderheiten und außerfiktionalen Intentionen die Dystopien, die eben genau diesem Anspruch entsprechen. Diese "spiegeln und extrapolieren geistige Strömungen und Denkweisen, sozio-politische Ereignisse, Entwicklungen und Tendenzen [...], die die zeitgenössische außerliterarische Gegenwart in eine diesen fiktiven Gesellschaftsentwürfen ähnliche Zukunft verwandeln könnten."[19] Das Genre der Dystopie ist in diesem und letzten Jahrhundert zur "vorherrschenden literarischen Ausdrucksform für politische, sozialkritische und ethische Bedenken und Warnung westlicher Autoren"[20] geworden. Eben genau aufgrund diesen Anspruchs der Dystopien eignen sie sich am besten, um Gewalt-, aber auch Machtdarstellungen[21] im Kontext der gesellschaftlichen Bewertungen von Gewalt zu untersuchen. In dieser Arbeit werden die "kanonischen Dystopien"[22] "1984" von George Orwell und "Wir" von Jewgeni Samjatin mit einem der kürzlich erschienenen dystopischen Werke, "The Hunger Games" von Suzsanne Collins in ihren Gewaltdarstellungen und deren moralischen Bewertungen verglichen, um etwaige Unterschiede und ihre Implikationen für den Wandel von Bewertung von Gewalt in der Gesellschaft festzustellen. Dazu wird zunächst der Begriff der Dystopie von anderen, verwandten Begriffen abgegrenzt, um anschließend auf die genaue Differenzierung des Gewaltbegriffs und die Ästhetisierung von Gewalt einzugehen. Danach werden an den betreffenden Werken die unterschiedlichsten Ausprägungen und Formen von Gewalt untersucht und miteinander verglichen. Anschließend werden die Ergebnisse im Kontext der gesellschaftlichen Bewertungen von Gewalt interpretiert.
II. Gewaltdarstellung in Dystopien und ihre moralischen Bewertungen
1. Definition und Abgrenzung des Begriffs "Dystopie"
Zunächst wird der in der Forschung recht diffuse Begriff der Dystopie[23] konkretisiert und von anderen, ähnlichen Formen wie der Utopie, der Anti-Utopie oder der kritischen Utopie abgegrenzt.
Bei der Definition des Begriffs der Dystopie kommt man nicht umhin, seinen literarischen Vorläufer, die Utopie zu analysieren. Die "Tradition der literarischen Utopie [reicht] vom 21. Jahrhundert bis in die Antike zurück"[24] und ist der Ausgangspunkt und Ursprung für alle nachfolgenden Bezeichnungen, strukturell wie terminologisch, weshalb der Begriff zuerst beleuchtet und vorgestellt wird.
1.1. Historischer Utopie-Begriff
Das "fiktive Spiel mit den religiösen oder säkularen Menschheitsträumen von einem glücklicheren Leben"[25] lässt sich bis zu Platons "Politeia" circa im Jahre 370 vor Christus zurückverfolgen, findet sich aber auch in den biblischen Beschreibungen vom Garten Eden oder Mythen von Atlantis oder El Dorado.[26] Der Begriff "Utopie" selbst entstammt aus dem gleichnamigen Werk ("Utopia") von Thomas Morus und ist ein Neologismus aus griechischen Wortstücken und bedeutet sinngemäß "Nicht-Ort", im Sinne eines nicht real existierenden Ortes. Gleichzeitig ist es ein Wortspiel mit der englischen Aussprache des Wortes, durch welches der Name wie "Eutopie" klingt, welches im griechischen "Gut-Ort" bedeuten würde. Somit impliziert das Wort gleichermaßen den idyllischen, erstrebenswerten Charakter des fiktiven Inselstaates, welchen Morus skizziert, aber auch dessen Nicht-Existenz.[27] Das Werk wird so populär, dass daraufhin der "Inselstaat Utopia zum Sinnbild für den philosophischen, politischen oder literarischen Entwurf eines idealen Staatsgebildes"[28] avanciert und sich über die Literatur hinaus in der Gesellschaft als Konzept etabliert. Diesem Umstand ist es zu verschulden, dass der Begriff der Utopie sehr weit gefasst ist und je nach "historischem und kulturellem Kontext bzw. individueller politisch-ideologischer Perspektive"[29] verwendet wird. So kann man zwischen utopischer Programmatik wie politischen Manifesten, gelebten Utopien in Form von Gesellschaftsexperimenten, sowie fiktionalen Entwürfen und literarischen Konzeptionen unterscheiden.[30] Die literarische Utopie besitzt "spezifische, gemeinsame Strukturmerkmale und poetologische Charakteristika"[31] in der Nachfolge von Morus. Zwar gibt es auch die "klassische Utopie", welche eine "statische Diskription des jeweiligen utopischen Staatsgefüges"[32] darstellt, jedoch haben sich die literarischen Utopien dahingehend weiterentwickelt, dass erzählerische Handlungsmomente eingebaut worden sind, wodurch literarische Mischformen mit Science-Fiction, Reiseerzählungen, Robinsonaden, etc. entstanden sind, die fließende Grenzen aufweisen.[33] Die Utopie funktioniert, ebenso wie die Dystopie, als Kritik an der Gegenwart. Das schafft sie durch die innerfiktionale Spiegelung [34]