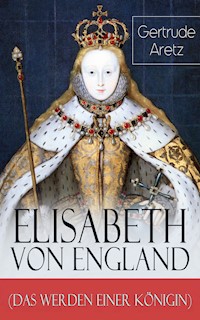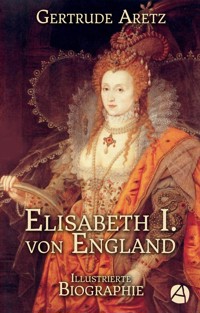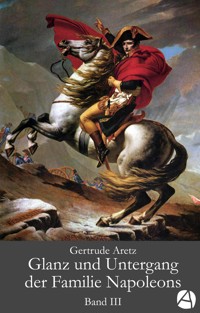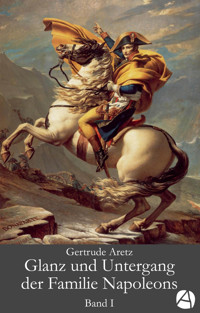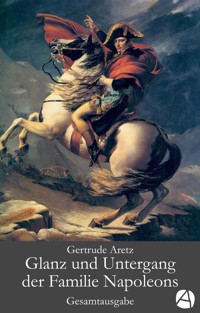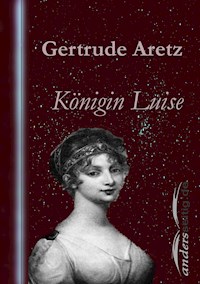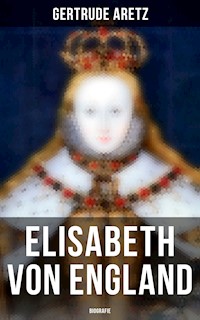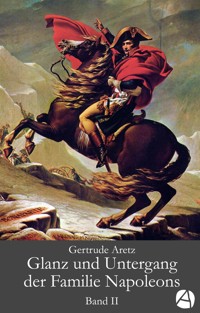
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Die Familie Napoleons
- Sprache: Deutsch
“Glanz und Untergang der Familie Napoleons” ist eine intensive Biographie der gesamten Familie Napoleons. Sowohl die Eltern, insbesondere die Mutter, als auch die Brüder, Schwestern sowie die Geliebten und Frauen werden eingehend porträtiert und in ihrer Bedeutung und ihrem Einfluss auf Leben und Wirken des großen französischen Herrschers dargestellt. In vielen Briefzeugnissen und überlieferten Äußerungen erhält man einen lebendigen Eindruck vom Denken und Fühlen Napoleons sowie dessen engsten Verwandten und Vertrauten. Deutlich tritt hier auch der private Mensch Napoleon Bonaparte hervor, der scheinbar genauso viel Energie aufbringen muss, um seine Familie zu regieren, wie es benötigt, um sein großes Reich zusammenzuhalten. Das ist vielleicht die größte Leistung dieses monumentalen Werkes der renommierten Historikerin Gertrude Aretz – man lernt neben dem Machtmenschen auch den Privatmenschen Napoleon Bonaparte kennen. Das Werk ist reich bebildert mit den originalen Kupfertiefdrucken. Dieses ist der zweite Band der dreibändigen Reihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
GERTRUDE ARETZ
GLANZ UND UNTERGANG
DER FAMILIE NAPOLEONS
BIOGRAPHIE EINER FAMILIE
IN DREI BÄNDEN
ILLUSTRIERTE AUSGABE
BAND II
1. Napoleon I., als Kaiser.
Es gibt kein Märchen aus Tausend und einer Nacht, das märchenhafter wäre als die Geschichte der Familie Bonaparte. Daß aber dieses Märchen in den ganz nüchternen Tagen der modernsten Zeit Wahrheit geworden ist, muß man als eine große Tat der Geschichte und als ein großes Glück betrachten.
Aus: Ferdinand Gregorovius »Korsika«.
GLANZ UND UNTERGANG DER FAMILIE NAPOLEONS wurde zuerst veröffentlicht vom Bernina Verlag, Wien - Leipzig - Olten 1937.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2023
V 1.1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Band 2
ISBN 978-3-96130-583-4
Buchherstellung & Gestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© apebook 2023
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
Inhaltsverzeichnis
Glanz und Untergang der Familie Napoleons. Band 2
Frontispiz
Impressum
Band II
Drittes Kapitel. Lucien und seine beiden Frauen: Christine und Alexandrine
Viertes Kapitel. Louis und Hortense
Fünftes Kapitel. Jérôme und Katharina
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
BAND II
Drittes Kapitel. Lucien und seine beiden Frauen: Christine und Alexandrine
I.
Nach der Geburt Josephs vergingen sieben und ein halbes Jahr, ehe Letizia ihre Familie mit dem dritten Sohne beschenkte. Sie hoffte wohl auf eine Tochter, die ihr das im Jahre 1771 kurz nach der Geburt gestorbene Mädchen ersetzen sollte, doch war auch ein Bube herzlich willkommen. Ja, gerade dieser sollte der Liebling der Mutter werden, vielleicht weil er dem Vater am ähnlichsten war.
Lucien kam am 21. Mai 1775 in Ajaccio zur Welt. Zu jener Zeit war Carlo Bonaparte Beisitzer der Junta von Ajaccio. Die Familie lebte ruhig, doch nicht ohne Sorgen. Die Würden des Vaters kosteten Geld, denn man mußte standesgemäß auftreten. Als es daher galt, auch diesem dritten Sohne eine Erziehung zu geben, versuchte Carlo, ihn, gleich seinen beiden Ältesten, auf Kosten des Königs in Autun unterzubringen. Aber vergebens. Man mußte in den sauren Apfel beißen und Luciens Unterricht bezahlen.
Er hatte inzwischen sein sechstes Lebensjahr, also das schulfähige Alter erreicht. Mit seinem Onkel Fesch, der ihn nach Autun bringen sollte, verließ er im Jahre 1781 die Heimat. Zuerst führte der Onkel den Knaben nach Lyon, zu dem Bruder des Gönners der Bonaparte, dem Bischof Marbeuf. Er war früher Bischof von Autun gewesen, und man hoffte viel von seiner Gunst. So erhielt auch Lucien, wie Joseph, auf Marbeufs Veranlassung später eine für die geistliche Laufbahn bestimmte Erziehung.
Nach einigen Tagen des Aufenthaltes bei dem »guten Monseigneur«, der den intelligenten Jungen mit Zärtlichkeit überhäufte, hielt Lucien in der Schule von Autun seinen Einzug. Dort sah er Joseph wieder, der in Tertia saß. Gerne würde er an der Seite dieses Bruders, dem er zugetan war, seine Studien fortgesetzt haben. Da jedoch sein Vater auch für ihn in Brienne eine Freistelle erlangt hatte, blieb er nur ein einziges Jahr in Autun. Lucien war ein guter Schüler und neben Napoleon gewiß das begabteste Kind Carlos und Letizias.
Sobald Napoleon seine Studien in Brienne beendet hätte, sollte die Freistelle für Lucien dort in Kraft treten, denn es durfte immer nur ein Sprößling einer Familie das Stipendium genießen. Bis zu diesem Zeitpunkte aber waren es noch vier Monate. So mußte der Jüngere vorläufig als zahlender Schüler aufgenommen werden.
Der Wechsel der Unterrichtsanstalt betrübte den kleinen Lucien besonders, weil er nun nicht mehr mit Joseph zusammen sein konnte. Später schreibt er in seinen Memoiren: »Napoleon empfing mich ohne den geringsten Beweis von Zärtlichkeit ... Ich glaube, diesen ersten Eindrücken von dem Charakter meines Bruders habe ich die Abneigung zu verdanken, die ich stets empfunden, mich vor ihm zu beugen. Joseph hingegen, der in meinen Augen der liebenswürdigste, sanfteste Mensch ist, hat mir bis auf den heutigen Tag eine fast väterliche Zuneigung eingeflößt.«
Das Beisammensein der beiden Brüder in Brienne währte übrigens nicht lange. Napoleon bezog, nachdem seine Frist abgelaufen war, die Militärschule von Paris. Der Jüngere setzte seine Studien fort und rief bei den Mönchen, die dieses militärische Institut leiteten, durch seinen lebhaften Geist, seine Vorliebe für die schönen Künste, besonders aber durch seine glänzenden Fähigkeiten nicht geringes Erstaunen hervor. Doch der Knabe eignete sich wenig für den militärischen Beruf. Er war nicht allein kurzsichtig, sondern auch körperlich schwächlich. Zwar behauptete Lucien später, daß er mit seinen Augengläsern genug sähe, um sich schlagen zu können, aber Napoleon konnte ihn in seinem Generalstab wirklich nicht brauchen. In Brienne interessierte sich Lucien außerdem vielmehr für das literarische Studium als für den Soldatenberuf. Er wollte Geistlicher werden.
So bezog er denn nach fast zweijährigem Aufenthalt in Brienne das geistliche Seminar in Aix. Dort hatte auch sein Onkel Fesch studiert. Man hätte es gern gesehen, für Lucien in Aix ein Stipendium zu bekommen. Sogar Napoleon, der ziemlich kümmerlich als Leutnant in Auxonne lebte, bemühte sich im Jahre 1785 darum und schrieb in dieser Angelegenheit an den Direktor des Seminars, Herrn Amielh. Zwei Jahre später wandte er sich an den Intendanten von Korsika. Aber seine Gesuche hatten keinen Erfolg. Die Mutter war im Jahre 1788 nochmals genötigt, darum zu bitten. Sie war nicht glücklicher als der Sohn, obwohl sie ihre kümmerliche Lage in beredten Worten schilderte. Dennoch sah die Familie Lucien bereits als ruhmvollen Nachfolger des Mönches Philipp Bonaparte von San Miniato, als den reichsten und angesehensten Mann des Clans! Es kam anders.
Der Aufenthalt im Seminar von Aix war für den jungen Bonaparte, den man als einen Bittsteller betrachtete, und noch dazu als einen, der nichts erreichte, ziemlich niederdrückend. Auch das Studium machte ihm jetzt keine Freude mehr. Er arbeitete wenig und wurde oft getadelt. Seines Bleibens im Seminar war daher nicht von langer Dauer, um so mehr, da die Familie nicht mehr die Mittel zu seinem Studium aufbringen konnte. Mit 15 Jahren, als die Revolution in Frankreich ausbrach, war er wieder in der Heimat.
Das Zusammentreffen Letizias mit ihrem Sohne Lucien muß seltsam gewesen sein. Der Junge hatte vollkommen seine Muttersprache verlernt. Einstweilen setzte er seine Studien unter der Leitung des kranken Onkels Archidiakon fort, schriftstellerte zu seinem Vergnügen, verschrieb ungeheuer viel Papier, deklamierte, redete und gestikulierte.
Lucien hatte einen viel zu beweglichen Geist, als daß er sich ernstlich und dauernd dem Priesterberufe härte widmen können. Die Politik interessierte ihn bei weitem mehr und änderte mit einem Schlage alle seine Pläne für die Zukunft. Er begrüßte mit Freuden die politische Bewegung, die sich auf seiner Heimatinsel bemerkbar machte, warf das geistliche Gewand von sich und stürzte sich mit der naiven Begeisterung eines jungen Stürmers kopfüber, kopfunter in die Ereignisse. Trotz seiner Jugend war er einer der eifrigsten Verteidiger der Revolution. Da er eine glänzende Redegabe besaß, spielte er bereits als Sechzehnjähriger in dem patriotischen Klub von Ajaccio eine gewisse Rolle. Die andern jungen Männer waren zwar etwas älter als er, aber keineswegs gereifter. Er schien das Zeug zu einem Politiker in sich zu haben. Gern wäre er an der Seite des großen Nationalhelden berühmt geworden. Ja er behauptete sogar, eine Zeitlang Paolis Sekretär gewesen zu sein, und erdichtete darüber eine seltsam phantastische Geschichte. Aber Paoli wollte ihn nicht. Er nannte Lucien einen Gelbschnabel und schien mit der Zeit den Söhnen seines alten Freundes Carlo zu mißtrauen. Er irrte sich nicht. Wie Joseph und Napoleon, so ging auch Lucien zu den Franzosen über, um für die Sache Frankreichs einzutreten.
So gern Lucien sich von seinem älteren Bruder raten und leiten ließ, weil es bei Josephs Sanftmut nie mit Gewalt geschah, so wenig ließ er sich von Napoleon, den er immer als seinesgleichen betrachtete, Vorschriften machen. Er verabscheute den herrischen Ton, den Napoleon anzuschlagen pflegte, wenn er mit dem Jüngeren sprach. Mit 17 Jahren fällte Lucien sein Urteil über den Bruder in einem Briefe an Joseph vom 24. Juni 1792. In diesem heißt es: »Ich habe in Napoleon stets einen Ehrgeiz entdeckt, der nicht gerade egoistisch ist, der aber bei ihm seine Liebe für das öffentliche Wohl übertrifft. In einem freien Staate wäre er, glaube ich, ein sehr gefährlicher Mann. Er scheint mir sehr zum Tyrannen geneigt, und ich glaube auch, er würde es sein, wenn er König wäre. Zum mindesten würde sein Name für die Nachwelt und für den empfindsamen Patrioten ein Schrecken sein.« – Es kränkte Lucien besonders, von Napoleon als Revolutionär und Politiker nicht für voll angesehen zu werden. Denn als Napoleon die Proklamation an das korsische Volk gelesen hatte, die sein junger Bruder dem General Paoli unterbreiten oder veröffentlichen wollte, sagte er zu dem Hitzkopf: »Ich habe deinen Aufruf gelesen. Er taugt nichts. Es sind viel zu viel Phrasen und zu wenig Gedanken drin. So spricht man nicht zu den Völkern. Diese haben mehr Verstand und Feingefühl, als du glaubst. Deine Schrift würde mehr Schaden anrichten als Gutes tun.« Napoleon meinte den Brausewind durch Vernunft zur Mäßigung zu bringen. Er irrte sich. Lucien hatte seinen eigenen Kopf.
Mehr Glück als bei Napoleon hatte er bei seiner klugen Schwester Elisa. Sie liebte er von allen seinen Geschwistern am meisten. Sie verstand und sprach Französisch, war fast im gleichen Alter mit ihm und interessierte sich für seine Reden. Sie erregten zwar Widerspruch in ihr, da sie in Frankreich ganz aristokratisch erzogen worden war, aber gleichzeitig bewunderte sie auch den Bruder. Sie war intelligent; er konnte mit ihr über alles sprechen, ohne daß er befürchten mußte, nicht, wie bei den Brüdern, für voll angesehen zu werden. »Elisa versprach keine Schönheit zu werden, aber ihre herrlichen Augen verrieten Geist.« Vom ersten Tage an, da sich die Geschwister in der Heimat wiedersahen, waren sie Freunde. Da auch die übrigen Familienmitglieder, besonders die weiblichen, Lucien bewunderten, glaubte er mit siebzehn Jahren zu allem fähig zu sein. Vom Schicksal hielt er sich bestimmt, eine bedeutende politische Rolle zu spielen. Er hielt sich für das gottbegnadete Genie der Familie.
Da kam das Unglück. Letizia mußte mit den jüngeren Kindern fliehen. Der Hauptschuldige war der junge Lucien. Sein Selbstbewußtsein überschritt alle Begriffe! Er war auf die Fähigkeiten seines Geistes so eingebildet, daß er meinte, sich alles gestatten zu dürfen. Seine Ideen, seine Ansichten und Aussprüche waren seiner Meinung nach untadelhaft. Niemand durfte ihm dreinreden. Er trat mit einer Frechheit auf, die nicht allein erstaunte, sondern sogar eine gewisse Achtung einflößte. Er hielt sich für den klügsten und erfahrensten Politiker. Kurz er brannte darauf, wie seine Brüder Joseph und Napoleon eine Rolle zu spielen. Die Gelegenheit schien günstig. Im März 1793 war er als Sekretär des Diplomaten Sémonville nach Toulon gegangen und hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als in dem dortigen Klub Paoli anzuklagen. Er nannte ihn einen Verräter, einen Tyrannen. Er sei durchaus nicht der Verteidiger Korsikas, als den er sich aufspiele. Mit französischem Gelde habe er ein Schweizer Regiment geworben, das ihm ganz ergeben sei. Er wolle sich zum Alleinherrscher über die Insel machen und verübe allerlei Bedrückungen und barbarische Handlungen gegen die Bewohner. So ließen Lucien der gekränkte Ehrgeiz und die verletzte Eigenliebe sprechen. Die Reue über seine unedle Handlung packte ihn erst später, als er allein war, als er nicht mehr den Beifall und die Begeisterung seiner Zuhörer um sich vernahm. Sie währte übrigens nicht lange. Bald fand er großen Geschmack an seiner neuen Rolle.
Er richtete an den Konvent eine Adresse, die sofort an den Abgeordneten des Departements Var befördert wurde und in die Versammlung gerade in dem Augenblick hineinfuhr, als man die Anklage Dumouriez' ausgesprochen hatte. Der Verrat war klar, und der Konvent beschloß, Paoli und Pozzo di Borgo vor die Schranken zu fordern.
Lucien war selig, den »entscheidenden Schlag gegen die Feinde«, besonders gegen Paoli, ausgeführt zu haben. Napoleon selbst wußte nichts von dem Streiche seines Bruders. Er machte sogar im Klub von Ajaccio den Vorschlag, eine Adresse an den Konvent zu senden, damit dieser den Beschluß gegen Paoli zurücknehme. Als er erfuhr, wer der Urheber gewesen, war er über die Unüberlegtheit Luciens entrüstet, denn das bedeutete für die Gegner Paolis Verfolgung und Verbannung, für Korsika den offenen Krieg mit der französischen Republik. Drei Jahre später sagte Napoleon von seinem Bruder: »Lucien vereinigt mit ein wenig Geist einen sehr harten Kopf und besitzt obendrein noch eine wahre Wut, sich in Politik zu mischen.«
In der Tat sollte diese Handlung Luciens schwere Folgen für die Familie nach sich ziehen. Paoli hatte außerdem einen Brief des jungen Bonaparte an seine Brüder aufgefangen, in welchem er der Guillotine geweiht wurde. Das war zu viel. Er schwor den Bonaparte ewige Rache. Nur mit Mühe vermochten sie seiner Wut zu entgehen.
Nach vierjähriger Abwesenheit betrat Lucien wieder den Boden Frankreichs, wo er einst seine Studien so schroff abgebrochen hatte. Damals war er noch ein Schüler, jetzt beinahe schon eine Persönlichkeit. Seine Jugend war ihm zwar dabei ein wenig hinderlich, aber das brachte ihn nicht in Verlegenheit. Er erhöhte einfach sein Alter von 18 auf 26 Jahre. Auch zuviele Kenntnisse besaß der angehende Jakobiner nicht, dafür aber desto mehr Eitelkeit, Einbildungskraft und frühreife Beredsamkeit.
Ende August 1793 hatte er schon einen Beruf. Als der General Carteaux mit seiner Revolutionsarmee nach Marseille kam, um dort den beginnenden Aufruhr zu unterdrücken, verschaffte er Lucien eine Stelle als Magazinverwalter in Saint-Maximin. Es war eine kleine Stadt im Departement Var, die dank Luciens und Barras' Marathon genannt ward. Luciens Anstellung war eine Gunst, die ihm als korsischen Emigranten zuteil wurde. Freilich war sein Einkommen dürftig: 1200 Franken im Jahr! Aber schon begann er von sich reden zu machen. Er sprach im Klub mit einer Flüssigkeit, einem Feuer und vor allem einer Überzeugung, die Bewunderung erregten. Die Anhänger strömten ihm von allen Seiten zu. Bald wurde er zum Präsidenten des revolutionären Komitees von Saint-Maximin ernannt. Die angesehensten Bürger der Stadt verdankten seinem Einfluß, daß sie als »verdächtig« in den Gefängnissen saßen. Er war eifriger Jakobiner, glühender Sanskülottist und unterzeichnete alle seine Schriftstücke mit »Brutus Buonaparte«. Ehemalige Galeerensträflinge, Diebe und Gauner waren seine Freunde. Als echter Republikaner mußte er doch das Beispiel der Gleichheit geben! Mehr als einmal stellte er sich bloß, denn seine Jugend ging oft mit seiner Vernunft durch. So schrieb er am Tage nach der Einnahme von Toulon an die Volksvertreter: »Bürger Repräsentanten! Vom Felde des Ruhmes aus, während meine Füße noch im Blute der Verräter schreiten, melde ich Ihnen mit Freuden, daß Ihre Befehle ausgeführt worden sind und Frankreich gerettet ist. Weder Alter noch Geschlecht sind verschont worden! Diejenigen, welche das republikanische Geschütz nur verwundete, sind durch das Schwert der Freiheit und das Bajonett der Gleichheit in die andere Welt befördert worden. Gruß und Bewunderung! Brutus Buonaparte, Bürger Sanskülottist.«
Sein Aufenthalt in Samt-Maximin entbehrte auch nicht des Idyllischen. Er verliebte sich in die junge, reizende Schwester des Gastwirts, bei dem er wohnte. Es war jene Katharine Boyer, die Lucien selbst später Christine nannte, »die beste, die liebenswürdigste, die sanfteste aller Frauen«. Als er sie das erstemal in der dumpfigen, raucherfüllten Gaststube sah, war sie zwanzig Jahre als, zwei Jahre älter als er selbst. Christine war groß, schlank, wohlgebaut und unvergleichlich anmutig, ganz ein Kind des Südens. Die Lieblichkeit und Zartheit ihrer Züge wurde nicht einmal durch die Spuren beeinträchtigt, die die Pocken auf ihrem Gesicht zurückgelassen hatten. Sie hatte wunderbar sanfte Augen und konnte bezaubernd lachen. Der leicht entzündbare Lucien liebte das Mädchen leidenschaftlich und heiratete es, trotzdem es sehr wenig gebildet war und weder lesen noch schreiben konnte. Sie wurden am 4. Mai 1794 in Samt-Maximin getraut. Lucien erklärte sich in seinem Ehevertrag als »Brutus Buonaparte, korsischer Patriot, 26 Jahre alt, geboren den 26. Mai 1768 in Ajaccio«. Merkwürdig ist es, daß alle drei Brüder bei ihrer Verheiratung in einem und demselben Jahre geboren sein wollen! In solchen Dingen waren die Bonaparte nie verlegen. Der Neunzehnjährige machte sich um sieben Jahre älter. Das war so Brauch in der Familie. Jeder gab sich das Alter und den Namen, die ihm zusagten. So nannte sich Marianne später Elisa; aus Maria Annunziata ward Karoline. Lucien beeilte sich, seine Frau Katharine in Christine umzutaufen und sich selbst Lucien-Joseph zu nennen. Auch die Familienpapiere gingen aus einer Hand in die andere, wie in manchen Kreisen die Kleider, die von einem Kind auf das andere vererbt werden.
Obgleich Lucien nichts weniger als hübsch war, hatte er doch Eindruck auf Katharine Boyer gemacht. Er hatte viel zu lange Arme und Beine, einen übermäßig kurzen Oberkörper, dazu die unsicheren Bewegungen eines Kurzsichtigen. Er zwinkerte beständig mit den kleinen, angestrengten Augen, und um seinen Mund spielte ein ewiges Lächeln. Seine Stimme hatte wenig Klang, und er sprach, obwohl sehr gewandt und fließend, stark durch die Nase. Da er jedoch fortwährend von seinen großen Brüdern, dem General und dem Kriegskommissar, von seinen Freunden Robespierre, Saliceti, Fréren und Arena erzählte, hätte er auch auf weniger einfache Gemüter als die Gastwirtstochter Eindruck gemacht. Sie gab sich die größte Mühe, ihre mangelhafte Bildung zu vervollständigen, um ihres geistreichen Gatten würdig zu sein. Lucien war ihr Lehrer. Unter seiner Anleitung lernte sie lesen und schreiben und wurde mit der französischen Literatur und Kunst bekannt. Bald schrieb sie sehr nette Briefe, die sie nicht vor den Damen der guten Gesellschaft zu verstecken brauchte. Die einfache Frau hatte auch Geschmack. Sie verstand sich gut zu kleiden und konnte in dieser Hinsicht später sogar mit der eleganten Josephine wetteifern.
Von der Familie hatte niemand, außer Napoleon, etwas gegen die Heirat Luciens einzuwenden. Sie war auch damals durchaus nicht unter seinem Stand. Was war er denn selbst? Ein kleiner Angestellter mit 1200 Franken Gehalt! Die Zeiten waren hart, das Geld war selten und der Klassenunterschied überhaupt nicht mehr vorhanden. Das bewies Lucien selbst durch seinen Umgang mit allen möglichen Leuten. Beständig sprach er von Gleichheit und Brüderlichkeit. Und was Christine an Reichtum und äußerer Bildung fehlte, ersetzte sie durch ihren Seelenadel. Sie entwaffnete sogar Napoleon durch ihre herzgewinnende Reinheit und Einfachheit. Als sie im Jahre 1797 nahe daran war, zum drittenmal Mutter zu werden, F8 schrieb sie an ihren unversöhnlichen Schwager, den General Bonaparte:
»Erlauben Sie mir, daß ich Sie mit dem Namen Bruder anrede. Mein erstes Kind kam zu einer Zeit zur Welt, da Sie gegen uns aufgebracht waren. Wie sehr wünschte ich, daß es Sie bald liebkosen dürfe, um Sie ein wenig über den Kummer zu trösten, den unsere Heirat Ihnen verursacht hat. Mein zweites Kind hat das Licht der Welt nicht erblickt, denn da ich auf Ihren Befehl Paris verlassen mußte, hatte ich eine Fehlgeburt in Deutschland. Aber in einem Monat hoffe ich Ihnen einen Neffen zu schenken ... Und das verspreche ich Ihnen: er soll ein Soldat werden! Nur möchte ich, daß er Ihren Namen trüge, und daß Sie sein Pate seien. Ich hoffe, Sie werden dies Ihrer Schwester nicht verweigern ... Wenn wir auch arm sind, so werden Sie uns doch nicht verachten, denn Sie sind ja unser Bruder. Meine Kinder sind Ihre einzigen Neffen und Nichten, und wir lieben Sie mehr als den Reichtum. Könnte ich Ihnen eines Tages alle Zärtlichkeit beweisen, die ich für Sie empfinde!«
Einem solchen Brief konnte Napoleon nicht widerstehen. Er versöhnte sich mit seiner Schwägerin und hat Christine Boyer später sehr geachtet.
Lucien hatte seinen Posten als Verwalter in Saint-Maximin verloren, da das dort befindliche Magazin nicht mehr bestand. So war er ohne Stellung und ohne Einkommen. Die Ereignisse des 9. Thermidor zwangen ihn, Saint-Maximin zu verlassen. Christine konnte ihrem Mann nicht sogleich folgen, da sie bald darauf ihrem ersten Kinde das Leben gab. Zum Glück fand Lucien in Saint-Chamans bei Cette eine Stellung als Inspektor der Fuhrwerke bei einem Armeelieferanten des Italienischen Heeres. Aber er hatte Feinde in Saint-Maximin, denn bisweilen hatte er sich auch als Verteidiger der Schwachen und Unterdrückten gezeigt. Wie sein Bruder Napoleon in Antibes, wurde er im Jahre 1795 von einem Demagogen als Freund des jüngeren Robespierre angezeigt und verhaftet. Auf Befehl der Volksvertreter Chambon und Guérin schleppte man ihn nach Aix ins Gefängnis. Seine Festnahme fand in einer ihm befreundeten Familie in Saint-Chamans statt, in der es gewöhnlich sehr lustig zuging. Man vergnügte sich gerade mit Pfänderspielen. Lucien war zur Auslösung seines Pfandes soeben im Begriff ein Gedicht vorzutragen, als ein gewisser August Rey unter die Gesellschaft trat und ihn im Namen des Gesetzes verhaftete. Dieser Rey war aus Samt-Maximin. Brutus-Lucien hatte dessen Vater und Mutter einst vorm Schafott gerettet. Unter den Tränen seiner reizenden Gesellschafterinnen wurde Lucien gebunden abgeführt. Noch war sein Kerker vom Blute der Gefangenen feucht, die man am Tage vorher niedergemetzelt hatte, um für neue Unglückliche Platz zu schaffen!
Es bedurfte des ganzen Einflusses des Generals Bonaparte, um seinen Bruder aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Napoleon ließ nichts unversucht und versah Lucien auch mit Geld. Lucien selbst schrieb einen Brief nach dem andern an seinen Bruder, an den Volksvertreter und Landsmann Chiappe, an den Bürger Rey, den Vater desjenigen, der ihn verhaftete. Ferner wandte er sich an Letizia, die sich wiederum bei Chiappe für ihren Sohn verwendete und an Frau Isoard in Aix schrieb. Luciens Angst war groß. Der kühne Redner von einst, der Brutus der Revolution, verzagte jetzt beinahe und wurde ganz klein. Welcher Gegensatz in seinem Briefe an Chiappe zu dem Schreiben, das er an die Volksvertreter nach der Metzelei von Toulon sandte! Eine furchtbare Angst vor dem Tode überkam ihn. »Ach! retten Sie mich vom Tode!« schrieb er. »Schenken Sie einem unglücklichen und unschuldigen Bürger, einem Vater, einem Gatten, einem Sohne das Leben! Möchte in stiller Nacht mein grauer Schatten um Sie schweben, damit er Sie erschüttere! ... Wenn Sie mir die Freiheit wiederschenken, will ich mit meiner Frau zum Italienischen Heere eilen, Ihre Füße küssen und Ihnen für immer das Leben weihen, das Sie mir wiedergeben. Ich schmachte – ich warte – o, retten Sie mich!«
Glücklicherweise hatte dieser kleinmütige Republikaner einen einflußreichen Bruder. Napoleons Schritte blieben nicht erfolglos. Und so verließ Lucien Bonaparte am 5. August 1795 das Gefängnis von Aix nach einer sechswöchigen Haft.
Seitdem war er etwas vorsichtiger in seinen demokratischen Reden. Er wandte sich jetzt wieder literarischen Arbeiten zu. Da er jedoch kein Einkommen hatte, lebte er vorläufig auf Napoleons Kosten. Der General war über Luciens Übertreibungen außerordentlich empört, und sein Groll gegen ihn steigerte sich noch nach des Bruder Verhaftung. Am 25. Oktober 1795 schrieb er unter anderem an Carnot: »Lucien hat sich 1793 zu verschiedenen Malen bloßgestellt, trotz der Ratschläge, die ich ihm wiederholt erteilt habe. Er wollte den Jakobiner spielen. Und wenn seine achtzehn Jahre nicht glücklicherweise eine Entschuldigung gewesen wären, hätte er sich mit unter der kleinen Zahl Männer befunden, die die Schande der Nation sind!«
Lucien, der Tollkopf, war lästig. Es mußte ein Amt für ihn gefunden werden, das ihm nicht viel Zeit zum Ausarbeiten seiner überspannten Ideen übrig ließ. Kurz nach dem 13. Vendémiaire verschaffte ihm daher der General Bonaparte den Posten eines Kriegskommissars bei der Nordarmee. Seine Ernennung erfolgte am 6. Brumaire des Jahres IV (23. Oktober 1795). Aber Lucien hatte es nicht eilig, das schöne Paris zu verlassen. Die Versuchung war für einen, der zum erstenmal dieses Pflaster betrat, zu groß. Die Salons der Frau von Staël und Frau Récamier, die Gesellschaften bei Barras und Theresia Tallien übten auf den zwanzigjährigen jungen Mann eine zu große Anziehungskraft aus, als daß er sich hätte so schnell losreißen können. Ein Charakter wie Lucien, der weder Pflichtgefühl noch Gehorsam noch Zwang kannte, auch keine Lust für einen militärischen Dienst zeigte, fügte sich nicht so leicht. Schließlich aber mußte er doch Paris verlassen. Am 8. Februar 1796 reiste er zur Nordarmee ab. Doch seine Dienste waren von geringem Nutzen. Er selbst fühlte sich auf seinem Posten nicht wohl, beschäftigte sich wieder mit Politik, hielt Reden und kümmerte sich durchaus nicht um den Dienst. Er war viel mehr der Bruder des italienischen Siegers als ein Kriegskommissar und verfehlte nicht, diese Art Verdienst zu mißbrauchen. Schließlich beklagte er sich bei Carnot, daß man ihn zu einer solchen Stellung ausersehen hätte. Es sei eine schreiende Ungerechtigkeit. Kurz, er verlangte wieder nach Frankreich, nach Marseille zurück. Er hegte die stille Hoffnung, dort eine weniger untergeordnete politische Rolle spielen zu können. Napoleon aber witterte in der Rückkehr seines Bruders nach Marseille Gefahr. Lucien sollte bleiben, wo er war. Der Widerspenstige kehrte sich natürlich wenig an die Ansichten und Absichten seines Bruders. Bereits nach zwei Monaten begab er sich, ohne daß er Urlaub hatte, von Antwerpen nach Paris. Dort hielt er sich bis Ende Mai auf. Dann reiste er, selbstverständlich wieder ohne die Befugnis zu haben, nach Italien auf den Kriegsschauplatz zu seinem Bruder.
Der Empfang, den ihm Napoleon bereitete, war, wie sich denken läßt, kein herzlicher. Jetzt war es ihm schon lieber, Lucien bliebe in Marseille als in Italien. So beförderte er ihn sofort wieder nach Frankreich, und zwar ebenfalls als Kriegskommissar.
In Marseille fühlte sich Lucien zu Hause. Dort war die Familie anwesend. Paulettes Liebesidyll mit dem Volksvertreter Fréron interessierte ihn außerordentlich, und er spielte bisweilen den Beschützer der beiden Liebenden. Was aber war Marseille gegen Paris! Die Erinnerung an die Hauptstadt und ihre Freuden war zu schön. Er sehnte sich nach Paris. Wunsch und Ausführung lagen bei Lucien immer nahe beieinander, und so hielt er es auch nur 22 Tage in Marseille aus. Dann war er wieder in der Stadt der Sehnsucht, natürlich ohne Erlaubnis. Das war durchaus nicht nach dem Geschmack Napoleons. In einem energischen Briefe an Carnot und Barras befahl er, daß man seinen Bruder sofort wieder auf seinen Posten zur Nordarmee schicke. Dort aber schien Lucien zu schlechte Erinnerungen hinterlassen zu haben, denn man verwendete ihn bei der Rheinarmee. In größter Eile mußte er mit seiner schwangeren Frau nach Deutschland abreisen, wo Christine eine Fehlgeburt hatte.
Aber auch bei dieser Armee taugte Lucien nichts. Napoleon sah nur einen Ausweg: ihn nach Korsika zu schicken, wo er der Republik von einigem Nutzen sein könne. Man vertraute ihm den bedeutenden und unabhängigen Posten eines Zahlungsanweisers an, und so kehrte Lucien mit den Vorschriften seines Bruders in sein Vaterland zurück. Wie Joseph, so hoffte auch er Abgeordneter zu werden.
Obwohl Napoleon sich über Lucien ernstlich zu beklagen hatte, vergab er ihm doch schnell. Nicht daß er ein besonderes Interesse für ihn gehabt hätte. Im Gegenteil, alles an Luciens widerspenstigem Charakter stieß ihn ab. Er wußte, dieser Mensch würde sich nie unter seinen Willen beugen. Aber Lucien war ein Bonaparte! Nur darin findet die außerordentliche Schwäche, die Napoleon bisweilen gegen ihn bewies, ihre Erklärung. Als er sich nach Ägypten begab, wollte er Lucien mitnehmen. Allein Lucien zog es vor, die Beliebtheit, deren er sich in Korsika erfreute, auszunützen, um als Abgeordneter in den Rat der Fünfhundert gesandt zu werden. Die Korsen wählten ihn, obwohl die Deputation bereits vollständig war und obwohl er nicht das vorgeschriebene Alter von 25 Jahren hatte. Er war erst 23 Jahre alt! Doch der Name des Siegers von Italien übte einen so gewaltigen Zauber aus, daß man meinte, den Bruder eines solchen Feldherrn nicht übergehen zu dürfen. Ja, der Rat der Fünfhundert empfing den jungen Mann bei seiner Ankunft mit einer Höflichkeit und Auszeichnung, die ganz und gar der Begeisterung zugeschrieben werden müssen, die man Napoleon entgegenbrachte. Sogar Lucien selbst gesteht das ein.
Dank dieser Ernennung wurde der Abgeordnete bald darauf in Paris zum Mitglied des Rates der Fünfhundert erwählt. Seine außerordentliche Beredsamkeit, vereint mit jugendlichem Feuer und großer Geschicklichkeit, erwarb ihm bald Anhänger und Freunde. Schließlich war sein Einfluß so groß, daß man ihn zum Präsidenten des Rates ernannte. So bestieg er ohne die geringsten juristischen Vorkenntnisse, ohne die geringste staatsmännische Erfahrung die Rednerbühne einer Versammlung, welche dem Volke Gesetze vorschrieb!
Seine Wohnung schlug er vorläufig bei seiner geliebten Schwester Elisa Baciocchi in der Rue Miromesnil, ganz in der Nachbarschaft der übrigen Familie auf. Denn Joseph, Julie, Letizia und Karoline wohnten jetzt in Paris, Rue de la Ville-l'Evèque; Josephine war Inhaberin eines Hauses der Rue Victoire. Der ganze Clan war also vereint. Dazu hatte sich Luciens eigene Familie um ein Töchterchen, Egypta, vermehrt.
Lucien war Freidenker, ein überzeugter Republikaner. Selbst die Rolle, die er anfangs bei den Ereignissen des 18. Brumaire spielt, widerspricht dieser Behauptung nicht. Sein Ehrgeiz, seine Redekunst und sein großes schauspielerisches Talent kamen ihm dabei vortrefflich zu statten. Wie wunderbar sicher und dramatisch war doch die Bewegung, mit der er seine Toga und seine Schärpe auf den Rand der Tribüne niederlegte, als sich Tausende von wütenden Stimmen gegen seinen Bruder und gegen ihn selbst erhoben! Seine Haltung, seine Worte, alles war unvergleichlich imponierend. »Es gibt hier keine Freiheit mehr!« rief er empört aus. »Da ich mich nicht mehr verständlich machen kann, so sollt Ihr Euren Präsidenten als Ausdruck der Trauer die Abzeichen der Volksgewalt niederlegen sehen!« Und damit stieg er majestätisch langsam von der Tribüne.
Seine Rolle war jedoch nicht in dem Maße bedeutend, wie sie ihm viele Historiker, besonders aber er sich selbst, beimessen. Anfangs handelte er gar nicht im Interesse seines Bruders. Napoleon und seine Armee schienen für Lucien nicht vorhanden zu sein, und die plötzliche Rückkehr des Generals aus Ägypten kam ihm wie jedem andern überraschend. Namen wie Moreau, Joubert, Jourdan, Hédouville, Macdonald u. a. wurden weit mehr in den Vordergrund gestellt als der des Generals Bonaparte. Als freilich Napoleon nach seiner Rückkehr die öffentliche Meinung ganz auf seiner Seite hatte, veranlaßten die eigenen Familieninteressen, und nicht zum wenigsten die Hoffnung, einst die Macht mit dem Bruder zu teilen, auch Lucien dazu, tätigen Anteil am Staatsstreiche zugunsten Napoleons zu nehmen. Lucien leistete seinem Bruder ohne Frage nützliche, doch nicht selbstlose Dienste. Er sah sich bereits als Zweiter Konsul.
II.
Napoleon hingegen verspürte nicht Lust, die Macht mit Lucien zu teilen. Er ernannte ihn zum Minister des Innern. Damit entledigte er sich vollkommen seiner Verpflichtungen gegen ihn. Es war ein hoher Posten, den er nur einem Menschen verleihen konnte, der sein ganzes Vertrauen besaß. Lucien war in diesem Amte, das für seine Verdienste zu groß, für seine Fähigkeiten zu schwer, für seinen Ehrgeiz aber viel zu klein war, der Nachfolger des Ministers Laplaces, eines äußerst pflichtgetreuen Staatsbeamten.
Allerdings hatte Lucien sich sein Wirken im Staate anders gedacht. Noch vollkommen erfüllt von dem Triumphe, den er am 18. Brumaire davongetragen hatte, glaubte er sich zum mindesten berechtigt, der erste Staatsmann Frankreichs zu sein, wie sein Bruder der erste Feldherr war. Nichtsdestoweniger hatte er trotz seiner Jugend manches geleistet. Er hatte während der zwei Jahre im Rate der Fünfhundert eine Tätigkeit und Energie entwickelt, die anerkannt werden müssen. Und bei dem aufreibenden politischen Leben fand er noch Zeit, sich seiner Familie zu widmen, gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen und auch noch einen Roman zu schreiben! Das war mehr, als man von einem so jungen Manne verlangen konnte.
Das gute Einvernehmen der beiden Brüder war indes unmöglich. Lucien und Napoleon hatten beide zuviel von korsischem Blute in sich, als daß sie sich gegenseitig hätten vertragen können. Lucien, von Natur aus widerspruchsvoll, widersetzte sich dem Willen des Ersten Konsuls in dem Maße, daß er, wäre er längere Zeit Minister gewesen, die heilloseste Verwirrung in der Verwaltung angerichtet hätte.
Seine glänzende Rednergabe und sein Hang zur Opposition hätten ihn wohl in einem Parlament zu einer bedeutenden Persönlichkeit gemacht, aber einer Regierung konnten diese Talente, verbunden mit großer Unbeständigkeit, verhängnisvoll werden. Der Herr Minister unterzeichnete fast nie persönlich ein Schriftstück. Das überließ er seinen Sekretären Campi und Desportes, die eine Art Namenszug, ein unleserliches Gekritzel, nachahmten. Lucien tat nur das eine in seinem Amte, was ihm angenehm war: die äußere Repräsentation. Er gab schöne Feste, hielt glänzende Reden, spielte Theater, hielt sich für einen bedeutenden Schauspieler und ließ sich von schönen Damen, wie Frau Récamier und der Schauspielerin Mézeray, anhimmeln. Das hinderte ihn indes nicht, zu behaupten, er sei seiner Christine »im Leben wie im Tode treu gewesen«. Außerdem entfaltete er einen Reichtum, der nicht nur von seinem Einkommen herrühren konnte. Er gefiel sich vor allem darin, die Handlungen des Ersten Konsuls öffentlich zu kritisieren.
Vorläufig hielt er es jedoch für besser, sich nicht zu beklagen, sondern sich lieber durch den einflußreichen Posten so viel wie möglich zu bereichern. Zu jener Zeit schrieb der preußische Gesandte Lucchesini am 10. November 1800 an Friedrich Wilhelm III.: »Lucien Bonaparte begann einen außerordentlichen Luxus zu entfalten, der das Volk stutzig machte. Um sich zu bereichern, mißbrauchte er seine Gewalt, indem er Monopole erteilte und überhaupt alle Mißbräuche der früheren Verwaltung wieder einführte.« Als Entschuldigung für das alles kann nur des Ministers große Jugend – er war 24 Jahre alt – angeführt werden.
Inzwischen bereiteten sich ernste Ereignisse vor. Der Erste Konsul mußte aufs neue zu den Waffen greifen. Er zog am 6. Mai 1800 in den ruhmreichen zweiten Italienischen Feldzug, den die Schlacht von Marengo beschließen sollte. Einige Tage später wurde Lucien Bonaparte Witwer. Christine starb nach fünfjähriger Ehe am 14. Mai im Alter von 26 Jahren. Die zarte Frau hatte bereits seit Monaten gekränkelt und ihren Gesellschaften, die seit der Ernennung Luciens zum Minister eine gewisse Berühmtheit erworben hatten, nicht mehr vorstehen können. Man hatte die häuslichen Pflichten Elisa Baciocchi übertragen müssen, die sich nun auch der beiden kleinen mutterlosen Mädchen annahm.
Luciens Schmerz über den Tod seiner Frau ist groß. »Ungeheurer erster Kummer meines Lebens!« ruft er in seinen Memoiren aus; »Christine Boyer, meine Frau, ist in ihrem einundzwanzigsten Lebensjahr gestorben! Mit ihren entseelten Überresten ziehe ich in die für sie erworbene und für sie verschönte Burg (Plessis-Chamant) ein. O reine, sanfte Seele! Sie ertrug mit mir das Geräusch und den Lärm der Städte; der Aufenthalt auf dem Lande schien ihr der Höhepunkt unseres Glücks!« Selbst in seinem Kummer vergißt er nicht, die Gattin um fünf Jahre jünger zu machen, weil er selbst erst 24 ist.
Vor dem Tode Christines, die das Landleben sehr liebte, hatte Lucien das reizende Schloß Plessis-Chamant gekauft. Dorthin zog er sich nun mit seinem ungeheuren Schmerze für einige Tage zurück. Die Reste seiner Christine ruhten hier unter Blumen und Bäumen, unter denen sie im Leben zu wandeln geträumt hatte.
Auch Letizia trauerte aufrichtig um die Schwiegertochter, die sich die Herzen der ganzen Familie gewonnen hatte. Die Mutter war es, die den Sohn schließlich bewog, in Paris in der Arbeit seines Ministeriums Trost und Beruhigung zu suchen. Napoleon selbst tröstete seinen Bruder mit den Worten: »Sie haben eine vortreffliche Frau verloren ... Sie werden sich nun wieder den Geschäften widmen, nicht wahr?«
Anstatt indes in der Arbeit Vergessenheit zu suchen, stürzte sich Lucien jetzt in den Strudel großstädtischer Zerstreuung. Er knüpfte mehrere Verbindungen mit Künstlerinnen der Oper und des Schauspiels an. Fräulein George von der »Comédie«, Jeanette Phillis und die Sängerin Henri erfreuten sich seiner Gunst. Besonders verfolgte er die schöne Julie Récamier mit glühender Leidenschaft. Nach den dreiunddreißig unendlich langen Briefen zu urteilen, die der Minister unter dem Namen »Romeo« an Julie schrieb, zog sie ihn abwechselnd an und stieß ihn wieder ab und entfachte dadurch nur noch mehr seine Leidenschaft. In rasender Liebe lag er vor der kalten Julia auf den Knien und flehte schluchzend um ihre Gunst. Nach einer Abendgesellschaft bei ihr schrieb er ihr:
»Daß Sie vor dem Abend, als ich Sie tränenerstickt verließ, gegen die Leidenschaft, die Sie mir einflößen, unempfindlich blieben, verstehe ich, denn Sie zweifelten an meiner Aufrichtigkeit. Daß Sie aber seit diesem Augenblick, über den ich noch erröte, Ihr Verhalten mir gegenüber nicht verändert haben, kann ich nur mit Ihrer Gleichgültigkeit erklären.
Gestern morgen dachte ich an meine Tränen und war empört. Gestern abend weinte ich wieder. Und Ihre Blicke, ein einziges Wort von Ihnen öffneten meine Seele von neuem der tiefen Bewegung, die mich bedrückte ... In dieser Lage ist die Freundschaft nichts für mich. Die Liebe ist das einzige, wonach mein Herz verlangt ... Ich brauche Liebe ... mich dürstet nach Liebe ... Aber Sie, Sie sind ebenso ruhig, wie ich unruhig bin. Ihre Ruhe tötet mich. Ihre Gegenwart und diese Ruhe ist für mich die Hölle!
Wenn ich fortfahre, Sie wiederzusehen, so bin ich verloren ... Noch einige solcher Aufregungen wie in den letzten beiden Tagen, und ich werde wahnsinnig ... Mein Charakter ist zu allem fähig ... Ich zittre, wenn ich an die Zukunft denke ... Ich kann Sie nicht hassen, aber ich kann Sie töten! ...«
Aber nicht nur sie konnte sich rühmen, das Interesse Lucien Bonapartes zu erregen. Es ging das Gerücht, daß keine junge Frau sich ohne Gefahr dem Kabinett des Ministers des Innern nähern dürfe!
Den Staatsgeschäften sollte Lucien als Minister nicht lange mehr obliegen. Napoleon behagte es durchaus nicht, daß sein geistreicher Bruder als Staatsbeamter sich mit politischer Literatur beschäftigte. Lucien entwarf Artikel und Reden, die er seinem Sekretär diktierte, aber eigenhändig verbesserte und dann dem Dichter Fontanes zuschickte, der sie veröffentlichte. Unter anderen war der Minister des Innern der Verfasser folgender Schriften: »Qui régnera sur les Français?«; »Des résultats du 18 Brumaire«; »Dialogue aux Champs-Elysées entre Henri IV, le Cardinal Richelieu et Périclès«. Doch schlimmer als das! Die Flugschrift »Parallèle entre César, Cromwell, Monk et Bonaparte«, als deren Verfasser man mit Recht Lucien Bonaparte vermutete, war der Öffentlichkeit übergeben worden. Der Verfasser suchte zu beweisen, daß Frankreich ohne die erbliche Staatswürde vor einem Abgrunde stünde und jederzeit entweder wieder in die Hände der Bourbonen oder irgendeines rohen Prätorianers fallen könne. Ohne Frage wurde in dieser Schrift auf die öffentliche Meinung für die Erblichkeit hingearbeitet. Aber es geschah zu früh. Noch war das Volk zu eng mit der Revolution verknüpft. Und daher war auch die Wirkung, die diese Flugschrift hervorbrachte, vernichtend. Der Erste Konsul war wütend und wollte den Verfasser wissen. Fouché nannte ihm seinen Bruder Lucien. Viele Historiker bestreiten noch heute die Urheberschaft Luciens an dieser Schrift und nennen Fontanes als Verfasser. Aber der beste Beweis ist, daß das Manuskript ganz von Luciens eigener Hand geschrieben ist. Er ergriff also auch in bezug auf die erbliche Staatswürde die Initiative. Nicht weil er ein so guter Republikaner war, daß er die Dauer der gegenwärtigen Regierung gewünscht hätte, sondern weil er darin den Vorteil der Familie, besonders seinen eigenen sah. Denn wie Joseph hoffte er, daß Napoleon ihn zu seinem Nachfolger bestimmte, ihn, der den 18. Brumaire gemacht hatte! Denn in Luciens Augen galt nur der 18. Brumaire. Alles, was vorher und nachher geschehen war, was Napoleon ins Werk geleitet und vollbracht hatte, waren Kleinigkeiten, die nicht zählten. Er, Lucien, er war der Begründer der Größe der Familie Bonaparte!
Der Becher war bis zum Überlaufen voll. In der Nacht vom 2. und 3. Juli kehrte Napoleon zum zweitenmal als Sieger aus Italien heim. Die Intrigen, an deren Spitze Talleyrand stand, hatten ihren Zweck nicht verfehlt. Bei der ersten Zusammenkunft der beiden Brüder brach der Sturm los. Es entspann sich ein heftiger Wortwechsel zwischen ihnen, und Napoleon zwang Lucien, daß er seinen Abschied einreiche.
Lucien schildert die Szene, die zwischen ihm und Napoleon stattfand, folgendermaßen: »Ich war wieder in meinem Ministerium und vertiefte mich ernstlich in die Arbeit. Vieles hatte ich aus den Augen verloren; ich fand auch etwas Unordnung in den Geschäften. Einer meiner Beamten hatte sich bloßgestellt oder sich bloßstellen lassen. Er wurde abgesetzt. Der Erste Konsul war wütend und machte mir die bittersten Vorwürfe wegen der Wahl eines Unterbeamten. Daraus entstand ein heftiger Wortwechsel zwischen uns beiden.
»Jupiter, du ärgerst dich, weil du im Unrecht bist!« rief ich.
Außer sich vor Zorn nennt mich der Erste Konsul einen schlechten Kerl ... Er will mich verhaften lassen. Da reißt mir die Geduld. Mein Ministerportefeuille fliegt auf den Tisch des Ersten Konsuls – nicht an seinen Kopf, wie man unrichtigerweise behauptet hat –; das genügte.«
Luciens Fall war nicht allzu hart. Napoleon bemühte sich, ihn fast unmittelbar darauf zu entschädigen und vertraute ihm den Gesandtschaftsposten in Spanien an. Und so traf den Minister nur eine halbe Ungnade. Aber für Lucien war es der derbste Schlag, den er erhielt, und das in einem Augenblick, wo er glaubte, seine Macht im Staate sei unwiderruflich befestigt.
Bei Napoleon siegte wiederum die Familienzuneigung. Er meinte, mit der Zeit würde sich Luciens unbändiger Charakter mäßigen. Auf Luciens Intelligenz und Fähigkeiten setzte er die größten Hoffnungen. Einst würde er ihm eine wirkliche, ja die beste Stütze des Staates werden. Die Fähigkeiten hatte Lucien allerdings dazu, ob aber den Willen?
Vorläufig also machte er sich am 17. November 1800 mit seiner zweijährigen Tochter Egypta, die in der Familie Lili genannt wurde, auf den Weg nach Spanien, jenem Wunderlande, das aus ihm den reichsten der Bonaparte machen sollte. Denn was waren für Lucien jetzt die 140.000 Franken, die er aus Frankreich bezog? Die brauchte er allein für den Unterhalt seiner Dienerschaft. Ein Bonaparte durfte nicht knauserig auftreten!
Nach einer beinahe vierwöchigen Reise traf er am 6. Dezember in Madrid ein. Er hatte sich längere Zeit in Bordeaux aufgehalten unter dem Vorwande, die Pest wüte in Spanien. In Wirklichkeit hoffte er, daß sein Bruder ihn wieder nach Paris zurückriefe. Aber es geschah nichts dergleichen. Lucien mußte die ihm anvertraute Aufgabe erfüllen. Sie bestand hauptsächlich darin, sich der spanischen Flotte zu versichern, die zur Verproviantierung des ägyptischen Heeres beitragen sollte. Außerdem sollte der Gesandte dem Prinzen von Parma, der mit der Infantin Marie Luise verheiratet war, eine Königswürde in Italien vorschlagen, sowie Spanien zum Bruche mit Portugal bewegen. Vor allem aber sollte er den spanischen Hof für die gemeinsame Sache gegen den Erbfeind England zu gewinnen suchen und sich bemühen, die Wiederabtretung Santo Domingos oder Louisianas zu erlangen.
Vom spanischen Königshause wurde der französische Gesandte aufs liebenswürdigste empfangen. Bald hatte er die ganze Gunst Karls IV. und seiner Gemahlin gewonnen. Er war »persona grata«. »Ich werde mit Auszeichnungen überschüttet«, schrieb er; »ich habe die Schranken der Hofsitte gebrochen, spreche mit dem König und der Königin über Geschäfte, ohne daß der Friedensfürst darüber entsetzt ist; im Gegenteil, er freut sich darüber.« Besonders zeichnete ihn die Königin aus. Sie hätte es gern gesehen, wenn ihre dreizehnjährige Tochter Isabella eine vorteilhafte Heirat gemacht hätte. Zwei deutsche Fürsten hatten bereits um die Hand der Prinzessin angehalten, aber die Königin wollte darüber zuvor die Ansicht des Ersten Konsuls hören. Dabei hegte sie im stillen die Hoffnung, daß Napoleon selbst die Infantin, die dem Fürsten Godoy aufs Haar ähnlich sah, zur Frau begehre. Lucien schrieb sofort an seinen Bruder und riet ihm zu dieser königlichen Verbindung und somit zur Scheidung von Josephine, die er nicht ausstehen konnte. Eine Heirat seines Bruders mit einer königlichen Prinzessin hätte diesen »überzeugten Republikaner« außerordentlich geschmeichelt.