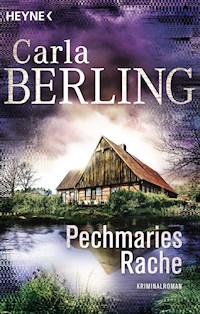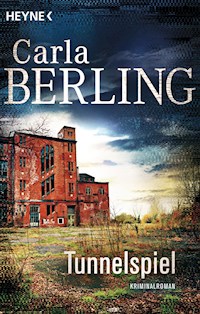9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich gehe Zähne putzen, soll ich deine gleich mitnehmen?«
Das kann es doch nicht gewesen sein!, denkt Thea, als ihr 40. Hochzeitstag vor der Tür steht und ihr Gatte Ronny das gemeinsame Eheleben mental schon mal ins Altenheim verfrachtet hat. Was ist aus Leidenschaft und Abenteuer geworden? Jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind und endlich mal Zeit für die eigenen Träume ist? Es wird Zeit, die Reißleine zu ziehen. Also verkünden die beiden auf der Party zu ihrem Hochzeitstag vor versammelter Mannschaft, dass sie ab jetzt getrennte Wege gehen. Die frisch gebackenen Singles sind bestens vorbereitet. Doch dann kommt alles anders als gedacht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
»Ronny schlüpfte in seinen Schlafanzug. Um zu wissen, was er tat, brauchte ich nicht hinzusehen, ich kannte das Geräusch jedes einzelnen Handgriffs. Normalerweise hockte Ronny danach auf dem Klosett, dabei summte die elektrische Zahnbürste exakt zwei Minuten lang. Dann hörte ich die Toilettenspülung und anschließend das Klacken, wenn er die Zahnbürste zurück in die Halterung steckte.
An diesem Abend drehte er sich entgegen allen regulären Bewegungsabläufen in der Tür kurz um und schaute mich grinsend an. ›Ich gehe Zähne putzen, soll ich deine gleich mitnehmen?‹
Mein Unterkiefer fiel herunter. Normalerweise konnte ich auf Ronnys speziellen Humor gelassen reagieren, das ist eben so, wenn man seit der Schulzeit ein Paar ist, aber an diesem Abend geschah etwas mit mir.
Ich merkte es nicht sofort, sondern erst Wochen später.«
Zur Autorin
Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen Erfolg als Selfpublisherin. Mit »Der Alte muss weg« wechselte sie sehr erfolgreich in die humorvolle Unterhaltung. Unter dem Pseudonym Felicitas Fuchs schreibt sie darüber hinaus historische Familiengeschichten. Bevor sie Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als Lokalreporterin und Pressefotografin. Sie tourt außerdem regelmäßig mit ihren Romanen durch große und kleine Städte.
Lieferbare Titel
978–3-453–41996–4 – Mordkapelle
978–3-453–41993–3 – Sonntags Tod
978–3-453–41994–0 – Königstöchter
978–3-453–41995–7 – Tunnelspiel
978–3-453–42315–2 – Der Alte muss weg
978–3-453–42252–0 – Pechmaries Rache
978–3-453–42412–8 – Klammerblues um zwölf
978–3-453–42492–0 – Was nicht glücklich macht, kann weg
Carla Berling
Glück für Wiedereinsteiger
Roman
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 05/2024
© 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Steffi Korda,
Büro für Kinder- & Erwachsenenliteratur, Hamburg
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
unter Verwendung von Abbildungen von © Gerhard Glück
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-31310-4V002
ISBN 978-3-641-31310-4V002
1
Neun Wörter waren es, die schließlich alles veränderten. Neun eigentlich unbedeutende Wörter, in freundlichem Ton dahingesagt, an einem Montagabend um Viertel vor elf.
Ich saß auf der Bettkante und massierte meine Füße. Ronny schlüpfte in seinen Schlafanzug. Die Hose war ihm an den Beinen zu kurz und das Oberteil am Bauch zu weit. Um zu wissen, was er tat, brauchte ich nicht hinzusehen, ich kannte das Geräusch jedes einzelnen Handgriffs. Das Ächzen, wenn er sich die Strickjacke über die Schulter zog, das Geräusch der Hose, die auf den Boden fiel, bevor er sie akkurat auf den stummen Diener hängte, das Schleifen seiner Unterhose über die trockene Haut seiner sehnigen Schenkel. Sobald Ronny im Nachtgewand war, hatte er die Angewohnheit, den rechten Daumen in den elastischen Bund der Schlafanzughose zu stecken. Er ließ das Bündchen dezent auf seinen flachen Bauch flitschen, bevor er sich, barfuß übers Laminat tapsend, auf den Weg ins Bad machte. Beim Gehen knackten seine Gelenke. Die Türen des Spiegelschrankes klappten; ich wusste, dass er jetzt die Zahnpasta portionierte, dann ertönte das laute Brummen der elektrischen Zahnbürste. Abends putzte Ronny sich die Zähne, während er auf dem Klo saß.
Ja, er saß.
Seit er mal eine Weile das Bad hatte sauber machen müssen – ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen und war für derlei Verrichtungen ausgefallen –, hing überm Klo die Attrappe einer Überwachungskamera neben einem Schild, auf dem stand: Bei Stehpinklern schaltet sich automatisch die Kamera ein!
Die Brille blieb fortan sauber, bei uns saßen alle.
Normalerweise hockte Ronny also auf dem Klosett und sorgte dafür, dass er nachts nicht rausmusste, dabei summte die elektrische Zahnbürste exakt zwei Minuten lang. Dann hörte ich die Toilettenspülung und anschließend das Klacken, wenn er die Zahnbürste zurück in die Halterung steckte.
An diesem Abend drehte er sich entgegen allen regulären Bewegungsabläufen in der Tür kurz um und schaute mich grinsend an. »Ich gehe Zähne putzen, soll ich deine gleich mitnehmen?«
Mein Unterkiefer fiel herunter. Ich bekam den Mund sekundenlang nicht zu. Normalerweise konnte ich auf Ronnys speziellen Humor gelassen reagieren, das ist eben so, wenn man seit der Schulzeit ein Paar ist, aber an diesem Abend geschah etwas mit mir.
Ich merkte es nicht sofort, sondern erst Wochen später.
»Ronny«, sagte ich an jenem Abend milde, »es ist eine Beißschiene und kein Gebiss, das außerhalb meines Körpers in einem Wasserglas mit Corega-Tabs übernachten musste. Deine Scherze waren auch schon mal besser.«
Ich zog mir die Decke über den Kopf. Als er zurückkam, bewegte ich mich nicht und tat, als würde ich schon schlafen.
Er knipste sein Leselicht an und murmelte: »Lass uns morgen endlich mit der konkreten Reiseplanung anfangen. Ehe man sich’s versieht, haben wir Silvester.«
»Hm«, brummte ich.
Die Mottoparty. Wir wollten unseren vierzigsten Hochzeitstag, der auch unser beider sechzigster Geburtstag sein würde, mit Freunden von damals feiern. Ronny hatte recht, bis Silvester waren es noch acht Monate; wir mussten sehen, dass wir in die Gänge kamen.
Ronny und ich sind am 1. Januar geboren, aber nicht nur das: Wir heißen beide von Geburt an Schmidt. Ich bin also Thea Schmidt, geborene Schmidt. Natürlich sorgten derlei Zufälle schon in der Schule für Erstaunen oder Verwirrung, denn da wir im selben Ortsteil aufgewachsen sind, wurden wir auch am selben Tag in derselben Klasse eingeschult. »Seid ihr Geschwister?«, fragte jeder, der uns kennenlernte. Dass wir später beide eine Lehre in der Sparkasse machten, war dann irgendwie die Krönung der Gemeinsamkeiten.
Ich fand es erst immer doof, Neujahr Geburtstag zu haben. Als Kind ging mir der höchste Feiertag des Jahres flöten, an dem ich endlich mal die Hauptperson hätte sein können. Aber als junge Erwachsene war es prima, mit Böllern und Feuerwerk reinzufeiern.
Ronny und ich sind in der Silvesternacht zu unserem achtzehnten Geburtstag zusammengekommen. Na ja, was heißt zusammengekommen … Ein Paar waren wir schon früher, aber platonisch. Nur mit Knutschen. Fast nur.
Wir gingen jedenfalls miteinander, seit wir sechzehn waren. Und an jenem Silvester feierten wir mit der Clique in der Kellerbar von Olli Holländers Eltern. Olli hatte sturmfrei, die Eltern waren im Sauerlandstern.
Wir hatten zu Peter Maffay getanzt. Eng. Sehr eng. Als ich Ronny fragte, ob er nicht seinen Schlüssel aus der Hosentasche nehmen könnte, der würde ein bisschen stören, ließ er mich für einen Moment los, um mich fassungslos anzusehen. Dann zupfte er an seinem mit Rauten gemusterten Pullunder und tanzte entschlossen und noch enger weiter.
So bist duhuhu … Nie hatte ein Text so zu mir und meinen Gefühlen gepasst. Denn wenn ich geh, dann geht nur ein Teil … Ich musste nur an diesen Song denken und hatte tagelang einen Ohrwurm.
Jedenfalls war das die unvergessliche Nacht gewesen, in der Ronny und ich unsere Unschuld verloren. In Holländers Gartenhäuschen, auf einer geblümten, muffigen Auflage für den Liegestuhl, bei fünfzehn Grad minus. Heiße Nächte sind anders. Aber wir haben danach immer wieder geübt, bis es uns richtig Spaß machte.
Und zwei Jahre später, am 31. Dezember, einen Tag vor unserem zwanzigsten Geburtstag, haben wir geheiratet.
Meine Eltern waren entsetzt, als ich ihnen unsere vollzogene Verlobung beichtete.
»Eine Hochzeit mit Rückenwind«, jammerte meine Mutter, »wie stehen wir vor den Leuten denn jetzt da …«
»Wie ’ne junge Oma!«, antwortete ich, was sie nicht wirklich tröstete. Die Erlaubnis zur Hochzeit musste sie trotzdem geben. Jedenfalls war es eine großartige Party, auch wenn ich als »gefüllte Braut«, wie mein Schwiegervater es charmant nannte, mit Capri-Sonne und Dunkelbier anstieß. Die anderen konnten es richtig krachen lassen: zwei zwanzigste Geburtstage, Silvester und eine Hochzeit an einem Tag, wann hatte man je so viele Anlässe auf einmal.
Nun, das war knapp vierzig Jahre her. Ronny und ich hatten also die »Rubinhochzeit« und den runden Geburtstag vor uns.
»Mama, dass ihr euren Sechzigsten feiern wollt, klar, finde ich grundsätzlich klasse. Aber eine Rubinhochzeit? Die Silberhochzeit feiert man groß und dann die Goldene, wieso hängt ihr ein krummes Jubiläum denn so hoch?«, fragte unsere älteste Tochter.
»Franziska, die erste Frage, die ich mir stelle, lautet: Wer ist noch mal ›man‹?« Kopfschüttelnd fuhr ich fort: »Wir haben eine Pandemie hinter uns. Wir haben keinen Klimawandel mehr, sondern eine sehr bedrohliche Klimakrise. Wir haben immer häufiger Starkregen, Hochwasser, Orkane, Dürren und Waldbrände. Hier, bei uns in Deutschland, nicht jottwehdeh. Wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Außerdem ist es vielleicht der letzte runde Geburtstag, an dem ich tanzen kann, mit siebzig gehe ich womöglich am Stock. Ich möchte zeitnah feiern. Was ich hab, das hab ich.«
»Du immer mit deinem Pessimismus«, moserte Franziska.
»Ich nenne das Realismus«, erwiderte ich.
Ronny war auf meiner Seite: Unsere Rubinhochzeit war ein toller Anlass für ein Fest, und er hatte sofort die Idee mit der Mottoparty.
»O ja«, rief ich begeistert, »sollen wir alles in einer Farbe machen? Kleidung, Deko, Getränke und Essen in Rot? Oder Grün? Oder vielleicht lieber eine Flower-Power-Party?«
Natürlich hätte ich wissen müssen, dass Ronny für nichts Schräges zu haben war, er wollte immer alles elegant, mit Stil und Klasse. Um nichts in der Welt wäre er je irgendwo in nachlässiger Kleidung aufgetaucht. Deswegen feierte er (als gebürtiger Rheinländer!) auch seit Jahrzehnten keinen Karneval mehr.
Natürlich gab ich nach. Also würde es nach seinem Wunsch eine Party mit dem Titel Comme au Cinema werden. »Wie im Kino«, na, das war ein weites Feld, dazu würde gewiss jedem etwas einfallen.
Nun war das Motto beschlossen und verkündet, aber die Gästeliste war noch nicht fertig. Einige unserer damaligen Freunde waren inzwischen leider verstorben, ein paar waren ausgewandert und nicht zu erreichen, mit manchen hatten wir uns für immer und ewig zerstritten, andere hatten wir irgendwann einfach aus den Augen verloren. Wochenlang hatte ich nachgeforscht, wer wo abgeblieben war, und oft hatte ich Ronny abends mit den Worten begrüßt: »Hör mal, weißt du, wer auch tot ist?«
»Kümmerst du dich bitte um die Liste der Überlebenden?«, hatte er schließlich gefragt.
Natürlich kümmerte ich mich. Ich kümmere mich immer um alles. Nicht umsonst werde ich von unseren drei Töchtern »Kümmermonster« genannt. Ich weiß nie so recht, ob es liebevoll gemeint ist oder sie genervt sind.
Zeitnah wollten Ronny und ich uns zusammensetzen und die Liste der Überlebenden und nicht Verschollenen durchgehen, dann würden wir sie aufsuchen und persönlich einladen. Die Besuchstour sollte die Urlaubsreise ersetzen, über deren Ziel wir uns dieses Mal nicht hatten einigen können.
Wir waren vor der Pandemie in Bayern gewesen – ein Kompromiss, ein fauler dazu. Ronny hatte eigentlich lässig in München flanieren wollen, sich elegant anziehen, stundenlang in Straßencafés sitzen, schlemmen und Wein trinken wollen. Ich liebte aber die Natur, wollte wandern, abschalten, Ruhe haben, die Stille hören. Also hatten wir uns auf eine Woche in München und anschließend sieben Tage Tegernsee geeinigt.
Ich hasste es, durch eine überfüllte Metropole zu latschen, alte Gebäude zu besichtigen und Vorträge darüber zu hören, wo und wann welcher König an einen besonderen Findling gepieselt hatte. Und ich sah es überhaupt nicht ein, in »angesagten« Lokalen Unsummen für Hausmannskost zu bezahlen, bloß weil ein berühmter Koch seinen Namen dafür hergegeben hatte. Dafür bekam man dort halbe Portionen zum zehnfachen Preis, die man in »Time-Slots« zu verzehren hatte, weil die nächsten Gäste schon auf ihren Auftritt warteten.
Nein, das war nicht meine Welt.
Ronny fand es doof, sich derbe Schuhe mit Profilsohlen und praktische Funktionskleidung anzuziehen, um auf Berge zu klettern, deren Gipfel oft im Nebel lagen und von denen man dann nicht mal eine schöne Aussicht hatte. Ich hingegen wartete gern, bis die Wolken sich verzogen hatten.
»Steig halt im Smoking mit Lackschuhen auf den Wallberg«, hatte ich gesagt, als er schon beim Frühstück wegen seiner wetterfesten Garderobe gezetert hatte.
Sobald die Pandemie das Reisen wieder zugelassen hatte, hatten wir sofort Pläne gemacht. Leider waren unsere Wünsche wieder so verschieden gewesen, dass wir ewig hatten diskutieren müssen. In Sachen Urlaub gebe ich nämlich nicht so schnell nach wie sonst.
Ronny wollte in diesem Jahr unbedingt nach Paris, ich träumte von Usedom. Glattes Wasser, lange Strände, Wälder in Strandnähe. Bei einer Entfernung von 1200 Kilometern, die unsere Wunschziele voneinander entfernt lagen, gab es dieses Mal keinen Kompromissurlaub.
»Fahrt doch getrennt!«, schlug unsere mittlere Tochter Katharina vor. Dabei bekam sie volle Unterstützung von ihrer jüngeren Schwester Jette, die seit jeher auf alle Konventionen pfeift, als berufstätige Mutter in Köln lebt und den kenianischen Vater unserer Enkelin schon vor der Geburt in die Wüste geschickt hat. Sie findet es normal, wenn ein Ehepaar nach vier Jahrzehnten getrennt in Urlaub fährt. Ich weiß nicht, warum, aber das kam für uns nicht infrage.
Die Entscheidung war gefallen, es gab die Mottoparty-Tour.
2
Junger Gouda, Leberwurst, Hähnchenbrust und gute Butter. Als ich die Zutaten aus dem Kühlschrank nahm und die Butterdose öffnete, schmunzelte ich.
»Gute Butter«, hatte meine Mutter immer gesagt. Ich hatte nie verstanden, warum. Wer nahm denn schlechte Butter?
Meine Mutter hatte einige Redewendungen gehabt, die mir immer wieder einfielen. Wenn sie zum Beispiel die Ziehung der Lottozahlen im Fernsehen anschaute, sagte die Lottofee zum Schluss immer dieselben Worte: »Diese Angaben sind ohne Gewähr«, und meine Mutter fügte immer im gleichen Tonfall und mit wackelndem Zeigefinger hinzu: »Aber mit Pistole!« Obwohl nie jemand darüber lachte, hat sie jedes Mal über ihren eigenen Witz gekichert. Und sie nahm gute Butter.
Bei uns wird in der Butterfrage penibel unterschieden. Ich bevorzuge Pflanzenmargarine, für Ronny kommt nur Butter mit grobem Meersalz infrage. Dazu isst er weichen französischen Käse, nach dem die ganze Küche stinkt, sobald man die Käseglocke lüftet. Und er will kein gesundes Vollkornbrot, sondern Baguette. »Das sind bloß leere Kalorien«, erklärte ich immer wieder. »Das ist ungefähr so, als würdest du einen großen Raum mit einem Kamin heizen und Papier ins Feuer werfen. Das wird sofort zu Asche, während ein Eichenscheit viel länger brennt und wärmt.«
Obwohl Ronny ansonsten sehr gesundheitsbewusst lebt, beim Essen lässt er sich nicht reinreden. Des Mannes Wille ist nun mal sein Himmelreich. Ich bereitete die Schnittchenteller vor. Für mich Gewürzgurke und Radieschen als Beilage, für Ronny Oliven und Weintrauben. Ich trank zum Essen immer Leitungswasser, ihm schenkte ich Rotwein in eins der bauchigen Gläser, die nicht in die Spülmaschine durften. Jeden Handgriff beherrschte ich im Schlaf: Stoffservietten zum Dreieck falten, das Licht der Dunstabzugshaube einschalten, weil es die Küchenzeile dezent beleuchtete, eine Kerze anzünden. Früher hatte ich Teelichter benutzt, aber die Metallschälchen waren alles andere als umweltfreundlich. Deshalb gab es jetzt bei uns Bienenwachskerzen.
Es war zehn vor sieben, um sieben Uhr wurde gegessen. Danach stand die Planung der Mottoparty auf dem Programm.
Das Telefon klingelte. Um diese Zeit?
Marita ruft an, stand auf dem Display.
Ich meldete mich mit den Worten: »Hallo, Marita, wir wollen gleich essen!«
Sie plapperte sofort los: »Stell dir doch bitte mal vor, Gaby Schickentanz hat ein Verhältnis!«
»Oh. Tatsächlich?«
»Ja, oh, das hab ich auch gedacht!«
»Und woher weißt du das?«, fragte ich.
»Heike hat es mir heute beim Turnen erzählt. Die Gaby! Ausgerechnet! Ich wollte es gar nicht glauben, aber die Information kommt aus erster Hand. Heike ist nämlich mit Gabys Schwägerin befreundet, und die wiederum ist Gabys beste Freundin und engste Vertraute.«
Ich teilte die Informationen in Häppchen auf, um sie besser verstehen zu können. »So eine Freundin braucht kein Mensch, wenn sie dafür sorgt, dass es sogar in deiner Turngruppe ankommt.«
Marita stutzte. »Da ist was dran.« Dann fuhr sie ungerührt fort: »Aber trotzdem. Gaby! Erinnerst du dich daran, wie sie sich benommen hat, als ich damals geschieden wurde? Von jetzt auf gleich war ich raus aus dem Freundeskreis. Sie wird geglaubt haben, dass ich mit jedem Kerl ins Bett wollte, der nicht bei drei auf dem Baum war. Geschiedene haben doch immer diesen Ruf, dass sie nur das eine wollen. Aber Thea, ganz im Vertrauen: Ihren Dirk, den hätte ich sowieso nicht rangelassen. Den hättest du mir nackt vor den Bauch binden können, ich wäre gerannt, bis er runterfällt. Aber Gaby wird gewusst haben, warum sie ihn so penibel bewacht hat. Sie dachte bestimmt, dass er auf jede scharf ist, die in seine Nähe kommt. Dabei war Dirk schon immer ein total schüchterner Mensch, der hat doch nicht mal beim Schützenfest mit anderen Frauen Brüderschaft getrunken. Und nun das. Wenn ich bloß wüsste, wen Gaby sich geschnappt hat …«
Sie holte Luft, ich nutzte den Moment, um nachzufragen: »Wie ist das denn aufgeflogen?«
»Dummer Zufall, ganz dummer Zufall! Dirk hat auf Gabys Handy zufällig eine SMS gesehen.«
»Wie kann man auf dem Handy des Partners zufällig eine SMS sehen?« Ich dachte an unsere Handys, die mit Gesichtserkennung oder Codes zu entsichern waren. Darauf zufällig etwas zu lesen, war nach meiner Kenntnis nicht möglich.
»Keine Ahnung, er muss das Passwort gehabt haben. Jedenfalls hat er eine eindeutige SMS gelesen: Mein süßer Blasehase, wir sehen uns wie gehabt im Kaiserforst. Dein Bärchen.«
Ich verschluckte mich fast, so sehr musste ich lachen.
Marita sagte: »Schade, dass Bärchen nicht mit seinem richtigen Namen unterschrieben hat, dann wüsste man, mit wem man es zu tun hat. Und schade auch, dass Dirk das Handy an die Wand geschmissen und nicht daran gedacht hat, den Absender der SMS anzurufen. Männer haben in solchen Situationen einfach keine Nerven, sie reagieren viel zu emotional.«
»Kann sein. Du, ich muss Schluss machen, Ronny sitzt am Tisch und wartet, wir essen jetzt!« Ich legte auf.
Ronny zog die Augenbrauen hoch. »Was war denn so wichtig, dass sie zur Essenszeit anrufen musste?«
»Sie wollte mir brühwarm erzählen, dass Gaby Schickentanz ein Verhältnis hat und dass Dirk es zufällig rausgekriegt hat.«
Er winkte ab. »Ob in China ein Sack Reis umfällt oder Gaby ’ne Affäre hat … mir ist beides egal.« Grinsend erzählte ich trotzdem vom Inhalt der SMS.
»Blasehase? Bitte, ich möchte dazu keine Bilder im Kopf haben.« Er klopfte mit dem Handballen an seine Schläfe und beschwor mit den Wörtern »Hundebabys, Hundebabys, Hundebabys!« sofortige Ablenkung herauf. Dann platzierte er eine Portion müffelnden Camembert auf einer Scheibe Baguette und biss genüsslich hinein.
Nachdenklich sah ich ihm beim Essen zu. Ronny war schon immer ein besonders attraktiver Mann gewesen, daran hatte sich auch mit fast sechzig Jahren nichts geändert. Sein welliges dunkles Haar schimmerte an den Schläfen silbergrau, er trug es klassisch nach hinten gekämmt. Feine Fältchen umrahmten seine blauen Augen, um deren lange schwarze Wimpern ich ihn seit jeher beneidete. Neuerdings brauchte er eine Lesebrille, aber die stand ihm ausgezeichnet. Ronny war groß, schlank, von athletischer Statur, die er dank Jogging, Schwimmen, Rudergerät, Radfahren, Liegestützen, Kniebeugen und Hanteltraining in Form hielt.
Daran sollte ich mir ein Beispiel nehmen, aber ich hatte einfach zu viel zu tun und keine Zeit für sportliche Aktivitäten. Man sah es mir inzwischen auch an. Nach den Wechseljahren war ich ein bisschen aus der Form geraten. Zuerst war ich unglücklich über mein wachsendes Bäuchlein und die Schwerkraft gewesen, die plötzlich an allen möglichen Körperteilen einsetzte, aber Ronny streichelte meine Schwachstellen bei passenden Gelegenheiten zärtlich und raunte liebevoll: »Das ist alles erotische Nutzfläche. Und wenn es jetzt ein bisschen mehr ist, umso besser.«
Ich liebte seinen Humor, auch wenn er zuweilen grenzwertig war (ich sag nur: Pinkelschild im Bad …). Das Schönste an ihm aber war sein Lächeln, und das gefiel mir nicht nur wegen der teuren Kronen, in die wir viel Geld investiert hatten. Er hatte beim Lächeln Grübchen, zauberhafte Grübchen, auf die ich früher gern mit spitzen Lippen Küsse gehaucht hatte.
Schon in der Schule war Ronny aufgefallen, weil er durch sein Gardemaß von eins zweiundneunzig fast alle anderen überragt hatte. Damals hatte er schulterlanges, welliges Haar gehabt, alle Mädchen waren hinter ihm her gewesen. Aber er hatte sich als Sechzehnjähriger tatsächlich in mich verliebt, und das war, wenn ich es richtig einschätzte, bis heute so geblieben.
Marita wollte mal wissen, ob ich keine Angst hätte, dass Ronny fremdgehe, weil er so gut aussehe.
»Ist es ein Grund zum Fremdgehen, wenn ein Mann attraktiv ist?«, fragte ich zurück.
»Aber sicher, weil Frauen es gut aussehenden Männern immer sehr leicht machen!«
Nein, ich hatte keine Angst. Ronny war mir immer treu gewesen. Er erzählte mir sogar, wenn ihn eine angebaggert und er es gemerkt hatte, und wir amüsierten uns gemeinsam darüber. Ja, er sah überdurchschnittlich gut aus und wusste das auch, aber er machte sich nichts daraus. Das heißt – er legte Wert auf Körperpflege und Garderobe, eitel war er schon. Er brauchte im Bad wesentlich länger als ich und gab eine Menge Geld für seinen Luxuskörper aus. Er ging regelmäßig zur Kosmetikerin, gönnte sich Maniküre, Pediküre, Massage, ging ab und zu ins Solarium und alle vier Wochen zum Friseur.
Ich erschrak, als er plötzlich mit der flachen Hand vor meinen Augen herumwedelte. »Hallo, ist jemand zu Hause? Wo bist du gerade mit deinen Gedanken?«
»Ich hab überlegt, ob du mir noch treu bist.«
»Du unterstellst mir ja wohl nicht, dass ich Gabys unbekannter Blasehase bin, oder?«, fragte er mit gespieltem Entsetzen.
Wir mussten lachen. Solange wir zusammen lachen, ist doch noch immer alles gut, dachte ich.
Nach dem Essen nahmen wir uns die Gästeliste vor. Zuerst notierten wir die Familienmitglieder, für die wir Übernachtungsmöglichkeiten schaffen mussten: Unsere älteste Tochter Franziska, die mit Mann und den Kindern Ronja und Damian in Stockholm wohnte, würde in ihrem alten Kinderzimmer schlafen. Ronnys Eltern, die auf Ibiza lebten und mindestens eine Woche bleiben würden, weil sich die Reise sonst nicht lohnte, sollten Katharinas Zimmer bekommen. Unsere mittlere Tochter lebte mit ihrer Familie nur ein paar Straßen weiter, sie konnten nach der Feier nach Hause gehen. Und Jette, die Jüngste, sollte mit ihrer Tochter Ilse auch in ihrem früheren Kinderzimmer schlafen. Dann hatten wir noch ein Gästezimmer, in dem wir zwei Leute unterbringen konnten, und im Wohnzimmer war auf dem Sofa Platz für zwei. So viele waren wir früher oft gewesen.
Spontan sagte ich: »Manchmal denke ich, dass es ziemlich irre ist, das große Haus zu behalten.«
»Hä? Wo sollen die Kinder denn alle schlafen, wenn sie mal hier sind?«, fragte Ronny.
»Das ist der Punkt: Wenn sie mal hier sind!«
Die meiste Zeit lebten wir allein auf über zweihundert Quadratmetern, aber wir benutzten nur noch das Erdgeschoss. Die Kinderzimmer unserer Töchter standen seit Jahren leer. Seit auch Jette ausgezogen war, betrat ich die Räume nur noch zum Staubwischen und Lüften. Dazu der riesige Garten, auch er war für zwei alternde Leute viel zu groß. Obwohl wir uns schon von etlichen Beeten und Beerensträuchern getrennt und Rasen gesät hatten, verbrachte ich immer noch viel Zeit mit der Pflege.
Ich sprach noch einen spontanen Gedanken aus: »Einer von uns beiden geht zuerst.«
»Wohin?«, fragte Ronny.
»Ins Grab natürlich. Ich meine, unter normalen Umständen stirbt einer von uns zuerst, und derjenige, der zurückbleibt, hockt allein in diesem großen, leeren Haus.«
»Thea, um Himmels willen, wie kommst du denn auf so was, wir sind neunundfünfzig und kerngesund!«
»Ja, jetzt! Aber vielleicht bleibt das nicht immer so. Was ist denn, wenn einer von uns gestorben ist? Hast du noch nie daran gedacht?«
»Nein. Daran will ich auch nicht denken, wozu? Ich habe beschlossen, mindestens Mitte neunzig zu werden.«
3
Der Wecker klingelte um sechs. Durch das gekippte Fenster wehte laue Frühlingsluft herein und bauschte die Gardinen zu weißen Schleiern. Draußen zwitscherten Heerscharen von Spatzen, die Sonne schien durch die Blätter des Fliederbusches und malte zitternde Schatten an die Zimmerdecke. Von Ronny schaute nur der Haarschopf unter der Decke hervor, ich hörte seinen ruhigen Atem.
So ein friedlicher Moment. Ich blieb noch ein bisschen liegen. Vor acht würde er nicht aufstehen. Schließlich war heute Sonntag, es wurde ausgeschlafen, Muttertag hin oder her.
Ich dachte an frühere Muttertage, in denen er vor mir aus dem Zimmer geschlichen war, um mit den Mädchen Frühstück zu machen. Das war jahrelang mein Geschenk gewesen: ein gedeckter Tisch mit Blumen aus dem Garten und drei aufgeregte Mädchen, die Bilder gemalt oder Glückwunschkarten gebastelt hatten. Leider war der Festakt jedes Mal beim Tischabräumen zu Ende gewesen, und ich hatte die Trümmer beseitigen müssen, die drei Kinder und ein unbeholfener Mann in einer Küche nun mal hinterlassen.
Heute wollten nur Katharina und Jette mit ihren Kindern zum Frühstück kommen, die Stockholmer würden sich abends per FaceTime melden. Natürlich hatte ich auch meinen Vater eingeladen.
Opa Günni, so nannte ihn fast jeder, lief stets in Cordhosen mit Hosenträgern, Flanellhemd und Turnschuhen rum, rasierte sich grundsätzlich nur montags und rauchte Roth-Händle-Zigaretten. Mein Vater war vierundachtzig Jahre alt, faltig wie ein Hundertjähriger, aber sehr rüstig. Er trank gern ein Schnäpschen oder zwei oder drei und geigte jedem ungefragt die Meinung. Das war anstrengend. Mein Vater hatte zuweilen etwas merkwürdige Ansichten, die er ungefragt kundtat, und auch das war anstrengend.
Der Schlummermodus des Weckers ließ mich schließlich aufstehen.
Duschen dauerte bei mir nur drei Minuten, Anziehen weniger als zwei. In Jeans, Shirt und Birkenstocks fühlte ich mich in der Freizeit am wohlsten, Schminke benutzte ich nicht, meine kurzen braunen Haare kämmte ich aus dem Gesicht und ließ sie an der Luft trocknen. Ich weiß, Ronny wünschte sich oft, dass ich wenigstens ab und zu schicke Garderobe tragen würde, aber ich hatte keinen Sinn für so was. Opa Günni hatte mal gesagt: »Du has en Klamöttschen wie en Putzfrau, und de Kääl sieht us wie ne Dressmenn!«
Mir reichte es, dass ich bei der Arbeit in der Sparkasse Blusen und Hosenanzüge tragen musste, obwohl ich mir mit meiner Kollegin Isa ein Büro im Souterrain teilte und mich außer ihr kaum jemand sah.
Heute aber war Freizeit, Sonntag, Muttertag, und ich hatte noch jede Menge Arbeit.
Pünktlich um zehn Uhr saßen alle am Tisch und schnatterten durcheinander. Ich reichte den Korb mit den frisch aufgebackenen Brötchen herum, als Opa Günni loslegte: »Kinners, isch muss eusch wat verzälle. Et sin Ausländer! Wat sisch de Verwaltung dabei jedacht hät, isch wäs et nit …«
Jette unterbrach ihn: »Opa Günni, bitte rede in Ilses Gegenwart Hochdeutsch!« Sie wandte sich an ihre Tochter: »Grandpa will talk to you soon in a more understandable way.«
Sofort rief Opa Günni: »Un isch möschte, dat minge Enkelin mit mir Deutsch vazällt!«
Jette erzog ihre Tochter zweisprachig, was ich natürlich begrüßte, daher nahm ich sie in Schutz: »Heutzutage ist es wichtig, sich in einer Fremdsprache genauso verständigen zu können wie in der Muttersprache. Ilse ist die Generation, die mit Sicherheit nicht so an der Scholle kleben kann wie wir. Die Welt ändert sich; wer weiß, wo sie mal leben muss! Und dann kann eine zweite oder dritte Sprache sehr hilfreich sein.«
Mein Vater verdrehte die Augen, Katharina schüttelte genervt den Kopf, ihre Söhne Matthäus und Cornelius daddelten auf dem Handy und kriegten nichts mit. Ich wollte noch etwas zum Thema Klimawandel und Studien über die daraus resultierenden und zweifelsfrei bevorstehenden Völkerwanderungen sagen, aber Ilse kam mir zuvor: »Opa Günni, Kompromiss? Wenn du kein Kölsch redest, spreche ich kein Englisch mit Mama.« Sie machte eine Pause, bevor sie schelmisch grinsend fortfuhr: »Is et denn dann allet wieder joot?«
Was für ein Sonnenschein. Alle brachen in Gelächter aus.
Opa Günni schmunzelte: »Für ne Fünfjährje hast du ne janz schöne Klappe!« Dann begann er zu berichten, was ihm auf der Seele lag, dabei war er um Hochdeutsch bemüht und sprach deswegen betont langsam. »Mir hat sisch keiner von de Neuen vorjestellt. Dat jeht aber so nit. Die müssen sisch anpassen. Un wir müssen uns abspreschen, wer wann de Treppe macht. Jestern han isch denen ne Putzplan an de Türe jeklebt: Eene Woch: Jünther Schmidt. Nexste Woch: neue Mieter. Den Namen kenn isch ja nit.«
»Opa Günni, wenn du deine neuen Nachbarn wirklich kennenlernen willst, dann klingele doch einfach. Und wenn das Treppenhaus geputzt werden muss, sag es ihnen«, meinte Jette.
Mein Vater machte sich gerade. »So weit kommtet, dat isch da hinnerherrenn! Dat sin de Neuen, die müssen sisch vorstellen! Isch weiß bloß, et sin Ausländer!«
Ilse platzte heraus: »Ausländer sind alle Menschen, wenn sie nicht zu Hause sind. Mein Erzeuger ist in Köln ein Ausländer, und als meine Mama mit ihm in Kenia verliebt war, war sie in Kenia eine Ausländerin!«
Der Begriff »Erzeuger« stieß mir übel auf, aber das war nun mal die Erziehung meiner Tochter, da durfte ich mich nicht einmischen.
Jette schaute Ilse mit liebevollem Stolz an, Opa Günni brummte, Ronny nickte zustimmend, und ich musste in die Küche, weil die Zeitschaltuhr am Backofen geklingelt hatte und das Blech mit den nächsten Brötchen fertig war.
Gegen Mittag brachen fast alle gleichzeitig auf. Katharinas Jungs mussten zum Tennis. Eigentlich brachte ich sie immer hin, aber weil heute Muttertag war, übernahmen die Eltern den Fahrdienst ausnahmsweise selbst.
Jette wollte noch arbeiten. »Mama, ich mag dich gar nicht fragen, ob Ilse vielleicht noch ein bisschen hierbleiben kann …«
»Na, dann frag halt nicht«, rutschte es mir heraus. »Du bist auch Mutter, mach doch heute mal was Schönes mit Ilse!«
Meine Tochter sah mich verärgert an. »Mama, du weißt, dass ich kein Typ bin, der auf Work-Life-Balance Wert legt. In meiner Position muss ich eben auch sonntags Mails beantworten.«
Abwehrend hob ich die Hände, ich hatte keine Lust auf Diskussionen. »Ja, lass sie halt hier, ich bring sie später nach Hause«, sagte ich, obwohl ich es gar nicht wollte.
Natürlich fragten meine Töchter, ob sie mir beim Aufräumen helfen sollten, aber der Ton, in dem sie es sagten, war eindeutig.
»Nein, lasst man, ich kümmere mich schon drum …«
Mein Spitzname »Kümmermonster« war ziemlich passend.
Ich blickte auf den verwüsteten Tisch, die bekleckerte Leinendecke und die Essensreste auf den Tellern. Mir kam die Galle hoch. Diese Unart, alles anzubeißen und dann nicht aufzuessen, ging mir entschieden gegen den Strich, aber was nutzte es, wenn ich es ansprach? Katharina hatte mich mal angepflaumt: »Die Kinder sollen zu essen aufhören, wenn sie satt sind, bei uns wird nicht gestopft, bis der Teller leer ist. Davon werden sie adipös, weil sie nicht lernen, auf ihren Körper zu hören.«
Als ob das bei uns je so gewesen wäre! Wir hatten mit den Kindern während der Mahlzeiten immer gemeinsam am Tisch gesessen, und zwar so lange, bis alle fertig gewesen waren. Und wenn man keinen großen Hunger hatte, lud man sich eben den Teller nicht so voll. Niemand hätte gewagt, am Tisch auf einem Handy zu daddeln. Okay, die gab es damals noch nicht, als die Kinder klein waren. Eigentlich hätte ich gern mit ihnen geschimpft, hätte gesagt, dass Tischmanieren nur dem schaden, der keine hat, aber … wozu? Sie machten ja doch, was sie wollten.
Katharina, ihr Mann Niko und die Jungs stiegen in ihren SUV.
»Nicht euer Ernst?«, rief ich. »Für den kurzen Weg nehmt ihr das Auto?«
»Mama, wir müssen noch zu Nikos Eltern! Das sind sechs Kilometer!«
Ich wollte eigentlich sagen, dass sie bei dem schönen Wetter auch mit dem Rad hätten fahren können und dass sie ihren Kindern damit keineswegs schaden würden. Aber ich wusste: Es hatte keinen Sinn.
Jette stieg in ihren schlüpferblauen Fiat und hupte, als sie vom Hof fuhr.
Ich winkte allen nach.
Ronny stand hinter mir. Als ich mich umdrehte, gab er mir einen Kuss auf den Scheitel. »Du bist ja am liebsten allein in der Küche, ich steh dir doch nur im Weg rum.« Er wartete keine Antwort ab. »Ich geh rudern, okay?«
Das war keine Frage, sondern eine Information. Er verschwand im Schlafzimmer, zog sein Sportzeug an, wenig später erklang das Geräusch des Rudergerätes aus dem Fitnesskeller.
Ilse fragte, ob sie sich auf unser Bett legen und auf ihrem iPad YouTube gucken durfte. Sie hatte ein eigenes, das Jette so eingestellt hatte, dass sie nur bestimmte Videos darauf anschauen konnte. Man musste es mit einem Code freischalten, den das Kind nicht kannte. Klar erlaubte ich es ihr.
Ich räumte den Tisch ab und die Spülmaschine ein, spülte die Gläser und das gute Besteck mit der Hand, steckte Stoffservietten und Tischdecken in die Waschmaschine und saugte den Boden.
Es war ein Muttertag wie etliche andere zuvor, aber heute zermürbte mich dieser Gedanke. Irgendwie war alles immer dasselbe. Das Jahr begann mit unseren Geburtstagen, es folgten die der Kinder, Enkel und Schwiegersöhne, wir feierten Ostern, dachten an Mutters Todestag, richteten Opa Günnis Geburtstag aus, dann kamen Muttertag, Urlaub, Weihnachten, Silvester.
Und danach begann alles wieder von vorn. Seit Jahrzehnten ging ich von montags bis freitags halbtags in die Sparkasse und bearbeitete Kreditanträge. Manchmal verspürte ich eine gewisse Macht, wenn mir eine Person auf der Straße begegnete, von der ich wusste, wie hoch sie verschuldet war. Aber solche Macht ist kein nachhaltiges Gefühl, sie bringt einen nicht weiter. Genau wie die öde Hausarbeit, die brachte mich auch nicht weiter. Immer dasselbe, Tag für Tag dieselben Handgriffe, nie wurde ich wirklich fertig. Wenn der Job getan, der Haushalt erledigt und der Garten in Schuss war, hütete ich meine Enkel, kochte für meinen Vater und gelegentlich für meine gestressten Töchter, ich half meinen Kindern, unseren Freunden, den Nachbarn, wann immer jemand Hilfe brauchte.
Nachdenklich schaute ich aus dem Fenster. Auch im Garten gab es jahrein, jahraus dieselben Abläufe. Mähen, jäten, harken, pflanzen, säen, ernten. Ronny war als Filialleiter den ganzen Tag in der Sparkasse in Bonn, der Garten gehörte zu meinen Aufgaben. Jedenfalls die leichteren Arbeiten. Wie oft beneidete ich Menschen, die in ihrer freien Zeit radeln oder wandern konnten. Unser Garten machte so viel Arbeit, dass wir selten Zeit hatten, um uns darin aufzuhalten und ihn nur zu genießen.
Ich ließ meinen Blick über den Rasen schweifen. Er war ziemlich trocken, es hatte schon wieder viel zu lange nicht geregnet. Ob er sich erholen würde? Da konnte Opa Günni noch so oft betonen, dass es früher auch schon heiße Sommer gegeben hatte, die letzten Sommer waren anders gewesen. Ich empfand die langen trockenen Phasen und Temperaturen um vierzig Grad als bedrohlich. Irgendwas lief auf diesem Planeten grundsätzlich falsch. Während ich mich an meinen vielen Gewohnheiten dem Alter entgegenhangelte, sorgte die Menschheit unermüdlich dafür, dass die Natur komplett verrücktspielte. Ich versuchte, in meinem Umfeld kleine Lösungen zu finden, und dabei waren meine Enkel mir eine große Hilfe. Matthäus und Cornelius hatten zum Beispiel in der Schule Filme mit Walen und Delfinen gesehen, die unter entsetzlichen Qualen im Plastikmüll verendet waren. Die Jungs zeigten sich schockiert und verstanden mich – lange bevor meine Töchter verstanden hatten, wie ernst die Lage war! Fortan bemühte ich mich, im Alltag Plastik zu vermeiden, dabei spielten in unserer Familie alle mit. Wir tranken Leitungswasser und versetzten es mit Kohlensäure, anstatt Plastikflaschen zu benutzen. Obst und Gemüse kauften wir unverpackt, bio und regional. Wir aßen nur selten Wurst, Fleisch oder Geflügel, ich benutzte das Fahrrad, wann immer es ging, auf unserem Dach glänzten Solarpaneele, wir versprühten kein Gift gegen Unkraut und Schädlinge. Und Ronny fuhr jetzt ein E-Auto.
»Was bringt das?«, hatte Opa Günni skeptisch gefragt.
Ronny hatte erklärt: »Abgesehen davon, dass ich es zu Hause mit eigenem Strom laden kann und keinen Sprit kaufen muss, sind wir nicht mehr Teil des Problems, sondern wenigstens ein kleiner Teil der Lösung.«
Obwohl ich sehr dankbar war, dass meine Familie sich um Umweltschutz und Klima sorgte, dachte ich oft, dass noch viel mehr möglich sein könnte. Mir ging das alles noch nicht weit genug, aber zu mehr Zugeständnissen ließen sich meine Leutchen nicht überreden. Natürlich konnte ich die Welt nicht retten – aber konnte man durch ein bisschen Engagement nicht alles besser machen, ohne wirklich auf etwas verzichten zu müssen? Ich wusste nicht, wovor ich mich mehr fürchten sollte, vor Pandemien, Querdenkern, rechtem Pöbel, Diktatoren oder dem Klimawandel. Manchmal wünschte ich mir, alles ausblenden zu können, keine Nachrichten mehr zu schauen, nur draußen zu sein, allein mit mir und meinen Gedanken.
Ich dachte an meine Kollegin Isa, mit der ich mir das Büro teilte. Sie wollte demnächst auswandern, nach Südspanien, weil es da billig und warm ist. Nie im Leben zöge ich in ein verdorrendes Land, außerdem vertrage ich Hitze nicht. Aber, und dieser Gedanke war auf einmal neu und ziemlich aufregend … wenn … nur mal so angenommen … wohin würde ich gehen, wenn ich wählen könnte?
Die Antwort war leicht: nach Neuseeland.
Seit ich wusste, dass es dieses Land gab, träumte ich davon, es zu bereisen. Aber da man Neuseeland nur per Flugzeug oder mit dem Schiff erreichen konnte und beides bei der enormen Entfernung eine der schlimmsten Umweltsünden war, die ein Mensch begehen konnte, würde es ein Traum bleiben müssen. Vom Preis einer solchen Reise mal abgesehen.
Nun war ich nie der depressive Typ. Ich habe es immer verstanden, dem Leben schöne Seiten abzugewinnen. Also riss ich mich zusammen, sagte mir, dass es uns gut ging, schließlich hatten wir drei gesunde Töchter, zwei nette Schwiegersöhne, fünf passable Enkelkinder, und mein Vater lebte auch noch. Ich hatte Freundinnen, Kollegen, Nachbarn. Und ich hatte Ronny, mit dem ich bald vierzig Jahre verheiratet sein würde.
Komisch, dass mir wieder dieser Satz einfiel: »Ich gehe Zähne putzen, soll ich deine gleich mitnehmen?« Was sagte er eigentlich über uns aus? Dass wir in einem Alter waren, in dem wir theoretisch vom Gebiss getrennt schlafen konnten. Dass wir uns sehr gut kannten und miteinander vertraut waren. Dass wir sozusagen tabulos miteinander umgingen. Das war doch nach all der Zeit ein schönes Fazit. Ich beschloss, zufrieden zu sein.
4
Zuerst hatte ich Ellen angerufen. Sie und ihr Mann Steffen standen ganz oben auf unserer Liste. »Wir wollen euch ganz bald wiedersehen! Und wir haben eine tolle Überraschung für euch.«
Ellen hatte dröhnend gelacht. »Du bist ja wohl nicht schwanger?«
Ich fand ihren Witz ziemlich daneben, ging aber oberflächlich darauf ein. »Nein, von nix kommt nix! Wann passt es euch?«
»Bei uns zu Hause im Moment ehrlich gesagt gar nicht. Wir wollen nämlich umziehen und sind am Packen, hier herrscht ein einziges Chaos. Aber wir können uns gerne im Brauhaus treffen, dann erzähle ich euch alles.«
»Ihr wollt umziehen?«, fragte ich überrascht.
Ellen und Steffen klammerten sich seit jeher an alles Vertraute. Nun wollten sie tatsächlich etwas verändern, und dann gleich so gravierend? Da war ich aber mal gespannt!
Wir verabredeten uns in einem Brauhaus in der Kölner Südstadt.
Ronny und ich setzten uns an einen Tisch in der Ecke. Der Köbes brachte uns zwei Kölsch. Plötzlich ging mein Handy. Ellen.
»Kommt ihr mal raus, ich brauche Hilfe.« Es war keine Frage, sondern ein Befehl.
Ronny und ich eilten vor die Tür – und ich erschrak zweimal. Einmal, weil Ellen in einem Rollstuhl saß, den sie mit der rechten Hand mit einer Art Joystick manövrieren konnte. Der linke Arm lag angewinkelt auf einer Schiene. Und dann erschrak ich, weil sie uns so selig anschaute, als säße sie nicht in einem Rollstuhl, sondern auf einem Thron.
Ich ging in die Hocke, legte fürsorglich die Hände auf ihr Knie und fragte bestürzt: »Liebelein, was ist denn bloß passiert?«