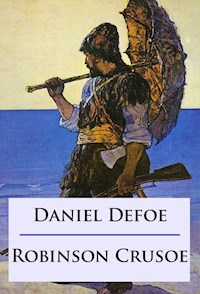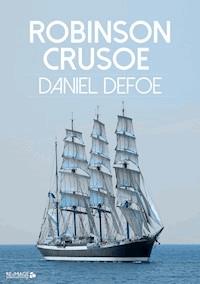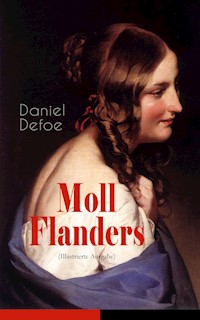Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Moll Flanders wächst als Waisenkind auf und wird mit ihrer klugen aber auch naiven Art zu einem beliebten Kind bei einigen wohlhabenden Familien. Als sie für das Waisenhaus zu alt wird, nimmt sie eine dieser Familien auf. Nach einigen Jahren verliebt sie sich in den ältesten Sohn der Familie, der jedoch seine Liebe zu ihr nicht öffentlich machen kann, weil es nicht angemessen für ihn wäre, ein Hausmädchen zu heiraten. Die Erkenntnis, dass sie wie eine Hure behandelt und benutzt wurde, ist für Moll ein harter Schlag. Der jüngere Bruder dagegen steht zu seiner Liebe zu Moll und heiratet sie schließlich, nachdem der ältere Bruder sie dazu überredet. Nach einigen Jahren stirbt Molls Ehemann plötzlich und sie ist alleine. Um finanziell abgesichert zu sein, ist es für Moll allerdings notwendig, wieder einen Mann zu finden. Sie heiratet einen Tuchhändler, der jedoch nach einiger Zeit bankrott geht und das Land verlassen muss. Er stellt es Moll frei, einen anderen Mann zu finden ... (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders
Daniel Defoe
Inhalt:
Daniel Defoe - Biografie und Bibliografie
Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Achtundzwanzigstes Kapitel.
Neunundzwanzigstes Kapitel.
Dreißigstes Kapitel.
Einunddreißigstes Kapitel.
Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders, D. Defoe
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849609207
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Daniel Defoe - Biografie und Bibliografie
Engl. Politiker und Schriftsteller, geb. 1660 oder 1661 in London, gest. daselbst 26. April 1731, war der Sohn eines Fleischers Foe und wie dieser ein eifriger Dissenter. Die geistliche Laufbahn, für die er bestimmt war, gab er auf und widmete sich in London dem Handelsstande, reiste in Geschäften nach Frankreich und Spanien, machte aber infolge politischer und literarischer Zerstreuungen Bankrott (um 1692). Seine Erfahrungen verwertete er zu einem »Essay on projects« (gedruckt erst 1698; deutsch von H. Fischer: »Soziale Fragen«, Leipz. 1890), worin er für ein nationales Bank- und Versicherungswesen, für Sparkassen, Irrenhäuser u. dgl. eintrat, in weitschauender Weise. Dann schrieb er für König Wilhelm, dem er sich gleich bei dessen Landung als Freiwilliger angeschlossen hatte, das satirische Gedicht »The trueborn Englishman« (1741) und wehrte die Angriffe gegen ihn als einen Fremden glänzend ab, indem er nachwies, daß die Engländer selbst ein Mischvolk seien und dieser Eigenschaft manchen Vorzug verdankten. Als nach Wilhelms Tode die Verfolgung der Dissenters sich erneute, stimmte er ironisch ein durch »The shortest way with the Dissenters« (1702): man solle sie austilgen, wieder König von Frankreich die Protestanten ausgetilgt habe. Er wurde zu Pranger und Gefängnis verurteilt, der öffentliche Schimpf gestaltete sich indessen zu einer Triumphszene. Im Gefängnis begann D. eine »Review« zu schreiben, die angeblich aus Beiträgen eines »Skandalklubs« bestand; ihr Erfolg veranlaßte alsbald die Gründung der moralischen Wochenschriften. Da er durch die Einsperrung das Geschäft verloren hatte, das ihn und seine zahlreiche Familie ernährte, war er fortan gezwungen, in seinen politischen Schriften zwischen seinem Gewissen und der Unterstützung des Ministeriums zu lavieren. Namentlich bei den Verhandlungen über die Union Englands und Schottlands diente er als Unterhändler mit Glück und Geschick.Unsterblich machte ihn »The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York« (1719; übersetzt von Altmüller, Hildburgh.1869; auch Stuttg. 1892). Das Werk, von Rousseau als erziehende Jugendschrift ersten Ranges gerühmt, verlegt seinen Schwerpunkt in die Entwickelung eines Charakters, der alles eigner Kraft verdankt. Obwohl es sich an die Geschichte von A. Selkirk auf der Insel Juan Fernandez anlehnt, hat es einen autobiographischen Kern: D., als geheimer Agent einer von ihm einst bekämpften Regierung, sah sich selber tief vereinsamt und in steter Gefahr. In alle europäischen und viele außereuropäische Sprachen wurde es übersetzt und häufig bis ins 19. Jahrh. nachgeahmt (s. Robinson Crusoe). Andre abenteuerliche oder unheimliche Geschichten von D., die teils vorher, teils nach dem ungeheuern Erfolg des »Robinson« entstanden, z. B. »Captain Singleton«, sind daneben fast vergessen. Eine Sammelausgabe seiner Schriften hatte er selber begonnen (1705). Doch druckte man nach seinem Tode lange nur einzelne Hauptwerke ab, so die »History of the union of Great Britain« (1709, mit Biographie von Chalmers 1786) und die »Novels« (mit Biographie von Walter Scott, Edinb. 1810, 12 Bde.). Vollständigkeit erstrebte erst W. Hazlitt (»Works«, mit Biographie, Lond. 1840–41, 3 Bde.); dann Bohn (»Standard library«, 1882, 7 Bde.). Den ersten Druck des handschriftlich überlieferten »Complete English gentleman« besorgte Buelbring (1890), in der Schrift »Of royal education« (1895). Biographien Defoes besitzen wir außerdem von W. Wilson (Lond. 1830, 3 Bde.), W. Chadwick (das. 1859), W. Lee (mit »Newly discovered writings of D.«, das. 1869, 3 Bde.), Minto (das. 1879) und Y. Wright (das. 1894).Vgl. ferner H. Morley, Defoe's earlier life and earlier works (Lond. 1889).
Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders
In atemloser Flucht reihen sich die ans Fabelhafte grenzenden Geschehnisse in der Geschichte dieses beispiellos bewegten Lebens aneinander. And neben der fiebernden Spannung, immer mehr zu erfahren aus dem Kaleidoskop weiblichen Glücksrittertums, ergreift den Betrachter ein Staunen, Staunen über die unerhörte Lebenskraft dieser Frau, mit der sie in Gleichmut und ungebrochener Frische durch die grausigsten, romantischsten, spaßhaftesten Verwickelungen ihres schier unwahrscheinlichen Lebens schreitet, und dabei noch Zeit findet zu Überlegungen von Wert und Tiefe ... Staunen aber auch über jenes Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten, das in den Abenteuern der berühmten Dirne und Diebin seinen Glanz und sein Elend so blitzartig erhellt.
Erstes Kapitel.
Mein wahrer Name ist in den Akten und Listen von Englands Zuchthaus, Newgate, so wohl bekannt, und so mancherlei dürfte dort noch seiner Erledigung harren, daß man nicht wohl erwarten kann, ich werde hier meinen richtigen Namen nennen und meine Familienverhältnisse ausführlich darlegen. Vielleicht, wer weiß, wird näheres einmal nach meinem Tode bekannt! Jetzt jedoch würde es zweifellos unangebracht sein, all ... all dieses selbst zu enthüllen; ja, auch dann noch würde es unangebracht sein, wenn gerade – setzen wir einmal den Fall – eine allgemeine Amnestie ohne Ausnahme der Person und Unterschied des Verbrechens erlassen worden wäre.
Es mag genügen, wenn ich Ihnen sage, daß ich unter meinen Genossen Moll Flanders hieß. Das waren nun freilich schlimme Genossen, die jetzt jedoch nichts mehr von mir verraten können, da sie diese Welt bereits wieder verlassen haben – und zwar über eine gewisse Leiter und durch eine gewisse Schlinge: ein Schicksal, von dem ich oft geglaubt, es werde einstmals auch meines sein. Gestatten Sie mir also, mich Moll Flanders zu nennen.
Man hat mir gesagt, daß in einem unserer Nachbarländer, ich weiß nicht, ob in Frankreich oder anderswo, der König ein Gesetz erlassen hat, nach dem die Kinder eines zum Galgen oder überhaupt zum Tode, oder auch nur zur Verbannung verurteilten Verbrechers, die durch die Missetaten ihrer Eltern schutzlos und unversorgt zurückbleiben, von der Regierung sofort in Obhut genommen und in ein Waisenhaus geschickt würden, in dem sie dann aufgezogen, gekleidet, beköstigt und unterrichtet werden, bis sie in Dienst gehen oder ein Gewerbe ergreifen können und fähig sind, sich mit Fleiß und in Ehrbarkeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Wäre dies auch in unserem Lande Gepflogenheit gewesen, so hätte ich mich nicht eines Tages als kleines, armes, hilfloses und verlassenes Mädchen sehen müssen – wie es das Schicksal mit mir wollte ... O dieses Schicksal, das mich nicht nur zu einer Zeit, da ich noch unfähig war, meine Lage zu verstehen oder gar zu bessern, hinein stieß in die größte, in die grausamste Not, nein, das mich auch auf jenen Lebensweg brachte, der – den Menschen ein Ärgernis – gewöhnlich schnell mit zerstörtem Leibe und zerstörter Seele endet.
In meinem Falle lagen die Dinge so: Meine Mutter war eines kleinen, ach, eines kaum nennenswerten Diebstahls überführt worden. Sie hatte einem Händler in Cheapside drei Stück seinen holländischen Leinens entwendet. Es würde zu lange währen, wollte ich die näheren Umstände wiederholen; mir selbst sind sie übrigens auf so verschiedene Art erzählt worden, daß ich kaum sagen kann, welche nun die richtige ist.
Jedenfalls, darüber sind sich alle Berichte einig, war meine Mutter damals gerade guter Hoffnung und die Vollstreckung des Urteils wurde denn auch auf ihren Antrag hin sieben Monate lang aufgeschoben, während deren sie in Newgate verbleiben mußte. Dann jedoch wurde sie wieder »vorgenommen«, wie der Ausdruck lautet, und alsbald zur Verbannung in die Kolonien geschickt. Sie ließ mich im Alter von einem halben Jahre allein zurück – und in schlechten Händen, das können Sie mir glauben.
Aus dieser Zeit, die ja allzunah am Anfang meines Lebens liegt, kann ich natürlich nur vom Hörensagen erzählen. Ich kann Ihnen auch weiter nichts sagen, als daß ich eben in Newgate, diesem unglückseligen Orte, geboren wurde, daß kein Pfarrer oder sonst jemand sich meiner annahm, um mich aufzuziehen, und daß ich nicht weiß, wie es kam, daß ich überhaupt leben blieb. Ich muß also wohl glauben, wie man mir auch erzählt hat, daß irgend eine Verwandte meiner Mutter mich aus Newgate wegholte; doch auf wessen Kosten und unter wessen Leitung ich dann aufgezogen wurde, das weiß ich nicht.
Die erste Wahrnehmung, die ich selbst zu machen imstande war und deren ich mich erinnere, ist die, daß ich mit einer Zigeunerbande umherzog; doch habe ich, wie mir scheint, nur eine kurze Zeit unter diesen Leuten zugebracht, denn man färbte meine Haut nicht, wie es sonst bei den Kindern, die sie mit sich herumführen, geschieht. Ich weiß aber nicht, wie ich zu ihnen, noch wie und warum ich wieder von ihnen weggekommen bin.
Auf jeden Fall geschah dieses Letztere zu Colchester in Essex; da ließen die Zigeuner mich dann zurück ... oder nein, es ist mir so, doch ganz dunkel und unbestimmt, als hätte ich sie verlassen, als hätte ich mich versteckt, weil ich nicht weiter mit ihnen ziehen wollte; doch ich weiß, wie gesagt, auch hiervon nichts genaueres mehr; nur dessen entsinne ich mich noch, daß ich einem Polizeibeamten zu Colchester erzählte, ich sei mit Zigeunern in die Stadt gekommen, solle aber nicht mit ihnen weiterziehen; sie hätten mich hier zurückgelassen; wohin sie gegangen, wisse ich nicht. Man stellte darauf im Lande herum Nachforschungen nach der Zigeunerbande an, doch wurde sie, wie es scheint, nicht gefunden.
Von jetzt ab war ich in gewissem Sinne gut aufgehoben; denn obwohl ich gesetzlich durchaus keinerlei Anspruch auf eine Unterstützung oder die Barmherzigkeit der Gemeinde Colchester hatte, nahm mich der Magistrat der Stadt, als er hörte, daß ich zu jung sei, um selbst irgend etwas für mich tun zu können – ich war ja kaum drei Jahre alt – aus Mitleid als ortsangehörig an und verfuhr mit mir, als sei ich in Colchester geboren.
Ein glücklicher Zufall wollte es, daß sie mich der »Kinderfrau« übergaben, so nannten sie nämlich eine alte Frau, die dort wohnte. Sie war früher in besseren Verhältnissen gewesen und verdiente sich jetzt ihren kargen Lebensunterhalt, indem sie solche Wesen, wie ich eins war, in Pflege nahm und sie mit dem nötigsten versah, bis sie alt genug waren, um in Dienst zu gehen oder sonst ihr Brot selbst zu verdienen. Diese Frau hielt zugleich eine kleine Schule, in der sie Kinder im Lesen und in allerlei Handarbeiten unterrichtete. Da sie, wie ich schon sagte, früher in besseren Verhältnissen gewesen war, erzog sie die Kinder wirklich mit viel Geschicklichkeit und Sorgfalt.
Mehr wert als all dieses war jedoch, daß sie mich Gottesfurcht lehrte und überhaupt in der Religion unterwies. Denn sie war selbst eine sehr fromme und rechtliche Frau. Außerdem trug sie sich sauber, hatte häuslichen Sinn und ein gutes und gewandtes Betragen, so daß wir Kinder, von unserer recht einfachen Nahrung, allzu engen Wohnung und mäßigen Kleidung abgesehen, so gut aufgezogen und erzogen wurden, als seien wir in einer feinen Schule.
Hier durfte ich bleiben, bis ich acht Jahre alt war. Dann aber erfuhr ich eines Tages mit Schrecken, daß der Magistrat nunmehr angeordnet habe, ich solle »in Dienst gehen«. Ich sagte mir zwar, daß man vorerst nicht sehr viel von mir werde verlangen können, daß ich vielleicht leichte Botengänge würde tun und so im allgemeinen das Packeselchen für ein Küchenmädchen würde abgeben müssen. Doch – ich weiß nicht – jedesmal wenn man mir nur davon sprach, wurde ich von einem ganz großen Furchtgefühl ergriffen. Ich hatte, obwohl ich noch so jung war, schon eine gründliche Abneigung davor, irgendwie »in Dienst« zu gehen, und sagte meiner Kinderfrau denn auch rund heraus, ich getraue mich, mir meinen Lebensunterhalt »auch so« zu verdienen, wenn sie es mir nur gestatten wolle. Denn sie hatte mich nähen gelehrt und Kammgarn spinnen, das den hauptsächlichsten Handel der Stadt ausmachte; und ich versprach ihr, wenn sie mich bei sich behielte, wollte ich für sie arbeiten, und zwar gern hart arbeiten.
So redete ich fast den ganzen Tag ... und brachte bald auch wirklich jeden Augenblick damit zu, indes mir die Tränen nur so die Backen herunterliefen, für sie zu arbeiten, für sie zu spinnen und zu nähen; so daß die gute Frau sich schon Kummer machte, denn sie liebte mich recht von Herzen.
Eines Tags kam sie in das Zimmer, in dem alle die anderen und gleich mir armen Kinder mit ihrer Arbeit beschäftigt waren. Sie setzte sich grade mir gegenüber, nicht an ihren gewöhnlichen Platz, den sie als Lehrerin inne hatte, sondern so, als wolle sie mich bei meiner Arbeit beobachten, beaufsichtigen. Ich hatte gerade eine vor, die sie mir neu aufgegeben hatte: ich zeichnete einige Hemden.
Nach einer Weile begann sie: »du dummes Kind,« sagte sie, »du weinst ja immer! (ich weinte wirklich wieder) nun bitte ich dich, weshalb weinst du?«
»Weil man ... mich hier wegnehmen will,« antwortete ich, »und in einen Dienst stecken ... und weil ich ... weil ich ... doch keine. Hausarbeit ... verstehe.«
»Nun Kind,« meinte sie, »wenn du auch jetzt noch keine Hausarbeit verstehst, so kannst du sie doch bald lernen, und sie werden dich anfangs nicht zu gar so schweren Arbeiten brauchen.«
»Das werden sie wohl,« rief ich, »und wenn ich es nicht ordentlich kann, dann werden die Dienstmädchen mich schlagen. Und ich bin doch noch so klein. Und ich kann doch auch noch nicht so schwer arbeiten.«
Und ich weinte wieder, und zwar so lange, bis ich nicht mehr sprechen konnte. Dies rührte dann die gute Kinderfrau so sehr, daß sie bei sich beschloß, mich vorläufig noch nicht in Dienst zu schicken. Sie sagte, ich möchte mit Weinen aufhören, sie wolle mit dem Herrn Bürgermeister sprechen, damit man mich erst in Dienst schicke, wenn ich größer geworden sei.
Ich beruhigte mich dabei jedoch nicht, denn die Aussicht, die sich mir nun einmal aufgetan: überhaupt in meinem Leben in Dienst gehen zu müssen, kam mir so schrecklich vor, daß ich auch geweint haben würde, wenn man mir versichert hätte, ich brauche erst mit zwanzig, mit dreißig Jahren eine Stellung anzunehmen.
Als meine Pflegerin schließlich sah, daß ich nicht zu beruhigen war, wurde sie ärgerlich:
»Was willst du noch mehr?« rief sie, »ich sage dir doch, daß du erst in Dienst zu gehen brauchst, wenn du größer bist.«
»Ach,« erwiderte ich, »einmal muß ich also doch gehen!«
»Du lieber Gott,« meinte sie darauf, »das Mädchen ist mir wohl verrückt! Du willst wohl eine Dame sein?«
»Ja,« rief ich, »das will ich!« und heulte wieder laut auf und weinte so lange und fassungslos, daß mich meine Schluchzer schließlich ordentlich hin und her stießen.
Die alte Frau aber mußte lachen, ob meiner Antwort – wie Sie sich denken können. »Nun, meine Gnädige,« sagte sie spöttisch, »du willst eine Dame sein, dann sag mir doch auch mal, wie du das anfangen willst? Glaubst du, daß du das mit deinen fünf Fingern fertig bringst?«
»Ja,« sagte ich unschuldig.
»So? Nun, dann sag mal, wie viel kannst du denn verdienen?«
»Drei Pence, wenn ich spinne ... und vier Pence, wenn ich Weißzeug nähe..«
»Ach, aber welch eine arme Dame'« lachte darauf meine Kinderfrau wieder; »damit willst du auskommen?«
»Ich werde schon damit auskommen – wenn ich nur bei dir bleiben darf.«
Dies letztere rief ich in solch kläglichem, bittendem Tone, daß es der alten Frau wirklich nahe ging, wie sie mir später einmal erzählte.
»Aber,« sagte sie, »das genügt doch nicht, um dich zu unterhalten und dir Kleider zu kaufen; und gar noch Kleider für eine kleine Dame ...«
Dabei lächelte sie mir freundlich zu.
»Dann will ich noch mehr arbeiten«, sagte ich, »und dir auch alles Geld geben.«
»Armes Kind,« sagte sie darauf, »es wäre dann immer noch nicht genug: das würde gerade für deinen Lebensunterhalt genügen.«
»Dann will ich keinen Lebensunterhalt haben,« sagte ich, »nur laß mich bei dir bleiben!«
»Aber wie willst du denn ohne Lebensunterhalt leben?« fragte sie hier wiederum.
»Ich will es versuchen,« antwortete ich. »Ich kann es sicher.«
Und wieder begann ich fürchterlich zu weinen.
Ich hatte keinerlei Nebenabsichten, als ich dies sagte. Es war nur meine Natur, die sich da äußerte ... doch mit soviel Unschuld und leidenschaftlichem Willen, daß das gute mütterliche Geschöpf wahrhaftig ebenfalls zu weinen begann und schließlich noch lauter schluchzte als ich selbst.
Dann aber nahm sie mich bei der Hand und führte mich aus dem Unterrichtszimmer hinaus.
»Komm,« sagte sie, »du brauchst nicht in Dienst zu gehen. Du sollst bei mir bleiben.« Und dies beruhigte mich dann auch – einstweilen.
Später ging die gute Frau, wie sie es mir versprochen hatte, zum Bürgermeister und erzählte ihm, wie ich mich angestellt hätte. Und meine Weigerung, in Dienst zu gehen, machte ihm soviel Vergnügen, daß er seine Gattin und seine beiden Töchter herbeiholen ließ, damit auch sie zuhören sollten. Und Sie können mir glauben, daß sich alle weidlich amüsierten.
Noch keine Woche war vergangen, als ganz unvermutet die Frau Bürgermeisterin und ihre beiden Töchter die alte Kinderfrau besuchten, um die Schule und die Kinder einmal in Augenschein zu nehmen.
Als sie sich alles angesehen hatten, sagte die Frau Bürgermeisterin plötzlich zu meiner Pflegerin: »Und wo ist das kleine Mädel, das absolut eine Dame werden will?«
Ich hörte es und erschrak fürchterlich, obgleich ich nicht wußte, warum. Doch die Frau Bürgermeisterin trat auf mich zu: »Nun, mein Fräulein,« fragte sie, »und was arbeiten Sie jetzt?«
Das Wort »Fräulein« hatte ich in unserer Schule noch nie gehört; und ich fragte mich, mit welch mißfälligem Namen sie mich da wohl genannt haben mochte. Ich stand jedoch auf, machte meinen Knix und reichte ihr meine Arbeit hin. Sie betrachtete dieselbe und meinte, sie sei ja recht schön. Dann nahm sie eine meiner Hände, drehte sie hin und her und sagte dabei: »Nun, sie kann wirklich eine Dame werden, denn ich sehe – sie hat eine richtige Damenhand.« Diese Worte gefielen mir außerordentlich, doch ließ sich die Frau Bürgermeisterin damit noch nicht genügen, sondern steckte ihre eigene Hand in die Tasche und zog sie mit einem Schilling für mich wieder heraus, ermahnte mich, recht fleißig zu sein und nur ja ein gutes und feines Arbeiten zu erlernen, dann könne ja immerhin noch eine Dame aus mir werden.
Meine gute alte Kinderfrau, die Frau Bürgermeisterin und die jungen Damen hatten mich freilich durchaus mißverstanden; denn mit dem Wort »Dame« meinten sie etwas ganz anderes als ich. »Eine Dame sein« bedeutete für mich blos, für sich selbst arbeiten dürfen und nicht in Dienst gehen müssen, während sie darunter ein üppiges, vornehmes Leben führen oder – was weiß ich – sonst noch alles verstanden.
Als die Frau Bürgermeisterin schon wieder weiter gegangen war, traten ihre beiden Töchter zu mir, um sich ebenfalls die kleine Dame anzusehen. Sie sprachen eine ganze Zeitlang mit mir und ich antwortete ihnen in meiner unschuldigen Weise; doch jedesmal, wenn sie mich fragten, ob ich denn wirklich fest entschlossen wäre, nur eine Dame zu werden, erwiderte ich prompt »ja«. Zum Schluß jedoch sagten sie, ich mochte ihnen aber auch erklären, was das sei, eine Dame. Diese Frage brachte mich in eine große Verlegenheit und nach einigem Nachdenken konnte ich es ihnen blos in seiner negativen Beziehung erklären – also: »eine Dame ist, wenn man nicht in Dienst zu gehen braucht, um Hausarbeit zu verrichten.« Diese Antwort schien ihnen viel Spaß zu machen, wie überhaupt mein ganzes kindliches Geplauder; denn sie waren sehr munter und schenkten mir zum Schluß ebenfalls Geld.
Dies Geld gab ich sofort meiner Pflegerin und sagte ihr, später, wenn ich erst eine Dame sei, solle sie alles haben, was ich verdiene. Solche und andere Redensarten ließen sie denn endlich erkennen, wie ich mir das Leben einer Dame vorstellte: daß ich mir nichts weiter darunter dachte – wie gesagt – als die Möglichkeit, mir meinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen; und zum Schluß fragte sie mich denn auch, ob ich es nicht so verstanden wissen wolle?
Ich antwortete ihr natürlich mit »ja!« und meinte: »da ist doch die X.« – hier nannte ich den Namen einer ganz gewöhnlichen Frau, die Spitzen ausbesserte und die Spitzenhauben der vornehmen Damen wusch und plättete – »sie ist doch auch eine Dame, und jeder nennt sie Madam.«
»Armes Kind,« sagte meine Pflegerin, »verhüte Gott, daß du jemals eine solche Dame wirst, das ist nicht schwer, denn sie ist eine übelberüchtigte Person und hat zwei uneheliche Kinder.«
Ich begriff natürlich nicht, was das heißen sollte; und antwortete nur: »Doch, gerade eine solche Dame möchte ich werden, denn sie geht in keinen Dienst und braucht keine Hausarbeit zu tun.«
All dies wurde natürlich der Frau Bürgermeisterin und ihren Töchtern wiedererzählt. Sie amüsierten sich darüber; und hin und wieder besuchten die Töchter meine Pflegerin, um sich nach der kleinen »Dame« zu erkundigen – was mich selbstverständlich nicht wenig stolz machte. Zuweilen brachten sie auch andere Töchter aus bekannten Familien mit, so daß man mich bald in der ganzen Stadt kannte.
Ich war nun ungefähr zehn Jahre alt geworden und sah wohl schon ein wenig aus wie ein junges Mädchen, denn ich war stets außerordentlich ernst, hatte ein sehr gesittetes Benehmen und konnte oft die Damen sagen hören, ich sei sehr hübsch und werde gewiß einmal schön werden. Und Sie können sich wohl vorstellen, wie stolz mich ein solches Urteil machte. Doch hatte dieser Stolz keine böse Wirkung auf mich, und nur die Folge, daß meine alte ehrliche Pflegerin das Geld, das die Damen mir schenkten und das ich ihr stets übergab, wieder für mich auslegte, indem sie mir Hüte und Wäsche und Handschuhe dafür kaufte; so daß ich immer zierlich und sauber einhergehen konnte; freilich – hätte ich auch in Lumpen gehen müssen, reinlich wären sie gewiß immer gewesen und wenn ich sie selbst in kaltem, klarem Wasser hätte waschen müssen; so jedoch kaufte mir die schlichte alte Frau stets allerlei Kleidungsstücke für das geschenkte Geld und verfehlte nie, den Damen zu sagen, dies oder jenes sei durch ihre Güte für mich angeschafft worden, so daß sie mir gern immer mehr gaben.
Als mich der Magistrat von Neuem aufforderte, mir einen Dienst zu suchen, war ich mittlerweile eine so geschickte Näherin geworden und die Damen waren weiter so gut zu mir, daß ich wieder daran vorbeikam; denn ich konnte nun selber so viel verdienen, daß meine Pflegerin meinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten vermochte; und sie fragte noch obendrein beim Magistrat an, ob er ihr nicht erlauben wolle, die »Dame« als Gehilfin bei sich zu behalten: die anderen Kinder lehren zu helfen, dazu wäre ich sehr wohl fähig, denn ich sei anstellig und flink bei der Arbeit – trotz meiner Jugend.
Als die Damen hörten, daß der Magistrat mich nicht mehr wie bisher unterstützen werde, gaben sie mir noch öfter Geld als vorher, und versahen mich dann auch mit Arbeit, brachten mir Weißzeug zum nähen, Spitzen zum ausbessern, Hüte zum garnieren und bezahlten mich nicht nur dafür, sondern lehrten mich sogar noch allerlei feine Arbeit, so daß ich also nun wirklich eine »Dame« war, oder vielmehr das, was ich mir darunter vorstellte, denn noch ehe ich zwölf Jahre alt war, schaffte ich mir nicht nur selbst meine Kleider an, und zahlte meiner Pflegerin meinen Lebensunterhalt mit eigenhändig Erworbenen, sondern sparte mir aus Verdientem obendrein noch ein kleines Taschengeld.
Oft schenkten mir die Damen auch Kleider von ihren Kindern, Strümpfe, Unterröcke, Hausröcke, die eine dies, die andere jenes; und mit all dem wirtschaftete meine Pflegerin für mich wie eine Mutter, ließ mich alles ausbessern, instand setzen, und instand halten und nach bestem Vermögen, anwenden, denn sie war eine selten gute Hausfrau.
Eine der Damen faßte zum Schluß eine solche Vorliebe für mich, daß sie mich für einen Monat, wie sie sagte, in ihr Haus aufnehmen wollte, damit ich ihren Töchtern Gesellschaft leiste.
Meine Pflegerin ging, wenn auch zögernd, auf den Vorschlag ein; und so begab ich mich denn für einige Zeit in das Haus der Dame. Dort gefiel es mir so gut bei den jungen Fräuleins, und diese gewannen mich bald so lieb, daß ich mich zum Schluß kaum von ihnen losreißen konnte, und auch sie sich nur sehr ungern von mir trennten.
Immerhin, ich kehrte am Ende in das Pflegehaus zurück und lebte noch fast ein Jahr bei der ehrlichen alten Frau, der ich nun schon eine tüchtige Stütze abgab. Ich war mittlerweile fast vierzehn Jahre alt geworden, groß für mein Alter und sah wirklich schon recht erwachsen aus. Doch hatte ich einen solchen Geschmack an dem angenehmen Leben in dem Hause der Dame gewonnen, daß ich mich in meinem bescheidenen Heim nicht mehr so behaglich fühlte, wie früher und dachte, es sei doch zu schön, eine richtige Dame zu sein. Denn ich hatte nun eine andere Auffassung von einer solchen, und weil ich also glaubte, es sei nichts schöner, als eine richtige Dame zu sein, wollte ich auch gern nur mit solchen umgehen.
Als ich dann vierzehn und ein viertel Jahr alt war, wurde meine Pflegerin, ich sollte sie eigentlich Mutter nennen, plötzlich krank und starb. Ich befand mich nun in einer traurigen Lage. Denn so schnell, wie sich eine arme Familie zerstreut, wenn man ihr Haupt erst einmal zu Grabe getragen, so schnell wurden die elternlosen Kinder auseinandergerissen. Die Schule war zu Ende, und die von den Kleinen, die bloß des Tages über gekommen waren, konnten nun zu Hause bleiben und warten, bis sie irgendwo anders hingeschickt wurden. Eine verheiratete Tochter der Verstorbenen, die in der Stadt wohnte, kam und nahm den kleinen Nachlaß derselben hinweg. Für mich hatte sie nichts weiter übrig, als den Scherz, die kleine Dame möge sich nun wirklich selbständig machen, wenn es ihr gefiele und möglich wäre.
Ich war darüber so erschrocken, daß ich alle Überlegung verlor und nicht wußte, was zu tun sei. Man hatte mich ja einfach vor die Tür gesetzt und in die weite Welt geschickt! Das schlimmste jedoch war, daß die alte ehrliche Frau bei ihrem Tode zweiundzwanzig Schilling in Verwahr hatte, die mir gehörten, mein ganzes Gut und Eigentum darstellten. Als ich die Summe von der Tochter zurückerbat, fuhr die mich ganz fürchterlich an und sagte, sie habe damit nichts zu schaffen.
Dabei hatte die gute Verstorbene noch vor ihrem Tode der Tochter ausdrücklich gesagt, das Geld, das an jenem bestimmten Platze liege, gehöre mir. Auch hatte sie mich ein oder zweimal rufen lassen, um es mir zu geben. Doch war ich in der Stunde, da sie starb, unglücklicherweise gerade nicht im Hause, und als ich zurückkam, konnte sie schon nicht mehr sprechen.
Später gab mir übrigens die Tochter das Geld doch zurück, aber erst, nachdem sie mich so grausam geängstigt hatte.
Zweites Kapitel.
Nun stand ich also da und war in der Tat eine arme, selbständige Dame und wurde noch am selben Abend in die weite Welt geschickt. Ich wußte kein Plätzchen, wohin ich gehen konnte und hatte kein Stückchen Brot zu essen. Wenn ich mich recht erinnere, machte schließlich eine mitleidige Nachbarin die Dame, bei der ich den einen Monat gewohnt hatte, auf meine Lage aufmerksam, auf jeden Fall schickte die letztere am Abend ihr Dienstmädchen, um mich zu holen. Ich ging natürlich sofort mit, und freudigen Herzens, das können Sie mir glauben. Ich war noch so erschrocken und voll Angst, daß mir nichts mehr daran lag, eine Dame zu sein, und ich gern damit einverstanden gewesen wäre, als geringe Bedienstete einzutreten, und zwar für jede Arbeit, die sich mir bieten würde.
Doch hatte meine neue Herrin es besser mit mir vor.
Ich war übrigens kaum bei ihr, als die Frau Bürgermeisterin ebenfalls nach mir schickte, um sich nach mir zu erkundigen. Und noch eine Familie, die sich schon früher sehr um mich bekümmert hatte, ließ nach mir fragen. Die Bürgermeisterin war sogar nicht wenig böse, daß die Andere mich schon vorher zu sich gerufen hatte. Denn wie sie sagte, gehörte ich von rechts wegen ihr, da sie ja doch die erste gewesen, die für mich gesorgt. Die Familie, die mich zuerst aufgenommen, wollte mich jedoch nicht wieder gehen lassen und ich – nun, ich muß sagen, ich war nirgendwo besser aufgehoben, als da, wo ich nun einmal war.
Ich blieb hier, bis ich zwischen siebzehn und achtzehn Jahr alt war, und genoß die beste Erziehung, die man sich denken konnte. Die Dame hielt für ihre Töchter Hauslehrer, die sie tanzen, französisch sprechen und schreiben, und andere, die sie Musik lehrten. Und da ich immer mit ihnen zusammen war, lernte ich so schnell wie sie, obschon die Lehrer nicht ausdrücklich angewiesen waren, mich auch mit zu unterrichten. Aber ich lernte eben durch Obacht und Fragen alles, was ihnen durch Belehrung beigebracht wurde, so daß ich in kurzer Zeit so gut wie nur eine von ihnen tanzen und französisch sprechen und viel besser singen konnte, denn ich hatte eine schönere Stimme. Zwar konnte ich nicht so fertig Spinett oder Klavier spielen, da ich kein eignes Instrument zum üben hatte, und das ihrige nur dann benutzen durfte, wenn sie keine Luft zum spielen hatten. Doch lernte ich ziemlich gut, und zum Schluß besaßen die jungen Damen ja zwei Instrumente, ein Spinett und ein Klavier, und unterrichteten mich auch selbst. Beim Tanzen konnten sie mich so wie so nicht entbehren, da sie mich nötig hatten, um eine gerade Zahl auszumachen. Und überhaupt lehrten sie mich ebenso gern alles was sie selbst lernten, wie ich willig war, mir Kenntnisse und Fertigkeiten von ihnen und mit ihnen anzueignen.
Auf diese Weise wurde ich also, wie ich schon bemerkt habe, so wohl erzogen, als wäre ich wirklich ein Fräulein, wie die, bei denen ich lebte. In manchen Dingen war ich sogar im Vorteil gegen sie, denn ich war von der Natur mit Gaben ausgestattet, die sie sich mit all ihrem Vermögen nicht kaufen konnten. Erstens war ich hübscher als sie. Zweitens hatte ich eine bessere Gestalt und drittens sang ich besser, das heißt, ich hatte meine schönere Stimme. Übrigens behaupte ich dies alles nicht, weil es meine eigene Überzeugung, sondern die Meinung aller war, die in der Familie verkehrten.
Zu diesen Eigenschaften kam aber noch die übliche Eitelkeit meines Geschlechtes. Ich wußte nämlich sehr gut, daß man mich für hübsch, oder wenn man will, sogar für eine große Schönheit hielt, und hatte infolgedessen eine so gute Meinung von mir, wie nur irgend sonst jemand. Es machte mir ein großes Vergnügen, jemanden von meinen Vorzügen reden zu hören, was sehr oft vorkam und mir jedesmal eine große Genugtuung gewährte.
Bis hierher habe ich eine ganz glatte Geschichte von mir erzählen können. Ich durfte sagen, daß ich nicht nur stets in sehr guter und geachteter Umgebung gelebt, sondern daß ich auch selbst mich des Rufes eines bescheidenen, ehrlichen und tugendhaften Mädchens erfreute. Ich hatte nicht einmal Gelegenheit zu bösen Gedanken gehabt und wußte nicht, was eine Versuchung zum Schlechten bedeutete.
Aber mein Äußeres, auf das ich zu eitel war, wurde mein Verderben, oder vielmehr meine Eitelkeit, die war die Ursache zu meinen Verderben.
Die Dame, in deren Haus ich lebte, hatte nämlich zwei Söhne, junge Herren von außerordentlichen Gaben und feinem Benehmen. Zu meinem Unglück sollte ich mit beiden etwas bekommen, sie jedoch betrugen sich ganz verschieden gegen mich.
Der ältere, ein sehr munterer Herr, kannte die Stadt so gründlich wie die ländliche Umgebung; und obwohl er leichtsinnig genug war, allerlei übles zu tun, behielt er doch immer soviel Besinnung, um seine Genüsse nie zu teuer zu bezahlen. Er begann damit, die für alle Frauen gefährlichste Schlinge nach mir auszuwerfen; ich meine, er begann damit, mir bei jeder Gelegenheit zu sagen, wie hübsch ich sei, welch gute Haltung ich habe, wie angenehm ihn mein Wesen berühre und dergleichen mehr. Und dies alles wußte er so geschickt vorzubringen, als habe er soviel Übung, Frauen in seinem Netz zu fangen, wie Rebhühner in seinen Schlingen, denn er sagte dies alles zu seinen Schwestern, wenn ich nicht gerade dabei, doch nahe genug war, um jedes Wort hören zu können. Seine Schwestern antworteten ihm dann wohl leise: »Still, Bruder, sie hört dich, sie ist ja im Nebenzimmer.« Dann hielt er inne, sprach leise weiter, als hätte er es nicht gewußt, tat darauf, als vergäße er sich plötzlich und sprach wieder laut. Und ich, die ich seine Reden ja gern hörte, belauschte sie natürlich bei jeder Gelegenheit. Nachdem er so seinen Köder ausgeworfen, und ihn leicht und sicher genug in meinen Bereich gespielt hatte, fing er an, offen vorzugehen.
Eines Tages kam er mit munterem Gesicht zu seiner Schwester ins Zimmer, in dem auch ich mich befand: »Oh, Fräulein Betty,« rief er wie überrascht aus, – Betty wurde ich nämlich damals genannt – »wie geht es ihnen, Fräulein Betty? Klingen ihnen ihre Ohren nicht?« Ich machte eine Verbeugung und errötete, doch sagte ich nichts.
»Was redest du so, Bruder?« warf seine Schwester ein.
»Nun, wir haben eben eine halbe Stunde von ihr gesprochen, nur von ihr.«
»Na,« meinte die Schwester, »da ihr doch nichts übles von ihr sagen konntet, dürfte es ihr ganz gleich sein, was ihr über sie redet.«
»Aber,« rief er, »wir haben auch gar nichts übles, sondern sehr viel gutes und angenehmes von ihr gesagt. Oder ist es nicht etwas gutes und angenehmes, wenn behauptet wird, daß sie das schönste junge Mädchen in ganz Colchester ist und daß man, kurz gesagt, bereits anfängt, in der Stadt auf ihre Gesundheit zu trinken?«
»Ich muß mich sehr über dich wundern, Bruder,« erwiderte die Schwester. »Unserer Betty fehlt allerdings, das gebe ich zu, bloß eines, aber da sie dies nicht hat, könnte ihr ebensogut alles fehlen. Denn es ist jetzt eine sehr schlimme und ungünstige Zeit für uns Mädchen und wenn eines von uns selbst aus gutem Hause ist, auch Schönheit, Erziehung, Klugheit, zierliches Betragen und Bescheidenheit im Übermaß besitzt, so nützt ihr das alles nichts, wenn sie kein Geld hat. Sie zählt einfach nicht und könnte alle anderen Eigenschaften ruhig entbehren. Nur das Geld empfiehlt heutzutage ein Mädchen von Bettys Alter, und die Männer denken in diesem Punkte wohl alle gleich.«
Aber da fiel ihr ihr jüngerer Bruder, der auch zugegen war, in die Rede: »Halt, Schwester, nicht zu hastig!« rief er, »ich bin eine Ausnahme von deiner Regel. Ich versichere dich, wenn ich ein so wohl ausgestattetes Mädchen fände, wie du es eben beschrieben hast, so würde ich mich um das Geld nicht kümmern.«
»Oh,« sagte die Schwester, »du würdest dich aber schon hüten, ein solches Mädchen ohne Geld zu finden.«
»Das kannst du durchaus nicht wissen,« antwortete der Bruder.
»Aber weshalb,« sagte jetzt der ältere, »legst du soviel Gewicht auf das Vermögen? Was dir auch sonst fehlen mag, über diesen Mangel hast du dich doch sonst nicht zu beklagen.«
»Ich verstehe dich sehr wohl, Bruder,« antwortete die junge Dame scharf. »Du willst sagen, Geld hätte ich, aber keine Schönheit. Doch wie die Zeiten nun einmal sind, genügt dieses vollständig und ich bin immerhin noch besser dran als manche andere.«
»Nun,« sagte der jüngere Bruder, »es kann aber doch vorkommen, daß manche andere nicht hinter dir zurückzustehen braucht, denn Schönheit stiehlt sich zuweilen einen Gatten trotz des Geldes. Und wenn das Zöfchen vielleicht zufällig hübscher ist als die Herrin, steht sie auf dem Heiratsmarkt oft ebenso hoch und fährt lange, lange vor ihr in der Hochzeitskutsche.«
Ich hielt es nun an der Zeit, mich zurückzuziehen. Doch begab ich mich nur soweit weg, daß ich auch ihre weiteren Reden noch verstehen konnte, in denen ich noch viele schöne Dinge über mich hörte, die meiner Eitelkeit schmeichelten, aber, wie ich bald einsehen mußte, nicht danach angetan waren, mich in der Familie beliebter zu machen. Denn die Schwester und der jüngere Bruder gerieten meinet halben ernsthaft aneinander, und da er ihr zu meinen Gunsten einige sehr wenig verbindliche Dinge gesagt hatte, mußte ich bald fühlen, wie sie sich dafür durch ihr künftiges und doch gewiß sehr ungerechtes Benehmen mir gegenüber zu rächen suchte. Ich hatte die Gedanken, die sie bei mir in Bezug auf ihren jüngeren Bruder argwöhnte, nie gehabt. Nur der ältere hatte, wie ich schon erzählte, im Scherz eine Menge Dinge gesagt, die ich, töricht genug, für Ernst gehalten; so daß ich mich denn mit Hoffnungen geschmeichelt, von denen ich mir hätte sagen müssen, daß er nie daran denken könne, sie zu verwirklichen.
Eines Tages kam er wieder die Treppen heraus und in das Zimmer gelaufen, in dem seine Schwester meist ihre Handarbeiten machte. Er hatte es schon öfter getan und rief auch diesmal, wie gewöhnlich, vor der Türe ihren Namen. Da ich mich allein in dem Raume befand, ging ich auf die Türe zu und rief: »Sie, die Damen, sind nicht hier, sie sind hinunter in den Garten gegangen.«
Doch im selben Augenblick schoß er auch schon herein und umarmte mich, als wäre es zufällig geschehen.
»Oh, Fräulein Betty,« sagte er, »sie sind hier, das ist ja viel besser. Ich habe mehr mit ihnen zu sprechen als mit den Schwestern;« und da er mich einmal in seinem Arm hatte, küßte er mich drei oder viermal.
Ich wand mich, um von ihm loszukommen, jedoch wohl nur schwach, denn er hielt mich fest und küßte mich immer wieder, bis er ganz außer Atem war, dann setzte er sich auf einen Stuhl und sagte: »Liebe Betty,« sagte er, »ich bin in dich verliebt.«
Ich muß gestehen, diese Worte brachten mein Blut auf. Es kam mir vor, als ströme jeder Tropfen zu meinem Herzen, und ich geriet in eine große Verwirrung. Er wiederholte nun noch mehrere Male, daß er in mich verliebt sei; und mein Herz sprach deutlich wie eine Stimme, daß ich es gern hörte; ja, jedesmal, wenn er es wieder sagte, antwortete mein Erröten allzudeutlich: »ich wollte, es wäre so!« Doch ereignete sich da noch nichts; ich war nur überrascht worden und fand bald meine Sinne wieder. Er wäre wohl gerne länger bei mir geblieben, doch sah er, als er zufällig aus dem Fenster blickte, seine Schwestern aus dem Garten heraufkommen. So nahm er schnell Abschied, küßte mich noch einmal, sagte, daß er es ernst mit mir meine, daß ich bald mehr von ihm hören solle und – weg war er; offenbar ganz außerordentlich mit sich zufrieden und der Wendung der Dinge. Ich hätte es auch sein können, wenn nicht, ja, wenn nicht leider die Verhältnisse so gelegen wären, daß Fräulein Betty diese Wendung ernst nahm und der junge Herr durchaus nicht.
Von nun an gingen mir allerlei sonderbare Gedanken durch den Kopf, und ich kann wohl sagen, ich war gar nicht mehr ich selbst, war nicht mehr die alte Betty, bei der Vorstellung, daß solch ein Herr gesagt hatte, er sei in mich verliebt und ich sei ein über die Maßen entzückendes Geschöpf. Ich wußte oft nicht, wie ich mit all dem fertig werden sollte, und meine Eitelkeit wuchs. In meinem Kopf waren jetzt nur hochmütige und stolze Gedanken, das ist wahr, aber da ich die Verderbtheiten der Zeit nicht kannte, hatte ich keine Ahnung davon, daß auch meine Tugend hier in Frage kommen könne: und wäre mir der junge Herr gleich beim erstenmale mit seinem Antrage gekommen, so hätte er sich gewiß jede Freiheit, die ihm beliebte, bei mir herausnehmen können. Doch nahm er seinen Vorteil damals noch nicht wahr: zum Glück für mich, für dies eine Mal.
Nicht lange danach fand er wieder eine Gelegenheit, mich zu überraschen, und zwar fast unter den gleichen Umständen, das heißt, von seiner Seite lag wieder Absicht vor, von meiner nicht die geringste. Die jungen Damen waren mit ihrer Mutter ausgegangen, um einen Besuch zu machen, der jüngere Bruder war überhaupt nicht in der Stadt, und der Vater befand sich ebenfalls schon seit acht Tagen außerhalb, in London. Der junge Herr hatte mich so genau beobachtet, daß er wußte, wo ich war, obwohl ich nicht ahnte, daß er sich überhaupt im Hause befand. Er eilte auch diesmal schnell die Treppen herauf, sah mich bei der Arbeit sitzen, trat ins Zimmer und tat wieder, was er das vorige Mal getan; das heißt er nahm mich in den Arm und küßte mich wohl eine Viertelstunde lang.
Ich befand mich im Zimmer seiner jüngeren Schwester, und da außer der Magd unten niemand im Hause war, benahm er sich vielleicht ein wenig stürmischer als das erste Mal. Vielleicht fand er auch, daß ich ihm ein wenig sehr willfährig sei, denn ich leistete nicht den geringsten Widerstand, als er mich in seine Arme nahm und küßte; ich war nämlich viel zu erfreut darüber, um mich erst lange zu wehren; das muß ich gestehen.
Nun, als er das Küssen müde geworden, ließen wir uns nieder und er sprach eine lange Zeit auf mich ein; er sagte, daß ich ihm so sehr gefalle und daß er keine Ruh noch Rast habe, bis er mir nochmals gesagt, wie sehr er in mich verliebt sei und wenn ich ihn wieder lieben könne und glücklich machen wolle, so würde ich das Heil seines Lebens sein und viel ähnliche schöne Worte. Ich antwortete ihm nur sehr wenig und entdeckte bald, daß ich gar nicht verstand, was er meinte.
Dann ging er im Zimmer auf und ab, nahm mich bei der Hand und ich schritt mit ihm hin und her. Mittlerweile schien er bemerkt zu haben, in welchem Vorteil er sich befand, denn er warf mich auf das Bett und küßte mich von neuem und sehr heftig; doch muß ich ihm die Gerechtigkeit widerfahren lassen und sagen, daß er in keiner Weise gewalttätig mit mir verfuhr, sondern mich nur immer und immer wieder küßte; dann sagte er jedoch, er höre jemanden die Treppe herauf kommen, stand von dem Bette auf, half auch mir aufstehen, drückte mir noch einmal seine große Liebe aus, wiederholte daß seine Zuneigung zu mir eine ganz ehrliche sei und daß er nur das beste mit mir im Sinne habe ... und mit diesen Worten steckte er mir fünf Guineen in die Hand und eilte die Treppe hinunter.
Der Anblick des Geldes setzte mich in größere Verlegenheit und Verwirrung, als es die Liebe getan; ja, ich war so aufgeregt, daß ich kaum den Boden unter meinen Füßen fühlte.
Alle diese Einzelheiten erzähle ich hier so genau, damit, wenn irgend ein junges unschuldiges Blut diese Geschichte lesen sollte, es sich beizeiten sagt, wie viel Übles daraus entstehen kann, wenn man zu früh von seinen Reizen eine Kenntnis erhält; weiß ein junges Mädchen erst einmal, daß sie schön ist, dann wird sie nie mißtrauen, wenn ein junger Mann ihr sagt, er liebe sie; denn da sie sich ja für reizvoll genug hält, um ihn überhaupt fesseln zu können, ist es nur ganz natürlich, daß sie glaubt, sie fessele tatsächlich gerade ihn.
Mein junger Mann hatte also sein Begehren nach mir ebenso angefeuert wie meine Eitelkeit; und ob er nun finden mochte, daß er eigentlich eine gute Gelegenheit unbenützt hatte vorübergehen lassen und sich darüber jetzt ärgerte – jedenfalls kam er nach einer halben Stunde wieder herauf und verfuhr wieder mit mir wie vorhin, nur machte er jetzt noch weniger einleitende Umstände.
Als er das Zimmer betreten, wandte er sich zuerst wieder um und schloß die Türe.
»Fräulein Betty,« sagte er dann, »ich glaubte eben, es käme jemand die Treppe herauf, doch war es nicht der Fall. Und wenn sie mich auch hier im Zimmer bei ihnen finden sollten, so will ich darum doch um keinen Kuß zu kurz kommen.«
Ich sagte darauf, ich wisse nicht, wer überhaupt herauskommen könne, denn ich glaube, es sei niemand sonst im Hause als der Koch und das Küchenmädchen, die niemals nach oben kämen.
»Desto besser, meine Liebste,« sagte er, »es ist immer gut, sicher zu gehen,« und er setzte sich nieder und begann wieder zu reden; und obwohl ich von eben her noch brannte und glühte und kaum antworten konnte, sprach er doch so unablässig auf mich ein, beschrieb mir, wie leidenschaftlich er mich liebe und sagte, daß er, obwohl er noch nicht im Besitze seines Vermögens sei, ganz fest entschlossen wäre, mich und sich glücklich zu machen, das heißt mich zu heiraten. In der Weise redete er noch eine Menge Dinge, ohne daß ich arme Närrin seine Absicht verstand; ich verblieb fest in dem Glauben, es gäbe überhaupt keine andere Liebe, als die mit einer gesetzmäßigen Ehe endigte. Und als er erst soviel gesagt, hatte ich weder die Neigung noch die Kraft, ihm mit einem Nein zu antworten; doch kamen wir auch jetzt noch nicht bis zum letzten Ende.
Zwar saßen wir noch nicht lange, als er aufstand, mir mit Küssen fast den Atem raubte und mich wieder auf das Bett warf; diesmal ging er auch weiter mit mir, als mir der Anstand zu erzählen erlaubt; ich hätte jedoch nicht die Kraft gehabt, ihn zurückzuweisen, selbst wenn er noch viel weiter mit mir gegangen wäre.
Immerhin, trotzdem er sich all solche Freiheiten mit mir herausnahm, kam es auch diesmal nicht, wie gesagt, zu dem letzten Ende, nicht zu dem, was man die letzte Gunstbezeugung nennt; er versuchte nicht einmal, sie zu erlangen, was ich der Gerechtigkeit halber wieder erwähnen muß; und diese Selbstüberwindung gebrauchte er später als Entschuldigung für all seine Freiheiten bei andern Anlässen. Er blieb diesmal auch nicht sehr lange, steckte mir plötzlich fast eine ganze Hand voll Gold zu und verließ mich mit tausend Beteuerungen seiner Leidenschaft und der oft wiederholten Versicherung, daß er von allen Frauen der Welt nur mich lieben könne.
Es wird niemanden verwundern, daß ich nun nach und nach ein wenig nachzudenken begann, doch tat ich es leider mit nicht viel Vernunft. Ich verfügte über ein fast unbegrenztes Maß an Eitelkeit und Stolz und über einen nur zu geringen Vorrat an Tugend. Ich erwog zwar zuweilen die Absicht, die der junge Herr mit mir hatte, doch dachte ich im allgemeinen nur an seine schönen Worte und an das Gold. Ich dehnte meine Betrachtungen nicht so weit aus, mir jemals klar zu machen, ob er mich wirklich heiraten könne oder nicht. Und ich tat nichts, um ihn an mich zu fesseln oder anzulocken, bis er mir selbst mit klaren, förmlichen Anträgen kam, wie Sie gleich hören sollen.
So stürzte ich mich gedankenlos in meinen Untergang und bin eine deutliche Warnung für alle jungen Frauen und Mädchen, deren Eitelkeit größer ist als ihre Tugend. Und dabei handelten wir alle beide noch höchst unklug und unvorteilhaft. Denn hätte ich mich betragen, wie ich sollte, und ihm, wie Tugend und Ehre es verlangten, widerstanden, so hätte er entweder von seinen Angriffen abgelassen, da er nicht hoffen durfte, sein Ziel zu erreichen, oder er hätte mir anständig und ehrlich einen Heiratsantrag gemacht. Und wer ihn dann auch immer tadelnswert finden mochte, mich konnte kein Vorwurf treffen. Hätte er mich jedoch gekannt und gewußt, wie leicht er die Kleinigkeit, nach der ihn verlangte, bei mir erreichen konnte, dann wäre weiteres Kopfzerbrechen für ihn ganz unnötig gewesen; er hätte mir bloß vier oder fünf Guineen gegeben und bei der ersten besten Gelegenheit bei mir geschlafen. Und anderseits würde ich, wenn mir seine Gedanken bekannt gewesen wären und seine Meinung, ich sei wunder wie schwer zu erringen, schon meine Bedingungen gestellt und wenn auch nicht auf sofortige Heirat, so doch auf standesgemäßen Unterhalt bis zu unserer dereinstigen Verheiratung gedrungen haben. Und höchst wahrscheinlich hätte ich meinen Willen auch durchgesetzt, denn er war ja, auch ganz abgesehen von dem, was er noch zu erwarten hatte, außerordentlich reich. Doch kam ein derartiger regelrechter Plan, wie ich mit ihm zu verfahren hätte, bei mir nicht auf; ich war vollständig eingenommen von meiner Eitelkeit und dem Stolz, von einem so großen Herren geliebt zu werden; dazu kam das Gold – ganze Stunden brachte ich damit zu, es zu betrachten, ich zählte die Guineen wohl tausendmal am Tage. Niemals war eine arme, kleine, eitele Kreatur verblendeter, als ich in jener Zeit, da ich auch nicht im entferntesten dachte, wie nahe mein Untergang vor der Türe stand; ja ich glaube, ich wünschte ihn innerlich sogar eher herbei, als daß ich versucht hätte, ihm zu entgehen.
Ich war jedoch schlau genug, niemandem in der Familie den geringsten Anlaß zu der Vermutung zu geben, ich unterhalte irgend welche Beziehungen zu dem ältesten Sohne. Ich sah ihn in Gegenwart anderer kaum an, antwortete kaum, wenn er mich gelegentlich anredete. Trotzdem trafen wir immer hin und wieder einmal zusammen und fanden Zeit zu ein paar Worten oder einem Kuß, doch niemals Gelegenheit zu dem Unheilvollem, das er im Sinne hatte, denn er hielt ja eine Menge Umschreibungen und Vorbereitungen für nötig, und hielt das Werk für so schwer, daß er es sich wirklich schwierig machte.
Da der Teufel jedoch nicht so leicht zu entmutigen ist, findet er stets Mittel und Wege, um die Niedertracht, die er vorhat, auszuführen.
Als ich mich eines Abends mit den beiden jüngeren Schwestern und ihm im Garten erging, fand er die Möglichkeit, ein Zettelchen in meine Hand schlüpfen zu lassen, in dem er mir mitteilte, daß er mich morgen im Beisein der Familie bitten werde, eine Besorgung für ihn zu machen, und daß er mich dann unterwegs irgendwo treffen wolle.
So sagte er denn auch am folgenden Tage nach dem Mittagessen in Gegenwart all seiner Schwestern ernsthaft zu mir: »Ich wollte sie um eine Liebenswürdigkeit bitten, Fräulein Betty.«
»Was soll das heißen?« fragte die zweite Schwester.
»Nun, Schwester,« erwiderte er ihr sehr ruhig und höflich, »wenn du Fräulein Betty heute nicht entbehren kannst, so kann sie mir den Gefallen auch ein anderes Mal tun.«
»Doch, doch,« riefen nun die Schwestern alle: sie könnten mich heute sehr gut entbehren; und die zweite bat sogar um Verzeihung für ihre unfreundliche Frage.
»Aber du mußt dem Fräulein Betty nun auch sagen, um was es sich handelt,« meinte schließlich die älteste, »wenn es eine Privatangelegenheit ist, so geh mit ihr hinaus ...«
»Wie meinst du das, Schwester?« fragte der junge Herr nun sehr würdevoll. »Ich wollte sie nur bitten, für mich in die Highstreet und dort in einen Laden zu gehen.« Und darauf erzählte er ihnen eine lange Geschichte von zwei prächtigen Halstüchern, auf die er schon geboten hätte: ich solle gehen und sein Angebot wiederholen, und wenn man auf dasselbe noch immer nicht eingehen wolle, noch einen oder zwei Schilling mehr bieten, jedenfalls aber tüchtig feilschen. Und dann trug er mir noch eine ganze Menge anderer Besorgungen auf, so daß ich längere Zeit zu ihrer Erledigung brauchen mußte.
Als er mir diese Aufträge gegeben, schwindelte er seinen Schwestern noch in einer langen Erzählung von einem Besuch vor, den er bei einer ihnen allen wohlbekannten Familie machen wolle. Er werde dort noch einen andren Herrn ihrer Bekanntschaft treffen und bitte sie höflichst, sich ihm doch anzuschließen. Die Schwestern entschuldigten sich aber ebenso höflich, da sich bei ihnen für den Nachmittag selbst Besuch angesagt habe, was der Gentleman, der alles zu seinem Zweck aufs schlaueste eingerichtet hatte, natürlich längst ganz genau wußte.
Er hatte kaum zu reden aufgehört, als sein Diener ins Zimmer trat und ihm mitteilte, daß der Wagen des Herrn W– vor der Türe stehe. Er lief schnell hinunter und kam bald mit den Worten wieder zurück: »Ach, dieser Nachmittag wäre mir wieder verdorben; Herr W– hat mir seinen Wagen geschickt und läßt mich bitten, ich möchte umgehend zu ihm kommen, da er mit mir zu reden habe.« Ich glaube, dieser Herr W– war ein Edelmann, der auf seinen drei Meilen entfernten Besitzungen lebte und den mein Liebhaber gebeten hatte, ihm für eine besondere Gelegenheit seinen Jucker zu leihen, der ihn, wie es jetzt auch geschehen war, gegen drei Uhr nachmittags abholen sollte.
Er ließ sich nun gleich seine beste Perrücke, seinen Hut und Degen bringen, schickte seinen Diener mit einer Entschuldigung zu der Familie, die ihn für heute eingeladen haben sollte, und machte sich bereit, das Wägelchen zu besteigen. Im Vorübergehen blieb er noch einen Augenblick bei mir stehen, redete sehr ernsthaft von den Besorgungen zu mir, und sagte zum Schluß ganz leise: »Und nun, meine Liebe, komm, so schnell es geht.«
Ich antwortete nichts, sondern machte nur eine Verbeugung, als wolle ich damit sagen, daß ich all seine Aufträge, die er mir mit lauter Stimme gegeben, gut verstanden habe und ausführen werde. Nach ungefähr einer Viertelstunde ging ich dann auch unauffällig und harmlos fort. Ich hatte kein anderes Kleid angezogen, nur einen Hut aufgesetzt, eine Maske, einen Fächer und ein Paar Handschuhe in meine Tasche gesteckt, so daß ich im Hause nicht den geringsten Argwohn erregte. Er wartete in einem Seitengäßchen, durch das ich kommen mußte, auf mich, der Kutscher wußte schon, wohin er uns fahren sollte – an einem Ort nämlich, der Mile-end hieß, und wo ein Vertrauter meines Liebhabers wohnte und wir alle Bequemlichkeiten der Welt fanden, um so viel böses zu tun, als wir nur wollten.
Als wir dort waren, fing er wieder sehr ernsthaft mit mir zu reden an und sagte, er habe mich nicht hierher gebracht, um mich ins Verderben zu stürzen, seine wahre Leidenschaft zu mir mache es ihm ganz unmöglich, mein Vertrauen zu mißbrauchen. Er sei fest entschlossen, mich zu heiraten, so bald er in den vollen Besitz seiner Güter gelange; und mittlerweile würde er mich, wenn ich seine Bitte erfülle, standesgemäß unterhalten ... noch tausendmal beteuerte er mir seine Aufrichtigkeit und seine Zuneigung, sagte, er werde mich nie verlassen, kurz, machte wieder viel mehr Umschweife, als nötig gewesen wären.
Als er mich nun drängte, ihm eine Antwort zu geben, erwiderte ich, daß ich ja keinen Grund hätte, an seiner Aufrichtigkeit und seiner Liebe zu zweifeln, aber – hier hielt ich inne, als überlasse ich es ihm, den Schluß meines Satzes zu erraten.
»Aber – was? meine Liebe?« setzte er ihn fort, »du willst sagen, aber wenn ich nun guter Hoffnung werde, nicht wahr? Nun, dann werde ich für dich sorgen, und für das Kind auch, und damit du siehst, daß es auch wirklich meine Absicht ist, will ich es dir schon gleich beweisen.« Damit zog er eine seidene Börse mit hundert Guineen aus der Tasche und reichte sie mir. »Und jedes Jahr, bis wir heiraten, sollst du ebensoviel bekommen,« fügte er noch hinzu.
Beim Anblick des Geldes, und wie er so drängend seine Anträge vorbrachte, wechselte ich mehrmals die Farbe, so daß er es bemerkte; auch, daß ich kein Wort sprechen konnte; er steckte mir die Börse in den Busen, ich leistete ihm nicht mehr den geringsten Widerstand und ließ ihn tun, was er wollte und wie oft er wollte und schuf mir so selbst meinen Untergang, denn von diesem Tage an blieb mir, da ich nun von aller Tugend und Scham entblößt war, nichts mehr an Wert, das mich der Hilfe Gottes oder dem Beistand der Menschen hätte empfehlen können.
Ich begab mich schließlich in die Stadt zurück, besorgte die Geschäfte, die er mir aufgetragen hatte, und war wieder zu Hause, ehe jemand sagen konnte, ich sei zu lange ausgeblieben. Der junge Herr jedoch blieb bis spät in die Nacht fort und weder er noch ich erregten bei der Familie den geringsten Argwohn.
Wir hatten nun häufig Gelegenheit, unser schmähliches Tun zu wiederholen und vollführten es selbst zu Hause, wenn die Mutter und die jungen Damen irgend wohin zu Besuch gegangen waren, was mein junger Herr immer vorher genau auskundschaftete, um nur nie zu verfehlen, mich, die dann in aller Sicherheit allein war, aufzusuchen, so daß wir fast ein halbes Jahr lang den vollen Becher unserer Schlechtigkeit tranken und zwar ohne daß ich, wie ich mit vollster Genugtuung merkte, schwanger wurde.
Drittes Kapitel.
Ehe jedoch dies halbe Jahr ganz zu Ende war, versuchte jener jüngere Bruder, den ich am Anfang meiner Geschichte schon einige Malekurz erwähnt habe, mit mir anzubändeln, und als er mich eines Abends allein im Garten traf, sagte er mir ziemlich dieselben Worte her, die ich nun inzwischen schon so oft, wenn auch nicht von ihm gehört hatte: das heißt, er machte mir eine Liebeserklärung, nur daß er sie – und das war wohl ein bedeutsamer Unterschied – kurz und bündig mit einem klaren und ehrenhaften Heiratsantrage schloß.
Niemals in meinem Leben war ich in eine größere Verwirrung geraten, als in dem Augenblick. Ich wies den Antrag mit Hartnäckigkeit zurück und führte alles mögliche gegen ihn an: Ich wies ihn auf die Ungleichheit der Partie hin, auf die Behandlung, die mir die Familie gewiß zu teil werden lasse, wenn sie von seinem Ansinnen erfahre, auf die Undankbarkeit, die ich durch meine Einwilligung gegen seinen guten Vater und seine gute Mutter begehen würde, die mich so großherzig aus dem niedrigsten Elend in ihr Haus aufgenommen; kurz, ich tat alles, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen, nur die Wahrheit sagte ich ihm nicht, die gewiß seinen Bemühungen ein sehr schnelles Ende gemacht haben würde, die ich aber natürlich nicht anzudeuten wagte.
Es trat nun in der Folge eine Wendung ein, die ich nie erwartet hätte und die mir dann viel zu schaffen machte. Da der junge Herr nämlich so geradeaus und ehrlich war, benahm er sich auch stets und bei allen Gelegenheiten so; und da er sich selbst nichts vorzuwerfen hatte, lag ihm nicht, wie seinem Bruder, etwas daran, daß seine Zuneigung zu Fräulein Betty der Familie ein Geheimnis bliebe; obgleich er niemandem gerade heraus erklärte, daß er schon mit mir gesprochen habe, tat und sagte er doch so deutliches, daß seine Schwestern notwendig erkennen mußten, wie er mir mit Liebe zugetan sei. Auch seine Mutter merkte seine Neigung heraus; und obgleich sie alle mir gegenüber nichts erwähnten, sprachen sie doch untereinander davon, und ich Arme, ich erfuhr nun, daß sie ihr Benehmen mir gegenüber gründlich veränderten.
Doch wenn ich auch wohl die Wolken sah, die sich zusammengezogen, so dachte ich nicht, daß das Unwetter so nahe wäre; zwar mußte bald ein jeder erkennen, daß sich die Stimmung der Familie gegen mich gründlich geändert habe und von Tag zu Tag schlimmer wurde; dennoch überraschte mich eines Tages die Erkenntnis, man werde mir bald sagen, es sei sehr wünschenswert, wenn ich binnen kurzem das Haus verließe.
Zwar war ich nicht allzu beunruhigt darüber denn ich sagte mir mit Genugtuung, daß ich wohl versorgt war und verhehlte mir nicht, daß ich jeden Tag erwarten konnte, mich guter Hoffnung zu sehen, und daß ich dann die Familie ja sowieso, ohne einen Vorwand angeben zu können, verlassen müßte.
Nach einiger Zeit nahm der jüngere Herr eine Gelegenheit wahr, um mir zu sagen, daß seine Neigung zu mir seiner Familie bekannt geworden; ohne mein Verschulden, fügte er hinzu, denn er wisse ganz genau, wie die Sache herausgekommen sei. Seine eigenen Reden seien der Grund, und daß er aus seiner Hochachtung für mich einstweilen noch kein Geheimnis gemacht habe, wie er es eigentlich hätte tun sollen. Aber verbergen könne er nun einmal nichts, im Gegenteil, er werde, sobald ich einwillige, seine Ehefrau zu werden, allen offen mitteilen, daß er mich liebe und heiraten wolle. Weiter sagte er, daß sein Vater und seine Mutter allerdings damit nicht einverstanden und ungnädig zu mir sein würden, daß er aber selbständig leben könne, da er mündig sei und sich nicht davor fürchte, für mich mit zu sorgen, daß er, kurz gesagt, glaube, ich brauche mich seiner nicht zu schämen, er aber wolle sich meiner auch nicht schämen, er finde es verächtlich, mich, die er später als seine Frau anerkennen wolle, nicht auch jetzt schon als seine Braut anzuerkennen, ich habe nichts weiter zu tun, als ihm meine Hand zu geben, alles Übrige wolle er schon verantworten.