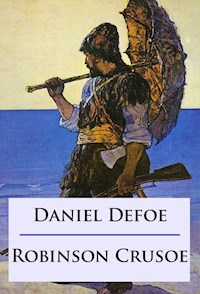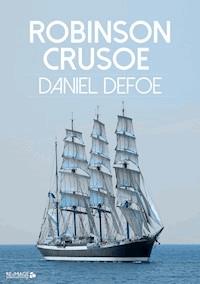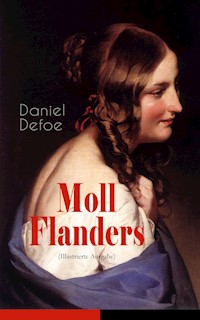
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Moll Flanders (Illustrierte Ausgabe)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Geschrieben in der Ich-Perspektive, beschreibt Defoe das Leben von Moll Flanders. Moll Flanders wächst als Waisenkind auf und wird zu einem beliebten Kind bei einigen reichen Familien. Als sie für das Waisenhaus zu alt wird, nimmt sie eine dieser Familien auf. Sie verliebt sich in den ältesten Sohn der Familie, der jedoch seine Liebe zu ihr nicht öffentlich machen kann, da sie nur ein Hausmädchen ist. Nimmt diese scheinbar hoffnungslose Romanze ein glückliches Ende? Daniel Defoe (1660-1731) war ein englischer Schriftsteller, der durch seinen Roman Robinson Crusoe weltberühmt wurde. Defoe gilt damit als einer der Begründer des englischen Romans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Moll Flanders (Illustrierte Ausgabe)
Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Welt ist in unsern Tagen überschwemmt mit Romanen und spannenden Begebenheiten, daß es schwer sein wird, für die Geschichte einer aus dem Volke Aufmerksamkeit zu erlangen, zumal noch Name und andere Umstände dieser Person verschwiegen werden, so daß ich nichts anderes tun kann, als dem Leser seine Meinung zu belassen über den Bericht auf den nachfolgenden Blättern, er mag ihn halten für was er mag.
Der Autor wird hier eingeführt, als ob er ihre Geschichte aufzeichne, und gibt in den ersten Zeilen die Gründe an, warum er es für passend erachtet ihren Namen zu verschweigen, in der Folge wird es kaum nötig sein, über diesen Punkt noch ein Wort zu verlieren.
Der Wahrheit die Ehre zu geben habe ich den ursprünglichen Bericht der verrufenen Frau, welche ihn hier erzählt, neu gefaßt und den Ausdruck an einigen Stellen verändert, insbesondere ist es meine Mühe gewesen, daß sie ihre Geschichte nunmehr in geziemenderen Worten erzählt, als sie es in ihrer eigenen Niederschrift getan, wo ihre Sprache viel mehr die Zuchthäuslerin verrät denn die reuige und zurückhaltende Ehrbare, die sie später nach ihrem Bericht geworden ist. Die Feder, welche diese Geschichte zu Ende gebracht und sie so gestaltet hat, wie sie jetzt zu lesen ist, hat nicht wenig Fleiß verwendet ihr das Kleid zu geben, in welchem sie nunmehr zu sehen ist, denn wenn ein von Jugend auf verdorbenes Weib, ja die Frucht von Laster und Verderbtheit, dazu schreitet, einen Bericht ihres lasterhaften Lebens zu geben, das sie geführt hat, und auf die besonderen Gelegenheiten und Umstände eingeht, durch welche sie auf Abwege und in einen völligen Abgrund geriet, so muß der Verfasser aufs angelegentlichste Bedacht nehmen, daß er die Gewandung so rein wählt, daß kein Schaden gestiftet werde, insbesondere damit das Laster nicht für seine Zwecke daraus Vorteil ziehe.
Alle erdenkliche Sorgfalt ist auch getragen worden, daß eine angesteckte Einbildungskraft nicht neue Nahrung bekomme, daß in die jetzige Aufmachung der Erzählung sich nicht Schlüpfrigkeiten einschleichen und keine allzu gemeinen Ausdrücke aus ihrer schlechten Umgebung. Zu diesem Ende ist ein gewisser Abschnitt ihres Luderlebens, der die Zartheit verletzte, ausgelassen und verschiedene andere Teile um ein Merkliches verkürzt worden. Von dem, was übrig geblieben, wird erhofft, daß es den keuschen Leser oder die züchtige Zuhörerin nicht verletze. Aber da auch die ärgste Erzählung den besten Nutzen zu stiften vermag, so erwartet der Verfasser mit Zuversicht von dem Leser, daß die Moral ihn in dem nötigen Ernst erhalte auch da, wo die Erzählung sich ihm nach einer bedenklichen Seite zu neigen scheint.
Wenn die Geschichte eines verabscheuenswerten Lebens erzählt werden soll, so muß sie mit Notwendigkeit verabscheuenswerte Begebenheiten enthalten, wie sie eben jenes wirkliche Leben enthielt, um dem späteren Abschnitt jenen Hintergrund zu geben, auf dem die Schönheit der Reue am besten und leuchtendsten erstrahlen kann, wie überhaupt in einer Wiedergabe immer derselbe Wind wehen muß wie in der Wirklichkeit.
Es wird gesagt, daß in der Erzählung eines reuigen Lebens nicht dieselbe Lebendigkeit, dieselbe Farbigkeit und dieselbe Anziehungskraft herrschen kann wie in einem Bericht von Schandtaten. Wenn diese Annahme einigen Grund haben soll, so muß mir auch verstattet sein zu sagen, daß es nicht einerlei Geschmack und Neigung beim Lesen gibt und es nur allzu wahr ist, daß die Verschiedenheit nicht in der Beurteilung des wirklichen Wertes des Gegenstandes liegt als vielmehr am Gaumen und Gelüste des Lesers.
Allein da dieses Werk vor allem in die Hände derjenigen kommen soll, welche zu lesen und den besten Gebrauch aus dem zu machen verstehen, was diese Erzählung ihnen in die Hände gibt, so ist zu erhoffen, daß solche Leser mehr befriedigt sein werden von der Moral als von der Fabel, mehr von der Nutzanwendung als von der Darstellung, mehr von dem Endzweck, den der Autor im Sinne hatte, als von dem Leben der Person, das hier erzählt wird.
Es sind in dieser Geschichte ergötzliche Vorfälle in großer Zahl, von denen sich in jedem Falle ein Nutzen ziehen läßt, und da sie in angenehmer und wohlgestalteter Form dem Leser vorgeführt werden, so mag er auf die eine oder die andere Weise seinen Vorteil daraus ziehen. Mit einem Wort: die Urschrift ist mit Fleiß durchgesehen worden, und keiner kann, ohne sich einer offenbaren Ungerechtigkeit schuldig zu machen, weder auf den Autor noch auf den Verleger einen Tadel werfen.
Die Befürworter des Theaters haben zu allen Zeitaltern dieses Hauptargument vorgebracht, um das Volk zu gewinnen, nämlich daß die Spiele Nutzen stiften und daß sie um dieses Grundes willen in allen zivilisierten und religiösen Staaten erlaubt sein sollten, da sie die Tugend befördern, und dies um so mehr, je lebendiger die Vorführung ist. Sie haben nicht unterlassen, Tugenden und edle Grundsätze anzuempfehlen, indem sie das Laster und die Sittenverderbnis darstellten, und wenn wirklich diese Regel befolgt wird, so darf wohl sehr viel zugunsten des Theaterspiels gesagt werden.
Auf solchem Grunde steht dieses Buch, das ein Werk ist, von dem der Leser einen Gewinn haben wird, wenn er ihn zu machen weiß.
Glück und Unglück der berühmten Moll Flanders
Mein eigentlicher Name ist in den Registern der Zuchthäuser von Newgate und Old-Bailey so wohl bekannt, und es sind daselbst noch einige Fälle unverhandelt geblieben, die meine besondere Aufführung betreffen, daß ich Bedenken trage, mich oder meine Herkunft bei dieser Gelegenheit näher zu benennen. Vielleicht erfährt man nach meinem Tode ein Mehreres davon.
Ich bin froh, da ich beständig dasselbe Ende befürchtete, daß etliche meiner schlimmsten Gefährten mir nun nicht mehr schaden können, weil sie durch Leiter und Strick aus dieser Welt geschafft worden sind, sie haben mich unter dem Namen Moll Flanders gekannt, es mag mir darum erlaubt sein diesen Namen so lange weiter zu führen, bis ich offenbaren darf, wer ich in Wirklichkeit bin.
Man hat mir gesagt, daß in einem benachbarten Lande, ich weiß nicht ob in Frankreich oder sonstwo, auf besonderen königlichen Befehl die Kinder eines zum Tode oder auf die Galeere oder zur Verschickung verurteilten Missetäters von der Regierung in Fürsorge genommen und ins Waisenhaus gebracht werden, wo sie erzogen, unterrichtet, gekleidet und ernährt werden, bis sie imstande sind ein Handwerk zu erlernen oder in einen Dienst zu treten, um dadurch selbst ihr Brot zu verdienen, zumal Kinder solcher Eltern von allen Mitteln entblößt zu sein pflegen.
Wäre dies auch in unserm Lande Brauch, so würde ich kein so armes verlassenes Mädchen gewesen sein, zu dem mich das Unglück gemacht hat, das ohne Freunde und ohne Hilfe dastand, wodurch denn mein Elend schon unbeschreiblich groß war, ehe ich meine Lage erkannte oder dieselbe zu verbessern vermochte, so daß ich in die ärgste Not geriet, welches gewöhnlich der nächste Weg ist Leib und Seele ins Verderben zu stürzen.
Meine Mutter wurde eines geringen Diebstahls überführt, der kaum nennenswert war: sie hatte nämlich drei Stücke seiner holländischen Leinwand von einem Kaufmann in Cheapside genommen. Die Geschichte ist aber zu lang und ist mir auch auf so verschiedene Weise erzählt worden, daß ich sie hier nicht wiederholen will.
Dem sei nun wie ihm wolle, darin stimmen aber alle Nachrichten überein, daß sich meine Mutter im Gefängnis auf ihre Schwangerschaft berief und deshalb eine Frist von sieben Monaten erhielt, nach deren Ablauf man sie wieder vor Gericht brachte, wo ihr die Gnade widerfuhr, daß man sie nach Virginien auswies. Mich ließ man als halbjähriges Kind, und wie man sich wohl denken kann, in schlimmen Händen zurück.
Aus meiner ersten Lebenszeit weiß ich natürlich alles nur vom Hörensagen. Ich war an einem unglücklichen Orte, nämlich im Zuchthaus Newgate, geboren, so daß ich kein Anrecht hatte, von einer Gemeinde erhalten zu werden. Wie mir gesagt wurde, sollen einige Verwandte meiner Mutter mich zu sich genommen haben, indes auf wessen Anordnung und Kosten dies geschehen, ist mir unbekannt.
Das erste, dessen ich mich erinnern kann, ist, daß ich mit Zigeunern herumwanderte, doch glaube ich war es nur eine kurze Zeit, denn meine Haut war nicht gefärbt, wie sie es mit Kindern, welche dieses Volk herumschleppt, zu tun pflegen, ich kann auch nicht sagen, auf welche Weise oder wann ich von ihnen losgekommen bin.
Zu Colchester in Essex bin ich von ihnen zurückgelassen worden, oder bin ich ihnen entlaufen und habe ich mich vor ihnen versteckt, weil ich nicht weiter mitziehen wollte. Wohin sie dann gezogen, konnte niemand in Erfahrung bringen, obgleich ihnen im ganzen Lande nachgespürt wurde.
Nun war ich auf gutem Wege versorgt zu werden. Denn obgleich ich von rechtswegen keiner Gemeinde zur Last gelegt werden konnte, rührte doch mein Schicksal und meine Jugend – ich war nicht älter als drei Jahre – den Rat der Stadt zum Mitleid, daß er sich meiner annahm und mir Unterhalt gewährte, wie wenn ich in ihrer Stadt geboren wäre.
So hatte ich das Glück, einer zwar armen aber frommen Frau anvertraut zu werden, die früher den besseren Ständen angehört hatte und sich nun damit ernährte, daß sie solche Kinder wie ich war in Kost nahm und so lange für sie sorgte, bis sie alt genug waren, bei andern Leuten zu dienen oder sich sonst weiterzuhelfen.
Diese Frau hatte dabei auch eine Schule und lehrte die Kinder lesen und arbeiten. Da sie nun, wie schon erwähnt, früher in besseren Verhältnissen gelebt hatte, so erzog sie die Kinder mit großem Fleiß und vieler Sorgfalt.
Vor allem aber gab sie uns eine sehr gottesfürchtige Erziehung, da sie selbst eine sittsame fromme Frau war und dabei auch häuslich, sauber, bescheiden und höflich. So wurden wir erzogen, wie wenn wir allerhand Lehrmeister gehabt hätten, doch das Essen war schlecht, unsere Schlafkammern kahl und die Kleidung sehr ärmlich.
Hier lebte ich bis zu meinem achten Jahre, als mich die Nachricht erschreckte, daß die Obrigkeit des Ortes befohlen habe, mich irgendwo in Dienst zu tun. Nun war ich aber sehr ungeeignet dazu, Bestellungen auszurichten oder einer Köchin zur Hand zu gehen, und dies ward mir sehr oft vorgehalten. Ich fürchtete mich nun vor solchen Diensten und äußerte dagegen großen Abscheu, obgleich ich erst so jung war. Dann gab ich meiner Pflegerin zu verstehen, daß ich mir schon zutraute mein Brot zu verdienen, ohne Dienste zu tun, wenn sie mir solches vergönnen würde. Sie hatte mich Nähen und Wollspinnen gelehrt, denn diese Gewerbe wurden in der Stadt am meisten betrieben. Ich sagte ihr deshalb, wenn sie mich nur bei sich behalten wollte, so würde ich für sie arbeiten, und zwar mit allen meinen Kräften. Fast täglich redete ich davon und tat nichts anderes als arbeiten und weinen, was der guten Frau endlich so zu Herzen ging, daß sie meinetwegen ganz bekümmert wurde, denn sie hatte mich sehr lieb.
Einmal kam sie in die Stube, wo all die armen Kinder arbeiteten, und setzte sich mir gerade gegenüber, nicht auf ihren gewöhnlichen Platz, sondern als wenn sie nur mich und meine Arbeit besonders beobachten wollte. Ich war eben damit beschäftigt, in die Hemden, die sie mir gegeben hatte, Namen zu nähen. Nachdem sie eine Weile so gesessen, redete sie mich an und sagte:
Du törichtes Kind, du sitzest immer und weinst – es standen mir gerade wieder Tränen in den Augen – sage mir, was dir fehlt, warum weinst du denn?
Sie wollen mich wegnehmen und in den Dienst geben, sagte ich, und ich kann doch keine Hausarbeit tun!
Wenn du es jetzt noch nicht kannst, so wirst du es schon mit der Zeit lernen, man wird dir wohl zuerst keine harte Arbeit geben.
Das wird man aber doch tun, sagte ich, und wenn ich dann nichts kann, so werde ich Stöße bekommen, und die Mädchen werden mich schlagen, damit ich schwere Arbeit tun soll, und ich bin doch noch ein kleines Kind und kann noch nichts arbeiten. Dabei fing ich wieder an zu weinen, bis ich nicht mehr reden konnte.
Dies rührte meine gute Lehrmeisterin so, daß sie den Entschluß faßte, mich noch nicht in Dienst zu geben. Sie befahl mir nicht mehr zu weinen und sagte, sie wolle mit dem Bürgermeister reden und es dahin bringen, daß ich noch so lange bei ihr bleiben sollte, bis ich größer geworden wäre.
Damit war mir aber nicht geholfen. Denn ich hatte solche Angst vor dem Dienen, daß es für mich doch dasselbe gewesen wäre, wenn man es auch bis in mein zwanzigstes Jahr hinausgeschoben hätte, und ich die ganze Zeit über geweint haben würde aus Furcht, daß es endlich doch sein müßte.
Als meine Lehrerin dies merkte, wurde sie böse und fragte mich, was ich denn noch wolle, sie versichere mir doch, ich solle nicht dienen, bis ich erwachsen wäre.
Aber ich muß doch zuletzt daran, sagte ich, darum muß ich weinen.
Wie, sprach sie, bist du denn närrisch? Willst du denn ein Fräulein sein? Wie willst du denn durchkommen, etwa durch deine Handarbeit?
Ja, sagte ich ganz einfältig und unschuldig.
Wie willst du dich damit erhalten, wieviel denkst du wohl, daß du den Tag über mit deiner Arbeit verdienst?
Drei Groschen, sagte ich, wenn ich spinne, und vier, wenn ich Weißzeug nähe.
Armes Fräulein, sagte sie lachend, wie weit willst du denn damit kommen!
Es wird mich schon ernähren, sagte ich, wenn ich nur bei euch bleiben darf. Dies sagte ich in einem so jämmerlichen Tone, daß es der guten Frau selbst leid tat, wie sie mir später gestand.
Aber, sprach sie noch immer lächelnd, dieser Verdienst kann dir nicht Nahrung und Kleider schaffen, wer wird denn dem kleinen Fräulein die Kleider kaufen?
Ich werde dann noch fleißiger arbeiten, und ihr sollt dann alles haben.
Armes Kind, sprach sie, es wird nicht ausreichen, es wird dir kaum das liebe Brot eintragen.
So will ich nichts essen, sagte ich wieder in größter Unschuld, aber laßt mich nur bei euch bleiben.
Wie kannst du denn ohne Essen auskommen, sagte sie.
Das kann ich, sagte ich einfältiges Kind. Ich dachte nichts Arges hierbei, es war alles natürlicher unverstellter Trieb, von soviel Unschuld und Leidenschaft begleitet, daß sich die gute Mutter zuletzt selber der Tränen nicht enthalten konnte und noch lauter als ich weinte. Darauf führte sie mich aus der Schulstube und sagte: Nun, du sollst nicht dienen, sondern sollst bei mir bleiben! Dann erst war ich zufrieden.
Als sie bald darauf zum Bürgermeister ging, um mit ihm über mich zu reden, erzählte sie ihm die ganze Geschichte, die ihm so wohl gefiel, daß er seine Frau und seine beiden Töchter rief, damit sie sich mit ihm daran ergötzen könnten.
Es waren kaum acht Tage vergangen, als die Frau Bürgermeisterin mit ihren beiden Töchtern zu uns kam und meine Pflegerin besuchte unter dem Vorwande, einmal die Schule und die Kinder zu besichtigen. Nach einer Weile fragte die Bürgermeisterin, welches das kleine Mädchen wäre, das ein Fräulein werden wolle. Ich hörte ihre Frage, und es wurde mir schrecklich bange, obgleich ich nicht wußte warum. Die Bürgermeisterin kam dann auf mich zu und sagte: Wie ist's, Fräulein, was habt ihr hier für Arbeit?
Mit Fräulein hatte mich noch niemand angeredet und ich dachte wunder was das für ein seltsamer Name sein müsse. Doch ich stand auf und verneigte mich, und sie nahm mir darauf die Arbeit aus der Hand, besah und lobte sie.
Darauf betrachtete sie meine Hände und sagte, es könnte wohl wirklich dereinst ein Fräulein aus mir werden, weil ich so schöne Hände hätte, wie eine vornehme Dame sie haben müßte. Dies gefiel mir über alle Maßen, aber die Bürgermeisterin ließ es dabei nicht bewenden, sondern langte mit der Hand in ihre Tasche und gab mir einen Schilling mit der Ermahnung, meine Arbeit in acht zu nehmen und wohl zu lernen, damit ich dereinst, wie sie mir wünsche, ein Fräulein werden möchte.
Bisher hatten mich weder meine Pflegemutter noch die Bürgermeisterin noch alle andern verstanden: unter dem Worte Fräulein begriffen sie etwas ganz anderes als ich meinte. Was ich darunter verstand, war, daß ich für mich selbst arbeiten und meinen Lebensunterhalt erwerben wollte, ohne in einen Dienst gehen zu müssen, sie aber waren in dem Wahn, ich wollte sehr vornehm und ich weiß nicht was sonst noch sein.
Nachdem die Bürgermeisterin gegangen war, traten ihre beiden Töchter auf mich zu und redeten lange mit mir, und ich antwortete ihnen auf meine unschuldige Art. So oft sie mich fragten, ob ich gesonnen sei ein Fräulein zu werden, sagte ich allemal ja. Zuletzt kam die Frage, was denn ein Fräulein sei. Da wurde ich verwirrt, besann mich aber bald und sagte, das wäre eine, die nicht nötig hätte zu dienen oder Hausarbeit zu verrichten. Das gefiel ihnen wohl, und meine kindlichen Reden machten ihnen große Freude, so daß sie mir auch Geld gaben.
Dieses aber gab ich alles zusammen meiner Pflegemutter und versprach ihr, sie sollte alles haben, was ich bekäme, sowohl jetzt wie später, wenn ich ein Fräulein sein würde.
Aus diesen und andern Gesprächen begriff sie endlich, was ich unter Fräulein verstand, nämlich nichts anderes als mein Brot durch eigene Arbeit zu verdienen, und sie fragte mich zuletzt, ob ich es so meinte.
Ich bejahte und bestand darauf, daß hierin nach meinem Begriff die Eigenschaft eines Fräuleins bestünde. Denn, sagte ich, unsere Nachbarin, welche Spitzen ausbessert und reinigt, ist ein Fräulein, und jedermann sagt zu ihr Fräulein.
Mein armes Kind, sagte die Frau, ein solches Fräulein könntest du leicht werden – das ist eine übelbeleumundete Person und hat bereits zwei uneheliche Kinder.
Hiervon verstand ich jedoch nichts, antwortete aber, ich wisse gewiß, daß man sie Fräulein nenne, und daß sie nicht wie eine Magd diene noch Hausarbeit verrichte, und blieb also dabei, sie sei ein Fräulein, und ich wollte auch eines werden.
Die vornehme Dame, die bei uns gewesen war, erfuhr bald, was ich geredet hatte, und belustigte sich daran. Die Töchter des Bürgermeisters kamen auch dann und wann und fragten nach dem kleinen Fräulein, worauf ich mir nicht wenig einbildete. Bisweilen brachten sie noch andere Damen mit, und ich wurde bald in der ganzen Stadt unter diesem Namen bekannt.
Nun war ich ungefähr zehn Jahre alt und fing an, einem Fräulein ähnlich zu sehen, ich war sehr ernst, doch auch sehr höflich. Und da die Damen oft sagten, ich sei hübsch und würde einmal sehr schön werden, so kann man sich leicht denken, daß ich nicht wenig stolz dadurch wurde. Doch hatte dieser Stolz keine schlechte Wirkung, und wenn man mir Geld gab, so gab ich es meiner alten Pflegemutter, die an mir sehr ehrlich handelte und es für Hüte, Leinenzeug und Handschuhe für mich ausgab. Ich war sehr eigen, und wenn ich auch nur Lumpen anhatte, so mußten sie doch rein sein, ich wusch sie oft selbst aus. Wenn nun meine redliche Pflegemutter den Damen sagte, daß sie mir dies oder jenes für das Geld angeschafft habe, so gaben sie mir immer mehr, und das dauerte so lange, bis die Obrigkeit in allem Ernst verlangte, ich sollte in einen Dienst gehen. Aber da ich mich so eingearbeitet hatte, und eine vornehme Dame mir sehr gewogen war, konnte ich den Dienst wohl entbehren. Denn was ich bekam, reichte aus, und ich konnte meiner Pflegemutter soviel einbringen, als zu meinem Unterhalt notwendig war. Deswegen bat sie die Herren um Erlaubnis, das Fräulein, wie sie mich nannte, bei sich behalten und als ihre Gehilfin in der Kinderschule anstellen zu dürfen. Hierzu war ich sehr geschickt, denn trotz meiner Jugend besaß ich eine besondere Geschicklichkeit beim Arbeiten.
Hiermit endete nun die Güte der Damen nicht, denn als sie hörten, daß mich die Stadt nicht mehr unterhielt, gaben sie mir häufiger Geld. Und als ich heranwuchs, brachten sie mir Wäsche zu nähen, Spitzen auszubessern, Hüte zu machen und ähnliche Arbeit, wofür sie mich nicht nur bezahlten, sondern mir auch Anweisungen gaben, wie ich es machen sollte. So war ich also wirklich in meinem Sinne ein Fräulein, denn ehe ich mein zwölftes Jahr erreicht hatte, schaffte ich mir selbst Kleider an, bezahlte meiner Pflegemutter Kostgeld und behielt noch einiges Taschengeld übrig.
Die Damen gaben mir auch oft von sich oder ihren Kindern Kleider, Strümpfe oder Unterröcke, bald dieses, bald jenes, und meine alte Pflegemutter verwahrte es mir und hielt mich dazu an, es auszubessern und nützlich zu verarbeiten, denn sie war eine vortreffliche Hausfrau.
Zuletzt gefiel ich der einen Dame so gut, daß sie mich zu sich ins Haus nehmen wollte, damit ich ihren Töchtern einen Monat lang Gesellschaft leisten sollte.
Obgleich dies sehr gütig gehandelt war, so wandte doch meine gute Pflegemutter dagegen ein, daß mir mehr Schaden als Vorteil daraus entstehen würde, es sei denn, daß die gütige Frau mich gänzlich und nicht nur für eine Zeitlang behalten wollte. Diese gab der Alten recht und sagte dann, sie wolle mich erst auf eine Woche versuchsweise nehmen und sehen, wie sich ihre Töchter mit mir vertragen würden, und wie ich ihr gefiele, später wollte sie sich dann genauer darüber äußern. Wenn jemand nach mir fragen sollte, so sollte es heißen, es sei ihr etwas für mich aufgetragen worden.
Dies war klug angefangen, und ich begab mich zu der gütigen Frau, wo mir die jungen Fräulein so gut gefielen, ebenso wie ich ihnen, daß es schwer hielt, dort wieder fortzukommen, und sie mich endlich gegen ihren Willen gehen ließen.
Darauf begab ich mich aufs neue zu meiner ehrlichen alten Pflegemutter, bei der ich fast noch ein Jahr zubrachte und ihr gute Hilfe leistete. Ich war nun beinahe vierzehn Jahre alt, wohlgebildet für mein Alter und sah schon fast erwachsen aus, allein ich hatte solchen Geschmack an dem Herrschaftsleben in dem erwähnten Hause gefunden, daß mir mein altes Quartier nun nicht mehr so gut gefiel wie früher. Ich dachte, es sei doch etwas Schönes um eine vornehme Dame und hegte jetzt von einem Fräulein eine ganz andere Meinung als zuvor. Deshalb mochte ich auch gern mit den Fräulein umgehen und wünschte mir wieder bei ihnen zu sein.
Als ich ungefähr vierzehn und ein viertel Jahr alt war, wurde meine gute Pflegemutter krank und starb. Das war für mich etwas sehr Trauriges, denn eine arme Familie hört auf zu bestehen, wenn die Hauptperson die Augen zumacht. Kaum war die gute Frau begraben, als die Schule geschlossen und die Kinder anderswo untergebracht wurden. Was den Nachlaß betraf, so kam die verheiratete Tochter der Alten und machte reinen Tisch, indem sie mir ins Gesicht lachte und sagte, das kleine Fräulein möge nun für sich selbst sorgen, wenns ihr beliebte. Ich wußte vor Angst nicht, was ich tun sollte. Denn man wies mir gleichsam die Tür in die weite Welt hinein, und was das schlimmste war, die selige Frau hatte von mir 22 Schillinge in Verwahrung gehabt, die mein ganzes Vermögen ausmachten. Als ich das Geld von der Tochter forderte, zog sie die Nase hoch und sagte, das ginge sie nichts an.
Die gute Frau hatte sogar mit ihrer Tochter davon gesprochen und ihr den Ort angedeutet, wo das Geld verwahrt war, und ihr gesagt, dies gehöre dem Kinde. Sie hatte mich auch ein paarmal rufen lassen, um es mir zurückzugeben, allein zu meinem Unglück war ich nicht bei der Hand, und als ich kam, war sie schon bewußtlos. Doch die Tochter war später so ehrlich mir das Geld zu bezahlen, obwohl sie sich anfangs geweigert hatte.
Nun war ich in der Tat ein armes Fräulein und mußte mich an demselben Tage noch meiner Wege scheren. Denn die Tochter hatte alles fortgeschleppt, und ich hatte weder Unterkunft noch Brot. Einige Nachbarn aber hatten so viel Mitleid mit mir, daß sie die gnädige Frau, bei der ich acht Tage im Hause gewesen war, über meinen Zustand unterrichteten, die auch bald ihr Mädchen schickte und mich zu sich holen ließ. So schnürte ich denn mein Bündel und ging frohen Herzens dorthin. Die Angst über meine Lage hatte mir so zugesetzt, daß ich fast nicht mehr verlangte ein Fräulein zu sein, sondern willig war eine Dienstmagd zu spielen, es mochte nun kommen was da wollte.
Allein meine neue großmütige Herrin hatte etwas Besseres mit mir im Sinne. Ich nenne sie großmütig, denn sie übertraf meine alte Pflegemutter sowohl an Reichtum wie in vielem andern. Ich muß aber hinzufügen: außer in der Redlichkeit. Denn obgleich diese vornehme Dame keinem Menschen zu nahe trat, so muß ich doch bekennen, daß jene andere, ungeachtet ihrer Armut, keinem an aufrichtigem Herzen nachstand.
Kaum war ich heimatlos geworden, als auch die Bürgermeisterin ihre beiden Töchter schickte, um Sorge für mich zu tragen. Noch eine andere Familie, mit der ich bekannt geworden war, wie ich noch das kleine Fräulein hieß, hatte geschickt, um sich nach mir zu erkundigen, und so wurde ein groß Wesen von mir gemacht. Ja sie waren sogar nicht wenig böse, besonders die Bürgermeisterin, daß ihre Freundin mich ihr weggenommen hatte, denn sie sagte, ich gehörte ihr von Rechts wegen, weil sie die erste gewesen, die sich meiner angenommen hätte. Doch die mich hatten, wollten mich nicht wieder fortlassen, und ich konnte es auch nirgends besser haben als da, wo ich war.
Hier blieb ich nun bis zu meinem achtzehnten Jahre und hatte die vortrefflichste Erziehung, die sich nur denken läßt. Es kamen allerhand Lehrer zu den Fräulein ins Haus, um sie im Tanzen, Französischen, Schreiben, Singen und andern Künsten zu unterweisen, und da ich stets bei ihnen war, so lernte ich alles ebenso gut wie die Fräulein selbst. Obgleich die Lehrer keinen Auftrag hatten, mich mit zu unterrichten, so lernte ich doch alles durch Nachahmen und Nachfragen, was jenen durch Unterricht und Aufgaben beigebracht wurde. Kurz, ich tanzte, redete Französisch so gut wie sie, sang aber weit besser, denn meine Stimme war den ihrigen an Schönheit überlegen. Mit dem Klavierspiel kam ich nicht so rasch vorwärts, da ich kein eigenes Instrument zum Üben hatte sondern warten mußte, bis die Fräulein gespielt hatten und es mir überließen, doch ging mir auch dies ziemlich vonstatten, bis zuletzt noch ein Instrument angeschafft wurde, so daß wir nun zwei hatten, ein Klavier und ein Spinett, alsdann unterwiesen mich die Fräulein selber. Was aber das Tanzen betraf, so behinderte mich nichts, denn bei allen Reigentänzen war ich unentbehrlich, weil die Zahl voll sein mußte. Andererseits waren sie ebenso willig mich zu unterrichten als selbst zu lernen.
Hierdurch erlangte ich viele gute Eigenschaften, die einem Fräulein zukamen. In einigen Dingen hatte ich sogar etwas voraus, denn ich hatte von Natur aus gute Anlagen, die nicht mit Geld zu bezahlen oder zu kaufen sind.
Dies war nicht nur meine eigene Meinung, sondern auch die des ganzen Hauses. Natürlich besaß ich die meinem Geschlecht eigene Eitelkeit und bildete mir nicht wenig auf meine Schönheit ein, ich mochte besonders gern hören, wenn man mich deswegen lobte.
Bis jetzt war meine Lebensgeschichte eben verlaufen, denn ich hatte nicht nur die Ehre, in einer angesehenen Familie zu leben, die wegen ihrer Tugend und Frömmigkeit berühmt war, sondern man hielt mich auch selbst mit Recht für ein bescheidenes, stilles und tugendhaftes Mädchen. Es war mir auch noch kein Anlaß gegeben worden auf andere Gedanken zu kommen, noch war gar eine Versuchung zum Laster an mich herangetreten.
Worauf ich so stolz war, nämlich meine Schönheit, wurde mein Fallstrick, und meine Eitelkeit und Eingebildetheit gab die Ursache dazu. Die gnädige Frau hatte zwei Söhne, sehr flotte junge Herren, bei denen ich zu meinem Unglück wohl gelitten war, wiewohl sie sich auf ganz verschiedene Art gegen mich benahmen. Der ältere war ein lustiger Herr, der in der Stadt wie auf dem Lande dafür bekannt war, und obwohl er leichtsinnig genug war, etwas Ungehöriges zu begehen, so wußte er doch alles so zu wenden, daß ihm seine Lust nicht zu teuer zu stehen kam. Er legte mir jenen Fallstrick, der allen Frauen gefährlich wird, nämlich er sagte mir bei jeder Gelegenheit, wie hübsch ich wäre, wie wohlgestaltet, wie angenehm und solch ähnliches. Dies trieb er so kunstvoll, daß man glauben konnte, er wisse die Frauenzimmer ebenso wie die Rebhühner in seinen Schlingen zu fangen. Er sprach immer über mich zu seinen Schwestern, wenn ich nicht nahe dabei war, aber wenn er doch ganz genau wußte, daß ich nicht weit weg stand und es hören mußte. Die Schwestern sagten oft zu ihm: Still, sie kann dich hören, sie ist nur nebenan.
Darauf hielt er inne und redete ganz leise, wie wenn er es nicht gewußt hätte, doch währte es nicht lange, so fing er wieder an, mich mit lauter Stimme zu rühmen, wie wenn er nicht daran dächte, daß ich ihn hören könnte. Ich für meinen Teil versäumte keine Gelegenheit ihn zu behorchen und zu belauern, weil es mir ungemein wohl gefiel so gelobt zu werden.
Nachdem er den Köder auf diese Weise ausgeworfen und ein Lockmittel gefunden zu haben glaubte, das er mir vorhalten könnte, gab er sich endlich, wie er wirklich war. Eines Tages ging er an der Stube seiner Schwestern vorüber, wo auch ich war, und als er mich sah, trat er ganz fröhlich herein und sprach: Haben euch eure Ohren jetzt nicht geklungen? Ich neigte mich und wurde rot, sagte aber nichts.
Warum, Bruder? fragte das Fräulein.
Wir haben, antwortete er, unten über eine halbe Stunde von euch geredet.
Ich hoffe, daß es nichts Böses war, sprach die Schwester, und dann kann es mir gleich sein, was ihr geredet habt.
Beileibe nichts Böses, sagte er, wir haben sehr viel Gutes von Jungfer Betty gesprochen, besonders daß sie das schönste Mädchen in ganz Colchester ist, mit einem Wort, es wird fast überall in der Stadt auf ihr Wohl getrunken.
Ich wundere mich über dich, Bruder, Betty fehlt es an einer Sache, die alles andere in sich begreift, und daher fehlt es ihr an allem. Das weibliche Geschlecht ist jetzt übel daran. Es mag ein junges Frauenzimmer von hoher Geburt und guter Erziehung, mit Witz, Verstand, guten Manieren, löblichen Sitten und allen Tugenden im Übermaße versehen sein, hat sie aber kein Geld dazu, so bedeutet sie nichts, und es ist so, als ob ihr alles fehlte. Nichts als Geld kann ein Frauenzimmer in den jetzigen Zeiten beliebt machen. Die Männer haben das Spiel in den Händen.
Der jüngere Bruder, der eben dazu kam, fiel ihr ins Wort: Still, Schwester, du übereilst dich, nimm mich von deiner Regel aus. Ich versichere dir, wenn ich eine Frau von solchen Eigenschaften fände, wie du sie eben beschrieben hast, so wollte ich mich nicht viel ums Geld kümmern.
Du wirst dir, sprach die Schwester, auch nicht ein solches Frauenzimmer ohne Geld vorstellen können.
Du kannst das nicht wissen, sagte der jüngere Bruder.
Aber warum, liebe Schwester, fuhr der ältere fort, redest du denn so viel von Geld? Daran fehlt es dir doch nicht, wenn es dir vielleicht sonst an mancherlei mangelt.
Ich verstehe dich schon, lieber Bruder, höhnte das Fräulein gar gereizt, du willst sagen, es fehlt mir zwar nicht an Gelde aber an Schönheit. Doch in unserer Zeit macht es nur das Geld, und ich habe darum vor andern alles voraus.
Aber, sagte der jüngere Bruder, die andern können dir doch gleich sein. Denn Schönheit fesselt bisweilen einen Mann auch ohne Reichtum, und wenn es sich trifft, daß die Kammerjungfer schöner ist als das Fräulein, kann sie oft ebenso gut ihr Glück machen und ihr in der Kutsche vorausfahren.
Hier war es Zeit für mich wegzugehen, und ich tat es auch, ging aber nicht so weit, daß ich die Unterredung nicht hätte weiter hören können. Da kam nun verschiedenes ins Gespräch, das meiner Eitelkeit schmeichelte, doch war dies nicht dazu angetan, mich bei der Familie beliebter zu machen, denn die Schwester entzweite sich sehr darüber mit ihrem jüngeren Bruder. Da ihr dieser meinetwillen etliche bittere Pillen zu kosten gab, so merkte ich an ihrem folgenden Benehmen zu mir, daß sie deshalb verletzt war, womit sie mir doch großes Unrecht tat, weil ich nie an ihren jüngeren Bruder in der Art gedacht hatte, wie sie wohl argwöhnte. Was den älteren betraf, so hatte er viele Dinge im Scherz vorgebracht, die ich als Ernst auffaßte, und ich schmeichelte mir mit einer Hoffnung, welche ich lieber für ganz ungegründet hätte halten sollen.
Eines Tages kam er nach seiner Gewohnheit die Treppen heraufgerannt nach der Kammer zu, in der seine Schwester zu arbeiten pflegte, und klopfte an, ehe er hineintrat, wie es auch sonst seine Art war. Ich befand mich allein in der Kammer, ging zur Tür und sagte: Mein Herr, die Fräulein sind nicht hier, sie haben sich in den Garten begeben. Ich hatte kaum ausgeredet, da trat er auch schon ganz herein, umarmte mich, als ob gar nichts dabei wäre, und sagte:
O Jungfer Betty, ihr seid hier, das ist noch besser, ich habe etwas mit euch zu reden! Mit diesen Worten hielt er mich fest in seinen Armen und küßte mich einige Male.
Ich bemühte mich von ihm loszukommen, doch vermochte ich es nicht, denn er hielt mich immer fester und küßte mich, bis ihm der Atem ausging, dann setzte er sich nieder und sprach: Meine schöne Betty, ich bin in dich verliebt! Ich muß gestehen, daß seine Worte mein Blut entzündeten, und mein Herz fing an zu pochen. Er wiederholte mir dies noch öfter, daß er mich liebe, und mein Herz sprach wie eine deutliche Stimme, daß mir das angenehm sei. So oft er sprach: ich liebe dich – gab ich mir die Antwort: ich wollte, daß es wahr wäre! Es fiel aber diesmal weiter nichts vor. Es war nur eine Überrumpelung, und ich kam bald wieder zu mir. Er wäre noch länger geblieben, wenn er nicht durchs Fenster gesehen hätte, daß seine Schwestern zurückkamen. Darum nahm er Abschied, küßte mich und sagte, daß es ihm Ernst sei, und ich bald mehr von ihm hören würde. Darauf ging er höchstvergnügt von mir fort. Es war nur traurig, daß der junge Herr es nicht so meinte, wie die Jungfer Betty annahm.
Von dieser Zeit ab setzte ich mir seltsame Gedanken in den Kopf und ich kann wohl sagen, daß ich mich selbst nicht mehr kannte. Ein solcher Herr redete mir von Liebe und fand mich reizend – das waren Dinge, die meine Eitelkeit aufs höchste trieben. Ich war voller Hochmut, aber weil mir die Verderbnis der Zeit nicht bekannt war, dachte ich nicht an meine Tugend. Ich hätte dem jungen Herrn, wenn er gewollt hätte, bei dem ersten Zusammensein jede Freiheit verstattet, allein er merkte zu meinem Glück seinen Vorteil nicht.
Es währte nicht lange, so fand er eine Gelegenheit mich abermals abzufangen, und zwar fast in derselben Weise. Doch geschah es seinerseits mit Absicht, die bei mir nicht ihr Spiel trieb. Die beiden jungen Fräulein waren mit ihrer Mutter auf Besuch ausgefahren. Der jüngere Bruder befand sich außerhalb der Stadt, und der Vater war schon seit acht Tagen in London. Er hatte mich so gut beobachtet, daß er wußte, wo ich mich aufhielt, wogegen ich nicht wußte, daß er im Hause war. Darauf kommt er die Treppe herauf, sieht mich bei der Arbeit, tritt geradenwegs in das Zimmer herein und beginnt das Spiel da, wo er das erstemal aufgehört hatte, nämlich mit Umarmungen und Küssen, und trieb es fast eine Viertelstunde lang hintereinander.
Ich befand mich in der Kammer der jüngeren Schwester, und kein Mensch war im Hause als die Magd unten, wodurch er vermutlich noch kühner wurde. So schien es denn, als ob Ernst daraus werden sollte. Vielleicht kam ich ihm ein wenig zu willfährig vor, denn ich leistete keinen Widerstand, solange er mich in den Armen hielt und küßte. Um die Wahrheit zu sagen, es gefiel mir nur allzu gut, als daß ich mich ihm hätte widersetzen können.
Nachdem wir nun beide von dieser Beschäftigung rechtschaffen ermüdet waren, setzten wir uns nieder und er redete lange mit mir und sagte, meine Schönheit habe ihn bezaubert und ihm keine Ruhe gelassen, bis er mir seine Liebe entdeckt hätte. Würde ich ihm nun Gegenliebe zeigen und ihn glücklich machen, so würde er mir sein Leben lang danken und dergleichen. Ich sagte wenig dazu, ließ aber deutlich genug merken, daß ich nicht verstünde, was er meinte.
Darauf ging er in dem Zimmer auf und ab, faßte mich bei der Hand, so daß wir nebeneinander gingen. Endlich nahm er seinen Vorteil wahr, warf mich aufs Bett und küßte mich heftig. Doch muß ich zu seiner Ehre sagen, daß er mir sonst nichts zumutete, sondern mich nur eine Zeitlang küßte. Dann kam es ihm so vor, als hörte er jemanden die Treppe heraufkommen, er sprang darum vom Bette, hob mich auf und versicherte mir noch einmal die Größe seiner Liebe und daß er es ehrlich meine und nicht die geringste böse Absicht dabei habe. Mit diesen Worten steckte er mir fünf Guinees in die Hand und ging hinunter. Das Geld blies mich noch mehr auf als die Liebe. Ich wurde dadurch so hochmütig, daß ich kaum den Boden unter mir fühlte, auf dem ich stand.
Bei dieser Erzählung wollte ich recht ausführlich sein, damit ein junges Frauenzimmer daraus lerne auf ihrer Hut zu sein, um sich nicht durch allzu frühes Eingebildetsein auf die eigene Schönheit ins Unglück zu stürzen. Wenn sich ein Frauenzimmer erst einmal einbildet, daß sie schön sei, so zweifelt sie später niemals mehr an der Aufrichtigkeit desjenigen, der ihr von Liebe spricht. Denn da sie sich für reizend genug hält, jedermann zu fesseln, so ist nur zu natürlich, daß sie die Wirkung ihrer Reize endlich zu sehen verlangt.
Mein junger Herr hatte nun seine Neigung und meinen Hochmut völlig angefeuert, und es mochte ihn vielleicht verdrießen, daß er die gute Gelegenheit so bald aus der Hand gelassen und sie nicht beim Schopfe genommen, deshalb kam er nach einer halben Stunde wieder herauf und trieb es mit mir auf die vorige Weise, doch machte er die Einleitung etwas kürzer.
Das erste, was er tat, nachdem er in die Kammer gekommen, war, daß er die Tür abschloß. Jungfer Betty, sprach er, es dünkte mich vorhin, als käme jemand die Treppe herauf, allein ich hatte mich geirrt. Und wenn man uns auch vielleicht zusammen in dem Zimmer finden mag, so soll man uns doch nicht küssend antreffen.
Ich sagte ihm, da nur die Köchin im Hause wäre, so wüßte ich nicht, wer wohl heraufkommen sollte, denn diese würde es nie tun.
Gut, meine Liebste, sagte er, aber Vorsicht kann nicht schaden. Darauf setzte er sich und redete weiter. Obwohl ich nun schon von seinem vorigen Besuch in voller Flamme war und gar wenig sagen konnte, redete er immer schönere Worte und versicherte mich seiner äußersten Liebe, wenn er auch hinzusetzte, er könnte mich zwar nicht sogleich heiraten, er wäre aber entschlossen, sowohl sein Glück als auch das meine zu machen, sobald er nur seine Erbgüter erhalten hätte, und dergleichen lockende Dinge mehr. Ich arme Närrin merkte nicht, wohin diese Redensarten zielten, und verhielt mich so, als ob es keine andere Liebe in der Welt gäbe als die, welche die Ehe zum Gefolge hat. Und wenn er auch von einer andern Liebe geredet hätte, so hätte ich doch weder Ursache noch Kraft gehabt ihm eine abweisende Antwort zu geben. Aber noch waren wir nicht so weit gekommen.
Wir saßen nicht lange beieinander, als er aufsprang und mich fast mit seinen Küssen erstickte und mich wiederum aufs Bett warf. Diesesmal kam er weiter mit mir, als mir der Anstand zu sagen erlaubt. Es wäre wohl auch nicht in meiner Macht gewesen, ihm in diesem Augenblicke das letzte zu versagen, wenn er es gleich verlangt hätte.
Dennoch ging diese mißbrauchte Freiheit nicht bis zum äußersten, und ich muß zu seinen Gunsten sagen, daß er sich dessen doch nicht getraute. Er bediente sich auch dieser Zurückhaltung als Ausrede, um mit ihr die andern Kühnheiten zu entschuldigen, die er darauf mit mir vornahm. Darauf blieb er nur noch kurze Zeit, steckte mir eine ganze Handvoll Gold zu und ließ mich mit tausend Versicherungen seiner größten Liebe zurück, wobei er mich über alle Frauenzimmer der Welt stellte.
Nun wäre es Zeit gewesen in mich zu gehen, aber leider war ich zu eingehender Betrachtung wenig geneigt. Mein Vorrat an eitlen Gedanken war unerschöpflich, hingegen war im Grunde wenig Tugend vorhanden. Bisweilen überlegte ich mir wohl, was mein junger Herr wohl im Sinne hatte, allein die glatten Worte und das schöne Gold erfüllten mein ganzes Herz. Es schien mir nicht von so großer Wichtigkeit zu sein, daß er willens war mich zu heiraten, ich dachte nicht einmal an einen Abschluß dieser Art, bis er mir selbst einen Vorschlag machte, wie wir bald hören werden.
So ergab ich mich also meinem Verderben ohne die geringste Besorgnis und kann allen jungen Frauenzimmern zum Beispiel dienen, deren eitler Hochmut größer ist als die Tugend. Niemals hat eine Liebschaft von beiden Seiten einfältiger angefangen als diese. Hätte ich gehandelt, wie es sich geziemt hätte, und den Widerstand geleistet, den Tugend und Ehre erforderten, so wäre ich entweder von seinen Nachstellungen befreit gewesen, wenn ihm sein Vorhaben nicht gelungen wäre, oder er würde mir in allen Ehren die Ehe angetragen haben. Wenn er mich recht gekannt oder gewußt hätte, wie leicht er den gewünschten Erfolg hätte haben können, so würde er sich den Kopf nicht so lange darüber zerbrochen sondern mir vier oder fünf Guinees dafür gegeben und sein Vorhaben bei der ersten besten Gelegenheit ausgeführt haben. Hätte ich hingegen seine Gedanken gewußt, wie er es sich so sauer werden ließ, um mich zu gewinnen, so hätte ich alles nach meinem eigenen Willen eingerichtet, und wenn ich schon keinen richtigen Kontrakt für die nachfolgende Heirat hätte erhalten können, so würde ich mir doch den Unterhalt bis zur Hochzeit gesichert haben, und damit hätte ich meinen Wunsch erfüllen können, denn er war überaus reich, auch ohne seine künftige Erbschaft. Allein es kam kein solcher Gedanke in meinen Sinn, all mein Dichten und Trachten ging nur auf Hoffart aus und ich freute mich, einen solchen jungen Herrn entflammt zu haben. Ganze Stunden brachte ich damit zu das Gold zu besehen und zählte meine Guinees wohl tausendmal am Tage. Kein armseliges Geschöpf ist jemals so vergnügt über ihr vermeintliches Glück gewesen als ich es war, ohne zu ahnen, daß das Unglück schon vor der Türe stand. Ja es scheint fast, daß ich mein Verderben heftiger gewünscht, als es zu vermeiden versucht habe.
Indes war ich doch so schlau, daß ich niemanden im Hause von meinem Umgang mit ihm etwas merken ließ. Ich sah ihn kaum an, wenn wir unter Leuten waren, antwortete ihm auch nicht, wenn er mich um etwas fragte. Trotzdem hatten wir manchmal eine kurze Zusammenkunft, so daß wir miteinander reden oder uns auch wohl einige Male küssen konnten, aber die Gelegenheit weiter zu gehen fand sich noch nicht, besonders da er mehr Umschweife machte als nötig waren, und sich das Werk schwer werden ließ, weil es ihm schwer vorkam.
Allein der Satan wird niemals müde, als Versucher fehlt es ihm auch nie an Gelegenheit das Laster ins Werk zu setzen, wozu er die Menschen treibt. An einem Abend, als ich mit dem Fräulein und meinem Liebhaber im Garten war, wußte er mir heimlich einen Zettel zuzustecken, worin er mich wissen ließ, daß er mir am andern Tage öffentlich eine Besorgung auftragen und ich ihn dann irgendwo antreffen würde.
Darauf redete er mich bei der Mahlzeit in Gegenwart der Schwestern ganz ernsthaft an:
Jungfer Betty, ich möchte euch um etwas bitten. Was soll das sein? fragte die jüngere Schwester.
Wenn du aber Jungfer Betty heute nicht entbehren kannst, so kann ich es auch bis zu einer andern Zeit aufschieben.
O nein, wir können sie ganz gut entbehren, sagten beide.
Aber, fuhr die ältere fort, du mußt der Jungfer Betty auch sagen, was es ist, es sei denn, daß es etwas betrifft, wovon wir nichts wissen sollen.
Was meinst du, fragte er ganz unverdächtig, alles, was ich möchte, ist, daß sie für mich nach der Hochstraße – dabei zog er eine Halsbinde hervor – und dort in einen Laden geht. Und darauf erzählte er eine lange Geschichte von zwei schönen Halstüchern, die er dort habe kaufen wollen, und die er durch mich gern kaufen lassen wollte, ich möchte mit den Leuten handeln. Er trug mir noch einige kleine Besorgungen auf und zwar so viele, damit eine gute Zeit damit hinginge.
Danach erzählte er seinen Schwestern, daß er eine ihnen gut bekannte Familie besuchen müßte, wo er einen gewissen Herrn antreffen wollte, er bat sie auch noch, ihn dahin zu begleiten, sie aber entschuldigten sich sehr höflich, weil sich verschiedene Fräulein bei ihnen nachmittags angesagt hätten, was auch er veranlaßt hatte.
Kaum hatte er ausgeredet, so meldete sein Diener, daß der Wagen des Barons W. vor der Tür hielte. Er lief hinunter, kam aber gleich wieder herauf mit den Worten: Nun ist mir meine ganze Freude verdorben, Baron W. hat mir eben seinen Wagen geschickt und will mich sprechen, und er wohnt drei Meilen von der Stadt draußen.
Mein junger Herr hatte den Wagen des Barons unter irgendeinem Vorwande geliehen und sich ihn auf drei Uhr bestellt, zu welcher Zeit er auch pünktlich eintraf.
Die beste Perücke, Hut und Degen wurden geholt, der Diener mußte seinen Herrn am andern Orte entschuldigen, das heißt, der Herr benutzte diese Gelegenheit, um seinen Diener fortzubringen. Während er zum Wagen ging, blieb er eine Weile in Gedanken stehen und redete dabei ernstlich mit mir über die mir aufgetragenen Besorgungen, fand aber Gelegenheit dabei mir heimlich zu sagen: Komm, mein Engel, sobald es nur möglich ist.
Ich sagte nichts sondern verneigte mich und gab dadurch meine Einwilligung zu verstehen. Eine Viertelstunde darauf machte ich mich auf den Weg. Meine Kleidung war nicht anders wie zuvor, nur hatte ich einen Kopfputz und ein paar Handschuhe in der Tasche mitgenommen, damit man im Hause keinen Argwohn schöpfte. Er erwartete mich in einer Hintergasse, durch die ich gehen mußte, der Kutscher war unterrichtet, wohin er fahren sollte, nämlich nach Mile-End, wo einer seiner Vertrauten wohnte, bei dem wir einkehrten und alle Bequemlichkeit von der Welt fanden, um so gottlos zu sein, als es uns nur gefiel.
Wie wir zusammen waren, fing er an ganz ehrbar mit mir zu reden und sagte, er ginge nicht damit um, mich zu betrügen. Seine Liebe zu mir erlaube ihm nicht, mir das geringste Üble anzutun, er sei entschlossen mich zu heiraten, sobald er zu seiner Erbschaft gelangt wäre. Wenn ich ihn inzwischen erhören wolle, wäre er erbötig mich ehrlich zu unterhalten, und brachte noch tausend Beteuerungen seiner Aufmerksamkeit vor mit dem Versprechen, mich nie zu verlassen. Ich kann wohl sagen, er machte tausendmal mehr Einleitungen als nötig waren.
Da er mich nun veranlaßte zu sprechen, gab ich ihm zu verstehen, daß ich keine Ursache hätte, an der Aufrichtigkeit seiner Liebe zu mir zu zweifeln, nachdem er mir dieselbe so hoch und so oft versichert, aber – hier hielt ich inne, als ob er das übrige erriete –
Ich kann mir denken, was du meinst, mein Schatz, sprach er, wenn du etwa schwanger werden solltest, nicht wahr? Nun, dann will ich auch dafür Sorge tragen, daß weder du noch das Kind zu kurz kommen sollen, und damit du siehst, daß ich nicht scherze, so soll dies das Angeld sein. Dabei zog er einen seidenen Beutel mit hundert Guineen heraus und gab ihn mir. Ebensoviel sollst du jedes Jahr bekommen, bis ich dich heiraten kann.
Ich wurde bald rot, bald blaß beim Anblick dieses Beutels und bei diesem Gespräch, so daß ich kein Wort herausbringen konnte, worauf er wohl merkte. Indes steckte ich den Beutel in meinen Busen und widerstand ihm nicht sondern ließ ihn machen, was und wie oft er wollte. So bewirkte ich mein eigenes Verderben, denn von diesem Tage an, da ich Tugend und Scham ganz fallen ließ, blieb mir nichts mehr, was mich hätte bei Gott und den Menschen angenehm machen können.