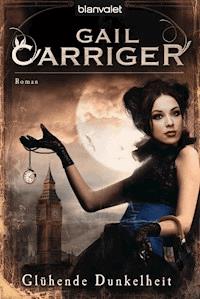
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lady Alexia
- Sprache: Deutsch
Nachdem Miss Alexia Tarabotti in Notwehr einen Vampir getötet hat, steht sie nun dem Alpha-Werwolf Lord Maccon gegenüber – dem Chefermittler der Queen für übernatürliche Angelegenheiten. Als dieser sich weigert, sie in die Ermittlungen einzubeziehen, beschließt Alexia, selbst nachzuforschen, was hinter dem Angriff auf sie steckt. Und plötzlich befindet sie sich nicht nur tief in einer Intrige gegen das Britische Empire – sie sieht auch ihr Herz durch den attraktiven Lord Maccon bedroht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Gail Carriger
Glühende Dunkelheit
Roman
Aus dem Englischen von Anita Nirschl
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Soulless« bei Orbit, New York.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe Juni 2011
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Tofa Borregaard
This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, New York, USA. All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlagmotiv: © Illustration Max Meinzold/HildenDesign, unter Verwendung von Motiven von Yaro / Shutterstock
Redaktion: Peter Thannisch
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-03929-5
www.blanvalet.de
1
Wofür sich Sonnenschirme eignen
Miss Alexia Tarabotti amüsierte sich nicht. Abendliche Tanzveranstaltungen im privaten Kreis waren für alte Jungfern bestenfalls leidlich unterhaltsam, und die unverheiratete Miss Tarabotti galt mit ihren sechsundzwanzig Jahren zwar als solche, konnte jedoch so einer Gesellschaft nicht einmal ein Mindestmaß an Vergnügen abgewinnen. Um dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, wurde sie, als sie sich in die Bibliothek zurückzog, ihren bevorzugten Zufluchtsort in jedem Haus, von einem Vampir überrascht.
Finster starrte sie den Blutsauger an.
Dieser hingegen schien seinerseits das Gefühl zu haben, dass sein Ballabend durch ihr Aufeinandertreffen gerade unermesslich bereichert wurde. Da saß sie, ohne Begleitung, in einem tief ausgeschnittenen Abendkleid.
In diesem speziellen Fall allerdings war es so, dass Unwissenheit nicht vor Schaden schützte, denn Miss Alexia war ohne Seele geboren worden, was sie, wie jeder anständige Vampir guten Blutes wusste, zu einer Dame machte, der man tunlichst aus dem Weg ging.
Dennoch löste er sich finster wabernd aus den Schatten der Bibliothek und kam mit gebleckten Fangzähnen auf sie zu. In dem Augenblick jedoch, als er Miss Tarabotti berührte, wirkte er mit einem Mal gar nicht mehr finster.
Er stand einfach nur da, die schwachen Klänge eines Streichquartetts im Hintergrund, und tastete dümmlich mit der Zunge nach Fangzähnen, die er urplötzlich auf unerklärliche Weise verlegt zu haben schien.
Miss Tarabotti war nicht im Geringsten überrascht. Übernatürliche Fähigkeiten wurden durch Seelenlosigkeit stets neutralisiert. Sie bedachte den Vampir mit einem äußerst ungehaltenen Blick. Natürlich hielten sie die meisten Tageslichtler für nichts anderes als eine typische englische Pedantin, aber dieser Mann hätte sich zumindest die Mühe machen sollen, das offizielle Abnormalitätsverzeichnis für Vampire in London und Umgebung zu lesen.
Der Vampir fand seine Fassung bald wieder. Rückwärts gehend wich er vor Alexia zurück und stieß dabei einen in der Nähe stehenden Teewagen um. Nachdem der Körperkontakt mit ihr unterbrochen war, erschienen seine Fangzähne wieder. Offenbar war er nicht gerade der Hellste unter den Finsterlingen, denn er hechtete sogleich wieder auf sie zu, mit dem Kopf voran wie eine Schlange, um erneut zu einem Biss anzusetzen.
»Ich muss schon sagen!«, ermahnte Alexia ihn tadelnd. »Wir wurden uns noch nicht einmal vorgestellt!«
Noch nie hatte ein Vampir versucht, Miss Tarabotti zu beißen. Natürlich kannte sie den einen oder anderen vom Hörensagen und war mit Lord Akeldama befreundet. Wer war nicht mit Lord Akeldama befreundet? Aber kein Vampir hatte je den Versuch gewagt, von ihr zu trinken!
Deshalb sah sich Alexia, die Gewalt zutiefst verabscheute, dazu gezwungen, den Schurken in die Nasenlöcher – einer empfindlichen und demzufolge schmerzhaften Gegend – zu greifen und ihn auf diese Weise von sich wegzuzerren. Er stolperte über den umgestürzten Teewagen, verlor auf für einen Vampir erstaunlich ungraziöse Weise das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und landete mitten auf einem Teller mit Siruptorte.
Darüber war Miss Tarabotti zutiefst bekümmert. Sie hegte eine besondere Vorliebe für Siruptorte und hatte sich schon darauf gefreut, genau jenen Tellervoll zu verspeisen.
Entschlossen griff sie nach ihrem Sonnenschirm. Es war fürchterlich geschmacklos von ihr, auf einer Abendveranstaltung einen Sonnenschirm bei sich zu tragen, doch Miss Tarabotti ging kaum jemals ohne ihn irgendwohin. Er war ganz nach ihren eigenen Vorstellungen gestaltet: eine Kreation aus schwarzen Rüschen mit aufgenähten Stiefmütterchen aus violettem Satin, einem Gestänge aus Messing und einer silbernen Spitze, die mit Schrotkugeln beschwert war.
Sie hieb dem Vampir damit auf den Kopf, während dieser versuchte, sich aus seiner frisch eingegangenen intimen Beziehung mit dem Teewagen zu lösen. Die Schrotkugeln verliehen dem Messingschirm gerade genug Gewicht, um ein herrlich befriedigendes Donk zu erzeugen.
»Manieren!«, belehrte ihn Miss Tarabotti.
Der Vampir heulte vor Schmerz auf und setzte sich erneut rücklings in die Siruptorte.
Diesen Vorteil nutzte Alexia und ließ einen heftigen Stoß zwischen seine Beine folgen. Sein Geheule kletterte eine Oktave höher, und er krümmte sich in embryonaler Stellung zusammen. Miss Tarabotti war zwar eine anständige englische junge Dame, einmal davon abgesehen, dass sie keine Seele hatte und zur Hälfte Italienerin war, doch sie verbrachte beträchtlich mehr Zeit als die meisten anderen jungen Damen damit, zu reiten und spazieren zu gehen, und war deshalb unerwartet kräftig.
Miss Tarabotti machte einen Satz nach vorn – soweit man in voluminösen dreilagigen Unterröcken, drapierter Tournüre und einem gerüschten Taftkleid überhaupt einen Satz machen konnte – und beugte sich über den Vampir. Er hielt seine unziemlichen Körperteile umklammert und krümmte sich windend. In Anbetracht seiner übernatürlichen Heilungsfähigkeit würde seine Pein nicht lange anhalten, doch in der Zwischenzeit schmerzte es höchst empfindlich.
Alexia zog eine lange hölzerne Haarnadel aus ihrer kunstvollen Hochsteckfrisur. Errötend über ihre eigene Kühnheit riss sie seine Hemdbrust auf, die billig und übertrieben gestärkt war, und piekste ihn damit in die Brust, direkt über dem Herzen. Miss Tarabottis Haarnadel war besonders lang und spitz. Vorsorglich vergewisserte sie sich, dass sie mit der freien Hand seine Brust berührte, da nur Körperkontakt seine übernatürlichen Fähigkeiten aufhob.
»Unterlassen Sie auf der Stelle diesen grässlichen Lärm!«, wies sie die Kreatur an.
Der Vampir hörte mit seinem Gekreische auf und lag vollkommen bewegungslos da. Seine schönen blauen Augen fingen leicht an zu tränen, während er unverwandt auf die hölzerne Haarnadel starrte. Oder, wie Alexia sie gern zu nennen pflegte, ihren Haarpflock.
»Erklären Sie sich!«, verlangte Miss Tarabotti, während sie den Druck erhöhte.
»Ich bitte tausendmal um Vergebung.« Der Vampir wirkte verwirrt. »Wer sind Sie?« Vorsichtig tastete er nach seinen Fangzähnen. Verschwunden.
Alexia löste die körperliche Verbindung zu ihm (wobei sie aber die spitze Haarnadel an Ort und Stelle beließ), und seine Zähne wuchsen wieder nach.
Voller Verblüffung keuchte er auf. »Waf find Fie?«, lispelte er um seine Fangzähne herum, aufrichtige Furcht in den Augen. »Ich hielt Fie für eine Dame, ohne Begleitung. Ef wäre mein Recht, von Ihnen zu trinken, wenn man Fie fo forglof unbeauffichtigt gelaffen hätte. Bitte, ich wollte mich wahrhaftig nicht erdreiften.«
Alexia fiel es schwer, bei dem Lispeln nicht zu lachen. »Sie haben keinen Grund, sich so übertrieben pikiert zu geben. Ihre Königin wird Ihnen sicher von meiner Art erzählt haben.« Erneut legte sie ihm die Hand auf die Brust. Die Zähne des Vampirs bildeten sich zurück.
Er sah sie an, als ob ihr urplötzlich Schnurrhaare gewachsen wären und sie ihn angefaucht hätte.
Miss Tarabotti war überrascht. Übernatürliche Geschöpfe, seien es Vampire, Werwölfe oder Gespenster, verdankten ihre Existenz einem Übermaß an Seele, einem Überschuss, der sich weigerte zu sterben. Die meisten von ihnen wussten, dass es auch andere wie Miss Tarabotti gab, die ohne jegliche Seele geboren worden waren. Das geschätzte Bureau of Unnatural Registry (BUR), eine Abteilung des öffentlichen Dienstes Ihrer Majestät, deren Aufgabe die Kontrolle und Registrierung des Unnatürlichen war, nannte ihre Art Außernatürlich. Alexia fand diese Bezeichnung angenehm würdevoll. Wie Vampire sie nannten war weit weniger schmeichelhaft. Schließlich waren sie einst von den Außernatürlichen gejagt worden, und Vampire hatten ein gutes Gedächtnis. Natürlich wurden Tageslichtler darüber sozusagen im Dunkeln gelassen, aber jeder Vampir, der sein Blut wert war, musste wissen, was die Berührung eines Außernatürlichen bewirkte. Die Unwissenheit von diesem hier war unvertretbar. Also sagte Alexia wie zu einem sehr kleinen Kind: »Ich bin eine Außernatürliche.«
Der Vampir wirkte nun verlegen. »Natürlich sind Sie das«, sagte er zustimmend, obwohl er offensichtlich immer noch nicht ganz begriff. »Entschuldigen Sie bitte nochmals, liebreizendes Fräulein. Ich bin überwältigt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sind meine erste …«, er stolperte über das Wort, »Außernatürliche.« Nachdenklich runzelte er die Stirn. »Weder übernatürlich noch natürlich, selbstverständlich! Wie töricht von mir, diese Gegensätzlichkeit nicht zu erkennen.« Seine Augen verengten sich listig. Er ignorierte nun geflissentlich die Haarnadel und sah Alexia mit gespielt zärtlichem Wohlwollen ins Gesicht.
Miss Tarabotti wusste sehr gut, wie es um ihre weibliche Anziehungskraft bestellt war. Das netteste Kompliment, auf das sie mit ihrem Gesicht jemals hoffen durfte, war »exotisch«, aber niemals »liebreizend«. Alexia nahm an, dass Vampire, wie alle Raubtiere, am charmantesten waren, wenn man sie in die Ecke getrieben hatte.
Die Hände des Vampirs schnellten vor und zielten auf ihren Hals. Offensichtlich hatte er beschlossen, dass, wenn er schon nicht ihr Blut saugen konnte, Strangulation eine annehmbare Alternative darstellte. Alexia fuhr zurück und bohrte der Kreatur dabei die Haarnadel etwa einen Zentimeter tief in das weiße Fleisch.
Der Vampir reagierte mit einem verzweifelten Zappeln, das Alexia in ihren samtenen hochhackigen Tanzschuhen selbst ohne seine übernatürliche Stärke aus dem Gleichgewicht brachte. Sie stürzte rückwärts.
Brüllend vor Schmerz sprang der Vampir auf, die Haarnadel in der Brust.
Hektisch tastete Miss Tarabotti nach ihrem Sonnenschirm, während sie sich unelegant zwischen den Teeutensilien herumwälzte und hoffte, dass ihr neues Kleid die heruntergefallenen Speisen verfehlte. Sie fand den Schirm und sprang, den Parasol in weitem Bogen schwingend, auf die Füße. Durch bloßen Zufall traf die schwere Spitze das Ende ihrer hölzernen Haarnadel und trieb sie dem Vampir geradewegs ins Herz.
Wie erstarrt blieb die Kreatur stehen, einen Ausdruck tiefster Überraschung auf dem gut aussehenden Gesicht. Dann fiel er rücklings auf das schwer in Mitleidenschaft gezogene Tablett mit Siruptorte, schlaff wie labbrig verkochter Spargel. Sein alabasterweißes Gesicht färbte sich gelblich grau, als leide er an der Gelbsucht, und er wurde reglos.
Alexias Bücher nannten dieses Ende des Lebenszyklus eines Vampirs Deanimation. Alexia, die der Meinung war, dass der Vorgang erstaunlich dem In-sich-Zusammenfallen eines Soufflés ähnelte, beschloss in diesem Augenblick, es den Großen Kollaps zu nennen.
Eigentlich hatte sie beabsichtigt, geradewegs aus der Bibliothek hinauszuschlendern, ohne dass jemand etwas von ihrer Anwesenheit dort bemerkte, auch wenn das bedeutete, ihre beste Haarnadel zurückzulassen und auf ihren wohlverdienten Tee sowie eine gehörige Portion Drama zu verzichten.
Doch unglücklicherweise kam genau in diesem Augenblick eine kleine Gruppe junger Dandys hereingeschneit. Was derart gekleidete junge Männer in einer Bibliothek zu suchen hatten, darüber konnte sie nur Vermutungen anstellen. Alexia hielt es für die wahrscheinlichste Erklärung, dass sie sich auf der Suche nach dem Kartenspielzimmer verlaufen hatten.
Dessen ungeachtet war sie durch deren Anwesenheit gezwungen, so zu tun, als habe sie den toten Vampir soeben selbst erst entdeckt. Also kreischte sie auf und fiel in Ohnmacht.
Sie blieb hartnäckig ohnmächtig, trotz der großzügigen Verabreichung von Riechsalz, das ihr die Augen ganz fürchterlich tränen ließ, eines Krampfes in der Kniekehle und der Tatsache, dass ihr neues Ballkleid schrecklich zerknittert wurde. All die vielen Schichten grüner Posamenten, die sie, nach der neuesten Mode in heller werdenden Schattierungen, passend zum Kürass-Mieder ausgewählt hatte, wurden unter ihrem Gewicht zerdrückt. Es folgten die zu erwartenden Laute: eine ganze Menge Geschrei, viel hektisches Herumgerenne und gelegentliches lautes Klappern, während eines der Dienstmädchen die heruntergefallenen Teeutensilien beseitigte.
Dann fegte eine Respekt einflößende Stimme sowohl die jungen Dandys als auch all die anderen interessierten Gäste, die hereingeströmt waren, nachdem man das sich dort bietende Schauspiel entdeckt hatte, aus der Bibliothek. Mit einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete, kommandierte die Stimme jeden Anwesenden »Hinaus!« und kündigte an, dass ihr Besitzer »von der jungen Dame die Einzelheiten in Erfahrung bringen« würde.
Stille breitete sich aus.
»Jetzt hören Sie mir einmal gut zu! Ich werde etwas viel, viel Stärkeres als Riechsalz benutzen«, drang ein Knurren in Miss Tarabottis linkes Ohr. Die Stimme war tief, gefärbt mit einem Hauch von Schottland. Sie hätte Alexia einen eisigen Schauer über die Seele rinnen lassen, instinktiv Bilder des Vollmonds vor ihrem inneren Auge heraufbeschworen und den Wunsch geweckt, jetzt sofort irgendwoanders zu sein – hätte sie eine Seele gehabt. Stattdessen seufzte sie frustriert und setzte sich auf.
»Ihnen ebenfalls einen guten Abend, Lord Maccon. Zauberhaftes Wetter haben wir für diese Jahreszeit, finden Sie nicht auch?« Sie betastete ihre Frisur, die ohne die Haarnadel drohte sich aufzulösen. Verstohlen sah sie sich nach Lord Conall Maccons Stellvertreter, Professor Lyall, um. Lord Maccon hatte zumeist ein viel ruhigeres Temperament, wenn sein Beta anwesend war. Dies schien, wie Alexia inzwischen begriffen hatte, der eigentliche Sinn eines Betas zu sein – ganz besonders eines Betas von Lord Maccon.
»Ah, Professor Lyall, wie schön, Sie wiederzusehen!« Sie lächelte erleichtert.
Professor Lyall, der besagte Beta, war ein schlanker, rötlichblonder Gentleman unbestimmten Alters und von angenehmem Wesen, genau genommen so umgänglich, wie sein Alpha griesgrämig war. Er lächelte sie breit an und lüpfte grüßend den Zylinder, der von erstklassigem Schnitt und aus bestem Material war. Seine Halsbinde war ähnlich dezent; obwohl fachmännisch gebunden, war der Knoten bescheiden.
»Miss Tarabotti, wie schön, Sie einmal wiederzusehen.« Seine Stimme war sanft und freundlich.
»Hören Sie auf mit den Schmeicheleien, Randolph«, bellte Lord Maccon. Der vierte Earl of Woolsey war viel größer als Professor Lyall und trug beinahe ständig eine finstere Miene zur Schau. Jedenfalls blickte er stets finster drein, wenn er sich in Gegenwart von Miss Alexia Tarabotti befand, und zwar seit jenem Zwischenfall mit dem Igel (der nun wirklich und wahrhaftig nicht ihre Schuld gewesen war). Davon abgesehen hatte er unverschämt hübsche goldbraune Augen, mahagonifarbenes Haar und eine besonders schöne Nase. Die Augen funkelten Alexia gegenwärtig aus schockierend intimer Nähe an.
»Wie kommt es, Miss Tarabotti, dass jedes Mal, wenn ich ein Schlamassel in einer Bibliothek beseitigen muss, Sie sich rein zufällig mittendrin befinden?«, verlangte der Earl von ihr zu wissen.
Alexia bedachte ihn mit einem vernichtenden Blick und strich sich über die Vorderseite ihres grünen Taftkleids, um es nach Blutflecken abzusuchen.
Anerkennend beobachtete Lord Maccon sie dabei. Miss Tarabotti mochte ihr Gesicht zwar jeden Morgen im Spiegel mit einer gehörigen Portion Kritik betrachten, aber an ihrer Figur gab es absolut nichts auszusetzen. Er hätte weit weniger Seele und erheblich weniger niedere Triebe haben müssen, um diese appetitliche Tatsache nicht zu bemerken. Natürlich ruinierte sie ihre Anziehungskraft stets sofort wieder, indem sie den Mund aufmachte. Seiner bescheidenen Erfahrung nach gab es auf der ganzen Welt keine Frau, die noch entnervend schlagfertiger war.
»Bezaubernd, aber unnötig«, meinte er mit einem Hinweis auf ihre Bemühungen, nicht vorhandene Blutstropfen von ihrem Kleid zu wischen.
Alexia rief sich in Erinnerung, dass sich Lord Maccon und seine Art erst seit Kurzem zivilisiert benahmen. Man durfte einfach nicht zu viel von ihnen erwarten, ganz besonders nicht unter heiklen Umständen wie diesen. Allerdings erklärte das natürlich nicht Professor Lyall, der stets äußerst kultiviert auftrat. Sie schenkte ihm einen anerkennenden Blick.
Lord Maccons Miene wurde noch finsterer.
Miss Tarabotti dachte darüber nach, ob der Mangel an zivilisiertem Verhalten möglicherweise einfach nur an Lord Maccons Herkunft lag. Gerüchte besagten, dass er erst seit vergleichsweise kurzer Zeit in London lebte – und dass er von allen barbarischen Orten ausgerechnet aus Schottland hergekommen war.
Der Professor hüstelte leise, um die Aufmerksamkeit seines Alphas auf sich zu lenken. Der gelbe Blick des Earls heftete sich mit solcher Eindringlichkeit auf ihn, dass er beinahe brannte. »Aye?«
Professor Lyall stand über den Vampir gebeugt und untersuchte gerade interessiert die Haarnadel. Ein makellos weißes Taschentuch aus Linon um die Hand gewickelt, stocherte er in der Wunde herum.
»Sehr wenig Gekleckere, ehrlich gesagt. Beinahe keine Blutspritzer.« Er beugte sich vor und schnupperte. »Eindeutig Westminster«, stellte er fest.
Der Earl of Woolsey schien zu verstehen. Er richtete seinen durchdringenden Blick auf den toten Vampir. »Er muss sehr hungrig gewesen sein.«
Professor Lyall drehte die Leiche um. »Was ist denn hier passiert?« Er zog eine kleine hölzerne Pinzette aus seiner Westentasche und pflückte etwas vom Hosenboden des Vampirs. Dann hielt er kurz inne, kramte in seinen Manteltaschen und holte ein kleines Lederetui hervor. Er klappte es auf und entnahm ihm ein äußerst bizarr aussehendes, brillenartiges Ding mit kreisrunden Gläsern. Es war goldfarben, mit mehrfachen Linsen auf einer Seite, zwischen denen sich eine Art Flüssigkeit zu befinden schien. Außerdem war der seltsame Apparat mit kleinen Knöpfen und Skalen übersät. Professor Lyall klemmte sich das lächerliche Ding auf die Nase und beugte sich wieder über den Vampir, wobei er fachmännisch an den Wählscheiben schraubte.
»Grundgütiger!«, rief Alexia aus. »Was haben Sie sich denn da aufgesetzt? Sieht aus wie das unglückselige Produkt einer unzüchtigen Verbindung zwischen einem Teleskop und einem Opernglas. Wie, um alles in der Welt, nennt sich dieses Ding? Telenokel? Binoskop?«
Der Earl schnaubte amüsiert, dann tat er schnell so, als wäre nichts gewesen. »Wie wäre es mit Brilloskop?«, schlug er aber noch vor, offenbar nicht in der Lage, sich seinen Beitrag zu verkneifen. Dabei lag ein Funkeln in seinem Blick, das Alexia ziemlich verwirrend fand.
Professor Lyall blickte von seinen Untersuchungen hoch und starrte die beiden an. Sein rechtes Auge war abscheulich vergrößert. Es sah ziemlich schaurig aus und ließ Alexia zusammenzucken.
»Das hier sind meine monokularen Trans-Magnifikations-Linsen mit Skalen-Modifikatoraufsatz, und sie sind von unschätzbarem Wert. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nicht darüber spotten würden.« Erneut wandte er sich der vorliegenden Aufgabe zu.
»Oh.« Miss Tarabotti gab sich gebührend beeindruckt. »Wie funktionieren sie?«
Professor Lyall hob erneut den Blick und sah zu ihr hoch. »Nun, sehen Sie, es ist wirklich recht interessant. Indem man diesen kleinen Knopf hier dreht, kann man den Abstand zwischen den zwei Glasscheiben hier verändern, was der Flüssigkeit erlaubt, sich …«
Das Aufstöhnen des Earls unterbrach ihn. »Bringen Sie ihn bloß nicht in Fahrt, Miss Tarabotti, sonst sind wir noch die ganze Nacht hier.«
Ein wenig geknickt, wandte sich Professor Lyall wieder dem toten Vampir zu. »Also, was ist das nur für eine Substanz überall an seiner Kleidung?«
Sein Chef, der eine direkte Herangehensweise bevorzugte, nahm seine finstere Miene wieder auf und sah Alexia vorwurfsvoll an. »Was, auf Gottes grüner Erde, ist das für schmieriges Zeug?«
»Siruptorte«, antwortete Miss Tarabotti. »Bedauerlicherweise. Ein tragischer Verlust, wage ich zu behaupten.« Ihr Magen wählte genau diesen Augenblick, um zustimmend zu knurren. Sie wäre vermutlich vor Scham anmutig errötet, hätte sie nicht den Teint jener »heidnischen Italiener« gehabt, wie ihre Mutter zu sagen pflegte, die niemals erröteten, weder anmutig noch anderweitig. (Ihre Mutter davon überzeugen zu wollen, dass das Christentum im Grunde bei den Italienern seinen Ursprung hatte und sie das dadurch zum genauen Gegenteil von Heiden machte, war nichts als eine Verschwendung von Zeit und Atemluft.)
Alexia lehnte es ab, sich für ihren vorlauten Magen zu entschuldigen und schenkte Lord Maccon einen trotzigen Blick. Ihr Magen war der Grund dafür, warum sie sich überhaupt davongestohlen hatte. Ihre Mama hatte ihr versichert, dass es auf dem Ball etwas zu essen geben würde. Und doch war alles, was man ihnen bei ihrer Ankunft angeboten hatte, eine Schüssel Bowle und etwas erbärmlich welke Brunnenkresse gewesen. Alexia, die nicht gerade jemand war, der seinen Magen die Oberhand gewinnen ließ, hatte kurzerhand beim Butler Tee bestellt und sich in die Bibliothek zurückgezogen. Da sie ohnehin jede Tanzveranstaltung damit verbrachte, sich abseits der Tanzfläche zu halten, damit nur keiner auf die Idee kam, sie zum Walzer aufzufordern, war Tee eine willkommene Alternative. Es war zwar unhöflich, bei den Bediensteten anderer Leute Getränke zu bestellen, doch wenn einem Sandwiches versprochen wurden und es nichts anderes als Brunnenkresse gab, musste man die Angelegenheit eben selbst in die Hand nehmen.
Professor Lyall, die gutherzige Seele, plapperte ohne an jemand Speziellen gerichtet weiter und tat so, als hätte er ihr Magenknurren nicht bemerkt. Obwohl er das natürlich hatte. Er hatte ein ausgezeichnetes Gehör. Das hatten sie alle.
Mit durch das Brilloskop völlig schiefem und verzerrtem Gesicht blickte er von seinen Untersuchungen auf. »Extremer Hunger würde erklären, warum der Vampir verzweifelt genug war, sich auf einem Ball an Miss Tarabotti vergreifen zu wollen, statt sich in die Armenviertel zu begeben, wie es die Klügeren unter ihnen tun, wenn sie in eine Notlage geraten.«
Alexia verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Er gehörte auch keinem Vampirstock an.«
Lord Maccon wölbte eine seiner schwarzen Augenbrauen, gab aber ansonsten vor, nicht beeindruckt zu sein. »Woher wollen Sie das denn wissen?«
Professor Lyall erklärte es für sie beide. »Ähnlich wie bei einem Bienenstock würde es eine Vampirkönigin niemals zulassen, dass einer ihrer Brut in einen so ausgehungerten Zustand gerät. Wir müssen es hier mit einem Schwärmer zu tun haben, einem, der keinerlei Verbindungen zum örtlichen Vampirstock hat.«
Alexia stand auf, wobei Lord Maccon erkannte, dass sie ihren Ohnmachtsanfall so geschickt eingerichtet hatte, dass sie bequem auf einem heruntergefallenen Sitzkissen zu liegen gekommen war. Er grinste und verbarg das schnell hinter einem finsteren Stirnrunzeln, als sie ihn argwöhnisch ansah.
»Meine Erkenntnis fußt auf andere Hinweise.« Sie deutete auf die Kleidung des Vampirs. »Schlecht gebundene Halsbinde und ein billiges Hemd. Kein Vampirstock, der etwas auf sich hält, würde eine Larve so für einen öffentlichen Auftritt aus dem Haus lassen. Es überrascht mich, dass ihm nicht schon an der Türschwelle der Zutritt verwehrt wurde. Dem Lakai eines Duchess sollte eine solche Halsbinde schon vor der Empfangsreihe auffallen, sodass er den Träger notfalls gewaltsam entfernen lässt. Ich nehme an, gutes Personal ist schwer zu kriegen, da die Besten heutzutage alle Drohnen werden. Aber so ein Hemd …!«
Der Earl of Woolsey funkelte sie wütend an. »Billige Kleidung ist keine Entschuldigung dafür, einen Mann zu töten.«
»Hm, das sagen Sie.« Abschätzend musterte sie Lord Maccons perfekt sitzende Hemdbrust und die ausgezeichnet gebundene Halsbinde. Sein dunkles Haar war ein wenig zu lang und zottig, um de mode zu sein, und sein Gesicht war nicht richtig glatt rasiert, doch er hatte genug stolze Ausstrahlung, um trotz seiner unterschichtenhaften Rauheit nicht schmuddelig zu wirken. Sie war überzeugt davon, dass er das Binden der mit schwarzem und silbernem Paisley gemusterten Halsbinde nur mit stummem Grimm über sich ergehen ließ. Vermutlich zog er es vor, zu Hause mit nackter Brust herumzulaufen.
Diese Vorstellung ließ sie seltsam erschauern. Es musste einem sehr viel Mühe abverlangen, dass ein Mann wie er ordentlich gepflegt aussah. Ganz zu schweigen von der Kleidung. Er war größer als die meisten. Sein Kammerdiener war offenbar ein besonders toleranter Claviger, was ihr eine gewisse Anerkennung abverlangte.
Normalerweise war Lord Maccon recht geduldig. Wie die meisten seiner Art hatte er gelernt, sich in feiner Gesellschaft entsprechend zu betragen. Doch Miss Tarabotti schien stets seine schlimmsten tierischen Instinkte zum Vorschein zu locken. »Wechseln Sie nicht ständig das Thema!«, blaffte er, wobei er sich unter ihrem abschätzend musternden Blick wand. »Erzählen Sie mir, was geschehen ist.« Er setzte sein BUR-Gesicht auf und zog eine kleine Metallröhre, einen Stift und ein Glas mit klarer Flüssigkeit hervor. Mit einem kleinen kurbelartigen Gerät entrollte er die Röhre, klappte den Deckel des Glases auf und tauchte den Stift in die Flüssigkeit. Es zischte bedrohlich.
Sein herrischer Tonfall machte Alexia wütend. »Erteilen Sie mir keine Befehle in diesem Tonfall, Sie …« Sie suchte nach einem besonders beleidigenden Wort. »… Welpe! Ich bin schließlich niemand aus Ihrem Rudel.«
Lord Conall Maccon, der Earl of Woolsey, war Alpha der örtlichen Werwölfe und verfügte dadurch über eine breite Palette von wahrhaft teuflischen Methoden, um mit Miss Alexia Tarabotti fertig zu werden. Anstatt also über ihre Beleidigung wütend zu werden (Welpe, also wirklich!), griff er zu seiner wirkungsvollsten Angriffswaffe, dem Ergebnis jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung mit mehr als einer Alpha-Wölfin. Er war als Schotte geboren und dadurch bestens gerüstet, mit willensstarken weiblichen Wesen umzugehen. »Hören Sie auf, Wortspiele mit mir zu treiben, Madam, oder ich gehe hinaus in diesen Ballsaal, suche Ihre Mutter und bringe sie her!«
Alexia rümpfte die Nase. »Na, das habe ich gern! Sie spielen ja nicht gerade fair. Wie unnötig grob von Ihnen«, tadelte sie. Ihre Mutter wusste nicht, dass Alexia eine Außernatürliche war. Mrs Loontwill – so hieß sie, seit sie wieder geheiratet hatte – tendierte in jeder Hinsicht ein wenig zu sehr zur Leichtfertigkeit. Sie trug gerne Gelb und neigte zu hysterischen Anfällen. Ihre Mutter mit einem toten Vampir und der wahren Identität ihrer Tochter zu kombinieren, war das perfekte Rezept für eine Katastrophe auf allen möglichen Ebenen.
Die Tatsache, dass Alexia außernatürlich war, hatte ihr im Alter von sechs Jahren ein netter Gentleman vom öffentlichen Dienst mit silberweißem Haar und einem silbernen Gehstock erklärt, ein Werwolf-Experte. Zusammen mit ihrem dunklen Haar und der markanten Nase war die Außernatürlichkeit etwas, wofür Miss Tarabotti ihrem verblichenen italienischen Vater zu danken hatte.
Miss Alexia, sechs Jahre alt, hatte höflich zu dem genickt, was der nette silberhaarige Gentleman ihr gesagt hatte. Danach hatte sie Unmengen griechischer Philosophie gelesen und sich mit Themen wie Vernunft, Logik und Ethik auseinandergesetzt. Wenn sie keine Seele hatte, dann hatte sie auch keine innere Moral, weshalb sie der Meinung war, es wäre am besten, eine Art Alternative zu entwickeln. Ihre Mama hielt sie für einen Blaustrumpf, was seelenlos genug war, soweit es Mrs Loontwill betraf, und sie war schrecklich betrübt darüber, dass ihre älteste Tochter einen so starken Hang zu Bibliotheken entwickelte. Es wäre zu ärgerlich, sich jetzt mit ihr auseinandersetzen zu müssen.
Lord Maccon schritt entschlossen auf die Tür zu, in der eindeutigen Absicht, Mrs Loontwill zu holen.
Alexia gab nach. »Oh, also schön!« Mit einem Rascheln ihrer grünen Röcke ließ sie sich auf einem mit pfirsichfarbenem Brokat bezogenen Chesterfield-Sofa in der Nähe des Fensters nieder. Ebenso amüsiert wie verärgert stellte der Earl fest, dass sie es geschafft hatte, ihr Ohnmachtskissen aufzuheben und wieder auf die Couch zu legen, ohne dass er irgendeine schnelle Bewegung bemerkt hätte.
»Ich ging in die Bibliothek, um in Ruhe einen Tee zu trinken. Mir wurde versprochen, dass es auf dem Ball etwas zu essen geben würde. Für den Fall, dass Sie es noch nicht bemerkt haben, es scheint nichts Essbares im Haus zu sein.«
Lord Maccon, der eine beachtliche Menge an Nahrung benötigte, und das meiste von der eiweißhaltigen Sorte, hatte es bemerkt. »Der Duke of Snodgrove ist dafür berüchtigt, sehr zurückhaltend zu sein hinsichtlich zusätzlicher Ausgaben für die Bälle seiner Frau. Lebensmittel standen vermutlich nicht auf der Liste akzeptabler Darreichungen.« Er seufzte. »Dem Mann gehört halb Berkshire, und er bietet seinen Gästen nicht einmal ein anständiges Sandwich.«
Miss Tarabotti gestikulierte mitfühlend mit beiden Händen. »Genau meine Rede! Dann werden Sie also verstehen, dass ich mir mein eigenes Mahl bestellte. Darf man von mir verlangen, dass ich verhungere?«
Der Earl musterte ihre üppigen Kurven wenig höflich von oben bis unten, stellte fest, dass Miss Tarabotti an genau den richtigen Stellen gut gepolstert war, und entschied, sich nicht von ihr dazu verleiten zu lassen, Mitleid für sie zu empfinden. Er behielt seine finstere Miene bei. »Ich vermute, das ist genau das, was der Vampir dachte, als er Sie ohne Anstandsdame antraf. Eine unverheiratete Frau allein in einem Zimmer, und das in diesem aufgeklärten Zeitalter! Wäre Vollmond, hätte sogar ich Sie angegriffen!«
Alexia musterte ihn scharf und griff zu ihrem Messingschirm. »Mein lieber Sir, ich würde gern miterleben, wie Sie das versuchen!«
Als Alpha war Lord Maccon ein wenig unvorbereitet auf solch kühne Widerworte, sogar angesichts seiner schottischen Herkunft. Überrascht blinzelnd sah er sie einen Sekundenbruchteil an, dann nahm er seinen verbalen Angriff wieder auf. »Ihnen ist doch hoffentlich bewusst, dass die modernen gesellschaftlichen Gepflogenheiten aus einem guten Grund existieren?«
»Ich war hungrig, da sollten Zugeständnisse gemacht werden«, entgegnete Alexia, als wäre die Angelegenheit damit erledigt. Sie konnte nicht verstehen, warum er darauf herumhackte.
Inzwischen fischte Professor Lyall, von den beiden unbeachtet, geschäftig in seiner Westentasche nach etwas. Schließlich zog er ein leicht ramponiertes Schinkensandwich mit Essiggurke hervor, das in ein Stück braunes Papier gewickelt war. Ganz Kavalier bot er es Miss Tarabotti an.
Unter normalen Umständen hätte der schändliche Zustand des Sandwichs Alexia abgestoßen, doch es war so nett gemeint und wurde ihr mit solcher Bescheidenheit gereicht, dass sie einfach nicht anders konnte, als anzunehmen. Tatsächlich war es ziemlich lecker.
»Das ist köstlich!«, stellte sie überrascht fest.
Professor Lyall grinste. »Ich habe immer welche zur Hand, für den Fall, dass seine Lordschaft besonders reizbar wird. Solche Gaben halten die Bestie meistens unter Kontrolle.« Er runzelte die Stirn und fügte noch eine Einschränkung hinzu. »Außer bei Vollmond, natürlich. Wäre ein schönes Schinkensandwich mit Gurke doch nur alles, was dann nötig ist.«
Interessiert richtete sich Miss Tarabotti auf. »Was genau machen Sie denn bei Vollmond?«
Lord Maccon wusste sehr wohl, dass Miss Tarabotti absichtlich versuchte, vom Thema abzulenken. Bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit getrieben verlegte er sich darauf, sie beim Vornamen zu nennen. »Alexia!« Es war ein langes, vielsilbiges, lang gezogenes Knurren.
Sie wedelte mit dem Sandwich in seine Richtung. »Äh, wollen Sie die Hälfte davon abhaben, Mylord?«
Seine Miene wurde noch finsterer, falls so etwas überhaupt möglich war.
Professor Lyall schob das Brilloskop hoch auf die Krempe seines Zylinders, wo es wie ein fremdartiges zweites Paar mechanischer Augen aussah, und sprang in die Bresche. »Miss Tarabotti, ich glaube nicht, dass Sie ganz begreifen, wie heikel Ihre Lage ist. Sollte es uns nicht gelingen, überzeugende Beweise für eine Notwehrsituation vorzulegen, könnten Sie wegen Mordes angeklagt werden.«
Alexia schluckte den letzten Bissen so schnell hinunter, dass sie sich verschluckte und husten musste. »Was?«
Lord Maccon war noch relativ neu in der Gegend von London. Gesellschaftlich noch völlig unbekannt hatte er den Alpha von Woolsey Castle herausgefordert und gewonnen. Selbst wenn er nicht in Wolfsgestalt auftrat, verursachte er den jungen Damen Herzklopfen, denn er strahlte eine gefällige Mischung aus Rätselhaftigkeit, Überlegenheit und Gefahr aus. Nachdem er von dem enteigneten ehemaligen Rudelführer dessen Posten bei BUR, seinen Adelsrang und Woolsey Castle erlangt hatte, mangelte es ihm nie an Dinner-Einladungen. Dadurch war für seinen mit dem Rudel geerbten Beta eine anstrengende Zeit angebrochen: Er musste stets einen protokollarischen Tanz aufführen und Lord Maccons zahlreiche gesellschaftliche Entgleisungen ausbügeln. Dessen unverblümte Direktheit schien bereits auf Professor Lyall abzufärben. Es war nicht seine Absicht gewesen, Miss Tarabotti zu schockieren, aber auf einmal wirkte sie äußerst kleinlaut.
»Ich saß einfach nur da«, erklärte Alexia, während sie das Sandwich beiseite legte, da ihr der Appetit vergangen war. »Er stürzte sich auf mich, völlig unprovoziert. Seine Fangzähne waren gefletscht. Ich bin mir sicher, wäre ich eine normale Tageslicht-Frau gewesen, hätte er mich völlig ausgesaugt. Ich musste mich einfach verteidigen.«
Professor Lyall nickte. Ein Vampir hatte in einem Zustand extremen Hungers nur zwei gesellschaftlich akzeptable Möglichkeiten: von verschiedenen bereitwilligen Drohnen zu schlürfen, die zu ihm oder seinem Haus gehörten, oder unten am Hafen bei Bluthuren zu bezahlen. Schließlich schrieb man das neunzehnte Jahrhundert, und man konnte nicht einfach hergehen und ungebeten und unangekündigt jemanden beißen! Sogar Werwölfe, die sich bei Vollmond nicht beherrschen konnten, stellten sicher, dass sie genug Claviger um sich hatten, die sie in solchen Nächten einsperrten. Er selbst hatte drei dieser Schlüsselträger, und es waren fünf von ihnen nötig, um Lord Maccon unter Kontrolle zu halten.
»Glauben Sie, dass er unter Zwang in diesen Zustand geriet?«, fragte der Professor.
»Sie meinen, dass er eingesperrt wurde, bis er dicht vor dem Verhungern stand und nicht mehr Herr seiner Sinne war?« Lord Maccon dachte über diese Theorie nach.
Professor Lyall klappte sein Brilloskop wieder von der Krempe und besah sich die Handgelenke und den Hals des toten Mannes. »Keine Anzeichen für Gefangenschaft oder Folter, aber bei einem Vampir ist das schwer zu sagen. Sogar in einem Zustand des Blutmangels würden die meisten oberflächlichen Verletzungen in …« Er verstummte kurz, schnappte sich Lord Maccons Metallrolle und den Stift, tauchte die Spitze in die klare, zischende Flüssigkeit und machte ein paar schnelle Berechnungen. »… in etwas über einer Stunde verheilen.« Die Berechnungen blieben eingeätzt auf dem Metall zurück.
»Und was dann? Ist er entkommen oder wurde er absichtlich freigelassen?«, fragte Lord Maccon.
»Auf mich wirkte er geistig völlig normal«, warf Alexia ein. »Abgesehen von dem Angriff, natürlich. Er war in der Lage, eine anständige Unterhaltung zu führen. Er hat sogar versucht, mir zu schmeicheln. Muss noch ein recht junger Vampir gewesen sein. Und …« Sie machte eine theatralische Pause und sagte dann mit Grabesstimme: »Er hatte ein Fangzahn-Lispeln.«
Professor Lyall sah schockiert aus und blinzelte sie durch die asymmetrischen Linsen mit großen Augen an. Unter Vampiren galt Lispeln als der Gipfel vulgären Benehmens.
Miss Tarabotti fuhr fort. »Es war, als wäre er nie in Vampir-Etikette unterrichtet worden. Überhaupt keine gesellschaftliche Klasse. Er wirkte auf mich wie ein Bauernlümmel.« Das war ein Wort, von dem sie nie geglaubt hätte, einmal einen Vampir damit zu bezeichnen.
Lyall nahm das Brilloskop ab und steckte es mit einer Aura von Endgültigkeit zurück in das kleine Etui. Ernst sah er seinen Alpha an. »Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr, Mylord?«
Lord Maccon blickte nicht mehr finster drein. Stattdessen sah er nun richtiggehend grimmig aus. Alexia fand, dass ihm das besser stand, denn es verlieh seinen gelbbraunen Augen ein entschlossenes Funkeln, und sein Mund mit den zuvor missmutig herabgezogenen Mundwinkeln wurde zu einem geraden Strich. Sie überlegte, wie er wohl mit einem richtigen, echten Lächeln aussah. Dann sagte sie sich recht bestimmt, dass es vermutlich am besten war, das nicht herauszufinden.
»Das bedeutet«, sagte der Gegenstand ihrer Überlegungen, »dass eine Vampirkönigin absichtlich Metamorphosen außerhalb der BUR-Vorschriften durchführt.«
»Könnte das nur ein Einzelfall sein?« Professor Lyall zog einen gefalteten weißen Stoff aus der Westentasche. Als er ihn ausschüttelte, zeigte sich, dass es ein großes Laken aus feiner Seide war. Alexia fand die Anzahl von Dingen, die er in seiner Weste verstauen konnte, mittlerweile für ziemlich beeindruckend.
»Das hier könnte der Anfang von etwas Weitreichenderem sein«, meinte Lord Maccon. »Wir sollten besser ins Büro zurückkehren. Man wird die örtlichen Vampire befragen müssen. Die Königinnen werden darüber nicht gerade erfreut sein. Neben allem anderen ist dieser Vorfall höchst peinlich für sie.«
Miss Tarabotti war derselben Meinung. »Insbesondere wenn sie von der unstandesgemäßen Hemdwahl erfahren.«
Die beiden Gentlemen wickelten die Leiche des Vampirs in das Seidenlaken, und Professor Lyall warf sie sich mühelos über die Schulter. Sogar in ihrer menschlichen Gestalt waren Werwölfe um einiges stärker als Tageslichtler.
Lord Maccon ließ den Blick seiner goldbraunen Augen auf Alexia ruhen. Sie saß steif auf dem Chesterfield-Sofa, eine behandschuhte Hand ruhte auf dem Elfenbeingriff eines lächerlich aussehenden Parasols. Nachdenklich hatte sie die brauen Augen zusammengekniffen. Er hätte hundert Pfund dafür gegeben, zu wissen, was sie in diesem Augenblick dachte. Allerdings war er auch sicher, dass sie ihm das haargenau sagen würde, wenn er sie danach fragte, doch er weigerte sich, ihr diese Genugtuung zu geben. Stattdessen erklärte er: »Wir werden versuchen, Ihren Namen aus der Sache herauszuhalten, Miss Tarabotti. Mein Bericht wird besagen, dass es nur ein normales Mädchen war, das noch einmal Glück hatte und einem ungebührlichen Angriff entkommen ist. Niemand braucht zu wissen, dass eine Außernatürliche beteiligt war.«
Nun war Alexia an der Reihe, finster zu funkeln. »Warum macht ihr Kerle von BUR das immer?«
Beide Männer sahen sie verwirrt an.
»Was machen, Miss Tarabotti?«, fragte der Professor.
»Mich so abzufertigen, als wäre ich ein kleines Kind. Ist Ihnen denn nicht klar, wie nützlich ich für Sie sein könnte?«
Lord Maccon stieß ein ächzendes Schnauben aus. »Sie meinen wohl, wir sollten Sie ganz offiziell herumspazieren und in Schwierigkeiten geraten lassen, anstatt dass Sie uns nur einfach so ständig auf die Nerven gehen?«
Alexia versuchte, sich nicht gekränkt zu fühlen. »BUR beschäftigt auch Frauen, und wie ich hörte, haben Sie oben im Norden sogar einen Außernatürlichen auf der Gehaltsliste, zur Gespensterkontrolle und für Exorzismen.«
Lord Maccons karamellfarbene Augen verengten sich zu Schlitzen. »Von wem haben Sie das gehört?«
Miss Tarabotti zog die Augenbrauen hoch. Als ob sie jemals verraten würde, wer ihr im Vertrauen derartige Informationen gab!
Der Earl verstand ihren Blick. »Nun gut, vergessen Sie die Frage.«
»Das werde ich nicht«, entgegnete Alexia steif.
»Wir haben beides bei BUR«, gab Professor Lyall zu, der immer noch die Leiche über der Schulter trug.
Lord Maccon wollte ihm den Ellbogen in die Rippen stoßen, doch Lyall trat mit einer lässigen Anmut, die von viel Übung zeugte, aus seiner Reichweite.
»Was wir aber nicht haben, sind weibliche Außernatürliche, und ganz gewiss keine vornehmen Damen«, schnauzte Lord Maccon. »Alle Frauen, die bei BUR beschäftigt sind, kommen aus anständigen Verhältnissen der Arbeiterklasse.«
»Sie sind einfach nur immer noch sauer wegen dem Igel«, murmelte Miss Tarabotti, doch sie nahm seine Worte auch mit einem Kopfnicken zur Kenntnis. Sie hatte diese Unterhaltung schon einmal geführt, mit Lord Maccons Vorgesetztem bei BUR, um genau zu sein. Einem Mann, der für sie immer noch der nette silberhaarige Gentleman war. Die bloße Vorstellung, dass eine Dame aus gutem Hause wie sie tatsächlich arbeiten wollte, war schlichtweg zu schockierend. »Mein liebes Mädchen«, hatte er gesagt. »Was, wenn Ihre Mutter das herausfindet?«
»Ist BUR denn nicht angeblich diskret? Ich könnte diskret sein.«
Miss Tarabotti konnte einfach nicht anders, als es noch einmal zu versuchen. Professor Lyall zumindest mochte sie ein wenig. Vielleicht würde er ein gutes Wort für sie einlegen.
Lord Maccon lachte auf. »Sie sind ungefähr so diskret wie ein Vorschlaghammer.« Gleich darauf verfluchte er sich im Stillen, denn mit einem Mal sah sie verloren aus. Zwar verbarg sie es schnell wieder, doch seine Entgegnung hatte sie eindeutig getroffen.
Sein Beta berührte ihn mit der freien Hand am Arm. »Wirklich, Sir. Manieren.«
Der Earl räusperte sich und wirkte zerknirscht. »Das sollte keine Beleidigung sein, Miss Tarabotti.« Der singende schottische Tonfall lag wieder in seiner Stimme.
Alexia nickte, ohne aufzublicken, und zupfte an einem der Stiefmütterchen auf ihrem Sonnenschirm herum. »Es ist nur so, Gentlemen«, und als sie die dunklen Augen hob, hatten sie einen leichten feuchten Schimmer, »ich würde so gern etwas Nützliches tun.«
Nachdem sie sich höflich – zumindest traf das auf Professor Lyall zu – von der jungen Dame verabschiedet hatten, wartete Lord Maccon, bis er und der Professor sich draußen im Korridor befanden, bevor er die Frage stellte, die ihn so drängend beschäftigte. »Um Himmels willen, Randolph, warum heiratet sie denn nicht einfach?« Sein Tonfall war voller Frustration.
Randolph Lyall sah seinen Alpha mit aufrichtiger Verwirrung an. Der Earl war normalerweise ein sehr aufmerksamer Mann, trotz all seiner lärmenden Art und schottischen Brummigkeit. »Sie ist ein wenig alt, Sir.«
»Papperlapapp«, sagte Lord Maccon. »Sie ist nicht mal ein Vierteljahrhundert alt.«
»Und sie ist sehr …«, der Professor suchte nach einer vornehmen Art, es auszudrücken, »… resolut.«
»Pah!« Der Adlige machte eine wegwerfende Handbewegung mit seiner großen Pranke. »Hat einfach nur ein Quäntchen mehr Rückgrat als die meisten Frauen in diesem Jahrhundert. Da muss es genug anspruchsvolle Gentlemen geben, die erkennen, was sie wert ist.«
Professor Lyall hatte einen gut entwickelten Sinn für Selbsterhaltung und das sichere Gefühl, dass ihm, sollte er etwas Unbedachtes über das Erscheinungsbild der Lady äußern, der Kopf abgebissen wurde. Er und der Rest der feinen Gesellschaft hielten Miss Tarabottis Haut für ein wenig zu dunkel und ihre Nase für etwas zu markant, doch es war fraglich, ob Lord Maccon das ebenso empfand. Conall Maccon war der vierte Earl of Woolsey, dem Lyall als Beta diente, und seit er bei ihnen allen hereingeschneit war, waren kaum zwanzig Jahre vergangen; die blutige Erinnerung daran war noch frisch und kein Werwolf schon bereit, laut zu fragen, warum sich Conall das Londoner Revier überhaupt aufgebürdet hatte, nicht einmal Professor Lyall. Der Earl war ein rätselhafter Mann, und sein Geschmack hinsichtlich Frauen war gleichermaßen verwirrender. Demnach hätten dem Alpha römische Nasen, gebräunte Haut und ein resolutes Wesen tatsächlich gefallen können. Also sagte Professor Lyall nur: »Vielleicht ist es der italienische Nachname, Sir, warum sie noch unverheiratet ist.«
»Mhm«, brummte Lord Maccon zustimmend. »Das wird es sein.« Er klang nicht überzeugt.
Die beiden Werwölfe traten aus dem Stadthaus des Duke hinaus in die schwarze Londoner Nacht, der eine mit der Leiche eines Vampirs auf der Schulter, der andere mit einem verwirrten Ausdruck auf dem Gesicht.
2
Eine unerwartete Einladung
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























