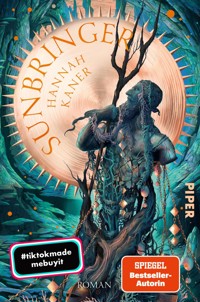14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zeitgenössisch und episch: Die neue fesselnde High Fantasy-Reihe mit modernem Twist Eine Frau, die Götter tötet, ein brotbackender Ritter, und ein adeliges Mädchen mit einem Gott im Gepäck. Die unaufhaltsame Kyssen hat sich das Töten von Göttern zu ihrem Beruf gemacht. Doch eines Tages trifft sie auf einen Gott, den sie nicht töten kann: Skedi, der Gott der Notlügen. Er ist an das junge adelige Mädchen Inara gebunden, das ohne ihn sterben würde. Gemeinsam müssen sie nach Blenraden reisen – die letzte Stadt, in der es noch wilde Götter gibt. Der ehemalige Ritter Elogast hat dasselbe Ziel, aber auch ein großes Geheimnis: In seinen Händen liegt das Schicksal des Landes. Nichts ahnend, was im Herzen von Blenraden lauert, tritt die ungleiche Gruppe ihre Reise an … #1 Sunday-Times-Bestseller und TikTok-Sensation "Düster, gewaltig und unglaublich fesselnd." – The Fantasy Hive "Kaners Debüt hat alles, was Fantasy Fans sich wünschen und noch mehr: Es ist voll von Blutbädern, Dämonen und Magie, während zeitgenössische Werte und Inklusion zelebriert werden." – Financial Times "Ein wundervolles, gewaltiges und explodierendes Debüt, welches im Kern eine klassische Quest mit einem ungleichen Trio trägt." – Daily Mail Band 1: Godkiller Band 2: Sunbringer Band 3: Faithbreaker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Godkiller« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem Englischen von Wolfgang Thon
© Hannah Kaner 2023
Titel der englischen Originalausgabe:
»Godkiller«, HarperVoyager, London 2023
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Wiebke Bach
Illustrationen: Tom Roberts
Karte: Tom Roberts
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach einem Entwurf von Holly Macdonald © HarperCollinsPublishers
Coverillustration: Tom Roberts
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Karte
PROLOG
Fünfzehn Jahre zuvor
Flugblatt
KAPITEL 1
Kyssen
KAPITEL 2
Inara
KAPITEL 3
Elogast
KAPITEL 4
Skediceth
KAPITEL 5
Elogast
KAPITEL 6
Kyssen
KAPITEL 7
Inara
KAPITEL 8
Elogast
KAPITEL 9
Kyssen
KAPITEL 10
Inara
KAPITEL 11
Elogast
KAPITEL 12
Kyssen
KAPITEL 13
Skediceth
KAPITEL 14
Kyssen
KAPITEL 15
Elogast
KAPITEL 16
Inara
KAPITEL 17
Elogast
KAPITEL 18
Inara
KAPITEL 19
Skediceth
KAPITEL 20
Elogast
KAPITEL 21
Inara
KAPITEL 22
Kyssen
KAPITEL 23
Inara
KAPITEL 24
Elogast
KAPITEL 25
Inara
KAPITEL 26
Elogast
KAPITEL 27
Kyssen
KAPITEL 28
Skediceth
KAPITEL 29
Elogast
KAPITEL 30
Kyssen
KAPITEL 31
Elogast
KAPITEL 32
Inara
KAPITEL 33
Kyssen
KAPITEL 34
Elogast
KAPITEL 35
Kyssen
KAPITEL 36
Inara
KAPITEL 37
Kyssen
Danksagungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meinen Vater, der jedes Wort liest
PROLOG
Fünfzehn Jahre zuvor
Ihr Vater verliebte sich in einen Meeresgott.
Der Name des Gottes war Osidisen, und ihre Eltern gaben Kyssen und ihren Brüdern Namen, um seine Gunst zu ehren: Tidean – »Auf den Gezeiten«; Lunsen – »Mond auf dem Wasser«; Mellsenro – »Die rollenden Felsen«. Und schließlich Kyssenna – »Geboren aus der Liebe zum Meer«. Osidisen füllte ihre Netze mit Fischen, lehrte sie, wann sie einem Sturm trotzen und wann sie sich verstecken sollten, und geleitete sie jeden Tag mit ihrem Fang sicher nach Hause. Kyssen und ihre Familie wuchsen in der Gunst des Meeres auf.
Doch der Meeresgott brachte den Ländern von Talicia kein Glück. Schließlich wurden die Dörfer auf den Hügeln von der Feuergottheit Hseth und ihren Versprechungen von Reichtum verführt.
Jeder wollte den Reichtum der Anhänger des Feuers. In Hseths Namen verbrannten die Talician ihre Boote und rodeten ihre Wälder, um Waffen zu schmieden, Messing zu erhitzen und große Glocken zu gießen, deren Läuten von den Meeresklippen bis zu den Bergkämmen drang. Die Gewässer Osidisens leerten sich, und Rauch stieg über dem Land auf. Bald verbreiteten sich andere, dunklere Geschichten von Gewalt von Stadt zu Dorf: von Opfern, Jagden und Säuberungen im Namen der Feuergottheit, von Feinden und alten Familien, die zum Vergnügen der Feuergottheit verbrannt wurden.
Eines Nachts, in der Nacht nach dem zwölften Geburtstag von Mellsenro, an dem sein Name auf seine Finger tätowiert wurde, erwachte die elfjährige Kyssen durch einen seltsam dichten und süßlich riechenden Rauch. Er kratzte in ihrer Kehle.
Sie kam zu sich und merkte, dass sie von Männern getragen wurde, die sich Tücher vor den Mund gebunden hatten und deren Gesichter mit Kohlenstaub beschmiert waren und in deren Haaren Glöckchen wie kleine Lampen leuchteten. Kyssen rührte keinen Muskel, und ihre Brust war schwer, als lasteten noch Träume auf ihr. Den süßen Rauch erkannte sie: Es war eine Schlafmedizin, die durch das Verbrennen von Slesssamen hergestellt wurde, zusammen mit anderen Aromen, die sie nicht kannte. Unterhalb ihres Hauses peitschte das Meer gegen die Klippen. Osidisen war wütend.
Sie versuchte zu sprechen, aber ihr Mund wollte nicht funktionieren, ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Ihr Kopf kippte zur Seite, und sie sah auch Mell, dessen frisch tätowierte Hand über den Boden schleifte.
»Mmmelll«, versuchte Kyssen es erneut, aber ihr Bruder rührte sich nicht. Der Drogenrauch drang durch die Fensterläden, sogar durch die Wände. Er hing in der Luft.
»Ruhig«, sagte einer der Männer, die sie festhielten, und schüttelte sie. Sie kannte diese Stimme, diese schlammgrünen Augen.
»N…Naro?«, fragte Kyssenna. Ihre Stimme war jetzt ein wenig kräftiger. Draußen donnerten die Wellen, und der Rauch wirbelte auf, als Seewind durch die Ritzen der Flechtwerkwände drang. Sie spürte den kühlen Biss salziger Luft auf ihrem Gesicht, auf ihren Lippen. Ihr Kopf wurde ein wenig klarer. Naro musterte sie, Panik in seinen Augen.
»Ihr sagtet, sie würden noch nicht aufwachen«, nuschelte er durch seine Maske.
»Mach schnell!« Die andere Stimme erkannte sie auch. Es war Mitt, Naros Schwager. Die Masken schützten sie vor dem Rauch. »Beeilung!«
Sie trugen sie tiefer in das Haus hinein, bis zur Feuerstelle in der Mitte des Hauses. »Was machst du da?«, fragte Kyssen müde, aber mit klarer Stimme. Ihr Körper rührte sich immer noch nicht.
Sie erreichten die Feuerstelle, einen runden Stein unter dem Strohdach, das sich zum Himmel hin öffnete, damit der Rauch abziehen konnte. Um die Glut des abendlichen Feuers war ein verschlungener Käfig aufgebaut, der in Form einer Glocke aus Treibholz und Metall geschmiedet worden war. Ihre Eltern waren bereits von außen an den Gittern festgebunden worden. Jetzt wurden auch ihre Brüder daran gefesselt: an Knöcheln, Armen, Hals. Opfergaben. Kyssen war die letzte.
Naro und Mitt drückten sie grob gegen die Gitterstäbe neben ihrem Vater. Der Seewind fegte durch das Rauchloch im Dach und pfiff um die Balken. Die Fensterläden klapperten, und das Haus erbebte unter dem Brausen des wütenden Wassers.
»Naro, hör auf!«, sagte Kyssen. Sie klang noch kräftiger. Der Slessrauch war fast weggeweht, aber er fesselte noch immer ihre Glieder. »Warum tust du das?«
Naro verdrehte ihre Beine, um sie unten am Käfig festzubinden, während Mitt ihre Hände an die Gitterstäbe fesselte. Lunsen weinte und hatte Schluckauf vor Angst. Sie hatte Mell aus den Augen verloren. Kyssen fand die Kraft, sich zu wehren, als sie sie an das Metall fesselten, doch sie waren größer und stärker als sie. Draußen läuteten die Glocken, deren Klang durch den aufkommenden Wind zerrissen wurde. Der Klang hätte von Tausenden Glocken stammen können, obwohl das Dorf kaum hundert Seelen zählte. All ihre Nachbarn mussten da draußen sein. Sie hatten das hier gemeinsam geplant, um die vom Meeresgott bevorzugte Familie zu fangen. Kyssen roch heißes Pech in der Nähe. Der Schrecken kroch ihr in die Kehle.
»Es tut uns nicht leid, Liln«, erklärte Mitt. Wie konnte er es wagen, sie »Kleine« zu nennen? So etwas durften Onkel tun, Freunde. Er war kein Freund. Er war ein Verräter. »Das hier muss sein.«
Kyssen nahm alle Kraft zusammen und schnappte mit ihren scharfen Zähnen nach seiner Hand. Er sprang weg und umklammerte seine Daumenballen, wo sie ihn erwischt hatte.
»Lass sie!«, schnauzte er. »Es ist Zeit. Sie werden nicht auf uns warten.«
Sie rannten weg. Kyssen zitterte. Sie spuckte Mitts Blut aus und versuchte zu atmen, wand sich in den Stricken, um den ihr nächsten aus der Familie zu finden. »Papa.« Er war nicht weit von ihr weg. »Papa!«
Bern, ihr Vater, atmete mühsam. Sein Mund war aufgerissen und blutig, sein Gesicht zerschlagen. Sie mussten ihn in seinem von Drogen betäubten Schlaf verprügelt haben. Dieser zerstörte Mund hatte den Gott des Meeres geküsst, aber jetzt war mit Kohle das glockenförmige Symbol von Hseth auf seine Stirn geschmiert.
Die Luft verdichtete sich wieder mit Rauch, diesmal aber nicht mit süßem Rauch der Droge, sondern er war bitter und klebrig, stieg heiß und schwarz aus dem Boden auf. Ihr Dorf hatte das Gras unter ihren Stelzenfundamenten angezündet.
Kyssen zerrte an ihren Handgelenken, an ihren Beinen. »Papa!«, schrie sie. Sie hatten ihren Hals nicht gefesselt, als sie versucht hatte, zu beißen. Sie krümmte sich, zerrte ihren Arm in seltsame Verrenkungen, und die Knochen knackten, als sie ihren Hals zu ihrer nächstliegenden Hand reckte. Da. Sie konnte sie erreichen. Sie schlug ihre Zähne in das Seil, nagte und zerrte an dem Knoten. Es war Schiffstau, das nicht ausfransen sollte, aber sie wollte nicht sterben.
Tidean war ebenfalls wach. »Ihr dreckigen Ausgeburten!«, schrie er, kämpfte gegen seine Fesseln an und würgte, als sie sich an seiner Kehle zusammenzogen. Er hustete in den Rauch. »Ihr feigen Verräter!« Seine Stimme war rau.
Die Hitze wurde stärker. Kyssen spürte sie schon unter ihren Fußsohlen.
»Bleibt ruhig«, murmelte ihre Mutter mit vom Rauch veränderter Stimme. »Seid ruhig, meine Lieben. Osidisen wird uns retten. Ich verspreche es.«
Sie konnten die Flammen noch nicht sehen, aber die Luft waberte. Der Seewind von Osidisen drängte sich immer noch ins Innere, und Rauch und Luft tanzten zusammen wie Öl und Wasser. Kyssens Mund, ihre Augen, ihre Nase trockneten aus. Sie grub ihre Zähne mit neuer Kraft in das Seil.
»Ihr alle werdet mir das büßen!« Tidean schrie sein Versprechen lauter heraus als seine Mutter, aber er war zu fest gebunden, fester als Kyssenna. Sein wildes Sträuben und Strampeln nützte nichts. Der Boden riss bereits an einigen Stellen. Helles Licht drang durch die Spalten in dem Fundament. Die Wände schwärzten sich. Dann flog Glut empor, ein Funke, eine Stichflamme, die hölzerne Türöffnung fing Feuer, schleuderte Funken in Tideans Augen. Er schrie und strampelte.
»Atme tief ein, mein Sohn«, sagte seine Mutter. »Es ist alles gut, Osidisen wird kommen.« Sie log, sie log, um ihren Tod zu erleichtern, sie belog sich selbst. Osidisen war ein Wassergott; er würde nicht so weit über das Ufer hinaustreten, nicht einmal für sie, so wie kein Feuergott es je wagen würde, im Meer zu schwimmen. Götter konnten sie jetzt nicht mehr retten.
Das Tau scheuerte das zarte Fleisch zwischen Kyssens Zähnen auf, Blut floss zäh und heiß über ihre Zunge. Sie knurrte und biss fester zu, zerrte an ihren Fesseln. Schmerz durchzuckte sie, ihre Zähne knirschten im Zahnfleisch, dann ein Schnappen. Das Tau! Das Tau war locker, ihr Eckzahn steckte noch darin und wurde ihr aus dem Mund gerissen.
Kyssen befreite mit einem Ruck ihr Handgelenk und riss an dem Tau um ihre andere Hand, ließ ihr salziges Blut über ihr Kinn auf den Stein darunter tropfen, wo es zischte und dampfte.
Die zweite Hand war auch frei! Jetzt die Füße. Sie riss sich die Finger an dem Tau blutig und knurrte vor Verzweiflung. Sie würde sie retten. Sie musste es schaffen. Ihr Atem war heiß, ihre Augen brannten, aber sie hörte nicht auf. Ihre Mutter hustete jetzt.
»Atmet tief ein, meine Kinder«, sagte sie. Kyssen konnte die Tränen in ihrer Stimme hören. Lunsen wimmerte jetzt; Tideans Wut ließ immer mehr nach. Mell hatte sich nicht einmal gerührt. »Lasst euch vom Rauch in den Schlaf tragen, und Osidisen wird euch holen.«
Kyssens Taue lösten sich, ihre Füße waren frei. Der Boden stand bereits in Flammen, und der Seewind vertrieb den Rauch, vereitelte damit die Chance, die sich ihre Mutter gewünscht hatte: einen schmerzlosen Tod.
»Papa.« Sie hatten ihren Papa fest an das Metall gebunden, das immer heißer wurde. Kyssen kletterte trotzdem zu ihm, ihre Hände brannten.
»Kyssenna«, murmelte Papa mit geschwollenen Lippen. Seine Augen waren offen. Sie leuchteten vor benommener Erleichterung. »Mein Mädchen, lauf.«
»Ich werde dich retten«, knurrte sie zwischen zwei Hustenanfällen. »Ich werde euch alle retten.«
Kyssen riss mit den Fingern an den festen Seemannsknoten; sie waren eng geknüpft, aber sie konnte sie lösen und ihren Papa Stück für Stück befreien. Ihre Augen brannten. Mell wachte endlich auf und schrie, als die Flammen den Rand der Feuerstelle erreichten und an seinen Fersen leckten. Gut, alle sind wach! Wenn sie wach waren, konnten sie laufen. Sie befreite die linke Hand ihres Vaters und machte sich an seinem Fuß zu schaffen, während er seine rechte Hand befreite. Sie verloren Zeit. Der Klang der Glocken draußen wurde lauter, dröhnender, das Läuten verschmolz zu einem einzigen Ton, lauter als das Feuer.
Die Flammen veränderten sich. Sie wanden sich umeinander, drehten sich in Spiralen die Wände hoch und stürzten dann in einer Säule aus Feuer zu Boden, und die Funken wirbelten wie Schnee. Ein krächzendes Lachen ertönte im Rauch, rau und voller Entzücken.
Das Feuer breitete sich aus und formte sich zu Röcken aus Licht und Glut. In ihnen wirbelte eine Frau mit ausgebreiteten Armen um ihre Achse. Hseth, die Göttin des Feuers. Ihr Haar funkelte in Gelb und Giftrot, und sie strahlte eine Hitze aus, die das Holz und die Balken knacken ließ und spaltete.
»Meeresgott!«, schrie sie, dann nannte sie seinen Namen. »Osidisen! Sieh, wie sie sich von dir abwandten und mir deine Liebsten schenken. Du kannst mir nichts anhaben, du schlaffer alter Wasserbock! Das Land gehört mir!«
Hseth würdigte weder Kyssen noch ihre Familie eines Blickes. Sie achtete nicht auf ihre Schreie. Sie durchbrach die Decke in einer Peitsche aus Flammen, und das Dach stürzte ein.
Kyssen blinzelte. Schwarze Hitze umgab sie. Dann Licht. Dann Schmerz. Der Käfig wurde von schweren Balken zertrümmert. Mells Schreie waren verstummt. Sie blinzelte noch einmal. Ihr Vater stand da, von seinen Fesseln befreit. Ihr Kopf schmerzte. Ihr Mund war voller Asche.
»Pa…!«, stieß sie hervor. Er riss die Trümmer von ihr weg, aber er konnte das verbogene Metall, das sich in ihren rechten Unterschenkel gebohrt und ihn unterhalb des Knies zerschmettert hatte, nicht hochheben. Sie war durch Fleisch und Knochen eingeklemmt. Sie würde sterben; sie las es in den Augen ihres Vaters.
»Es wird alles gut, Kyssenna«, log er, wie ihre Mutter, mit der sanften Stimme, die Osidisen bewunderte. Er strich ihr über das Haar, als wolle er sie in den Schlaf wiegen. »Sei tapfer, meine Liebe, meine Tochter.«
»Lauf, Papa!«, stammelte sie und unterdrückte ein Schluchzen vor Angst. »Bitte.«
»Nicht weinen, Kyssenna«, sagte er. »Es ist besser so.«
Schmerz. Blendender, grausamer Schmerz fuhr durch Kyssens Bein. Sie schrie, doch der Rauch erstickte das Geräusch in ihrer Kehle. Ihr Papa hielt orange glühendes Metall in seinen Händen, zischend vom Blut der beiden. Er hob es hoch.
»Ihr Bein für ihre Sicherheit, Osidisen!«, rief er. »Ich flehe dich an, rette sie von diesem Ort, als Gegenleistung für dies, ihr Fleisch, ihr Blut und ihre Knochen, die ich selbst gezeugt habe.«
Er senkte das Metall ein weiteres Mal und drehte es.
Kyssenna schrie wieder, der Schmerz verschlang sie schneller als das Feuer. Aber ihr Vater war noch nicht fertig. Alles wurde schwarz und weiß vor ihren Augen. Als sie wieder zu sich kam, zerrte ihr Vater sie aus den Trümmern, ließ den unteren Teil ihres Beins zurück. Holzkohle fiel ihm über das von Tränen zerfurchte Gesicht und floss in seinen Bart.
Dann sah sie das Meer unter den zerschmetterten Wänden ihres Hauses. Wütend, ohnmächtig hämmerte es gegen den Fuß der Klippe. Salzige Luft peitschte hoch. Sie biss Kyssen einen Moment wach. Die Wellen erfassten jedes Stück Holz, das vom Haus in die Tiefe fiel, und zerfetzten es.
»Mein Leben, Osidisen!«, rief ihr Vater. »Mein Leben für das ihre, das ist die letzte Sache, die ich je verlangen werde.«
»Nein!«, krächzte Kyssen, kaum noch bei Bewusstsein.
»Das schuldest du mir! Mein Geliebter, mein Freund. Und jetzt schuldest du es ihr. Mein Leben für das von Kyssenna!«
Das Meer erhob sich, peitschte die Klippe hinauf, als wollte es ihn erreichen. Osidisens Gesicht erhob sich aus den Wellen, seine Augen so dunkel wie die Tiefe. Einen Moment lang hoffte Kyssen, er würde es verweigern und stattdessen ihren Vater retten.
Aber Götter lieben Märtyrer.
Er nickte.
Kyssenna versuchte sich zu wehren. Sie wollte kein Versprechen eines Gottes, sie wollte ihren Vater, ihre Mutter, Tidean, Lunsen und Mell. Sie wollte ihre Familie. Ihr Papa drückte sie ein letztes Mal an seine Brust, und sein kratziger Bart fuhr über ihr Gesicht, als er sie küsste.
»Ich liebe dich«, sagte er und schleuderte sie ins Meer.
KAPITEL 1
Kyssen
Es war schwer, einen Gott in seinem Element zu töten. Daran erinnerte sich Kyssen bei jedem verfluchten Schritt, den sie die steilen, hügeligen Hänge des mittelwestlichen Middren hinaufstapfte, Talicias einst mächtigerem Nachbarn. Bis es seine östliche Handelsstadt Blenraden und die Hälfte seiner Bewohner an zänkische Götter verloren hatte. Schrecklich für Middren, aber gut für die Geldbörsen von Godkillern wie Kyssen.
Die Luft war frisch und kühl am Morgen. Middren hatte gerade erst angefangen, den Griff des Winters abzuschütteln. Obwohl ihr rechtes Bein zum Wandern gebaut war und sie ihr Knie doppelt bandagiert hatte, spürte sie bereits, wie sich dort, wo ihre Prothese auf ihrem Fleisch saß, Blasen bildeten. Die würden ihr später eine Welt voller Schmerzen bereiten.
Der schmale Weg durch den Wald war von Schlamm und halb gefrorenem Eis überzogen, aber Kyssen erkannte hier die Form eines Fußes im Moos, einen umgedrehten Stein dort und an einigen Stellen sogar Blutstropfen, die ihr sagten, dass dies der richtige Weg war. Das war die Art von Pfad, auf dem die Menschen beteten.
Trotz ihrer Geschicklichkeit als Spurensucherin war die Sonne schon halb aufgegangen, als sie die Markierung endlich fand: eine Reihe weißer Steine am Rande des Pfades, wo der Boden sich zu einem nahen Bach senkte. Eine Schwelle. Sie lockerte die Schultern und holte tief Luft. Vielleicht hätte sie diesen Gott in einen kleineren Schrein locken können, doch das hätte Zeit und Geduld erfordert. Beides hatte sie nicht.
Sie überschritt die Grenze.
Die Geräusche veränderten sich. Verstummt war das Vogelgezwitscher des frühen Morgens und verschwunden der Duft von Blättern und Mulch. Stattdessen hörte sie Wasser rauschen, spürte Tiefe und kalten Stein und roch die schwachen Spuren von Weihrauch in der Luft – und Blut.
Es war schwieriger, einen Gott zu töten, als einen zu erschaffen. Selbst eine frischgeborene Göttin wie diese hier, die nur ein paar Jahre alt war. Noch schwieriger war es, einen Gott mit einer Münze oder einer Perle zu locken, wenn er erst einmal Geschmack an Opferungen gefunden hatte.
Der Geruch von Weihrauch wurde stärker, als Kyssen sich vorsichtig am Ufer entlangbewegte. Der Gott wusste, dass sie hier war. Sie blieb auf den Steinen des Ufers stehen, gab sich den Schmerzen in ihren Beinen, der Kälte des Morgens und dem scharfen Zwicken der Blasen hin. Sie zückte ihr Schwert nicht, noch nicht. Der Fluss war seicht, aber die Strömung war stark, und auf dem Wasser trieb weißer Schaum von den nahe gelegenen Wasserfällen.
Die Luft wurde kühler.
Du bist hier nicht willkommen, Godkillerin. Die Gedankensprache der Götter war schlimmer, als eine Nadel in den Schädel zu bekommen. Es fühlte sich an, als würde ihr Geist zerrissen, wie eine Invasion.
»Du bist gierig gewesen, Ennerast«, erwiderte Kyssen. Die Luft zischte. Namen besitzen Macht, und die Götter spürten den Zug ihres Namens wie einen Haken in ihren Rippen, der sie ins Freie zog. Aber Ennerast ließ sich nicht allein durch ihren Namen herauslocken.
Es war nur ein bisschen Blut, sagte Ennerast, nur ein oder zwei Kälber. Keiner von der Brut der Menschen.
»Komm schon, du hast sie ausgehungert, bis sie sie dir gegeben haben«, sagte Kyssen, die ihren Blick umherschweifen ließ und ihre Umgebung prüfend musterte. »Du hast ihre Gewässer mit Krankheiten verseucht. Du hast ihre Kinder und ihre Ältesten an deine Ufer gezerrt und ihr Leben bedroht.« Wo sie stand, hatte sie nur wenig Vorteile. Der Fluss plätscherte gegen ihre Stiefel.
Wirklich, die Siedlung hier hätte schon früher eine Veiga rufen sollen. Kein Anführer einer Stadt von der Größe Ennertons, der etwas auf sich hielt, hätte eine Gottheit so lange leben lassen sollen, dass sei so mächtig wurde. Obwohl Schreine verboten waren, tauchten immer wieder Götter auf. Wesen mit Macht, Geister, denen die Liebe und die Angst der Menschen Kraft und Willen verliehen, bis sie stark genug waren, um sie auszubeuten. Menschen waren törichte Geschöpfe, und Götter waren grausam.
»Du hast ihnen Schaden zugefügt«, sagte Kyssen. Das Wasser zu ihren Füßen strömte nicht mehr, sondern wirbelte stattdessen gegen das Ufer.
Das ist mein Recht. Ich bin eine Gottheit.
»Ha.« Kyssen lachte humorlos. »Du zehrst von den Verängstigten, Ennerast. Du bist eine Ratte, und ich bin deine Fängerin.«
Kyssen griff in ihren Wachswollmantel und fuhr mit den Fingern über ihre Taschen mit Reliquien und Totems, Werkzeugen und Weihrauch, den Tricks ihres Handwerks. Sie erkannte an den kleinen geriffelten Markierungen auf dem Gefäß, was sie suchte, schob ihren Fingernagel unter den Korken und hob ihn ab. In dem Gefäß befand sich ein zusammengerolltes, beschriebenes Stück Leder.
Die Luft um sie herum war aufgeladen, als wäre sie nervös und aufgeregt. Das Wasser begann zu schäumen.
Was ist das?
Kyssen vermochte nicht zu spüren, was Götter wahrnehmen konnten: Angst, Hoffnung, Verzweiflung; Gefühle, mit denen sie gerne spielten, die ihnen aber gleichgültig waren. Sie wusste jedoch, was Götter antrieb, wonach sie sich sehnten. »Es ist ein Gebet«, sagte sie, ohne es loszulassen.
Ich will es haben.
»Das Gebet eines jungen Mannes aus einem fernen Dorf.« Kyssen drückte den Daumen auf den Korken. »Er möchte vor der Dürre und den Bränden in seinen Wäldern gerettet werden, um seine Ernte und seine Tiere zu retten. Er sehnt sich verzweifelt nach Wasser.«
Gib es mir.
»Er verspricht alles, Ennerast.« Kyssen lächelte. »Alles.«
Meins.
Das Wasser schoss in die Höhe und verwandelte sich in einen grünen Sturzbach, mit einem Kopf so glatt wie Stein und von Unkraut überwucherten Armen. In der Mitte, in einem Torso aus fließendem Wasser, befand sich eine dunkle Masse: ein Herz aus Blut. Sie griff nach Kyssen, die ihren Stand sicherte und mit einer einzigen fließenden Bewegung ihre Klinge zog und Ennerasts Finger abtrennte. Die Gottheit schrie auf, zog sich zurück, und Wasser bildete sich dort neu, wo ihr Flussfleisch zerfetzt worden war.
»Es brennt«, sagte sie laut, mehr überrascht als verletzt. Ihre Augen waren flach und grau wie Kieselsteine. Das Schwert war leicht und härter als Stahl, strapazierfähig, geschmiedet aus einer Mischung aus Eisen und Bridhid-Erz, wie Kyssens Bein. Es konnte die Materie eines Gottes ebenso zuverlässig zerschneiden wie die eines Menschen, von der kleinsten Gottheit der Verlorenen Dinge bis zum großen Gott des Krieges. Eine Gottheit wie Ennerast, die sich erst kürzlich in diesem Gebirgsfluss manifestiert hatte, war noch nie von einer Briddite-Klinge verletzt worden.
Die Gottheit fletschte ihre Fischgrätenzähne und schlug gegen das Ufer unter Kyssens Füßen. Es gab nach, und Kyssen stürzte in den Fluss. Sie versuchte aufzustehen, aber das Unkraut schlang sich um ihre Handgelenke und zog sie tiefer hinab. Das Wasser drang in ihren Mund und ihre Nase und weiter in ihre Lunge.
Kyssen schob ihr Schwert vorwärts, gegen das Unkraut, und rammte die Klinge in das Flussbett. Sie traf auf einen Stein und hielt stand. Ihr rechtes Bein rammte sie hart nach unten und gewann etwas mehr Stabilität. Mit aller Kraft riss sie ihre Klinge aus dem Wasser und durchtrennte mit der Schneide Strömung und Unkraut. Dann bäumte sie sich auf und schlitzte Ennerasts Arm auf, als die Gottheit versuchte, sie unter Wasser zu drücken.
Ennerasts Fleisch fiel in einer Kaskade von Wasser in den Fluss. Sie kreischte, die Strömung wurde schwächer, und Kyssen sah, wonach sie suchte. Hinter dem Wasserfall blitzten ein Knochen, ein farbiges Band und ein Stein auf: der Schrein des Flussgottes. Ennerast war keine alte Gottheit mit vielen Schreinen, vielen Gebeten. Die konnten nach Lust und Laune die Welt bereisen. Sie war eine neue Gottheit, und obwohl sie in der Wildnis geboren war, brauchte sie ihren Schrein zum Leben.
Kyssen ließ Ennerast keine Zeit, sich neu aufzustellen. Sie sprang vor und hob ihre Klinge zum Schlag.
Ennerast tappte in die Falle. Sie tauchte ab, um ihr Heiligtum zu schützen, und Kyssen drehte sich im letzten Moment um, drehte sich im Kniegelenk und riss das Schwert mit aller Kraft hoch.
Es bohrte sich durch Ennerasts dunklen Torso und direkt in die blutige Masse ihres Herzens. Die Gottheit brüllte wie ein Damm, der tosend brach. Sie schnappte nach Kyssens Schwerthand und packte sie so fest, dass sie ihr fast die Knochen zermalmte.
»Bitte«, flehte Ennerast. »Lass mich leben, Veiga, vielleicht hast du noch Verwendung für mich.«
»Ich brauche keine Götter«, erwiderte Kyssen.
»Das sagt eine, die das Versprechen von Osidisen noch im Herzen trägt.«
Das Wasser war ein Verräter von Geheimnissen; Geschichten wurden vom Tropfen bis zum Wolkenbruch weitergegeben, vom Rinnsal bis zum Meer. Nichts konnte das Geschwätz einer Wassergottheit aufhalten.
»Ich kann dich davon befreien, weißt du«, sagte Ennerast, beugte sich über die Klinge und schob ihr Gesicht dicht an das von Kyssen. »Von dem Versprechen, den Narben, den Erinnerungen.« Sie strich Kyssen über die Wange.
»Mächtigere Götter als du haben mir Angebote gemacht, Ennerast«, sagte Kyssen, »und ich habe sie trotzdem getötet.«
Ennerast zischte. »Dann verfluche ich dich!«, schrie sie. »Ich …«
Kyssen riss ihr Schwert in einem Schwall aus Blut und stinkendem feuchtem Wasser aus der Seite der Gottheit, und der Schrein hinter dem Wasserfall zerbarst. Ennerast gab keinen Laut von sich, als ihr Fleisch in die Strömung zurückfiel und im Fluss Ennerun versank. Sie gab ihn frei, für die Stadt und die Dörfer, die er speiste, zum Gedeihen oder Untergang. Aber es gelang ihr, Kyssen einen letzten Stich ins Herz zu versetzen.
Wenn Middren an die Götter fällt, wird eure Art die erste sein, die stirbt.
Die Geräusche des Flusses verstummten, und der süßliche Duft von Weihrauch wurde wieder von dem nach Lehm und Feuchtigkeit überlagert. Der Gesang der Vögel kehrte zurück.
Kyssen zitterte. Sie war bis auf die Knochen durchnässt, doch ihre Arbeit war noch nicht getan. Die Gottheit war tot, aber Götter konnten zurückkommen. Der Schrein war ihre Erinnerungen, ihre Opfer, ihr Anker in der Welt.
Kyssen näherte sich dem Schrein. Er war beschädigt, doch nicht völlig zerbrochen. Zwei Tierschädel waren zersplittert. Die meisten Gottheiten verlangten eher Tieropfer als Menschenopfer. Kyssen raffte die Trümmer zusammen und warf sie zum Verrotten in den Wald. Der Weihrauch war zerbröckelt, aber die Asche war übrig geblieben. Sie schüttete etwas davon in eine kleine Glasphiole und warf den Rest in das Wasser. Viele der anderen Gaben an Ennerast waren noch intakt. Genug, um sie wieder zum Leben zu erwecken, wenn sie verschont würden. Kyssen behielt einen gewebten Seidenstreifen, handgefertigt, mit einem Gebet in der Weberei und Blut, das mit den Fäden vermischt war. Ein Liebesgesuch, wie es aussah. Sehr verlockend für eine Gottheit. Von den anderen Gebeten lohnte sich kaum eines, aufbewahrt zu werden. Kyssen schichtete die Überreste des Schreins auf und zündete sie an, weit weg vom Wasser und in einem Ring aus Steinen. Sorgfältig beobachtete sie, wie der behelfsmäßige Scheiterhaufen zu Asche verbrannte.
Sie behielt nur noch einen weiteren Gegenstand: ein Totem aus Kalkstein, geschnitzt mit einem Kopf, hohen Wangenknochen und flachen Augen. Etwa so groß wie ihre eigene Handfläche. Es war in der Mitte geborsten, als Ennerast starb, aber die Gottheit hatte das als Vorbild für ihre Gestalt genommen.
Kyssen stank nach Dampf, Schlamm und Teerrauch, als sie schließlich ihr Pferd vom Fuß des Bergpfades holte und den langen Weg zurück in die Stadt Ennerton und zu dem Vogt ritt, der sie gerufen hatte. Vogte waren aufgeblasene Verwalter, die in Städten und Gegenden eingesetzt wurden, um sich um die Geschäfte des Adligen zu kümmern, dem das Land gehörte. In diesem Fall war es das Haus Craier. Kyssen kümmerte sich nicht darum, wem welcher Flecken Schlamm gehörte, solange das Silber rein war.
Kyssen klopfte an die Tür des Amtssitzes. Die ältere Frau, die ihr öffnete, begrüßte sie mit einem finsteren Blick und rieb sich Tuscheflecken von ihrer dunkelolivfarbenen Haut.
»Ihr Veiga solltet die Hintertür benutzen«, sagte sie.
Kyssen lächelte und zeigte ihren Goldzahn. Vor dem Krieg um Blenraden galten die Godkiller kaum mehr als Attentäter oder Kammerjäger. Kyssen und die Veiga, die sie ausgebildet hatte, waren unter der Hand bezahlt worden. »Heutzutage haben wir den Segen des Königs«, gab Kyssen zurück. »Oder wollt ihr es mit den Toten von Blenraden aufnehmen?«
Die Frau errötete und ließ sie durch die Tür, und Kyssen warf ihr einen spöttischen Kuss zu. Heutzutage musste sie nicht mehr so tun, als sei ihre Berufung eine Sünde.
Der Vogt kontrollierte gerade die Kassenbücher in seinem Büro. Er saß an einem großen Eichenschreibtisch, der stolz vor einem bunten, gerahmten Bild von König Arren stand. Er blickte mürrisch auf, als sie eintrat, und die klappernden Kupferohrringe in seinem linken Ohr glitzerten im Lampenlicht. Sie hatten bläuliche Spuren auf seinem blassen Ohrläppchen hinterlassen.
»Ist es getan?«, wollte er wissen.
»Ich grüße dich auch, Vogt Tessys«, antwortete Kyssen. »Ich dachte, die Craier-Länder wären gastfreundlich.«
Tessys machte ein säuerliches Gesicht, als hätte man schon zu oft auf ihm herumgetrampelt. »Ich brauche einen Beweis.« Er wirkte ein wenig spitzbübisch bei diesen Worten. Der Beweis war der Rauch, der an diesem feuchten Tag immer noch am Berg aufstieg, genau dort, wo Ennerasts Schrein gestanden hatte. Der Beweis war das Odeur von Wut, das an Kyssen haftete wie das statische Knistern eines abklingenden Sturms. Sei es drum – kleine Männer hielten gerne große Dinge in Händen.
Kyssen legte Ennerasts zerbrochenes Kalkstein-Totem auf den Schreibtisch. Tessys wusste, so etwas konnte nur aus einem Schrein genommen worden sein. Der Vogt starrte das Totem ängstlich an.
»Vernichte es!«, befahl Kyssen, zog ihre in Leder eingewickelten Veiga-Dokumente aus ihrer Manteltasche und schob sie über den Tisch. »Und wasch dir die Sorgen aus dem Herzen, sonst ist sie noch vor dem Winter wieder da.«
Er blickte sie irritiert an, dann auf die Papiere und befühlte seine Feder. »Du sagtest, du hättest sie getötet.«
»Götter sind Parasiten. Sie werden wiederkommen, wenn es Angst gibt, von der sie sich nähren können.« Eine wiedergeborene Ennerast würde irgendwann denselben Weg einschlagen, auch ohne Erinnerungen an ihr Heiligtum. Götter wurden alle vom gleichen Verlangen getrieben: dem nach Liebe, nach Opfern, nach Blut.
Der Vogt schniefte. Konnte Kyssen ihn melden, weil er es versäumt hatte, den Schrein von Ennerast früher zu entfernen? Er würde eine saftige Geldstrafe bekommen, wenn nicht sogar einen Finger verlieren. Vielleicht sollte sie das tun, aber es würde sein Wesen nicht ändern. Gottheiten wurden aus menschlichen Gebeten geboren, und niemand wollte es sich mit ihnen verderben. Wenn sie jedes Mal, wenn jemand eine Veiga brauchte, dem nächstbesten Ritter davon erzählte, würde sie bald keine Arbeit mehr haben.
Der Vogt holte einen Stempel aus seiner Schublade und dazu einen Beutel mit Silber. Sein Tuschestein war bereits nass, also drückte er den Stempel darauf, dann auf ihre Dokumente, mitten in das dreizackige Symbol der Veiga. Kyssen nahm das Silber zuerst und wog es in ihrer Hand. Sie würde ihn vielleicht nicht melden, aber sie berechnete ihm trotzdem einen Aufschlag.
»Und jetzt verschwinde!« Er schob ihre Papiere über den Schreibtisch und scheuchte sie mit einer Handbewegung weg. Doch er konnte ihr nicht in die Augen sehen.
»Du hast sonst keinen weiteren Auftrag für mich?«, fragte Kyssen. »Warum nicht?«
»Hier gibt es keine weiteren Götterprobleme«, erwiderte der Vogt mit einem säuerlichen Lächeln. »Ich schicke dich bei Bedarf zu deinem örtlichen Vogt in Lesscia.«
Kyssen zuckte mit den Schultern und steckte das Silber ein.
»Du wirst das nicht klären, richtig?«, sagte sie und zeigte auf Ennerasts Totem. Es war keine Frage. Er hatte nicht nur vor der toten Gottheit Angst, sondern auch vor ihren Anhängern. Sie würden einen Schuldigen suchen, und der Vogt war derjenige, der eine Godkillerin gerufen hatte. Vielleicht würde er die Reliquie aufbewahren, vielleicht würde er sich von ihnen bestechen lassen, um sie wieder herauszurücken.
Die letzten Worte von Ennerast kamen Kyssen wieder in den Sinn. Wenn Middren an die Götter fällt …
Kyssen zog ihr Schwert, und mit einer kurzen Drehung des Handgelenks zerschmetterte sie das Totem mit der flachen Seite der Klinge. Der Vogt sprang zurück, als das Antlitz von Ennerast auf den Schreibtisch zerbröselte und eine große Delle und einen Haufen weißer Krümel hinterließ.
»Wie kannst du es wagen …!«, begann er, stockte allerdings, als Kyssen ihm ein goldblinkendes Grinsen schenkte und ihren Blick auf das Porträt des Königs richtete, das hinter seinem Schreibtisch hing. Der Fuß des Königs ruhte auf dem Schädel eines Hirschs, die Sonne ging hinter ihm über der brennenden Stadt auf. Es war sein Dekret, dem er gehorchen musste, egal was die Stadtbewohner dachten. Der Vogt unterdrückte seinen Zorn.
»Danke«, presste er zwischen den Zähnen hervor.
Kyssen verließ den Amtssitz und versuchte, sich diese Worte aus dem Kopf zu schlagen. Die großen Götter waren in alle Winde zerstreut, ihre Jagdgründe aufgelöst, ihr Krieg in Middren lange vorbei. Ennerasts Worte bedeuteten nichts, waren nur der letzte verzweifelte Atemzug einer sterbenden Gottheit.
Kyssen legte eine Hand auf ihre Brust, wo das Versprechen Osidisens, das Opfer ihres Vaters, noch immer auf ihrem Herzen lastete.
KAPITEL 2
Inara
Inara Craier hielt den Atem an, als das Holzfuhrwerk, in dem sie sich versteckte, rumpelnd zum Stehen kam. Heute war wie immer Holztag für Ennerton, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wohin es geliefert wurde. Sie drückte ihren pelzigen Begleiter Skedi unter ihrem Wams fest an ihre Brust und spähte durch eine Lücke der Plane, die den Wagen bedeckte. Sie hatten vor einem großen Tor auf einer belebten Kopfsteinpflasterstraße angehalten. Drinnen trainierten Menschen mit Schwertern und Armschilden in dem feuchten Innenhof. Alle trugen die hellblauen und grauen Farben des Hauses Craier. Über dem Tor hing ein Schild, auf dem drei Bäume gemalt waren, über die ein Vogel schwebte. Das Wappen ihrer Mutter: Lessa Craier, die Matriarchin des Hauses Craier. Das hier musste eine Art Kaserne sein.
»Tief durchatmen«, sagte Inara zu sich selbst und wich von der Plane zurück. Ihr Flüstern bildete kleine Nebelwölkchen vor ihrem Mund. »Tief durchatmen.«
Sie war noch nie in Ennerton gewesen. Genau genommen war sie in ihren zwölf Jahren nicht ein einziges Mal über die Ländereien von Craier hinausgekommen. Da draußen schien alles stinkend und laut zu sein. Und hell. Viel zu hell und mit viel zu vielen Farben.
Es ist so laut, dass wir nicht auffallen werden, sagte ihr Begleiter. Tu, was ich dir gezeigt habe, und kümmere dich nicht um die Farben.
Inara schluckte und glitt an der Seite von dem Fuhrwerk herunter. Ihre Mutter war mutig, selbstbewusst, stark. Das musste Inara auch sein, für ihre Mutter. Für Skedi.
Niemand würdigte sie auch nur eines Blickes, als sie sich von dem Karren entfernte. Alle waren mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt: Sie trugen Dinge umher, arbeiteten, schrien, lachten. Die Farben umgaben jeden Bewohner von Ennerton wie eine leuchtende Wolke, sickerten aus ihren Händen, wogten um ihre Schultern, tanzten über ihren Köpfen. Ein unbeständiges, sich bewegendes Kaleidoskop, das aufblitzte und verschwand, wie ein Blitz flackerte und dann wieder erlosch. Inara nahm einen tiefen Atemzug. Nur sie und Skedi konnten diese Farben sehen. Sie musste durch sie hindurch auf die Straße blicken, auf die Gesichter der Menschen. Sofort trat das Flimmern in den Hintergrund.
Nicht laufen, sagte ihr kleiner Freund, kroch in ihren Ärmel und versteckte sich in ihrer Armbeuge. Geh einfach, und geh langsam.
Inara wäre fast »langsam« mit einer Frau zusammengestoßen, die rückwärts aus einer Tür trat. Sie trug eine tote Ziege über ihren Schultern, die mit den Füßen an den Stock darüber gefesselt war.
»Entschuldigung«, sagte sie.
»Spar dir deine Entschuldigung, kleine Närrin«, fauchte die Frau und wich ihr aus. Ihre Farben schossen aus ihr heraus, orange und aggressiv. Inara hielt den Atem an.
Geh weiter. Das sind nur ihre Gefühle, die können dir nichts tun.
Inara raffte ihren Mantel um sich. Skedi hatte recht, sie sollte inzwischen an die Farben gewöhnt sein, die schwach um die Bediensteten des Craier-Haushalts waberten oder um die Arbeiter, die die Obstgärten, die Weiden und das Vieh pflegten. Seit Skedi zu ihr gekommen war, oder vielmehr kurz danach, konnte sie sie sehen. Fünf Jahre voller Farben und Geheimnisse.
Es war ein kühler Frühlingsabend, und der Frost des Winters war noch nicht verschwunden. Deshalb war sie mit einem gefütterten Wams, einem Reisemantel und einem Kopftuch über dem Haar aus dem Haus gegangen. Sie war jedoch die Einzige, die so warm angezogen war. Hier in der Stadt, ein paar Stunden Fahrt mit dem Fuhrwerk vom Herrenhaus entfernt, war die Luft wärmer. Inara band das Kopftuch fester und senkte den Kopf, um nicht erkannt zu werden. Jeder hier stand unter der Kuratel ihrer Mutter, aber niemand schenkte ihr auch nur einen zweiten Blick.
Inara entfernte sich von der Kaserne und trat sofort knöcheltief in eine Pfütze, in der Innereien aus der nahe gelegenen Schlachterei schwammen. Sie schüttelte ihren Fuß aus und schaffte es gerade noch, zur Seite zu hüpfen und der stinkenden Dusche eines Nachttopfs auszuweichen, der aus einem Fenster im Obergeschoss geschüttet wurde. Ihr Herz hämmerte gegen ihre Rippen. Das hier war dumm. Es war verrückt. Sie riskierte alles, und sie wusste nicht einmal, wohin sie gehen sollte.
»… muss die Veiga hierbleiben, Vogt Tessys?« Inara schnappte einen Gesprächsfetzen auf, als sich zwei Männer an ihr vorbeidrängten. Der Sprechende trug einen Kragen, der mit einem zerknitterten Seidenstreifen zusammengehalten wurde; der andere hatte kupferne Ringe in den Ohren. Sein Gewand war aus feiner Wolle und mit Perlmuttknöpfen besetzt. Er war jemand Wichtiges. »Du weißt, dass Ennerasts Anhänger vom Hügel Ärger machen werden. Es ist besser, wenn sie verschwindet.«
»Sie ist eine ungehobelte, stolze Frau, und sie will, dass wir alle das wissen«, antwortete der Mann mit den Kupferohrringen. Offenbar war er der Stadtvogt. Sie hatte manchmal gelauscht, wenn ihre Mutter über ihn sprach. »Ich weigere mich, auch nur einen Moment länger mit ihr zu sprechen. Außerdem habe ich gehört, dass sie viel zu sehr damit beschäftigt ist, Rosalie, der Kneipenwirtin, schöne Augen zu machen.« Er deutete auf eine Taverne in der Nähe. Davor standen Leute, die aus dampfenden Bechern tranken. Es roch nach heißem Wein. »Sei klug und geh woandershin.«
Der erste Mann wirkte verlegen. »Was wäre, wenn …?«
»Ich habe sie bezahlt; mein Teil ist erledigt.«
Inara sah, dass die Taverne Der Wille des Königs hieß. Ihr Schild zeigte eine Sonne über einer brennenden Stadt. Blenraden. Natürlich. Inara erinnerte sich nur an wenige Momente des Krieges, undeutliche Bilder aus ihrer Kindheit. Kein Kind würde jedoch vergessen, wie seine Mutter in jenen dunkelsten aller Tage nach Hause kam, verletzt, untröstlich und still.
Noch deutlicher war ihr der Tag in Erinnerung, an dem es endete. Sie war neun Jahre alt gewesen, und sie hatten in den Kellern die Wein- und Brandyfässer angezapft und für die Dienerschaft Feuerwerk am Himmel explodieren lassen. Lady Craier hatte Inara eng und fest in den Armen gehalten. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte Inara bereits Geheimnisse.
Die guten Zeiten waren jetzt vorbei, doch die Geheimnisse blieben. Lessa Craier verbrachte die meiste Zeit in Sakre, der Hauptstadt, um die Gunst von König Arren zurückzugewinnen, wie die Dienerschaft tuschelte. Ihre Besuche zu Hause waren stets kurz.
Erst heute Morgen war sie zum Frühstück erschienen, direkt von der Straße. Ihr Haar war fein säuberlich zu einem Zopf auf dem Rücken geflochten. Sie hatte Inara mit ihrer Aufmerksamkeit überschüttet, sie über ihre Lektionen, ihre Lektüre, ihre Fortschritte beim Bogenschießen ausgefragt, ohne sich anmerken zu lassen, wie müde sie sein musste.
Dann war eine Läuferin gekommen. Eine ängstlich aussehende Frau aus dem Büro des Vogts, die peinlich berührt gewesen war, die Matriarchin des Hauses persönlich anzutreffen. Sie hatte wohl die Hoffnung gehabt, nur die Nachricht hinterlassen zu können, in der stand, dass eine Godkillerin beauftragt worden war, um sich der örtlichen Flussgöttin Ennerast anzunehmen. Inara hatte das nicht mithören sollen. Ihr war befohlen worden, sich zu verstecken, wenn jemand Unbekanntes das Haus betrat. Das hatte sie auch getan, aber inzwischen wusste sie, wo sie sich verstecken und trotzdem lauschen konnte.
Eine Godkillerin.
Man sah sie in dieser Gegend nur selten, und Inara hatte nie etwas davon gehört, dass eine aufgetaucht wäre. Das hier war ihre Chance. Ihre erste Chance auf Freiheit. Wann würde Skedi eine weitere bekommen? Die Botin war verschwunden, und Inara hatte all ihren Mut zusammengenommen.
Ihre Mutter war in ihrem Arbeitszimmer gewesen, hatte über einem Brief gebrütet und ein Antwortschreiben verfasst. Der Duft von Zitronen lag in der Luft, ein scharfer Zitrusgeschmack. In diesen Tagen rochen alle Briefe, die sie schrieb, nach Zitrone.
»Ina«, sagte Lady Craier, als sie sie sah, und schob den Brief, den sie gerade las, beiseite. Aber Inara konnte noch einen kurzen Blick auf ein Wappen in brauner Tusche erhaschen, das wie ein Baumzweig aussah. Ihre Mutter sah gehetzt und besorgt aus, doch im Gegensatz zu den meisten Menschen waren ihre Farben verborgen. Eine brennende Kerze stand auf ihrem Schreibtisch, obwohl helllichter Tag war.
Inara schluckte. Skedi hatte sich in ihrer Tasche versteckt, und sie schob ihre Hand hinein, damit er seine Nase dagegendrücken konnte. »Ich möchte mit dir über Götter sprechen.«
Die Farbe zuckte nur kurz aus ihrer Mutter hervor. Es war eine Mischung aus Grau und Weiß, wie ein Blitz. Sie erlosch sofort wieder, aber Inara hatte bereits verstanden, was sie bedeutete: Panik.
»Nein«, beschied sie Lady Craier. »Du sollst nicht von Göttern sprechen, Inara, das ist gefährlich.«
»Mama, es ist aber wichtig.« Sie wollte ihr von Skedi erzählen, von den Farben, ihr erklären, warum sie das Geheimnis so lange für sich behalten hatte. Wenn sie es erklärte, würde ihre Mutter sie vielleicht zu der Godkillerin in die Stadt bringen. Vielleicht würden sie dann Antworten bekommen.
»Eines Tages wirst du es verstehen.«
»Aber …«
»Genug.« Wut blitzte um sie herum auf. Aber dann kam ihre Mutter zu Inara und strich ihr sanft eine widerspenstige Lockensträhne hinter das Ohr, wie sie es immer getan hatte, als Inara noch klein gewesen war. Lessas Hände hatten einen dunklen, goldbraunen Ton, während Inaras Haut heller war. Lessas Haar war schwarz und glatt, Inaras Locken braun. Sie sähe aus wie ihr Vater, hatte Lessa ihr einmal gesagt, aber sie hatte es nie genauer ausgeführt. »Ich meine es ernst. Schlag dir das aus dem Kopf, mein Herz. Bitte. Tu es für mich. Ja?« Dann war sie wieder aufgestanden, und ihre Schultern hatten das Licht am Fenster verdeckt. Lessa war nur selten zu Hause, und wenn, dann hörte sie nicht zu. Sie versuchte es nicht einmal. Sie waren einfach zu verschieden. Inara würde das alleine angehen müssen.
Lüge, hatte Skedi da zu ihr gesagt.
Also hatte Inara gelogen. »Gewiss, Mama.«
Und jetzt schlich sich Inara in die Taverne. Die Luft war von Rauch und der Hitze von den Kaminfeuern geschwängert. Es stank nach Schweiß, Hunden und Essig. Hier tranken zumeist Einheimische. Inara erkannte das an der Kleidung, gewalkte und gefärbte Wolle oder Baumwolle in einem ähnlichen Schnitt wie die Kleidung der Bediensteten. Die einiger reicherer Bürger war mit bunten Fäden verziert und mit fantasievollen Mustern bestickt. Andere trugen Reisekleidung aus Wolle oder Leder und dicke Stiefel. Sie wusste von ihrem Lehrer, dass dies hier eine Handelsstadt war. Viele Menschen reisten hier hindurch.
Trotz ihrer behüteten Erziehung erkannte sie die Veiga sofort. Die Frau saß an einem Tisch. Das Leder ihres Wamses sah so hart aus, dass es als Rüstung dienen mochte. Und es war am Hals gerade so tief geschnitten, dass es eine Tätowierung am oberen Rand ihrer Brust entblößte, eine Art weite Spirale. Niemand hätte sie mit einer Händlerin oder einer Magd verwechselt. Sie sah aus wie eine Talician – blass und sommersprossig, das kastanienbraune Haar reichte bis zu den Ohren und war am Hinterkopf mit einigen grob geflochtenen Zöpfen und einem Lederband zusammengebunden.
Die Veiga unterhielt sich gerade mit der Kneipenwirtin, und als sie lächelte, fiel das Licht auf den blassen Umriss einer spinnennetzartigen Narbe, die sich von ihrem linken Auge bis zu ihrem Kinn zog. Der Anblick jagte Inara einen Schauer über den Rücken. So etwas hatte sie bisher nur auf Pergamenten und in Büchern gesehen: ein toter Fluch.
Der Fluch bedeutete, dass sie jemanden so verletzt hatte, dass dieser mit einem Gott einen Vertrag für einen Fluch geschlossen hatte. Oder aber sie hatte einen Gott so sehr verärgert, dass er ihr das schwarze Mal seiner Macht aufgedrückt hatte, ohne dass jemand darum gebetet oder ein Opfer dargebracht hatte. Und das Mal eines toten Fluchs bedeutete, dass die Veiga diese Gottheit getötet oder irgendwie ihren Willen, den Fluch, gebrochen hatte. Dadurch wurde das Mal weiß wie gebleichter Knochen.
Vielleicht ist das keine gute Idee, gab Skedi zu bedenken.
»Es war deine Idee«, flüsterte Inara. Er hatte ihr geholfen, zu lügen, damit sie früh zu Bett gehen konnte. Auch wenn ihre Mutter kaum darauf geachtet hatte. Und dann auch dabei, unbemerkt unter den Augen aller das Gut zu verlassen. Er hatte sich gefreut, dem Anwesen zu entfliehen, in die Welt hinauszugehen, aber jetzt, wo er die Godkillerin sah, bekam er Angst. Sollte sie auch Angst haben?
Während Inara zusah, nahm die Veiga die Hand der Wirtin und drückte ihr einen Kuss auf das Handgelenk. Es war eine zärtliche Geste, eine menschliche Geste. Die Wirtin lächelte und beugte sich zu ihr hinunter, um ihr Bier nachzufüllen. Sie nutzte die Bewegung, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Die Veiga strahlte, als sie lachte, und ihre meergrauen talicianischen Augen leuchteten schalkhaft. Inara konnte die Farben ihrer Gefühle nicht sehen, genauso wenig wie sie es bei ihrer Mutter vermochte, also musste sie ihr Gesicht lesen, um zu erraten, was sie dachte.
Eine Gruppe von Gästen weiter hinten in der Taverne rief nach der Wirtin. Sie schwenkten aggressiv ihre Becher durch die Luft und schlugen rhythmisch damit auf den Tisch. Ihre Farben waren leicht zu erkennen – gereiztes Safran und salziges Pink. Es gefiel ihnen nicht, dass die Veiga mit ihrer Bedienung flirtete. Die Wirtin zog langsam ihre Hand weg und strich dabei der Veiga über das Kinn. Dann ging sie zu den anderen Gästen, um ihre Becher zu füllen.
Inara war jetzt hier, und es gab kein Zurück mehr, also nutzte sie diesen Moment als ihre Chance.
Sei vorsichtig, mahnte Skedi.
Sie ließ sich auf den Stuhl gegenüber der Godkillerin fallen und wartete.
Die Veiga sah sie über den Rand ihres Bechers hinweg an, als sie einen langen Schluck nahm. Vor ihr stand ein Teller mit Krumen und sauber abgenagten Knochen. Inara knurrte der Magen. Es war schon lange nach ihrer üblichen Schlafenszeit, und sie war zu nervös gewesen, um etwas zu essen, als sie ihren heimlichen Ausflug geplant hatte. Aber das machte nichts, sie würde essen, wenn sie nach Hause kam. Vorausgesetzt, sie geriet nicht in allzu große Schwierigkeiten.
Sie biss die Zähne zusammen. Das war ein Problem für später. Jetzt musste sie sich um die Frau vor sich kümmern, deren gebrochener Fluch aus der Nähe noch tödlicher aussah. Auch auf ihren Händen glänzten Narben, alten Brandmale, die die Haut faltig machten.
»Was willst du?«, fragte die Godkillerin.
Inara blinzelte, irgendwie überrascht, einfach angesprochen zu werden, und das auch noch so unhöflich. Ihr Mund wurde trocken vor Nervosität.
»Du bist eine Godkillerin, nicht wahr?«, begann Inara. Die Veiga hob eine Augenbraue, sagte jedoch nichts. »Eine Botin sagte, du wärest gekommen, um Ennerast zu erledigen, diejenige, die den Fluss wegen ihrer Gier nach Blut hat austrocknen lassen.«
»Und wieso kümmert das ein kleines adliges Mädchen einen Scheiß?«
Inara errötete. Sie hatte ihr Haar bedeckt und ihre einfachste, wärmste Reitkleidung angezogen. Sie dachte, sie sei gekleidet wie die Dienerschaft – woher konnte die Veiga das wissen? »Ich bin keine Adlige.«
»Na klar.« Die Veiga zuckte mit den Schultern. Offenkundig war es ihr völlig gleichgültig. »Was auch immer du bist, verschwinde, Liln.«
Liln war ein talicianisches Wort, das »Kleine« bedeutete. Die Godkillerin hatte zwar einen middrenitischen Akzent, allerdings auch etwas von dem runden, tiefen Klang des Talic, wie einstmals scharfe Felsen unter der Wasseroberfläche, die vom Meer glatt geschliffen worden waren.
Sag ihr nicht die Wahrheit.
»Mein Name ist Inara. Ich brauche deine Hilfe.«
»Dann frag die Garnison.« Die Veiga klopfte sich mit der Faust auf die Brust und rülpste. »Ich bin keine käufliche Handlangerin und auch keine Babysitterin.«
»Die können mir nicht helfen«, antwortete Inara und versuchte, ihre Abscheu vor der Frau zu verbergen. »Nicht dabei.«
Am Feuer wurde es plötzlich laut, als zwei Gäste mit einem Wettstreit in Armdrücken begannen und die anderen Gäste anfingen, mit Hacksilber Wetten abzuschließen. Die Wirtin ging wieder vorbei, ohne sich an dem Lärm zu stören. »Rosalie«, rief Kyssen ihr zu.
»Veiga?«, sagte sie und lächelte. Inara war fast erleichtert über ihren Flirt. Das machte die Godkillerin irgendwie menschlicher.
»Bitte, einen Wein? Bring deinen eigenen Becher mit, aber lass mich erst diese Göre loswerden.« Inara kauerte sich zusammen, als Kyssen auf sie zeigte. »Zu welchem Adelshaus gehört sie? Craier?«
Rosalie musterte sie kurz, und Inaras Herz schlug ihr bis zum Hals. Aber die Farben der Schankwirtin waren kühl und grau: kein Erkennen, keine Überraschung. »Hier gibt es keine adligen Kinder«, antwortete sie. »Lady Craier hat jetzt keine Kinder mehr, und die Familie ist zerstritten. Wahrscheinlich ist sie die Tochter eines Kaufmanns.«
Inara brauchte einen Moment, um ihren verletzten Stolz herunterzuschlucken. Sie war die Erbin der Craier-Ländereien. Die Leute aus Ennerton arbeiteten vielleicht nicht alle für Lady Craier, aber sie sollten zumindest wissen, dass es Inara gab. Und was bedeutete überhaupt »jetzt«? Skedi stieß sie mit seinem Kopf an.
Verärgert ist besser als erwischt.
Also schwieg Inara, während Rosalie der Veiga zuzwinkerte. »Ich bringe dir Wein, wenn ich hier fertig bin«, versprach sie.
»Wenn es dir keinen Ärger macht.« Die Veiga nickte in Richtung der Gruppe, die die Wirtin beim letzten Mal von ihr weggeholt hatte.
»Ach, die sind nicht schlimm«, antwortete Rosalie. »Sie haben nur ihre eigenen Ansichten. Und wenn ich mit einer Veiga rummachen will, können sie ihre Ansichten gern für sich behalten.«
Kyssen grinste. »Na, dann bin ich aber froh, dass ich mich entschlossen habe, hier zu übernachten.«
Rosalie ging weiter, und Inara war es leid, einfach ignoriert zu werden. Davon hatte sie schon genug von ihrer Mutter zu ertragen. »Du kennst dich mit Göttern aus, ja?«
Die Godkillerin seufzte. »Falls du eine Priesterin oder eine Gelehrte suchst, ich bin weder das eine noch das andere.« Sie hoffte unverkennbar, dass Inara aufgeben und verschwinden würde.
»Nein, ich …« Inara senkte ihre Stimme. Sie wollte der Godkillerin beweisen, dass es sich lohnte, ihr zuzuhören. Das Letzte, was sie und Skedi wollten, war, von den Leuten in Ennerton erwischt zu werden – sie musste den Namen ihrer Mutter aus der Sache heraushalten. Aber es war die Aufgabe dieser Frau, ihr zu helfen. »Ich habe ein Problem mit einem Gott.«
Die Veiga musterte sie ungläubig mit einem scharfen Blick. Inara sah ihren goldenen Eckzahn aufblitzen, als sie zu lachen begann. Inaras Miene verfinsterte sich.
»Komm raus, Skediceth«, sagte sie.
Das haben wir nicht vereinbart, protestierte er.
»Bitte. Tu es für mich.«
Skedi kroch in ihrem Ärmel hinab. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Was auch immer die Godkillerin erwartet hatte, es war jedenfalls nicht das hasenähnliche Gesicht und das Geweih des eichhörnchengroßen Gottes, der seinen Kopf aus Inaras Ärmel herausstreckte, die gefiederten Flügel fest an seinen Rücken gepresst. Skedi sah aus wie eine Mischung aus einem Hasen, einem Reh und einem Vogel.
Im Handumdrehen hielt die Veiga ein Messer in der Hand. Skedi schrumpfte ebenso schnell auf die Größe einer Maus und flüchtete zurück in Inaras Ärmel, während sich die Klinge in das Holz des Tisches grub.
»Tu ihm nicht weh!«, rief Inara, riss ihre Hand zurück an ihre Brust und hielt den zitternden Skedi beschützend fest. Das Metall des Dolches war von einem stumpferen Grau als Eisen. Briddite. Sie hatte es schon einmal in den Räumen ihrer Mutter gesehen: das Schwert, das sie aus dem Krieg mitgebracht hatte, war aus Briddite. Es konnte Skedi im Handumdrehen töten.
»Wo ist sein Schrein?«, wollte die Veiga wissen. Ein oder zwei Gäste blickten neugierig zu ihnen, aber die Lautstärke in der Taverne änderte sich nicht. Inara biss sich auf die Unterlippe. »Antworte, Mädchen!«
»Du hast mir gar nichts zu befehlen«, gab Inara im Tonfall ihrer Mutter zurück. Was die Godkillerin sichtlich nicht beeindruckte. Aber sie brauchten sie. Sie beide brauchten sie. »Er hat keinen Schrein«, räumte sie ein.
»Alle Götter haben Schreine. Sogar wilde Götter haben irgendwelche Heiligtümer.« Die Veiga zog das Messer aus der Tischplatte.
»Was glaubst du denn, warum ich hier bin?«, zischte Inara und sah sich um. Sie und Skedi hatten so viel Zeit damit verbracht, sich zu verstecken, zu hoffen, herumzuschleichen und zu suchen. Die Godkillerin kaute auf ihrer Wange und lehnte sich abwartend zurück. »Er ist einfach so aufgetaucht. Vor fünf Jahren. Er ist … irgendwie an mich gebunden.«
Sie war kaum groß genug gewesen, um einen Bogen zu spannen, aber sie war am Morgen mit einem kleinen Gott in ihrem Kinderbett aufgewacht, der sich niemals weiter als zwanzig Schritte von ihr entfernen konnte. Wenn sie es versuchten, litten sie beide Schmerzen.
»Und wir können es niemandem sagen, weil ich dann in den Kerker gesteckt werde«, fügte Inara hinzu. »Oder meine Mutter wird es, und er wird umgebracht. Es ist nicht seine Schuld, er kann sich nicht erinnern, was passiert ist.«
»Und wie kommst du darauf, dass ich dich nicht an den Vogt ausliefere und deinen kleinen Nager für Silber selbst umbringe?«
Inara schnappte nach Luft. Nein, das war genau das, was sie nicht wollten, und dabei hatte sie der Veiga noch nicht einmal von den Farben erzählt, die sie sah. Was würde die Godkillerin dann mit ihr machen? Würde sie sie auch töten? War alles umsonst? Hatte sie alles nur noch schlimmer gemacht?
Lass uns flüchten, sagte Skedi in Inaras Kopf. Sie konnten nicht wegrennen. Sie würden gefangen werden oder genau dorthin zurückkehren, wo sie angefangen hatten.
»Weil, Godkillerin«, antwortete Inara, »ich alle Bücher in unserer Bibliothek gelesen habe und nichts über Götter ohne Schreine finden kann oder warum wir aneinander gebunden sind. Weil es nicht seine Schuld ist, dass er lebt, und weil ich versuche, das Richtige zu tun, und ihn freilassen will, ohne meine Familie in Schwierigkeiten zu bringen. Denn wenn wir eine andere Möglichkeit hätten, würden wir nicht vor einer unhöflichen, stinkenden Veiga sitzen und sie um Hilfe bitten.«
Die Augen der Godkillerin verengten sich zu schmalen Schlitzen, aber bevor sie antworten konnte, ertönte ein Schrei von der Tür der Taverne.
»Da ist sie!«
Inara drehte sich um und sah einen Jungen mit einer primitiv gefertigten Armbrust, die kein Waffenschmied je verkauft hätte. Er zielte damit direkt auf die Godkillerin.
»Verflucht!«, stieß die Veiga hervor, während sich Skedi noch tiefer in Inaras Röcken versteckte. Mit einer Hand packte die Gottkillerin den Stuhl neben sich und hielt ihn vor Inara. Der Stuhl erzitterte unter dem Aufprall des Bolzens, der sich eine Handbreit vor Inaras Gesicht in die Sitzfläche grub.
»He!«, rief Rosalie. »Nicht in meiner …«
»Stirb, Godkillerin! Für Ennerast!« Drei weitere Personen stürmten durch die Seitentür der Taverne, eine davon mit einer gewöhnlichen Spaltaxt in der Hand.
Die Godkillerin wirbelte das Messer in der Luft herum, fasste es an der Klinge und schleuderte es wie einen hüpfenden Stein. Der Knauf traf den Mann hart am Auge, und er fiel um. Die Axt landete auf seiner Brust, mit der Klinge nach oben. Glück gehabt. Jemand packte Inara am Kragen, und sie schrie vor Überraschung auf, als die Veiga sie vom Stuhl hochriss und sie unsanft in die Ecke neben dem Fenster schleuderte, außer Reichweite des Tumults.
Dann machte die Veiga zwei lange Schritte und hämmerte dem Armbrustschützen den Hocker gegen den Hinterkopf. Der Mann landete krachend auf dem Boden. Die Frau neben ihm hielt eine kleinere Faustaxt und schrie laut auf, als sie damit ausholte, aber die Godkillerin rammte ihr den Hocker direkt in den aufgerissenen Kiefer und anschließend in den Bauch.
Sie hatte nicht bemerkt, dass ein vierter Bursche hinter sie geschlüpft war.
»Pass auf!«, schrie Inara. Er schwang eine Sense, die er am Stiel grob gekürzt und zu einer Waffe gebogen hatte. Sie landete mit einem ekligen Knall im rechten Bein der Veiga.
Die Godkillerin wankte jedoch nicht, sondern hämmerte ihm den Hocker in die Knie. Seine Beine versagten ihm den Dienst. Sie zückte das Schwert an ihrer Taille und setzte ihm die Spitze an die Kehle. Die Klinge war dunkel: Auch das war Briddite. Sein Adamsapfel hüpfte hastig, als er schluckte.
»Mach weiter!«, stieß er hervor. Seine Stimme, halb gebrochen, quietschte wie ein ungeöltes Rad. »Du hast unsere Gottheit getötet, also kannst du mich auch gleich töten.«
Inara hielt den Atem an. Das würde sie doch nicht tun, oder? Skedi sprach wieder in ihrem Geist.
Sie ist zu gefährlich.
Die Godkillerin lachte höhnisch. »Ich töte keine Menschen«, sagte sie und steckte das Schwert wieder in die Scheide. Der Junge krabbelte zurück, und sein letztes bisschen Mut verließ ihn, als er in Tränen ausbrach. In der Taverne war es still geworden, als alle darauf warteten, dass noch etwas passierte.
Die Veiga sah zu Rosalie auf, die ihr einen gequälten Blick zuwarf. »Schon gut«, seufzte die Veiga. »Ich verschwinde dann mal lieber.«
Sie entschuldigte sich nicht. Sie hatte dieses Chaos aus zertrümmertem Holz schließlich nicht verursacht.
Die Godkillerin trat an ihren Tisch zurück. Ihr Gang war etwas anders, aber sie litt offenbar keine Schmerzen. Sie hob ihre Satteltaschen vom Boden auf, bevor sie Inara in die Augen sah. Inara wusste nicht, ob sie froh oder entsetzt war, dass sie sich an sie erinnerte.
»Du«, sagte die Veiga mit einem Gesicht, das einen Fluch hätte wirken können. »Du kommst mit.«
Inara wusste nicht, was sie hätte tun sollen, außer ihr nach draußen zu folgen. Der Platz war leer und dunkel, die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden, aber der Mond noch nicht aufgegangen.
»Was für ein Gott ist das?«, wollte die Veiga wissen.
»Ein Gott der Notlügen«, sagte Inara zitternd und blickte noch einmal zurück auf das Chaos in der Bar. Skedi klammerte sich an ihr Handgelenk.
»Na, großartig«, erwiderte die Godkillerin. Ihre Stimme troff vor Sarkasmus. »Na gut. Ich bringe dich und deinen Parasiten zu deinen Eltern zurück. Du kannst mich Kyssen nennen.«
KAPITEL 3
Elogast
Elogast liebte es, Teig zu kneten. Einmal kneten und falten, dann kneten und wieder zusammenfalten. Das war einfach und fesselte die Aufmerksamkeit. Es beruhigte ihn, beruhigte seine Gedanken, beruhigte das Klopfen seines unruhigen Herzens.
Brot war ein lebendiges Wesen: angenehm und ehrlich. Die Hitze des Ofens, dessen Klappe geöffnet war, um etwas Wärme abzugeben, strich über seine Wangen und erweckte die hefehaltige Luft zum Leben. Es war das Ende eines kühlen Frühlingstages, und seine Bäckerei in den westlichen Niederungen von Middren hatte gutes Geld verdient. Jetzt begann er mit dem Brot, dessen Teig über Nacht aufgehen und am Morgen gebacken werden sollte. Und bereitete alles für die Nachtarbeiter vor, die Minenarbeiter, die in wechselnden Schichten das Silber aus den nahen Flözen schlugen. Die obere Klappe der Küchentür stand offen, um den Raum abzukühlen und den Duft des Fliederbaums seines Nachbarn hereinzulassen, während er arbeitete. Kleine Freuden, sagte er sich, während seine Hände rhythmisch den Teig schlugen.
Götter, war ihm langweilig!
Einmal kneten und zusammenklappen, zweimal kneten und wieder klappen. Der Teig kräuselte sich, als er ihn durch das Mehl auf der hölzernen Arbeitsplatte rollte. Sie war der Stolz seiner Bäckerei, eigens in Auftrag gegeben und aus irisianischem Räucherholz hergestellt, aus dem Land seiner Mütter. Es hatte das gleiche schöne dunkle, warme Braun wie seine Haut, und das helle, gemahlene Weizenmehl hob sich auf beiden ab wie Sterne oder Schnee. Diese Platte war eine bessere Oberfläche als in den überfüllten Küchen des Reach in Sakre, dem Palast der Hauptstadt Middren, wo er als Knappe gearbeitet hatte. Und auch besser noch als die flachen Steine und der Schlamm eines Schlachtfeldes.
Seine Finger hielten inne, zitterten leicht, und ein stechender Schmerz durchzog seine Schulter und seine Brust. Er atmete langsam durch und grub seine Hände wieder in den Teig, fühlte seine Weichheit, seine Zartheit. So kostbar. Der Schmerz ließ nach, dann auch das Zittern.