
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gods and Warriors
- Sprache: Deutsch
Der 12-jährige Ziegenhirt Hylas weiß nicht, wie ihm geschieht, als ihn in den Bergen plötzlich mysteriöse Krieger angreifen – albtraumhafte Gestalten in Rüstungen aus schwarzem Leder, umgeben von einem Dickicht aus Speeren, die Gesichter mit Asche beschmiert. Diese schwarzen Krieger wollen Hylas töten. Er weiß nicht, warum, aber er muss entkommen. Und so beginnt seine Reise über Land und Meer. Seine einzigen Verbündeten sind Pirra, die rebellische Tochter einer Hohepriesterin, und ein Delfin namens Filos. Aber die schwarzen Krieger sind erbarmungslos. Doch warum nur jagen sie Hylas ... und wie soll er überleben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Aus dem Englischen vonGerald Jung und Sabine Reinhardus
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlagin der Penguin Random House VerlagsgruppeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2014 der deutschsprachigen Ausgabe cbj, Münchenin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2012 Michelle Paver
Die englische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel: »Gods and Warriors« bei Puffin Books, einem Imprint von Penguin Books Ltd, UK
Übersetzung: Gerald Jung, Sabine Reinhardus
Coverkonzeption: init|Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen
unter Verwendung des Logos von James Frazer und Fotos von © Shutterstock, Arcangel und I-Stock images
Illustration: Fred Van Deelen; © 2012 Puffin Books
MP · Herstellung: UK
Satz: Uhl & Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-11003-1V002www.cbj-verlag.de
Der schwarze Pfeilschaft war mit Krähenfedern versehen, doch die Spitze konnte Hylas nicht erkennen. Sie steckte tief in seinem Arm.
Während er den Hügel hinunterstolperte, hielt er den Schaft mit einer Hand fest. Zum Herausziehen hatte er keine Zeit. Die Schwarzen Krieger konnten ganz in der Nähe sein.
Er war halb verdurstet und völlig erschöpft. Die Sonne brannte unbarmherzig und das Dornengestrüpp bot wenig Deckung. Er fühlte sich entsetzlich ausgeliefert. Am schlimmsten aber setzte ihm die Sorge um Issi zu und das fassungslose Entsetzen darüber, was mit Scram geschehen war.
Vor ihm lag der Pfad ins Tal. Er blieb keuchend stehen. Zikaden sirrten ohrenbetäubend, ein Falkenschrei hallte durch die Schlucht. Von seinen Verfolgern war nichts zu hören. Hatte er sie tatsächlich abgeschüttelt?
Er konnte es immer noch nicht glauben. Am Abend zuvor hatten er und Issi ihr Lager in einer Höhle unterhalb des westlichen Gipfels aufgeschlagen. Nun war seine Schwester verschwunden, sein Hund war tot, und er rannte, unbekleidet und unbewaffnet, um sein Leben. Sein einziger Schutz war das schmutzige, kleine Amulett, das er an einem Lederriemen um den Hals trug.
Der verletzte Arm pochte schmerzhaft. Hylas hielt den Pfeilschaft umklammert und wankte zum Rand des Pfades. Kleine Steinchen lösten sich und kullerten in die schwindelerregende Tiefe, wo sich der Fluss wand. Der Abhang war so steil, dass seine Zehen sich auf gleicher Höhe mit den Kiefernwipfeln ein Stück weiter unten befanden. Vor ihm erstreckte sich die Bergkette bis in weite Ferne, hinter ihm ragte der höchste Berg des Gebirgszuges auf: der Lykas, dessen schneebedeckte Gipfel gleißend in der Sonne leuchteten.
Er dachte an das Dorf tief unten in der Schlucht und an seinen Freund Telamon in der Festung des Stammesfürsten auf der anderen Seite des Berges. Hatten die Schwarzen Krieger das Dorf in Brand gesteckt und die Feste Laphitos angegriffen? Aber dann hätte er den Rauch riechen oder den Alarmruf der Widderhörner hören müssen. Warum leisteten der Fürst und seine Männer keinen Widerstand?
Der Schmerz in seinem Arm war inzwischen unerträglich geworden. Hylas pflückte eine Handvoll Thymianzweige und riss das pelzige, graue Blatt einer Königskerze ab, um die Wunde damit zu verbinden. Es war so flauschig weich wie ein Hundeohr. Er runzelte die Stirn. Jetzt bloß nicht an Scram denken.
Sie waren bis kurz vor dem Angriff zusammen gewesen, Scram hatte sich an ihn geschmiegt, das struppige Fell voller Kletten. Hylas hatte einige herausgeklaubt, bevor er Scrams Schnauze weggeschoben und ihm befohlen hatte, die Ziegen zu bewachen. Scram war mit wedelndem Schwanz davongetrottet und hatte ihm mit einem Blick zurück zu verstehen gegeben: Ich weiß schon, was ich zu tun habe, ich bin schließlich ein Hirtenhund.
Denk nicht dauernd an Scram, ermahnte sich Hylas wütend.
Er presste die Zähne zusammen und legte die Finger fester um den Pfeilschaft. Dann hielt er die Luft an und zog ihn mit einem Ruck heraus.
Der Schmerz war so heftig, dass er beinahe in Ohnmacht gefallen wäre. Er biss sich auf die Lippe, kämpfte schwankend gegen die Übelkeit erregenden roten Wellen an. Scram, wo bist du? Warum bist du nicht hier und tröstest mich?
Mit schmerzverzerrtem Gesicht zerrieb Hylas den Thymian und presste ihn auf die Wunde. Das Verbinden mit nur einer Hand gelang ihm erst nach einer Weile. Zum Schluss wickelte er einen Grashalm um das Wollkraut und zog ihn mit den Zähnen fest.
Vor ihm auf dem Boden lag die Pfeilspitze. So eine hatte er noch nie gesehen: Sie war rund wie ein Pappelblatt, mit einer üblen, sich verjüngenden Spitze. Hier in den Bergen verwendete man Pfeilspitzen aus Feuerstein oder gelegentlich Bronze, vorausgesetzt man war reich genug. Diese Spitze bestand jedoch aus schwarz glänzendem Obsidian, was Hylas nur wusste, weil die Seherin im Dorf eine Scherbe aus diesem Material besaß. Sie behauptete, es sei das Blut von Mutter Erde, das sie aus ihren glühenden Eingeweiden ausgespien habe. Es stamme von einer Insel weit draußen im Meer.
Wer waren diese Schwarzen Krieger? Warum verfolgten sie ihn? Er hatte doch nichts Böses getan.
Ob sie inzwischen Issi gefunden hatten?
Plötzlich flatterte hinter ihm ein Taubenschwarm auf.
Er wirbelte herum.
Von dort, wo er stand, führte der Pfad steil bergab und dann um einen Felsvorsprung, hinter dem eine dichte, rote Staubwolke aufstieg. Hylas vernahm stampfende Schritte und das Klappern von Pfeilen in Köchern. Sein Magen zog sich zusammen.
Sie waren zurückgekommen.
Er kroch über den Rand des Pfades, bekam einen Kiefernschössling zu fassen und klammerte sich wie eine Fledermaus daran fest.
Die stampfenden Schritte kamen näher.
Hylas ertastete mit den Zehen einen kleinen Vorsprung und schob sich darauf seitwärts unter einen kleinen Überhang. Das Gesicht an eine Baumwurzel gepresst, warf er einen Blick in die Schlucht und bereute es sofort. Alles was er sah, waren die schwindelerregenden wogenden Baumkronen unter ihm.
Die Krieger hatten ein rasches Tempo angeschlagen. Hylas hörte Leder knirschen, roch ranzigen Schweiß und einen seltsam bitteren, schrecklich vertrauten Geruch. Derselbe Geruch war ihm bereits gestern Abend aufgefallen. Die Krieger hatten ihre Haut mit Asche eingerieben.
Unter dem Überhang konnten ihn die Männer zwar nicht sehen, aber zu seiner Linken wand sich der Pfad in einer weiten Kehre bis in die Schlucht hinein. Er hörte den Trupp schnaufend vorbeistürmen und in der Kurve sah er die Männer in einer dichten, roten Staubwolke: albtraumhafte Gestalten in Rüstungen aus steifem schwarzen Leder, umgeben von einem Dickicht aus Speeren, Dolchen und Bögen. Die langen schwarzen Umhänge flatterten wie Krähenflügel hinter ihnen, die Gesichter unter den Helmen waren aschgrau.
Plötzlich ertönte ganz in der Nähe eine Männerstimme.
Hylas hielt die Luft an. Der Krieger musste unmittelbar über ihm auf dem Pfad stehen.
Die anderen weiter oben auf dem Weg machten kehrt und kamen zurück, direkt auf Hylas zu.
Steinchen knirschten unter Sohlen, als sich ein einzelner Mann näherte. Seinem gemächlichen Tempo nach zu urteilen war er sicher der Anführer. Das Klirren seiner Rüstung klang eigentümlich laut und metallisch.
»Sieh mal, da«, sagte der Mann, der zuerst stehen geblieben war. »Blut.«
Hylas überlief es eiskalt. Blut. Sein Blut. Es musste auf den Pfad getropft sein.
Er wartete.
Der Anführer schwieg.
Sein Schweigen schien den anderen Krieger zu verunsichern. »Wahrscheinlich ist es nur das Blut des Ziegenhirten«, sagte er hastig. »Entschuldige. Du wolltest ihn lebendig haben.«
Beharrliches Schweigen.
Hylas war schweißüberströmt. Mit einem Mal fiel ihm ein, dass die Pfeilspitze ebenfalls auf dem Pfad lag. Hoffentlich entdeckten die Männer sie nicht.
Er verrenkte sich fast den Hals, bis er schließlich unmittelbar über sich die Hand eines Mannes erkannte, die sich auf einen Stein an der Kante über ihm stützte.
Die kräftige Hand sah wie die eines Toten aus. Die Haut war mit grauer Asche eingerieben, und die Nägel waren pechschwarz. Der Armschutz des Mannes glühte rot wie die untergehende Sonne und blinkte so hell, dass der Anblick beinahe schmerzte. Hylas wusste, was das war, obwohl er es zum ersten Mal aus der Nähe sah: Bronze.
Trotz der Staubkörnchen in seinen Augen wagte er nicht einmal, zu blinzeln. Die beiden Männer standen so dicht über ihm, dass er ihre Atemstöße hörte.
»Weg damit!«, sagte der Anführer. Seine Stimme klang dumpf und tief. Hylas dachte unwillkürlich an eine kalte Höhle, in die niemals ein Sonnenstrahl fiel.
Dann fiel etwas Schweres über den Rand und verfehlte ihn nur knapp. Es landete krachend in dem dornigen Baum, eine Armeslänge entfernt, und blieb an seinem Fuß liegen. Als Hylas begriff, was es war, wurde ihm übel.
Früher war es einmal ein Junge gewesen, aber nun war es nur noch ein blutiges, zerschundenes Bündel. Hylas kannte den Toten. Skiros war zwar nicht sein Freund gewesen, aber er hatte Ziegen gehütet, so wie Hylas. Der Tote war etwas älter als Hylas und hatte als besonders rücksichtsloser Kämpfer gegolten.
Die Leiche war bedrohlich nahe, er konnte sie beinahe berühren. Er spürte, wie der böse Geist aus dem Toten ausbrechen wollte. Wenn er ihn fand und in seine Kehle eindrang …
»Damit haben wir sie alle erledigt«, sagte der Mann.
»Was ist mit dem Mädchen?«, fragte der Anführer.
Hylas erstarrte.
»Ist das Mädchen denn wichtig?«, entgegnete der andere. »Es ist doch bloß ein …«
»Und der andere geflüchtete Junge?«
»Den habe ich mit dem Pfeil erwischt, der kommt nicht weit.«
»Dann haben wir also nicht alle erledigt«, erwiderte der Anführer kalt. »Nicht, solange dieser Junge noch am Leben ist.«
»Das ist wahr.« Der andere klang ängstlich.
Wieder knirschten Steinchen, als sich die Männer erneut in Bewegung setzten. Hylas hoffte inständig, dass sie nicht stehen bleiben würden.
An der Kurve, wo der Pfad in Richtung Tal vorsprang, hielt der Anführer inne. Den Fuß auf einen Stein gesetzt, beugte er sich vor und spähte in die Tiefe.
Er sah nicht aus wie ein Mensch, sondern eher wie ein dunkles Ungeheuer aus Bronze. Bronzene Beinschienen umschlossen seine muskulösen Beine und ein Bronzeschutz bedeckte den kurzen schwarzen Lederschurz. Die Brustplatte bestand aus gehämmerter Bronze, die bronzenen Schulterschienen waren ausladend breit. Bis auf einen schmalen Augenschlitz war von dem Gesicht des Mannes nichts zu erkennen. Sein Gesichtsschutz umschloss Nase und Mund und reichte bis zum Hals. Der schwarz bemalte Helm mit dem bronzenen Wangenschutz bestand aus schuppenförmig angebrachten Hälften von Eberstoßzähnen. Ein Kamm aus schwarzem Rossschweif schmückte die Helmspitze. Lediglich das Haar des Mannes wirkte menschlich. Es reichte ihm bis zu den Schultern und war zu schlangenartigen Zöpfen geflochten, wie sie Krieger zu tragen pflegten. Jeder Zopf war dick genug, um einen Schwerthieb abzuwehren.
Obwohl er wusste, dass der Mann womöglich seinen Blick spürte, starrte Hylas wie gebannt auf die Sehschlitze, hinter denen die unsichtbaren Augen die Hänge der Schlucht nach ihm absuchten.
Langsam richtete der Mann den Blick nach oben, flussaufwärts.
Unternimm etwas, ermahnte sich Hylas. Wenn er sich umdreht, entdeckt er dich …
Vorsichtig löste Hylas eine Hand von dem Schössling und streckte sie nach Skiros’ Leiche im Dornengestrüpp aus. Er versetzte dem Baum einen Stoß. Die Leiche erzitterte, als missfalle es ihr, berührt zu werden.
Der behelmte Kopf drehte sich in seine Richtung.
Mit weit ausgestrecktem Arm versuchte es Hylas erneut. Die Leiche löste sich aus dem Geäst und kollerte, sich überschlagend, talwärts.
»Schau mal«, sagte einer der Krieger kichernd. »Da macht sich einer davon.«
Die anderen stimmten in das Lachen ein, nur der Anführer verzog keine Miene, sondern sah stumm zu, bis die Leiche schließlich am Fuß des Hügels aufschlug. Dann zog er sich von seinem Ausguck zurück.
Hylas blinzelte den Schweiß aus den Augen und lauschte angestrengt, während die Schritte allmählich leiser wurden.
Der Schößling gab unter seinem Gewicht nach, Hylas griff nach einer Baumwurzel.
Aber er griff ins Leere.
Halb rutschend, halb fallend stürzte Hylas bis ans Flussufer. Ein Regen aus Kieselsteinen ging auf ihn nieder – aber keine Pfeile.
Er war kopfüber in einem Ginsterbusch gelandet, rührte sich jedoch trotz der piekenden Stacheln nicht. Jäger nehmen jede Bewegung wahr. Obwohl er sich völlig zerschlagen und zerkratzt fühlte, hatte er sich wahrscheinlich keine Knochen gebrochen, auch das Amulett trug er immer noch.
Fliegen summten, die Sonne brannte ihm auf den Rücken. Schließlich hob er den Kopf und sah sich vorsichtig um. Von den Schwarzen Kriegern war nichts zu sehen.
Skiros lag etwas weiter oben am Hang. Genauer gesagt, das, was von ihm noch übrig war. Die ersten Geier hatten sich bereits eingefunden und kreisten gierig. Skiros hatte den Kopf verdreht, als wollte er sich alles genau ansehen.
Sein Geist brauchte Hilfe für die Reise, aber Hylas konnte es einfach nicht riskieren, ihn zu begraben und die Bestattungsrituale durchzuführen. »Tut mir leid, Skiros«, murmelte er. »Das wäre gegen die Überlebensregel. Hilf keinem, der dir nicht helfen kann.«
Weiden- und Esskastanienäste ragten bis weit über den Fluss und boten Hylas Deckung. Erleichtert taumelte er ins seichte Wasser, fiel auf die Knie und trank in gierigen Zügen. Er benetzte sich mit Wasser und biss die Zähne zusammen, als die eiskalten Tropfen auf seine heiße, aufgescheuerte Haut sprühten. Er erhaschte einen kurzen Blick auf sein verzerrtes Abbild im Fluss. Schmale Augen, die Lippen vor Anspannung zusammengepresst, langes, offenes Haar.
Der Trunk tat ihm gut, zum ersten Mal seit dem Angriff konnte er wieder einen klaren Gedanken fassen. Er benötigte Nahrung, Kleider und ein Messer. Vor allen Dingen musste er auf dem schnellsten Weg ins Dorf. Issi wusste, dass sie im Dorf am sichersten sein würde, und war inzwischen bestimmt dort angekommen. Sie muss ganz einfach dort sein.
Das Krächzen der Geier erfüllte die Schlucht. Von Skiros war unter dem dichten Schwarm nackter Hälse und staubiger Flügel nichts mehr zu sehen. Damit ihn der Geist des Toten nicht verfolgte, riss Hylas hastig ein paar Knoblauchblätter ab und streute sie hinter sich. Geister nähren sich vom Geruch der Nahrung, je durchdringender, desto besser. Dann machte er sich rasch auf den Weg und ging am Fluss entlang durch die Schlucht.
Hylas spürte, dass ihn die Bäume und Felsen beobachteten. Würden sie ihn verraten? Er war in diesen Bergen aufgewachsen, kannte ihre geheimen Pfade und die Lebensweise der wilden Geschöpfe: den Schrei des Falken, das Brüllen des Löwen. Er wusste auch um die verkohlten Rinnen, denen man der Erzürnten wegen ausweichen musste. Aber nun war alles anders.
Dann haben wir also nicht alle erledigt, hatte der Krieger gesagt. Offenbar wusste er, dass Hylas noch am Leben war. Aber wen hatte er mit »sie« gemeint?
Mit einem Mal verstand Hylas, und die Erkenntnis war wie ein Schock: Skiros war nicht nur Ziegenhirte gewesen, sondern ein Fremdling.
Ein Fremdling wie Hylas und wie Issi. Sie waren außerhalb des Dorfes zur Welt gekommen. Neleos, der Dorfälteste, hatte das Geschwisterpaar vor Jahren, als sie beide noch klein waren, in den Bergen gefunden und es für sich arbeiten lassen. Im Sommer hüteten sie die Ziegen oben auf den Almen, im Winter unten in der Schlucht.
Aus welchem Grund verfolgten die Schwarzen Krieger Fremdlinge? Das ergab keinen Sinn. Niemand scherte sich um Fremdlinge, alle blickten auf sie herab.
Die Sonne wanderte nach Westen, die Schatten krochen langsam an den Steilhängen der Schlucht empor. In der Ferne kläffte ein Hund. Das Bellen klang ängstlich, und Hylas wünschte, es würde aufhören.
Er erreichte den kleinen dreifüßigen Opfertisch aus Lehm, der unter einem Baum stand. Hier brachte man dem Gott der Berge Opfer dar. Auf dem Tisch lag ein schäbiges Hasenfell, das er sich um die Hüften schlang. Eine Eidechse sah ihm ungnädig dabei zu, und er murmelte eine Entschuldigung, falls das Tier ein verwandelter Geist sein sollte.
Es war gut, nicht mehr nackt zu sein, aber ihm war schwindlig vor Hunger. Für Feigen war es noch zu früh im Sommer, aber er pflückte im Laufen ein paar von Mäusen angeknabberte Erdbeeren. In einem Busch hatte ein Neuntöter seine Beute auf Dornen gespießt: drei Zikaden und einen Spatz. Mit einem eiligen »Entschuldige« stopfte sich Hylas alles in den Mund und spie im Laufen Federn und Insektenschalen aus.
Allmählich ging die Wildnis in Olivenbäume über; an den Hängen waren Terrassen für den Ackerbau angelegt. Die Gerste war bereits reif für die Ernte, aber niemand brachte sie ein. Offenbar hatten sich alle ins Dorf geflüchtet, falls die Schwarzen Krieger es nicht bereits in Schutt und Asche gelegt hatten.
Doch zu seiner Erleichterung standen die Hütten noch, allerdings herrschte eine unheilvolle Stille. Lehmziegelhütten duckten sich wie eine verängstigte Schafherde hinter den Palisaden aus Dorngestrüpp. Es roch nach verbranntem Holz, Stimmen hörte er nicht. Vor dem Dorf waren weder Esel noch in der Erde wühlende Schweine zu sehen wie sonst, und die Geisterpforten waren geschlossen.
Sie waren mit dunkelrotem Ocker bemalt und von dem Horn eines Stiers, der am Querbalken befestigt war, spähte ein Ahne herab. Er hatte die Gestalt einer Elster angenommen, war aber zweifellos ein Ahne – allerdings keiner seiner Ahnen.
Hylas streute die Gerste aus, die er unterwegs mitgenommen hatte, doch der Ahne missachtete das Opfer. Er wusste, dass Hylas nicht hierher gehörte. Die Geisterpforte schützte das Dorf und wachte darüber, dass keine Fremdlinge eindrangen.
Das Tor öffnete sich mit leisem Quietschen und ein paar schmutzige Gesichter spähten durch den Spalt. Hylas hatte seine gesamte Kindheit in diesem Dorf verbracht, aber jetzt musterten ihn die Dörfler wie einen Fremden. Einige hielten Fackeln aus Fenchelstangen hoch, deren Flammen spuckend loderten. Alle hatten sich mit Äxten, Sicheln und Speeren bewaffnet.
Plötzlich durchbrachen die Hunde unter wildem Gekläff die Menge und stürmten auf ihn zu. Ein Hirtenhund namens Dart führte das Rudel an. Er war so groß wie ein Eber und konnte einem ausgewachsenen Mann mit einem Biss die Kehle zerreißen. Er hielt abrupt vor Hylas inne und starrte ihn durchdringend an, den Kopf bedrohlich gesenkt. Dart wusste, dass Hylas das Dorf nicht betreten durfte.
Hylas wich nicht von der Stelle. Nur ein Schritt zurück und Dart würde sich auf ihn stürzen. »Lasst mich rein!«, rief er.
»Was willst du hier?«, knurrte Neleos, der Dorfälteste. »Du sollst draußen in den Bergen meine Ziegen hüten!«
»Lasst mich rein. Ich suche meine Schwester.«
»Sie ist nicht hier. Wie kommst du darauf?«
Hylas blinzelte ungläubig. »Aber – wo kann sie sonst sein?«
»Vermutlich tot. Wen kümmert das schon.«
»Du lügst«, gab Hylas zurück. Panik stieg in ihm auf.
»Du hast meine Ziegen im Stich gelassen!«, brüllte Neleos. »Deine Schwester würde es nicht wagen, ohne Ziegen zurückzukehren. Du bist anscheinend ganz versessen auf eine Tracht Prügel, sonst würdest du dich nicht hierhertrauen.«
»Sie wird bald hier sein. Lass mich rein! Sie sind hinter mir her!«
Neleos kniff die Augen zusammen und kratzte sich mit seiner schwieligen Hand nachdenklich den Bart. Er hatte die O-Beine eines Bauern, und das Joch hatte seine Schultern gekrümmt, aber er war listig wie ein Wiesel und stets auf seinen Vorteil bedacht. Hylas wusste, dass Neleos in der Zwickmühle steckte: Einerseits wollte er ihn bestrafen, weil er die Ziegen im Stich gelassen hatte, andererseits widerstrebte es ihm, dadurch seinen Ziegenhirten zu verlieren.
»Sie haben Skiros getötet«, fuhr Hylas fort, »und mich werden sie auch umbringen. Vergesst eure Grundsätze und lasst mich ins Dorf.«
»Schick ihn weg, Neleos«, ertönte eine schrille Frauenstimme. »Seit du ihn gefunden hast, haben wir nichts als Ärger mit ihm.«
»Ja, hetz die Hunde auf ihn«, schrie eine andere. »Wenn sie ihn hier erwischen, sind wir alle in Gefahr.«
»Sie hat recht, lass die Hunde auf ihn los! Er hat bestimmt was angestellt, sonst wären sie nicht hinter ihm her.«
»Wer sind diese Männer?«, rief Hylas. »Warum verfolgen sie Fremdlinge?«
»Das weiß ich nicht, und es ist mir auch egal«, fauchte Neleos, doch seine Angst war unverkennbar. »Ich weiß bloß, dass sie aus dem Osten kommen und hinter Fremdlingen her sind. Meinetwegen! Sollen sie doch machen, was sie wollen, solange sie uns in Ruhe lassen.«
Die Dörfler brachen in zustimmende Rufe aus.
Hylas leckte sich nervös die Lippen. »Was ist mit dem Recht auf Zuflucht? Ihr seid dazu verpflichtet, jemanden einzulassen, der in Lebensgefahr schwebt.«
Neleos zögerte einen Augenblick, dann setzte er eine steinerne Miene auf. »Dieses Recht gilt nicht für Fremdlinge«, stieß er hervor. »Und jetzt sieh zu, dass du weiterkommst, sonst hetze ich dir noch die Hunde auf den Hals.«
Die Dämmerung brach herein. Wohin sollte er jetzt gehen?
Na gut, dann eben nicht, dachte Hylas wutschäumend. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, helfe ich mir eben selbst.
Zwischen den Pinien hindurch schlich er zum rückwärtigen Tor. Es lag verlassen da, alle hatten sich an der Geisterpforte versammelt.
Falls die Dörfler glaubten, er sei noch nie in ihrem Dorf gewesen, hatten sie sich gründlich getäuscht. Ein Fremdling scheute auch vor Diebstahl nicht zurück, um zu überleben.
Hylas schlüpfte durch eine Lücke im Gebüsch und kroch zur nächstliegenden Hütte, die einer verschlagenen alten Witwe namens Tyro gehörte. Die Alte hatte Kohlen auf das Feuer gehäuft und im rauchgeschwängerten, rötlichen Dämmerlicht stieß er ein kleines Gefäß mit Milch für die Hausschlange um. Das in Lumpen gehüllte Bündel auf dem Lager in der Ecke gab ein Grunzen von sich.
Hylas blieb bewegungslos stehen und wartete einen Augenblick, bevor er langsam und vorsichtig einen geräucherten Schinken vom Haken nahm.
Tyro rührte sich im Schlaf, schnarchte aber weiter.
Außer dem Schinken nahm er auch noch eine Tunika, ließ jedoch die Sandalen zurück. Die brauchte er nicht, denn im Sommer ging er immer barfuß. Als Tyro abermals grunzte, machte er sich schleunigst aus dem Staub, allerdings nicht, ohne vorher das Opfergefäß für die Hausschlange gerade hinzustellen. Schlangen verständigten sich untereinander. Wenn man es sich mit einer von ihnen verdarb, machte man sie sich allesamt zu Feinden.
Die zweite Hütte gehörte Nelos. Sie war leer. Hylas raffte einen Trinkschlauch und Lederschnüre für einen Gürtel an sich und stopfte einen Ring Blutwurst, einen Schafskäse, ein Fladenbrot und eine Handvoll Oliven in einen Beutel aus geflochtenem Stroh. Zum Schluss stahl er dem Alten noch Wein aus dem Krug und streute Asche in den Rest, den er übrig ließ. Das war seine Rache für die vielen Prügel, die er jahrelang eingesteckt hatte.
Draußen kam der Klang von Stimmen näher; die Geisterpforten schlossen sich knarrend. Hylas machte sich rasch durch das Gebüsch davon. Erst vor dem Dorf fiel ihm auf, dass er vergessen hatte, ein Messer mitzunehmen.
Inzwischen war der Mond aufgegangen, und der durchdringende Chor der Nachtzikaden setzte ein, als Hylas den schattigen Mandelbaumhain hinter dem Dorf erreichte. Er streifte eilig die Tunika über und schlang sich das Seil um die Taille.
Ein paar verspätete Bienen summten um die Stöcke. Im Gras stand ein Opfertisch. Hoffentlich hatten sich alle von den Göttern geschickten Kreaturen bereits bedient, dachte er und schlang zwei Honigkuchen sowie einen Fladen herunter. Der Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl war üppig mit einem Mus aus Linsen, getrocknetem Barsch und Käsekrümeln gefüllt und schmeckte besonders köstlich. Hylas ließ einen winzigen Rest für die Bienen übrig und bat sie, nach Issi Ausschau zu halten. Ihr Summen konnte Ja und Nein bedeuten.
Jedenfalls war Issi bestimmt nicht hier entlanggekommen. Nie im Leben hätte seine Schwester diese leckeren Pfannkuchen verschmäht. Sollte er hier auf sie warten oder sich lieber nach Laphitos durchschlagen, weil sie vielleicht dorthin unterwegs war und seinen Freund Telamon dort zu finden hoffte? Aber Laphitos lag weit entfernt auf der anderen Seite des Berges, und weder Hylas noch seine Schwester waren je dort gewesen. Ihr einziger Anhaltspunkt bestand in den reichlich vagen Beschreibungen Telamons.
Weit entfernt erklang unablässig das Bellen des Hundes, den er schon vorhin gehört hatte. Es klang nun noch verzagter und mutloser. Hylas wünschte sich inständig, das Gebell würde aufhören, denn es erinnerte ihn an Scram.
Er wollte jetzt nicht an seinen Hund denken. Das durfte er einfach nicht. In seinem Schädel waren alle möglichen unangenehmen Erinnerungen hinter einer schützenden Mauer eingeschlossen.
In den Bergen kühlte die Luft nach Sonnenuntergang rasch ab, und bald klapperte Hylas trotz der groben Wolltunika mit den Zähnen. Da er zudem völlig erschöpft war, beschloss er, sich nach einem Schlafplatz umzusehen.
Er war noch nicht weit gekommen, als er bemerkte, dass das Bellen verstummt war. Stattdessen ertönte nun ein lang gezogenes, klägliches Jaulen.
Das Jaulen schwoll an, als Hylas um die Kurve bog.
Der Hund war kleiner als Scram, aber genauso struppig. Sein Besitzer hatte ihn vor einer Hütte aus Pinienzweigen an einem Baum festgebunden. Die Wasserschüssel war leer. Der Hund war noch jung und geriet bei Hylas’ Anblick außer Rand und Band. Er stellte sich auf die Hinterbeine und strampelte in ekstatischer Begrüßungsfreude mit den Vorderpfoten.
Hylas war, als presste ihm jemand das Herz zusammen. Das Bild von Scram, wie er mit einem Pfeil in der Flanke tot am Boden lag, tauchte vor ihm auf.
Der Hund bellte aufgeregt und wackelte begeistert mit dem Hinterteil.
»Sei still!«, befahl Hylas.
Das Tier legte den Kopf schräg und winselte.
Hylas öffnete rasch den Trinkschlauch, goss Wasser in die Schüssel und warf dem Hund die Blutwurst zu. Das Tier trank das Wasser in gierigen Zügen und verschlang die Wurst mit einem Happs. Anschließend warf er Hylas mit einem Sprung zu Boden und leckte begeistert seine Wange. Halb betäubt vor Kummer grub Hylas das Gesicht in das Fell des Hundes und sog den warmen, vertrauten Geruch ein. Dann stieß er ihn mit einem Aufschrei von sich, rappelte sich hoch und zog sich außer Reichweite zurück.
Der Hund wedelte mit dem Schwanz und gab ein klägliches Wu-wu-wuhuuu von sich.
»Ich kann dich nicht losbinden«, erklärte Hylas. »Dann folgst du mir und sie fangen mich.«
Der Hund sah ihn flehentlich an.
»Dir passiert schon nichts«, sagte Hylas möglichst überzeugend. »Dein Besitzer hat dir sogar einen Wassernapf zurückgelassen. Bestimmt kommt er bald und holt dich.«
Er handelte doch richtig, oder? Er konnte den Hund einfach nicht mitnehmen, wenn ihn die Schwarzen Krieger verfolgten. Hunde können sich nicht verstecken und man kann einem Hund unmöglich beibringen, dass er einen nicht verraten darf.
Aber wenn sie den Hund töteten, so wie sie Scram getötet hatten?
Schnell, bevor er es sich anders überlegte, ergriff er die Wasserschüssel, befreite den Hund und zog ihn hinter sich her. In Sichtweite des Dorfes band er ihn an einem Baum fest, füllte erneut die Wasserschüssel und vergewisserte sich, dass das Seil nicht zu stramm saß.
»Keine Sorge«, murmelte er. »Jemand wird sich um dich kümmern.«
Er ließ den Hund zurück, der auf den Hinterbeinen hockte und ihm leise winselnd nachschaute. Als Hylas sich umdrehte, sprang er hoch und stieß ein hoffnungsvolles Wu-wuuu aus.
Hylas biss die Zähne zusammen und floh in die Dunkelheit.
Dichte Wolken hatten sich vor den Mond geschoben, und schon bald verlor Hylas in der Dunkelheit die Orientierung. Trinkschlauch und Vorratsbeutel wurden mit jedem Schritt schwerer. Schließlich entdeckte er an einem bewaldeten Hang eine verlassene Steinhütte.
Er kletterte unter dem niedrigen Eingang hindurch. Zerbrochene Tonscherben knirschten unter seinen Füßen, der Geruch nach feuchter Erde stieg ihm in die Nase. Drinnen war es kalt und dunkel, und es roch, als habe sich etwas hereingeschleppt, um hier zu sterben. Aber immerhin bot der Unterschlupf einen gewissen Schutz.
Hylas kauerte sich in der Dunkelheit mit dem Rücken zur Wand nieder und bemerkte den Hundegeruch an sich. Unweigerlich fiel ihm sein letztes Zusammensein mit Scram ein. Er hatte seine Schnauze weggeschoben, aber hatte er ihm auch die Ohren gestreichelt oder ihn unter der Vorderpfote gekratzt, wie Scram es gern mochte?
Er konnte es einfach nicht fassen, dass er Scram nie wieder sehen oder seinen großen, warmen, struppigen Leib an seinem Körper spüren würde. Nie wieder würde sich die haarige Schnauze unter sein Kinn schieben, um ihn zu wecken.
Hylas nestelte den Trinkschlauch auf und trank in großen Schlucken. Dann öffnete er den Vorratsbeutel und suchte nach den Oliven. Plötzlich zitterten seine Hände so heftig, dass sie zu Boden fielen. Er tastete herum, aber vergebens.
Der schützende Wall, der seine Erinnerung umgeben hatte, war zusammengebrochen und alles stürmte wieder auf ihn ein.
Er hatte mit Issi ein Lager am westlichen Gipfel aufgeschlagen. Während Issi in einiger Entfernung ein paar Affodilwurzeln ausgrub, zog er einem Eichhörnchen die Haut ab, um es über dem Feuer zu braten.
»Ich geh mich schnell im Bach abkühlen«, hatte er ihr zugerufen. »Pass auf, dass das Eichhörnchen nicht anbrennt.«
»Wann habe ich je etwas anbrennen lassen?«, hatte sie empört zurückgerufen.
»Vorgestern!«
»Stimmt überhaupt nicht!«
Er ging den Pfad hinunter, ohne auf sie zu achten.
»Es war kein bisschen angebrannt!«, brüllte sie hinter ihm her.
Am Bach hatte er Messer und Schleuder auf einen Stein gelegt, die Tunika ausgezogen und sich langsam ins Wasser gleiten lassen. Vom weit oben war der schrille Schrei eines Falken ertönt: kikikikiki. Er hatte sich beiläufig gefragt, ob das vielleicht ein böses Omen war.
Mit einem Mal begann Scram laut zu bellen. Komm schnell! Etwas Schlimmes! Komm schnell!
Und dann hatte er Issis durchdringenden Schrei gehört.
Ohne sich um die Tunika zu scheren, hatte er das Messer gepackt und war den Pfad hinaufgejagt. Ein Bär? Ein Wolf? Oder gar ein Löwe? Ihrem Schrei nach zu urteilen musste es etwas Schreckliches sein.
Kurz vor dem Lager hörte er leise, entschlossene Männerstimmen und nahm einen seltsam bitteren Aschegeruch wahr. Er hatte sich hinter einen Wacholderbusch geduckt und durch die Zweige gespäht.
Sie hatten vier Ziegen abgeschlachtet, die restliche Herde war geflohen. Er sah Krieger – jawohl, Krieger –, die das Lager durchsuchten. Und er sah Scram. Er brauchte nur einen entsetzlichen Augenblick, um zu begreifen, was er sah: das struppige, mit Kletten verklebte Fell, die großen, starken Pfoten. Der Pfeil, der aus Scrams Flanke ragte.
Dann war sein Blick auf Issi gefallen, die sich in einer Höhle verbarg. Ihr mageres, schmales Gesicht war schreckensbleich. Er musste sie ablenken, sonst würden sie seine Schwester finden.
Seine Schleuder hatte er im Bach zurückgelassen, er trug nur sein Feuersteinmesser bei sich, aber was konnte er damit schon ausrichten? Ein Junge von zwölf Sommern gegen sieben waffenstarrende Männer.
Kurz entschlossen war er aus seinem Versteck hervor ins Freie getreten und hatte gerufen: »Hier bin ich!«
Sieben aschgraue Gesichter hatten sich ihm zugewandt.
Dann lockte er sie im Zickzackkurs von seiner Schwester weg. Er hatte es nicht riskieren können, ihr etwas zuzurufen, aber Issi war schlau. Sie würde keine Minute zögern und die Höhle verlassen.
Pfeile waren links und rechts an ihm vorbeigezischt, einer davon erwischte seinen Arm. Mit einem Schrei hatte er das Messer fallen lassen …
Hylas schlang die Arme um die Knie und wiegte sich vor und zurück. Es war schrecklich, sich unvermittelt an alles zu erinnern. Warum nur hatten die Schwarzen Krieger sie angegriffen? Was hatten er und seine Schwester diesen Männern getan?
Seine Augen brannten, er bekam kaum Luft. Ärgerlich schluckte er den Kloß im Hals herunter. Tränen brachten ihm weder Scram zurück, noch halfen sie ihm, Issi zu finden.
»Ich heule ganz bestimmt nicht«, sagte er laut zu sich selbst. »Das lass ich mir von denen nicht antun.«
Er bleckte die Zähne und drosch mit der Faust auf den Boden, um die Tränen zu unterdrücken.
Ein Strahl des Mondlichts, der durch die Tür fiel, weckte Hylas, und im ersten Moment wusste er nicht, wo er war. Auf der Seite liegend, kämpfte er gegen die Panik an. Dann fiel ihm alles wieder ein – und das war noch schlimmer.
Sobald es hell wird, gehe ich nach Laphitos zu Telamon, sagte er sich. Issi ist wahrscheinlich schon bei ihm. Falls nicht, muss ich sie eben suchen. Sie ist zäh, kennt sich in den Bergen aus und wird sich schon durchschlagen.
Es war einfach ausgeschlossen, dass seine Schwester nicht mehr am Leben war.
Hylas’ Augen hatten sich allmählich an die Dunkelheit gewöhnt. Jetzt erst bemerkte er eine Art Tonöfchen neben der Tür, auf dem verkohlte Knochen aufgeschichtet waren. Daneben lagen ein zerbrochenes Steinmesser und mehrere Pfeile, allesamt fein säuberlich in der Mitte zerbrochen.
Mit einem Schlag war Hylas hellwach. Für eine Reihe zerbrochener Pfeile gab es nur eine einzige Erklärung.
Der Tote lag mit dem Rücken zur Wand. Sein Gesicht war mit einem Tuch bedeckt, aber Hylas erkannte an der ungefärbten Tunika und den schwieligen Füßen, dass der Verstorbene ein Bauer gewesen war.
Seine Sippe musste hin- und hergerissen gewesen sein zwischen der maßlosen Angst vor den Schwarzen Kriegern und dem zwingenden Bedürfnis, den erzürnten Geist ihres Verwandten zu besänftigen. Trotzdem hatten sie das Bestattungsritual eingehalten: Der Tote lag auf einer Schilfgrasmatte, man hatte ihm Sichel und Speer mitgegeben und beides zerbrochen, damit sein Geist sich des Werkzeugs und der Waffe bedienen konnte. Aus dem gleichen Grund hatten sie auch das Tongefäß und die Trinkschale zerschlagen und seinen Hund erwürgt. Das tote Tier lag neben der Leiche, bereit, seinem Herrn auch im Jenseits hinterherzutrotten. Der Verstorbene musste ein reicher Bauer gewesen sein, denn in einer Ecke kauerte, wie Hylas jetzt bemerkte, ein toter Sklave. Genau wie der Hund würde auch er seinem Herrn im Jenseits dienen.
Ein Grabhaus, dachte Hylas entsetzt. Du hast dich in einem Grabhaus versteckt.
Wie hatte er die Zeichen nur übersehen können? Die Gabe auf dem Opfertisch neben dem Bienenstock war natürlich für den Toten bestimmt gewesen, damit die Bienen an der Bestattungsfeier teilhatten. Deswegen hatte auch die Tür offen gestanden: Nur so konnte der Geist vorbeiziehen.
Er hatte alle Regeln missachtet. Er war weder mit an die Stirn gelegter Faust von Westen gekommen, noch hatte er die Ahnen um Erlaubnis gebeten, eintreten zu dürfen.
Mit angehaltenem Atem streckte Hylas die Hand nach seinen Habseligkeiten aus.
In diesem Augenblick schlug der tote Sklave in der Ecke die Augen auf und starrte ihn an.
Die Leiche war wächsern bleich wie ein frisch Verstorbener, und ihre Augen glitzerten im Mondlicht.
Hylas wich an die Wand zurück und beobachtete benommen, wie sich die grauen Lippen öffneten. Dann hörte er den Toten sprechen.
Eine Stimme wie aus dem Grab, wie ein hoher Falkenschrei am kalten, klaren Himmel, in einer Sprache, die er nicht verstand.
Nein, dachte er, das ist einfach unmöglich.
Die Leiche stieß einen langen, rasselnden Seufzer aus. »Aaah … Geh nicht weg …«
Hylas schnappte nach Luft. Die hervorgestoßenen Worte des Toten ließen den Staub im Mondlicht tanzen. Er atmete. Eine Leiche, die atmete. »Du – du lebst«, flüsterte Hylas.
Der Tote bleckte die Zähne und grinste verzerrt. »Nicht … mehr lange.«
Vorsichtig rückte Hylas näher. Seine Hände berührten etwas Feuchtes, Klebriges, er roch frisches Blut.
Der Sterbende war noch jung und bartlos. Er war kein Sklave, wie Hylas zuerst geglaubt hatte, denn sein dunkles Haar war nicht geschoren, sondern lag zusammengedreht unter seinem Kopf. Die glatten, gepflegten Füße verrieten, dass er auch kein Bauer war. Er trug einen knielangen Wickelrock aus feinem Leinen mit spiralförmiger Bordüre. Ein breiter Ledergürtel, an dem ein Schwert in einer prächtig geschmückten Scheide hing, umschloss fest die schmale Taille. In das schöne Knochenamulett um seinen Hals war ein kleiner, geheimnisvoll lächelnder Fisch geschnitzt, der in der schwarz glänzenden Blutpfütze auf der Brust des Sterbenden schwamm.
»Versteck mich«, hauchte er.
Hylas wollte zurückweichen, aber die eisigen Finger des jungen Mannes packten seine Hand.
»Ich komme aus Keftiu«, sagte er stockend in Hylas’ Sprache. »Das ist eine große Insel weit draußen im Meer.« Die Erinnerung setzte ihm sichtlich zu. »Bald geht die Sonne auf und sie schließen das Grabhaus. Sie werden mich finden und den Geiern zum Fraß vorwerfen.« Er blickte Hylas ängstlich an. »Hilf meinem Geist, Frieden zu finden.«
»Das geht nicht«, sagte Hylas. »Ich muss weiter. Wenn sie mich erwischen …«
»Du brauchst unbedingt eine Waffe«, keuchte der Keftiu. »Nimm meinen Dolch, ich habe ihn gestohlen. Er ist kostbar, du musst ihn verstecken.«
Hylas überlief es kalt. »Woher weißt du, dass ich keine Waffe habe?«
Der Sterbende verzog erneut das Gesicht zu einem schaurigen Lächeln. »Ein Mann kriecht in ein Grabhaus, um zu sterben. Ein Junge kriecht in ein Grabhaus, um zu überleben. Hältst du das für einen Zufall?«
Hylas musste sich entscheiden. Der Mond ging unter und die Zikaden stimmten bereits ihren frühmorgendlichen Gesang an. Wenn die Dorfbewohner kamen, durfte er nicht mehr hier sein.
»Versteck mich«, flehte der Keftiu.
Der Wunsch eines Sterbenden ist etwas Mächtiges. Hylas brachte es einfach nicht über sich, den jungen Mann im Stich zu lassen.
Er machte sich rasch auf die Suche nach einem Versteck. Das Grabhaus war geräumig. Er stieß im Zwielicht gegen die aufgereihten tönernen Sarkophage. Manche davon waren für Kinder bestimmt und klein wie Kochtöpfe, andere deutlich größer. In der dunkelsten Ecke hob Hylas schließlich den Deckel eines Sarkophags an. Ein modriger Geruch nach verwestem Gebein schlug ihm entgegen.
Um nichts in der Welt hätte Hylas diese Knochen mit bloßen Händen berührt. Er nahm einen zerbrochenen Pfeil und schob den Schädel und die größeren Knochen beiseite. »Ich kann dich nicht heben«, sagte er zu dem Keftiu. »Du musst selbst hineinklettern.«
Es war schrecklich, den Sterbenden zu dem Sarkophag zu schleppen, ihn halb in das hochwandige Grab hineinzuhieven und seine Glieder anzuwinkeln, bis er darin lag wie ein Ungeborenes in einem Schoß aus Ton. Der Keftiu gab keinen Laut von sich, obwohl es die reinste Tortur sein musste.
»Wie bist du hier hereingekommen«, fragte Hylas keuchend, als der junge Mann sicher versteckt war. »Und wer hat dich so schwer verletzt?«
Der Sterbende schloss die Augen. »Sie kamen von Osten, aus Mykene. Sie sind … ich kenne das Wort dafür in eurer Sprache nicht. Sie sind Vögel, die so ein Geräusch machen.« Er krächzte leise.
»Du meinst Krähen?«
»Ja, wir nennen sie Krähen, weil sie so gierig sind und sich vom Tod der anderen nähren.«
Hylas musste an die Schwarzen Krieger und ihre Umhänge denken, die wie Flügel flatterten.
Der Keftiu rang sich ein Lächeln ab. »Es war dunkel. Ich habe zur Tarnung den groben Hasenfellumhang eines Armen angelegt. Sie haben mich für einen – Fremd-ling gehalten. Was bedeutet Fremd-ling?«
»Das bedeutet, dass du nicht in einem Dorf geboren bist«, erklärte Hylas knapp. »Du hast keine Ahnen, die dich beschützen, und darfst nicht im Dorf leben. Du bist von Opferritualen ausgeschlossen und bekommst daher auch kein Fleisch. Deshalb musst du heimlich jagen oder ein Schaf erlegen und behaupten, es sei durch einen Steinschlag getötet worden. Alle sehen auf dich herab. Das bedeutet es, ein Fremdling zu sein.«
»Du bist ein Fremd-ling«, sagte der Keftiu und blickte ihn an. »Du siehst anders aus und hast anderes Haar als die Menschen hier. Du gehörst zum Volk der Wildnis. Leben in Lykonien viele Fremd-linge?«
Hylas schüttelte den Kopf. »Soviel ich weiß, bloß eine Handvoll.«
»Hast du Verwandte?«
Hylas schwieg. Als Neleos ihn und seine Schwester damals in den Bergen gefunden hatte, besaßen sie, bis auf das Bärenfell, auf dem sie lagen, nichts. Neleos hatte ihnen gesagt, ihre Mutter hätte sie ausgesetzt. Hylas hatte ihm diese Geschichte nie geglaubt. Zum einen, weil er Neleos sowieso kein Wort glaubte, und zum anderen, weil es nicht zu den Erinnerungen passte, die er an seine Mutter hatte. Sie hatte ihn und Issi geliebt, da war er sich sicher. Sie hätte ihre Kinder niemals ohne Not ihrem Schicksal überlassen.
»Auf meiner Insel«, murmelte der Keftiu, »nennen wir solche wie dich Menschen der Wildnis. Sie tragen Bemalungen auf der Haut. Aber du nicht. Woher wissen sie, was du bist?«
Hylas berührte sein linkes Ohrläppchen. »Siehst du die Narbe hier? Sie stammt von Neleos. Als er uns gefunden hat, hat er sie mit dem Messer eingeritzt.« Er schluckte. Er hatte Issis Schmerzensschreie, als sie an die Reihe kam, niemals vergessen.
»Ehrt ihr die Große Göttin?«, hauchte der Keftiu.
»Wieso?«, fragte Hylas verblüfft. »Wir, also, wir verehren den Berggott und die Herrin der Wildnis. Aber was hat das damit zu tun, dass …«
»Aah, das ist sehr gut …«
»Erzähl mir lieber von den Krähen«, fiel Hylas ihm ungeduldig ins Wort. »Wer sind sie? Und warum sind sie hinter Fremdlingen her?«
»Die Große Göttin hat in jedem Land einen anderen Namen, aber Sie ist immer dieselbe Göttin und …«
Hylas wollte antworten, doch plötzlich rief ein Wiedehopf drüben am Hang sein deutliches Hup-hup-hup. Bald tagte es. »Ich muss weiter«, sagte er.
»Nein! Bleib noch! Ich will nicht allein sterben!«
»Aber ich kann nicht!«
»Ich habe Angst!«, bettelte der Keftiu. »In meiner Heimat bestatten wir unsere Toten am Meer. Ich habe nicht einmal etwas bei mir, das dem Meer gehört. So werde ich nie mehr nach Hause zurückkehren.«
»Du hast den Fisch auf deiner Brust.«
»Das ist kein Fisch, sondern ein Delfin, aber er ist aus Elfenbein! O bitte …«
Unnachgiebig raffte Hylas seine Ausrüstung zusammen, krabbelte aber kurz darauf mit einem gereizten Ausruf wieder zu dem Sterbenden zurück.
»Hier«, stieß er hervor, riss sich das Amulett vom Hals und drückte dem Keftiu den kleinen Beutel in die Hand. »Mir hat es bisher nicht viel geholfen, aber du stirbst ohnehin. Es sind Kristallsplitter und Haare vom Schweif eines Löwen drin. Die Splitter habe ich auf dem Gipfel gefunden, sie verleihen angeblich Stärke, und den toten Löwen habe ich in einer Höhle entdeckt. Seine Haare verleihen Mut. Außerdem ist in dem Beutel eine Muschel. Ich weiß zwar nicht, wozu sie gut sein soll, aber immerhin ist es etwas aus dem Meer.«
»Eine Muschel!« Das Gesicht des Sterbenden hellte sich auf. »Dann warst du also schon einmal am Meer?«
»Nein, noch nie. Die Muschel ist ein Geschenk, aber ich habe nicht …«
»Die See wird alle deine Fragen beantworten! Und das Meervolk wird dich finden …« Er packte Hylas am Handgelenk, zog ihn dicht zu sich herunter und fixierte ihn beunruhigend eindringlich mit seinen braunen Augen. »Sie wissen, dass du kommst«, stieß er hervor. »Sie suchen nach dir in ihrer tiefblauen Welt. Sie werden dich finden.«
Hylas schrie auf und riss sich los.
»Das Meervolk bringt dich zu seiner Insel. Dort gibt es fliegende Fische und singende Höhlen, laufende Hügel und Bäume aus Bronze …«
Er fantasierte anscheinend. Dumpfes, graues Licht stahl sich allmählich ins Grabhaus. Hylas warf sich den Trinkschlauch über die Schulter und streckte die Hand nach dem Vorratsbeutel aus.
»Sobald du das Meer erreicht hast …«, fuhr der Keftiu unbeirrt fort.
»Ich sag dir doch, ich gehe nicht zum Meer.«
»… musst du den Wellen eine Haarsträhne von mir geben.«
»Unmöglich, das hab ich dir doch schon gesagt.«
»Nimm eine Strähne, du musst mir sofort eine Locke abschneiden …«
Zähneknirschend nahm Hylas eine Pfeilspitze, schnitt eine krause, schwarze Strähne aus dem Schopf des Sterbenden und stopfte sie in seinen Gürtel. »So! Siehst du! Jetzt muss ich aber wirklich verschwinden.«
Der Keftiu sah lächelnd zu ihm auf. Diesmal war es kein verzerrtes Grinsen, sondern ein aufrichtiges Lächeln. »Am Meer musst du das Meervolk bitten, meinen Geist zu holen. Du wirst sie gleich erkennen, wenn sie durch die Wellen auf dich zukommen. Sie sind so stark und schön. Sie werden mich zur Leuchtenden bringen und mit Ihr werde ich meinen Frieden finden wie ein Wassertropfen, der endlich ins Meer fällt …«
»Zum allerletzten Mal, ich gehe nicht zum Meer!«
Der Keftiu schwieg.
Irgendetwas an der plötzlichen Stille veranlasste Hylas, zum Sarkophag zurückzugehen und hineinzuspähen.
Der junge Mann starrte ihn mit gebrochenen Augen an.


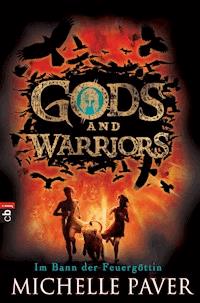













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












