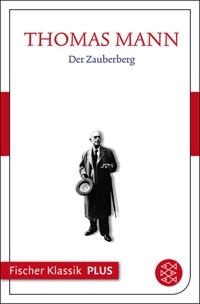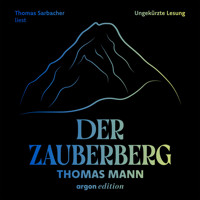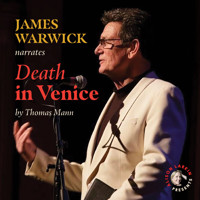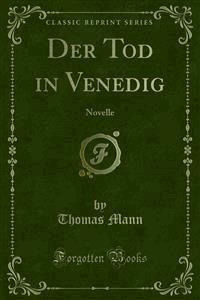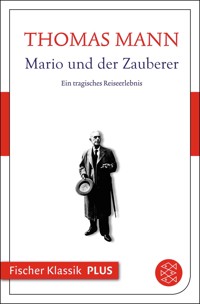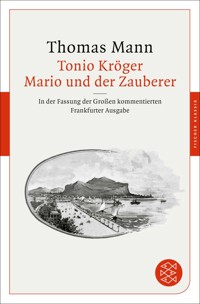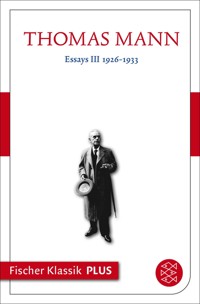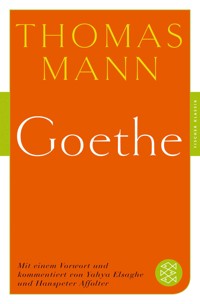
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik
- Sprache: Deutsch
Thomas Mann hat sich in seinem Œuvre erst ab den zwanziger Jahren - also nach seinem Bekenntnis zur Republik - ausführlich und kontinuierlich mit dem Leben und Werk Johann Wolfgang Goethes beschäftigt. Neben dem Goethe-Roman ›Lotte in Weimar‹ sind zahlreiche Essays entstanden, in denen er sich mit der Größe dieses Klassikers auseinandersetzt – und durchaus auch vergleicht. Diese Ausgabe beinhaltet alle Goethe-Essays Thomas Manns mit ausführlicher Einleitung und einem Kommentar von Yahya Elsaghe und Hanspeter Affolter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thomas Mann
Goethe
Über dieses Buch
Thomas Mann hat sich in seinem Œuvre erst ab den zwanziger Jahren – also nach seinem Bekenntnis zur Republik – ausführlich und kontinuierlich mit dem Leben und Werk Johann Wolfgang Goethes beschäftigt. Neben dem Goethe-Roman ›Lotte in Weimar‹ sind zahlreiche Essays entstanden, in denen er sich mit der Größe dieses Klassikers auseinandersetzt – und durchaus auch vergleicht. Diese Ausgabe beinhaltet alle Goethe-Essays Thomas Manns mit ausführlicher Einleitung und einem Kommentar von Yahya Elsaghe und Hanspeter Affolter.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas Mann, 1875–1955, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne deutsche Roman den Anschluss an die Weltliteratur. Manns vielschichtiges Werk hat eine weltweit kaum zu übertreffende positive Resonanz gefunden. Ab 1933 lebte er im Exil, zuerst in der Schweiz, dann in den USA. Erst 1952 kehrte Mann nach Europa zurück, wo er 1955 in Zürich verstarb.
Yahya Elsaghe, Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Bern, hat sowohl zu Goethe als vor allem auch zu Thomas Mann geforscht (zuletzt »Krankheit und Matriarchat. Thomas Manns Betrogene im Kontext«).
Dr. Hanspeter Affolter (Universität Bern) forscht zu Thomas Mann und anderen Autoren der Klassischen Moderne.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books 2019
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: kreuzerdesign Agentur für Konzeption und Gestaltung
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490890-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Goethe und TolstoiZum Problem der Humanität
Stötzer
Rangfragen
Rousseau
Erziehung und Bekenntnis
Ungeschicklichkeit
Gnadenorte
Krankheit
Erkrankungen
Plastik und Kritik
Buhlerei
Freiheit und Vornehmheit
Adelsanmut
Problematik
Natur und Nation
Sympathie
Bekenntnis und Erziehung
Unterricht
Zum Beschluss
Zu Goethes »Wahlverwandtschaften«
An die japanische JugendEine Goethe-Studie
Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters
Goethe’s Laufbahn als Schriftsteller
Über Goethe’s »Faust«
Goethe’s »Werther«
Phantasie über Goethe Als Einleitung zu einer amerikanischen Auswahl aus seinen Werken
Goethe und die Demokratie
Die drei Gewaltigen
Ansprache im Goethejahr 1949
Stellenkommentar
Vorbemerkung
Goethe und Tolstoi. Zum Problem der Humanität
Zu Goethes »Wahlverwandtschaften«
An die japanische Jugend. Eine Goethe-Studie
Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters
Goethe’s Laufbahn als Schriftsteller
Über Goethe’s »Faust«
Goethe’s »Werther«
Phantasie über Goethe. Als Einleitung zu einer amerikanischen Auswahl aus seinen Werken
Goethe und die Demokratie
Die drei Gewaltigen
Ansprache im Goethejahr 1949
Siglenverzeichnis
Drucknachweise
Einleitung
Diverse Miszellen nicht mitgezählt,[1] hat Thomas Mann mehr als zehn Essays über Goethe hinterlassen: Goethe und Tolstoi in drei, teilweise sehr verschiedenen Fassungen (1921/22, 1925, 1932); Zu Goethes »Wahlverwandtschaften« (1925); An die japanische Jugend – Eine Goethe-Studie (1932); Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters (1932); Goethe’s Laufbahn als Schriftsteller (1932); Über Goethe’s »Faust« (1939); Goethe’s »Werther« (1941); Phantasie über Goethe (1948); Goethe und die Demokratie (1949); Die drei Gewaltigen (1949); Ansprache im Goethejahr 1949.
An dieser Liste kann zweierlei interessieren. Zum einen fällt auf, wie spät sie einsetzt. Sie beginnt zur Zeit der frühen Weimarer Republik, als Thomas Mann bald einmal fünfzig Jahre alt war und nachdem er sich schon vor Jahrzehnten zu anderen Autoren des deutschen Literaturkanons geäußert hatte, zu Heinrich Heine zum Beispiel schon als Teenager »in einer wenig schulgemäßen Schülerzeitschrift, betitelt ›Der Frühlingssturm‹«.[2]
Zum anderen weisen seine Goethe-Essays auch über seine zweite Lebenshälfte eine sehr ungleichmäßige Streuung auf. Sie gruppieren sich zum allergrößten Teil um zwei einzelne Daten: den 22. März 1932, als sich Goethes Todestag zum hundertsten Mal, und den 28. August 1949, als sich sein Geburtsdatum zum zweihundertsten Mal jährte.
Das ist zunächst nicht weiter verwunderlich. Es dokumentiert bloß das dezimal-annalistische System der Gedächtniskultur und des Literaturbetriebs, für das Manns eigene Rezeptions- und Vermarktungsgeschichte dann wieder vortreffliche Beispiele liefern sollte; zum Zeichen dafür, dass seine späteren Aspirationen auf Goethes, das heißt auf die Stelle dessen in Erfüllung gingen, was auch er in seinen Goethe-Essays den »Nationalschriftsteller« nannte.[3] Nun wollte es aber ein, es wäre zynisch zu sagen, glücklicher Zufall, dass gleich beide Feierdaten in nationalhistorisch bedeutsame Jahre fielen: das eine in das letzte Jahr der ersten deutschen Republik; und das andere in das Jahr, in dem gleich zwei Republiken auf deutschem Boden neu gegründet wurden.
Aus der chronologischen Auflistung der Mann’schen Goethe-Essays ergeben sich damit ganz von selbst zwei Fragen: Warum begannen Manns essayistische Auseinandersetzungen mit Goethe erst so spät? Und wie reflektieren sie ihren jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext?
Erstens also: Warum erst so spät? Um die Länge des Wegs oder Umwegs auszumessen, auf dem Mann zu Goethe gelangte, braucht man sich nur seine literarischen Anfänge zu vergegenwärtigen. Literatur- und geistesgeschichtlich fallen diese Anfänge, überflüssig, es eigens zu wiederholen, ins fin de siècle – um unter den verfügbaren Epochenbegriffen den hier passendsten, einen hier selbsterklärenden aufzugreifen. Das resignative Lebensgefühl, das der Epoche diesen Namen gab und dem die Buddenbrooks (1901) seinen bleibenden Ausdruck verleihen sollten, traf sich sehr genau mit der persönlichen Situation des Jungautors, der als verkrachter Gymnasiast und ›wilder‹ Student, als bohemistisch heruntergekommener Patriziersohn und homo- oder bisexuelles Muttersöhnchen seit dem frühen Tod seines Vaters keinerlei reelle Aussichten hatte, den erlittenen Schwund an sozialem und ökonomischem Kapital je wieder zu kompensieren.
Die selbstzweiflerischen Vorstellungen, die sich der junge Mann von seinem Ort in der Gesellschaft oder vielmehr von seiner gesellschaftlichen Ortlosigkeit machte, hat er auch nach seinem eigenen Zeugnis den »Männerchen«[4] seines Frühwerks samt und sonders einbeschrieben.[5] Solche Vorstellungen standen allem diametral gegenüber, was man spätestens seit der Reichsgründung[6] und gerade damals noch mit Goethe verband und wofür Thomas Mann in seinen späteren Essays denn auch zu den landesüblichen Superlativen greifen sollte – »größt«,[7] »höchst«,[8] »tiefst«,[9] »deutschest«[10] und so fort –: Goethe als so etwas wie ein Totemtier[11] oder eben, nur etwas anders gesagt, als Nationaldichter, dessen Werke von unantastbarer Vorbildlichkeit waren und den Goldstandard aller Klassizität abgaben; Goethe deswegen auch als Legitimationsinstanz des Establishments, da er denn wirklich zeit seines Lebens, wie Thomas Mann nach Ausweis seiner Essays sehr wohl wusste, jede Oppositionsrolle geflissentlich gemieden hatte; und Goethe nicht zuletzt als Naturgenie und Ausbund vital-kreativer Energien, ein Mensch, dessen Liebschaften »bildungsobligatorisch«[12] wurden und dessen größtes Kunstwerk sein Leben war. So wollte und will es ein Gemeinplatz der Goethe-Forschung, den der späte Mann denn in seinen Essays prompt abrufen wird: »das hohe Geschäft dieses Lebens, das man oft ein Kunstwerk genannt hat und besser noch ein Kunststück nennen sollte«.[13]
Die oft aufgebotene Formel vom Kunstwerk »dieses Lebens« stammt aus der Zeit, da der junge Thomas Mann seine ersten Novellen schrieb und bei seinen Bemühungen, sie zu publizieren, teils herbe Enttäuschungen einstecken musste. Erstmals erscheint der spätere Topos 1895 in einem dreibändigen Beitrag zu einer Buchreihe Geisteshelden – Richard M. Meyers Goethe[14] –, um eben bis heute wirksam zu bleiben. Das verrät schon die Titelei des jüngsten Bestsellers der deutschen Goethe-Industrie: Goethe. Kunstwerk des Lebens;[15] wobei dieser Untertitel fast wörtlich und jedenfalls sinngemäß mit dem der bislang letzten Thomas Mann-Biographie übereinstimmt (Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk[16]), zum neuerlich untrüglichen Zeichen dafür, wie gründlich dem späteren Mann das Projekt einer Goethe-Nachfolge endlich gelingen sollte.
Davon aber, es mit dem nahezu gottgleichen »Olympier« Goethe aufnehmen zu können, wie er gerade auch wieder in den Rezensionen jenes Bestsellers bezeichnet wird,[17] war der junge Thomas Mann noch unvorstellbar weit entfernt. Umso weniger war daran zu denken, als die ›olympischen‹, erdrückend übermächtigen Züge, die Goethe im kollektiven Bewusstsein ohnehin schon angenommen hatte, in Manns frühem Goethe-Bild womöglich noch verstärkt wurden. Verstärkt und geschärft wurden sie durch einen rezeptionsgeschichtlich sehr speziellen Zusammenhang. Einen solchen legen alle verfügbaren Zeugnisse nahe: die Korrespondenz, die Notizbücher, die Lesespuren in Manns Nachlassbibliothek und ein früh angelegter Zitatenfundus, aus dem er ein Leben lang schöpfen sollte, auch und besonders gern in seinen Essays.
Nach allen diesen Zeugnissen war für das Goethe-Bild des jungen Thomas Mann kein Buch so prägend wie eines, dessen Authentizität man füglich bestreiten darf: die Gespräche oder, um eine kühne These Stephan Porombkas aufzugreifen, Werkstattgespräche Goethes mit Johann Peter Eckermann.[18] Und zwar scheint der Wert, den Mann ausgerechnet diesem Korpus zugemessen hat, ein side effect seiner frühen Lektüre eines Autors gewesen zu sein, der zu seinem, Manns, damaligen Selbstverständnis als Außenseiter sehr viel besser passte und von dem er auch die Formel bezog, dieses zu bezeichnen,[19]»Pathos der Distanz«.[20]
Friedrich Nietzsche stand bekanntlich nicht an, Goethes Gespräche mit Eckermann zum »besten deutschen Buche« zu erklären, »das es giebt«;[21] ein sehr befremdliches und leicht anfechtbares Urteil. Wenn Thomas Mann es dennoch so fraglos, unbesehen und, man möchte sagen, unterwürfig übernahm, dann verrät sich darin einmal mehr die unüberschätzbare Prägung, die er in seinen formativen Jahren durch Nietzsche erfuhr. Von jung auf war er daher mit den Konturen vertraut, die Nietzsche an seinem Goethe so stark gemacht hatte. Dazu gehört insbesondere das Europäisch-Undeutsche, Überdeutsche, das den Nationalschriftsteller als solchen freilich etwas in Frage stellte und auf das Mann je länger, desto entschiedener, das heißt besonders in seinen spätesten Essays zurückgreifen sollte.
Dem frühen Thomas Mann indessen gab sowohl Nietzsches als vor allem auch Eckermanns Goethe keinerlei Anhaltspunkte, sich so mit ihm zu identifizieren, wie es der spätere dann etwa in Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters tun würde;[22] und zwar kraft einer Berufung auf sein Stadtpatriziertum, das er nun wieder herkunftsstolz mit Goethe teilen durfte, nachdem er solcher Standes- oder Klassenzugehörigkeit in jungen Jahren verlustig zu gehen gedroht hatte. In diesen Jahren gebot Goethe Devotion oder zumindest Bewunderung und verbot er jede imitatio, geschweige denn aemulatio. Eine quasi ödipale Rivalität, wie sie Harold Bloom unter der Formel anxiety of influence konzeptualisiert und für die Beschreibung der Literaturgeschichte fruchtbar gemacht hat,[23] lag vorderhand weit außerhalb des Denk- und Erwartbaren. Nach dieser Sorte Einflussangst sucht man in Thomas Manns Frühwerk denn auch ganz vergebens. Obwohl es an hartnäckigen und halsbrecherischen Versuchen nicht gefehlt hat, intertextuelle Beziehungen zwischen diesem Frühwerk und Goethe herzustellen – zum Beispiel zwischen dem Bajazzo (1897) und den Leiden des jungen Werther[24] –, bezeugen solche Versuche in ihrer verzweifelten Angestrengtheit und Velleität immer nur wieder den Sicherheitsabstand, den der frühe Thomas Mann dazumal noch zu Goethe hielt und zu halten wohl auch gut beraten war.
Wenn Goethes Name im Frühwerk überhaupt vorkommt – gerne auch in der archaisierenden Schreibung »Göthe« oder sogar ironisch-atavistisch flektiert, »Göthen«[25] –, dann als Kennung einer »jovialen«,[26] endgültig vergangenen Epoche, der Zeit eines Johann Buddenbrook senior,[27] oder aber als Requisit des bürgerlichen Bildungsinventars. In Manns allererster Erzählung, Gefallen (1894), dient Goethe als Namenspatron eines mediokren Provinztheaters,[28] dessen weibliche Ensemblemitglieder sich nicht anders prostituieren als in Wilhelm Meisters Lehrjahren beziehungsweise der (damals noch nicht entdeckten) Theatralischen Sendung. In Luischen (1900) bietet er einem seinerseits offenbar eher mittelmäßigen Laienimpersonator die Herausforderung, seine, Goethes, Person darzustellen[29] – bevor nota bene die ganze Veranstaltung in eine zutiefst niederträchtige und zuletzt schauerlich-makabre Groteske ausartet.
Ein ungleich höheres Identifikationspotential hat im Frühwerk dagegen der andere der beiden Klassiker. So bildet Schillers Don Carlos, der Liebling unter Manns Jugendbüchern,[30] die Folie für die homoerotisch tingierte Freundschaft, die Tonio Kröger (1903) seinem geliebten Hans Hansen anträgt.[31] Über Manns Affinität zu Schiller als einem Frühvollendeten, Leidenden, sollte dann freilich eine erste Annäherung an Goethe erfolgen. Diese erste produktive Annäherung an die Gestalt und die Instanz Goethe fiel für ihr Teil auf ein Jubiläums- und Gedenkjahr. Es war Schillers Tod, der sich damals zum hundertsten Mal jährte.
In Schwere Stunde (1905), um es mit einer weidmännischen Verbalmetapher zu sagen, die er selber wiederholtermaßen[32] dafür aufbot und die als solche aggressive bis totschlägerische Konnotate mit sich brachte, – in Schwere Stunde also ›pirschte‹ sich Thomas Mann bekanntlich an den Weimarer Olympier aus der Perspektive Schillers ›heran‹, in dessen Haut er sich hier so einfühlsam zu versetzen vermochte wie erst Jahrzehnte später, in Lotte in Weimar (1939), in diejenige Goethes. Die so eingenommene Position war eine expresso verbo feindliche. Es war »sehnsüchtige[] Feindschaft«.[33] Hier nun könnte man also schon mit der Bloom’schen anxiety of influence operieren. Dass dieser Ansatz von jetzt an langsam, aber sicher doch noch zu greifen anfängt, hat mit der Stellung zu tun, die Mann seinerzeit auf dem Literaturmarkt und in der deutschen Gesellschaft einzunehmen begonnen hatte. Er war nun ein bereits arrivierter Autor und durchaus nicht mehr der nobody oder das Nichts, als das er sich 1899 einmal in der Grußformel eines Briefs verabschiedet hatte: »Was mich betrifft, so bin ich nichts«.[34]
Den Großerfolg der Buddenbrooks im Rücken und noch vor dem leichten Karriere-Knick, den die relativ laue Rezeption von Königliche Hoheit (1909) markieren sollte, war der Verfasser von Schwere Stunde das, was man heute einen shooting star nennen würde. In dieser Situation konnten sich gegen den Nationalschriftsteller, und sei es auch unterhalb der Bewusstseinsschwelle, sehr wohl schon feindselige Impulse regen, wie sie Bloom anderwärts beobachtet hat und wie sie bei Mann späterhin in ziemlich offenen Konkurrenzen zu einzelnen Teilen des Goethe’schen Gesamtwerks zutage treten sollten:[35] zum Beispiel Die vertauschten Köpfe (1940) versus Der Paria, Gesang vom Kindchen (1919) versus Hermann und Dorothea, natürlich Doktor Faustus (1947) versus Faust, vielleicht auch Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil (1954) versus Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit.[36] Aus Dichtung und Wahrheit, aus einem dort erwähnten Werkprojekt, bezog der Autor der Tetralogie von Joseph und seinen Brüdern (1933–1943) auch die Idee, die Josephslegende literarisch auszugestalten.[37] Und den ersten Sätzen von Dichtung und Wahrheit ist der Anfang einer ausführlicheren Skizze nachgebildet, die Thomas Mann öffentlich von seinem eigenen Leben entwarf – und zwar um den Preis einer platten Lüge. Denn tatsächlich wurde er keineswegs erst »mittags zwölf Uhr« geboren,[38] wie er uns in einem Lebenslauf aus dem Jahre 1936 weismachen möchte, sondern schon zwei Stunden früher. Die Unwahrheit dieser Angabe ist natürlich der schalkischen Absicht geschuldet, die eigene Biographie dem Leben Goethes nachzumodellieren. Goethe selber war »Mittags mit dem Glockenschlage zwölf […] auf die Welt« gekommen,[39] wenn man dem Anfang von Dichtung und Wahrheit trauen darf. Misstrauen muss man freilich dem Anfang auch dieser Autobiographie, deren Titel solche Zweifel ja bereits provoziert. So hatte Goethe in Dichtung und Wahrheit denn schon das Horoskop dieser Geburtsstunde zum ausnehmend Günstigen hin frisiert;[40] eine Manipulation, die Thomas Mann vermutlich präsent war und aus der er gegebenenfalls die Lizenz zu seiner eigenen Schwindelei beziehen durfte.
Manns Selbstidentifikation mit der Vater-Imago Goethe reichte demnach weit über das Literarische hinaus oder vor es zurück. Mit dem Orden der Ehrenlegion, mit dem auch Goethe dekoriert war, soll der alte Thomas Mann eine für diesen typische Haltung eingenommen haben.[41] Er pflegte dasselbe Eau de Cologne zu benutzen wie Goethe.[42] Im selben Lebensjahr, in dem Goethe sein erstes Gespann gekauft hatte, erwarb Mann sein erstes Automobil.[43] Ja, der Identifikationszwang scheint sogar psychosomatische Symptome gezeitigt zu haben. So befielen Mann einmal, als er sich besonders intensiv mit ihm auseinandersetzte, dieselben »[r]heumatische[n] Gliederschmerzen« wie Goethe, an demselben Ort, »im Arm«,[44] und so weiter, und so fort.
Mann und Goethe also gaben endlich doch noch ein textbook example für die Bloom’sche These ab, wonach sich Literaturgeschichte eben nach den Gesetzen eines Ödipuskomplexes abspielt. Sie sind geradezu das Beispiel dafür, wie es im deutschen Literaturkanon, abgesehen allenfalls von Hölderlin und Pindar[45] oder von Brecht und Villon,[46] seinesgleichen kaum haben dürfte. Dass sie zu solch einem Paradebeispiel avancieren konnten, hatte zwei verschiedene, aber ineinandergreifende Ursachen.
Es hatte nicht nur und nur zur Hälfte mit dem schon erwähnten Verlauf zu tun, den Thomas Manns literarische Karriere mit dem leicht verzögert einsetzenden Erfolg der Buddenbrooks zu nehmen begann. Gegenläufig zu Manns mehr oder minder kontinuierlichem Aufstieg nämlich vollzog sich in der Goethe-Forschung der Zwischenkriegszeit, als Mann seine ersten Essays über Goethe schrieb, ein Paradigmenwechsel, in dessen Folge dieser eine sozusagen reziproke Bewegung durchmachte. Und man kann dem Essayisten nicht vorwerfen, dass er hier hinter dem Stand auch der neusten Forschung zurückgeblieben wäre. Vielmehr erwies er sich als erstaunlich hellhörig dafür.
Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg – und das spricht Bände über die erlittene Demütigung des deutschen Nationalstolzes – wurde auch Goethe von einer allgemeinen Tendenz erfasst, die einer ihrer Exponenten oder Initiatoren, Emil Ludwig, auf den Nenner »Entgötterung der Helden« brachte.[47] Im Zuge dieser Tendenz wurden die Helden und Geisteshelden von einst auf menschliche Abmessungen redimensioniert. Geschichte eines Menschen steht im Untertitel von Ludwigs dreibändiger Goethe-Biographie.[48]
Auf menschlich-allzumenschliche Dimensionen gebracht, ließen sich die Geistesgrößen nun aber ganz neu verstehen. Für Thomas Mann, weil er darauf von langer Hand vorbereitet war und sich die theoretischen Voraussetzungen dafür bereits seit ein oder zwei Jahrzehnten[49] angeeignet hatte, erwiesen sich hier die psychoanalytischen Ansätze als besonders wichtig. Am allerwichtigsten war unter diesen ein Versuch, dessen Publikation sinnigerweise just ins Jahr der Nobelpreisverleihung fiel, als Manns eigene Karriere also einen Zenit erreichte, gegenläufig eben zum hier vorgenommenen debunking Goethes: Goethe. Sexus und Eros von Felix A. Theilhaber (1929). Die nachhaltige Wirkung dieser Studie verrät sich nicht nur in den dichten und teilweise ungewöhnlich energischen Lesespuren in Manns Handexemplar, sondern vielleicht mehr noch ex negativo oder gewissermaßen a silentio. Denn über die Bedeutung, die Theilhabers Buch für ihn hatte, ganz besonders auch für Lotte in Weimar, schwieg sich Thomas Mann beharrlich aus; und zwar selbst dann, wenn er geradewegs auf die Inspirationsquellen seines Romans angesprochen wurde, und selbst dort, wo er darüber scheinbar bereitwillig, aber eben auch irreführende Auskünfte gab.[50]
Theilhaber ging es freilich nicht einfach darum, Goethe schlechtzumachen, seine Größe oder Einzigartigkeit, seinen Status als Genie und dergleichen in Zweifel zu ziehen – Superlative vom Typus »deutschest[]« finden sich auch bei ihm[51] –; ebenso wenig wie es etliche Jahrzehnte später noch Kurt R. Eissler um solcherlei gehen würde, von dessen im Unterschied zu Theilhaber berühmt gewordener Psycho- oder Pathographie vorderhand ungeklärt bleibt, was sie diesem oder ob sie ihm überhaupt etwas verdankt. Aber immerhin rückte schon Theilhaber seinen Goethe näher an diejenigen heran, die sich mit ihm identifizieren oder messen wollten. Er familiarisierte Goethe, indem er ihn gleichsam auf die Couch legte. Mit so einem Goethe, wie er ja auch in Lotte in Weimar erst einmal in der Horizontalen seines Betts vorgeführt wird, ließ es sich im Rahmen eines quasi ödipalen Konkurrenzkampfs jetzt ungleich hemmungsloser aufnehmen als mit dem ad nauseam so genannten Olympier – eine Erleichterung vergleichbar der, die Goethe selber erlebt haben mochte, als der klassische Philologe Friedrich August Wolf ihn und seinesgleichen »endlich vom Namen Homeros/Kühn […] befrei[te]«.[52] (Das erst ermöglichte es ihm, »als letzter« »Homeride« Hermann und Dorothea zu schreiben – oder vielmehr zu diktieren –, ohne gleich »mit dem Einen« und »mit Göttern den Kampf« »wag[]e[n]« zu müssen.[53])
Die ambivalenten und widersprüchlichen Impulse, die für ödipale Identifikationswünsche charakteristisch sind – zu sein wie der Andere, Ältere, aber in eins damit auch seine Stelle einzunehmen und ihn also von dieser wegzudrängen –, diese Ambivalenz gelang es Mann augenscheinlich auf eine sehr elegante Art und Weise zu bewältigen. Er scheint Ehrfurcht und passiv-aggressive Anwandlungen säuberlich auf verschiedene Textsorten verteilt zu haben: Die ehrfürchtigen Affekte deponierte er in den Reden und Essays, auf die er eo ipso unmittelbar zu behaften war; und den missgünstigen Regungen ließ er in fiktionalen Texten ihren Lauf, wie eben Schwere Stunde einer ist und in denen er sich hinter den Stimmen ihrer Erzähler sozusagen verschanzen konnte.
Kurz nach Schwere Stunde plante Thomas Mann denn auch eine Novelle über Goethes letzte Verliebtheit. Er fand damit und hatte offenbar einen Stoff gesucht, in dem der nunmehr zum Rivalen gewordene Klassiker eine ziemlich klägliche Figur hätte machen müssen und der so gar nicht zu dessen »Standbild« gepasst hätte, »wie es […] der Nation vor Augen steht«.[54] »Das«, lautet eine Marginalie der Notizbücher, »wurde« dann einstweilen nur der »›Tod in Venedig‹« (1912).[55] (Ihre eigentliche Verwirklichung fand Manns anfängliche Projektidee for all it’s worth erst hundert Jahre später, in Ein liebender Mann – was immer Martin Walser damit an nationalschriftstellerischen Ansprüchen angemeldet haben mag.[56])
Solche literarischen Versuche, den Rivalen zu liquidieren und die Stelle des Nationalschriftstellers zu besetzen, auf die Mann je länger, desto energischer aspirierte, scheinen also zur Abfuhr der aggressiven Affektbeträge gedient zu haben, die Bloom in Analogie zum Ödipuskomplex am Verhältnis eines Autors zu einer autoritären Vaterfigur wie Pindar, Villon oder eben Goethe ausmacht. Damit war die charakteristische Ambivalenz dieses Verhältnisses zu ihrer negativ-feindschaftlichen Seite hin bereinigt; und zwar eben in fiktionalen Texten, die es einem bekanntlich als solche verteufelt schwer machen, ihren jeweiligen Autor auf sie zu verpflichten. Dafür konnten sich die anderen, umso eindeutiger positiven Emotionen dem säkularen Nationalheiligen gegenüber umso ungetrübter an den diskursiv-expliziten Artikulationen, vor allem eben an den Essays schadlos halten.
Dem entspricht der Tenor ausnahmslos aller Goethe-Essays. Alle sind sie immer schon und immer auch Goethe-Panegyrik. Sie sind Teil und Ausdruck eines deutschen Goethe-Totemismus. Damit einher geht eine ungewöhnlich hohe Redundanz des jeweils über Goethe Gesagten; eine Redundanz übrigens, die Mann mehrfach und ganz offen eingestand: »J’ai vidé mon sac.«[57]
Dennoch oder gerade deshalb lohnt es sich, desto genauer die paar wenigen Verschiebungen und vergleichsweise minimen Modifikationen zu betrachten, welche das Goethe-Bild oder vielmehr die Goethe-Bilder erfuhren, die Mann in drei Jahrzehnten einschlägiger Essayistik entwarf. Ihre Veränderungen sind für ihr Teil Reflexe einer nunmehr weit fortgeschrittenen Selbstidentifikation mit Goethe. Sie reflektieren im Grunde die Metamorphosen, die der mittlere und späte Thomas Mann selber durchlief. So gelang es Hinrich Siefken[58] nachzuweisen, wie sich Manns Konversion zum Demokraten oder doch zum Vernunftrepublikaner ganz unmittelbar auch an dem Bild vollzog, das er unter der Weimarer Republik von Goethe entwarf. Dieses Bild war in politicis das exakte Gegenteil von allem und jedem, wofür der ehedem vorgeblich noch Unpolitische unmittelbar zuvor den Nationaldichter auf der Basis eines »genuin Wilhelminischen Goetheverständnisses«[59] in Anspruch genommen hatte.
Um dafür nur ein, ein besonders unappetitliches Beispiel aus den ersten Kriegsmonaten zu geben. Es findet sich in einer unverhohlen nationalpropagandistischen Schrift, Gedanken im Kriege (1914), die ihrem hernach zum Republikanismus bekehrten Verfasser nach Ausweis schon nur ihrer Publikationsgeschichte leidgetan haben oder peinlich gewesen sein muss. Denn er hielt sie aus allen späteren Ausgaben seiner Essays heraus.[60] Auch wurde sie zu seinen Lebzeiten nie übersetzt.[61]
Bereits auf den allerersten Seiten dieses Elaborats erscheint Goethe als Personifikation all dessen, was Thomas Mann hier wie dann auch wieder in den berüchtigten Betrachtungen eines Unpolitischen (1918) der »›Zivilisation‹« im Namen der »›Kultur‹« gegenüberstellt, sofern der »›Geist‹« der »›Zivilisation‹« halt als »der geschworene Feind der Triebe, der Leidenschaften« zu dienen hat, »zivil, […] bürgerlich«, »antidämonisch, antiheroisch, […] antigenial«.[62] »Kultur« und »Kunst« dagegen seien »die Sublimierung des Dämonischen«; und dafür eben stehen Goethe und »sein dämonisches Wissen«.[63] »Dieser dämonischste Deutsche«,[64] wie sonst nur noch Friedrich der Große, repräsentiert hier die »deutsche Seele«.[65] Der deutschen Seele »eigne[] etwas Tiefstes und Irrationales«.[66] Und als die Inkarnation solch eines Tiefsten und Irrationalen eben muss Goethe hier so gut wie Friedrich der Große herhalten. Beide verkörpern sie »das unbekannteste Volk Europas«,[67] »dieses innerlichste Volk, dies Volk der Metaphysik«[68] oder was der halbschlauen Floskeln und Phrasen noch mehr sind. Goethe mit nochmals anderen Worten erscheint hier als Repräsentation eines den andern »fremde[n]«[69] und vorderhand unverständlichen Deutschland, »verhaßt[]«,[70] »so widerwärtig zugleich und entsetzlich«:[71] »und das Ergebnis eures Anschlages wird sein, daß ihr euch staunend genötigt sehn werdet, uns zu studieren«.[72]
Überhellt wurden anders gesagt jeweils diejenigen Züge an Goethe, die mit Manns eigener Person und Rolle zur gerade gegebenen Zeit übereinstimmten, im Guten und manchmal, nicht immer, aber manchmal eben doch auch im Schlimmen oder immerhin Bedenklichen – zum Beispiel was einen gewissen »Egoismus« betraf.[73] Auf »den ärgsten Egoismus«[74] Goethes war Mann just auch wieder bei seinen spätesten Lektüren gestoßen, »selbst« dort, wo »ein innigster Bewunderer unter den Zeitgenossen« über Goethe sich ausließ,[75] Carl Gustav Carus, in einem dazumal, 1948, brandneu zusammengestellten Sammelband.[76] Carus, mit einer Mann tief beeindruckenden Redewendung, wies darauf hin, wie Goethe im eigenen Überlebensinteresse »seine Fortifikationslinien« immer wieder »zu rechter Zeit zu schließen« wusste.[77]
Wie weit allerdings die Parallelen zwischen Goethes und seinem eigenen Leben und Familienleben tatsächlich reichten, sehr viel weiter noch, als ihm lieb sein konnte, hat Mann anscheinend nicht wahrhaben wollen. So in Hinblick auf die letzten Konsequenzen, die die rechtzeitig geschlossenen Fortifikationslinien hier wie dort pro domo sua mit sich brachten. Dazu gehört etwa die Hypothek, die ein Vater vom Kaliber Goethes oder eben auch Thomas Manns für einen Sohn bedeuten kann. Nicht zufällig lautet der Titel einer Publikation, die Mann heranzog, um sich ein Bild von August von Goethe zu verschaffen: Goethes Sohn[78] – wie dieser Sohn buchstäblich bis in alle Ewigkeit nur Sohn und nichts als Sohn selbst noch auf seinem Grabstein bleibt, wo ihm ein eigener Vorname und seine eigene Individualität bis auf den heutigen Tag vorenthalten sind: »GOETHE FILIUS / PATRI / ANTEVERTENS«; ›Goethe, der Sohn, seinem Vater vorangegangen‹.[79]
Dass eine solche Belastung des Sohns durch seinen Vater, wie Thomas Mann sie in Lotte in Weimar besonders klarsichtig darzustellen vermochte, ihrerseits frappante Ähnlichkeiten mit seinen eigenen Familienverhältnissen aufwies, scheint ihm aber eben entgangen zu sein. Oder jedenfalls wollte er sich dergleichen Ähnlichkeiten durchaus nicht eingestehen, so deutlich sie einem heute buchstäblich vor Augen liegen, und zwar gerade wieder in der makabren Form der Gräber und Grabsteine. Denn einer seiner Söhne, Golo Mann, legte offenbar Wert darauf, nicht neben seinem Vater und nicht einmal in Sichtweite seines Grabs bestattet zu werden.[80] Und ein schweres Leben »im Schatten des Vaters«[81] hatten auch die zwei anderen Söhne. Beide wohl begingen sie Selbstmord; der eine nach mehreren gescheiterten Versuchen und ohne jeden Zweifel, der andere – so oder so eine versehrte Existenz – mit hoher Wahrscheinlichkeit.[82]
Sollten die Eltern von diesem zweiten Tod auch nicht mehr erfahren – der Vater schon gestorben, die zusehends demente Mutter von den Ihren damit verschont –, so ereilte die Hiobsbotschaft vom endlich doch noch geglückten Suizid ihres Ältesten das Paar just in einem Moment, da Thomas Mann in Sachen Goethe auf Vortragstournee war. Und in einem seiner späten Vorträge, der in Frankfurt und Weimar gehaltenen Ansprache im Goethejahr 1949, als er die Deutschen hüben und drüben erstmals wieder auf ihrem eigenen Boden adressierte, sollte er Klaus Manns Selbstmord denn auch wirklich aufnehmen, ohne ihn freilich als solchen zu bezeichnen. Den Freitod oder eben nur den Tod seines am Leben so schwer tragenden Sohnes erwähnte er hier indessen durchaus nicht im Sinn einer der Parallelen, die der ältere und alte Thomas Mann sonst mehr oder weniger deutlich zwischen sich und Goethe auszuziehen liebte. Vielmehr erscheint der ›Verstorbene‹ nur eben als Opfer seiner Zeit:
Ich komme zu Ihnen als ein armer, leidender Mensch, der sich mit den Problemen dieser in Geburtswehen des Neuen, in Umwälzungen und qualvollen Anpassungsnöten liegenden Zeit herumschlägt, wie irgendeiner von Ihnen. Zu meinem verstorbenen Sohn, einem Opfer dieser Krisenzeit, sagte ein großer französischer Freund, André Gide: »Wann immer junge Leute kommen, sich bei mir Rats zu holen, fühle ich mich so beschämend inkompetent, so hilflos, so verlegen. Immer fragen sie mich, ob es einen Ausweg gibt aus der gegenwärtigen Krisis, ob irgendeine Logik, ein Zweck, ein Sinn ist hinter dem Durcheinander. Aber wer bin ich, ihnen zu antworten? Ich weiß es ja selber nicht.« – Wenn der so sprechen konnte, sprechen mußte, – wer bin ich, daß ich es besser wissen sollte?[83]
Mit dem Bezug, den Thomas Mann auf die konkrete Gegenwart seiner Rede nimmt, indem er seinen Sohn hier wie anderwärts zu einem »Opfer der Zeit« erklärt,[84] ist die zweite Frage schon gestellt. Denn was an den inhaltlichen Verwerfungen der Goethe-Essays über reine Biographismen hinaus vor allem interessieren kann, ist wie gesagt ihre Beziehung zur je gegebenen zeitgeschichtlichen Situation. Wie greift das je entworfene Goethe-Bild die jeweilige »Krisenzeit« auf? Wie versucht es gegebenenfalls, auf diese einzuwirken? Und was kann man daraus ganz grundsätzlich über die Funktionsmodalitäten der Instanz Nationalschriftsteller lernen?
Für solche Fragestellungen eignen sich die Goethe-Essays von 1932 und 1949 deswegen besonders gut, weil die beiden je begangenen Feierstunden natürlich sehr verschiedenen Gegebenheiten Rechnung tragen mussten. Hierzu gehörten wohl oder übel auch die Umgruppierung der geopolitischen Machtverhältnisse, ein ganz neues Kräfteparallelogramm der militärischen Großmächte und der waffentechnologische ›Fortschritt‹. So hat Thomas Mann, von seinem Schwager Peter Pringsheim bereits 1941 in das Geheimnis der Atombombe eingeweiht, aber wohl erst nach den Abwürfen über Hiroshima und Nagasaki zum Pazifisten geworden,[85] in seine späten Essays gelegentlich Anspielungen auf die damals schon näher rückende Gefahr einer nuklearen Katastrophe[86] oder auf den Kalten Krieg[87] überhaupt inseriert. In diesem eindeutig Partei zu nehmen wusste er hier wie anderwärts freilich zu vermeiden; und schon gar nicht schlug er sich einfach auf die Seite der USA,[88] deren Staatsbürgerschaft er 1944 verliehen bekommen hatte. Ein überaus triftiges Beispiel für diese seine Unbefangenheit findet sich in Goethe und die Demokratie oder genauer in den Entstehungsvarianten dazu. Gemeint ist hiermit die pro domo so genannte »Rußlandstelle«[89] oder die ›russische‹, soll heißen eine stark prosowjetische Passage, die er unter dem Eindruck eines Schauprozesses[90] endlich doch wieder entfernte und worin er sich und sein Publikum rhetorisch gefragt hatte: »ob nicht heute«, 1949, »Goethe’s Blick eher auf Rußland gerichtet wäre, als auf Amerika«.[91] Ein Indiz für Goethes kommunistische Sympathien glaubte Mann allen Ernstes in Hermann und Dorothea entdecken zu können. Dort spreche »er«, Goethe – tatsächlich ist es eine zutiefst revolutionsskeptische Figur –, »von der höheren – ›der höheren‹! – Gleichheit«.[92] (Die Emphase übrigens, welche die Repetition des Komparativs oder auch deren Interpunktion der gemeinten Gleichheit und ihrer ausgesuchten Höhe verleiht, um sie natürlich gegen vulgärkommunistische Vorstellungen abzusetzen, steht in einem süffisanten Missverhältnis zu dem Umstand, dass das Zitat, aus dem Gedächtnis abgerufen, gerade hier falsch ist. Im Original jener revolutionskritischen Figurenrede ist durchaus von keiner höheren, sondern mit einem blassen und vagen Versfüllsel nur eben von der »löblichen Gleichheit« die Rede.[93])
Was die politische Ausrichtung schon der Essays von 1932 angeht, so fällt unter dem gewählten Blickwinkel daran zunächst auf, wie Mann hier in gewissem Sinn auf Nietzsche zurückkommt. Wie Nietzsche fokalisiert er nun das Kosmopolitische gegenüber dem Nationaldeutschen oder Deutschnationalen, nachdem er dieses zuvor nota bene – in den ersten beiden Fassungen von Goethe und Tolstoi und in seinem Nachwort zu den Wahlverwandtschaften – besonders stark gemacht hatte. Goethes Degermanisierung sozusagen und seine reziproke Verweltbürgerlichung sind sogar quantitativ objektivierbar. Statistisch erhärten lassen sie sich im Rahmen eines distant reading, wie Franco Moretti seine Methode nennt, die seit einem halben Jahrhundert berufenen two cultures[94] der Wissenschaft endlich wieder zusammenzuführen und über die Kommunikationslosigkeit der beiden Wissenschaftskulturen hinauszugelangen.[95]
Einem distant reading bieten sich Manns Goethe-Essays hier beispielshalber in Hinblick auf die Verteilung eines schon verschiedentlich zitierten Wortungetüms an, das man füglich als Shibboleth des deutschen Nationalismus bezeichnen darf. Denn besonders gerne artikulierte sich dieser in jenem aberwitzigen und denn bei Goethe selbst nicht belegten Superlativ des Deutschen, ›deutschest‹: »›Dienst‹« zum Beispiel als »das deutscheste Wort« – so Thomas Mann in jenen propagandistischen Gedanken im Kriege –;[96] Lübeck als die »deutscheste« der deutschen Städte – so Wilhelm II., als er die ihm noch ganz unbekannte Stadt mit seinem Besuch beehrte –;[97] oder Hermann und Dorothea als »deutscheste[s] […] Epos«[98] und in solch »deutscheste[r] Deutschheit«[99] »deutscheste[s]«[100] unter Goethes Werken.
Die Verteilung des paradoxen Superlativs hat in der deutschen Sprachgeschichte zwei sich scharf abzeichnende Peaks, einen um die Zeit der Befreiungskriege und einen zur Zeit des Nationalsozialismus.[101] Demgemäß oder vielmehr kontrapunktisch dazu weist das morphologische Shibboleth auch in Manns Goethe-Essayistik eine ziemlich eindeutige Streuung auf. Es erscheint 1925 im Nachwort zu den Wahlverwandtschaften (nicht dem »größte[n]«, aber dem »höchste[n]« Roman »der Deutschen«[102]), zuvor und dann zeitgleich damit im Großessay Goethe und Tolstoi: ein Beleg in der ersten Fassung von 1921, zwei weitere in der Fassung von 1925.[103] In der dritten, noch einmal leicht erweiterten Fassung von 1932 kommt jedoch kein neuer hinzu. Und in den folgenden Essays taucht die Form gar nicht mehr auf.
Ihre Absenz ist hier ein Reflex der Tendenz, Goethe nun eben gegen deutschtümelnde Vereinnahmungen in Schutz zu nehmen und das Inter- oder Supranationale an ihm einzufordern. Symptomatisch dafür sind die mehrfachen Zitate des Gesprächs, in dem Eckermann die Prägung des Begriffs »Weltliteratur« aufzeichnete.[104] Auf diese berühmteste Begriffsprägung des alten Goethe, der damit das Zeitalter der Nationalliteraturen für tot erklärt haben wollte – »als Tatsache halb, halb als Forderung«[105] –, griff Thomas Mann erst relativ spät zurück, erst ab 1932, als der deutsche Nationalismus gerade dabei war, seine grässlichste Gestalt anzunehmen. Und zwar findet sich Manns erste Rückbesinnung auf den Begriff »Weltliteratur« sinnigerweise in einem ans fernste Ausland gerichteten Text, in seiner Adresse An die japanische Jugend.
Auch in den dann notgedrungen in der Ferne gehaltenen Vorträgen, den Princetoner Vorlesungen über Faust und über Werther von 1938 und 1939 (wenngleich erst 1939 respektive 1941 publiziert),[106] fehlt es, der konkreten Vortragssituation, aber auch der globalpolitischen Bedrohungslage entsprechend, so gut wie vollständig an Versuchen, Goethe für den deutschen Nationalismus zu vereinnahmen. Doch schon in den Reden von 1932 (abgesehen eben vom besonders gelagerten Fall der Letztfassung von Goethe und Tolstoi, die nicht mehr zu öffentlichem Vortrag gelangte[107]) fehlen alle deutschtümelnden Vokabeln.
Dabei blieb es. Denn darin, dass sie versuchen, zwischen Goethes eh und je reklamiertem »Deutschtum« und seiner nunmehr vindizierten Internationalität zu vermitteln, werden die Essays von 1949 nahtlos an diejenigen von 1932 anknüpfen, wenn auch auf der Basis erweiterter Kenntnisse. So war Thomas Mann mittlerweile »ein nicht genug zu rühmendes Buch« bekannt, Goethe und die Weltliteratur,[108] das »kürzlich der Berner Literatur-Gelehrte Fritz Strich […] geschrieben«[109] und ihm zu »Weihnachten 1945« handschriftlich gewidmet hatte: »Thomas Mann / Diesen Gruß aus der Schweiz, / die ihn, wie ich selbst, so / gern bald wieder sehen möchte.«[110]
Unbeschadet solcher Horizonterweiterungen, wie von Mann ja selber in einer eigentlich sehr nötigen captatio benevolentiae eingestanden, findet sich wenig Neues in seinen Essays. Er »selbst habe das [S]eine gesagt und [s]einen Sack geleert«.[111] Aber das Wenige, das dieser richtigen Selbsteinschätzung entgegen doch noch hinzukommt, ist in seiner Weise unerhört.
In diesem Sinn bemerkenswert ist zum Beispiel der Umstand, dass in den spätesten Essays jene Formel wiederkehrt, die dem jungen Thomas Mann dazu gedient hatte, seinen und den Abstand seiner Protagonisten zum gros seiner Landsleute zu benennen. »Nietzsche’s Lieblingswort« vom »Pathos der Distanz« überträgt der alte Thomas Mann in seinen letzten Essays endlich auf Goethe höchstselbst.[112] Oder genauer gesagt überträgt er es auf »Goethe’s majestätisches Alter«,[113] um damit einmal mehr seine Neigung zu verraten, seine eigenen und die Befindlichkeiten Goethes in eins zu setzen oder miteinander zu verwechseln. Der alte Goethe, aus dem »Absolutismus und persönliche[n] Imperialismus« seiner »Größe« heraus, hat nun seinerseits in einem problematischen Verhältnis zu »Deutschland« zu stehen.[114]
Dergleichen spricht natürlich wieder ganze Bände über das Intervall, das die letzten Essays von allen früheren trennt, insbesondere vom Jahr 1932. Bei der heiklen Aufgabe aber, dieses Intervall wenigstens andeutungsweise anzusprechen, griff Thomas Mann gewissermaßen auf seine allerersten Bemühungen zurück, Goethe zu charakterisieren und in eins damit politisch zu instrumentalisieren, und sei es auch zu einem damals noch ganz anderen Zweck. Dabei kam ihm Goethes eigene Begrifflichkeit zupass. Manns Aneignung derselben lässt sich wieder in Form eines distant reading objektivieren. Für ein distant reading drängt sich hier ein Begriff auf, von dem Goethe freilich behauptete, dass er ein solcher gar nicht sei: das Dämonische. Denn das damit notdürftig bezeichnete Phänomen, so Goethe, entziehe sich aus inneren Gründen, in seiner Widersprüchlich- und Unfassbarkeit, jedem Versuch, ihm mit einem Wort oder als Begriff beizukommen: »etwas […], das sich nur in Widersprüchen manifestirte und deßhalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefaßt werden könnte.«[115]
Vor den großen Goethe-Essays und zur Zeit seiner antirepublikanischen Gesinntheit hatte Thomas Mann hie und da das Dämonische sehr wohl schon bemüht, um Goethe zu charakterisieren und ihn wie gesehen für das »Irrationale[]« des tiefsten, innerlichsten etc. pp. Volks in Anspruch zu nehmen. In der eigentlichen Goethe-Essayistik jedoch, das heißt nach seiner Bekehrung zum Demokraten, mied Thomas Mann den Begriff zunächst sehr weitgehend; auch dort, wo der Kontext förmlich danach schrie.[116] Vor Ende des Zweiten Weltkriegs erscheinen in den Goethe-Essays nur ganz vereinzelt Vokabeln aus dem Wortfeld des ›Dämonischen‹.[117] Dieses selbst aber, als Substantivierung des Adjektivs, kommt fast nur nach dem Krieg vor, mit allein einer Ausnahme (einer Stelle der Princetoner Vorlesung Über Goethe’s »Faust«,[118] die kurz vor Kriegsausbruch vollendet und gehalten wurde[119]). Abgesehen jedoch von dieser einen Ausnahme taucht »das Dämonische« in den Goethe-Essays erst und ausschließlich der Nachkriegszeit auf: je drei-, viermal in der Phantasie über Goethe,[120] in den Drei Gewaltigen[121] und in der Ansprache im Goethejahr 1949.[122]
An diesen Stellen erscheint das Dämonische regelmäßig als Gegen- oder Komplementärgröße des »Urbanen«,[123] in Verbindung mit der »Sphäre des Natürlichen, Elementaren«.[124] Oder es erscheint in solchen Kollokationen, die dieser Sphäre ein entschieden unheimliches Timbre verleihen: »Dämonisch-Dunkles, Übermenschlich-Unmenschliches, das den bloßen Humanitarier kalt und schreckhaft anweht«;[125] »etwas Dämonisches doch auch an dunkler Getriebenheit, naturelbischer Vieldeutigkeit, vitalem Magnetismus«;[126] »etwas Kindliches und Dämonisches, etwas Entzückendes und Schauder Erregendes«.[127]
Es ist hier nicht der Ort, aber auch nicht wirklich nötig, philologisch akkurat abzuklären, was Goethe selber unter dem ›Dämonischen‹ verstand oder was er darunter nicht verstand; ein Wort, das in seinem Gesamtwerk erst ziemlich spät aufzutauchen beginnt, nicht vor 1805, und das er vorwiegend mündlich gebraucht haben wird. Denn mit der höchsten Frequenz erscheint es in dem für Mann so prägenden Korpus der Gespräche mit Eckermann. 18 von insgesamt 54 Belegen finden sich allein dort. Dabei scheint Thomas Mann allerdings bei seiner hingebungsvollen Lektüre des »besten deutschen Buch[s]« dennoch entgangen zu sein, wie sehr sich Goethes Gebrauch gerade dieses Worts von dem seinen und dem unseren unterscheidet.
Um sich des Goethe’schen Wortgebrauchs zu vergewissern, genügt es hier, die gründlich geleisteten Vorarbeiten der Goethe-Philologie zu Rate zu ziehen. Rose Unterberger, die Verfasserin des entsprechenden Artikels im Goethe-Wörterbuch, umschreibt den Bedeutungskern der Substantivierung so:
[A]ls metaphys[ische] Kategorie des G[oethe’]schen Altersdenkens zur Bezeichnung einer universal, bes[onders] aber im Bereich des (hist[orischen]) Geschehens schicksalhaft wirksamen unfaßbaren Energie des Paradoxen, mehrf[ach] als Gegenspieler der eth[ischen] u[nd] rationalen Instanz, öfter die Wende zu etw[as] Neuem, Außerordentlichem markierend.[128]
Diese Verwendungsweise unterteilt Unterberger noch weiter: einerseits »in allg[emeine] (wesensumschreibende[]) Aussagen«,[129] andererseits »das Dämonische in konkr[eten] Manifestationen im menschl[ichen] Bereich, meist m[it] Bez[ug] auf Personen von genialer, alle Normen sprengenden Kraft u[nd] Wirkung u[nd] auf schicksalhafte Konstellationen«.[130] Die hierfür wichtigste und berühmteste Stelle, an der sich Goethe also über die konkret-menschliche Manifestationsweise des Dämonischen auslässt, findet sich im letzten Buch von Dichtung und Wahrheit, der nach Manns Dafürhalten »beste[n] und jedenfalls liebenswürdigste[n] Autobiographie der Welt«.[131] Dort erzählt Goethe von der Entstehung eines seiner Trauerspiele; von der sozusagen apotropäischen Funktion, welche die Gestalt des Grafen Egmont und die Arbeit am eponymen Drama bei seinem Versuch gewannen, jenes in Worten und Begriffen unfassbare Wesen wenigstens in »ein Bild« zu bannen:
Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich dämonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer die etwas Ähnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete.[132]
Das solchermaßen Dämonische, für dessen Konkretisationen Goethe an anderen Stellen des Gesamtwerks noch weitere historische Beispiele gibt – Napoleon[133] oder Cagliostro[134] –, meint mehr und anderes, als man heute darunter verstehen würde und auch zu Thomas Manns Zeit spontan darunter verstanden hätte. Dieser Abstand vom alltagssprachlichen Wortgebrauch ergibt sich aus der ursprünglichen griechischen Bedeutung von daimon – das erste der ›orphischen‹ Urworte[135] –, auf die sich Goethe bei seinem Bestimmungsversuch ja auch explizit berief (»nach dem Beispiel der Alten«): »god, goddess, of individual gods or goddesses, […] but more freq[uent] of the Divine power«; »the Deity«; »the power controlling the destiny of individuals«; »ghost«; »spiritual or semi-divine being inferior to the Gods«.[136]
So, wie ihn Goethe vorzugsweise verwendet, steht der Begriff des Dämonischen diesen älteren Bedeutungen sehr viel näher als der heute landläufigen Verwendung des Worts, deren Spuren freilich in Dichtung und Wahrheit ebenfalls zu finden wären; erscheint das Dämonische doch auch dort wiederholt[137] als »furchtbare[s] Wesen«. Die bis heute habituelle Wortbedeutung ist natürlich eine Folge der Christianisierung, das heißt der christlichen Verdächtigungen und Abwertungen vorchristlicher Glaubensinhalte. Insofern darf man in Goethes Verwendungsweise der Vokabel auch einen Reflex seines notorischen Heidentums sehen. Sie ist Teil und Ausdruck der Reserve, die er als »dezidirter Nichtkrist«[138] dem Christentum gegenüber eh und je wahrte[139] und auf die auch Mann, seinerseits vom »freudige[n] Glaube[n]«[140] seiner Vorfahren abgefallen,[141] mehr oder minder unverhohlen zu sprechen kam (nachdem er sie anfänglich noch schönzureden versucht hatte, so im Nachwort zu den Wahlverwandtschaften – »Goethes allerchristlichstes Werk«[142] – und näherliegenderweise in Goethe und Tolstoi,[143] um erst ganz zuletzt wieder von Goethes Christentum zu reden und es als »natürliches Ingrediens seiner Persönlichkeit« auszugeben[144]).
Das Dämonische also führt in Goethes aktivem Wortschatz nicht dieselben stark negativen Konnotationen mit sich, die dem Begriff im älteren wie im jüngeren Neuhochdeutschen unweigerlich anhaften.[145] Wie weit nun aber diese grundsätzliche Differenz Thomas Mann seinerzeit selber oder auch nur seinen Gewährsmännern in Sachen Goethe bewusst war, ist nicht auszumachen. Albert Bielschowsky zum Beispiel, Verfasser einer zweibändigen Goethe-Monographie, die lange als Standardwerk gehandelt wurde und die Thomas Mann in seinen Essays denn bei sehr Weitem weidlicher ausschlachtete als jeden anderen Sekundärtext zum Autor[146] – obschon er sie kein einziges Mal beim Namen ihres Verfassers anführte und also verschwieg, wie viel er diesem verdankte –, Bielschowsky also benutzt das substantivierte Adjektiv, ohne die besondere, zumal die dezidiert positive Bedeutung eigens auszuweisen, die es in Goethes Lexikon annehmen kann.[147] Auch Mann jedenfalls greift in seinen späteren und späten Essays wieder zur Charakterisierung Goethes selbst auf das Wortfeld zurück, ohne je auf dessen sehr spezielle Verwendungsweise in Goethes eigener Diktion einzugehen. Erst für die Zeit nach dem letzten Goethe-Essay lässt sich seine (wenig begeisterte) Lektüre eines Buchs belegen,[148] das, gleichfalls erst danach erschienen, die Besonderheit des Goethe’schen Sprachgebrauchs immerhin partiell berücksichtigt, nämlich soweit dieser sich auf die Ableitungsbasis »Daimon« erstreckt – also ohne eigentlich auf die Substantivierung des ›Dämonischen‹ zu sprechen zu kommen –: Goethe in der Periode der Wahlverwandtschaften von Hans M. Wolff.[149] (Wolff, ein Exilgermanist, der sich später vermutlich wegen seines Leidens an seiner Homosexualität suizidierte, sollte sich als Philologe im Übrigen auch um Thomas Mann verdient machen[150] und hatte diesem schon kurz zuvor »in alter Verehrung« eine erste Studie zu Goethe gewidmet, Goethes Weg zur Humanität, die bereits mit diesem Titel dem Tenor seiner, Manns, eigenen Goethe-Essays huldigt – schon deren erster führt seinerseits das »Problem der Humanität« schon im Untertitel –, um dieselben denn buchstäblich auf der allerersten Seite affirmativ zu zitieren.[151])
So aufs Geratewohl verwendet wie in Manns Essays, mussten das Adjektiv ›dämonisch‹ und seine Substantivierung wenigstens für den weit überwiegenden Teil der Leser- und Hörerschaft die Denotate anlagern, die ihnen bei Goethe selbst, um es nochmals zu wiederholen, durchaus nicht notwendig eigneten, Denotate eben des Dunklen, Ungeheuren, Abgründigen, ja des schlechtweg Bösartigen. Die diffuse Verwendung des Begriffs aber, der schon bei Goethe wie gesagt ein solcher gar nicht sein wollte und der dadurch nur desto stärker ins Schillern geriet, ermöglichte Mann wie auch den zeitgenössischen Goethe-Forschern die sprichwörtliche Quadratur des Kreises; so etwa auch dem frisch ›entlasteten‹ Ordinarius Hans Pyritz,[152] der als Mitläufer des Nationalsozialismus seine besonderen Beweggründe haben mochte, mit solcherlei goetheanischen Verbrämungen des Bösen zu poussieren.
Der ›Begriff‹ des Dämonischen, vollends zu schwammig geworden, um diesen Namen zu verdienen, half Thomas Mann wie kein anderer, das hauptsächliche Dilemma zu bearbeiten, das sich in den spätesten Goethe-Essays stellte, ganz besonders soweit sie für ein deutsches Publikum bestimmt waren. Einerseits musste Mann seinen Goethe selbstverständlich weiterhin als den deutschen Repräsentanten besten humanistischen Erbes hinstellen und hochhalten. Solch ein Goethe aber wäre pur et dur nur um den Preis einer besonders in Übersee »populäre[n]« und für Thomas Mann mehr und mehr »abgeschmackte[n] Unterscheidung« zu haben gewesen, »zwischen einem ›bösen‹ und einem ›guten‹ Deutschland«.[153] Nur auf dem Weg solch einer Zwei-Deutschland-Theorie, wie sie Mann in den Goethe- und anderen Essays prinzipiell und ausdrücklich ablehnte,[154] wäre Goethe ohne Rest gegen die Geschehnisse auszuspielen gewesen, die mit dem Deutschland der vergangenen anderthalb Jahrzehnte unauflöslich verbunden waren.
Andererseits ging es nun eben gerade darum, Goethe als deutschen Nationalschriftsteller in eine Zeit hinüberzuretten, da die deutsche Vernichtungspolitik die humanistischen und humanitären Traditionen soeben noch verhöhnt und geschändet hatte. Goethe als Nationalschriftsteller zu retten, das hieß unter solchen Umständen auch: seine Person für die überwiegende Mehrheit der Deutschen als Integrationsangebot zu wahren; seine Positionen nicht ganz und gar kompromisslos gegen das in Frontstellung zu bringen, was in und mit Deutschland geschehen war in der jüngsten Vergangenheit. Auf diese Vergangenheit, ohne sie ausdrücklich beim Namen zu nennen, konnte mit der unscharfen Größe des Dämonischen Bezug genommen werden – je nachdem, was alles man sich unter dem verschwommenen ›Begriff‹ noch vorzustellen bereitfand. Die Bedeutungsbreite des so unspezifisch benutzten Worts ließ es zu, bei diesem selbst an die nationalsozialistischen Exzesse zu denken, während in Goethes eigener Verwendungsweise damit allerhöchstens noch so etwas wie die Massenpsychologie des Faschismus oder die Charismatik seiner Führerfiguren gedeckt gewesen wäre.
Manns Wortwahl lief auf eine Offerte hinaus, die im Namen des deutschen Volks verbrochenen Scheußlichkeiten doch auch, und sei es noch so vage und von sehr, sehr fern, an etwas »Dunkles«, Nicht-»Urbane[s]«, »Unmenschliches« anzuschließen, das er unter der Signatur des Dämonischen in Goethes Persönlichkeitsstruktur neuerdings nun auch wieder und sogar besonders nachdrücklich ausmachte. Zu diesem Ende bedachte er es mit der typisch Goethe’schen Vokabel, deren Bedeutung in dieser euphemistischen Funktion freilich noch ungleich stärker zu oszillieren begann als bei Goethe selbst. Damit verharmloste er das Geschehene zugleich auch. Oder jedenfalls ließ er die Möglichkeit offen, es dem zu integrieren, was mit dem Nationalschriftsteller Goethe noch, was mit ihm auch noch assoziierbar war.
Das hierfür schlagendste Zeugnis ist die Rede und der Essay Goethe und die Demokratie oder fast mehr noch dessen Textgeschichte. Wie der Titel erwarten lässt, vollführt Mann in Goethe und die Demokratie ein waghalsiges, wenn nicht halsbrecherisches Manöver. Es geht ihm darum, den Nationalschriftsteller dadurch zu salvieren, dass er ihn für demokratische Ideale in Anspruch zu nehmen versucht, wie sie nunmehr in Deutschland hüben und drüben unversehens in so hohen Ehren gehalten wurden. Um Goethe für die Demokratie zu gewinnen, trotz allem, was so eklatant dagegensprach – angefangen schon beim ausdrücklich »undemokratischen«[155] »Absolutismus und persönliche[n] Imperialismus« zumal seines »majestätische[n] Alter[s]« –, kam Mann selbstverständlich nicht darum herum, dies ›alles‹ mehr oder weniger schonungslos zu benennen, bevor er dann sozusagen die andere Spalte einer doppelten Buchführung aufzufüllen begann. Zu diesem Zweck konfrontierte er wohl oder übel erst einmal Goethes »Skepsis gegen liberale Regierungsformen«.[156] Diese Skepsis, und damit hatte der Redner und Essayist natürlich nur zu recht, sei »tief«:
Man werde finden, sagte er [scil. Goethe], daß »man von oben herab mit zu großer Güte, Milde und moralischer Delikatesse auf die Länge nicht durchkomme, indem man eine gemischte und mitunter verruchte Welt zu behandeln und in Respekt zu halten habe« – was bereits bis ins Wort hinein an Schopenhauer, seinen politischen Schüler, erinnert. In Fragen der Kriminaljustiz ist er entschieden gegen Weichheit und Schlaffheit, erzürnt sich gegen die humanitäre Neigung der Zeit, Verbrechern mit ärztlichen Zeugnissen und Gutachten an der verwirkten Strafe vorbeizuhelfen und läßt sich wohlgefällig von einem energischen jungen Physikus berichten, der die Frage, ob eine gewisse Kindsmörderin zurechnungsfähig sei oder nicht, entschlossen dahin beantwortet habe, sie sei es allerdings. – »Sie ist die erste nicht!«[157]
Oder in der englischen Übersetzung, in der Thomas Mann die Rede bei den ersten vier oder dann auch wieder bei der letzten Gelegenheit hielt und insgesamt fast so oft wie auf Deutsch (vor deutschem Publikum überhaupt nur ein einziges Mal):[158]
His scepticism of liberal forms of government is deep seated. It will be found, he said, that »great kindness, leniency, and moral delicateness, applied from above, will not avail in the long run, since the ruler has to deal with a mixed and frequently [versus ›mitunter‹] wicked world, and has to keep it in awe of him.« He was annoyed with the humanitarian tendency of the time to commute the sentences of criminals on the basis of medical opinions and certificates. He listened with satisfaction to the report of a resolute young physician on the question of the sanity of a certain woman who had killed her child, and whom the medical expert pronounced sane and guilty. One thinks on Gretchen and on Faust’s wrath over Mephistopheles’ icy word: »Sie ist die Erste nicht.«[159]
Dass dieser Passus unter den gegebenen zeitgeschichtlichen Umständen überaus heikel war, zeigt sich schon an den verschiedenen Versionen des Essays und der Rede, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. In den als Typoskript erhaltenen Radiofassungen fehlt der Passus. In einer gekürzten Version der englischen Übersetzung strich ihn Thomas Mann erst durch, um die Streichung dann mit Punktierungen doch wieder zu annullieren und eigens die (eingeklammerte) Marginalie hinzuzusetzen: »[Do not omit!]«
Wie er in der englischen Übersetzung und für ein im Faust weniger beschlagenes Publikum eigens ausbuchstabierte, legt Thomas Mann Goethe hier ein ganz besonders »zynisches«[160] Wort Mephistos in den Mund: »One thinks on Gretchen and on Faust’s wrath over Mephistopheles’ icy word: ›Sie ist die erste nicht.‹«[161] Und zwar erfolgte die Verschiebung des eisigen Worts von der Teufelsfigur auf deren Schöpfer weder grundlos noch leichtfertig. Denn so sehr Faust sich über die sarkastische Art entrüstet, wie Mephisto Gretchens erschütterndes Schicksal als Alltagsbagatelle abtut, so wenig kann man den späteren Goethe davon freisprechen, dass er sich diese mephistophelisch-indolente Logik selber zu eigen machte. Als man zu Ehren seines achtzigsten Geburtstags Der Tragödie ersten Teil inszenierte, hatte Goethe offenbar nichts dagegen, Fausts »wrath« und seine, Fausts, empörte Entgegnung auf Mephistos Zynismus schlankerhand wegzulassen.[162] Darauf hatte Mann selber schon in seiner Princetoner Faust-Vorlesung hingewiesen, indem er Goethe sogar eine Alleinverantwortung für die Strichfassung zuschrieb.[163] In derselben Vorlesung wie bereits in Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters steht auch, dass der Minister Goethe nicht anders als seine »gestrengen Herren«[164] Kollegen, und obwohl der Herzog, später Großherzog Carl August lieber Gnade vor Recht hätte walten lassen, das über eine sogenannte Kindsmörderin verhängte Todesurteil »durch seine Unterschrift guthieß«[165] – »jenes schreckliche ›Auch ich‹«[166] –; eine in den frühen Dreißigerjahren schnell zur Allerweltslegende ausgewachsene Anekdote,[167] deren juridische Quisquilien bis heute umstritten sind, die aber einen erwiesenermaßen wahren Kern hat.[168]
Indessen macht Thomas Mann in Goethe und die Demokratie den Nationalschriftsteller doch ein bisschen schlechter, als es die hier herangezogene Quelle eigentlich erforderte. Diese ist schnell ermittelt. Die hier ins Feld geführten Zitate stammten wieder einmal aus Manns ältestem Fundus, aus den Gesprächen mit Eckermann: einem Tischgespräch mit diesem, 18. Februar 1831; und einem tags darauf geführten Gespräch mit Eckermann und dem Leibarzt des Großherzogs, Karl Vogel, auf das bereits der junge Thomas Mann aufmerksam geworden sein musste. Denn unter dem Lemma »Zurechnungsfähigkeit der Verbrecher« ist es auch schon in der Konkordanz erfasst,[169] die er in seiner ersten Eckermann-Ausgabe zusätzlich zu dem dort ohnedies mit enthaltenen Register anzulegen sich die Mühe gemacht hatte – ein weiteres, besonders anrührendes Dokument für die angestrengte Ernsthaftigkeit, mit der er sich in das von Nietzsche quasi heiliggesprochene Buch zu versenken pflegte.
Das Privatissimum mit Eckermann zerfällt in dessen Referat in zwei völlig verschiedene Hälften. Es drehte sich zu seiner ersten Hälfte um »verschiedene Regierungsformen«,[170] zur zweiten um Goethes gegenwärtige Arbeiten, die seinerzeit gerade in ganz unverhoffter Weise gediehen (wobei der Passus wieder einen guten Beleg für die entschieden positive Bedeutungsfacette des ›Dämonischen‹ enthält: »Dergleichen« sei ihm, Goethe, »öfter begegnet, und man komm[e] dahin, in solchen Fällen an eine höhere Einwirkung, an etwas Dämonisches zu glauben, das man anbetet, ohne sich anzumaßen, es weiter erklären zu wollen.«[171]).
Während es sich bei dieser zweiten Gesprächshälfte ganz offensichtlich um einen treu protokollierten Werkstattbericht Goethes handelt, ist die Autorschaft des in der ersten Hälfte Referierten, »über verschiedene Regierungsformen«, durchaus nicht so eindeutig festgelegt. Eckermann unterlässt es hier auszuweisen, wer zu diesem Teil des Tischgesprächs was beigetragen habe: »Wir reden […]. Es wird […] erwähnt […].«[172]
Dass es Goethe war, der sich dermaßen rigid gegen Liberalismus und »moralische[] Delikatesse« aussprach, ist ganz so sicher nicht, wie es Thomas Mann hinstellt. Es bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, Goethe von der Autorschaft des zitierten Bekenntnisses zu entlasten und sie Eckermann anzuhängen; eine Versuchung, mit der denn auch der bisher letzte Kommentator des Essays prompt zu liebäugeln scheint.[173] Indessen ist Manns Auffassung natürlich die viel, viel wahrscheinlichere. Denn wäre Johann Peter Eckermann oder, wie ihn sein notorischer Gastgeber etwas herablassend nannte, wäre der »getreue Eckart«[174] wirklich der Tischgenosse und die Persönlichkeit gewesen, seinem Gastgeber und Idol gegenüber eine politische Position zu vertreten, von der er auch nur hätte vermuten können, dass sie Goethes Missfallen fände?
Manns Bereitschaft einzuräumen, was seinem Ziel entgegensteht – eben Goethe der Partei der Demokraten einzugemeinden und allem gleichzusetzen, was damit an »Güte, Milde« und Toleranz mitgemeint ist –, solch eine Gewilltheit, selbst das in Rechnung zu stellen, was diesem Ende widerspricht, lässt sich auch an seiner Verwendung der anderen hier herangezogenen Gesprächsstelle ausmachen. Namentlich ist sie an der Art abzulesen, wie Thomas Mann Goethes harte Positionen in Sachen Strafvollzug referiert. Denn auch hier schießt er über das Ziel hinaus, das ihm die Gespräche mit Eckermann beziehungsweise auch mit Karl Vogel an und für sich gesteckt hätten.
In dem Gespräch mit Eckermann und Vogel ging es ebenfalls um die Härte und nackte Gewalt, mit der ein Staat seine Macht durchzusetzen habe. Auf dieses Thema kam das Gespräch aus aktuellem Anlass. Den Anlass bildete eine bis heute oder heute gerade wieder kontroverse Frage, die auch in Goethes Erzählwerk verhandelt wird.[175] Es war die Frage nach der Legitimität eines staatlich verordneten Impfzwangs.[176] »Vogel erzählte, als das Neueste des Tages«,[177] von einem Rezidivieren der Blattern. Diese Neuigkeit nahm Goethe dazu wahr, sich für eine rigorose Durchsetzung staatlicher Impfprogramme auszusprechen, »strenge auf ein Gesetz zu halten, zumal in einer Zeit wie die jetzige, wo man aus Schwäche und übertriebener Liberalität überall mehr nachgibt als billig«.[178] Und weiter:
Es kam sodann zur Sprache, daß man jetzt auch in der Zurechnungsfähigkeit der Verbrecher anfange weich und schlaff zu werden, und daß ärztliche Zeugnisse und Gutachten oft dahin gehen, dem Verbrecher an der verwirkten Strafe vorbei zu helfen. Bei dieser Gelegenheit lobte Vogel einen jungen Physikus, der in ähnlichen Fällen immer Charakter zeige, und der noch kürzlich bei dem Zweifel eines Gerichts, ob eine gewisse Kindesmörderin für zurechnungsfähig zu halten, sein Zeugnis dahin ausgestellt habe, daß sie es allerdings sei.[179]
In diesem Passus steht kein Wort davon, dass sich Goethe »wohlgefällig« von jenem Hardliner von jungem Arzt hatte berichten lassen, der die »gewisse Kindesmörderin« für zurechnungsfähig erklärt hatte. Lob und Wohlgefallen sind hier nicht für Goethe, sondern allein für den Höfling Vogel bezeugt. Thomas Manns inakkurate Wiedergabe des Sachverhalts scheint mit anderen Worten zu den Stellen zu gehören, an denen er aus dem Vollen seiner Goethe-Kenntnisse schöpfte und sich, nicht ganz zu Recht, auf sein Gedächtnis verließ.
Damit, dass Thomas Mann die Stelle ex memoria anführt, ist die Ungenauigkeit ihrer Paraphrase freilich nur beschrieben oder erklärt, aber noch nicht verstanden. Verstehen muss man die Abänderung des Sachverhalts oder Gesprächsverlaufs als eine Fehlleistung. Die Eintrübung der Erinnerung ist Ausdruck eines bestimmten Bilds, das sich Thomas Mann vorgängig vom älteren und umso kaltherzigeren Goethe schon zurechtgelegt haben musste.
Was also die unmenschliche Erbarmungslosigkeit gegenüber gewissen Delinquentinnen betrifft, darf oder muss man Goethe vor Thomas Mann ein wenig in Schutz nehmen. Ganz anders verhält es sich indessen bei dem, was sich in Goethe und die Demokratie an jenes sardonische Mephisto-Zitat unmittelbar anschließt – oder allenfalls vermittelt nur durch einen desto bedeutungsträchtigeren Gedankenstrich. Was er in seinen Quellen gefunden hatte, gab Thomas Mann hier vollkommen akkurat wieder, peinlich und anstößig, wie es war – und worauf eben vielleicht schon die Interpungierung oder die Schweigepause deutet, die sie notiert –:
»Sie ist die erste nicht!« – Mit der Judenemanzipation, die doch von seinem großen Kaiser überall gefördert wurde, ist er wenig einverstanden. Schließlich, sagt er, werde man in Weimar gar noch eine jüdische Oberhofmeisterin haben.[180]
Goethes Widerwillen gegen die Judenemanzipation tritt einem in Goethe und die Demokratie sozusagen aus heiterem Himmel entgegen, das heißt ohne in den früheren Essays je auch nur gestreift worden zu sein. Unter den früheren Essays, sieht man beim distant reading derselben einmal vom Titel des Ewigen Juden ab, kommt »das Wort ›Jude, jüdisch‹«[181] kaum je vor, nämlich allein in Goethe und Tolstoi. Das Adjektiv taucht dort im Zusammenhang mit Tolstois »eher jüdisch-alttestamentarische[r] als christliche[r]«[182] Ehe auf, und auch das Abstraktum erscheint im Junctim mit dem Christentum: in einer Invektive – der zweiten und dritten Fassung – gegen den »deutsche[n] Faschismus«, dem »nicht nur das internationale Judentum, sondern ausdrücklich auch das Christentum […] zuwider« sei;[183] und im Rahmen jener anfänglichen Anstrengungen, Goethe doch noch für das Christentum zu reklamieren. »Das angeblich dezidierte Heidentum Goethes (der in den ›Wanderjahren‹ das Judentum zu den ethnisch-heidnischen, den Volksreligionen rechnet)« konfrontiert Thomas Mann mit der Einschätzung oder Behauptung, dass dieser Goethe »in seinem Bewußtsein […], aller olympischen Göttlichkeit ungeachtet, in hohem Grade geistiger Christ«[184] sei – eine ziemlich absurde Apologie, deren Fragwürdigkeit der Autor selbst verrät, allein schon durch seine Interpunktion des Texts. Die Klammern, zwischen die er den Relativsatz von Goethes Zurechnung des Judentums erst seit der zweiten Fassung stellt – nachdem er dem Hinweis darauf in der ersten Fassung noch einen eigenen Hauptsatz gewidmet hatte[185] –, geben doch wohl deutlich genug zu erkennen, dass schon auch ihm selber nicht so recht einleuchtete, was hiermit für Goethes hochgradig geistiges Christentum gewonnen sein sollte. –
Bevor er in Goethe und die Demokratie so unversehens auf Goethes Ressentiments gegen die Juden zu sprechen kam, hatte Thomas Mann den Nationaldichter ganz im Gegenteil in Frontstellung gegen alles Antisemitische gebracht. So namentlich im Essay Zum Problem des Antisemitismus (1937). Sein Goethe und alles Goethische waren dort sozusagen noch ein Immunisationsschutz dagegen: »Der goethisch erzogene, der kulturell gerichtete Deutsche […] kann nicht Antisemit sein, er muß es sich versagen, an dieser niedrigen Volksbelustigung im Geringsten teilzunehmen […].«[186]
Dem entspricht das Goethe-Bild des Romans, an dem der goethisch erzogene und kulturell gerichtete Autor damals schrieb, Lotte in Weimar. Dort stellte er Goethes Aufgeschlossenheit gegenüber dem Judentum heraus. Besonders gerne griff er dabei auf die in Goethes Gesprächen überlieferte Vorstellung von der »allerwunderlichste[n] Verwandtschaft« des jüdischen und des deutschen »Volks« zurück.[187] Hiermit distanzierte er sich von den völkischen Vereinnahmungen des Nationalschriftstellers,[188] gegen die er sich auch schon vor der fatalen Machtergreifung abgrenzte,[189] als ihn die »Vermischung von Hitlerismus und Goethe« immerhin »eigenartig berührte«.[190] So anlässlich der Goethe-Feierlichkeiten von 1932 in Weimar, einer »Zentrale des Hitlertums«,[191] allwo der »letzte[] große[] Weltdichter[]«[192] bei der nächstbesten Gelegenheit denn schlankerhand zum Nazi-Sympathisanten avant la lettre