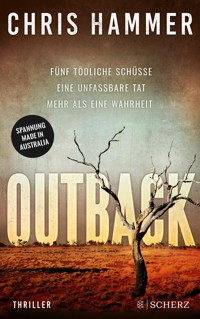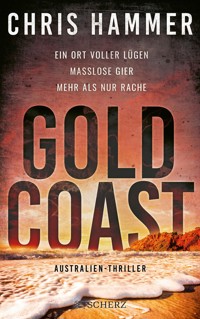
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
»Gold Coast«, der australische Nr.1-Bestseller-Thriller - vom Gewinner des wichtigsten britischen Krimipreises Chris Hammer Journalist Martin Scarsden ist auf dem Weg zu seinem Heimatort an der Gold Coast im Osten Australiens. Doch bei seiner Ankunft bietet sich ihm ein schreckliches Bild: seine Freundin Mandy hockt in der Küche, Blut an den Händen. Neben ihr liegt ein alter Freund, brutal erstochen. Sofort ist sie die Hauptverdächtige. Martin ermittelt auf eigene Faust – und trifft auf alte Lügen und neues Geld. Dann der Schock: unter den Palmen eines Hippie-Resorts sterben sieben Touristen an Gift, darunter ein indischer Guru und ein Filmstar. Die Medien wollen von Martin die große Story. Kann er sie liefern und gleichzeitig Mandys Unschuld beweisen? Die Zeit läuft ihm davon. »Überwältigend gut, hochspannend, eindrucksvoll.« Sunday Times »Chris Hammer, selbst Journalist, legt ein fulminant spannendes Krimidebüt hin.« Stern über »Outback«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 684
Sammlungen
Ähnliche
Chris Hammer
GOLD COAST
Ein Ort voller Lügen. Maßlose Gier. Mehr als nur Rache AUSTRALIEN-THRILLER
Australien-Thriller
Aus dem australischen Englisch von Rainer Schmidt
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Glenys und Kevin
Montag
Eins
Die Sonne sticht ihm in die Augen, er kann den Ball nicht sehen und schwingt blind den Schläger. Hoffentlich trifft er, hoffentlich blamiert er sich nicht, wenigstens diesmal. Also schwingt er den Schläger, mit geschlossenen Augen, wie im Gebet. Und wie vom Himmel diktiert, trifft er den Ball. Durch den Holzgriff, durch den zerschlissenen Gummibezug und die zerfasernde Wickelschnur hindurch fühlt er die Wucht. Er fühlt, wie der Schlag den schwammigen Ball flachdrückt und komprimiert, wie dieser sich wieder ausdehnt und im hohen Bogen davonfliegt. Und in diesem Moment des Aufpralls, in diesem Sekundenbruchteil, liegt Vollkommenheit. Er öffnet die Augen, lässt den Schläger los und beschattet sein Gesicht noch rechtzeitig, um dem Ball nachzusehen, ihn zu bestaunen, wie er über den Lattenzaun in den Nachbargarten fliegt. Eine Sechs. Sechs und aus. Abgewiesen, aber prachtvoll, nicht schändlich. Kein dumpfes Aufschlagen des Balls in der Mülltonne, kein höhnisches Gelächter über eine vergebene Chance. Eine Sechs. Über den Zaun. Ein Heldentod.
»Leck mich am Arsch, Martin. Was für ein Schlag«, sagt Onkel Vern.
»Aber Vern«, mahnt seine Mutter.
»Triffst du ihn, hast du ihn«, sagt der Bowler, ein Junge, der weiter unten an der Straße wohnt.
Martin sagt nichts, er tut nichts, er rührt sich nicht, ist gefangen im Augenblick. Im Augenblick seines Schlags. In diesem perfekten Augenblick. Gefangen in der Zeit.
Und dann.
Klingelt das Telefon. »Mumma, Mumma«, ruft Enid oder Amber, jedenfalls eine der beiden Zwillinge, der unzertrennlichen, nicht unterscheidbaren Schwestern. Und seine Mutter geht, bevor sie ihn zu seinem Schlag gratulieren, ihn so beglückwünschen kann, wie er es verdient. Geht zum Telefon, zu dem Anruf, der die Welt in zwei Hälften teilt, der eine messerscharfe Linie zwischen Vorher und Nachher zieht.
Dreiunddreißig Jahre später ist Martin Scarsden unterwegs, fährt in seine Erinnerung hinein, fährt hinunter nach Port Silver. Halb konzentriert er sich auf die Straße und steuert den Wagen durch die Haarnadelkurven den Steilhang hinunter, und halb hat er sich in der Vergangenheit verloren, in jenem vollkommenen Tag, als das Schicksal so hell und so kurz aufstrahlte, und gleich darauf der Vorhang fiel wie nach einem Theaterstück. Heute flimmert die Sonne durch das Laubdach des Regenwalds, flackert wie ein Stroboskop. Martin blinzelt, er kann das Meer nicht sehen, nur fühlen, und er weiß, wenn er an den Straßenrand fahren würde – wenn an dieser schmalsten aller Straßen Platz zum Anhalten wäre –, dann könnte er ihn sehen: den Pazifik. Er ist da, hinter den Bäumen, eine unendliche blaue Fläche. »Kannst du das Meer sehen?«, fragt sein Vater ihn, wie er ihn jedes Mal gefragt hat, wenn sie durch die Haarnadelkurven hinunterfuhren. »Siehst du das Meer, komm wieder her«, sagte er dann lachend. Martin sah es nie. Nie. Aber es kam der Moment, wo er es nicht mehr sehen musste.
Wo er wusste, dass es da war, jenseits des Escarpment, der Abbruchkante, jenseits der Milchfarmen, der Zuckerrohrfelder und der Flussebenen, hinter dem Fischereihafen, den Ferienhütten, den weißen Sandstränden. Sehen konnte er es nicht, aber fühlen.
Und so ist es auch an diesem Tag im Frühherbst, als der Wagen sich zwischen Gesprenkeltem Eukalyptus und Keulenlilien hinunterschlängelt, zwischen Palmen und Geweihfarnen, rankenbehängten Zedern und den Rufen der Glockenvögel hindurch auf den Ozean zu. Er fühlt ihn in der Luft; aus feucht und kühl wird feucht und warm, und es knackt in seinen Ohren, als er zum Ozean hinunterfährt und den Sog der Trockenheit des dürreverwüsteten Inlandes auf der anderen Seite des Küstengebirges zurücklässt. Und in der Ferne, immer noch unsichtbar, aber schon beeindruckend: Port Silver. Das Land seiner Jugend. Er ist zurück.
»Vern! Vern!«, ruft sie, und ihre Stimme klingt nie zuvor. »Martin! Mädels!« Er klettert wieder über den Zaun. Das graue Holz ist trocken und voller Splitter. In der Hand hat er den Ball, seine glorreiche, vom Hund zerkaute Trophäe. Die Mutter stürmt zur Fliegentür heraus, lachend und weinend zugleich. Ihre Emotionen sind wie eine Flutwelle. »Wir haben’s geschafft. Herrgott noch mal. Wir haben den Scheiß gewonnen!«
Martin sieht seinen Onkel an, erkennt dort dieselbe Ratlosigkeit angesichts der noch nie dagewesenen Flucherei der Schwester.
»Hilary?«, fragt er.
»Die Lotterie, Vern. Die verdammte Lotterie! Division One!«
Martin springt vom Zaun in den plötzlich nicht mehr vertrauten Garten. Der Ball ist vergessen, der Schläger liegt am Boden. Die Lotterie. Sie haben im Lotto gewonnen. Im verdammten Lotto. Vern umarmt eine von Martins Schwestern, und sie erwidert die Umarmung, glücklich und verständnislos, und dann tanzen sie alle fünf: seine Mutter, die Zwillinge, er selbst und Onkel Vern, sie tanzen auf dem siegreich umgemähten Wicket, während der Junge, der weiter unten an der Straße wohnt, mit großen Augen und offenem Mund die Neuigkeit vor sich hertreibt wie der Südwind: Die Scarsdens haben Division One gewonnen. Die verdammte Lotterie.
Die Steilwand stößt auf die Ebene, der Regenwald endet, und die Milchfarmen kommen näher. PORTSILVER30 KM steht auf dem Straßenschild. Martin Scarsden kehrt in die Gegenwart zurück. Himmel noch mal, warum hatte Mandy ausgerechnet diese Stadt, seine Heimatstadt, für den gemeinsamen Neuanfang ausgesucht? Er fährt auf der alten Brücke über den Battlefield Creek, der am Fuße des Escarpment entlangfließt, eine Grenzlinie zwischen der Natur der Steilwand und der aufgezwungenen Geometrie von Farmen und Zuckerrohrfeldern. Martin will den Gang wechseln, auf der schnellen Straße durch das Flachland beschleunigen, als er sie sieht: die Anhalterin.
Ihre Beine in der abgeschnittenen Jeans leuchten in der subtropischen Sonne. Ein bauchfreies Tanktop, ein lässig ausgestreckter Daumen. Eine Ausländerin also. Ihr Haar ist offen, ihr Lächeln ebenfalls, und es wird breiter, als er am Straßenrand hält, auf dem Kies, kurz vor dem Abzweig zur Zuckermühle. Schon bevor der Wagen steht, sieht Martin ihren Begleiter. Er hat dunkle, lange Haare und sitzt neben zwei Rucksäcken im Schatten, wo man ihn von der Straße aus nicht sehen kann. Martin lächelt; er erkennt den Trick, ist nicht beleidigt.
»Port Silver?«, fragt die junge Frau.
»Natürlich.« Es ist nicht so, dass man auf dieser Straße woanders hinkäme.
Martin muss den Schlüssel benutzen, um den Kofferraum aufzuschließen. Die Innenentriegelung in seinem alten Toyota Corolla ist seit langem kaputt. Der junge Mann wuchtet die Rucksäcke mühelos in den Kofferraum und klappt den Deckel zu. Martin sieht seine Arme und die Tattoos auf den definierten Muskeln, die Muskulatur der Jugend, umweht von Tabakduft und Sorglosigkeit. Die junge Frau setzt sich neben Martin, der Mann schiebt Martins spärliche Besitztümer zur Seite und nimmt auf dem Rücksitz Platz. Sie riecht gut nach irgendeinem Kräuterparfüm. Ihr Freund nimmt die Sonnenbrille ab und lächelt dankbar. »Danke, Mann. Nett von Ihnen.« Er langt über die Rückenlehne und begrüßt Martin mit einem kräftigen Händedruck. »Royce. Royce McAlister.«
»Topaz«, sagt das Mädchen und ersetzt die Hand ihres Freundes durch ihre. »Und Sie sind …?« Ihre Hand ruht einen flirtenden Moment auf Martins Arm.
»Martin«, antwortet er lächelnd.
Er startet den Motor und fährt weiter. Seine Kindheitserinnerungen sind verweht.
»Sie wohnen in Port Silver?«, fragt Topaz.
»Nein. Schon lange nicht mehr.«
»Wir suchen Arbeit.« Sie spricht mit amerikanischem Akzent. »Wir haben gehört, um diese Jahreszeit gibt’s hier oben reichlich.«
»Kann sein«, sagt Martin. »Die Ferien sind vorbei, die Kids sind wieder in der Schule, vielleicht habt ihr Glück.«
»Was ist mit Obstpflücken?« Royce beugt sich vor. Er spricht unverkennbar wie ein Australier, breit und unprätentiös. »In Treibhäusern?«
»Bestimmt«, sagt Martin. »Aber das ist ein härterer Job als Kellnern im Café oder die Betreuung von Touristen.«
»Ich brauche das für mein Visum«, sagt Topaz. »Wenn ich drei Monate außerhalb der Großstädte arbeite, kriege ich noch ein Jahr in Oz. Wir haben den Nachtzug rauf nach Longton genommen. In Sydney heißt es, dort gibt’s jede Menge Arbeit.«
»Möglich. Keine Ahnung«, sagt Martin. Als er Kind war, haben in den Treibhäusern am Fluss Migranten gearbeitet, Wanderarbeiter, die in ihrer neuen Heimat Fuß fassen wollten. Heutzutage sind Rucksacktouristen aus dem Ausland die Arbeitskräfte der Wahl.
Topaz redet weiter. Mit ansteckender Begeisterung erzählt sie von ihren Abenteuern: wie sie Royce in Goa kennengelernt hat, wie er ihr nach Bali und dann nach Lombok gefolgt ist, wie sie sich verliebt haben und zusammen nach Australien gekommen sind. Royce wirft Bemerkungen ein und lacht. Es ist wie ein Auftritt, ein Zwei-Personen-Stück, und Martin ist das Publikum; er ist dankbar für die Ablenkung. Royce hat seine Sonnenbrille wieder aufgesetzt. Sie hängt schief; der eine Bügel fehlt, aber das scheint ihn nicht zu stören – als sollten alle Sonnenbrillen so sein. »Wir lassen uns einfach treiben, Mann«, so fasst er die Moral ihrer Geschichte zusammen. Martin hat Mühe, sich auf die Straße zu konzentrieren. Immer wieder wirft er einen verstohlenen Blick auf die beiden, Royce auf dem Rücksitz mit seinem breiten Kinn, dem offenen Lächeln und der widerspenstigen Sonnenbrille, und Topaz vorn, neben ihm, der Sicherheitsgurt schneidet ein Tal zwischen ihre Brüste. Seine Aufmerksamkeit scheint ihr bewusst und willkommen. Bald redet auch Martin, während der Wagen mit hohem Tempo auf Port Silver zufährt. Er erzählt ihnen, wo die besten Strände und Surfplätze sind, wo man angeln und wo man schwimmen kann. Dann erreichen sie die Stadt: eine neue High School, ein Parkplatz, ein billiges Hotel, ein paar Fastfood-Läden. Stämmige Palmen säumen die Straße. Verändert, und doch vertraut nach dreiundzwanzig Jahren. Die Anhalter sagen, er soll sie irgendwo absetzen, aber er besteht darauf, sie zu einem Backpacker-Hostel in der Nähe des Town Beach zu bringen, von dem sie gehört haben. Und richtig, da ist es, ein zweigeschossiges, holzverkleidetes Gebäude, in auffälligem Blau gestrichen. SPERMCOVEBACKPACKERS steht auf dem Schild unter einem lächelnden Wal, der zwinkert und eine Flosse wie einen Daumen hochstreckt. Martin parkt und hilft Royce, die Rucksäcke auszuladen. Fast tut es ihm leid, sich von den beiden zu trennen.
Wieder allein im Auto, fährt er nicht gleich los. Er spürt den warmen Wind im Gesicht, und das Gefühl hat sich in all den Jahren nicht geändert, warm, feucht und sanft, ganz anders als die glutheißen Böen im Landesinneren oder die knirschende Secondhand-Luft von Sydney. Unten am Strand liegen Backpacker in der Sonne, sitzen plaudernd zusammen oder spielen Fußball. Er spürt Neid, hat noch nie einfach in den Tag hineingelebt, hat sich noch nie auf indonesischen Inseln in ein hübsches Mädchen verliebt. Er hat kein Brückenjahr gehabt, ist nie durch Asien gestreunt, hat nie den großen Road Trip durch Australien unternommen. Die Jugend war etwas, das überstanden werden musste. Warum sie in die Länge ziehen? Er ist sofort auf die Uni gegangen, und noch bevor er sein Examen hatte, war er schon bei der Zeitung angestellt. Seine Reisen waren anders: Er hat in Kriegsgebieten über dem Laptop geschwitzt, statt auf Bali Joints zu rauchen. Er hat wichtigtuerische Männer in Anzügen interviewt, statt exzentrische Einheimische in einem englischen Pub zu bedienen, und statt sich zu verlieben, hat er mit fremden Frauen geschlafen, die nach Zuneigung gierten. Vielleicht würde es jetzt anders werden, wenn er mit Mandalay und ihrem Sohn Liam hier lebte. Jetzt hat er die Chance, ein neues Leben anzufangen. Nicht die Gelegenheit, sich treiben zu lassen, sondern die große Chance, sein Leben einzuholen und zu akzeptieren, bevor es über den Horizont verschwindet und er endgültig strandet. Er findet, dass die Hitchhiker ihm einen Gefallen getan haben. Er startet den Motor. In Port Silver geht es nicht um die Vergangenheit, sagt er sich. Hier geht es um die Zukunft, es geht darum, eine Zukunft zu haben und sie zu gestalten. Und die Zukunft sieht strahlend und einladend aus. Mandy ist hier und wartet auf ihn, die alleinerziehende Mutter, die er draußen am Rand des Nichts kennengelernt und in die er sich verliebt hat. Das ist auch nicht ohne Romantik und so gut wie Goa oder Lombok. Für einen Moment erfüllt ihn eine Woge von Optimismus und Sehnsucht, und die Welt scheint sich rückwärts zu drehen, bis sie wieder im Gleichgewicht ist. Er kann es nicht erwarten, Mandy zu sehen und sein neues Leben zu beginnen.
Überall ist Blut. Er drückt die Tür auf, und überall ist Blut. Der Schlüssel steckt im Schloss, deshalb kann er, die Begrüßung noch auf den Lippen, die Tür öffnen, und überall ist Blut. Er hat das Townhouse ausfindig gemacht, den Wagen geparkt und die Tür gefunden. Und jetzt ist da Blut. Überall. Spritzer an der Wand im Flur, ein roter Handabdruck, den ein Kind mit einer Schablone hinterlassen haben könnte, rote Tropfen auf den cremefarbenen Fliesen, als habe ein Maler unsauber gearbeitet. Er kann es riechen, der metallische Geruch umhüllt ihn und dringt in seine Poren. Und mitten im Blut eine Gestalt. Leblose Beine ragen durch einen Türbogen in den Flur. Sie stecken in beigefarbenen Chinos und braunen Schuhen mit durchscheinenden Gummisohlen. Es sind Männerschuhe. Die Gestalt liegt auf dem Bauch. Und noch immer fließt das Blut und sammelt sich auf den Fliesen. Überall. Martin bleibt wie angewurzelt stehen. Ihr Name bleibt unausgesprochen. Entsetzen durchflutet ihn, Verwirrung, dann Panik.
»Mandy!«, schreit er. »Mandy?!«
Er lauscht. Nichts. Die Blutpfütze glitzert und wächst weiter. Ist die Gestalt noch am Leben?
»Mandy!«, ruft er noch einmal, und Angst liegt in seiner Stimme. Ist sie im Haus? Ist sie verletzt?
Langsam schiebt er sich vorwärts. Jetzt kann er die Gestalt vollständig erkennen. Die Beine sind in den Flur gestreckt, der Körper, das Gesicht nach unten, liegt im Wohnzimmer. Der Mann hat einen runden roten Fleck zwischen den Schulterblättern, als hätte man ihm eine Zielscheibe auf das Leinenhemd gemalt, mit einer klaffenden Zwölf in der Mitte, aufgerissen und mit Blut gefüllt. Die wachsende Lache auf dem Boden hebt sich grellrot von den cremefarbenen Fliesen ab. Martin muss daran vorbei, vorbei an der Leiche und der glitzernden Sperre. Er nimmt Anlauf und springt über die glänzende Pfütze, die inzwischen die Wand erreicht hat, und landet dahinter am Fuße einer Treppe. Er dreht sich um. Der Mann regt sich nicht. Sein Körper ist gedrungen, er hat dunkles Haar, erste graue Strähnen an den Schläfen und wirkt gepflegt. Der Blutfleck lässt das weiße Leinenhemd an der Wunde in seinem Rücken kleben.
Ein Mörder. Hier ist ein Mörder. Ist er noch hier? »Mandy!« Seine Stimme wird lauter.
Sein Verstand fängt an zu arbeiten, und unter Panik, Adrenalin und Schock kommen die ersten Gedanken hervor. Er hockt sich neben die Blutlache und zwingt sich, ganz ruhig zu atmen. Er schaut hin, er lauscht, nimmt aber kein Lebenszeichen wahr. Er streckt den Arm aus, stützt sich mit einer Hand unter einem zweiten roten Handabdruck am Türrahmen ab. Mit der anderen Hand tastete er am Hals des Mannes nach dem Puls, aber er findet keinen. Die Haut ist warm und gibt nach. Der Mann ist eben erst gestorben. Martin hat Blut an der Hand.
Der Mann hält etwas in der Linken. Die toten Finger umschließen es fest. Eine Postkarte, es sieht aus wie eine Postkarte, und das Blut sammelt sich um die Ränder. Martin beugt sich vor, streckt sich weit über den Toten, stützt sich immer noch mit einer Hand am Türrahmen ab. Die Karte ist verdeckt durch die Hand des Toten und das langsam fließende Blut, aber es scheint ein religiöses Motiv darauf zu sein, die Abbildung Christi oder eines Heiligen mit einem goldenen Heiligenschein.
Da, ein Geräusch. Und dann sieht er sie durch den Türbogen. Sie sitzt reglos und mit blutigen Händen auf einer Couch im Wohnzimmer und starrt den Toten an. Es ist, als könnte sie Martin nicht sehen, der dort kniet, sondern nur die Leiche neben ihm. Ihr Haar sieht anders aus; es ist rötlich braun statt blond, aber nicht das zieht seinen Blick auf sich. Mit blutigen Händen. Eine Spur aus Blutstropfen auf den Fliesen führt von ihr zur Leiche.
»Mandy?« Sie hat auch Blut an der Kleidung. Er klingt eindringlich, aber sie reagiert nicht. »Mandalay!«
Benommen sieht sie ihn an. Kaum merklich schüttelt sie den Kopf. Vielleicht ist es eine Geste der Ungläubigkeit, vielleicht will sie ihm signalisieren, dass er nicht hier sein sollte.
Martin denkt an ihren zehn Monate alten Sohn, und er macht Sorgen. »Mandy, wo ist Liam? Wo ist er?«
Aber sie kann nur den Kopf schütteln, und er weiß nicht, was diese Bewegung bedeutet.
Martin zieht sein Telefon aus der Tasche. Halb rechnet er damit, dass er kein Signal hat, nicht in dieser alternativen Realität. Aber das Signal ist stark. Fünf Balken. Martin wählt dreimal die Null und fordert einen Rettungswagen an. Dann ruft er die Polizei.
Mandy starrt immer noch die Leiche an. Der tote Mann liegt im Türbogen, das Blut ist noch nicht bis ins Wohnzimmer geflossen. Trotzdem rührt Martin sich nicht von der Stelle, geht nicht zu ihr. Stattdessen schaut er wieder auf sein Telefon, sucht die Nummer einer Anwaltskanzlei in Melbourne. Wright, Douglas & Fenning. Mandys Anwältin: Winifred Barbicombe. Sie braucht Winifred jetzt mehr als ihn.
Zwei
Der Police Sergeant hat etwas von einem Raubtier. Seine Augen unter den Lidern sind schmal, seine Lippen dünn und seine Haut ist voller Aknenarben. Sein Teint ist von einem Grau, das nicht in eine Stadt am Strand passt. Er starrt Martin eine volle Minute lang an, bis der den Blick nicht länger erträgt und zu der Polizistin hinübersieht, die neben der Tür des Vernehmungsraumes hinter der Videokamera steht. Sie ist Constable und wirkt so unbehaglich, wie Martin sich fühlt, tritt von einem Fuß auf den anderen und starrt entschlossen auf das Kameradisplay, während das Schweigen sich in die Länge zieht. Erst als der Blickkontakt unterbrochen ist, lässt der Polizist sich herab, zu sprechen. Seine Stimme klingt flach. »Sergeant Johnson Pear befragt Martin Michael Scarsden. Polizeirevier Port Silver. Vierter März, vierzehn Uhr zehn.« Martin wartet, aber der Polizist macht wieder eine Pause, und sein Blick ist unergründlich. Das rote Licht an der Videokamera blinkt alle fünf Sekunden.
»Okay, Mr. Scarsden. In Ihren eigenen Worten. Bitte erzählen Sie uns, wie Sie heute in Mandalay Blondes Townhouse gekommen sind.«
Martin räuspert sich. Ihm ist unbehaglich zumute, als stünde er unter Anklage, und er muss sich daran erinnern, dass er schuldlos ist. »Ich habe in Glen Innes übernachtet. Ich bin gestern auf dem New England Highway von Sydney heraufgefahren und in einem Pub namens Great Central Hotel abgestiegen. Das können Sie überprüfen. Es gibt ein Gästebuch. Heute Morgen bin ich weitergefahren und war gegen elf in Port Silver.«
»Und hier sind Sie direkt zu Mandalay Blondes Townhouse, 15 Riverside Place, gefahren?«
»Nein, nicht sofort.« Martin erzählt, wie er die beiden Hitchhiker, Topaz und Royce, mitgenommen und am Backpacker Hostel abgesetzt hat.
Der Polizist notiert alles. Er hat ein nagelneues Notizbuch, ein großes.
»Nachnamen?«
Martin überlegt. »Royce hat mir seinen gesagt. McAlister, glaube ich. Bei dem Mädchen bin ich nicht sicher.«
»Macht nichts. Die beiden finden wir, und sie können Ihre Angaben bestätigen. Das erleichtert uns die Arbeit.« Wenn er darüber erfreut ist, sieht man es ihm nicht an. »Können Sie sagen, wann genau Sie das Pärchen am Hostel abgesetzt haben?«
Martin schüttelt den Kopf. »Nicht genau. Wie gesagt, es war gegen elf.«
Der Polizist wirkt nicht überzeugt, und Martin windet sich innerlich unter seinem Blick. Das Rotlicht an der Videokamera blinkt regelmäßig wie ein Metronom. Der Himmel weiß, wie er sich fühlen würde, wenn er tatsächlich etwas verbrochen hätte.
»Mr. Scarsden, wir werden Mobilfunkdaten auslesen, denen wir genauere Informationen über Ihre Bewegungen entnehmen können, speziell zwischen Glen Innes und Port Silver. Gibt es irgendeinen Grund, weshalb wir diese Daten lieber nicht bekommen sollten?«
»Nein, nur zu.«
Der Polizist starrt ihn volle zehn Sekunden lang an und schreibt dann wieder etwas in sein Notizbuch. Er lässt sich Zeit dabei. Anscheinend formuliert er seine nächste Frage, da fliegt die Tür auf, und ein atemloser junger Mann stürmt herein. Sein Haar sieht aus wie ungekämmte schwarze Wolle, seine Bartstoppeln sind so dicht, als wären sie miteinander verwoben, und seine Augen sind schwarz. Er trägt Bermudashorts und Sandalen, und sein Brusthaar quillt aus einem nachlässig zugeknöpften Hawaiihemd hervor.
Sergeant Pear reagiert nicht sofort. Er seufzt und dreht sich dann mit seinem Drehstuhl zu ihm um.
»Nick Poulos«, keucht der Mann. »Ich bin Nick Poulos.«
»Ich weiß, wer Sie sind. Was wollen Sie?«
»Ich bin Mr. Scarsdens Anwalt.«
»Ist das wahr?« Der Sergeant wendet sich Martin zu. »Können Sie das bestätigen?«
»Nein. Aber ich hätte gern einen Anwalt.«
Pear bleibt unbeeindruckt. »Befragung unterbrochen um vierzehn Uhr sechzehn.« Seine Kollegin schaltet die Kamera aus. »Okay, Sie beide klären jetzt Ihr Verhältnis. Ich gebe Ihnen fünf Minuten, dann machen wir weiter.«
»Danke, Mate.« Nick grinst breit. Die Kühle des Polizisten scheint ihm nichts auszumachen. Sergeant und Constable gehen hinaus, und Poulos breitet die Arme aus, als wolle er Martin an sich drücken. »Martin Scarsden. Ist das zu glauben? Martin fucking Scarsden. Der berühmteste Journalist des Landes. Mein Klient!«
Martin zwinkert. Der Eifer des jungen Mannes verschlägt ihm für einen Augenblick die Sprache. »Sind Sie wirklich Anwalt?« Er wundert sich über die lässige Kleidung und die Jugend seines Gegenübers. »Haben Sie heute Ihren freien Tag.«
»Ja, ich hatte frei. Na und? Jetzt bin ich hier.«
»Wer hat Sie beauftragt?«
»Die Kanzlei in Melbourne. Wright, Douglas & Fenning. Die haben mich angerufen. Ich soll sofort herkommen. Für ein Spitzenhonorar.« Der Anwalt macht große Augen und hechelt immer noch wie ein kleiner Hund.
Martin begreift: Mandys Anwaltskanzlei hat ihm diesen Anwalt geschickt, zum Dank dafür, dass er sie über Mandys Lage informiert hat. »Warum Sie, Nick? Warum hat man Sie angerufen?«
Poulos lacht, zieht einen Stuhl heran und setzt sich, als hätte Martin ihn bereits engagiert. »Die Auswahl ist nicht groß. Es gibt eine große Kanzlei hier, Drake and Associates, und mich. Oben in Longton sind noch ein paar.«
»Und warum beauftragen die nicht Drake?«
»Haben sie ja. Drake vertritt Mandalay Blonde, zumindest bis ihre eigenen Leute angekommen sind.«
Martin verzieht das Gesicht. Mandys Anwälte mögen ihm helfen, aber sie vertreten ihn separat für den Fall, dass seine und ihre Interessen nicht zusammenpassen. Für den Fall, dass sie ihn den Löwen zum Fraß vorwerfen müssen. Er sieht Poulos an, der nicht zur Ruhe zu kommen scheint. »Nick, Sie sind nicht high, oder?«
»Scheiße, nein. Kein Alkohol, keine Drogen. Ich vertrag so was nicht. Flippe aus davon.«
»Machen Sie viel Strafrecht?«
»Jede Menge. Meist stehe ich vor dem Friedensrichter.«
»Das hier ist aber nicht gerade ein Fall für den Friedensrichter.«
»Was Sie nicht sagen. Mord. Wie gut ist das denn?« Poulos reibt sich die Hände. »Der Oberste Gerichtshof. Scheiße, Mann, das ist ganz großes Kino.«
Martin weiß nicht, was er antworten soll, da kommt Pear zurück.
»Sind Sie klar miteinander?«, fragt er. Zum ersten Mal sieht Martin eine Regung hinter der wortkargen Feindseligkeit des Polizisten: Belustigung.
»Ja«, sagt Martin. »Mr. Poulos ist mein Anwalt. Vorläufig.«
»Freut mich zu hören. Lassen Sie uns weitermachen.«
Sie nehmen ihre früheren Positionen wieder ein – Martin am Tisch, Sergeant Pear gegenüber, die Polizistin hinter der Videokamera –, aber jetzt sitzt Nick Poulos neben Martin. Die Befragung wird fortgesetzt. Pear ist der Inbegriff von Stille im Zentrum von Martins Blickfeld, Nick in unaufhörlicher Bewegung am Rand. Martin braucht nicht lange, um zu berichten, was passiert ist – wie er die Haustür angelehnt vorgefunden hat, den Schlüssel im Schloss, den Toten auf dem Boden, die wachsende Blutlache. Er erzählt, wie er Mandy gesehen hat, die offensichtlich unter Schock stand, und wie er den Notarzt gerufen hat.
»Hat jemand das Haus betreten oder verlassen?«
»Nein. Niemand.«
»Und Sie haben auch nichts gehört? Keinen Kampf, keinen Hilferuf, nichts?«
»Nichts. Das war wohl alles schon vorbei, als ich kam.«
»Aber Ihrem Eindruck nach ist die Tat erst kurz vor Ihrer Ankunft geschehen?«
»Ja. Das Blut breitete sich noch auf dem Boden aus. Und als ich den Puls fühlen wollte, war der Hals des Opfers noch warm und weich. Es gab nur keinen Puls mehr.«
Pear legt wieder eine seiner bedeutungsschwangeren Pausen ein, bevor er weiterspricht. »Und der Tote … haben Sie ihn erkannt?«
»Nein. Er lag mit dem Gesicht nach unten. Wer war es?«
»Ein Immobilienmakler aus der Stadt. Jasper Speight.«
»Jasper?«, ruft Nick Poulos. »Leck mich am Arsch.«
Pears Blick durchbohrt Martin.
»Sie haben ihn gekannt?«, fragt der Polizist.
Martin kann nicht sofort antworten, irgendwas fühlt sich zutiefst falsch an. »Ja. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Wir waren Freunde«, sagt er. »Gute Freunde.«
»Ach ja? Hier? In Port Silver?«
»Ja. Ich bin hier aufgewachsen.« Seine Hände zittern. Er faltet sie, um sie zur Ruhe zu bringen.
Der Sergeant schreibt etwas in sein Notizbuch. Martins Beziehung zu Port Silver ist ihm offenbar neu. »Und wann haben Sie das Opfer zuletzt gesehen, vor heute Morgen?«
»Vor dreiundzwanzig Jahren. Als ich mit der High School fertig war, habe ich sofort die Stadt verlassen.«
»Und Sie sind nie wieder hergekommen?«
»Nein.«
»Nie?«
»Nein.«
»Und Sie hatten zwischendurch auch keinen Kontakt mit Jasper Speight? Briefe, E-Mails, Telefonate?«
»Nein, nicht dass ich wüsste.«
»Und warum sind Sie jetzt hier?«
»Ich komme zurück. Mit meiner Partnerin, Mandalay Blonde. Sie ist vor kurzem hergezogen.«
»Wann?«
»Vor drei Wochen, vielleicht vor einem Monat. Das müsste ich nachsehen.«
»Und warum kommen Sie jetzt erst?«
»Ich war in Sydney, um ein Buch fertig zu schreiben.«
»Im Ernst?«, ruft Nick Poulos. »Über die Morde draußen im Westen? Das muss ich lesen.«
Martin starrt seinen Anwalt ungläubig an und Pear schüttelt den Kopf. »Mr. Poulos, dies ist eine polizeiliche Befragung. Wenn wir fertig sind, können Sie Mr. Scarsden um ein Autogramm bitten.«
»Ja. Sorry, Mate«, sagt Poulos, zappelt aber weiter neben Martin herum.
Pear wendet seine Aufmerksamkeit wieder Martin zu. »Waren Sie heute Morgen zum ersten Mal in Mandalay Blondes Townhouse? Vorher noch nie?«
»So ist es.«
»Und abgesehen vom Eingang, haben Sie keinen Bereich des Hauses betreten?«
»Nein.«
»Und Sie haben die Waffe nicht angerührt?«
»Da war keine Waffe. Ich habe jedenfalls keine gesehen.«
»Was für Verletzungen hatte das Opfer?«
Martin braucht nur die Augen zu schließen, und die Szene ist sofort wieder da: Blut in Technicolor, der Geruch, schwer in der Luft, auf dem Boden der Tote.
»Es sah aus, als habe man ihn von hinten erstochen. Rund um die Wunde war ein Blutfleck. Man sah, wo das Hemd zerschnitten war, und auch den Einstich selbst. Aber da war nicht so viel Blut. Bei all dem Blut auf dem Boden musste er von vorn erstochen oder aufgeschnitten worden sein, aber diese Verletzungen konnte ich nicht sehen, nur die auf seinem Rücken. Er lag ja auf dem Bauch.«
»Haben Sie ihn berührt?«
»Ja. Ich habe am Hals nach dem Puls getastet. Dabei habe ich Blut an die Hand bekommen.«
»An seinem Hals war Blut?«
»Das weiß ich nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, ihn anderswo berührt zu haben, und ich hatte Blut an der Hand.« Pear blinzelt und starrt Martin unverwandt an, als hätten seine Worte große Bedeutung.
»Er hielt etwas in der Hand«, fährt Martin fort. »Es sah aus wie eine Postkarte mit einer religiösen Abbildung.«
»Haben Sie sie angefasst?«
»Nein. Was war das für eine Karte?«
Pear schüttelt den Kopf. »Das kann ich Ihnen nicht sagen.« Wieder macht er eine Pause. »Und Sie sind nicht zu Mandalay Blonde gegangen? Sie haben nicht versucht, ihre Freundin zu trösten?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Martin weiß nicht, was er sagen soll. »Ich glaube, ich hatte einen Schock. Wir brauchten Hilfe. Ich habe den Notarzt und die Polizei gerufen.«
»Mr. Scarsden, haben Sie Jasper Speight umgebracht?«
»Moment mal«, sagt Nick.
»Schon gut«, sagt Martin. »Machen wir es gleich aktenkundig. Ich habe Jasper Speight weder umgebracht noch irgendwie verletzt. Er war tot, als ich ankam.«
»Sehr gut«, sagt Pear, aber nichts in seinem Ton deutet darauf hin, dass er Martins Antwort gut, schlecht oder unwichtig findet. Er stellt noch ein paar Fragen, hauptsächlich über Mandy und ihr Verhalten, dann beendet er die Befragung. Die Polizistin schaltet die Kamera aus, zieht die Speicherkarte heraus und nimmt sie mit, als sie hinausgeht.
Pear bleibt sitzen und wartet, bis sein Constable die Tür geschlossen hat, bevor er spricht – eher nüchtern als bedrohlich. »Dies ist eine Morduntersuchung. Die Mordkommission aus Sydney wird jeden Augenblick eintreffen und den Fall übernehmen. Die wollten, dass Ihre Erinnerungen zu Protokoll genommen werden. Wir müssen Sie in Gewahrsam nehmen, bis sie da sind.« Er sieht Poulos an. »Ihnen ist klar, dass ich das nicht zu bestimmen habe?«
»Mein Mandant kooperiert vollumfänglich. Er hat die Polizei gerufen. Es gibt keinen Grund, ihn in Gewahrsam zu nehmen«, sagt der junge Anwalt. »Er war nicht Zeuge des Mordes.«
Pear sieht Martin an, nicht Nick Poulos. »Ich werde mit der Mordkommission sprechen. Die hat das zu entscheiden. Wir kümmern uns um Ihre Telefondaten, und ich rede mit den Rucksacktouristen und lasse mir Ihr Alibi bestätigen. Die Spurensicherung aus Sydney fliegt ebenfalls ein, aber ein Teil ihrer Ausrüstung kommt auf dem Landweg. Kann sein, dass wir Sie über Nacht festhalten müssen.«
»Das langt nicht«, sagt Poulos beinahe fröhlich. »Wenn Sie ihn nicht unter Anklage stellen wollen, muss er spätestens –« er wirft einen dramatischen Blick auf seine Uhr »– um, sagen wir, halb sieben wieder auf freiem Fuß sein. Okay?«
Der Sergeant mustert den Anwalt. Martin hat den Eindruck, dass in Pears Gesicht eine subtile Veränderung vorgeht. Dringt da Verachtung durch die starre Maske? »Richtig, mein Junge. Wir dürfen ihn nur vier Stunden festhalten. Plus so lange, wie man vernünftigerweise braucht, um die kriminaltechnische Arbeit zu erledigen. Das könnte bis morgen dauern. Wie gesagt, das ist Sache der Mordkommission. Die bald hier sein wird. Sie können dann mit denen diskutieren.«
Pear steht auf, aber bevor er zur Tür geht, wendet er sich noch einmal Martin zu. »Eins will ich Ihnen sagen. Für Ihren Anwalt sind diese Morde in der Riverina anscheinend ein Riesenspaß. Für Sie sicherlich nicht, denke ich. Als Polizist bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie dort einen Mörder vor Gericht gebracht haben. Aber gleichzeitig hat ein Polizist sein Leben verloren, und ein anderer kam ins Gefängnis. Erwarten Sie von mir keine Gefälligkeiten.« Pear wirft erst ihm einen vernichtenden Blick zu, dann Nick Poulos, dann geht er.
»Was ist mit Mandy?«, fragt Martin beinahe zu spät. »Wie geht es ihr?«
»Tut mir leid«, sagt Pear über die Schulter, aber es klingt nicht so. »Das ist nicht meine Sache.«
Die Zelle ist renoviert, frisch und steril. Graffiti und Elend hat man weggeschrubbt, und es riecht nach Desinfektionsmittel, nicht nach Pisse. Eine solide Stahltür mit einer kleinen Luke in Augenhöhe gibt ihm ein Gefühl der Privatsphäre, obwohl eine Videokamera, die aus der Ecke auf ihn herabstarrt, klarmacht, dass dies nicht stimmt. Martin erinnert sich an die alten Zellen, die nach Scheiße und Kotze stanken, mariniert in Überresten schiefgegangener Menschenleben. Damals gab es keine Kameras, aber auch keine vorgetäuschte Privatsphäre: Die Wand zum Korridor bestand aus Stahlgittern. Er war als Minderjähriger ein paar Mal verhaftet worden, wegen Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses, zu seinem eigenen Besten eingesperrt vom alten Sergeant Mackie, dem Herrn über Willkürjustiz. Ohne richterlichen Beschluss, ohne Haftprüfungstermin – nur Martin und Jasper und manchmal noch Scotty, festgenommen, weil es Mackie gefiel, und entlassen mit einer Ohrfeige und einem Tritt in den Arsch.
Was hatten sie damals angestellt? An dem Abend mit Scotty? Zu viel Grog getrunken, keine Frage. Billigwein im Vier-Liter-Container und geklauten Rum. Und Dope? Wahrscheinlich. Jasper hat gern gekifft. Langsam fällt Martin alles wieder ein.
Sie sitzen auf dem Parkhausdeck des Supermarkts, versteckt hinter der Brüstung, und sie trinken und quatschen und lachen. Es ist Nacht. Sie sind sechzehn, haben den Körper von Männern und den Verstand von Kindern. Betrunkenen Kindern. Die Einkaufswagen stehen da und warten darauf, sie in Versuchung zu führen. Jasper ist der Erste; er klettert in einen der Wagen und will geschoben werden.
In seiner Zelle schließt Martin die Augen und hört wieder das Klappern des Einkaufswagens auf dem Asphalt. Er rattert wie ein Zug, und Martin spürt die Vibrationen in den Händen.
Sie schieben sich abwechselnd. Um Haaresbreite verfehlen sie die Lichtmasten, bevor sie gegen den Randstein krachen. Martin wird durch die Luft geschleudert, schlägt sich das Knie auf und den Ellenbogen blutig; hemmungsloses Gelächter ist die Folge. Alle drei rollen lachend über den Boden und halten sich den Bauch, sie haben Tränen in den Augen und sind Gefangene des Augenblicks. Nichts tut weh, nicht sein Knie, nicht sein blutiger Ellenbogen. Wie betrunken ist er?
Jetzt will Jasper ein Rennen fahren. Er fordert sie heraus, aber es geht nicht, denn sie sind nur zu dritt. Dann die unvermeidliche Idee. Es kommt nicht darauf an, wer sie hat, sie ist sofort akzeptiert: ein Rennen die Rampe hinunter. Sie stellen also die Einkaufswagen nebeneinander, klettern in die Körbe, zählen drei-zwei-eins und stoßen sich ab. Sie beschleunigen blitzartig, kreischend vor Begeisterung, rasen die Rampe hinunter, und alle drei kippen um, aber nur Scotty schreit noch, er hat einen Arm gebrochen und einen Zahn verloren. Jasper und Martin rasen mit dem Kopf voran in ein geparktes Auto – das Auto des Bürgermeisters –, und der Aufprall schleudert sie aus ihren Einkaufswagen. Sie haben Glück, sind nicht ernsthaft verletzt.
Martin lächelt bei der Erinnerung. Waren sie wirklich so tollkühn? So wild? Seit Jahren hat er nicht mehr daran gedacht, aber er hat auch seit Jahren nichts mit Port Silver zu tun gehabt. Absichtlich nicht. Und jetzt ist Jasper tot. Fünfundzwanzig Jahre seit dem Supermarkt – und tot bei Martins Ankunft. Jasper mit dem dichten dunklen Haar und den funkelnden blauen Augen, der immer gern lacht, immer einen Witz auf den Lippen hat und auf sein Glück vertraut. Der mit einem kitschigen Spruch die Mädchen anbaggert, nur zum Spaß, und ganz überrascht ist, wenn sie zurückflirten. Jasper. Erstochen, verblutet, vom Glück verlassen.
Scotty landet im Krankenhaus, Jasper und Martin im Knast. Dann verschwindet Jasper. Seine Mutter stürmt herein und holt ihn ab, und er kassiert einen Monat Hausarrest. Jasper zwinkert Martin zu, als er geht, und grinst verschwörerisch – unverletzt und immer noch betrunken. Jetzt ist Martin allein, und der Schmerz erwacht zuerst in seinem Ellenbogen und dann in seinem Knie, bevor er bis in den Kopf vordringt und dort die Herrschaft des Leidens ausruft. Martin versucht, sich hinzulegen, aber ihm wird schwindelig. Er richtet sich wieder auf und kämpft mit dem Brechreiz. Niemand kommt ihn holen, und sei es, um ihm Hausarrest zu verpassen; nur Mackie versucht, ihn zu disziplinieren. Aber Martin hat keine Angst, lässt sich nicht einschüchtern. Es ist nicht das erste Mal. Irgendwann wird er nachts daheim sein, während sein Vater hier in der Zelle einen gewaltigen Rausch ausschläft. Dann sind die Rollen vertauscht.
Martin öffnet die Augen und durchforscht sein Gedächtnis: Wann hat er beschlossen, nicht mehr zu trinken, nicht zu werden wie sein Vater? In einer Nacht in der Zelle, betrunken und elend, oder eines Morgens, als er mit schwerem Kopf, trockenem Mund und rebellierendem Magen aufwachte? Als Old Mackie mit dem Frühstück kam, Eier mit Speck, schwimmend in Fett, bevor er ihn rauswarf und nie wieder sehen wollte? Vielleicht ist die Botschaft irgendwann durchgedrungen? Nein. Martin weiß, wann es war. In der Nacht draußen in der Siedlung, in der Nacht, als sein Vater starb. Er steht auf, geht auf und ab und räumt die Erinnerungen weg, verstaut sie wieder da, wo sie hingehören. Bald wird man ihn freilassen, die Erinnerungen können hier bleiben.
Martin hört Geräusche vor der Zellentür. Er steht auf und späht durch die Luke. Ihr geschwungener Hals und ein kurzer Blick auf ihr Haar, das nicht mehr blond ist.
»Mandy!«, ruft er.
Sie hält inne, schaut sich um, versucht, seine Stimme zu orten. Sie hat ihren schlafenden Sohn Liam auf dem Arm, bringt ein mattes Lächeln zustande, wirkt bedrückt. Ein zaghaftes Winken, und ihre Augen richten sich auf die falsche Tür. Dann ist sie weg, abgeführt von der Polizistin, die die Videokamera bedient hat.
Martin setzt sich auf die Pritsche. Eine dünne Matratze, weiter nichts. Kein Kissen, keine Decke. Sie hat gelächelt, da ist er sicher. Und Liam ist gesund. Gefühle branden auf: Erleichterung, Sehnsucht, der Drang, sie und ihren Jungen zu beschützen. Er spürt, wie die Woge über ihn hinwegrollt, und ist sich seines emotionalen Gleichgewichts nicht sicher. Mit seinen einundvierzig Jahren muss er sich immer noch daran gewöhnen, an diese emotionalen Wellen, diese Tiefenströmung der Zuneigung. Früher, vor nicht allzu langer Zeit, hatte er das Ruder in der Hand und war auf ruhiger See unterwegs, ohne etwas von den Strömungen zu ahnen, die in der Tiefe pulsierten. Jetzt ist er näher am Ufer, und die Wellen können ihn unvermittelt mitreißen. Er starrt die frisch gestrichene Wand an. Atmet tief durch und lässt die Gefühle verebben.
Die Polizei wird ihn bald freilassen, aber sie werden sich mit Mandy befassen. Er sieht sie wieder auf der Couch sitzen, schockstarr und mit blutigen Händen. Was wird die Polizei sagen? Sie wird fragen, ob sie Speight aufgeschlitzt und dann mit einem gewaltigen Stich ins Herz umgebracht hat. Martin weiß, dass es so nicht gewesen sein kann. In der Riverina hatte sie einem Mörder ein Messer an die Kehle gehalten, einem Mann, der ihr wehrloses Kind umbringen wollte. Damals hat sie nicht getötet, nicht einmal bei dieser extremen Provokation, und er kann nicht glauben, dass sie jetzt töten würde, nicht einmal in Notwehr. Den letzten Stich, den tödlichen Messerstich in den Rücken, hätte sie nicht über sich gebracht. Nicht, wenn das Opfer schon so schwer verletzt ist. Nicht, wenn es ihr den Rücken zukehrt.
Aber wenn Mandy ihn nicht ermordet hat, wer dann? Martin begreift, dass sie es nicht weiß. Wenn sie Zeugin des Mordes wäre und den Mörder gesehen hätte, dann hätte sie es der Polizei inzwischen gesagt, und Martin wäre nicht mehr in der Zelle. Sie muss also nach der Tat gekommen sein, kurz vor Martin. Vielleicht hat sie etwas gehört und ist die Treppe heruntergekommen, hat Jasper tot aufgefunden, unmittelbar vor Martins Ankunft.
Trotzdem ist er nicht zu ihr gegangen, er hat sie da sitzen lassen, hilflos und verloren, und ist im Flur geblieben, um auf die Polizei zu warten. Sie hat ihn gebraucht. Was hat ihn gelähmt? Und noch ein Bild erscheint vor seinem inneren Auge. Jasper Speight in seinem Blut. Nicht mehr eine Leiche, sondern Jasper. Martin zittert unwillkürlich und kämpft gegen einen Brechreiz. Er ist nicht mehr der leidenschaftslose Auslandskorrespondent.
Sergeant Mackie und die alte Polizeistation mögen nicht mehr existieren, aber das Frühstück ist immer noch unverändert. Die gleichen Eier, der gleiche fettige Speck, die gleiche Schmalzpfütze. Diesmal lehnt Martin es ab; er hat keinen Kater, und er ist nicht pleite. Der Constable, ein junger Kerl, der seinen Babyspeck noch nicht völlig losgeworden ist, nimmt das anscheinend persönlich. »Das ist ein gutes Frühstück, Mate. Viele Leute wären dankbar.«
»Dann essen Sie es. Es gehört Ihnen.«
»Das mach ich auch«, sagt der Constable trotzig und nimmt den Teller wieder mit. Der Babyspeck wird sich noch eine Weile halten.
»Hallo, Martin? Keinen Hunger?« Das ist Detective Inspector Morris Montifore, der den Constable in der Tür zur Seite schiebt. Es ist erst sechs Wochen her, dass Martin ihm geholfen hat, eine Reihe brutaler Morde im ausgetrockneten Landesinneren aufzuklären, mehr als tausend Kilometer von Port Silver entfernt. Und schon gibt er eine ganz unerwartete Zugabe. Er kann nicht viel älter als Martin sein, sieht aber erschöpft aus. Die Falten auf seiner Stirn gehen nicht mehr weg, als habe der Mann schon zu viel gesehen. Vielleicht hat er das ja.
»Morris. Was machen Sie denn hier?«
»Das dachte ich auch gerade.« Der Blick des Detective ist hellwach. Hellwach und amüsiert.
»Ich habe einen Anwalt, wissen Sie«, sagt Martin. »Ich will, dass er dabei ist, wenn Sie mich befragen.«
Montifore lächelt. »Nicht nötig. Sie können gehen. Tut mir leid, dass man Sie über Nacht hierbehalten musste, aber wir hatten eine Liste abzuarbeiten. Dies ist nur ein Höflichkeitsbesuch.«
»Sie haben den Mörder?«
»Noch nicht.«
»Aber Ihre Spurensicherung hat mich entlastet?«
Montifore schüttelt den Kopf. »Dies ist eine Polizeiangelegenheit. Eine Ermittlung in einem Mordfall. Ich wünsche nicht, dass Sie unsere Kreise stören, verstanden? Das ist der höfliche Teil meines Besuchs: Mischen Sie sich nicht ein, überlassen Sie die Sache uns. Okay?«
»Was ist mit Mandy? Kann sie auch gehen?«
»Sie ist schon draußen. Seit gestern Abend. Hat bessere Anwälte, nehme ich an.«
Martin geht nicht darauf ein. »Und ihr Junge? Ist mit dem alles in Ordnung?«
Montifore wird ernst. »Ja. Kommen Sie, ich bringe Sie raus. Ich werde mich noch mal mit Ihnen unterhalten müssen. Und mit ihr auch.«
Dienstag
Drei
Noch bevor er sich die Schuhe zubindet, den Gürtel wieder einfädelt und das grell beleuchtete Foyer der Polizeistation verlässt, ruft er Mandy an. Sie meldet sich beim dritten Klingeln.
»Martin«, ruft sie. Er hört Verkehrsgeräusche. Sie hat den Lautsprecher eingeschaltet. »Bist du draußen?«
»Ja«, sagt er laut. »Wo steckst du?«
»Unterwegs nach Longton. Ich hole Winifred vom Flughafen ab.«
Vom Flughafen? Ihm war nicht klar, dass es hier so was gibt. Mandys Anwältin kommt wohl mit einem Charterflugzeug aus Melbourne. »Gut. Ist alles okay mit dir?«
Die Pause ist so lang, dass er schon glaubt, die Verbindung sei unterbrochen. »Bist du da, wenn ich zurückkomme?«, fragt sie schließlich.
»Natürlich.«
»Gut. Bis dann.« Sie legt auf.
Er starrt auf sein Telefon. Das abrupte Ende des Gesprächs ist beunruhigend. Offensichtlich hat sie sich von dem Schock über Jaspers blutiges Ende noch nicht erholt. Winifred ist unterwegs, Montifore will sie befragen, Mandy steht nach wie vor unter Mordverdacht. Kein Wunder, dass sie kurz angebunden ist. Die Sache ist noch nicht vorbei.
Er betritt eine Stadt, die sich wandelt, weniger wie ein Teenager, der erwachsen wird, als vielmehr wie eine Frau mittleren Alters nach kosmetischen Operationen – hier ein bisschen gestrafft, da ein bisschen gelockert, das Gesicht geliftet, die Falten mit Botox unterspritzt, fleckige Haut geschält, gepimpt für Touristen und Rentner, für Hipster und Telearbeiter. Er sieht es am Sicherheitsversprechen des neuen, zweigeschossigen Polizeireviers aus Beton und Klinker, geschützt von polierten Stahlpollern, gekrönt von Satellitenschüsseln und mit einer Tiefgarage mitsamt Stahltor. Er sieht es am Straßenbild mit Blumenkästen, Temposchwellen und Fußgängerüberwegen, an den der Jahreszeit entsprechenden Transparenten an den Lichtmasten. Er sieht es an der Hauptstraße, The Boulevarde. Die Straße ist schmaler geworden; man hat Platz für breitere Bürgersteige geschaffen, für Bürgersteige, die mit Fischgrätziegeln gepflastert sind, groß genug für Straßencafés mit Menütafeln und Sonnenschirme mit den Namen italienischer Kaffeemarken. Als er das letzte Mal hier war, waren die Gehwege schmale Teerstreifen, gesprenkelt mit Kaugummi, Zigarettenstummeln und Hundescheiße.
Er blickt über die Straße, ein Zeitreisender, der gerade aus seiner Tardis gekommen ist. Der alte Fish-and-Chips-Shop, Theo’s, ist noch da mit seinen verblassten Coke-Tafeln und einer handgemalten Erklärung, dass Fisch Health Food ist. Hier haben er, Jasper und Scotty Caramel-Milkshakes aus Dosen getrunken und Kartoffelchips aus Wachspapier-Tüten gegessen. Der Secondhandladen nebenan ist weg, ersetzt durch eine Boutique für Bademoden und einen chinesischen Massagesalon. Früher haben leere Grundstücke den Boulevarde gesäumt wie Zahnlücken und den Zugang zum Strand auf der einen Seite und zu Wohnhäusern und Ferienwohnungen auf der anderen eröffnet. Aber jetzt wird The Boulevarde zahntechnisch korrekter, die Brachgrundstücke werden weniger und seltener, der Kommerz breitet sich aus, und der Strand ist kaum zu sehen und schwer zu erreichen.
Ein schwarzer Range Rover mit personalisiertem Nummernschild gleitet vorbei und hält lange genug, um eine magere Frau aussteigen zu lassen. Sie trägt einen Sarong und aufgesprühte Sonnenbräune, und ihre übergroße Sonnenbrille blitzt golden. Auf Korkabsätzen kommt sie näher und schließt die Boutique auf.
Martin überquert die Straße. Ein alter Mann schlendert vorbei, unbelastet von Verantwortung und beruflichen Pflichten. Er trägt gebügelte Shorts, ein faltenloses Polohemd und Segelschuhe. Sein Panamahut ist fleckenlos. Er ignoriert einen Altersgenossen, der unrasiert und mit trüben Augen auf einem Stück Pappe hockt und leidenschaftlich mit sich selbst redet. Neben ihm steht eine Flasche in einer braunen Papiertüte, ein kleiner Hund schläft auf seiner anderen Seite, und in einem umgestülpten Hut vor ihm liegt eine Schicht Münzen, dünner als seine Pappe. Ein Trupp Radfahrer in Lycra-Trikots rollt an und hält vor einer Bäckerei. Sie stellen ihre Karbonfaser-Räder in die Fahrradständer der Gemeinde und setzen sich lachend und schwatzend an einen Tisch neben eine Gruppe Straßenarbeiter in Signalwesten, die stumm ihre Eier-und-Speck-Brötchen herunterschlingen, bevor sie wieder an die Arbeit gehen. Ein Hippie mit glasigem Blick und Dreadlocks schlurft vorbei. Seine Kleidung ist schmutzig, und er kann kaum die Füße heben.
Einen Moment lang sieht Martin die beiden Städte in einer Überblendung: die derbe Arbeitergemeinde seiner Jugend und das gentrifizierte Pensionärsdorf, das daraus geworden ist. Eine gute Fee ist in seiner Abwesenheit gekommen und hat alles mit dem silbernen Feenstaub von Familientrusts, selbstverwalteten Anlagefonds und negativer Verschuldung überstäubt, aber nicht gleichmäßig. Der Teil der Stadt, der zu kämpfen hat, ist nicht restlos verschwunden, aber er ist auf dem Rückzug, landeinwärts vertrieben, weg vom Meer, weg vom Boulevarde, auf die Westseite der Straße nach Longton, wo der Wind selten weht und der Knast nie weit entfernt ist. Martin weiß genau, wo dieser Teil der Stadt immer noch existiert: Er lauert in der Siedlung, hockt in den mit Faserplatten verkleideten Wohnblocks seiner Jugend und lungert auf den kleinen Farmen herum. Martins Blick wandert den Boulevarde entlang, und er fragt sich, ob der Wohlstand, der schon so lange durch die australischen Großstädte geströmt ist, auch bei den Kämpfern von Port Silver Reichtum hinterlassen hat.
Er will im Che Bay Café an der Theke einen Kaffee trinken, erfährt aber, dass nur am Tisch bedient wird, und soll Platz nehmen. Erst dann erscheint die anmutige junge Kellnerin. Sie trägt eine Schürze, die für die Revolution wirbt, und zückt keinen Bestellblock, sondern ein Smartphone. Sie wirkt enttäuscht, als er sich keinen Vortrag über die Vorzüge der Fair-Trade-Sorten anhören will. Er bestellt einen schlichten Kaffee mit Milch und dazu einen Sauerteig-Rosinentoast.
Dann versucht er noch einmal, Mandy anzurufen, landet aber auf der Mailbox. Entweder hat sie kein Netz oder sie telefoniert. Er sucht im Internet nach der Nummer von Nick Poulos. Das Telefon unterbricht ihn dabei und fragt, ob er das Gratis-WiFi von Port Silver nutzen möchte. Die Stadt hat ein Gratis-WiFi! Natürlich hat sie eins. Er akzeptiert die Nutzungsbedingungen, ohne sie zu lesen, aber die Verbindung hat das Zeitlimit bereits erreicht. Also benutzt er seine 4G-Verbindung, um die Nummer des Anwalts zu suchen.
»Nick? Martin Scarsden. Wo sind Sie?«
»Ich mache die Kinder für die Schule fertig. Sind Sie draußen?«
»Ja. Können wir uns treffen?«
»Selbstverständlich. Oberste Priorität. Sagen wir, um elf am Surf Club?«
Martin sieht auf die Uhr. Es ist noch nicht mal neun. »Geht es nicht früher?«
»Halb elf?«
»Okay. Lassen Sie sich nicht stören.« Er legt auf. Je schneller er diesen Stützrädchen-Anwalt loswird, desto besser.
Sein Kaffee kommt, und er fängt an, die Nachrichtenseiten auf seinem Handy durchzusehen, findet aber kein Wort über einen Mord in Port Silver – nicht auf Fairfax, News, Abc oder einer anderen Mainstream-Website. Offenbar hält die Polizei die Sache noch unter Verschluss. Hat man ihn deshalb über Nacht festgehalten? Um die Nachricht noch länger zu blockieren? Aber vielleicht ist, so weit von den großen Städten entfernt, eine Erwähnung nicht lohnend. Ein toter Einwohner in einer Kleinstadt am Meer – was ist das im Vergleich zur Prominenz von Sydney, zu den Immobilienpreisen in Melbourne oder der neuesten Doku-Soap? Er erinnert sich an eine Lokalzeitung mit Sitz in Longton, dem regionalen Zentrum am Highway oberhalb des Escarpment, die über den gesamten Distrikt berichtet hat. Er findet eine Website namens Longton Observer, die seit Tagen nicht aktualisiert wurde, und dann findet er auch den Grund dafür: Die einzige Tageszeitung der Region erscheint inzwischen nur noch zweimal wöchentlich, nämlich mittwochs und samstags. Heute ist Dienstag. Vielleicht arbeitet der Redakteur gerade an einem Knaller über den Mord an Jasper Speight für die morgige Titelseite. Vielleicht.
Martin checkt seine E-Mails, findet nur Spam mit Werbung für Wein, Frequent-Flyer-Punkte und Hotels. Er trinkt seinen Kaffee aus, zahlt und geht weiter den Boulevarde hinunter. Zwei Schulmädchen hüpfen aus einem Sushi-Shop und stoßen fast mit ihm zusammen. Kichernd hüpfen sie weiter. Sie tragen Strohhüte und grün-weiß karierte Baumwollkleider, und auf ihren grünen Rucksäcken prangt das Motto der Longton Grammar School: Dienst und Erfolg. Sie klettern auf den Rücksitz eines wartenden SUV. Eine Privatschule in Longton! Die Welt verändert sich, ohne Frage. Er sieht zu, wie der Wagen, ein glänzender Hyundai, sich in den Verkehr fädelt. Erst als er den Blick von der Straße abwendet, sieht er sie: Denise Speight, die nur zehn Meter entfernt gerade ihr Immobilienbüro aufschließt. Jaspers Mutter.
Unsicher macht er ein paar Schritte auf sie zu. »Mrs. Speight?«, fragt er, förmlich wie zu Kinderzeiten.
Sie dreht sich um und sieht ihn. Ihre Augen sind rot. Anscheinend hat sie wenig geschlafen. »Martin? Bist du das? Martin Scarsden?«
Er nickt. »Ja. Ich bin’s.«
Sie schlägt die Hand vor den Mund, und ein Zittern geht durch sie hindurch. »Guter Gott. Martin.«
Er weiß nicht, was er sagen soll. Sie umklammert seine Hand. »Er ist tot, Martin. Weißt du? Jasper ist tot.«
»Ja, ich weiß.«
»Ich musste nach Longton fahren. Ins Krankenhaus. Um ihn zu identifizieren.« Sie zittert wieder, und Tränen steigen ihr in die Augen. »Er war es.«
Ein älteres Paar geht vorbei und schaut besorgt. »Lassen Sie uns reingehen«, sagt Martin. »Da können wir besser reden.«
»Ja«, sagt Denise Speight. »Ja. Gut.« Sie lässt seine Hand los und öffnet die Tür. Drinnen schaltet sie das Licht ein, es summt und klickt, und die Leuchtstoffröhren erwachen flackernd zum Leben. Mehrere Plakate mit der Aufschrift ZUVERKAUFEN bedecken die Schaufensterscheibe; sie filtern das Licht, das von der Straße hereinfällt, und bieten ein gewisses Maß an Privatsphäre. Vor zwei verglasten Büros steht ein leerer Empfangstresen. Auch an den Wänden hängen Flyer, auf denen ZUVERKAUFEN und ZUVERMIETEN steht.
»Mrs. Speight, entschuldigen Sie, aber was tun Sie hier? Heute? Im Büro?«
»Was soll ich sonst machen? Zu Hause bleiben ertrage ich nicht. Ich konnte nicht schlafen.«
Martin hat sie als grimmige, scharfzüngige Frau in Erinnerung, die Scotty und ihn nicht mochte. Jetzt wirkt sie verloren, klein und verletzlich. Sie trägt ihre Bürokleidung: dunkle Hose, flache Schuhe, weiße Bluse. Das graue Haar ist kurz geschnitten. An jedem anderen Tag würde sie Professionalität ausstrahlen, aber nicht heute. Heute kann ihre Kleidung sie nicht stützen. Sie sieht aus wie ein zusammengesunkener Sack.
»Gibt es jemanden, bei dem Sie bleiben können?«, fragt Martin. »Verwandte? Freunde?«
Sie schüttelt den Kopf.
Er gibt nicht auf. »Sie sollten sich ein paar Tage freinehmen. Um das Geschäft kann sich jemand anders kümmern.«
»Nein, da gab es nur Jasper und mich. Er sollte zum Jahresende ganz übernehmen.« Sie sieht sich im Büro um. Es ist still und leer, und sie unterdrückt ein Schluchzen. »Das war alles für Jasper.« Wieder dieses Zittern. Sie ringt um Fassung. Der Raum ist erfüllt von ihrem Sohn, der vor so kurzer Zeit gegangen ist.
»Kommen Sie«, sagt Martin sanft, »lassen Sie uns woanders hingehen, einen Kaffee trinken. Miteinander sprechen.«
»Nein, die Polizei wird gleich hier sein. Sie will Jaspers Büro durchsuchen. Das ist seins, das da drüben.«
Die Tür zum Büro ihres Sohnes ist geschlossen. Martin möchte zu gern einen Blick hineinwerfen, aber das geht nicht, ohne dass er seine Fingerabdrücke auf dem Türknauf hinterlässt. Er geht zu der Glastür und späht hindurch. Er sieht einen Schreibtisch, auf dem Papiere verstreut sind. Ein Füller liegt da neben seiner Kappe, bereit, den nächsten Satz zu schreiben. Eine Kaffeetasse, halb leer, mit einer Milchhaut. Eine Jacke am Garderobenständer. Zwei leere Stühle vor dem Schreibtisch.
»Als ob er jeden Augenblick zurückkäme, nicht wahr?« Denise steht hinter ihm.
»Ja, stimmt«, flüstert er.
»Kommen Sie in mein Büro. Dort können wir reden.«
Ihre Stimme klingt ein bisschen gleichmäßiger, als habe sie ein inneres Hindernis überwunden.
In ihrem Büro setzt sie sich auf ihren Schreibtischstuhl, und Martin nimmt gegenüber auf einem der Stühle für Kunden Platz, als wolle er ein Haus mieten, statt um ihren geliebten Sohn trauern. Hinter ihr stehen gerahmte Fotos. Ihr Sohn. Kinder. Das verblasste Bild eines schwarzhaarigen Mannes.
Denise sieht Martin mit roten Augen an. »Die Polizei sagt, du hast ihn gefunden.«
Martin nickt unsicher. Draußen hat sie ihn gefragt, ob er wisse, dass Jasper tot sei, und jetzt weiß sie, dass er ihn gefunden hat. Ein Beweis, wie durcheinander sie ist. »Ja, das stimmt. Ich habe ihn gefunden.«
»Was ist denn passiert, Martin? Wer hat ihn umgebracht?«
»Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Polizei weiß es auch nicht. Noch nicht. Ich habe nur eine einzige Verletzung gesehen, auf dem Rücken. Die dürfte sein Herz getroffen haben. Jasper hat wahrscheinlich gar nicht gemerkt, was da passiert ist. Er muss sofort tot gewesen sein. Praktisch sofort.«
Denise sieht ihn beschwörend an. »Er hat nicht gelitten?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Das ist lieb von dir, Martin. Lieb, dass du das sagst. Aber ich weiß, es stimmt nicht. Die Polizei sagt, er wurde zuerst in Bauch und Brust gestochen und hat versucht, zu fliehen. Seine Hände waren zerschnitten. Die Polizei glaubt, er hat seinen Mörder vielleicht gekannt.« Denise starrt in eine scheinbare Ferne und spricht mit sich selbst ebenso wie mit Martin, bevor sie sich wieder auf ihn konzentriert. »Sie haben gesagt, sie befragen deine Freundin. Vernehmen sie. Mandalay Blonde. Von da unten, aus der Kleinstadt, wo es so viel Tod und Chaos gegeben hat.«
»Man hat sie freigelassen«, sagt Martin ruhig. »Es gibt keinen Hinweis, dass sie etwas damit zu tun hatte.«
»Aber sie war da?«
»Ich glaube ja. Sie war im Haus. Aber ich weiß nicht, ob sie die Tat mitbekommen hat.«
»Sie hat also nichts gehört? Nichts gesehen?«
»Ich weiß es nicht«, sagt Martin. »Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen.«
»Dich hätte man auch befragt, hieß es.«
»Ja, das stimmt. Ich tue, was ich kann, um zu helfen.«
Das scheint sie zufriedenzustellen. Sie lässt sich zurücksinken, ihr Interesse verschwindet, und die Trauer kehrt zurück.
»Darf ich Sie etwas fragen, Mrs. Speight?«
Sie lächelt und tut amüsiert. »Nenn mich Denise, Martin. Du bist ja kein Schuljunge mehr.«
»Danke, Denise. War Jasper religiös?«
»Nicht, dass ich wüsste. Warum fragst du?«
»Es war nicht gut zu erkennen, aber als ich ihn fand, hielt er eine Postkarte oder ein Foto in der Hand. Es sah aus wie ein religiöses Bild, Christus oder ein Heiliger.«
Denise lächelt matt, als sei eine schöne Erinnerung erwacht. »Eine seiner Postkarten. Er hatte Tausende. Hat sie gesammelt. Das war sein Hobby.«
»Religiöse Postkarten?«
»Nein. Alles Mögliche. Hauptsächlich Ansichtskarten. Das habt ihr angefangen.«
»Wie bitte?«
»Ihr habt ihm eine Ansichtskarte geschickt, als ihr in Sydney angekommen ward. Du und Scott. Erinnerst du dich?«
Martin blinzelt. Er kann sich nicht erinnern, Jasper jemals geschrieben zu haben.
»Er wollte immer reisen. Er hat deine Berichte aus der ganzen Welt verfolgt, und er hat Postkarten gesammelt. Aber letzten Endes hat er eigentlich nicht viel von der Welt gesehen, und in Übersee war er auch nie. Anders als du.«
Martin weiß nicht, ob er in der Stimme der Mutter wirklich Bitterkeit hört. Er fragt nicht nach. »Wissen Sie, warum Jasper bei Mandy in ihrem Townhouse war?«
Denise lächelt wieder. Es ist ein widersprüchlicher Gesichtsausdruck: Die Mundwinkel sind aufwärts gebogen, die Augen traurig. »Nein. Wir vermieten ihr das Haus jetzt seit fast einem Monat, aber ich wüsste nicht, weshalb er sie dort besuchen sollte. Obwohl er immer ein Auge für hübsche Mädchen hatte.« Sie zuckt die Achseln. »Ich glaube, er wollte zu dir.«
»Zu mir? Warum?«
»Ich sage doch, Martin, du hast keine Ahnung, wie stolz er auf dich war. Er hat mir immer deine Artikel gezeigt. Die Auslandsberichte und in letzter Zeit die Titelgeschichten aus dem Westen. Und jedem, der es wissen wollte, hat er erzählt, was für dicke Freunde ihr beide wart.«
Martin empfindet plötzlich Schuld und Reue. Jetzt ist er es, dem Gefühle die Kehle zuschnüren. »Ich wünschte, ich hätte ihn wiedergetroffen. Ich hatte mich darauf gefreut.«
»Er hat gehört, dass du wieder hierher ziehst. Und er hat gedacht, du könntest ihm helfen. Als Journalist.«
»Wie meinen Sie das?«
Sie beugt sich vor. Die Wachheit in ihrem Blick flackert wieder auf, die Trauer weicht für einen Moment zurück. »Die Stadt hat sich verändert, Martin. Jedes Jahr, jeden Monat wird ein neues Haus gebaut. Das Geld kommt aus Sydney und Melbourne, und Immobilienentwickler kommen von Brisbane und der Gold Coast, und alle treffen sich hier. Unten auf dem Boulevarde kannst du jeden fragen: Wir sind das neue Byron Bay, das neue Noosa. Und ein paar wollen, dass wir die neue Gold Coast werden. Als wäre das etwas Gutes.«
»Das klingt, als wäre es eine gute Gegend für Immobilienmakler.« Martin bereut sofort seine Worte. »Entschuldigung. Ich wollte nichts unterstellen.«
»Schon gut. Du hast ja recht. Es geht uns sehr gut. Jaspers Kindern wird es an nichts fehlen.«
»Kinder? Er war verheiratet?« Martins Blick wandert zu den gerahmten Fotos. Jaspers Kinder.
»War ist das entscheidende Wort. Seit sieben oder acht Jahren geschieden. Seine Schuld – er konnte die Hände nicht bei sich behalten.«
»Wo ist seine Ex? Und die Kinder?«
»Susan? In Neuseeland. Ich habe sie gestern Abend angerufen. Vielleicht kommt sie zur Beerdigung. Vielleicht auch nicht. Wie ich sie kenne, interessiert sie eher, ob es sich auf ihren Unterhalt auswirkt.« Dieser Satz klingt bitter, und Denise schließt die Augen, als rufe sie sich zur Ordnung. »Ich kann nicht sagen, dass ich ihr das vorwerfe. Kinder sind teuer.«
Martin überlegt, bevor er weiterspricht. »Ich komme nicht mehr mit. Sie haben gesagt, die Stadt erlebt einen Boom. Sie verdienen gut. Aber was hat das mit Jasper zu tun und weshalb wollte er mich sehen?«
Denise runzelt die Stirn, als habe sie ebenfalls den Faden verloren – oder als sei das, was sie sagen will, schmerzhaft für sie. »Wir sind Immobilienmakler, keine Projektentwickler. Das große Geld machen die Projektentwickler. Natürlich profitieren wir davon, aber das heißt nicht, dass uns alles gefällt, was Entwickler tun. Jasper war sehr ehrgeizig, sehr geldgierig, aber nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, bekam er Depressionen und fing an, sich zu hinterfragen. Medikamente, Selbsthilfegruppen, spirituelle Einkehr und so. Er hat es ganz gut überstanden, und der alte Funke war wieder da, aber Jasper war nicht mehr so draufgängerisch wie früher. Als Grünen würde ich ihn nicht bezeichnen – das nicht –, aber er hat sich der Kampagne gegen die Erschließung oben bei der Crystal Lagoon angeschlossen.«
»Crystal Lagoon? Nie gehört. Wo ist das?«
»Das ist der neue Name für Mackenzie’s Swamp.«
Martin lacht und schüttelt den Kopf. »Das ist nicht Ihr Ernst. Da wimmelt es doch von Bullenhaien. Kein vernünftiger Mensch würde diese Gegend erschließen.«
»Die Haie sind weg. Nachdem die Käsefabrik geschlossen wurde.«
»Die Käsefabrik?«
»Du würdest dich wundern.«
Die Käsefabrik. Er hat kein Bild davon im Kopf, kann sich nicht mal erinnern, ob er je dort gewesen ist, aber er weiß, wo sie liegt – draußen an der Dunes Road, außerhalb der Stadt. Irgendeine Erinnerung geht ihm durch den Kopf, das Gefühl, sein Vater könnte einmal dort gearbeitet haben, aber als er diese Erinnerung festnageln will, weiß er nicht, ob sie real ist oder ein Phantasieprodukt. »Wieso war Jasper gegen dieses Projekt? Was wollte er beschützen?«
Denise steht auf und geht um ihren Schreibtisch herum. An einer Wand hängen zwei Landkarten. Die eine ist ein Stadtplan von Port Silver, auf dem die einzelnen Blocks nummeriert und der Flächennutzungsplan farbig codiert ist. Die andere zeigt den Distrikt in einem größeren Maßstab. Denise geht zu dieser Karte. Sie ist schwarzweiß mit grünen Höhenlinien. Martin folgt ihr.
»Wir sind hier in der Stadt.« Denise deutet auf die Karte. »Die Brücke bringt dich über den Argyle zur Dunes Road. Die Straße ist erhöht, ein Fahrdamm durch das Sumpfland. Die Lagune liegt großenteils auf der linken Seite, und die Käsefabrik ist oben am Nordufer.«
Martin macht sich wieder mit der Landschaft seiner Jugend vertraut. Die Dunes Road führt vom Argyle River schnurgerade zwanzig Kilometer weit nach Norden. Das Land zu beiden Seiten der Straße ist flach – Mackenzie’s Swamp –, und das Wasser trägt neuerdings den Namen Crystal Lagoon. »Hochwassergefährdet«, stellt er fest.
»Ja. Bauen kann man da nicht.«