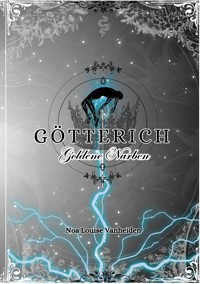
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ungläubig starrte ich auf meine Arme, als würde das Licht direkt aus meinen Adern wie flüssiges Gold fließen: Größere und kleinere Punkte pulsierten. Meine Arme fühlten sich warm an und das Licht, das von ihnen ausging, erinnerte an Sonnenschein. Im sog der Träume zieht es Brian in eine geheimnisvolle Welt, die zugleich eine schreckliche Furcht in ihm entfacht.Als plötzlich seine Adern zu leuchten beginnen, erscheint eine geheimnisvolle Frau, und in diesem schicksalhaften Moment muss Brian eine Entscheidung treffen. Sein Seelenkristall droht zu zersplittern und er steht an der Grenze zwischen den Welten eine Wahl, die über sein Schicksal entscheidet. In einer Welt, in der die Linien zwischen Traum und Realität verschwimmen und ein Krieg seit seiner Geburt tobt, ruft Brians Seelenkraft nach ihm. Gemeinsam mit anderen Auserwählten muss er sich in einem epischen Kampf zwischen Leben und Tod beweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für all jene die ein bisschen Licht in den dunkelstenTagen brauchen
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 1
Es war kalt, der Nebel kroch den Berg nach oben und sammelte sich in den Tälern. Der Morgen begann sich gerade erst zu zeigen. Ich war früh aufgestanden, um den Sonnenaufgang an meinem See zu erleben, doch ich war zu spät. Doch wollte ich mir nicht durch meinen Ärger das Spektakel, das sich mir bot, ruinieren.
Weiter oben zeichneten sich die kleinen Nebelschwaden ab, die sich bald zurückzogen und die Sonne enthüllten. Ihre Strahlen glitten durch die Bäume, wärmten meine Haut. Ich lief ein Stück schneller.
Die alten Bahnschienen, auf denen ich lief, waren morsch und mit Moos bewachsen. Ein heikler Pfad, der volle Konzentration erforderte. Kälte herrschte, obwohl Sommer war und mein eigener Atem zeichnete sich vor mir ab. Es war so früh, dass das nicht überraschte.
Efeu schlängelte sich an dem Eisen entlang. Meine Füße kannten den Weg gut, doch der Wind trug fremdartige Gerüche heran. Über die Schienen schauend, erkannte ich die steile Abbruchkante. Doch das beunruhigte mich nicht.
Das Fahrrad hatte ich zu Hause gelassen, um über Äste zu springen. Der verwilderte Wald schreckte die meisten ab und das war gut so – mein geheimer Ort sollte unentdeckt bleiben. Ein rauschender Fluss und der Klopfen eines Spechts begleiteten mich.
Je tiefer ich in den Wald ging, desto enger wurden die Bäume. Die Baumkronen rauschten leicht, es herrschte kaum Wind. Ein dunkles Grün dominierte. Ich genoss es, nicht im überfüllten Klassenzimmer zu sitzen, während draußen bereits sechsundzwanzig Grad herrschten. Die Schule erschien mir ohnehin sinnlos, voller blöder Lehrer und wenigen Freunden.
Mein Handy klingelte – Tyler, mein bester Freund. »Hey, wo bist du? Die Schule hat schon angefangen! Ich dachte, du kommst heute!«, schrieb er. »Ich komme nicht mehr. Mir geht es nicht gut. Muss mindestens eine Woche zu Hause bleiben.«, log ich.
»Ey, ich brauch dich hier! Frau Metzger hat wieder ihr Überraschungsdiktat ausgepackt. Das schaffe ich ohne dich nicht...«, flehte er. »Du schaffst das schon! Sieh es positiv: Du musst nicht die ganze Zeit brechen.« Mein Handy klingelte erneut. »Du bist doch schwanger, gib es doch zu!«, schrieb er.
Tyler war ein guter Freund, der mich immer zum Lachen brachte. »Von dir oder was? Aber ernsthaft, mir geht es echt dreckig. Ich kotze mir die Seele aus dem Leib.«, gestand ich. »Hast du wieder eine deiner Kreationen gegessen?«, fragte er. Ich lachte. Mit meinen lauten Lachen scheuchte ich Vögel auf.
»Nee, von meinem Essen wird mir nie schlecht. Außerdem brichst du immer von meinen Kreationen.«, schrieb ich zurück. Mein Handy hochhaltend, um besseren Empfang zu haben, erhielt ich eine Nachricht: »Okay, hast ja recht. Naja, bis nachher vielleicht. Gute Besserung.« Es war beruhigend, so einen guten Freund zu haben.
Doch manchmal verstand er mich nicht. In solchen Momenten hoffte ich auf Gleichgesinnte. Allein in dieser Welt, unverstanden. Viele nahmen sich nicht die Mühe, andere zu verstehen.
Dann gab es Menschen wie Tyler, meine Mutter und mein Vater, die sich immer bemühten, mich zu verstehen. Die drei waren die wichtigsten Menschen in meinem Leben.
Doch in letzter Zeit gehörte auch meine Mutter zu den Unverständigen. Sie wollte mich ausgerechnet in dieser Woche zur Schule schicken. Niemals wollte ich zurück. Die Schule war für mich einer der schlimmsten Orte. Ohne meinen Freund hätte ich längst aufgegeben. Wenn diese eine Woche kam, ließ mich meine Mutter normalerweise zu Hause. Doch dieses Jahr sollte ich es versuchen. Seit Wochen war alles kompliziert.
Besser gesagt, seit meinem sechzehnten Geburtstag. Seltsame Träume hatten mich jede Nacht heimgesucht und wurden mit der Zeit realer. In der Schule fühlte ich mich nicht mehr sicher, da ich immer wieder einschlief und schreiend erwachte. Mein Schlafmangel war das Schlimmste. Alle starrten mich an wie einen Freak und ein Freak wollte ich auf keinen Fall sein. Doch irgendwie war ich einer und das war nicht mehr normal. Ich wollte einfach nur alleine an meinem Platz sitzen, ohne dass jemand wusste, wo ich war.
Ich lief weiter, die rutschigen Schienen entlang, bis ich schließlich zu dem kleinen See gelangte. Fünf Jahre waren vergangen und je mehr Zeit verstrich, desto mehr fühlte ich mich allein gelassen. Es roch hier nach frischem Gras und nach Zuhause.
Unser Haus war von denselben Gerüchen erfüllt wie dieser Wald; schließlich wohnten wir nicht allzu weit entfernt. Früher war ich oft mit meinen Eltern hier aber seit fünf Jahren kam nur noch ich allein. Trauer durchströmte mich. Ich hätte diesen Moment gern mit ihm geteilt, als die Sonne sich langsam über den See erstreckte. Aber ich hatte es geschafft.
Ich kletterte geschwind den kleinen Abhang hinunter und rannte zu meinem Platz.
Schnell atmend durchströmte mich die frische Waldluft, ein angenehmer Schauer ging durch meinen Körper. Im Wasser spiegelte sich mein Gesicht und ich betrachtete mich genauer. Ich spürte immer eine gewisse Veränderung in meinem Inneren, wenn ich hier war und das spiegelte sich auch im Wasser wider. Irgendwie sah ich hier immer anders aus.
Müll trieb im Wasser, den hob ich auf und steckte ihn in meine Tasche. Der ganze Müll verschmutzte meinen einst so idyllischen Ort und ich konnte es nicht fassen. Sicherlich war ich nicht derjenige, der diesen hier hinterlassen hatte. Jemand anders kannte diesen versteckten Flecken ebenso. Ein Gefühl der Wut durchzuckte mich und meine Hände ballten sich zu Fäusten. Wer auch immer dafür verantwortlich war, sollte sich auf etwas gefasst machen.
Entschlossen stand ich an der kleine Sandbank, meinen Blick starr auf den umliegende Umgebung gerichtet. Auf einem großen runden Stein, den ich einst mit eigener Kraft dort platziert hatte, nahm ich Platz. Ein Stück entfernt von meiner Sandbank erstreckte sich ein Steinkunstwerk wie eine Brücke. Stolz erfüllte mich, da ich dieses Meisterwerk allein erschaffen hatte. Ein Werk, das nun von Müll verunstaltet wurde.
Ich streifte meinen Rucksack von den Schultern und lehnte mich zurück.Die Sonne und die Bäume spiegelten sich im ruhigen Wasser. Das Schilf neigte sich im leichten Wind. Grillen zirpten, Vögel sangen. Eine kleine Entenfamilie schwamm auf dem großen See, doch das verlockende Wasser wagte ich nicht zu betreten. Irgendwie hatte ich das Schwimmen vergessen, denn seit Jahren hatte ich nicht mehr diese erfrischende Freiheit genossen.
Die Farben des Himmels wurden von Minute zu Minute intensiver. Ich verlor mich in den rosa, orange und roten Nuancen des Himmels. Die Sonne selbst tauchte in das tiefste Rot, während sie langsam emporstieg.
Doch in diesem malerischen Moment konnte ich nicht abschalten. Der Ärger über den Müll nagte an mir und die ruhige Szenerie war von einer angespannten Erwartung durchzogen. Jemand teilte meinen geheimen Ort und es war an der Zeit, herauszufinden, wer es wagte, die Magie dieses Ortes zu stören.
Der Himmel tanzte in seinen vielfältigen Schattierungen, genauso wie meine bunten Gedanken in meinem Kopf. Sie rasten so schnell, dass ich keine Ahnung hatte, wo ich anfangen sollte, sie zu sortieren. Eine Leere breitete sich in mir aus, die ich mit nichts füllen konnte, nicht einmal mit diesen wirbelnden Gedanken. Allein gelassen fühlte ich mich mit meinen eigenen Überlegungen.
Ich griff in meinen Rucksack und zog eine noch warme Flasche und eine Brotdose heraus. Ich hatte mir die Brote für den Tag selbst zubereitet und brach eilig auf, um früh genug das Haus zu verlassen. Damit sie nicht aufwachte und mich beim Davonschleichen erwischte. Ein Biss in das Brot und der Geschmack entfaltete sich, herrlich. Draußen schmeckte alles besser.
Ich liebte es, neue Kombinationen auszuprobieren, wie Erdbeeren mit Käse oder Zimt mit Schinken.
Meine belegten Brote waren auch ein Produkt meiner verrückten Ideen – eines mit Schinken, Käse und Erdnussbutter, das andere mit Käse, Schokolade und Banane. Ich musste lächeln; ich war der Einzige, der solch verrückte Kombinationen genießen konnte. Tyler hatte einmal eine meiner Kreationen probiert und musste sich übergeben aber für mich war es ganz normal.
Damals behauptete er, dass ich mit meinem Essen jemanden umbringen könnte, dass meine zubereiteten Gerichte vergiftet wären. Dann erstellte er ein Meme mit meinem Gesicht und einem unteren Körper, der wie eine Hexe aussah, die über einem Kessel rührte.
Das erste Brot war bereits verschwunden, doch das zweite wollte ich mir für den Nachmittag oder den Abend aufsparen. Stunden konnte ich hier verweilen. Plötzlich klingelte mein Handy. Ein Anruf. Von meiner Mutter. Ich ignorierte ihn. Sie musste nicht wissen, wo ich war; sie würde es sowieso nicht verstehen. »Wo bist du?«, las ich. An meinem Lieblingsplatz, dachte ich. »Brian, bitte komm nach Hause. Wir können doch über alles reden. Bitte!!!«
Nein, Reden würde nichts ändern. Vielmehr würde ich hier übernachten, beschloss ich. Fünf Jahre. Die Tage danach kamen mir vor wie gestern. Eine ganze Woche hatte ich das Haus nicht verlassen, saß vor dem Fernseher, verheult und in den Klamotten, die ich an jenem Tag trug.
Ich aß nichts und ich schlief auch nicht. Ich musste damals ins Krankenhaus weil es so schlecht, um mich stand. Meine Therapie begann, doch mit dreizehn brach ich sie ab. Die Trauer, die einst mein Begleiter war, verblasste. Nur an wenigen Tagen im Jahr erlaubte ich mir, zu trauern, wenn der Jahrestag kam.
Jetzt drohte meine Mutter mir sogar das zu nehmen. Den Blick auf den See gerichtet, versuchte ich mich abzulenken. Langsam schlich sich Müdigkeit ein. Ich breitete meine Jacke im Sand aus und legte mich darauf. Hier konnte ich in Ruhe schlafen, ohne befremdliche Blicke, wenn ich wieder mit einem Schrei aufschreckte.
»He, hallo. Geht es dir gut? Alles okay?« Eine Stimme durchbrach die Stille. Ich öffnete langsam meine Augen. Die Dämmerung hatte eingesetzt, eine Taschenlampe blendete mich. Ich blinzelte mehrmals. Mein Kopf fühlte sich schwer an und ich war allgemein benommen. Erstmals seit Tagen hatte ich weder geträumt noch konnte ich mich daran erinnern. Endlich hatte ich durchgeschlafen.
»Was?«, sagte ich verwirrt und leise, während ich mich langsam aufrichtete. Ein Polizist hockte vor mir, fuhr sich durch seine braunen lockigen Haare. Seine braunen Augen musterten mich, seine Nase war leicht dick und Sorgenfalten überzogen seine Stirn. Ich schätzte ihn auf Mitte dreißig. Er wirkte sehr muskulös, seine Uniform saß wie angegossen, als wäre sie maßgeschneidert. Weiter hinten stand ein anderer Polizist mit einem großen runden Bauch, den er festhielt. Grau-braune Haare und kleine Augen beobachteten mich. Seine Uniform hing herunter, als wäre sie in der Wäsche ausgeleiert worden.
Er sprach in ein Telefon: »Ja wir haben ihn gefunden. Ja wir bringen ihn sofort zu ihnen.« Ich war geschockt. Hatte meine Mutter die Polizei wieder einmal gerufen nur weil ich nicht in die Schule gegangen bin und ihre Anrufe ignoriert hatte? Es sah danach aus. »Geht es dir gut? Du siehst ja ziemlich benebelt aus. Hast du was genommen?«
Ich schüttelte meinen Kopf: »Nein. Mir geht es gut.« Mit einem Ruck stand ich auf, ich klopfte mir den Sand vom Hintern und von der Jacke die ich aufhob. »Okay, wenn es dir gut geht dann bringen wir dich jetzt zurück.« »Es ist ja schon spät.« Der Polizist war Herr Gabler, das realisierte ich jetzt, als ich nicht mehr so vom Licht geblendet wurde. Er hatte mich schon öfter nach Hause gebracht, weil sich meine Mutter Sorgen machte. Er war auch einer der vor fünf Jahren dabei gewesen war. In einer kleinen Stadt kennt jeder jeden. Ich mochte ihn.
Aber ich mochte es nicht, wie gut meine Mutter und er sich verstanden. »Mir geht es blendend. Wollte nur alleine sein.«, sagte ich und zog meinen Rucksack nach oben. »Brian, das kann so nicht weitergehen. Deine Mutter macht sich unglaubliche Sorgen um dich! Ich weiß, es ist schwer aber du musst auch mal zur Schule gehen.«, sagte er und legte seine Hand auf meine Schulter.
Ich wusste, er war ein aufrichtiger Mann aber er könnte niemals ihn ersetzen, auch wenn meine Mutter Interesse an ihm zeigte. Ich wollte, dass sie glücklich ist aber es fühlte sich komisch an, sie mit jemand anderem zu sehen. »Fünf Jahre sind eine lange Zeit.«, sagte er. Ich schüttelte wieder meinen Kopf. Nein.
Fünf Jahre waren keine lange Zeit, damit der Schmerz verschwindet. »Das wissen Sie doch gar nicht.«, sagte ich und wich zurück. »Brian, komm, lass uns dich wieder zu deiner Mutter bringen. Sie ist schon ganz krank vor Sorge. Du musst in deinem Leben etwas ändern, sonst läuft alles nur noch aus dem Rahmen.« Ich wurde sauer. Wie er mir sagen wollte, was ich zu tun hatte. Mein Leben war doch jetzt schon ein einziges Chaos.
Da brauchte er mir nicht noch zu sagen, dass ich etwas ändern muss. Ich ging widerwillig mit ihnen. Er schritt voran zu ihrem Wagen und ich folgte ihm. Ich wusste, dass es einen Weg auch für Autos gab aber ich war ihn schon lange nicht mehr mitgefahren. So vieles verband ich mit den fünf Jahren und mit ihm. Ich setzte mich hinten in den Wagen. Sie fuhren aus der kleinen Bucht heraus.
Die Atmosphäre im Dunkeln des Wagens war angespannt, als der Polizist versuchte, auf mich einzureden. Während die Polizisten fuhren und versuchten, mit mir ein Gespräch anzufangen, saß ich nur stumm da und schaute aus dem Fenster.
Die Spannung im Auto war greifbar, als die Vergangenheit auf unangenehme Weise wieder hochkochte.
Ich saß schon lange nicht mehr in diesem Wagen, der irgendwie immer nach Chips und Donuts roch. Der Wagen war so alt, dass es mich nicht gewundert hätte, unter den Sitzen Essen verstreut zu finden. Der dickere Polizist, Herr Pflaume genannt, schaltete das Radio an, um die totenstille zu zerbrechen.
»Sag mal, Brian, was machen deine Hobbys so?«, fragte Herr Gabler. »Nichts, denn ich habe keine.«, antwortete ich leicht genervt. Warum wollte er das wissen? Alles, was ihn wirklich interessierte, war meine Mutter. »Gar keine? Hat deine Mutter nicht erzählt, dass du gerne zeichnest?«
»Hm, naja.«, sagte ich und quetschte mich noch tiefer in den Sitz. Warum merkte er nicht, dass ich nicht mit ihm reden wollte? Herr Gabler versuchte nicht weiter, ein Gespräch anzufangen. Stattdessen unterhielt er sich mit Herr Pflaume, der ziemlich schlecht fuhr. Bei jeder Kurve legte er sich mächtig ins Zeug, so dass mir schlecht wurde.
Unruhig rutschte ich auf dem Sitz hin und her. Bald erreichten wir unser Haus. Herr Pflaume hupte kurz und ich stieg aus, gefolgt von den Polizisten. Meine Mutter kam sofort aus dem Haus gerannt, hastete zu mir. »Oh mein Gott, Brian, ich bin so froh, dass es dir gut geht.« Sie umarmte mich fest und beinahe erdrückend. »Mutter, du erdrückst mich.«, sagte ich mit heißerer Stimme. Schließlich ließ sie mich los und strich mir ein paar Haare aus dem Gesicht. Die Spannung hielt an, als ich mich auf das Zusammentreffen vorbereitete.
Meine Mutter wirkte ziemlich mitgenommen. Irgendwie überkam mich ein schlechtes Gewissen. »Ich danke euch. Bitte kommt doch herein.«, sagte sie zu den Polizisten und lächelte die beiden an.
In wenigen Minuten saßen wir an dem großen runden Tisch in unserer Küche und tranken Mutters selbstgemachten Tee, der verlockend nach Kamille roch. Meine Mutter kannte sich sehr gut mit den Pflanzen des Waldes aus, daher hatten wir oft getrocknete Kräuter in der Speisekammer.
Die Atmosphäre war angespannt und ich spürte, dass diese Gespräch mehr aufdecken würde als nur einzelne Dinge.
Alle waren ziemlich still nur das geschlürfte von Herrn Pflaume hörte man, in der ganzen Küche. Ich rührte die ganze Zeit in meinen Tee, mit unseren Holzlöffel herum. »Also,«, begann Herr Gabler, »Mein Kollege und ich haben nach gedacht was für Brian am besten wäre, entweder ein Internat mit einer Therapeutischen Beobachtung oder ihr nehmt die Therapie wieder auf. Eine Heilbehandlung würde ich allerdings vom Vorteil sehen, weil so muss, Brian, seine Freunde nicht verlassen. So kann es ja nicht weiter gehen. Er muss lernen es zu akzeptieren und damit umzugehen.« Wie Bitte? Ich konnte meinen Ohren nicht trauen was er da gerade Gesagt hatte.
War der jetzt völlig übergeschnappt?, ich schüttelte meinen Kopf. »Nur über meine Leiche.« »Aber Brian, eine Therapie wäre doch eigentlich eine gute Idee.«, sagte meine Mutter. »Es muss ja nicht sofort sein. Sie können ja auch erstmal nach einem guten Therapeuten suchen.«, fügte Herr Pflaume hinzu und nahm einen großen Schluck aus seiner Tasse.
»Vielen Dank für ihre Gastfreundschaft. Wir gehen dann mal, denn ich habe jetzt Feierabend.« und richtete sich auf.
Herr Gabler griff nach seiner Jacke und stand auf, doch meine Mutter legte ihre Hand auf seine: »Bleib doch noch ein bisschen, James.«
Er lächelte: »Gerne, ich habe sowieso für heute Schluss.« Herr Pflaume nickte: »Alles gut, James. Ich lasse dir den Wagen hier, ich laufe zu meinem Haus, ist ja nur fünf Minuten entfernt. Ich freue mich schon so sehr, meine kleine Rosa in den Arm zu nehmen und meine kleine Lotta. Sie ist ein wahrer Engel.«
Meine Mutter folgte ihm. Nun blieb ich allein mit Herr Gabler im Raum. »Nochmals vielen Dank. Auf Wiedersehen«, hörte ich meine Mutter sagen. »Immer wieder gerne. Wenn es um meine Tochter Lotta geht, wäre ich genauso besorgt. Bestimmt findet sich eine gute Lösung.«, hörte ich Herr Pflaume sagen. Meine Mutter verabschiedete sich erneut von ihm und bedankte sich erneut.
Dann fiel die Tür zu und meine Mutter betrat erneut die Küche. »Mutter, bitte, ich will zu keinem Therapeuten. Mir geht es gut. Außerdem sind die Sitzungen doch sowieso sinnlos.«, sagte ich zu ihr. Sie wusste genau, dass der letzte Therapeut ein Reinfall gewesen war. Er konnte mir nicht einmal ansatzweise helfen, hatte mich nicht einmal nach meinen Gefühlen gefragt oder warum wir überhaupt dort waren.
»Ich werde einen suchen. Die beiden haben aber recht. Es würde dir bestimmt guttun, darüber zu reden.«, seufzte sie. »Nein, sie können mir nicht helfen.«, ballte ich meine Hand zu einer Faust. »Brian, überlege es dir doch erst mal.«, sagte Herr Gabler und legte seine Hand auf meine Schulter, wie vorhin. Ich wich zurück. »Warum sollte ich überhaupt darüber nachdenken? Wenn ich mit niemandem darüber reden möchte.«, sagte ich lauter werdend.
»Es wird alles wieder gut.«, lächelte meine Mutter schwach. Nichts wird wieder gut!, dachte ich. Alles war anders. »Nichts wird anders.«, schrie ich nun. »Brian, du wirst diese Therapie machen.«, erklärte meine Mutter. »Was?«, schrie ich, sprang auf. »Auf gar keinen Fall. Mach ich nochmal eine Therapie. Das könnt ihr nicht mit mir machen.«
Meine Mutter stand ebenfalls auf und kam auf mich zu. »Brian, beruhige dich. Wir wollen doch nur das Beste für dich. Die Zeit sollte eigentlich längst deine Wunden geheilt haben.« Ich wurde wütend. Eine große Falte bildete sich auf meiner Stirn. »Ein ‚wir‘ wird es niemals geben. Und dich werde ich auch keinesfalls als Vater akzeptieren.«, schrie ich weiter.
Ich war voller Wut. Die gesamte Trauer und Einsamkeit hatten sich zu einem brodelnden Wutgefühl verdichtet. »Die Zeit heilt solche Wunden nicht so schnell. Da mache ich nicht mit. Das kannst du vergessen!«, schrie ich, während ich die Treppe hinauf in mein Zimmer rannte. »Brian!«, rief meine Mutter. Ich ließ die Tür hinter mir zuschlagen und verriegelte sie.
Ein lautes Krachen erklang, als ein großes Bild von der Wand fiel und die Treppe hinunterpolterte. Ich warf mich auf mein Bett. Das Schluchzen meiner Mutter drang an mein Ohr. Ich biss mir auf die Lippe. Ich hasste es, sie weinen zu hören. Doch ich konnte und wollte nicht erneut zur Therapie. Jede Sitzung würde bedeuten, den Tag des Geschehens immer wieder durchleben zu müssen – und das wollte ich nicht.
Ich lauschte, wie Herr Gabler und sie Worte austauschten: »Lena, ich weiß, es ist schwierig. Bitte mach dir nicht so viele Sorgen. Ja, ich weiß, es ist auch schwer für mich. Er war schließlich einer meiner besten Freunde.« Mein Blick wanderte zur Tür. Leise ging ich hin, schloss sie auf und setzte mich auf die Treppenstufen, so dass ich sie sehen konnte, ohne selbst entdeckt zu werden.
Dort lagen sie einander in den Armen und Herr Gabler streichelte meine Mutter über den Kopf. »Es wird alles gut, das verspreche ich dir.«, sagte er sanft. »Ich bin froh, dich zu haben. Es tut mir leid, dass er so zu dir war. Normalerweise ist er gar nicht so.«, erwiderte meine Mutter, während sie eine Hand auf seinen Arm legte.
Dann küssten sie sich Entsetzt machte ich auf dem Absatz kehrt und stürmte in mein Zimmer.
Das Bild brannte sich wie ein Blitz in meine Gedanken und ich rang intensiv mit meinen Emotionen. Doch schließlich überwältigte mich der Schock und ich fällte den Entschluss, mich zu entschuldigen. Mit dieser schweren Entscheidung legte ich mich schlafen, doch das verstörende Bild ließ mich nicht so schnell los.
Kapitel 2
In der Dämmerung erblickte ich ein flackerndes Licht – mal hell, mal schwächer. Es symbolisierte Hoffnung, doch ich wagte es nicht, wirklich hindurchzutreten.
Das Neue schüchterte ein und viele Menschen fürchteten sich davor. Ich wollte nicht zu diesen Ängstlichen Menschen gehören, dennoch überkam mich eine leichte Furcht vor dem Unbekannten. Eine Sehnsucht durchdrang meinen Körper, trieb mich dazu, weiterzugehen. Unbeschreiblich aber unglaublich richtig. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich sie zu Fäusten ballen musste. Trotz der Dunkelheit um mich fürchtete ich mich nicht davor, sondern allein vor dem, was vor mir lag.
Ein erstaunliches Wärmegefühl umhüllte mich und ich kostete den angenehmen Sonnenschein auf meiner Haut voll aus. Als stünde eine geheimnisvolle Kraft hinter mir, die mich hierher lockte, erhob ich mich aus dem Nebel. Jeder Atemzug füllte meine Lungen mit erfrischender Luft und jeder Schritt schien mein Herz in ein unerklärliches Kribbeln zu versetzen.
Schließlich erreichte ich ein im Boden verankertes Tor, aus Holz, auf dem kleine Ästchen wuchsen und mysteriöse Schriften eingehämmert waren. Die Oberfläche fühlte sich rau an, obwohl sie glatt erschien. Beim Öffnen bot sich ein faszinierender Anblick: Eine zauberhafte Wiese breitete sich aus, das Gras schimmerte in einem saphirgrünen Glanz. Es wirkte so verlockend weich, dass ich mich am liebsten hineingelegt hätte.
Doch etwas in mir zögerte, mich weiter vorzuwagen. Der Himmel spannte sich in einem intensiven Azurblau, während zarte Wolken in Rosa und Lila getaucht waren und ein Hauch von Geheimnis in der Luft lag.
Ein Mond stand am Himmel, obwohl es noch nicht Nacht war, getaucht in ein helles Gold und verlieh der Landschaft einen zauberhaften Glanz. Kleine weiße Wolken, wie flauschige Watte, umgaben den Mond. Die Felsen, die sich erstreckten, schimmerten wie flüssiges Silber im Sonnenlicht.
In die Felsen waren Becken eingehauen, in denen türkisfarbenes Wasser floss und funkelte. Mehrere dieser Becken formten einen Kreislauf – ein beeindruckendes Schauspiel.
Das Wasser reflektierte die Sonne und die türkisen Schimmer malten die Wände der Felsen in ein magisches Licht. Der Bach, der sich vor mir erstreckte, glitzerte und schimmerte in den schillernden Farben des Regenbogens. Sein Wasser mündete schließlich in einen großflächigen See von lebendigem Grün.
Auf der Wasseroberfläche trieben zahlreiche große und kleine Seerosen. Uferseitige Bäume beugten ihre Zweige bis hinab zum See, als würden sie sich direkt aus dem klaren Wasser nähren. In der Ferne standen Bäume, überzogen von zarten rosafarbenen und lila Blüten.
Die weiten Wiesen waren mit einer Vielzahl von Blumen übersät, als wären sie funkelnde Diamanten. Der Duft von Zimt und Hyazinthen erfüllte meine Nase vollständig. Das ganze erweckte den Eindruck eines lebendigen Gemäldes. Ein entferntes Rauschen erklang, während der Wind, der mir entgegenkam, um mich herumwirbelte und mich in seine Richtung zog.
Und dennoch schlich die Angst mit jedem Schritt näher, während Aufregung und Sehnsucht in mir wuchsen. Diese Gefühle vermengten sich zu einem eigenartigen Kribbeln in meinem Bauch, während mein Herz gegen meine Rippen hämmerte.
Genau vor diesem Ort angekommen, inhalierte ich tief den Duft der Blumen und plötzlich spürte ich nicht nur Angst, sondern auch eine seltsame Sicherheit – als ob mir dieser Ort etwas Bekanntes offenbaren würde. Die Landschaft vor mir entfaltete sich wie ein märchenhaftes Gemälde, so nah und doch gleichzeitig unerreichbar.
Der Wind peitschte mir erneut ins Gesicht, als würde er mich rufen. Der Ort wirkte vertraut und diese seltsame Geborgenheit umfing mich. Entschlossen folgte ich dem Ruf mit festen Schritten, wie so oft in diesem wiederkehrenden Traum.
Mein Kinn zitterte und das Kribbeln in meinem Bauch verstärkte sich. Ich stieß auf eine unsichtbare Wand, die sich wie Gummi anfühlte.
Mit aller Kraft drückte ich dagegen, mein gesamtes Körpergewicht einsetzend. Sie gab unter meinem Druck nach und ich musste mein Gleichgewicht halten, um nicht zu Boden zu stürzen.
Endlich stand ich davor und konnte eintreten. Noch nie hatte ich diese unsichtbare Mauer durchbrochen. Doch als mein Fuß die andere Seite berührte, durchzuckte mich ein stechender Schmerz in meiner linken Brust.
Mein Herz hämmerte wie wild, während mir schwindelig wurde und übel.
Mit einem Mal durchzog mich eisige Kälte und meine Arme prickelten, als wären sie eingeschlafen. Dann verschlang mich die Dunkelheit.
***
Mit einem markerschütternden Schrei erwachte ich. Mein Herz raste, pochte hart gegen meine Rippen, als würde es gleich aus meiner Brust springen.
Ich klammerte mich fest an meine Brust, um meinen Herzschlag zu spüren und mich zu beruhigen. »Nur ein Traum, nur ein Traum,«, murmelte ich immer wieder vor mich hin, während ich versuchte, die aufgewühlten Emotionen zu besänftigen. Mein Shirt war fest in meiner Hand verheddert, mein Körper von Schweiß durchtränkt, das Laken nass.
Kleine Schweißtropfen perlten auf meiner Stirn und ich wischte sie mit meinem Arm fort. Ein Zittern durchlief mich beim Berühren.
Mein Blick schweifte aus dem Fenster; draußen herrschte Dunkelheit, doch in meinem Zimmer erstrahlte in Helligkeit. Mir wurde bewusst, dass ich inmitten der Dämmerungsstille erwacht war – etwa um drei Uhr morgens.
Denn alles lag ruhig da, im Schatten eingehüllt, nur der Mond schien kurzzeitig hervor. Ich blickte mich um und legte meine Hände in meinen Schoß, so wie ich es immer tat, wenn ich nachdachte und versuchte, mich nach solchen Träumen zu beruhigen.
Warum brannte so helles Licht in meinem Zimmer? Ich blickte nach unten und starrte auf meine Arme. Sie waren es, die in intensivem Glanz erstrahlten. Ein leichtes Brennen begleitete dieses unwirkliche Schauspiel. Ungläubig starrte ich auf meine Arme, als würde das Licht direkt aus meinen Adern wie flüssiges Gold fließen.
Größere und kleinere Punkte pulsierten in meinen Rhythmus, der mein Herz widerspiegelte, was ich in meiner Brust spürte. Ich war erstaunt und gleichzeitig fassungslos. Wie konnte das sein? Meine Arme fühlten sich warm an und das Licht was von ihnen Ausging erinnerte an einen Sonnenschein.
Die kleinen Punkte bewegten sich auf und ab, wurden kleiner und wieder größer. Das Leuchten war genauso in diesem Takt verankert.
Wahrscheinlich war ich noch zu sehr in den Fängen meines Traums gefangen, sodass die Grenze zwischen Realität und der Magie, die sich mir darbot, verschwommen war. Ich schloss meine Augen, öffnete sie wieder, schüttelte mich und zwickte mich, um die verbliebene Trance zu vertreiben.
Aber sie verließen mich nicht. Ich zwang mich erneut zum Hinlegen, kämpfte gegen den Schwindel an, der meinen Kopf in die Irre trieb. Um sechs Uhr entschied ich mich dazu, dem Schlaf Lebewohl zu sagen und aus dem Bett zu steigen. Das Wochenende war angebrochen und meine Mutter schlief noch tief und fest. Also beschloss ich, ihr Frühstück zu bereiten.
Schlaftrunken trottete ich zu meinem großen, hellbraunen Schrank. Beim Griff nach dem blauen Shirt blieben meine Augen an meinen Armen haften. Das gleißende Leuchten und die kleinen goldenen Punkte waren hartnäckig. Ich eilte ins Bad und betrachtete mein Spiegelbild mit seinen goldenen Schnörkeln.Ich brauchte das Licht im Bad nicht einmal anzuschalten, obwohl es draußen noch leicht dunkel war. Die Adern auf meinen Armen verströmten eine faszinierend intensive Helligkeit, die aber nicht zu überwältigend wirkte. In diesem unwirklichen Licht betrachtete ich mich im Spiegel: Meine Haare wirbelten wild umher, durch die Magie leicht schwebend. Ich strich mir mit den Händen durch die schokobraunen Strähnen, versuchte vergeblich, sie zu bändigen.
Doch die Magie spielte mit ihnen, ließ sie trotz meiner Bemühungen widerspenstig in die Höhe stehen. Ich kräuselte meine Nase und meine Wangen wurden von einem leichten Stirnrunzeln begleitet. Meine blauen Augen verengten sich, als ich im Spiegel nachforschte.
Immer wieder hörte ich von anderen staunend: »Wow, du hast wirklich beeindruckende Augen. Solche habe ich noch nie gesehen. Benutzt du etwa Kontaktlinsen?«
Sonst waren meine Augen immer hell und strahlend, doch heute schienen sie trüb und matt. Tiefe Augenringe zogen sich unter ihnen ab, in denen kleine, feine Äderchen leuchteten. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden, während ich heißes Wasser in das Waschbecken laufen ließ.
Mein Körper fühlte sich bleischwer an. Jede Bewegung kostete mich enorme Kraft. Mit zittrigen Händen griff ich nach der Bürste, die am Beckenrand lag und versuchte meinen Arm zu schrubben.
Doch die Flecke und das Leuchten blieben hartnäckig. Ein Rauschen erfüllte meine Ohren und mein einziger Fokus lag auf meiner schnellen, flachen Atmung. Ich kniff mich hart, um sicherzustellen, dass dies nicht bloß ein Albtraum war. Der scharfe Schmerz, der durch meinen Arm fuhr, bestätigte die Realität.
Angst breitete sich wie ein unheilvoller Nebel in mir aus und ich starrte nur darauf. Die Minuten dehnten sich aus, fühlten sich an wie Stunden in diesem beklemmenden Moment.
Ein stummer Schrei rang in meiner Kehle, doch kein Ton entwich meinen Lippen. Hilflos musste ich zusehen, wie sich immer mehr kleine Ästchen um mich formten. In einem verzweifelten Akt presste ich meinen Kopf ins Wasser. Normalerweise beruhigte mich das Eintauchen unter Wasser, doch heute wartete ich geduldig, bis die Luft in meinen Lungen knapp wurde, um dann wieder an die Oberfläche zu steigen. Der Spiegel reflektierte nun mein Abbild mit triefend nassen Haaren, die nach ein paar blinkenden Momenten jedoch trocken schienen.
Ich tauchte erneut ab, um mit eigenen Augen zu sehen, wie meine Haare binnen Sekunden wieder trocken wurden. Ein Gefühl der Unverwundbarkeit durchströmte mich – nie fror ich, immer war mein Körper angenehm warm. Sogar im Sommer vermochte ich mühelos der Hitze zu trotzen, ohne einen Tropfen Schweiß zu vergießen.
Meine Mutter nannte es ein Wunder und ich hatte immer Glück gehabt. Diese scheinbare Superkraft offenbarte sich gerade auf besondere Weise. Das Licht, das meine Adern abstrahlten, schien meine Haare so rasch zu trocknen, dass man diesem Prozess förmlich zusehen konnte. Eilig kehrte ich in mein Zimmer zurück und zog einen Hoodie aus meinem Schrank.
Die Kapuze tief ins Gesicht – wenn dieser Makel nicht innerhalb der nächsten Stunden verschwand, würde ich mich nie wieder in der Schule oder überhaupt in der Öffentlichkeit blicken lassen können.
Ein Freak wäre ich, verurteilt für etwas, das ich selbst nicht verstand. Meine Hände begannen, wie in meinem Traum, zu zittern, doch diesmal ballte ich sie nicht zur Faust. Die Angst vor einem unüberlegten Handeln war zu groß.
Entschlossen verließ ich mein Zimmer und stieg die knarrende Holztreppe hinab. Ich vermied behutsam die knarrenden Stellen, um meine Mutter nicht zu wecken.
In der Küche versuchte ich, mich abzulenken, indem ich ihr Frühstück zubereitete. Unsere Küche war eine Mischung aus Nostalgie und Funktionalität, geprägt von einem Uhrmotiv, das das gesamte Haus durchzog. Die Wände strahlten in einem Olivton, die Schränke in einem Karamellton und der Kühlschrank in einem cremefarbenen Ton. Obwohl wir einen Kühlschrank besaßen, gab es zusätzlich eine Speisekammer für kühlere Lagerungen.
Als ich gerade das Ei und den Speck briet, betrat meine Mutter die Küche. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass sie dort stand – die Tür zur Küche quietschte immer, wenn man sie nur ein Stück bewegte. »Guten Morgen, Brian.«
Ich drehte mich um und sah ihr wunderschönes Lächeln, ihre kleinen abstehenden Locken, ihre grünen Augen und ihr blaues Nachthemd, das sie am liebsten trug. Trotz der Situation brachte mich dieser Anblick zum Lächeln.
Jeder könnte mir Bilder von anderen Müttern zeigen, die sogar Models sein könnten und behaupten, sie sähen wunderschön aus.
Doch ich würde den Kopf schütteln und jedes Mal sagen: »Dann hast du aber noch nie meine Mutter gesehen.« Obwohl sie bereits vierundvierzig war, strahlte sie Jugendlichkeit mit ihrem Lächeln aus. »Möchtest du Frühstück?«, fragte ich sie. Sie nickte und strahlte dabei. Ich glaube, dass jeder schön ist; es kommt nur auf die Ausstrahlung an.
Ich legte das Ei und den Speck kunstvoll auf ihrem Teller und legte die letzten beiden Brotscheiben dazu. Den dampfenden Kaffee schenkte ich in zwei Tassen – eine für sie und eine für mich.
Obwohl sie normalerweise nicht begeistert war, wenn ich Kaffee trank – schließlich war ich erst 16 und sie betonte gerne die Nachteile von starkem Kaffee für jemanden meines Alters – spielte das an diesem Wochenende keine Rolle.
Heute brauchte ich definitiv einen Kaffee. Nach der vergangenen Nacht fühlte sich mein Körper noch immer schwer an. Selbst als ich den ersten Schluck Kaffee nahm und ihn durch meine Kehle rinnen ließ, musste ich wieder an die Ereignisse und das Leuchten denken. Ich schüttelte sofort meinen Kopf, um die Gedanken loszuwerden. »Mutter, es tut mir leid wegen gestern. Ich werde die Therapie machen.«, sagte ich. »Es tut mir auch leid, dass wir dich so überrumpelt haben und dass ich James gesagt habe, er könne die Nacht bleiben.« fügte sie traurig hinzu.
»Alles gut. Du hast das Recht, glücklich zu sein. Aber sag mal, wo ist er eigentlich?« Während ich mein Brot mit Butter bestrich und Salami darauf legte, antwortete sie zwischen den Handgriffen: »Er musste früh raus. Schon um fünf Uhr.«
Meine Mutter hob fragend die Augenbrauen: »Warum trägst du einen Pullover? Ist dir kalt?« Kopfschüttelnd verneinte ich und nahm einen großen Schluck aus meiner Tasse. Doch trotz des scheinbaren Zusammenseins fühlte ich mich einsam, denn darüber konnte ich ihr niemals erzählen.
Sie sollte keine Angst vor mir haben. Denn die Tatsache, dass ich Angst vor mir selbst hatte, reichte mir. »Du siehst nicht gut aus. Hast du schlecht geschlafen?«, erkundigte sich meine Mutter besorgt. »Ja, derselbe Traum wie in den letzten Nächten. Dieses Mal hat er mich noch weniger schlafen lassen als die Male zuvor.«, berichtete ich. Meine Mutter legte ihre Hand auf meine und zuckte gleich wieder zurück. »Hast du Fieber? Du bist ganz heiß. Du solltest vielleicht ein kaltes Bad nehmen.«, schlug sie vor. »Hmm, ja, vielleicht hast du recht.«, erwiderte ich und stand auf.
Ich lief die Treppe nach oben, mit jedem Schritt knatschte sie, denn ich achtete nicht darauf, wohin ich trat. Meine Mutter war ja nun wach. Im Bad setzte ich mich an den Rand und ließ eine kalte Wanne ein.
Als sie gefüllt war, stieg ich mit meinen Klamotten hinein, weil ich wusste, dass sie eh nach ein paar Sekunden trocken würden. Als ich ganz in der Wanne lag, zischte es und das Wasser wurde zu Nebel. Ich schüttelte mich – wie konnte das sein? Na super, das war es dann auch wieder mit Abkühlen. Das war mir jetzt zu viel. Mir wurde ganz schwindelig durch den Nebel. Ich stieg aus der Wanne. Die Fenster waren beschlagen und die Luft war allgemein stickig.
Die unerklärlichen Vorkommnisse ließen meine Unruhe weiter steigen. Ich öffnete die Fenster, setzte mich auf den Wannenrand, um mich zu beruhigen.
Ein unbeschreiblicher Schwindel durchzog mich. Ich sehnte mich förmlich danach, diesem Körper zu entkommen. Die Vorstellung dessen, was mit mir und meinem Körper geschah, jagte mir Angst ein. Die Luft blieb erstickend. Langsam atmete ich, versuchte, mich zu beruhigen.
Nach einigen Minuten stand ich auf, stieg die Treppe hinunter zu meiner Mutter in die Küche. »Ich brauche noch einen Kaffee. Das mit der Wanne lasse ich lieber für heute.« sagte ich, setzte mich und schenkte etwas in meine stehengebliebene Tasse ein.
Meine Mutter runzelte die Stirn: »Ist alles okay?« Ich nickte heftig mit dem Kopf. Sie schaute mich lange an und sagte dann: »Schatz, wir müssen reden!« Ich schüttelte meinen Kopf. Ich wusste, worauf das hinauslaufen würde. »Nein. Ich möchte nicht darüber reden. Nicht nochmal!«, sagte ich und sprang auf.
»Ich dachte, jetzt ist alles geklärt.«, rief ich. Ich bereute zwar sofort, was ich getan hatte aber meine Beine bewegten sich schneller zur Hintertür, als ich denken konnte.
Ich wollte weg von diesem Gespräch. Die Tür fiel hinter mir ins Schloss und ich stolperte ein paar Treppenstufen hinunter in den Garten zu dem alten Schuppen.
Ich hörte noch, wie sie mir etwas hinterherrief aber ich wollte nicht darauf reagieren. Ich wusste, sie würde mir nicht folgen; nach einer Auseinandersetzung zog sie sich lieber zurück. Ich war immer so hitzig und schon in dem Moment, wo ich etwas tat, bereute ich es auch schon wieder.
Die Flucht vor dem Gespräch trieb mich zu einem Ort der Stille, doch die Spannung blieb in der Luft hängen.
Immer wenn sie mit »Wir müssen reden« anfing, wusste ich genau, um welches Thema es sich handelte. Seit fünf Jahren versuchte sie schon, mit mir darüber zu reden aber ich war und bin auch jetzt noch nicht dafür bereit.
Gestern, nachdem ich meine Mutter weinen gesehen hatte, war ich mit allem einverstanden. Aber ich wollte nicht schon heute mit meiner Mutter über das Thema reden. Ich kam am alten Schuppen an, der über und über mit Efeu bedeckt war und wo das Holz leicht vermodert aussah. Aber es reichte trotzdem, um mein Fahrrad zu verstauen. Das alte Schloss ließ sich immer ein bisschen schwierig öffnen aber heute hatte ich irgendwie den Dreh raus.
Mein Fahrrad sah so komisch aus unter all den alten Sachen, weil es ganz neu in einem schönen knalligen Rot war. Ich zog es schnell heraus und ging damit vorbei an der großen Eiche und den Blumenbeeten meiner Mutter. Sie liebte es, sich um Blumen zu kümmern, besonders um seltene. Sogar ein Beet für Gemüse und Obst hatte sie angelegt. In unserem Garten stand ein Kirschbaum und zwei kleine Apfelbäume, die immer zuckersüß schmeckten.
Und dann war da noch das Beet, wo sie Melonen, Kartoffeln, Gurken und Kürbisse gepflanzt hatte. Sie legte nicht viel Wert auf die Jahreszeiten; sie meinte, das könne auch ohne die Jahreszeit funktionieren. Ich ging weiter vorbei an dem großen Kirschbaum, der schon seine kleinen grünen Kirschen zeigte.
Wenn es soweit war, würde Mutter bestimmt wieder einen Kuchen aus ihnen machen. Das kleine schiefe Tor mit der grauen Lackfarbe, das zum Wald führte, hob ich zur Seite.
Die Farbe blätterte schon leicht ab und nun klebte ein bisschen davon an meinen Händen. Ich wischte es an meiner Hose ab, schob mein Fahrrad ganz heraus und sprang auf.
Ich fuhr los, hinaus in den Wald, in meinen Wald. Kräftig trat ich in die Pedale. Die Geräusche der Natur umgaben mich aber die angespannte Atmosphäre der vorherigen Diskussion blieb wie ein Schatten über mir.
Ich blickte noch kurz zurück zu dem kleinen Backsteinhaus, doch dann drehte ich mich wieder um, um schneller zu fahren. Die Büsche und die kleinen Trampelpfade, an denen ich vorbeifuhr, die Menschen sich erkämpft hatten, kannte ich auswendig. Ich war in diesem Wald aufgewachsen. Schon als kleines Kind war ich oft spazieren gewesen.
Ich hatte noch nie Angst vor dem Wald gehabt. Die frische Luft tat mir gut und auch die Kühle, die mit dem Wald kam.
Heute strahlte der Wald hell von der Sonne und es gab keinen Nebel mehr wie am vorherigen Tag. Die Bäume bildeten ein Blätterdach, durch das viele Sonnenstrahlen hindurchschienen.
Es roch hier immer nach frischem Gras und Erde. Man hörte immer die Vögel singen, selbst im Winter konnte man denken, dass man sie hört. Ich lauschte gerne dem Gesang der kleinen Vögel.
Die Bäume zogen an mir vorbei mit ihrem saftigen Grün. Ich war so in meine Gedanken versunken, dass ich die Frau an der kleinen Waldbrücke, genau in der Mitte stehend, fast übersah.
Ich legte eine Vollbremsung hin und flog dabei mitten in den Graben – zumindest dachte ich das. Ich erwartete den Schmerz und kniff automatisch meine Augen zu, ich hatte Angst. Doch nach ein paar Sekunden, als kein Schmerz zu spüren war und auch kein Aufprall erfolgte, öffnete ich meine Augen wieder. Ich schwebte in der Luft. Die Frau, die sehr alt aussah, hatte ihre Hand oben und nahm sie langsam herunter. Während sie ihre Hand senkte, schwebte auch ich nach unten. Nun saß ich auf dem Boden und die Frau kam auf mich zu gerannt. »Hinas linma?«, fragte sie in einer ganz anderen Sprache.
Die Sprache klang so fließend, so schön, so unglaublich anders. Das, was sie sagte, diese Sprache – ich kannte sie nicht und doch verstand ich sie. Sie hatte mich gefragt, ob alles okay war. In meinem Kopf drehte sich alles.
Erst die Sache mit meinen Träumen, dann das Leuchten, das Verdunsten des Wassers und jetzt auch noch eine andere Sprache, die in keinem Wörterbuch stand.
Die geheimnisvollen Elemente meines Lebens häuften sich und ein Gefühl von Unheimlichkeit machte sich in mir breit.
Ich verstand die Sprache, als wäre es meine Muttersprache, als hätte ich sie mein ganzes Leben lang benutzt. Ich bewegte meine Lippen so, wie sie es getan hatte aber kein Ton kam aus meiner Kehle. Etwas hämmerte die ganze Zeit in meinem Kopf, als wollte unbedingt etwas aus mir heraus. Doch ich wusste nicht, was herauswollte. Die Sprache? Die Wahrheit, die ich tief in mir kannte? Ich hielt meinen schweren Kopf. Ich starrte ins Leere. Nun glaubte ich wirklich, ich sei ein Freak. Mein Kinn bebte. Ein komisches Gefühl breitete sich in meinem Magen aus.
Die rätselhaften Ereignisse und meine inneren Konflikte verstärkten die Spannung, die sich in mir aufbaute.
Alles drehte sich. Ich fühlte mich wie auf einer nie endenden Achterbahnfahrt. »Wie kann das sein?«, flüsterte ich. »Warum verstehe ich diese Sprache?«, fragte ich weiter. Ich blickte nach oben und stellte ihr eine weitere Frage und damit auch meine letzte: »Wie konnten Sie mich schweben lassen?« Ich bemerkte, dass ich selbst so sprach wie sie.
Das ließ mich erschauern. Alles fühlte sich so surreal an, als wäre ich in einem meiner Fantasy-Bücher gefangen. Meine Lippen bewegten sich wie von selbst, als würden sie jede einzelne Bewegung genau kennen. Die Kapuze war während des Fluges von meinem Kopf gerutscht, also zog ich sie schnell wieder über mein Gesicht. Ich fühlte mich plötzlich so schutzlos, da sie mein Leuchten gesehen hatte. So nackt,
alleine, ich fühlte mich wieder gar und ganz alleine. Ich hatte Angst was geschieht hier bloß mit mir. Die Ereignisse wuchsen und sie fühlten sich alle so unwirklich an. »Du musst keine Angst haben. Das ist bei dir ganz normal.«, sagte sie. Normal? Sollte das wirklich normal sein? Ich blickte sie verwirrt an und wartete darauf, dass sie weiter sprach: »Ich werde dir alles erklären, zur rechten Zeit. Du bist doch Brian, oder? Du kannst die Kapuze runternehmen. Ich weiß doch, was mit dir geschieht.« Ich nickte, zog meine Kapuze herunter und schaute die Frau an.
Ihre Augen waren braun, mit einem sehr hellen roten Ton vermischt, wenn mich meine Wahrnehmung nicht täuschte. Sie war rundlich, hatte gebräunte Haut und sehr große Augen, mit denen sie mich anstarrte. Ihre Haare waren grau und wirr, kurz geschnitten.
Kleine Löckchen rebellierten auf ihrem Kopf. Ihre Nase, lang und geradlinig, verlieh ihr ein markantes Aussehen, während ihr schmaler Mund Rätselhaftigkeit ausstrahlte. Schwerer Schmuck zierte ihren Hals und zahlreiche Ohrringe schmückten ihre Ohren.
In braunen Stiefeln, lockeren grauen Hosen und einer langen, schokoladenbraunen Jacke mit roten Knöpfen, die im Wind hin und her flatterte, trat sie auf. Ein schwarzes, braunes Ornament zierte ihre Schläfe, diese erstreckend sich bis zu ihren Ohren. Die Farbe durchdrang vollständig ihre Ohren und die Ornamente verliehen ihr eine geheimnisvolle Aura.
Ihr Lächeln war breit und aufrichtig. »Deine Mutter ist eine alte Bekannte von mir. Würdest du mich zu ihr bringen, dann erkläre ich dir, was mit dir los ist.« Endlich war ich bereit, Antworten zu bekommen.
Diese Frau schien das Geheimnis um mich zu kennen. Dennoch fand ich die Situation äußerst merkwürdig. Woher kam sie? Was wollte sie von uns? War es überhaupt sicher, ihr zu vertrauen? Ich zögerte: »Können Sie mir nicht unterwegs erklären, was es damit auf sich hat?«
»Ich habe hier kein gutes Gefühl dabei zu reden. Es wäre besser, an einen Ort zu gehen, wo man sicher ist.«, antwortete sie. »Na gut aber sagen Sie mir wenigstens, was mit mir oder meiner Mutter zu tun hat.«, forderte ich und schaute sie herausfordernd an.
»Ich weiß von dem Ring. Mehr musst du nicht wissen.« Ihr Wissen über den Ring überraschte mich. Offensichtlich kannte sie meine Mutter gut. Alicen sprach weiter: »Mein Name ist Alicen, Alicen Kina. Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Brian Bradley.«
Kapitel 3
Ein Gefühl der Furcht überkam mich, als ich darauf wartete, was sie mir enthüllen würde. Ihre Fremdartigkeit war offensichtlich.
Und was, wenn auch ich nicht von hier stammte? Die Tatsache, dass ich ihre Sprache verstand und beherrschte, wirbelte Gedanken über meine Herkunft auf. Was, wenn alles, was ich als meine Familie und mein Zuhause kannte, nicht wirklich zu mir gehörte? Diese Fragen plagten meinen Geist.
Oft stellte ich mir die grundlegende Frage nach meiner Identität. Meine Mutter pflegte zu sagen: »Du bist mein Sohn.« Doch in diesem Moment zweifelte ich stärker als je zuvor daran, ob ich wirklich in diese Familie gehörte. Die Vorstellung, dass mein bisheriges Leben nicht meines war, nagte an mir und fühlte sich an, als würde der Boden unter mir erzittern.
Heute, wenn ich an ihre Worte dachte, konnte ich kaum daran glauben. Der Waldweg fühlte sich ungewöhnlich lang an, düster und bedrohlich. Mein Fahrrad machte quietschende Geräusche, bei jeder Umdrehung des Rades begleitet von einem nervenaufreibenden Ton.
Das Zwitschern der Vögel war verstummt, der Wald schien wie ausgestorben. Meine Sinne waren betäubt, meine Hände zitterten leicht und eine Furcht durchzog jeden Teil meines Körpers. Das Gefühl, beobachtet zu werden, verlieh mir eine Gänsehaut. Um diesem Unbehagen zu entkommen, beschleunigte ich meinen Schritt.
»Haben Sie auch das Gefühl, als würden wir verfolgt werden?«, fragte ich sie. »Ja, ich habe auch das Gefühl, als würden wir verfolgt oder beobachtet werden.«, sagte sie und sah sich mit einem gehetzten Blick um. Wir liefen beide schneller.
Schon von Weitem sah ich die roten Backsteine, das schiefe braune Dach und die Fenster mit ihren schönen hellgrauen Fensterläden.
Das Haus war ebenfalls wie der Schuppen von Efeu bewuchert und in der Regenrinne sah man ein Nest, in dem ein kleiner Vogel saß und wahrscheinlich brütete. Ich war froh, es zu sehen. Ich fühlte mich sofort sicherer. Je näher wir dem Haus kamen, desto mehr spürte ich, dass ich der Wahrheit ein Stück näherkam.
Wir standen nun vor der Eichenholztür, die mit Mustern verziert war. Alicen drückte auf die im Stein eingebaute Klingel. Es dauerte keine zwei Minuten, da stand meine Mutter an der Tür in ihrem blauen Kleid mit den hellen weißen Blümchen und der braunen Schürze, die sie sich um die Hüfte gebunden hatte.
Ich sah, dass ihre Augen leicht verquollen und rot waren – sie hatte geweint.
Das tat mir in der Seele weh. Ich wollte das nicht. Aber immer, wenn es darum ging, konnte ich nicht anders. Alles tat mir leid. Nun hatte ich es schon wieder getan und sie verletzt. Als sie mich und Alicen erblickte, stieg die Traurigkeit wieder in ihre Augen und sie schaute auch sehr erschrocken aus. »Die Zeit ist wohl um? So schnell.«, sagte sie zu Alicen.
»Es tut mir leid aber wir wussten, dass der Tag kommen würde. Dürfen wir rein?«, sprach sie in ganz normalem Deutsch mit einem leichten Akzent. Der Akzent klang schön und verursachte ein Kribbeln auf meiner Kopfhaut. Meine Mutter trat ein Stück zur Seite, sodass genügend Platz war, dass sie hindurchkonnten.
Mein Blick fiel kurz auf mein Fahrrad, das an der Hausmauer lehnte und gesichert war. Nachdem ich mich vergewissert hatte, schaute ich mich noch einmal um – niemand war zu sehen. Dennoch überzog eine Gänsehaut meinen ganzen Körper. Mit einem komischen Gefühl im Magen betrat ich das Haus und schloss die Tür hinter mir.
Als meine Mutter mein Gesicht sah, hielt sie die Hände vor dem Mund. »Ich hätte niemals gedacht, dass sie so schnell kommen würde. Wie groß du doch geworden bist. Mein Schatz, ich wollte eigentlich über etwas ganz anderes reden, nicht über diese Sache.«, sagte sie und streichelte mir über die Wange.
Dann drehte sie sich schnell weg und ich sah, wie sie eine Träne mit ihrer Schürze wegwischte. Jetzt tat es mir noch mehr leid, dass ich einfach aus dem Haus gerannt war. Sie wollte mit mir über eine andere Sache reden und ich war einfach aufgesprungen. Das tat mir leid. Manchmal war ich wohl wirklich ein Idiot.
»Es tut mir leid, dass ich dich wieder verletzt habe.«, sagte ich und ließ meinen Kopf hängen. »Oh, Brian, es ist doch alles in Ordnung. Hauptsache, ich muss die Polizei nicht noch einmal nach dir suchen lassen.«, sagte sie und nahm mich in den Arm. Ich atmete ihren Geruch ein – nach ihrem Parfüm, nach Wärme und Zuhause.
Vielleicht wollte sie über die Geschehnisse der letzten paar Tage reden. Sie wusste, dass ich immer diesen einen Traum hatte. Sie meinte, sie würde nach einer Traumdeutung suchen. Vielleicht wollte sie darüber reden.
Ich ging versunken in meinen wirren Gedanken durch den Flur zur Küche, versuchte, die Ereignisse der letzten Tage zu ordnen. Doch so richtig gelang es mir nicht, Klarheit in meinen Kopf zu bringen. Als ich eintrat, umströmte mich der Geruch von Mutters Marzipankuchen, den sie immer backte, wenn wir stritten.
Schon im Flur hatte ich den Duft wahrgenommen aber in der Küche war er noch intensiver. Ich zog dieses Aroma tief in die Nase. Sie wusste, dass ich ihn liebte und machte ihn immer, damit ich nach unten kam, um mit ihr zu reden. So versöhnten wir uns meistens, weil wir beide wussten, dass das, was wir uns an den Kopf geworfen hatten, nicht böse gemeint war.
Wir setzten uns in die Küche, meine Mutter kochte Tee – sie meinte, das könnte länger dauern. Als der Tee dann auf dem Tisch stand, roch es auch noch nach Pfefferminz. Was für eine herrliche Kombination aus diesen beiden Gerüchen. Wir saßen alle still an dem kleinen Tisch. Niemand traute sich, etwas zu sagen. Alicen griff nach dem Kuchenteller und dem scharfen Messer, schnitt sich ein dickes Stück ab, nahm einen Teller, den meine Mutter auf den Tisch gestellt hatte, hievte das dicke Stück darauf und fing an zu mampfen.
Während zwei Bissen und ihrem genüsslichen Geschmatze fing Alicen an zu erzählen: »Brian, das, was gerade mit dir passiert, nennt man Seelenkristallbruch.« Ich zog eine Augenbraue nach oben. Man sah, dass die Verwirrung mir ins Gesicht geschrieben stand.
»Das heißt, dass jetzt deine Magie sich endlich entwickelt und freigesetzt wird. Deswegen hattest du auch immer diese Träume. Weil du gerufen wirst. Deine Magie ist halt noch unkontrolliert, deswegen leuchtet dein ganzer Körper.«
Meine Mutter fing an: »Du kamst als Baby...« Auf ein Mal erklang ein ohrenbetäubender Knall.
Die Küche, in der wir gerade noch gestanden hatten, explodierte. Wir wurden nach hinten geschleudert auf den Boden. Ich hustete und versuchte nach Luft zu ringen. Alles wurde erschüttert.
In meinem Kopf drehte sich alles. Mitten in diesem ganzen Rauch und Feuer sah ich die schwarzen Augen, die aufleuchteten. Uns hatte also doch etwas verfolgt. Meine Gänsehaut war also nicht unbegründet. Ein Feuer entstand, Funken flogen und in meinen Ohren piepte und rauschte es unaufhörlich, wahrscheinlich durch den Knall. Überall lagen Trümmer und Asche flog, viele Staubpartikel wirbelten durch die Luft.
Ich sah nichts mehr, nur noch Alicen und das große Loch, das in der Wand hinter dem Ofen klaffte. Die Luft war stickig und ich rang wieder nach Luft. Ich kroch auf den Boden und stützte mich dann langsam an einen der noch intakten Stühle hoch. Ich hörte beide neben mir husten. »Mutter?«, rief ich in den Nebel aus Staub. »Mutter?«, schrie ich lauter, als keine Antwort kam.
Ich schmeckte Blut. Meine Hand glitt zu meinen Lippen; sie waren leicht aufgeplatzt. Ich spürte keine Schmerzen durch das Adrenalin. Ich hatte Angst – ging es ihr gut? Lebte sie noch? In meinem Mund begann es zu prickeln, wie immer, wenn die Tränen sehr nah waren. Und schon stiegen auch die ersten richtigen Tränen in mir hoch.
Meine Augen tränten vom Rauch des Feuers und wegen meiner Mutter. »Wir müssen hier weg, sie haben dich gefunden.«, schrie Alicen und griff nach meinem Arm.
»Nein, ich kann hier nicht weg. Mutter!«, schrie ich erneut und befreite mich von Alicen. Ich lief um den Tisch herum und tastete den Boden ab. Plötzlich ergriff eine eiskalte Hand meinen Arm. Ich zuckte zusammen und drehte mich so, dass ich dem Wesen direkt in die Augen blickte. Es stand so nah bei mir; unsere Köpfe waren so dicht, dass kaum noch ein Blatt dazwischen gepasst hätte.
Das Wesen zog an mir und schaute mich aus seinen eiskalten grauen Augen an, dabei beleckte es seine gelben Zähne. Der Anblick ließ mich stocksteif werden. Ein undefinierbares Wesen, der Duft von Schwefel hing in der Luft. Seine großen Hände mit langen Krallen bohrten sich langsam in meinen Arm. Seine zerfetzte Kleidung klebte an ihm wie eine zweite Haut, durchtränkt von dem Geruch von Moder und Knoblauch.
Auf seiner Stirn prangte ein rotes Mal, die Farbe tropfte auf den Boden. Es wirkte, als wäre es mit Blut gemalt. Der Körper des Wesens war dünn, fast knochig, mit langen Ohren, einer zerrissenen Nase und einem starren Blick aus großen Augen.
Entsetzt über das Wesen versuchte ich mich zu befreien aber es hielt mich fest. »Haben wir dich.«, sagte es mit stinkendem Atem. Ich schloss die Augen und hoffte auf ein Wunder. Als ich sie wieder öffnete, sah ich, wie ein helles Leuchten aus meinen Fingerkuppen strömte.
Ein Blitz schoss heraus, traf den Arm des Monsters und es wurde zurückgeschleudert. Als ich meine Hand wegzog, lief eine schwarze Brühe daraus und das Monster ergriff mich erneut. Plötzlich knallte meine Mutter dem Monster mit einem alten Kochtopf auf den Kopf. Es sackte in sich zusammen. Ihre Kleidung war zerrissen aber sie lächelte erleichtert. »Es geht dir gut.«, sagte ich und wir umarmten uns.
Doch dann wurde ihr Blick irgendwie traurig. »Schnell, beeile dich. Geh mit Alicen. Ich bin beschützt. Du musst dich in Sicherheit bringen.
Die Wesen werden bald wieder angreifen und ich glaube nicht, dass unser Küchentopf noch lange das aushalten.«, sagte meine Mutter und schob mich Richtung Eingang. »Aber Mutter, ich kann dich hier doch nicht zurücklassen. Das kann und werde ich nicht tun.«, sagte ich und hielt ihren Arm fest.
»Du musst, mein Schatz.«, sagte sie und drückte mich von sich, in die Nähe von Alicen. »Alicen, passen Sie bitte auf meinen Sohn auf.«, rief sie ihr zu, die auf uns zukam, aus dem Nebel.
»Ich gebe dir mein Wort, dass ihm nichts geschehen wird. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Solange ich lebe, ist er sicher. Komm, Brian, wir müssen los.«, sagte sie und hielt mir ihre Hand hin.
»Mutter aber ich will nicht, dass dir etwas passiert.«, sagte ich und blickte sie an. »Mir wird schon nichts passieren. Ich liebe dich. Sie wollen dich. Nicht mich.«, sie drückte mir einen Kuss auf die Stirn und schob mich weiter vor zu Alicen. »Ich liebe dich auch.«, sagte ich leise, nur dass sie und ich es hören konnte.
Alicen griff nach mir und zog mich in den Flur, dann hinaus aus dem Haus. Ich hörte hinter uns ein Röcheln, das uns verfolgte. »Mutter!«, schrie ich, während ich versuchte, mich aus dem festen Griff von Alicen zu befreien.
»Alicen, lassen Sie mich los. Ich muss meine Mutter retten. Sie befreien. Ich muss sie beschützen. Sie kann doch nicht alleine dort zurückbleiben, oder?«, schrie ich zu ihr.
»Deiner Mutter wird nichts passieren. Um sie liegt schon lange ein Schutzzauber. Das hoffe ich zumindest. Die Monster wollen sie nicht, sondern dich. Und jetzt komm, ich bringe dich schnell hier weg. Du kannst hier nicht mehr sein, du würdest sie nur in Gefahr bringen. Sie werden uns folgen. Deine Mutter und du selbst, ihr habt uns einen großen Vorteil gegeben, den wir nutzen müssen.«
Ich schluckte und mir kamen die Tränen. Ja, Alicen hatte recht, wir mussten hier weg. Doch dann hörte man einen noch lauteren Knall und eine Welle schoss auf unsere Körper zu. Das Haus, in dem ich aufgewachsen war, explodierte. Wahrscheinlich waren die Flammen auf unseren alten Gasherd übergegangen.
Wir flogen durch die Explosion, wie wehrlose Puppen durch die Luft. »Nestla!«, schrie sie. Schutzzauber.
Eine feine hellgelbe Hülle überzog meinen Körper und ihren, diese ließ uns weich auf dem Boden aufkommen. Alicen zog mich auf die Füße. Wir rannten weiter zu einem gelben Käfer. Alicen drückte auf den Autoschlüssel. Das Auto blinkte einmal. »Steig ein!«, sagte sie streng. Und ich tat, was sie sagte, denn so wie das Haus explodiert war, hatte mir eine ganz schöne Angst gemacht.
Alicen startete das Auto, sie versuchte es mehrmals, doch der Motor sprang nicht an. Ich sah, wie mehrere Monster, die dem ähnelten, der mich am Arm gepackt hatte, uns hinterher liefen. Ich sah auch meine Mutter, wie sie aus dem Haus stolperte und uns unversehrt nachblickte. Sie rief etwas, doch ich konnte nicht sehen, was sie sagte.
Der Motor gab ein klägliches Geräusch von sich. »Alicen, schnell, beeile dich, sie kommen immer näher!«, schrie ich angsterfüllt. Alicen versuchte es noch einmal, dann sprang endlich der Motor an.
»Ja, endlich.«, schrie sie und trat auf das Gaspedal. Die Monster kamen schnell voran, es sah fast so aus, als könnten sie fliegen. »Was sind das für Wesen?«, fragte ich. »Das sind Wesen, die von deinen Feinden losgeschickt wurden, um dich zu vernichten.«, sagte Alicen hektisch und fuhr eine scharfe Linkskurve.
»Aber warum? Ich habe doch niemandem etwas getan.«, zitterte ich. »Nein, hast du auch nicht. Aber er fürchtet sich vor dir. Wegen der Legenden. Und frag jetzt nicht nach welcher. Ich muss mich hier unbedingt konzentrieren.«, sagte sie, während die Monster schon ganz nah waren, sodass ich sie schon riechen konnte.
Der Geruch war so eklig wie in unserer Wohnung. Alicen bog nach rechts ab und so schaffte sie es immer, ein kleines Stück Abstand zwischen uns und diesen unglaublich hässlichen Monstern zu bringen.
Die Landschaft zog unglaublich schnell an uns vorbei. Mir war schon ganz schlecht von den vielen Kurven und der schnellen Fahrt. Alicen sah angestrengt aus; ihr ganzes Gesicht war konzentriert. Dumpfe Geräusche waren über uns zu hören. Ein Monster hatte es geschafft, auf das Dach zu klettern.
»Oh mein Gott, Alicen. Ich glaube, eins ist auf dem Dach.« Alicen fuhr nun hin und her.
Das Monster fauchte die ganze Zeit und dieses Fauchen erschütterte den ganzen Wagen. Es fiel nach hinten und stieß mit seinen beiden anderen Kumpanen zusammen. Ich beobachtete alles im Rückspiegel.
Die drei lagen auf der Straße und aus ihnen floss diese schwarze Brühe. Ich sackte im Sitz ein Stück zusammen. Zum Glück haben wir es geschafft, dachte ich. Auch Alicen sah erleichtert aus.
»Jetzt kann uns erst mal nichts mehr passieren. Das Auto absorbiert deine unkontrollierte Magie, sodass sie uns nicht so schnell folgen können. So verlieren sie deine Fährte, denn sie können unkontrollierte Magie aufspüren.«, sagte sie und lehnte sich im Sitz zurück. Sie fuhr mit dem Wagen auf eine größere Straße, die weit belebter war als die kleinen Dorfstraßen, in denen ich aufgewachsen war.
Wir fuhren auf eine Hauptstraße. Ich sah, wie kleine Wäldchen an mir vorbeizogen und größere Felder. Die Stille war gerade gut, denn wir beide fühlten uns wahrscheinlich immer noch ziemlich erschrocken. »Bist du verletzt?«, brach Alicen die Stille. »Nein, ich denke nicht. Zumindest spüre ich gerade gar nichts.« Ich blickte zu meinen Beinen hinunter. »Selbst wenn du verletzt wärst, durch deine Kräfte wärst du nach ein paar Sekunden geheilt. Ich ähm, ich meine, Brian, ich hätte dich so oder so von deiner Mutter trennen müssen.«, sagte sie. Eine kleine Träne rollte mir über die Wange.





























