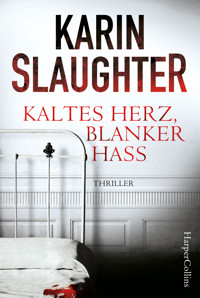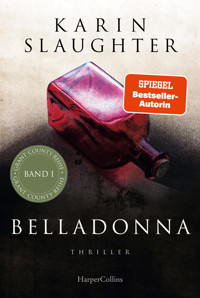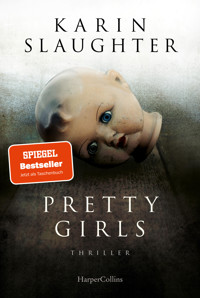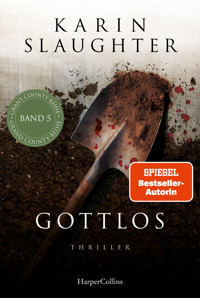
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Grant-County-Serie
- Sprache: Deutsch
Tief in den Wäldern von Grant County finden Polizeichef Jeffrey Tolliver und Dr. Sara Linton die Leiche eines jungen Mädchens. Erste Ermittlungen offenbaren Grausames: Das Mädchen war offensichtlich lebendig begraben worden. Obwohl Sara und Jeffrey noch von ihrer eigenen Vergangenheit verfolgt werden, müssen sie zusammenarbeiten, um den Täter zu finden. Jeffrey und seine Kollegin Lena Adams folgen der Spur bis zur Familie des Mädchens hinaus aufs Land, in eine religiöse Gemeinschaft, die sehr abgeschieden lebt. Hier sieht sich Lena schnell mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert. Doch dann verschwindet ein weiteres Mädchen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
Als in einem Waldstück die Leiche eines Mädchens gefunden wird, ist schnell klar: Die junge Frau hat vor ihrem Tod Grausames durchgestanden, ihr Mörder kannte offenbar keine Skrupel. Lena Adams und Jeffrey Tolliver ermitteln, doch die Familie der Toten lässt fast keinen Kontakt zur Außenwelt zu. Sie leben in großer Abgeschiedenheit, wirken jedoch nicht wie religiöse Fanatiker, sondern ehrlich erschüttert vom Tod der jungen Abigail. Dann entdeckt die Polizei einen zweiten Sarg – und an der Innenseite befinden sich Kratzspuren. Jeffrey ahnt, dass Abigail nicht das erste Opfer des Killers war …
Zur Autorin:
Karin Slaughter ist eine der weltweit berühmtesten Autorinnen und Schöpferin von über 20 New-York-Times-Bestseller-Romanen. Dazu zählen Cop Town, der für den Edgar Allan Poe Award nominiert war, sowie die Thriller Die gute Tochter und Pretty Girls. Ihre Bücher erscheinen in 120 Ländern und haben sich über 40 Millionen Mal verkauft. Ihr internationaler Bestseller Ein Teil von ihr ist 2022 als Serie mit Toni Collette auf Platz 1 bei Netflix erschienen. Eine Adaption ihrer Bestseller-Serie um den Ermittler Will Trent ist derzeit eine erfolgreiche Fernsehserie, weitere filmische Projekte werden entwickelt. Slaughter setzt sich als Gründerin der Non-Profit-Organisation »Save the Libraries« für den Erhalt und die Förderung von Bibliotheken ein. Die Autorin stammt aus Georgia und lebt in Atlanta.
Karin Slaughter
GOTTLOS
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Sophie Zeitz
HarperCollins
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel Faithless bei Delacorte Press, New York.
© 2005 by Karin Slaughter
Ungekürzte Ausgabe im HarperCollins Taschenbuch
by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2016 für die deutschsprachige Ausgabe by Blanvalet Verlag München, in der Verlagsgruppe Randomhouse GmbH
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Covergestaltung von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung unter Verwendung von Midjourney
E-Book Produktion von GGP Media Gmbh, Pößneck
ISBN 9783749907922
www.harpercollins.de
Für all meine neuen Freunde bei Bantam
Am Anfang
Der Regen hatte den Waldboden aufgeweicht, sodass die Blätter und Zweige unter ihren Füßen nachgaben, ohne zu knacken. Das Laub war wie ein dicker, feuchter Teppich, und ihre Schritte schmatzten, als sie tiefer in den Wald drangen. Genie sagte nichts, stellte ihm keine Fragen. Seine Enttäuschung bedrückte sie, und sie war erfüllt vom tiefen Kummer eines Kindes, das plötzlich das Wohlwollen eines geliebten Erwachsenen verloren hatte. Sie strauchelte, doch er fing sie auf, sein Griff um ihren Arm war fest, beruhigend in der Finsternis. Sie kannte diese Hände schon ihr ganzes Leben, war vom Kind zum Teenager in dem Bewusstsein herangewachsen, dass sie immer da waren, um sie zu trösten und zu beschützen.
»Wir sind gleich da«, sagte er, und seine sonst so sanfte Stimme klang seltsam tief im Dunkel der Nacht.
Langsam gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit. Sie wusste, wo sie waren, vor ihnen lag die Lichtung. Als sie stehen blieb, stieß er sie weiter, und diesmal waren seine Hände nicht mehr behutsam, nicht mehr beruhigend.
»Geh«, befahl er.
Wie immer tat Genie, was man ihr sagte. Sie trottete weiter, bis sie mit den Schuhspitzen gegen etwas stieß, das ihr den Weg versperrte, ein Erdhaufen. Von Bäumen ungehindert, beleuchtete der Mond die Lichtung und ließ eine große, rechteckige Grube im Boden erkennen, die erst kürzlich ausgehoben worden war. Darin befand sich, genau eingepasst, eine längliche Holzkiste mit glattem Boden und hohen Wänden. Neben der Grube lag ein Deckel aus mehreren schmalen Planken, mit einem Querholz sauber zusammengefügt. In der Mitte des Deckels klaffte ein Metallrohr wie ein überraschter kleiner Mund. Ein Spaten stak in dem Hügel frischer Erde, wartend.
Er legte ihr die starke Hand auf den Rücken und drückte sanft, als er sagte: »Hinein.«
Sonntag
Eins
Sara Linton stand vor der Haustür ihrer Eltern. In den Händen hielt sie so viele Einkaufstüten, dass ihre Finger taub wurden. Sie wollte die Tür mit dem Ellbogen aufdrücken, stattdessen stieß sie sich an der Scheibe. Sie machte einen Schritt zurück und versuchte, die Tür mit einem Fußtritt zu öffnen, wieder umsonst. Schließlich gab sie auf und klopfte mit der Stirn gegen die Scheibe.
Durch das geriffelte Glas beobachtete sie, wie ihr Vater durch den Flur kam. Er öffnete ihr, ganz untypisch für ihn, mit einem ausgesprochen mürrischen Gesicht.
»Kannst du nicht zweimal gehen?«, fragte Eddie und nahm ihr ein paar Tüten ab.
»Warum ist die Tür nicht offen?«
»Vom Auto sind es gerade mal fünf Meter.«
»Dad«, entgegnete Sara, »warum habt ihr die Tür abgeschlossen?«
Er sah über ihre Schulter hinweg. »Dein Wagen ist dreckig«, sagte er und stellte die Tüten wieder ab. »Meinst du, du schaffst es, zweimal in die Küche zu gehen?«
Er war schon wieder an ihr vorbei, bevor Sara etwas erwidern konnte. »Wo willst du hin?«
»Dein Auto waschen.«
»Draußen ist es eiskalt.«
Eddie drehte sich um und blickte sie vielsagend an.
»Dreck klebt, egal, wie der Wind steht.« Er klang dabei wie ein Schauspieler in einem Shakespeare-Stück, nicht wie ein Klempner aus einer Kleinstadt in Georgia.
Bevor Sara etwas sagen konnte, war er in der Garage verschwunden, um das Putzzeug zu holen.
Als er sich bückte, um den Eimer mit Wasser zu füllen, sah Sara, dass er eine ihrer alten Jogginghosen aus Highschool-Zeiten, als sie in der Leichtathletikmannschaft gewesen war, anhatte.
»Willst du den ganzen Tag da rumstehen und die Kälte reinlassen?« Cathy zog Sara ins Haus und schloss die Tür.
Sara beugte sich zu ihr hinunter und ließ sich auf die Wangen küssen. Zu ihrem großen Kummer hatte sie ihre Mutter schon in der fünften Klasse um einen Kopf überragt. Saras kleine Schwester Tessa hingegen hatte die zierliche Figur, das blonde Haar und die natürliche Anmut ihrer Mutter geerbt. Neben den beiden sah Sara aus, als sei sie ein Nachbarskind, das eines Tages zum Mittagessen gekommen und einfach geblieben war.
Cathy griff nach den Supermarkttüten, überlegte es sich dann aber anders. »Trägst du die bitte?«
Folgsam lud Sara sich erneut alle acht Tüten auf, ohne Rücksicht auf ihre Finger zu nehmen. »Was ist hier eigentlich los?«, fragte sie. Ihre Mutter wirkte irgendwie angeschlagen.
»Isabella«, seufzte Cathy, und Sara verkniff sich ein Grinsen. Ihre Tante Bella war die einzige Sara bekannte Person, die mit einem eigenen Alkoholvorrat anreiste.
»Rum?«
»Tequila«, flüsterte Cathy in einem Ton, in dem andere Leute »Krebs« sagen würden.
Eine Welle von Sympathie stieg in Sara auf. »Hat sie gesagt, wie lange sie bleibt?«
»Noch nicht.« Bella hasste Grant County und war seit Tessas Geburt nicht mehr hier gewesen. Vor zwei Tagen war sie unangekündigt aufgetaucht, mit drei großen Taschen im Kofferraum ihres Mercedes Cabrio und ohne ein Wort der Erklärung.
Früher wäre Bella mit so viel Geheimniskrämerei nicht durchgekommen, doch seitdem das neue Motto der Lintons »Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen« lautete, hatte sie niemand weiter mit Fragen bedrängt. Seit dem Überfall auf Tessa im letzten Jahr war alles anders geworden. Es war, als stünden sie alle noch immer unter Schock, auch wenn offenbar keiner von ihnen darüber reden wollte. Im Bruchteil einer Sekunde hatte der Täter nicht nur Tessas Leben, sondern das der ganzen Familie verändert. Sara fragte sich oft, ob sie sich jemals davon erholen würden.
»Warum war die Tür abgeschlossen?«, fragte Sara.
»Das muss Tessa gewesen sein.« Einen Moment lang standen Tränen in Cathys Augen.
»Mama …«
»Geh schon mal rein«, wehrte Cathy ab und zeigte zur Küche. »Ich komme gleich nach.«
Sara nahm die Tüten und ging durch den Flur nach hinten. Dabei glitt ihr Blick über die Fotos an den Wänden, die sie und Tessa in ihren Mädchenjahren zeigten. Natürlich sah Tessa auf den meisten Bildern schlank und hübsch aus. Sara war dieses Glück nicht beschieden. Das schlimmste Foto zeigte sie im Sommerlager in der achten Klasse. Sie hätte es sofort von der Wand gerissen, wenn sie damit irgendwie durchgekommen wäre. Sara war stehend in einem Ruderboot aufgenommen worden. Der Badeanzug hing ihr wie Teerpappe von den knochigen Schultern, und auf ihrer Nase leuchteten unförmige Sommersprossen, die ihrem Teint einen unglücklichen Gelbstich verliehen. Ihre roten Locken, die in der Sonne getrocknet waren, standen kraus in alle Richtungen ab und sahen aus wie eine Clownsperücke.
»Schätzchen!« Bella breitete begeistert die Arme aus, als Sara in die Küche kam. »Schau dich an!«, zwitscherte sie, als wäre das ein Kompliment. Sara wusste, dass sie nicht gerade vorteilhaft aussah. Sie war vor einer Stunde aus dem Bett gekrochen und hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sich die Haare zu kämmen. Sie war eindeutig ihres Vaters Tochter und hatte noch immer das T-Shirt an, das sie zum Schlafen getragen hatte, dazu eine Jogginghose aus ihrer Leichtathletikzeit am College, die nicht viel neuer war als die aus der Highschool. Bella dagegen trug ein blaues Seidenkleid, das vermutlich ein Vermögen gekostet hatte. An ihren Ohren funkelten Diamanten, und die vielen Ringe an ihren Händen glitzerten in der Sonne. Ihre Frisur und ihr Make-up waren wie immer makellos, und selbst um elf Uhr früh an einem ganz normalen Sonntagmorgen sah sie hinreißend aus.
»Tut mir leid, dass ich erst jetzt vorbeikomme«, sagte Sara.
»Ach was.« Ihre Tante winkte ab und setzte sich wieder.
»Seit wann erledigst du die Einkäufe für deine Mutter?«
»Seit du da bist und Mama sich um deine Unterhaltung kümmern muss.« Sara stellte die Tüten neben die Spüle und massierte ihre Finger, damit sie wieder durchblutet wurden.
»Ich amüsiere mich auch alleine prächtig«, sagte Bella. »Deine Mutter ist diejenige, die mal mehr rauskommen müsste.«
»Mit Tequila?«
Bella lächelte verschmitzt. »Cathy hat Alkohol noch nie vertragen. Ich bin überzeugt, das ist der wahre Grund, warum sie deinem Vater das Jawort gegeben hat.«
Sara lachte und stellte die Milch in den Kühlschrank. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen, als sie darin einen Teller mit filetierten Hähnchen entdeckte, die nur noch in die Kasserolle mussten.
Bella erklärte: »Die Bohnen haben wir gestern Abend geputzt.«
»Köstlich«, murmelte Sara. Das war das Erfreulichste, was sie die ganze Woche gehört hatte. Cathys Kasserolle war unschlagbar. »Wie war es in der Kirche?«
»Ein bisschen viel Weihrauch für meinen Geschmack«, gestand Bella und nahm sich eine Orange aus der Obstschale.
»Aber erzähl mir lieber, was dein Leben so macht. Hast du was Aufregendes erlebt?«
»Immer der gleiche Trott«, seufzte Sara, während sie die Konservendosen einräumte.
Bella schälte ihre Orange und klang ein wenig missmutig, als sie sagte: »Routine kann auch tröstlich sein.«
»Hm«, machte Sara und stellte eine Suppendose ins Regal über dem Herd.
»Sehr tröstlich.«
»Hm«, wiederholte Sara, die genau wusste, worauf das Gespräch hinauslaufen würde.
Während ihres Medizinstudiums an der Emory University in Atlanta hatte sie eine Weile bei ihrer Tante gewohnt. Doch Bellas Partys bis tief in die Nacht, die vielen Cocktails und wechselnden Männerbesuche hatten irgendwann dazu geführt, dass Sara auszog. Für manche ihrer Kurse musste sie um fünf Uhr aufstehen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie zum Lernen ruhige Nächte brauchte. Sara zuliebe hatte Bella versucht, ihr gesellschaftliches Leben einzuschränken, aber schließlich waren sie beide der Meinung, dass es das Beste wäre, wenn Sara sich etwas Eigenes suchte. Das alles geschah in herzlichem Einverständnis, bis Bella ihr vorschlug, sie könne sich doch eins der Apartments unten in der Clairmont Road ansehen – im Altersheim.
Cathy kam in die Küche und wischte sich die Hände an der Schürze ab. Sie nahm die Suppendose, die Sara gerade verstaut hatte, aus dem Regal und schob ihre Tochter zur Seite. »Hast du alles bekommen, was auf der Liste stand?«
»Bis auf den Sherry«, sagte Sara und setzte sich zu Bella an den Tisch. »Wusstest du, dass man sonntags keinen Alkohol kaufen kann?«
»Ja«, gab Cathy vorwurfsvoll zurück. »Deswegen hatte ich dich gebeten, gestern Abend einzukaufen.«
»Tut mir leid.« Sara nahm sich ein Stück Orange. »Ich musste bis abends um acht mit einer Versicherung im Westen verhandeln. Das war der einzige Telefontermin, den wir gefunden haben.«
»Du bist Ärztin«, sagte Bella erstaunt. »Warum zum Teufel musst du mit Versicherungen telefonieren?«
»Sie weigern sich, für die Tests zu zahlen, die ich veranlasse.«
»Ist das nicht deren Job?«
Sara zuckte die Achseln. Irgendwann hatte sie klein beigegeben und eine Vollzeitkraft engagiert, die sich mit den Versicherungen herumschlagen sollte. Trotzdem verbrachte sie noch immer täglich zwei bis drei Stunden damit, nervtötende Formulare auszufüllen oder am Telefon auf Versicherungsangestellte einzureden, wenn sie sie nicht sogar anschrie. Inzwischen ging sie eine volle Stunde früher in die Kinderklinik, um des Papierkriegs Herr zu werden, aber nichts davon half.
»Lächerlich«, murmelte Bella mit vollem Mund. Sie war Mitte sechzig und, soweit Sara wusste, in ihrem Leben keinen einzigen Tag krank gewesen. Vielleicht sollte man die gesundheitlichen Folgen des Kettenrauchens und Tequilatrinkens bis in die frühen Morgenstunden noch einmal überdenken.
Cathy stöberte in den Supermarkttüten. »Hast du Salbei bekommen?«
»Ich glaube schon.« Sara stand auf, um ihr suchen zu helfen, doch Cathy scheuchte sie weg. »Wo ist Tess?«, fragte Sara.
»In der Kirche«, antwortete Cathy. Sara wunderte sich über den missbilligenden Ton ihrer Mutter, doch sie fragte nicht weiter. Bella ging es offenbar ähnlich, denn sie sah Sara mit hochgezogenen Brauen an, als sie ihr ein weiteres Stück Orange reichte. Tessa war aus der Gemeinde der Primitive Baptist Church ausgetreten, der Cathy, seit sie Kinder waren, angehörte, und besuchte neuerdings eine kleine Freikirche im Nachbarbezirk. Eigentlich hätte Cathy sich freuen können, dass wenigstens eine ihrer Töchter keine gottlose Heidin war, doch offensichtlich gefiel ihr Tessas Wahl nicht. Wie bei den meisten Dingen in letzter Zeit fragte niemand nach den Gründen.
Cathy öffnete den Kühlschrank, räumte die Milch um und fragte beiläufig: »Wann bist du gestern Abend heimgekommen?«
»So um neun«, sagte Sara und schälte noch eine Orange.
»Verdirb dir nicht den Hunger«, mahnte Cathy. »Hat Jeffrey seine Möbel schon zu dir gebracht?«
»Fast al…« Im letzten Moment bremste Sara sich und wurde dunkelrot. Sie schluckte ein paarmal, bevor sie wieder sprechen konnte. »Woher weißt du das?«
»Ach, Schätzchen«, Bella schmunzelte. »Wenn du willst, dass die Leute sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, wohnst du in der falschen Stadt. Genau deshalb habe ich das Land verlassen, sobald ich mir die Fahrkarte leisten konnte.«
»Besser gesagt, sobald du einen Kerl gefunden hattest, der dir die Fahrkarte kaufen konnte«, versetzte Cathy trocken.
Sara räusperte sich wieder. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Zunge auf die doppelte Größe angeschwollen war.
»Weiß Daddy Bescheid?«
Cathy zog die Brauen hoch. »Was glaubst du?«
Sara holte Luft und atmete durch die Zähne aus. Jetzt verstand sie, was ihr Vater mit dem Dreck, der kleben bleibt, gemeint hatte. »Ist er wütend?«
»Ein bisschen«, sagte Cathy. »Aber vor allem ist er enttäuscht.«
Bella schnalzte mit der Zunge. »Kleine Städte, kleinkarierte Köpfe.«
»Es liegt nicht an der Stadt«, widersprach Cathy. »Es liegt an Eddie.«
Bella lehnte sich zurück, als wollte sie sehr weit ausholen.
»Einmal habe ich mit einem Jungen zusammen in wilder Ehe gelebt. Ich war gerade nach London gezogen. Er war Schweißer von Beruf, aber seine Hände … Er hatte die Hände eines Künstlers. Habe ich euch je erzählt …«
»Ja, Bella«, unterbrach Cathy betont gelangweilt. Bella war ihrer Zeit schon immer voraus gewesen, als Beatnik, als Hippie und als Veganerin. Zu ihrer großen Enttäuschung war es ihr nie gelungen, ihre Familie zu schockieren. Sara hatte den Verdacht, dass ihre Tante vor allem deswegen das Land verlassen hatte, um den Leuten erzählen zu können, sie sei das schwarze Schaf in der Familie. In Grant County kaufte ihr das keiner ab. Großmutter Earnshaw, die für das Frauenwahlrecht gekämpft hatte, war stolz auf ihre verwegene Tochter, und Big Daddy gab vor allen mit seinem »kleinen Wirbelwind« an. Nur ein einziges Mal war es Bella gelungen, in ihrer Familie so etwas wie Aufsehen zu erregen, und zwar als sie verkündete, sie würde einen Börsenmakler namens Colt heiraten und in einen Vorort ziehen. Glücklicherweise hatte die Beziehung nur ein Jahr gehalten.
Sara spürte, wie ihre Mutter sie mit Blicken durchbohrte. Als sie es nicht mehr aushielt, fragte sie: »Was ist denn?«
»Ich verstehe nicht, warum du ihn nicht einfach heiratest.«
Sara drehte an dem Ring, den sie am Finger trug. Jeffrey hatte seinerzeit an der Auburn University Football gespielt, und sie trug seinen Mannschaftsring am Mittelfinger wie ein verliebter Teenager.
»Dein Vater kann ihn nicht ausstehen«, bemerkte Bella, als wäre das eine Ermutigung.
Cathy verschränkte die Arme vor der Brust. »Warum?«, wiederholte sie und machte eine kurze Pause. »Warum heiratet ihr nicht einfach? Hat er dich nicht gefragt?«
»Doch.«
»Warum sagst du nicht einfach Ja und bringst es hinter dich?«
»Es ist kompliziert«, gab Sara zurück und hoffte, das Thema wäre damit beendet. Alle wussten, wie ihre Beziehung mit Jeffrey verlaufen war, von dem Augenblick an, als sie sich in ihn verliebt hatte, über ihre Ehe bis zu dem Abend, als Sara früher von der Arbeit gekommen war und ihn mit einer anderen Frau im Bett erwischt hatte. Am nächsten Tag hatte sie die Scheidung eingereicht, doch aus irgendeinem Grund kam Sara nicht von ihm los.
Zu ihrer Verteidigung musste gesagt werden, dass Jeffrey sich in den letzten Jahren geändert hatte. Heute war er zu genau dem Mann geworden, den sie schon vor fünfzehn Jahren in ihm erkannt hatte. Und ihre Liebe zu ihm war neu, irgendwie sogar noch aufregender als beim ersten Mal. Sie hatte nicht mehr dieses alberne Gefühl, mit dem sie sich anfangs gequält und das Telefon beschworen hatte, es möge endlich klingeln, sonst müsse sie auf der Stelle sterben. Heute fühlte sie sich in seiner Gegenwart einfach wohl. Sie wusste, dass er immer für sie da sein würde. Und nach den fünf Jahren, in denen sie allein gelebt hatte, wusste sie auch, dass sie ohne ihn unglücklich war.
»Du bist zu stolz«, sagte Cathy. »Wenn es hier nur um dein Ego geht …«
»Es hat nichts mit meinem Ego zu tun«, erwiderte Sara. Sie wusste nicht, wie sie es erklären sollte, und sie ärgerte sich, dass sie überhaupt das Gefühl hatte, sich rechtfertigen zu müssen. Aber ihre Beziehung mit Jeffrey war das Einzige, worüber ihre Mutter noch gerne mit ihr sprach. Sara ging ans Waschbecken und wusch sich die Hände.
Um das Thema zu wechseln, fragte sie Bella: »Wie war es in Frankreich?«
»Französisch«, antwortete Bella, die sich nicht so leicht ablenken ließ. »Vertraust du ihm?«
»Ja«, sagte Sara. »Mehr als je zuvor. Und genau deshalb brauche ich auch kein Stück Papier, das mir sagt, wie wir zueinander stehen.«
Selbstgefällig stellte Bella fest: »Ich habe gleich gewusst, dass ihr wieder zusammenkommt.« Sie zeigte mit dem Finger auf Sara. »Wenn du ihn wirklich hättest loswerden wollen, dann hättest du deinen Job als Coroner aufgegeben.«
»Es ist nur ein Nebenjob«, verteidigte sich Sara, doch insgeheim wusste sie, dass Bella recht hatte. Jeffrey war der Polizeichef von Grant County. Sara war die Gerichtsmedizinerin. Bei jedem verdächtigen Tod in einer der drei Städte, die zu Grant County gehörten, hatte sie ihm wieder gegenübergestanden.
Cathy beugte sich über die letzte Einkaufstüte und zog einen Liter Cola heraus. »Und wann hattest du vor, uns einzuweihen?«
»Heute«, log Sara. Der Blick, den Cathy ihr über die Schulter zuwarf, zeigte, dass sie keine besonders talentierte Lügnerin war.
»Irgendwann«, gab Sara zu und trocknete sich die Hände an ihrer Hose ab, bevor sie sich wieder hinsetzte.
»Machst du für morgen einen Braten?«
»Ja«, antwortete Cathy, doch sie war noch nicht fertig. »Du wohnst nicht einmal zwei Kilometer von uns die Straße runter, Sara. Dachtest du, dein Vater kriegt nicht mit, wenn Jeffreys Wagen jeden Morgen vor deinem Haus steht?«
»Was ich da so höre«, warf Bella ein, »würde er da auch stehen, wenn er nicht umgezogen wäre.«
Sara sah ihrer Mutter zu, wie sie die Cola in eine große Plastikschüssel kippte. Cathy würde ein paar Gewürze dazugeben und den Braten dann über Nacht einlegen, um ihn morgen den ganzen Tag schmoren zu lassen. Herauskommen würde das zarteste Fleisch, das jemals auf einem Teller gelandet war, und obwohl es ganz leicht aussah, war es Sara nie gelungen, das Rezept nachzukochen. Es lag eine gewisse Ironie darin, dass Sara die Chemiekurse an der anspruchsvollsten Universität des Landes mit summa cum laude absolviert hatte, der Cola-Braten ihrer Mutter jedoch ein unüberwindliches Hindernis für sie darstellte. Abwesend würzte Cathy die Marinade und wiederholte ihre Frage: »Wann hattest du vor, uns einzuweihen?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Sara. »Wir wollten uns erst mal selbst an die Vorstellung gewöhnen.«
»Glaub nicht, dass dein Dad sich so bald daran gewöhnt«, sagte Cathy. »Du weißt, dass er strikte Auffassungen hat, was solche Dinge angeht.«
Bella brach in schallendes Gelächter aus. »Der Mann hat seit vierzig Jahren keine Kirche von innen gesehen.«
»Es geht hier nicht um Religion«, entgegnete Cathy.
Zu Sara sagte sie: »Wir erinnern uns beide sehr gut, wie sehr du gelitten hast, als du von Jeffreys Seitensprung erfahren hast. Es ist nicht leicht für deinen Vater, dich erst so verzweifelt zu sehen, und plötzlich schneit Jeffrey einfach so wieder herein.«
»Ich würde das nicht gerade plötzlich nennen«, widersprach Sara. Ihre Wiederannäherung war alles andere als einfach gewesen.
»Ich weiß nicht, ob dein Vater ihm das je verzeiht.«
»Immerhin hat Eddie dir verziehen«, warf Bella ein.
Sara sah, wie ihre Mutter blass wurde. Cathy wischte sich die Hände an der Schürze ab, ihre Bewegungen waren steif und kontrolliert. Mit belegter Stimme sagte sie:
»In zwei Stunden gibt es Mittagessen.« Dann verließ sie die Küche.
Bella zuckte die Achseln und seufzte laut. »Ich hab’s versucht, Herzblatt.«
Sara biss sich auf die Zunge. Vor ein paar Jahren hatte Cathy Sara gebeichtet, dass sie während ihrer Ehe eine Affäre gehabt hatte, vor Saras Geburt. Auch wenn ihre Mutter darauf beharrte, dass nie wirklich etwas passiert sei, hatten Eddie und Cathy sich wegen des anderen Mannes beinahe scheiden lassen. Sara konnte sich denken, dass ihre Mutter nicht gerne an diese dunkle Episode erinnert wurde, besonders nicht vor ihrer ältesten Tochter. Sara wurde ja selbst nicht gern daran erinnert.
»Hallo?«, rief Jeffrey aus dem Flur.
Sara versuchte, ihre Erleichterung zu verbergen. »In der Küche«, rief sie.
Als er hereinkam, sah Sara seinem Lächeln an, dass ihr Vater draußen zu beschäftigt gewesen war, um sich Jeffrey vorzunehmen.
»Hallo«, sagte er und sah grinsend von Bella zu Sara.
»Wenn ich hiervon träume, sind wir gewöhnlich alle nackt.«
»Du alter Schwerenöter«, schimpfte Bella, aber Sara sah das Leuchten in ihren Augen. Nach all den Jahren in Europa war sie immer noch durch und durch Südstaatenprinzessin.
Jeffrey nahm ihre Hand und küsste sie. »Du wirst immer schöner, Isabella.«
»Wie alter Wein, mein Freund.« Bella zwinkerte ihm zu. »Solange man ihn trinken kann.«
Jeffrey lachte, und Sara wartete einen Moment, bevor sie fragte: »Hast du Dad gesehen?«
Jeffrey schüttelte den Kopf. Im gleichen Moment knallte die Haustür zu, und Eddies wütende Schritte waren im Flur zu hören.
Sie griff nach Jeffreys Hand. »Lass uns ein bisschen spazieren gehen«, sagte sie und zerrte ihn förmlich zur Hintertür hinaus. Bella rief sie zu: »Richte Mama aus, dass wir pünktlich zum Mittagessen zurück sind.«
Jeffrey stolperte über die Terrassenstufen, als sie ihn vom Haus wegzog, außer Sichtweite der Küchenfenster.
»Was ist denn los?« Er rieb sich die Schulter.
»Tut es noch weh?« Vor geraumer Zeit war Jeffrey angeschossen worden, und trotz der Physiotherapie hatte er manchmal immer noch Schmerzen.
Er zuckte halbherzig die Achseln. »Es geht schon.«
»Tut mir leid.« Sara legte ihm die Hand auf die heile Schulter. Im nächsten Moment hatte sie die Arme um ihn geschlungen und vergrub den Kopf an seinem Hals. Tief atmete sie seinen Geruch ein. »Gott, du fühlst dich so gut an.«
Er strich ihr übers Haar. »Was ist denn los?«
»Ich habe dich vermisst.«
»Jetzt bin ich ja da.«
»Nein«, sie hob den Kopf, um ihm in die Augen zu sehen.
»Die ganze Woche.« Sein Haar war an den Seiten lang geworden, und sie strich ihm eine Strähne hinters Ohr.
»Du kommst, räumst ein paar Kisten rein, und schon bist du wieder weg.«
»Am Dienstag ziehen die neuen Mieter ein. Ich hab ihnen versprochen, dass die Küche bis dahin fertig ist.«
Sie küsste sein Ohr und flüsterte: »Ich wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst.«
»Viel zu tun in letzter Zeit.« Er wich ein Stück zurück. »Papierkram und so. Die Arbeit und das Haus – ich habe kaum noch Zeit für mich selbst, geschweige denn für uns.«
»Das ist es nicht.« Sein defensiver Ton irritierte sie. Sie arbeiteten beide zu viel, und Sara konnte ihm deswegen kaum Vorwürfe machen.
Er trat einen Schritt zurück. »Ich weiß, dass ich ein paarmal nicht zurückgerufen habe.«
»Jeff«, unterbrach sie ihn. »Ich bin davon ausgegangen, dass du zu tun hast. Damit habe ich kein Problem.«
»Womit dann?«
Sie verschränkte die Arme, plötzlich fröstelte sie. »Dad weiß Bescheid.«
Er schien irgendwie erleichtert, und Sara fragte sich, womit er gerechnet hatte.
»Hast du gedacht, wir könnten es geheim halten?«
»Ich weiß auch nicht.« Sie spürte, dass er irgendwas auf dem Herzen hatte, aber sie wusste nicht, wie sie es am besten aus ihm herausbrachte. »Machen wir einen Spaziergang um den See, ja?«
Er warf einen Blick zum Haus, bevor er sie ansah. »Na schön.«
Durch den Garten führte ein gepflasterter Pfad zum Ufer, den ihr Vater noch vor Saras Geburt angelegt hatte. Sara und Jeffrey fielen in vertrautes Schweigen, als sie sich Hand in Hand den Weg am sandigen Seeufer entlang zum Wald bahnten. Beinahe glitt Sara auf einem nassen Stein aus, doch Jeffrey hielt sie fest, über ihre Tollpatschigkeit grinsend. Durch die Baumkronen über ihnen turnten Eichhörnchen, und am Himmel zog ein großer Bussard seine Kreise, die Flügel steif in der Brise, die vom Wasser herwehte.
Lake Grant war ein Stausee, zwölfhundert Hektar groß und stellenweise bis zu einhundert Meter tief. Die Wipfel der Bäume, die einst im Tal gewachsen waren, bevor es geflutet wurde, ragten teilweise noch aus dem Wasser, und Sara musste oft an die verlassenen Häuser da unten denken. Ob sie inzwischen von Fischen bewohnt wurden? Eddie besaß ein Foto aus der Zeit, bevor der See angelegt wurde. Es zeigte eine Ortschaft, die genauso aussah wie alle anderen in der Gegend: hübsche kleine Häuser, manche mit einem Schuppen dahinter. Es gab Geschäfte, Kirchen und eine Baumwollspinnerei, die den Bürgerkrieg und den Wiederaufbau überstanden hatte, nur um während der großen Depression geschlossen zu werden. All das war unter den Wassern des Ochawahee River versunken, damit Grant County mit Strom versorgt wurde. Im Sommer stieg und fiel der Wasserspiegel, abhängig vom Bedarf, den das Kraftwerk zu decken hatte, und als Kind hatte Sara geglaubt, wenn sie im Haus immer fleißig die Lichter löschte und Strom sparte, würde ihr Beitrag helfen, den Pegel zu halten, damit sie Wasserski fahren konnte.
Ein großer Teil des Uferlands war im Besitz der staatlichen Forstwirtschaftsbehörde, über vierhundert Hektar, die sich wie ein Schal um das Wasser schmiegten. Eine Seite des Sees grenzte an das Wohngebiet, in dem Sara und ihre Eltern lebten, auf der anderen schloss sich das Gelände des Grant Institute of Technology an. Sechzig Prozent der hundertdreißig Kilometer langen Uferlinie standen unter Naturschutz, und Saras Lieblingsstelle lag mitten in diesem Gebiet. Es war zwar nicht verboten, im Wald zu zelten, aber das steinige Terrain am Wasser war so uneben und steil, dass es sich nicht als gemütlicher Lagerplatz eignete. Hauptsächlich kamen Teenager hierher, um zu knutschen oder um ihren Eltern zu entfliehen. Von Saras Haus blickte man auf eine spektakuläre Felsformation genau gegenüber, die wahrscheinlich einst den Indianern als Weihestätte gedient hatte, bevor sie vertrieben worden waren. Manchmal sah sie in der Dämmerung ein Licht dort aufblitzen, wenn sich jemand eine Zigarette oder auch etwas anderes anzündete.
Vom Wasser her blies ein kalter Wind, der Sara erschauern ließ. Jeff legte den Arm um sie. »Dachtest du wirklich, sie würden es nicht merken?«
Sara blieb stehen und sah ihn an. »Vielleicht habe ich es einfach gehofft.«
Er grinste sie mit seinem schiefen Lächeln an, und aus Erfahrung wusste sie, dass jetzt eine Entschuldigung folgen würde.
»Es tut mir leid, dass ich so wenig Zeit hatte.«
»Ich bin doch selbst die ganze Woche nicht vor sieben nach Hause gekommen.«
»Hast du das mit der Versicherung klären können?« Sie stöhnte. »Ich habe keine Lust, darüber zu reden.«
»Na gut«, sagte er. Offensichtlich suchte er nach einem Gesprächsthema. »Wie geht’s Tess?«
»Darüber auch nicht.«
»Okay …« Wieder grinste er, und als sich die Sonne im Blau seiner Augen fing, bekam Sara eine Gänsehaut.
Doch Jeffrey verstand ihr Frösteln falsch. »Willst du, dass wir zurückgehen?«
»Nein.« Sie verschränkte die Hände in seinem Nacken.
»Ich will, dass du mich in die Büsche zerrst und über mich herfällst.«
Er lachte, bis er merkte, dass sie es ernst meinte. »Hier draußen?«
»Wir sind ganz allein.«
»Das meinst du nicht ernst.«
»Es ist zwei Wochen her«, stellte sie fest, auch wenn es ihr bis eben gar nicht aufgefallen war. Es sah ihm nicht ähnlich, sich so lange zurückzuhalten.
»Mir ist kalt.«
Sie legte die Lippen an sein Ohr und flüsterte: »In meinem Mund ist es warm.«
Sein Körper reagierte, doch Jeffrey wehrte ab: »Ich bin ein bisschen müde.«
Sara drückte sich fester an ihn. »Den Eindruck machst du aber gar nicht.«
»Sicher fängt es gleich an zu regnen.«
Der Himmel war bedeckt, aber Sara hatte in den Nachrichten gehört, dass es frühestens am Nachmittag regnen würde. »Komm schon«, sagte sie und schmiegte sich an ihn, um ihn zu küssen. Als sie merkte, dass er immer noch zögerte, wich sie zurück. »Was hast du denn?«
Er trat einen Schritt weg von ihr und blickte hinaus auf den See. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich müde bin.«
»Du bist nie müde«, erwiderte sie. »Jedenfalls nicht, wenn es darum geht.«
Er machte eine vage Handbewegung zum See. »Es ist eiskalt hier draußen.«
»So kalt ist es auch wieder nicht«, sagte sie, und plötzlich war das alte Misstrauen wieder da und kroch ihr den Rücken herauf. Nach fünfzehn Jahren kannte sie Jeffrey in- und auswendig. Wenn er ein schlechtes Gewissen hatte, zupfte er sich am Daumennagel, und wenn ihn ein Fall beschäftigte, kratzte er sich an der rechten Augenbraue.
Nach einem besonders harten Tag war er einsilbig und ließ die Schultern hängen, bis sie ihn dazu brachte, darüber zu sprechen. Der Zug, den sie jetzt um seinen Mund sah, bedeutete, dass er ihr etwas zu beichten hatte, aber sich entweder nicht traute oder nicht wusste, wie er es sagen sollte.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Was ist los?«
»Nichts.«
»Nichts?«, wiederholte sie und starrte Jeffrey an, als könnte sie die Antwort aus ihm herauspressen. Er biss sich auf die Lippen und begann, am linken Daumennagel zu zupfen. Plötzlich hatte sie ganz eindeutig das Gefühl, dass sie das hier schon einmal erlebt hatte, und die Erkenntnis traf sie wie ein Presslufthammer. »Ach, verdammt.« Sie schnappte nach Luft, als sie mit einem Mal begriff. »Verdammt noch mal.« Sie legte sich die Hand auf den Bauch, um die Übelkeit zurückzuhalten, die in ihr aufstieg.
»Was?«
Sie machte auf dem Weg kehrt, kam sich dumm vor und war zugleich wütend auf sich selbst. Davon wurde ihr so schwindelig, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.
»Sara …« Jeffrey legte die Hand auf ihren Arm, aber sie stieß ihn weg. Er lief ein paar Schritte voraus und stellte sich ihr in den Weg, zwang sie, ihm ins Gesicht zu sehen.
»Was ist denn los?«
»Wer ist es?«
»Wer ist wer?«
»Wer ist sie? Wer ist es diesmal, Jeffrey? Die vom letzten Mal?« Sie biss die Zähne so fest aufeinander, dass ihr die Kiefer schmerzten. Es passte alles zusammen: sein abwesender Blick, die abwehrende Haltung, die Distanz zwischen ihnen. Diese Woche hatte er jeden Abend einen anderen Vorwand gehabt, nicht bei ihr zu übernachten: Er musste Umzugskartons packen, er musste Überstunden machen, die verdammte Küche fertig bauen, die er seit fast zehn Jahren renovierte. Jedes Mal wenn sie sich ihm öffnete, jedes Mal wenn sie aus der Deckung kam und sich wohlzufühlen begann, fand er einen Weg, sie von sich zu stoßen.
Sara drückte sich klarer aus. »Welche Schlampe vögelst du dieses Mal?«
Er trat einen Schritt zurück, die Verwirrung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Du glaubst doch nicht …«
Sie spürte, wie Tränen in ihr aufstiegen, und begrub das Gesicht in den Händen, um sie zu verbergen. Sie war so wütend, dass sie ihn am liebsten mit bloßen Händen erwürgt hätte.
»Gott«, flüsterte sie. »Ich bin so blöd.«
»Wie kannst du nur so was denken?«, fragte er voller Entrüstung.
Sara ließ die Hände sinken, es war ihr egal, ob er die Tränen sah. »Tu mir einen Gefallen, ja? Lüg mich dieses Mal nicht an. Wag es ja nicht, mich anzulügen.«
»Ich lüge dich nicht an«, beharrte er empört und klang dabei fast so aufgebracht, wie sie es war. Allerdings hätte sie seinen empörten Tonfall überzeugender gefunden, wenn er die gleiche Show nicht schon mal abgezogen hätte.
»Sara …«
»Lass mich in Ruhe«, knurrte sie und marschierte zum See zurück. »Nicht zu fassen. Nicht zu fassen, wie blöd ich bin.«
»Ich betrüge dich nicht«, rief er und lief hinter ihr her.
»Hör zu, okay?« Er versperrte ihr den Weg. »Ich betrüge dich nicht.« Sara blieb stehen und funkelte ihn an. Sie wünschte, sie könnte ihm glauben.
Er sagte: »Sieh mich nicht so an.«
»Ich weiß nicht, wie ich dich sonst ansehen soll.«
Er seufzte laut, als laste ein riesiges Gewicht auf seinen Schultern. Für jemanden, der seine Unschuld beteuerte, hatte er ein ziemlich schlechtes Gewissen.
»Ich gehe jetzt zum Haus zurück«, sagte sie, doch als sie ihn ansah, entdeckte sie in seinem Ausdruck etwas, das sie innehalten ließ.
Er sprach so leise, dass sie genau hinhören musste, um ihn zu verstehen. »Es könnte sein, dass ich krank bin.«
»Krank?«, wiederholte sie, plötzlich von Panik ergriffen.
»Wie, krank?«
Jeffrey ging zurück und setzte sich mit hängenden Schultern auf einen Stein. Jetzt war es Sara, die ihm hinterherlief.
»Jeff?«, fragte sie und kniete sich neben ihn. »Was ist los?« Wieder hatte sie Tränen in den Augen, doch diesmal klopfte ihr Herz vor Furcht, nicht vor Wut.
Von allen Dingen, die er hätte sagen können, war das, was er als Nächstes vorbrachte, das Schlimmste. »Jo hat angerufen.«
Sara lehnte sich auf die Hacken zurück. Sie faltete die Hände im Schoß und starrte mit leerem Blick zu Boden. In der Highschool hatte Jolene Carter all das verkörpert, was Sara nicht war: Sie war anmutig, kurvig und doch schlank, und als beliebtestes Mädchen der Schule hatte sie freie Auswahl bei den süßesten Jungs. Sie war Ballkönigin beim Abschlussball, Kopf des Cheerleader-Teams, Jahrgangsstufensprecherin. Natürlich war sie blond, hatte blaue Augen und einen kleinen Schönheitsfleck auf der rechten Wange, der ihren ansonsten makellosen Zügen einen Hauch von Sinnlichkeit und Exotik verlieh. Und selbst mit fast vierzig hatte Jolene noch einen perfekten Körper – was Sara deswegen so genau wusste, weil es Jo war, die sie vor fünf Jahren, als sie eines Abends nach Hause kam, splitternackt mit Jeffrey in ihrem Bett gefunden hatte.
Jeffrey sagte: »Sie hat Hepatitis.«
Sara hätte laut losgelacht, wenn sie gekonnt hätte. Alles, was sie herausbrachte, war: »Welche Sorte Hepatitis?«
»Die schlimme Sorte.«
»Es gibt mehrere schlimme Sorten.« Sara fragte sich, wie zum Teufel sie in diese Situation geraten war.
»Ich habe außer diesem einen Mal nie wieder mit ihr geschlafen. Das weißt du, Sara.«
Ein paar Sekunden starrte sie ihn an, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, aufzuspringen und davonzulaufen, und dem Drang zu bleiben, um mehr herauszufinden. »Wann hat sie angerufen?«
»Letzte Woche.«
»Letzte Woche«, wiederholte sie, dann holte sie tief Luft: »Wann genau?«
»Ich weiß nicht. Anfang der Woche.«
»Montag? Dienstag?«
»Was spielt das für eine Rolle?«
»Was das für eine Rolle spielt?«, wiederholte Sara ungläubig. »Ich bin Kinderärztin, Jeffrey. Zu mir kommen Kinder – kleine Kinder –, denen ich jeden Tag Spritzen gebe. Ich nehme ihnen Blut ab. Ich fasse ihre Wunden und Kratzer an. Es gibt Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt alle möglichen …« Sie brach ab, als sie nachrechnete, wie viele Kinder sie der Gefahr ausgesetzt hatte, wie viele Spritzen sie gegeben, wie viele Wunden sie genäht hatte. Hatte sie fahrlässig gehandelt? Sie verletzte sich dauernd an den Kanülen. An ihre eigene Gesundheit mochte sie gar nicht denken. Das war einfach zu viel.
»Ich war gestern bei Hare«, erklärte Jeffrey, als würde ihn die Tatsache, dass er nach einer Woche schließlich einen Arzt aufgesucht hatte, rehabilitieren.
Sara presste die Lippen zusammen und versuchte, die richtigen Fragen zu stellen. Sie machte sich vor allem Sorgen um die Kinder, und erst jetzt dämmerte ihr, was das in letzter Konsequenz für sie selbst bedeuten könnte. Vielleicht hatte sie eine chronische, oft genug tödlich verlaufende Krankheit, mit der Jeffrey sie angesteckt hatte.
Sara schluckte. »Hat Hare einen Schnelltest machen lassen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du weißt es nicht«, wiederholte sie. Natürlich wusste er es nicht. Jeffrey litt unter dem typisch männlichen Verdrängungsmechanismus in Bezug auf alles, was mit seiner Gesundheit zusammenhing. Er wusste mehr über die Reparaturgeschichte seines Wagens als über seinen eigenen Körper, und sie sah ihn förmlich vor sich, wie er mit leerem Blick in Hares Sprechzimmer saß, mit nur einem einzigen Gedanken im Kopf, nämlich dem an den schnellsten Weg, da rauszukommen.
Sara stand auf. Sie musste sich bewegen. »Hat er dich untersucht?«
»Er hat gesagt, ich habe keine Symptome.«
»Ich will, dass du zu einem anderen Arzt gehst.«
»Was hast du gegen Hare?«
»Er …« Sara fand die richtigen Worte nicht. Ihr Gehirn verweigerte den Dienst.
»Nur weil er dein verrückter Cousin ist, heißt das noch lange nicht, dass er kein guter Arzt ist.«
»Er hat mir nichts davon erzählt«, sagte sie. Sie fühlte sich von beiden hintergangen.
Jeffrey sah sie an. »Weil ich ihn darum gebeten habe.«
»Natürlich«, stellte sie, weniger sauer als fassungslos, fest. »Aber warum hast du es mir nicht gesagt? Warum hast du mich nicht mitgenommen und mich die richtigen Fragen stellen lassen?«
»Genau deswegen«, sagte er mit Blick auf ihr unruhiges Auf-und-ab-Gehen. »Du hast schon genug Sorgen. Ich wollte nicht, dass du dich aufregst.«
»Das ist Bockmist, und das weißt du.« Jeffrey hasste es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. So direkt er in seinem Beruf sein musste – zu Hause vermied er jede Konfrontation. »Wolltest du deshalb nicht mit mir schlafen?«
»Ich wollte vorsichtig sein.«
»Vorsichtig«, wiederholte sie.
»Hare meint, ich könnte den Virus übertragen.«
»Aber du hast dich nicht getraut, mit mir zu reden.«
»Ich wollte nicht, dass du dich aufregst.«
»Du wolltest nicht, dass ich mich über dich aufrege«, berichtigte sie ihn. »Das hat nichts damit zu tun, dass du mich schonen wolltest. Du wolltest bloß nicht, dass ich sauer auf dich bin.«
»Bitte, hör auf damit.« Er streckte die Hand nach ihr aus, doch sie wich zurück. »Es ist nicht meine Schuld, okay?« Er versuchte es noch einmal von vorne. »Sara, es ist Jahre her. Sie musste mich darüber informieren, ihr Arzt hat darauf bestanden.« Als würde das irgendwas besser machen, fügte er hinzu: »Sie geht auch zu Hare. Ruf ihn an. Er war es, der meinte, sie müsste es mir sagen. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Du bist Ärztin. Du weißt das.«
»Halt«, unterbrach sie ihn und hob die Hände. Sie war kurz davor, Dinge zu sagen, die sie später bereuen würde.
»Ich kann jetzt nicht mehr darüber sprechen.«
»Wo gehst du hin?«
»Ich weiß es nicht.« Sie lief in Richtung See. »Nach Hause«, sagte sie dann. »Du kannst heute bei dir übernachten.«
»Siehst du«, rief er. »Genau deswegen habe ich es dir nicht gesagt.«
»Gib ja nicht mir die Schuld daran«, schoss sie mit erstickter Stimme zurück. Sie wollte schreien, aber sie war so wütend, dass ihr die Stimme versagte. »Ich bin nicht sauer auf dich, weil du herumgevögelt hast, Jeffrey. Ich bin sauer, weil du mir nichts gesagt hast. Ich habe ein Recht, das zu wissen. Selbst wenn es weder mich noch meine Gesundheit noch meine Patienten betrifft – dich betrifft es auf jeden Fall.«
Er lief hinter ihr her. »Aber es geht mir doch gut.«
Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. »Weißt du überhaupt, was Hepatitis ist?«
Er zuckte die Achseln. »Ich dachte, damit beschäftige ich mich, wenn es nötig ist. Falls es nötig ist.«
»Mein Gott«, flüsterte Sara und wollte nur noch weg von ihm. Sie lief in Richtung Straße, sie wollte einen Umweg zu ihren Eltern nehmen, um sich ein wenig zu beruhigen. Das Ganze wäre ein gefundenes Fressen für ihre Mutter, und sie hätte auch noch recht damit.
Jeffrey folgte ihr. »Wo willst du hin?«
»Ich ruf dich in ein paar Tagen an.« Sie wartete nicht auf eine Antwort. »Ich brauche Zeit zum Nachdenken.« Doch Jeffrey holte sie ein und berührte ihren Arm.
»Wir müssen reden.«
Sie lachte bitter. »Jetzt willst du reden.«
»Sara …«
»Da gibt es nichts mehr zu sagen«, erklärte sie und ging schneller. Jeffrey hielt mit. Sie hörte seine schweren Schritte. Sie war beinahe in Laufschritt verfallen, als Jeffrey plötzlich von hinten auf sie fiel. Sie stürzte zu Boden, der unter ihr hohl klang. Der dumpfe Schlag hallte in ihren Ohren nach wie ein Echo.
Sie schob ihn von sich und keuchte: »Was machst du …«
»O Gott, Sara, es tut mir leid. Hast du dir wehgetan?«
Er kniete vor ihr und zupfte ihr einen Zweig aus dem Haar. »Das war keine Absicht …«
»Du Vollidiot«, fauchte sie. Er hatte sie zu Tode erschreckt, und jetzt war sie noch wütender als vorher. »Was zum Teufel ist bloß mit dir los?«
»Ich bin gestolpert«, erklärte er und versuchte, ihr auf die Beine zu helfen.
»Fass mich nicht an.« Sie stieß ihn weg und stand allein auf. Er klopfte ihr den Dreck von der Hose. »Hast du dir wehgetan?«, fragte er noch einmal.
Sara wich vor ihm zurück. »Alles bestens.«
»Sicher?«
»Ich bin ja kein Porzellan.« Als sie die Flecken auf ihrem Sweatshirt sah, knurrte sie. Der Ärmel hatte einen Riss. »Was ist bloß los mit dir?«
»Ich bin gestolpert. Oder denkst du etwa, ich hätte das absichtlich getan?«
»Nein«, gab sie zu, war aber keineswegs besänftigt.
»Gott, Jeffrey.« Vorsichtig belastete sie ihr Knie. »Das hat wirklich wehgetan.«
»Tut mir leid«, wiederholte er und zupfte ihr einen Zweig aus dem Haar.
Sie sah sich den eingerissenen Ärmel an, inzwischen nur noch genervt. »Was ist passiert?«
Er drehte sich um und suchte den Waldboden ab. »Irgendwas war da …« Er unterbrach sich.
Als sie seinem Blick folgte, entdeckte sie das Ende eines Metallrohrs, das aus dem Boden ragte. Mit einem Gummiband war ein Drahtgitter daran befestigt.
Jeffrey sagte nur: »Sara«, doch das Unbehagen in seiner Stimme ließ sie frösteln.
Im Geist spielte sie die Szene noch einmal durch, und wieder hörte sie den seltsamen Schlag, als sie auf den Boden gefallen war. Auf festem Boden hätte der Sturz gedämpfter klingen müssen. Er hätte nicht nachhallen dürfen. Irgendwas war da unter ihnen. Irgendwas war dort vergraben.
»O Gott«, flüsterte Jeffrey und riss das Gitter von dem Rohr. Er versuchte hineinzusehen. Sara ahnte, dass er durch die enge Öffnung nichts erkennen würde. Dennoch fragte sie nach.
»Ist da was?«
»Nein.« Er versuchte, an dem Rohr zu rütteln, aber es gab nicht nach. Irgendwo weiter unten war es fest verankert.
Sara kniete sich hin und begann, Blätter und Kiefernnadeln zur Seite zu schieben. Nach und nach legte sie ein Stück lockerer Erde frei. Zwischen der Stelle, an der sie gefallen war, und dem Rohr lag etwas über ein Meter, und Sara und Jeffrey ahnten gleichzeitig, was da unter ihnen war.
Alarmiert begannen sie beide zu graben. Die Erde war locker, als wäre der Waldboden erst kürzlich umgegraben worden. Sara kniete neben Jeffrey und schaufelte mit den Fingern Erde und Steine beiseite, während sie versuchte, nicht darüber nachzudenken, was sie finden würden.
»Scheiße!« Jeffrey zuckte jäh zurück, und Sara sah einen tiefen Schnitt an seiner Handinnenfläche, in der ein scharfkantiger Holzspan steckte. Die Wunde blutete stark, doch er achtete nicht darauf, sondern grub weiter, tiefer und tiefer, und schüttete die Erde neben sich auf.
Schließlich stieß Sara auf etwas Hartes, und als sie die Hand zurückzog, sah sie ein Brett. »Jeffrey«, rief sie, doch er grub weiter. »Jeffrey.«
»Ich weiß«, murmelte er. Um das Rohr herum hatte er ein Stück Holz freigelegt. Es war mit einer Metallmanschette an einem Brett festgeschraubt. Jeffrey holte sein Taschenmesser aus der Tasche, und Sara sah zu, wie er versuchte, die Schrauben herauszudrehen. Das Blut aus seiner Wunde machte das Messer glitschig, und schließlich gab er es auf, warf das Messer weg und packte das Rohr mit beiden Händen. Er stöhnte vor Schmerz, als er sich mit der Schulter dagegenstemmte, doch er drückte mit aller Kraft, bis das Holz ein bedrohliches Knirschen von sich gab. Das Brett um die Metallmanschette zersplitterte.
Sara hielt sich die Nase zu, als aus der Öffnung ein beißender Gestank entwich.
Das Loch hatte einen Durchmesser von etwa zwanzig Zentimetern, scharfe Splitter ragten wie Zähne aus dem Holz.
Jeffrey beugte sich hinunter. Er schüttelte den Kopf.
»Ich kann nichts erkennen.«
Sara grub weiter. Sie arbeitete sich entlang der Bretter voran, und mit jedem freigelegten Stück Holz wurde ihre Panik größer. Mehrere zwanzig mal sechzig Zentimeter große Planken bildeten den Deckel einer rechteckigen Kiste. Sie war schweißgebadet, trotz des kalten Winds. Ihr Sweatshirt fühlte sich an wie ein Korsett. Sie riss es sich vom Leib, um sich besser bewegen zu können. Vor Angst, was sie entdecken würden, schwirrte ihr der Kopf. Sie betete selten, doch jetzt schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel, egal, wer da oben sie erhören mochte.
»Vorsicht«, warnte Jeffrey und setzte das Rohr als Hebel ein, um die Bretter aufzustemmen. Sara lehnte sich zurück und hielt sich schützend die Hände vor die Augen, als Erde und Schmutz durch die Luft flogen. Das Holz splitterte. Jeffrey begann, mit bloßen Händen an den schmalen Leisten zu reißen. Mit einem dumpfen Knarren gaben die Nägel nach. Säuerlicher Verwesungsgeruch stieg Sara entgegen, doch sie wandte den Blick nicht ab, als Jeffrey sich flach auf den Boden legte und den Arm in die schmale Öffnung streckte.
Er sah ihr in die Augen, während er mit zusammengebissenen Zähnen in der Kiste herumtastete. »Ich fühle etwas«, sagte er. »Hier liegt jemand.«
»Atmet er noch?«, fragte Sara, doch Jeffrey schüttelte den Kopf, bevor sie zu Ende gesprochen hatte.
Jeffrey arbeitete jetzt langsamer. Bedächtig löste er das nächste Brett. Er besah sich die Unterseite, bevor er es an Sara weitergab. Sie konnte Kratzer im Holz erkennen, wie von einem gefangenen Tier. Im nächsten Brett, das Jeffrey ihr reichte, steckte ein Fingernagel, etwa in der Länge ihrer eigenen. Sara legte das Brett zur Seite. Das nächste wies noch tiefere Kratzer auf. Sara ordnete die Bretter nach ihrer ursprünglichen Lage. All das war Beweismaterial. Vielleicht war es doch ein Tier. Ein Lausbubenstreich. Ein alter indianischer Friedhof. Verschiedenste Erklärungen gingen ihr durch den Kopf, während sie zusah, wie Jeffrey eine Planke nach der anderen löste. Jedes Brett bohrte sich wie ein Splitter in Saras Herz. Insgesamt waren es fast zwanzig, doch bereits nach dem zwölften konnten sie erkennen, was sich darunter verbarg. Jeffrey starrte in den Sarg, sein Kehlkopf bewegte sich, als er schluckte. Wie Sara hatte es ihm die Sprache verschlagen.
Das Opfer war eine junge Frau, wahrscheinlich keine zwanzig Jahre alt. Ihr dunkles Haar reichte bis zur Taille und bedeckte einen Teil ihres Körpers. Sie trug ein einfaches blaues Kleid, das ihr bis zu den Waden ging, und weiße Strümpfe ohne Schuhe. Mund und Augen waren weit aufgerissen. Sara konnte ihre Todesangst förmlich schmecken. Das Mädchen hatte eine Hand nach oben gestreckt, die Finger gekrümmt, als würde sie noch immer versuchen, sich den Weg freizukratzen. Im Weiß ihrer Augen waren winzige punktförmige Blutungen, und dünne rote Linien auf ihren Wangen zeugten von längst getrockneten Tränen. Neben ihr lagen mehrere leere Wasserflaschen und eine Art Nachttopf. Außerdem waren da eine Taschenlampe und ein angebissenes Stück Brot. Das Brot war verschimmelt, und auch auf der Oberlippe des Mädchens hatte sich Schimmel gebildet, wie ein flaumiger Schnurrbart. Die junge Frau war keine auffallende Schönheit, doch wahrscheinlich war sie auf ihre ganz eigene, unscheinbare Art hübsch gewesen.
Jeffrey atmete langsam aus und setzte sich auf. Wie Sara war er voller Erde. Wie Sara war es ihm egal.
Sie starrten das Mädchen an, sahen zu, wie der Wind in ihrem dichten Haar und an den langen Ärmeln ihres Kleides spielte. Sara bemerkte, dass sie eine Schleife im Haar trug, die zum Stoff des Kleides passte, und fragte sich, wer sie ihr wohl angesteckt hatte. War es ihre Mutter oder ihre Schwester gewesen? Oder hatte sie in ihrem Zimmer vor dem Spiegel gesessen und sich die Schleife selbst gebunden? Und was war dann passiert? Wie war sie hierhergeraten?
Jeffrey wischte sich die Hände an der Jeans ab und hinterließ dabei blutige Abdrücke. »Die hatten nicht vor, sie umzubringen«, sagte er.
»Nein«, stimmte Sara zu und wurde von unsäglicher Traurigkeit überwältigt. »Sie wollten sie nur zu Tode erschrecken.«
Zwei
In der Klinik hatte man Lena auf die blauen Flecken angesprochen.
»Alles in Ordnung bei Ihnen, Schätzchen?«, hatte die ältere schwarze Schwester gefragt und besorgt die Stirn in Falten gelegt.
Lena hatte automatisch mit Ja geantwortet und gewartet, bis die Schwester den Raum verließ, bevor sie sich weiter anzog.
Als Polizistin hatte sie ständig blaue Flecke: an der Hüfte, wo die Dienstwaffe so massiv auf den Knochen drückte, dass es sich an manchen Tagen anfühlte, als würde die Pistole eine bleibende Delle hinterlassen. Am Unterarm, an dem wie mit blauer Kreide gezeichnet eine dünne Linie verlief, wo sie den Arm gegen das Holster presste, damit nicht gleich jeder Zivilist bemerkte, dass sie eine Waffe trug.
Anfangs war es noch härter gewesen: Rückenschmerzen, Blasen vom Holster, Striemen vom Gummiknüppel, der ihr beim Rennen gegen das Bein schlug, wenn sie einen Täter verfolgte. Manchmal tat es richtig gut, den Knüppel zum Einsatz zu bringen, wenn sie den Kerl schließlich erwischte. Dann zahlte sie dem Arschloch heim, dass sie bei dreißig Grad im Schatten und mit der schweren Ausrüstung am Körper hinter ihm herrennen musste. Und das mit kugelsicherer Weste. Lena kannte Cops – große, kräftige Männer –, die wegen der Hitze vor Erschöpfung ohnmächtig geworden waren. Im August war es so heiß, dass sie alle ernsthaft überlegten, welches das kleinere Übel war: erschossen zu werden oder an einem Hitzschlag zu sterben.
Und trotzdem – als sie zum Detective befördert wurde und Uniform und Mütze ablegen musste, zum letzten Mal das Funkgerät abgab, da vermisste sie das ganze Gewicht. Ihr fehlte die drückende Erinnerung daran, dass sie ein Cop war. Als Detective musste sie ohne Requisiten auskommen. Auf der Straße konnte sie nicht mehr die Uniform sprechen lassen oder den Streifenwagen, bei dessen Anblick der Verkehr langsamer wurde, obwohl sich bereits alle an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Sie musste nun andere Wege finden, die bösen Jungs einzuschüchtern. Dass sie noch immer ein Cop war, daran musste sie sich selbst erinnern.
Als die Schwester in Atlanta sie im sogenannten Erholungsraum allein gelassen hatte, hatte Lena ihre vertrauten blauen Flecken betrachtet und sie mit den neuen verglichen. Fingerabdrücke, die sich wie ein Reif um ihren Arm legten. Ihr Handgelenk war dort, wo es verdreht worden war, angeschwollen. Die Prellung über der linken Niere konnte sie nicht sehen, doch sie spürte sie bei jeder Bewegung.
In ihrem ersten Jahr als Streifenpolizistin hatte Lena alles gesehen. Häusliche Auseinandersetzungen, bei denen Frauen den Polizeiwagen mit Steinen bewarfen, um die Cops daran zu hindern, ihren gewalttätigen Ehemann ins Gefängnis zu bringen. Nachbarn, die mit dem Messer aufeinander losgingen, weil ein Ast über den Zaun hing oder ein Rasenmäher verschwunden war, der meistens in der Garage wieder auftauchte, oftmals neben einem hübschen Vorrat an Marihuana, manchmal härterem Stoff. Kleine Kinder, die sich an ihre Väter klammerten, darum bettelten, zu Hause bleiben zu dürfen, und wenn man sie dann ins Krankenhaus brachte, entdeckten die Ärzte Hinweise auf vaginalen oder analen Missbrauch. Manchmal fanden sie auch Verletzungen tief im Mundraum, Würgemale an der Kehle.
Die Ausbilder an der Polizeischule versuchten, einen auf diese Dinge vorzubereiten, aber gegen manche davon konnte man sich einfach nicht wappnen, man musste sie mit eigenen Augen sehen, man musste sie schmecken, fühlen. Niemand erklärte einem, wie groß die Angst sein konnte, wenn man einen verdächtigen Wagen aus einem anderen Staat zwecks Fahrzeugkontrolle anhielt und einem das Herz bis zum Hals klopfte, während man mit der Hand an der Waffe vom Streifenwagen zur Fahrertür ging und sich fragte, ob der Typ im Wagen seine Hand auch an einer Waffe hatte. In den Büchern waren Abbildungen von Toten, und Lena erinnerte sich daran, wie die Typen in ihrer Klasse sich darüber lustig machten. Über die Frau, die besoffen mit der Nylonstrumpfhose um die Knöchel in der Badewanne ertrunken war. Über den Kerl, der sich mit geöffneter Hose erhängt hatte und bei dessen Anblick man erst nach einer Weile begriff, dass das Ding in seiner Hand keine reife Zwetschge war. Vermutlich war auch er ein Vater, ein Ehemann gewesen, auf jeden Fall der Sohn von jemandem, aber für Generationen von Kadetten war er nur noch der »Zwetschgensack«.
Und nichts von alldem bereitete dich auf die Wirklichkeit vor, ihren Anblick, ihren Geruch. Kein Ausbilder kann dir vermitteln, wie sich der Tod anfühlt, wenn du einen Raum betrittst, sich dir die Nackenhaare aufstellen und du weißt, hier ist etwas Grauenhaftes passiert oder – schlimmer noch – es wird gleich etwas Grauenhaftes geschehen. Kein Chief kann dich vor der schlechten Angewohnheit bewahren, mit der Zunge zu schnalzen, um diesen Geschmack loszuwerden. Keiner hat dir gesagt, dass du noch so oft duschen kannst, aber den Geruch des Todes wirst du nicht los. Und schließlich gehst du täglich fünf Kilometer in der heißen Sonne laufen und ins Fitnesscenter, um den Geruch endlich auszuschwitzen, bis dich der nächste Notruf erreicht – eine Tankstelle, ein liegengebliebener Wagen, ein Nachbarhaus, vor dem sich Post und Zeitungen stapeln –, und du findest die nächste Leiche, eine Großmutter, eine Schwester, einen Bruder oder Onkel, und alles geht wieder von vorne los.
Keiner hilft dir, wenn der Tod in dein eigenes Leben tritt. Niemand steht dir in dieser Trauer bei, wenn bei deinem Einsatz jemand ums Leben kommt – egal, wie erbärmlich dieses Leben gewesen ist. Und genau darum geht es. Als Cop lernst du schnell, zwischen »denen« und »uns« zu unterscheiden. Lena hätte nicht gedacht, dass sie eines Tages einen Verlust auf der Gegenseite betrauern würde, doch in letzter Zeit dachte sie an nichts anderes mehr. Und jetzt hatte sie ein weiteres Leben beendet, war verantwortlich für einen weiteren Tod.
Mit jeder Faser spürte sie seit Tagen den Tod in sich. Sie hatte seinen sauren Geschmack im Mund, jeder Atemzug roch nach Verwesung. Er summte schrill in ihren Ohren, und ihre Haut fühlte sich kalt und feucht an, als hätte sie sie sich vom Friedhof geborgt. Ihr Körper gehörte nicht mehr ihr, ihren Geist hatte sie nicht mehr unter Kontrolle. Von dem Moment an, als sie die Klinik in Atlanta verlassen hatte, über die Nacht im Hotel bis zu ihrer Rückkehr ins Haus ihres Onkels hatte sie an nichts anderes denken können als an das, was sie getan hatte, und an all die Fehler, die sie gemacht hatte, um an diesen Punkt zu gelangen.
Jetzt lag sie im Bett und starrte aus dem Fenster in den trostlosen kleinen Garten hinter dem Haus. Seit Lenas Kindheit hatte Hank nichts mehr am Haus gemacht. An der Decke in ihrem Zimmer war immer noch der braune Wasserfleck, wo einmal im Sturm ein Ast das Dach beschädigt hatte. Die Farbe blätterte von den Wänden, wo Hank die falsche Grundierung benutzt hatte, und die Tapeten waren so nikotingetränkt, dass alle Wände die gleiche gelbbraune Tönung angenommen hatten.
Hier waren Lena und ihre Zwillingsschwester Sibyl aufgewachsen. Ihre Mutter war bei der Geburt gestorben, ihr Vater Calvin Adams war ein paar Monate zuvor bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden. Und vor drei Jahren war Sibyl ermordet worden. Wieder ein Verlust, wieder war Lena im Stich gelassen worden. Vielleicht war ihre Schwester der letzte Anker in ihrem Leben gewesen. Jetzt fühlte sie sich völlig verloren. Sie traf eine falsche Entscheidung nach der anderen und machte sich nicht einmal mehr die Mühe, die Dinge wieder zurechtzubiegen. Sie versuchte, mit den Folgen ihrer Taten zu leben. Vermutlich traf »überleben« es besser.
Lena betastete ihren Bauch, in dem bis vor knapp einer Woche noch ein Baby gewachsen war. Sie allein musste mit den Folgen leben. Sie allein hatte überlebt. Hätte das Kind wie sie den dunklen Teint ihrer mexikanischen Großmutter geerbt oder die stahlgrauen Augen und die helle Haut seines Vaters?
Lena stützte sich auf, schob die Finger in die Gesäßtasche ihrer Jeans und nahm das lange Taschenmesser heraus. Vorsichtig klappte sie die Klinge auf. Die Spitze war abgebrochen, und in einem Halbkreis getrockneten Bluts war Ethans Fingerabdruck.
Sie betrachtete ihren Arm, den dunklen Fleck, wo Ethan sie gepackt hatte, und fragte sich, wie die gleiche Hand, die das Messer gehalten hatte, die ihr so viel Schmerzen bereitet hatte, so zärtlich sein konnte, wenn sie ihren Körper liebkoste.
Die Polizistin in ihr wusste, dass sie ihn verhaften sollte. Die Frau in ihr wusste, dass er böse war. Die Realistin in ihr wusste, dass er sie eines Tages zu Tode prügeln würde. Doch eine andere, unbekannte Seite in Lena widersetzte sich ihrem Verstand, und sie hielt sich selbst für den schlimmsten aller Feiglinge. Sie war nicht anders als die Frau, die mit Steinen nach dem Streifenwagen warf. Sie war wie der Nachbar mit dem Messer. Sie verhielt sich wie das verstörte Kind, das sich an seinen Vergewaltiger klammerte. Sie war es, die fast erstickte an dem, was sie täglich über sich ergehen ließ und herunterschluckte.
Es klopfte an der Tür. »Lee?«
Hastig klappte sie das Messer zu und setzte sich auf. Als ihr Onkel die Tür aufmachte, hielt sie sich den Bauch. Sie hatte das Gefühl, etwas in ihr war zerbrochen.
Hank trat zu ihr ans Bett und streckte die Hand nach ihrer Schulter aus, ohne sie wirklich zu berühren. »Alles in Ordnung?«
»Hab mich nur zu schnell aufgesetzt.«
Er ließ die Hand sinken und steckte sie in die Hosentasche. »Hast du Hunger?«
Sie nickte, die Lippen leicht geöffnet, damit sie Luft bekam.
»Brauchst du Hilfe beim Aufstehen?«
»Es ist jetzt eine Woche her«, wehrte sie ab, als würde das seine Frage beantworten. Man hatte ihr gesagt, sie würde schon zwei Tage nach dem Eingriff wieder arbeiten können, doch Lena war unbegreiflich, wie andere Frauen das schafften. Sie war seit zwölf Jahren bei der Polizei von Grant County, und es war das erste Mal, dass sie Urlaub nahm. Die Ironie darin war zu bitter, als dass sie darüber hätte lachen können.
»Ich habe uns Mittagessen mitgebracht«, sagte Hank. Lena erkannte an seinem frisch gebügelten Hawaiihemd und den weißen Jeans, dass er den Vormittag in der Kirche verbracht hatte. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Es war nach zwölf. Sie hatte fünfzehn Stunden geschlafen.
Hank stand da, die Hände in den Hosentaschen, als wartete er auf etwas.
»Ich komme gleich«, sagte sie.
»Brauchst du irgendwas?«
»Was denn, Hank?«
Er presste die Lippen zusammen und kratzte sich an den Armen, als würden sie jucken. Die Narben der Einstiche, die seine Arme verunstalteten, waren selbst nach so vielen Jahren noch deutlich zu sehen, und sie hasste ihren Anblick. Vor allem hasste sie es, weil es Hank egal zu sein schien, dass seine Narben Lena an all die Dinge erinnerten, die zwischen ihnen standen.
»Ich mache dir einen Teller fertig.«
»Danke«, brachte sie heraus und schob die Beine über die Bettkante. Sie stellte die Füße auf den Boden und versuchte, sich darauf zu konzentrieren, wo sie war, hier in diesem Zimmer. Die letzte Woche war sie in Gedanken woanders gewesen, an besseren, sichereren Orten. Sibyl war noch nicht tot. Ethan Green war noch nicht in ihr Leben getreten. Alles war leichter.
Sie hätte gerne ein langes heißes Bad genommen, aber damit musste Lena noch eine Woche warten. Doppelt so lange durfte sie keinen Sex haben, und jedes Mal wenn sie versuchte, sich eine Ausrede für Ethan auszudenken, kam sie zu dem Ergebnis, dass es leichter wäre, ihn einfach machen zu lassen. Was auch passierte, sie allein war dafür verantwortlich. Irgendwie würde sie bestraft werden für die Lüge, die ihr Leben war.