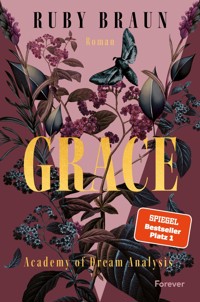
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Academy of Dream Analysis
- Sprache: Deutsch
Wer träumt, sündigt. Wer nicht träumt, stirbt. Die Traumstudentin Nemesis von Winther versucht verzweifelt das Leben ihres einstigen Rivalen Mercury "Mercy" Sterling zu retten. Denn Mercy hat eine tragische Entscheidung getroffen, die ihre aufflammende Liebe unter den Trümmern ihrer Träume begrub und ihn in den Schlund seines Unterbewusstseins verdammte. In den düsteren Hallen der Academy of Dream Analysis im hohen Norden Finnlands muss Nemesis an die Grenzen ihrer Fähigkeiten gehen, um für Mercy zu kämpfen. Doch auch ihre wahren Feinde schlafen nicht, und die Wahrheit über den Tod von Nemesis' Bruder öffnet die Tore zu ihren schlimmsten Albträumen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Grace
Ruby Braun, 1995 in Heilbronn geboren, lebt und schreibt in Köln. An der dortigen Universität studierte sie zunächst Deutsche Sprache und Literatur sowie Medienkulturwissenschaften, dann im Master Theorien und Praktiken professionellen Schreibens. Sie gibt auf Instagram und TikTok Einblicke in ihr Autorinnenleben unter @xrubybraun.
Wer träumt, sündigt. Wer nicht träumt, stirbt.
Die Traumstudentin Nemesis von Winther versucht verzweifelt das Leben ihres einstigen Rivalen Mercury „Mercy“ Sterling zu retten. Denn Mercy hat eine tragische Entscheidung getroffen, die ihre aufflammende Liebe unter den Trümmern ihrer Träume begrub und ihn in den Schlund seines Unterbewusstseins verdammte. In den düsteren Hallen der Academy of Dream Analysis im hohen Norden Finnlands muss Nemesis an die Grenzen ihrer Fähigkeiten gehen, um für Mercy zu kämpfen. Doch auch ihre wahren Feinde schlafen nicht, und die Wahrheit über den Tod von Nemesis' Bruder öffnet die Tore zu ihren schlimmsten Albträumen …
Ruby Braun
Grace
Academy of Dream Analysis
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH Berlin
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München; Joanna Jankowska / Trevillion Images; NSA Digital Archive / Getty ImagesAutorinnenfoto: © John RupprechtE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-95818-845-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
PART I
1 Nemesis
2 Mercy
3 Nemesis
4 Nemesis
5 Mercy
6 Nemesis
7 Nemesis
8 Nemesis
9 Ein Mann aus Asche und Sand
10 Nemesis
11 Nemesis
12 Nemesis
13 Nemesis
14 Mercy
15 Nemesis
16 Nemesis
PART II
17 Nemesis
18 Nemesis
19 Nemesis
20 Nemesis
21 Mercy
22 Mercy
23 Nemesis
24 Mercy
25 Nemesis
26 Mercy
27 Nemesis
28 Nemesis
PART III
29 Mercy
30 Nemesis
31 Nemesis
32 Mercy
33 Nemesis
34 Mercy
35 Nemesis
36 Mercy
37 Mercy
38 Nemesis
39 Mercy
40 Mercy
41 Nemesis
42 Nemesis
43 Nemesis
44 Ein Mann aus Asche und Sand
Epilog Nemesis
Anhang
Dank
Leseprobe: Two Lives to Rise
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Liebe Leser:innen,
Grace ist ein düsterer, abgründiger Roman, der potenziell triggernde Inhalte beinhaltet. Eine Auflistung der Themen findet ihr auf der letzten Seite.Mercys und Nemesis’ Geschichte ist emotional intensiv und gleicht stellenweise einem albtraumhaften Sog. Bitte passt daher gut auf euch auf.
Alles Liebe,Ruby
Für alle, die gnädiger mit sich selbst sein sollten.
Und für meine Schwester Ina.Niemand begegnet wahr gewordenen Albträumen so furchtlos wie du. Ich bin so froh, dass du bei uns bist.
Prolog
Ein Mann aus Asche und Sand
In der Nacht, in der er zurückkehrte, ging ein Raunen durch die Akademie der Träume.
Ein Flüstern wie eine plötzliche Windbö, die den Schnee aufwirbelt und die Flocken durch die Luft jagt. In ihrem Zwinger spitzten die Huskys die Ohren, einige brachen in lautes Gebell aus. Die Rentiere scharrten in ihren Ställen nervös mit den Hufen, die Seeadler schlugen aufgebracht mit ihren majestätischen Flügeln, selbst die Mäuse in der Speisekammer quiekten vor Schreck.
Studierende wie Lehrkräfte zuckten im Schlaf zusammen und wälzten sich unruhig in ihren Betten. All ihre Träume hatten einen unerwartet bitteren Beigeschmack.
Doch er schritt selbstbewusst voran.
Dass die Akademie unter seinem Gewicht zu ächzen schien, verstand er als Willkommensgruß. Silberweißes Mondlicht fiel durch die hohen Rundfenster und wies ihm den Weg zu ihren Räumen.
Seine Faust donnerte gegen die Tür, die sich wenig später öffnete. Aus müden, verwirrten Augen sah sie ihn an, zog ihren Morgenmantel enger um die schmalen Schultern und fragte: »Wer sind Sie?«
Er lächelte. »Es ist schön, dich wiederzusehen.«
Jahre später konnte man es wieder hören, das düstere Raunen, das wie ein kräftiger Luftstoß durch die Gänge wehte, doch ebenso schnell verklang, wie es aufgekommen war. Wieder spitzten die Hunde die Ohren, bellten jedoch nicht. Die Rentiere hoben die Köpfe, senkten sie aber wieder zum Heu hinab, die Seeadler machten sich nicht die Mühe, ihre Flügel aufzuspannen, nur die Mäuse quiekten erschrocken.
In Zimmer Nummer neun des Studierendenhauses schliefen eine junge Frau und ein junger Mann in einem Bett. Sie hatte gerade erfahren, dass ihr tot geglaubter Bruder am Leben war, und schlief vor Erschöpfung tief und fest. Er war so vertraut mit seinen Albträumen, dass er das finstere Flüstern gar nicht bemerkte.
Wären die beiden doch nur in ihrem Schlaf aufgeschreckt, hätten das Raunen gehört und es als Warnung verstanden …
PART I
Eins, zwei –der Sandmann kommt vorbei.
Drei, vier –schließ ab deine Tür.
1 Nemesis
In meiner Vorstellung ist der Tod ein Meister der Masken und präsentiert sich mit unzähligen verschiedenen Gesichtern. Zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe ich ihn in der Gestalt eines kleinen rostrot gefiederten Vogels. Mein Bruder Neiro, meine Mutter und ich verließen das Freibad und betraten den Parkplatz, als ich das Tier auf dem Asphalt liegen sah. »Flieg los!«, rief ich, als ich mich näherte, doch der Vogel erhob sich nicht in die Lüfte, sondern blieb regungslos in der Augusthitze. »Er ist tot, Lucy. Natürlich kann er nicht mehr fliegen«, sagte Neiro, kniete sich neben mich und schob einen Stock unter den Vogel. Als er das Tier herumdrehte, erschrak ich angesichts der dicken Maden, die sich durch den Bauch fraßen. Das Gesicht des Todes vergaß ich nicht mehr.
Dann zeigte er jahrelang das Antlitz meines Bruders. Neun Jahre meines Lebens war Neiro tot, und dieser Umstand bestimmte mein Sein, trieb mich vor sich her, machte aus dem Mädchen Lucy, das ich einst war, Nemesis, seine Rächerin.
Und jetzt, jetzt trägt der Tod das Gesicht des Mannes, in den ich mich verliebt habe. Denn als ich die Lider öffne, halb im Arm des Schlafes, halb in Mercys, und ihn anschaue, denke ich: Er ist tot. Mercy ist tot.
Schwachsinn.
Ich reibe mir die Augen, rücke von ihm ab und stütze mich auf den Ellbogen. Mercys Arm, der bis vor wenigen Sekunden um meine Schultern gelegen hatte, fällt schlaff auf das Laken. Noch immer ganz schummerig vom Schlaf blinzle ich in das diesig graue Licht und schlucke gegen den fahlen Geschmack in meinem Mund an. Als ich den Kopf drehe und mehr von meinem Zimmer erkennen kann, werden ich und meine Erinnerungen wacher.
Und plötzlich ergießt sich eine Erkenntnis wie ein Eimer Eiswasser über mich: Mein Bruder lebt. Ich habe es vor wenigen Stunden in den Erinnerungen der Direktorin Jupiter Sterling gesehen: Neiro ist am Leben.
»Mercy.« Vorsichtig rüttle ich an seiner Schulter, schlage die Bettdecke zurück und komme auf die Knie. Mit einem Mal schlägt mein Herz so schnell, als hätte ich einen Hundertmetersprint und keine Ruhepause hinter mir. Ich will zu Jupiter und mit ihr über das, was ich gesehen habe, sprechen. Sofort. »Hey.« Meine Finger graben sich tiefer in seinen Oberarm, und ich rüttle an ihm. »Wach auf.« Aber Mercy zeigt keinerlei Regung, sodass ich mich über ihn beuge, an beiden Schultern fasse und lauter sage: »Steh auf. Wir müssen zu deiner Tante.« Nichts. Sein Körper und Kopf bewegen sich unter meiner Berührung, doch seine Lider bleiben geschlossen. Angesichts seiner unnatürlichen Blässe verziehe ich irritiert das Gesicht. »Hallo?« Mit der flachen Hand schlage ich leicht gegen seine Wange. »Wach auf!«
Plötzlich habe ich das Gefühl, dass mein rasender Puls nicht mehr meinem Bruder, sondern Mercy gilt.
Er ist tot. Habe ich nicht genau das in meinem benommenen, nicht zurechnungsfähigen Zustand zwischen Schlafen und Wachen gedacht?
Ich lasse von ihm ab und rutsche ans Ende des Himmelbetts. Die Eisenstäbe des Gestells drücken hart und kalt in meinen Rücken, während ich Herz, Atem und Verstand dazu zwinge, sich zu sortieren.
Was ist passiert?
Ich bin in meinem Bett im Zimmer der Akademie aufgewacht. In Mercys Arm. Mein Kopf lag nach wie vor auf seiner Brust, ein kleiner Sabberfleck auf seinem Hemd beweist meinen Tiefschlaf. In den ersten Sekunden habe ich verstörende Todesassoziationen gehabt, vermutlich ist das meine Art zu verarbeiten, dass mein Bruder lebt. Doch jetzt starre ich auf Mercy, der völlig bewegungslos vor mir liegt …
Mit einem Herzschlag, der wie Fausthiebe in meiner Brust schlägt, rutsche ich an ihn heran und versuche es noch einmal, greife nach seinem Oberarm und schüttle ihn.
»Mercy?«
Nichts.
Mit beiden Händen fasse ich nach seinen Schultern und rüttle. »Mercy? Wach auf.«
Nichts.
Schweiß sammelt sich in meinen Handflächen. Vorsichtig schiebe ich die Finger in seinen Nacken und hebe den Kopf an. Seine akkurat geschwungenen Lippen sind geradezu blutleer, seine Haut fahl, fast gräulich.
»Wenn das ein schlechter Scherz sein soll, dann öffne lieber jetzt die Augen als später«, sage ich, doch … nichts.
Ist er …?
Obwohl ich keine Bewegung hinter seinen Lidern wahrnehme, die auf die REM-Schlafphase hindeutet, dominiert schlagartig ein Gedanke in meinem Kopf: Mercy ist in einem seiner Albträume gefangen. Er kommt nicht raus. Er hat die Kontrolle verloren.
Ich liege wieder neben ihm, verschränke unsere Finger miteinander und presse mich eng an ihn.
»Keine Sorge«, flüstere ich mehr zu mir selbst als zu ihm. »Ich hol dich da raus.«
Binnen Sekunden bin ich in einem hypnagogen Zustand und renne die Treppe des Bewusstseins hinauf. Mit jeder Stufe verlasse ich die hypnoseähnliche Ebene und schlafe tiefer ein. Dabei konzentriere ich mich allein auf Mercy, doch das ist keine rationale Entscheidung, die ich treffen muss, es kostet mich keinen Funken Energie. Vielmehr ist alles in mir so von dem Wunsch getrieben, zu ihm zu gelangen, dass ich den Eingang zu seiner Traumwelt bereits sehe, als ich noch nicht einmal die letzte Stufe der Treppe erklommen habe.
Ich spüre den Wind an Haaren und Rock reißen und sehe den dunkelgrauen Schlund, der mich verschlucken will, doch ich gebe mich ihm nur allzu bereit hin. Als ich in den Strudel zu Mercys Träumen gelange, wird mein Puls in den anaeroben Bereich katapultiert, um in der nächsten Millisekunde schmerzhaft hinabzusacken. Mir wird die Sicht genommen, ich rieche den Gestank von verbrannter Erde, weiß jedoch, dass ich jeden Moment durch die wirbelnde Spirale hindurch sein muss.
Doch als ich es bin, traue ich meinen Augen nicht. Denn Mercys Traum ist … leer. Vollkommen leer. Ich stehe im schwarz-weißen Nichts, das merkwürdig flackert und surrt wie ein alter Fernseher, dessen Stecker gezogen wurde.
Mercy träumt … nicht?
Aber … aber …
Im nächsten Moment bin ich wach, schlage die Lider auf und blicke an die stuckverzierte Decke meines Akademiezimmers. Ich schmecke Panik, mein gesamter Mund füllt sich mit dem säuerlichen Geschmack. Als ich erneut auf den Knien bin, packe ich Mercy und schüttle ihn. »Verflucht!« Meine Stimme klingt spröde. »In welchem Zustand du dich auch immer befindest, WACH AUF!«
Mercys Kopf fällt zurück, seine Lider sind geschlossen. Ruckartig ziehe ich die Hände zurück, sodass sein Körper schlaff auf der Matratze liegt.
Verzweiflung mischt sich unter meine Panik. Ich verstehe nicht. Verstehe nicht, dass wir nebeneinander eingeschlafen sind und er jetzt nicht aufwacht. Was …? Ist er …?
Ich springe aus dem Bett, reiße die Zimmertür auf und renne den Gang hinab.
»Esra!« Meine Faust hämmert gegen das Holz. »Esra, bi…«
Als die Tür aufschwingt, falle ich beinahe über die Schwelle.
»Zur Mondgöttin«, flucht sie. »Was ist in dich gefahren?«
»Mercy … er …«, stammle ich nach Luft japsend, während ich in die Richtung meines Zimmers zeige. »Wir … Er …«
In ihrem floral bestickten Morgenmantel tritt Esra aus dem Raum und greift nach meinen Händen. »Beruhige dich. Du hyperventilierst gleich.«
»Mercy braucht Hilfe, ich weiß nicht …«
Sie verstärkt den Druck ihrer Hände und zieht mich näher zu sich. »Sieh mich an.«
Mein Blick springt von Esra den Gang hinab.
»Schau mich an, Nem.«
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, komme ich ihrer Bitte nach. Sie runzelt die Stirn, vermutlich weil sie zu begreifen versucht, was gerade vor sich geht.
Hinter ihr tritt Victoria in den Türrahmen. Sie trägt nur ein T-Shirt, das ihr bis zu den Oberschenkeln reicht, und ihre gesamte Mimik verzieht sich argwöhnisch bei meinem Anblick. »Was ist denn mit dir los?«
Noch immer Esras Hände haltend, stottere ich: »Mercy … er … wacht nicht auf. Wir sind eingeschlafen, und dann bin ich wach geworden, aber er … er liegt in meinem Bett wie … wie …«
Mehr braucht es nicht, um Esra in Bewegung zu versetzen. Sie lässt mich los, holt ihren knallgelben Mantel aus dem Zimmer und sagt zu Victoria: »Bleib bei ihr. Ich hole Jupiter«, während sie bereits den Gang hinab zur Eingangstür des Studierendenhauses eilt.
Ich will ihr nachgehen, doch Victoria fasst nach meiner Schulter und hält mich zurück. »Du hast gehört, was sie gesagt hat. Zeig mir lieber dein Dornröschen, das anscheinend in einen tausendjährigen Schlaf gefallen ist.«
Mir ist nicht nach Lachen, sondern nach Kotzen zumute, so sehr, dass ich mich am liebsten vornüberbeugen und auf den polierten Boden spucken möchte. Doch ich presse nur die Finger in die Seiten und kehre mit Victoria zurück in mein Zimmer. Nachdem sie das Deckenlicht eingeschaltet und die Tür hinter uns geschlossen hat, tritt sie an das Himmelbett heran. Hellgelbes Licht umfließt Mercy; sein Hals liegt frei, sodass mich die Lettern seines Tattoos verspotten: NO MERCY.
Victoria hält ihm einen Finger unter die Nase. »Atem. Wenn auch sehr flach.« Sie beugt sich über ihn und presst ihr Ohr an seine linke Brust. »Herzschlag. Wenn auch sehr langsam.«
Bedeutet das …?
»Dornröschen ist auf jeden Fall nicht tot.« Sie richtet sich auf und sieht auf Mercy hinab. »Hast du es schon mit einer Ohrfeige probiert?«
»Ich habe versucht, ihn zu wecken, aber er …«
Victoria schüttelt unsanft seine Schulter. »Guten Morgen, Mister Sterling.«
Als wäre mein Zimmer nicht mehr meins, verharre ich in der Ecke und wage es nicht, mich dem Bett zu nähern. Als es laut gegen die Tür klopft, ist es Victoria, die sie öffnet.
Ein sauberer, fast steriler Duft, eine hoch taillierte Hose, eine knitterfreie Bluse und der strenge weißblonde Dutt – Jupiter Sterling stürmt in den Raum. Mit wenigen Schritten ist sie bei ihrem Neffen, beugt sich über ihn und betrachtet ihn eingehend, berührt ihn allerdings nicht.
Esra, wieder im Morgenmantel, Victoria im Oversize-Shirt, ich in Rock und Bluse, die Haare zerwühlt vom Schlaf, wir alle starren auf Jupiter in ihrer piekfeinen Aufmachung und warten darauf, dass sie etwas sagt, etwas erklärt, etwas tut.
Als sie sich schließlich zu uns umdreht, ist ihre Miene wie aus Marmor gemeißelt, nur ihre Augen verraten sie. Die Direktorin fixiert mich. »Was ist passiert?«
»Ich … ich weiß es nicht.« Mein Gestammel kommt mir so erbärmlich vor. »Ich …« Soll ich vor Esra und Victoria erwähnen, dass ich in ihre Erinnerungen eingedrungen bin und von dem Gesehenen so erschöpft war, dass Mercy und ich eingeschlafen sind?
Sie muss in meinem Ausdruck lesen, was mir auf der Zunge liegt, denn sie präzisiert: »Was ist danach passiert?«
Danach … Wir sprechen also vom selben Danach, vom Was-ist-nach-dem-Eintritt-in-meine-Erinnerungen-passiert.
»Mercy und ich haben uns in mein Bett gelegt. Er hat mir mein Armband zurückgegeben.« Ich zupfe am Ärmel meiner Bluse, und Jupiter folgt meiner Bewegung; ihr Blick liegt so intensiv auf dem Schmuckstück, das mir mein Bruder einst geschenkt hat, als würde sie es damit in Brand setzen wollen. »Dann bin ich eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, wollte ich ihn wecken, aber er …« Wie ein hilfloses Kind deute ich zum Bett. »Er wacht nicht auf.«
Jupiter sieht zu ihrem Neffen, und für die Hälfte einer Sekunde bröckelt ihre Marmormiene. Ihre Unterlippe zittert, die Nasenflügel beben, Sorgen durchfurchen ihre Stirn. Als sie sich ganz in unsere Richtung dreht, ist ihre Stimme jedoch gefestigt. »Niemand fasst ihn an, habt ihr verstanden? Ihr lasst ihn genau so liegen, bis dein Vater und dein Bruder hier sind, Esra.«
Elios Zwillingsschwester nickt, Victoria hebt unschuldig die Hände, nur ich harre starr in der Ecke des Zimmers.
»Und ihr erzählt niemandem etwas darüber, habt ihr gehört? Kein Wort zu irgendjemandem.«
»Selbstverständlich sagen wir nichts.« Esra tritt hervor und wirft einen Blick auf Mercy. »Aber hast du eine Vermutung, was mit ihm los ist?«
Jupiter presst die Lippen zusammen, doch schließlich antwortet sie: »Ich habe ihn schon einmal so bleich gesehen … so totenbleich.«
»Wann?«, fragt Esra, doch die Direktorin wendet sich von uns ab und ihrem Neffen zu. Als wäre Mercy aus fragilem Glas, lehnt sie sich zögerlich zu ihm hinunter und haucht einen zarten Kuss auf seine Stirn. »Alles wird gut, mein Liebling, hast du gehört? Alles wird gut.« Ihre Worte klingen nicht nach einem Versprechen, sondern nach absoluter Gewissheit. Sie richtet sich auf, streicht ihre Hose glatt und geht zur Tür. »Wenn du dich angezogen hast, erwarte ich dich in meinem Büro, Esra.«
»Natürlich«, antwortet sie und folgt Jupiter, doch auf halbem Weg hält Esra inne und sieht mich mitfühlend an. »Du kannst erst mal in meinem Zimmer bleiben.«
»Oder bei mir«, bietet Victoria etwas steif an.
»Wir klären Nemesis’ Unterkunft, sobald wir Henrique angerufen haben«, bestimmt Jupiter und wartet im Türrahmen darauf, dass wir das Zimmer verlassen.
»Kann ich noch einen Moment bleiben?« Mein Tonfall ist unterwürfig.
Esra und Victoria stehen bereits im Flur, als die tannengrünen Augen der Direktorin auf meine treffen. Sie sieht mich mit so viel bedingungsloser Härte an, dass sie mich für die Länge unseres Blickkontakts an meine Mutter erinnert.
»Bleib einen Moment. Aber wenn sich herausstellt, dass du für seinen Zustand verantwortlich bist, Schlafwandlerin, dann gnade dir die Mondgöttin.«
Damit schließt sie die Tür.
Und ich? Ich schaffe es gerade so zum Bett. Obwohl ich Mercy nicht anfassen soll, greife ich nach seiner erstarrten, kalten Hand und presse sie gegen meine Lippen. Ich spüre die Narben auf der Innenfläche, das kühle Eisen seiner Ringe, meine Tränen, die ich niederringe, denn ich habe heute wahrlich genug geheult.
Ich verstehe es einfach nicht. Noch vor wenigen Stunden lag ich auf dem Theaterboden des Sigismund Schlomo Theatre und habe zum Deckenfresko hinaufgestarrt. Dann kam Mercy und mit ihm so viel wütende Begierde, so viele verlangende Küsse, so viel Lebendigkeit.
Die Wahrheit ist: Ich habe mich in dich verliebt, Nemesis.
Das hat er gesagt. Zwar gequält, aber echt, mit schlagendem Herzen und blutvoller Angst. Dann gab er mir den Mut, mich Jupiter Sterlings Erinnerungen zu stellen. Er war da, er hat mich nicht losgelassen, er war der erste Mensch, mit dem ich geteilt habe, dass mein Bruder lebt. Der erste und einzige Mensch, mit dem ich es teilen wollte.
Und dann? Und jetzt? Bin ich für seinen Zustand verantwortlich? Ist es meine Schuld, dass er nicht aufwacht?
Mercy atmet. Mercys Herz schlägt. Mercy lebt. Und dennoch fühle ich mich, als würde ich an seinem Totenbett kauern.
2 Mercy
Meinen Müttern tiefer in die Katakomben meines Unterbewusstseins zu folgen, fühlt sich an, als würde ich in einen traumlosen Winterschlaf fallen. Mit jedem Schritt spüre ich meine schwächer werdende Atmung, meinen sich verlangsamenden Puls, meine sinkende Körpertemperatur. Ich riskiere einen Blick auf meine blassblauen Hände, auf deren Rücken die Adern noch deutlicher hervortreten, während mein flacher Atem in einer schwarzen Wolke vor mir aufsteigt.
Immer wieder drehen meine Mütter ihre verformten, rauchenden Köpfe nach mir um und heulen, als würden sie mich rufen. Immer wieder flackert eine Emotion am Rand meines Bewusstseins auf, doch ich kann sie nicht greifen. Ist es Angst? Unverständnis? Oder doch Befriedigung? Immer schleppender komme ich voran, bis ich das Gefühl habe, ähnlich wie meine Mütter nur noch über dem Boden zu schweben. Ihre spindeldürren Arme hängen herab, sodass ihre monströsen Krallen tiefe Furchen in den Stein graben, doch sie schreiten unbeirrt weiter. Zu ihrem Meister?
Schimmlige Feuchtigkeit sickert von den dunkelgrauen Wänden.
Tropf, tropf, tropf.
Ein modriger Gestank strömt mir in die Nase, doch es ist fast so, als würde ich mich daran gewöhnen, als würde ich Teil meiner Umgebung werden und ihn nicht mehr als so beißend und übelkeiterregend wahrnehmen.
Meine Mütter gehen voran, und ihr liebender Sohn folgt. Folgt, bis die Nebelschwaden um meine Waden dichter werden. Folgt, bis ich hüfthoch im Dunst gehe und er so schwer wird, dass ich ab der Hüfte abwärts nichts mehr von meinem Körper erkennen kann. Wie Wasser, das in eine Kammer strömt und Zentimeter für Zentimeter an Höhe gewinnt, steigt auch der Nebel an. Bald reicht er mir bis zur Brust, bald spüre ich unter der Kälte nicht einmal mehr meinen schleichenden Herzschlag. Es ist keine klirrende Kälte, keine, die die Zähne zum Klappern bringt, sondern eine, die sich wie eine Faust um mich legt, zudrückt und damit auf eine groteske Art zusammenhält.
Als der Nebel meinen Hals emporkriecht, versucht die Panik, mich am Leben zu halten. Ich spüre, wie das Adrenalin mir eine Hand entgegenstreckt, an der ich mich hochziehen könnte, doch ich brauche keine überhitzte Panik, wenn ich meine eisige Starre habe. Und so lasse ich den Nebel weiter anschwellen, Stück für Stück steigt der Dunst höher, und es ist, als würde ich in ihm ertrinken.
Er nimmt mir Sicht und Gehör. Ich möchte die Arme ausstrecken, um nicht die Orientierung zu verlieren, doch meine Glieder sind zu schwerfällig, und es würde zu viel Energie kosten, sie anzuheben. Wie durch mehrere Lagen Watte nehme ich das Heulen meiner Mütter wahr und halte mich daran fest, gehe darauf zu, schleppe mich hinter ihnen her. Irgendwann höre ich ihre schauerliche Melodie – Mercy, Mercy, Mercy –, doch je dichter und dicker der graue Schleier wird, desto mehr wird ihr grausamer Singsang von einer anderen Stimme überlagert.
Zunächst dringt sie wie ein gedämpftes Echo zu mir hindurch. Vor, dann hinter, doch rechts … oder links von mir? Vor, hinter, links, rechts? Ich bin versucht, mich im zähflüssigen Grau in alle Richtungen umzudrehen, doch plötzlich rast die verzerrte Stimme frontal auf mich zu und trifft mich wie ein schreiender Rammbock.
NICHTS IST SO GEWISS WIE DAS ELEND.
NICHTS IST SO GEWISS.
NICHTS.
Die Worte schlagen auf mich ein, die Frauenstimme brüllt: ELEND, ELEND, ELEND. Und ich? Bin elendig, wie ich weiter voranschreite, mich tiefer und tiefer im Nebel verliere, nichts sehe als das Grau, das feucht auf meiner Haut liegt. Nur die Stimme schneidet durch den dickflüssigen Dunst.
Bewege ich mich überhaupt noch vorwärts? Wo ist dieses Vorwärts? Ich kann meine Mütter nicht mehr hören, weiß nicht, wo sie sind. Wo ich bin. Drehe ich mich nur noch im Kreis um die eigene Achse? Verrückt von der Stimme, die in einem Moment in meinem Hinterkopf widerhallt, im nächsten hinter meiner Stirn pulsiert, in der folgenden Sekunde von weit entfernt zu mir dröhnt.
Nichts ist so gewiss wie das Elend.
Ich irre umher wie eine Nadel in einem Kompass ohne Himmelsrichtungen. Verliere jegliches Zeit- und Raumgefühl. Nichts ist so gewiss wie dieser verdammte Nebel, will ich der brüllenden Stimme entgegenschleudern, doch meine Zunge ist zu ermattet, um Worte zu formen.
Der Duft von Lavendel berührt meine Sinne. Als sich eine zarte Note Vanille daruntermischt, halte ich mich an diesem Geruch fest. In dem feuchten Dunst wirkt er so fremd und verstörend, dass er mir Halt gibt; wie ein blumiges, pudriges Versprechen. Der Schleier lichtet sich. Aber nicht wie ein Vorhang, der endlich fällt, nicht wie eine Nebelbank, die man durchbricht, sondern schleichend. Als sich meine Sicht so weit klärt, dass ich Umrisse erahnen kann, blicke ich auf bewachsene Weite, durch die schemenhafte Gestalten wabern. Der Duft intensiviert sich, wird mit einem Mal so stark, dass er mir in die Nase sticht, während der dickflüssige Nebel langsam ausdünnt, sodass er mir nur noch wie ein Seidentuch um die Schultern liegt.
Gigantische Felder voll Lavendel erstrecken sich vor mir. Zwischen den Büschen wächst eine weitere Pflanze, krautig, mit drei gezackten Laubblättern und weißen Blüten. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass ich selbst ohne den Nieselregen Nässe auf der Haut spüren würde. Ich weiß, dass ich nicht träume, denn ich sehe Farben. Sehe das satte Lila des Lavendels, das von dunkelgrünen Blättern und cremefarbenen Blüten unterbrochen wird. Dunkelrote Wassertropfen glänzen auf den Pflanzen, perlen von Stielen und Blattbewuchs.
Nein. Keine Wassertropfen, sondern …
Ich lecke über meine Unterlippe und schmecke Eisen.
Blut.
Es regnet … Blut.
Zahlreiche ewig Schlafende schreiten durch den Lavendel wie Feldarbeiterinnen durch ihre satte, doch verfluchte Ernte. Ihre geöffneten Schädel sind nicht mehr zu sehen, denn sie tragen tiefschwarze Schleier, die dürren Glieder erscheinen ausgemergelt, die Knie angeschwollen, die Ellbogen wie spitze Winkel.
Willkommen, singen sie in einem scheußlichen Chor. Die weinenden Witwen heißen dich willkommen.
Willkommen in ihrem Reich.
Im Reich der ewig Schlafenden.
Ich suche nach meinen Müttern, doch plötzlich stehen sie dicht vor mir. Gerade als ich vor ihren Klauen zurückweichen will, hebt eine von ihnen ihren stiftdünnen Arm und hält mir einen Zweig Lavendel hin.
Ich starre auf die fragile Pflanze zwischen den pechschwarzen Krallen.
Ein Geschenk?
Ganz langsam hebe ich die Hand, halte nach jedem Zentimeter inne und rechne damit, dass meine Mutter ihren Schleier hochreißt, mich anspringt und ihre vor Gift tropfenden Zähne in mich gräbt.
Doch stattdessen fasse ich mit zwei Fingern nach dem Zweig, und wir berühren uns. Ein elektrisierender Schock zuckt durch mich hindurch, meine Augenlider fallen zu, und ich … sehe, wie ich als kleiner Junge mit meiner Mutter Alba frühmorgens vor dem Fernseher sitze, Cartoons schaue und Pancakes esse.
Ich höre das Schlaflied, das Neptune mir jeden Abend vorgesungen hat. Fühle Albas innige Umarmung und wie sie mir den Kopf küsst. Schmecke keine Angst mehr, nachdem meine Mütter mit mir jeden Winkel der Akademie abgelaufen sind, um mir zu beweisen, dass dort keine Monster lauern.
Keine Monster.
Mit geschlossenen Augen frage ich: »Mum?«
Und sie antwortet: »Du bist zu Hause, mein Kind.«
3 Nemesis
Obwohl Jupiter Sterling umgehend Henrique Barbosa kontaktiert hat, braucht es mehr als einen Tag, bis er und Elio die ADA erreichen. Die herausfordernden Witterungsbedingungen und der starke Schneefall Ende Dezember erschweren ihre Anreise aus Portugal in den hohen Norden Finnlands.
»Dein Nagelbett ist schon ganz blutig«, sagt Esra, die im Schneidersitz auf dem hellblauen Teppich sitzt und mit ihrer Herzdame Victorias Herzsieben schlägt.
»Und wenn du nicht aufhörst, deine Haare um deinen Finger zu wickeln, hast du bald nur noch Knoten.« Mit einem Seufzen stehe ich vom Bett auf und werfe meine Spielkarten auf den Stapel zwischen Esra und Victoria. Es war ein mieser Vorschlag, mit einem Kartenspiel die Wartezeit zu überbrücken, denn ich habe weder zugehört, als Esra die Regeln erklärt hat, noch habe ich einen einzigen überlegten Zug getan. Seit über vierundzwanzig Stunden kann ich mich auf nichts konzentrieren als auf das Unterdrücken meiner Panik, wenn ich an Mercy denke.
»Sie müssen jeden Moment ankommen«, versucht Esra mich zu beruhigen. »Mein Vater hat den frühesten Flug gebucht, den er von Lissabon bekommen konnte.«
Ich gehe durch ihr farbenfrohes Zimmer. Sie hat den getrockneten Lavendel auf dem Schreibtisch in eine hübsche gepunktete Vase gestellt und mit weiteren Trockenblumen ergänzt. Pampasgras, Schleierkraut, Farn und Disteln sorgen dafür, dass das Arrangement fast romantisch wirkt. Bunte Aquarellzeichnungen hängen an den Wänden. Esra ist zweifellos begabt, wenn auch in ihren Motiven eingeschränkt, denn ich erkenne ziemlich oft Victorias Gesicht. Die Bettwäsche ist geblümt, Spitzengardinen hängen vor den Erkerfenstern, und ihre Kleidung ist nicht in dem dunklen Eichenschrank untergebracht, sondern hängt nach Farben sortiert auf einer Kleiderstange.
»Wenn Jupiter deinen Vater so dringend für Mercys Diagnose braucht, dann vermutet sie … was genau? Dass Mercys Zustand durch eure Sternenmagie behoben werden kann?«, frage ich Esra, während ich am Fenster stehe und auf den schwarzen Schnee starre, weil das Mondlicht von Wolken geschluckt wird.
Jupiter hat Mercy aus meinem Zimmer auf die Krankenstation der Akademie bringen lassen. Er wurde wie ein Schwerverletzter mit fixierten Gliedmaßen und Halskrause auf einer Liege abtransportiert. Während des gesamten Prozesses hat unsere Direktorin weder Wort noch Blick an mich gerichtet.
Denkt sie wirklich, dass ich für Mercys Zustand verantwortlich bin? Dass ich durchgedreht bin, nachdem ich in ihren Erinnerungen gesehen habe, dass sie Neiro nicht mit einer Überdosis Schlafmohn getötet hat? So durchgedreht, dass ich ihrem Neffen was genau zugefügt habe? Das kann Jupiter unmöglich glauben. Auch wenn unser Verhältnis nach wie vor angespannt ist, hat sie mich dazu aufgefordert, erneut in ihre Erinnerungen einzudringen, was bedeutet, dass sie mir auf die ein oder andere Art vertrauen muss.
»Ich weiß es nicht«, antwortet Esra und weicht mir mit dieser Aussage wiederholt aus. Seit Stunden versuche ich, mehr Informationen aus ihr herauszubekommen. Im Wandschrank in Sterlings Büro befindet sich fluide Sternenmagie. Ich selbst habe von der Tinktur profitiert, nachdem mir die Kreaturen aus Mercys Albtraum das Bein aufgeschlitzt hatten, denn es war das Wundermittel der Barbosas, das meine Verletzung in beängstigender Geschwindigkeit geheilt hat. Warum verabreicht Jupiter ihrem Neffen dann nicht selbst die Tinktur? Warum wartet sie auf Henrique Barbosa, während sie Mercys Vitalfunktionen streng ärztlich überwachen lässt, als könnte er jeden Moment von dieser Welt scheiden?
Ich schmecke Blut auf der Zunge, als ich die Haut an meinem Daumen mit den Zähnen zu tief einreiße.
Verdammt. Das alles ist so verwirrend und verstörend, ich fühle mich rat- und hilflos, doch am meisten stemme ich mich gegen die Panik, in die ich am liebsten ausbrechen würde. Mercy liegt da wie tot. Nachdem er mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat. Dass er sich für mich entschieden hat. Dass er mich nicht damit allein lässt, dass Neiro die Nacht vor der Wahl der stellvertretenden Akademieleitung überlebt hat.
Neiro.
Nachdemmir Jupiter Sterling ihre gesamte Erinnerung an jene Nacht gezeigt hat, habe ich eine goldwarme, mächtige Mischung aus Überwältigung, Freude und purer Erleichterung empfunden. Doch bereits einen Tag später ist nicht mehr viel meines Glückstaumels übrig, denn der Gedanke an meinen Bruder wird mittlerweile von unzähligen schmerzhaften Fragen getrübt.
Wenn Neiro tatsächlich noch lebt, warum hat er sich in den letzten bald zehn Jahren nicht gemeldet? Kein einziges Mal? Selbst wenn er in seiner herausstechenden Stellung als Schlafwandler mit der Welt der Traumgeborenen brechen wollte und untergetaucht ist, hätte er zumindest mir einen Hinweis auf sein Überleben geben können. Schließlich wäre es ein Leichtes für ihn gewesen, sich in meine Träume zu begeben und so im Geheimen Kontakt zu mir aufzunehmen. Er muss doch wissen, dass ich für ihn geschwiegen hätte, dass es aber mir – und Lucy – die Welt bedeutet hätte, von ihm zu hören.
Es sei denn, er hatte nie die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Weite Teile der Traumgeborenen treten Schlafwandelnden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten noch immer feindselig gegenüber, weshalb ich Schlimmes befürchte. Neiro könnte sich in Gefangenschaft befinden und gegen seinen Willen festgehalten werden. Oder ist er womöglich … doch tot? Umgebracht – zwar nicht von Jupiter Sterling, aber von jemand anderem?
Als ich die Direktorin gefragt habe, ob sie meinen Bruder auf dem Gewissen hat, verneinte sie das, fügte jedoch hinzu, dass sie sich wünschte, sie hätte ihn damals getötet. Ich muss Jupiter damit konfrontieren. Ganz gleich, wie eingenommen wir beide von Mercys besorgniserregendem Zustand sind, ist sie mir Antworten schuldig.
Ich habe drei absichtlich verpasste Anrufe meiner Mutter auf dem Handy, aber ich kann mich ihr in meiner Verwirrung und Sorge nicht stellen. Sie würde sofort merken, dass etwas mit mir nicht stimmt, und ich habe das Gefühl, dass eine außer sich geratene Augusta von Winther alles nur schlimmer machen würde. Andererseits wird mein schlechtes Gewissen beim Blick auf mein Telefon gigantisch, denn trotz allem verdient Mama die Wahrheit über den angeblichen Tod ihres Sohnes.
Plötzlich steht Victoria neben mir am Fenster. »Dornröschen wird wieder aufwachen, Nemesis.«
Ich möchte ihren rauen Tonfall als zuversichtlich interpretieren, doch dann sehe ich sie von der Seite an, und es scheint, als wäre jegliche Hoffnung aus ihrem bleichen Gesicht gewichen. Schwarz-lila Ringe liegen unter ihren Augen. Ich bin anscheinend nicht die Einzige, die schon länger nicht mehr gut geschlafen hat. Ihre sonst glänzenden rosa Lippen sind spröde. Mein Blick geht zu Esra, die immer noch auf dem Teppich sitzt und die Spielkarten mischt.
Das wiederholte Sigillenritual ist nicht einmal zwei Tage her, und dennoch kommt es mir vor, als wären wir nicht mehr dieselben. Ich aus offensichtlichen Gründen: Neiro soll am Leben sein, aber Mercy … Nein. Ich verbiete mir diesen Gedanken. Mercy atmet und sein Herz schlägt.
Doch auch Victorias Welt ist vornübergekippt und hat sich elendig zu ihren Füßen ergossen. Denn während des Rituals haben wir den Versuch unternommen, unsere tiefsten Wünsche zu manifestieren, doch was wir bekommen haben, waren keine seidigen, strahlenden Zukunftsvisionen, sondern schmerzhafte Wahrheiten.
Esra ist krank. Sie leidet am Charcot-Wilbrand-Syndrom, was bedeutet, dass sie ihre Fähigkeit zu träumen verloren hat. Für normale Menschen ist das nicht tödlich, aber für Traumgeborene wie uns ist es ein schleichendes und unaufhaltsames Ende.
Victoria sieht Esra an, als wäre sie all das Gute und Warme in dieser Welt, als wäre sie Sonne, Frühling, Blumenduft, frisches Gebäck und eine feste Umarmung in einem. Aber nicht so, als wäre Esra eine naive Träumerin, die die Augen vor der Realität verschließt, sondern so, als wäre sie sich der harten, ruchlosen Wirklichkeit nur allzu bewusst und würde gerade deswegen wissen, wie lebensnotwendig es ist, Wärme zu teilen.
Auch jetzt liegt dieser Ton in Victorias Augen, doch er wird überschattet von Wut und Verzweiflung. Denn bis zum Sigillenritual wusste sie nichts von Esras Krankheit. Ich auch nicht, aber anders als Victoria habe ich mich weder in Esra verliebt noch mit ihr geschlafen. Stattdessen ist mir ihr schwieriger Gesundheitszustand zwar aufgefallen, aber ich war seit unserer ersten Begegnung so selbstbezogen, nie auch nur nachzufragen.
Das Schweigen zwischen uns ist niederdrückend. Nachdem Esra und Victoria nach München geflogen sind, um mich nach der verheerenden Wintersonnwendfeier zurück an die ADA zu holen, habe ich einen Moment echter Freundschaft verspürt. Schließlich sind sie für mich gekommen … wegen mir.
Ich räuspere mich und frage befangen: »Wie geht es euch?«
»Wie es uns geht?«, schnaubt Victoria ungehalten. »Frag das am besten unsere Meisterlügnerin.«
»Ich habe nicht gelogen!« Esra wirft die Karten mit solcher Wucht auf den Teppich, dass der Stapel verrutscht. Ihre Augen sind genauso grau-violett unterlaufen wie unsere, doch das Funkeln darin ist voller Energie.
»Nicht gelogen?« Mit der angelehnten Schulter stößt sich Victoria vom Erkerfenster ab und geht auf den Teppich zu. »Deine CWS-Erkrankung so lange zu verschweigen, das kommt einer Lüge gleich.«
Einen neuerlichen Streit wollte ich zwischen den beiden zwar nicht auslösen, aber vermutlich ist die Situation so explosiv, dass es beinahe egal ist, wer das Streichholz hinhält.
»Ich verstehe deinen Frust, aber er bringt uns überhaupt nicht weiter«, sagt Esra gebremster.
»Meinen Frust?« Victorias braune Augen treten fast aus ihren Höhlen. »Meinen Frust?«
Wenn ich Esras milderen Tonfall als Schlichtungsversuch interpretiert habe, liege ich damit falsch. Denn sie steht aus ihrem Schneidersitz auf, wirft ihr fliederfarbenes Haar über die Schultern und faucht: »Nenn es Wut, Angst, Hilflosigkeit. Nenn es meinetwegen auch Liebe. Aber deine Reaktion auf mein Verschweigen kann noch so kämpferisch und rasend sein, sie wird mich nicht heilen.«
»O ja«, Victoria hebt abfällig die Hände in die Luft, »erleuchte mich mit deinen Weisheiten, Esra Barbosa. Natürlich wird dich nichts, was ich für dich empfinde, heilen. Nichts davon. Und dennoch fühle ich es, dennoch kommt mir das Kotzen, wenn ich in dein unverschämt schönes Gesicht sehe, und weiß, dass … dass …«
Esras Mundwinkel zuckt. »Dir kommt das Kotzen, wenn du mich ansiehst? Wie schmeichelhaft.«
Die beiden sind kurz davor, sich entweder an die Gurgel zu gehen oder sich die Kleider vom Leib zu reißen. Vielleicht auch beides, wenn ich in Betracht ziehe, wie Victoria Esra ansieht.
Ich möchte mich gerade bemerkbar machen und vom Fenster wegtreten, als es an der Tür klopft. Ein lauter Faustschlag hämmert gegen das Holz, und ehe Esra »Herein« sagen kann, öffnet sich die Tür.
Elio steht im Zimmer. Obwohl er versucht, seinen Atem zu drosseln, hebt sich sein Brustkorb so schnell, als wäre er gerannt. Schmelzender Schnee glänzt in seinen nachtschwarzen Locs, er trägt einen wadenlangen Wollmantel, dazu lederne Fingerhandschuhe und einen rot karierten Schal.
Nachdem er sich während des Sigillenrituals heftig mit seiner Zwillingsschwester gestritten hatte, war er nach Portugal geflogen und wollte den Jahreswechsel eigentlich auf dem Anwesen seiner Familie verbringen. Doch nun liegt sein bester Freund auf der Krankenstation, und ich frage mich, ob es Elio überhaupt nach Hause geschafft oder am Flughafen kehrtgemacht hat und direkt den Rückflug angetreten ist?
Seine lagunenblauen Augen finden nicht Victoria, er sieht auch nicht als Erstes zu seiner Schwester, sondern zu mir. Sein Blick trifft mich wie ein Pfeil ins Herz, denn ich sehe meine Angst um Mercy in seinem fiebrigen Ausdruck. Tränen schießen mir in die Augen, so unvermittelt und heftig, dass ich sie kaum zurückdrängen kann.
In wenigen großen Schritten durchquert er das Zimmer, nimmt mich an den Schultern und drückt mich an seine Brust. Unter meiner Wange spüre ich seinen feuchten Mantel und die Härte seiner Muskulatur, ich rieche Zedernholz und kalte Orangenblüte, fühle, wie er die Arme um mich schließt, um mich so zusammenzuhalten, wie er es sicherlich viele Male bei Mercy getan hat.
»Wir holen ihn zurück«, sagt er, der Bass seiner Stimme noch tiefer als sonst.
Ich nicke, während sich eine Träne aus meinem Augenwinkel stiehlt und über meine Wange läuft. »Wir müssen, Elio, wir müssen.«
Wenig später betrete ich zum ersten Mal die Krankenstation der Academy of Dream Analysis. Der Bodenbelag ist hellgrau, die Wände sind weiß verputzt, die in die Decke eingelassenen LED-Leuchten verströmen ein steriles klinikweißes Licht. Es riecht nach Desinfektionsmittel mit einer zitronigen Note, was mich unweigerlich an den Geruch in Jupiter Sterlings Gedächtnisbibliothek erinnert. Mein Blick schnellt zu ihr. In enger schwarzer Hose und einer frackähnlichen Jacke schreitet sie neben Henrique Davi Barbosa rechts außen den Flur entlang. Elio, Esra und ich halten etwas Abstand und gehen hinter ihnen.
Der Krankenflügel befindet sich wie auch die Feuerwehr im Verwaltungskomplex der Akademie. Im Vergleich zum Rest der Gebäude, den imposanten, klassizistischen Bauten mit Säulen, Reliefs und viel Marmor, ist die Verwaltung modern und gerade deswegen wie aus der Zeit gefallen. Alles wirkt rational, effizient und schmucklos, so auch die Krankenstation.
Am Ende des Flurs befindet sich eine Tür, die sich erst öffnet, nachdem Jupiter eine Klingel betätigt hat.
»Bitte desinfiziert eure Hände«, weist uns Mister Barbosa an, als wären wir Kinder, doch wir folgen protestlos und betreten anschließend die Intensivstation, die nur aus einer Handvoll Zimmern besteht.
Mein Herz ist taub. Ich weiß, dass es schlägt, doch ich fühle es nicht. Zu wissen, dass Mercy hier liegt – auf der Intensivstation, als wäre er ein akuter Notfall –, lässt mir keine andere Möglichkeit, als so viel Abstand wie möglich zu meinen Emotionen zu nehmen, weshalb ich mich merkwürdig leer und hohl fühle, als ich als Letzte sein Zimmer betrete.
Er wird nicht beatmet, aber ein Monitor überprüft seine Vitalfunktionen. Da mein Vater Chirurg ist und ich über laienhaftes Wissen verfüge, kann ich ablesen, dass Mercys Herzfrequenz und sein Blutdruck zu niedrig sind. Außerdem schockiert mich seine Temperatur, die mit etwas über 35 Grad Celsius viel zu gering ist.
Die Tür schwingt auf. »Guten Abend«, grüßt die Oberärztin, hinter der eine weitere Frau in blauem Kasack den Raum betritt.
»Hat sich sein Zustand verbessert, Doktor Kaya?« Jupiters sonst so joviale, zuvorkommende Art ist stringenter Präzision gewichen. Sie scheint keinerlei Wert auf höfliches Geplänkel und Eis brechenden Small Talk zu legen, stattdessen sieht sie mit streng gehobenen Brauen zu der Ärztin.
Diese schüttelt den Kopf. »Nein, leider nicht. Nach wie vor können wir nicht genau sagen, was Ihrem Neffen widerfahren ist. Sein Zustand ist dem eines Komas irgendwie ähnlich, doch er befindet sich in keinem klassischen Koma.« Sie tritt an den Monitor heran, und als sie Mercys Werte abliest, runzelt sie die Stirn. »Meistens tritt ein Koma auf, wenn es sich um eine lebensbedrohliche Beeinträchtigung der Hirnfunktionen handelt. Die Betroffenen verlieren Wachheit und Bewusstsein, sind auch durch starke äußere Reize nicht aufzuwecken. Letzteres trifft auf Ihren Neffen zu, Direktorin Sterling, aber wir nehmen noch ausgeprägte Aktivität in seiner Großhirnrinde wahr, die eine maßgebliche Rolle für das Bewusstsein spielt.«
Mit einer Handbewegung fordert Doktor Kaya die andere Frau auf hervorzutreten. Auf ihrem Namensschild lese ich: Helena Vlachos, Pflege. Sie ist jung, kann nicht viel älter sein als die Barbosa-Zwillinge und ich, ihre Augen schimmern goldgelb, und ihre sonnenblonden Haare umrahmen in feinen Locken ihr herzförmiges Gesicht. Obwohl der Kasack nicht sonderlich figurbetont geschnitten ist, erinnert sie mich an eine kurvenreichere Version von Botticellis Venus.
Die Pflegerin reicht ein Blatt Papier an die Ärztin weiter, nicht ohne meinen musternden Blick zu bemerken. Ihre Augen liegen abwartend auf mir, nicht unfreundlich oder ablehnend, doch so, als wollte sie mir signalisieren, dass sie mein Starren nicht nur bemerkt, sondern so lange erwidert, bis ich es bin, die sich abwendet.
»Das Elektroenzephalogramm zeichnet Mercurys Gehirnaktivität auf.« Doktor Kaya zeigt Jupiter den Ausdruck, auf dem zahlreiche Wellenmessungen abgebildet sind. »Vermutlich kann man seinen Zustand am ehesten mit einem Sopor vergleichen. Das ist eine Form der Bewusstseinsstörung, bei der Patienten nicht mehr durch äußere Reize aufgeweckt werden können, jedoch noch ungezielte Abwehrbewegungen machen oder unverständliche Laute von sich geben. Bei Mercury scheinen noch bestimmte Funktionen des Hirnstamms zu funktionieren, er kann schlucken und selbstständig atmen, weshalb er sich in einem vegetativen Zustand befindet.« Sie reicht das Papier zurück an Helena, die es auf ihrem Klemmbrett befestigt, und tritt nah an den Monitor links von Mercys Bett heran.
»Seine Körpertemperatur ist besorgniserregend niedrig«, fährt die Ärztin fort.
Seit Betreten des Zimmers habe ich es nicht gewagt, ihn anzuschauen. Ich möchte an meiner Taubheit festhalten, möchte nur die medizinischen Fachbegriffe hören und nicht das Wehklagen meines Herzens. Doch sobald meine Augen auf ihm liegen, fängt mein gesamter Körper an zu kribbeln. Es ist kein angenehmer Schauer, es ist vielmehr so, als hätte ich mich vergiftet und mein Körper würde unter der Toxizität anfangen zu bitzeln.
Mercys schwarzes Haar hebt sich deutlich vom muschelweißen Kissenbezug ab. Seine Hautfarbe hat einen gespenstisch blauen Unterton angenommen, seine Lippen – die schönsten aller Lippen – sind an den Mundwinkeln leicht eingerissen. Die Bettdecke zieht eine akkurate Linie von Schulter zu Schulter, das offen liegende Tattoo an seinem Hals wirkt noch düsterer und knochiger.
»Weitere Tests werden folgen«, sagt die Doktorin. »Wir warten gerade auf seine Blutwerte und die Ergebnisse zum Nervenwasser. Aber das«, sie wendet sich vom Bett ab und blickt in unsere stille Runde, »ist nur die medizinische Betrachtungsweise seines Zustands.« Ihr Blick schweift über Jupiter und die Zwillinge hinweg zu Mister Barbosa. »Es ist sicherlich ratsam, die Grenzen der weltlichen Medizin zu überschreiten und andere Erklärungen für Mercurys Befinden zu diskutieren.«
Henrique Barbosa nickt und tritt hervor. »Danke, Doktor Kaya.« Er legt seine Hand auf das Gestell des Krankenbetts, als würde er sie auf Mercys Schulter platzieren wollen. Sein Ausdruck ist schwer vor Sorge und Mitgefühl. »Die neurologische Expertise ist unabdingbar, aber vielleicht nicht zielführend.«
Die Oberärztin der Krankenstation ist vermutlich ein gutes Beispiel für all diejenigen unter den Traumgeborenen, die keine luziden Träumenden auf höchstem Niveau werden. So wie mein Vater kommt Dr. Kaya zwar aus einer Familie Traumgeborener und hat vermutlich ihr Grundstudium an der ADA absolviert, aber dann einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Alle Beschäftigten der Akademie – vom Personal im Speisesaal über die Pflegenden der Rentiere, Huskys und Seeadler bis zur Oberärztin – stammen aus traumgeborenen Familien, haben sich aber dagegen entschieden, ihre akademische Laufbahn so weit zu treiben, einen Nexus zu kreieren und mit dessen Hilfe die Realität zu beeinflussen.
Über die dreijährige Nichte der Oberärztin – Rana Kaya – wird jedoch spekuliert, ob sie nicht wie ich schlafwandlerische Fähigkeiten besitzt, doch das Kind ist noch zu jung, um das sicher sagen zu können.
»Würden Sie uns einen Moment allein lassen?« Jupiter stellt eine formale Frage, doch ihr Ton verrät die Anweisung darin.
»Natürlich«, erwidert Doktor Kaya umgehend und gibt der Pflegerin mit einem Kopfnicken zur Tür zu verstehen, dass sie ihr folgen soll.
»Was starrst du ihr so nach?«, höre ich Esra aggressiv flüstern. »Das ist super unangenehm.«
»Ich starre nicht«, entgegnet Elio, doch auch ich bemerke den Blick, mit dem er Helena Vlachos so lange bedenkt, bis sich die Tür hinter ihr und der Oberärztin schließt.
Obwohl sie kein Wort gesagt hat und es ihr ihre Arbeitskleidung nicht einfach macht, hat sie eine Aura versprüht, die nicht sonderlich warm, aber definitiv golden war. Es scheint, als hätte auch Elio ihre göttinnenähnliche Ausstrahlung bemerkt.
Jupiter geht ans Kopfende des Betts und stellt sich vor Mercy, als wollte sie ihn beschützen. »Was denkst du, Henrique?«
Esras und Elios Vater nimmt die Hand vom Gestell und legt sie an den Knoten seiner erdbeerroten Krawatte. Er rüttelt leicht daran, als würde er schlecht Luft bekommen. »Du weißt, was ich denke. Deswegen hast du mich umgehend kontaktiert.«
Die Direktorin schweigt, sieht nur in das Gesicht ihres Neffen und lässt eine Regung zu. Für wenige Sekunden bröckelt ihre Härte, gequält zieht sie die Brauen zusammen, und Tränen glänzen in ihren Augen. Als sie die Lider schließt, sehe ich, wie eine von ihren Wimpern perlt und über ihre Wange bis zum Kinn läuft. Harsch wischt sie die Träne mit dem Handrücken weg.
»Ihr glaubt, dass Sternenmagie helfen könnte«, schlussfolgert Esra nach Minuten des Schweigens. »Deswegen sollten Elio und mein Vater sofort anreisen. Aber wenn Sternenmagie hilft, dann … dann …« Sie sieht unsicher zu mir. Vermutlich wägt sie ab, was sie vor mir sagen kann und wie viel ich weiß.
»Dann spielen auch die ewig Schlafenden eine Rolle«, beende ich ihren Satz.
Bis vor Kurzem habe ich geglaubt, dass die ewig Schlafenden nur Teil der spirituellen Weltanschauung der Barbosas sind. Meine Mutter hat ihren Glauben an die ewig Schlafenden stets als »primitiven Totenkult« bezeichnet und darüber gespottet. Doch dann bin ich in Mercys Albtraum eingedrungen und wurde Zeugin von den Höllenkreaturen, die ihn Nacht für Nacht jagen. Als eines der dämonenhaften Wesen in seinem Traum mein Bein aufschlitzte und ich verwundet in meinem Akademiebett aufwachte, wusste ich, dass Mercys Monster nicht nur Fiktion innerhalb seiner Traumwelt sind, sondern weit mehr als imaginär sein müssen. Denn meine Wunde war echt, sie blutete mein Laken voll und musste umgehend behandelt werden. Wenn ich mich auf die Erinnerung einlasse, spüre ich wieder diese feuerheiße Hitze, die sich in meinem ganzen Körper ausgebreitet hat.
Mercy verarztete meinen Oberschenkel mit fluider Sternenmagie. Die silberglänzende Flüssigkeit stammt aus einem Baum auf dem Land der Barbosas in ihrer Heimat Portugal. Laut Mercy ist alles an diesem Baum magisch aufgeladen, von den Wurzeln über den Stamm bis zur Blätterkrone. Er soll im Gegensatz zu anderen Pflanzen nicht tagsüber mithilfe des Sonnenlichts Fotosynthese betreiben, sondern nachts durch das Mond- und Sternenlicht. Die silbrige Tinktur hat nicht nur mein Bein gerettet, sie hat mich auch von der Wirksamkeit der Sternenmagie überzeugt und mich gleichzeitig fragen lassen, was für eine Teufelsbrut Mercys Albträume bewohnt, die die Grenzen der fiktiven Traumwelt verlassen kann. Die Antwort: Es sind die ewig Schlafenden.
Nicht nur Esra sieht mich fragend an, sondern auch Elio und ihr Vater. Unter ihren skeptischen Blicken steigt Röte in meine Wangen. Vermutlich sehen sie mich als Augusta von Winthers Tochter nicht gerade auf ihrer Seite.
»Mercy …«, sein Name schwankt zittrig über meine Lippen, weshalb ich mich räuspere, »hat mir davon erzählt. Dass es sich bei den ewig Schlafenden um Wesen handelt, die im Kern Projektionen unverarbeiteter Trauer sind. Es ist kein Totenreich im eigentlichen Sinne, nicht alle Verstorbenen von Traumgeborenen werden nach ihrem Tod zu ewig Schlafenden, sondern nur die, die von ihren Hinterbliebenen nicht losgelassen werden kö…« Ich stocke, und der Schock fährt mir so tief in die Knochen, dass ich erstarre. »Nein.«
»Doch.« Mister Barbosa geht um das Bettende herum, hält jedoch Abstand zu Jupiter Sterling. Er legt eine Hand auf Mercys Bettdecke und sieht stur auf seine Finger hinab, als er sagt: »Ich hätte früher reagieren sollen. Als ich die Einführung in Astrologie und Traumdeutung gegeben habe, hat mich Mercury auf dem Flur aufgehalten.« Seine Stimme klingt vorwurfsvoll und überhaupt nicht mehr souverän.
Jupiter macht einen fordernden Schritt auf ihn zu. »Meinst du eure Unterhaltung vor meinem Büro? Als ich euch unterbrochen habe?«
Barbosa nickt mit gesenktem Kopf. »Bei dieser Begegnung hat er seine Hand auf meinen Unterarm gelegt. Es war eine flüchtige Berührung, doch ich habe gespürt, dass er … dass er nach all den Jahren die Verbindung zu seinen Müttern immer noch nicht gelöst hat.« Voller Reue und Besorgnis sieht er die Direktorin direkt an.
»Was soll das heißen?«, schnappt sie verwirrt.
»Genau kann ich es dir nicht sagen, aber als dein Junge mich angefasst hat, habe ich gespürt, dass sie noch da sind.«
Rote Flecken treten auf Jupiters Hals und Gesicht, während ich vermutlich gletscherblau anlaufe. Mit einem Mal ist mir schwindelig, und ich wanke leicht, sodass sowohl Esra als auch Elio ihre Hände nach mir ausstrecken, doch ich schüttle sie ab.
»Die ewig Schlafenden, die in der Nacht des Infernos aus Mercys Träumen in die Akademie eingebrochen sind, das waren … seine Mütter?«, frage ich leise, als könnte ein Flüsterton das Gesagte einfach unhörbar und damit ungeschehen machen.
Seine Mütter, die bei einem tragischen Autounfall im Sommer vor neun Jahren ums Leben gekommen sind. Mercy saß mit in dem Wagen und überlebte das Unglück, doch anstatt den Tod seiner Eltern zu verarbeiten, wollte er ihn ungeschehen machen. Jahrelang experimentierte er mit seinem Nexus, wollte durch dieses verbindende Element aus seinen Träumen in die vergangene Realität gelangen und seine Mütter von der Autofahrt abhalten. Doch sein verzweifelter Versuch endete in der Nacht des Infernos.
Ich fühle mich, als würde ich ihn verraten, aber wenn ich jetzt nicht spreche, könnte es weitaus schlimmere Konsequenzen für ihn haben als erschüttertes Vertrauen, weshalb ich hinzufüge: »Und wenn Mister Barbosa sagt, dass Mercy die Verbindung zu seinen Müttern nicht getrennt hat, dann erklärt das, warum er immer noch von ihnen in seinen Albträumen heimgesucht wird.«
»Wie bitte?« Nun treten selbst die Adern an Jupiters Hals hervor.
Esra legt ihre Hand auf meine Schulter und dreht mich zu sich herum. Fassungslosigkeit steht in ihren violetten Augen. »Was?«
Ich bringe ein steifes Nicken zustande. »Mercy hat Albträume, in denen er von zwei dämonenhaften Kreaturen gejagt wird. Es muss sich um die ewig Schlafenden handeln, denn sie sehen genauso aus wie die Monster, die ich in seinen Erinnerungen zur Nacht des Infernos gesehen habe. Er sagt, er würde diesen Horror freiwillig wählen. Doch was ich jetzt erst verstehe, ist, dass es seine Mütter sein müssen, die er in seine Träume lässt.«
»Du hast seine Erinnerungen zur Nacht des Infernos gesehen?« Esras Pupillen weiten sich noch mehr. »Wie?«
»Auch wenn du von selbst gewähltem Horror sprichst«, mischt sich Elio ein und übergeht seine Schwester, »weiß ich, dass Mercy um die Kontrolle seiner Träume gefürchtet hat.«
Halb wende ich mich ihm zu. »Dessen bin ich mir bewusst. Deswegen habe ich ihm mein Armband gegeben.« Ich rolle den Ärmel meiner spitzenbesetzten Bluse nach oben und offenbare Neiros Schmuckstück. Es sieht aus wie aus einem Stück Holz gearbeitet, mit helleren korkähnlichen Flecken und silberfarbenen Fäden.
Jupiter kommt so schnell auf mich zu, dass ich nicht zurückweichen kann. Ihre Schritte sind bebend, sodass ich fürchte, jeden Moment würden ihre Absätze in den Boden rammen und feststecken. Grob schließt sie ihre Finger um mein Handgelenk und reißt es in die Höhe.
»War das Armband nicht wieder in deinem Besitz, Henrique?« Ihr Ton ist fordernd harsch, doch ebenso blechern, als würde sie kurz davor stehen, die Fassung zu verlieren.
»Am Ende der Wintersonnwendfeier habe ich es Mercy wiedergegeben. Als Schutz vor den ewig Schlafenden. Als Schutz vor …«
»… seinen Müttern, die nach wie vor existieren«, beendet Elio mit leerem Blick.
Jupiter lässt mein Handgelenk los, sodass mein Arm schlapp hinabfällt. Während mein Körper stumpf, steif und frostig kalt ist, brennt mein Verstand lichterloh. Ich versuche, die Zusammenhänge zu begreifen, versuche, aus diesem Wahnsinn etwas Logisches zu destillieren, das Mercys aktuellen Zustand erklären und ihm tatsächlich helfen könnte.
Ist es so weit? Hat Mercy endgültig die Kontrolle über sein Innenleben verloren und ist jetzt vielleicht in keinem Albtraum, aber sonst wo eingesperrt, wo er nicht erwachen kann? Kämpft er seit fast zwei Tagen ums Überleben? Wird er von den Höllenkreaturen – seinen Müttern – gejagt? Oder haben sie ihn bereits erwischt und ihn mit ihren Krallen ähnlich ausgeweidet wie Amélie Morel in der Nacht des Infernos?
Nein. Zumindest diese Überlegung kann ich verwerfen, denn sein Körper ist in der Wachwelt unverletzt.
Eine Mischung aus Keuchen, Knurren und Schluchzen entweicht Jupiter Sterling. Der Laut ist so unbeherrscht und roh, dass wir uns alle zu ihr herumdrehen. Ihr rotfleckiges Gesicht, die hervortretende Halsschlagader und ihre verkrampfte Mimik sind so untypisch für sie, dass ich einen Schritt zurücktrete.
»Als ich ihn in Nemesis’ Bett gesehen habe, hat mich seine Leichenblässe an die Nacht des Infernos erinnert, und ich habe befürchtet, dass diese Höllenkreaturen involviert sind, aber wie konnte ich ahnen, wie schlimm es tatsächlich um ihn steht?«, presst sie hervor. »Wie, wenn ich das alles zum ersten Mal höre?« Anklagend deutet sie auf Henrique Barbosa. »Warum bist du nicht sofort zu mir gekommen, als du das Gefühl hattest, seine ewig Schlafenden sind nach wie vor existent? Warum«, sie schnellt in Elios Richtung, »weiß ich nicht, dass mein Neffe – ein Luzider – die Kontrolle über seine Träume verliert?« Ihr Fokus springt zu mir. »Warum weiß ich nichts davon, dass er seine ewig Schlafenden in seine Träume lässt? Freiwillig? Weil er … O Göttin …« Sie verbirgt das Gesicht in den Händen und krümmt sich. »Weil er all die Jahre nur vorgegeben hat, seine Trauer zu verarbeiten. Weil er so getan hat, als würde er heilen, aber stattdessen … O Mondgöttin.« Sie nimmt die Hände weg, ihre Miene ist getränkt von Verzweiflung, doch sie weint nicht. Stattdessen schreit sie: »Warum?« Und feine Speicheltropfen fallen auf das Linoleum.
Mister Barbosa kommt mit erhobenen Händen auf sie zu. »Beruhige dich, Jupiter.«
Mit einem ausgestreckten Arm hält sie ihn auf Abstand und fixiert mich.
Jahrelang habe ich diese Frau für eine kaltblütige Mörderin gehalten, die meinen Bruder aus berechnender Konkurrenz aus dem Leben löschte. Jahrelang habe ich nichts als rachsüchtige Wut für sie empfunden, doch jetzt, in diesem verflucht sterilen Krankenzimmer, unweit ihres Neffen, habe ich zum ersten Mal Angst vor ihr. In ihrem Ausdruck liegt etwas Wildes und Unberechenbares, sodass ich eine Ahnung davon bekomme, was eine wirklich zügellose Jupiter Sterling bedeutet.
»Befriedigt dich sein Anblick, Schlafwandlerin? Hast du endlich erreicht, wonach deine erbärmliche Familie dein Leben lang lechzt?« Sie zeigt auf Mercy. »Sieh hin. Sieh ihn dir an, wie er im Sopor vor sich hin vegetiert. Ist das deine Rache an mir? Ist es das, was du wolltest?«
Ich will stumm bleiben. Taub bleiben. Meine Gefühle nicht zulassen. Ich will Verständnis aufbringen für ihre Situation, dafür, dass sich ihr geliebter Neffe in einem unerklärlichen Zustand befindet und niemand den Ausgang voraussehen kann. Ich will das alles, aber ich kann nicht.
Denn plötzlich bricht aus mir hervor, was ich mit aller Kraft zu unterdrücken versuche: meine eigene herzzerfetzende Angst um Mercury Sterling. Wie die reißende Naht einer frisch genähten Wunde platzt etwas in mir auf, und Worte quellen wie Blutströme aus mir hervor: »Du bist nicht die Einzige, die ihn liebt, Jupiter. Du bist es nicht gewesen, die in seinen Armen aufgewacht ist und geglaubt hat, dass er … tot ist.« Meine Stimme macht einen jämmerlichen Hickser, und ich beginne unkontrolliert zu zittern.
In der nächsten Sekunde ist Esra bei mir, doch ich schüttle sie ab.
»Ich habe ihm nichts getan, ich würde ihm nie willentlich schaden, ich weiß doch selbst nicht, was mit ihm passiert ist.« Harsch reiße ich mir das Armband vom Handgelenk. »Ich habe es ihm geschenkt, damit er seine Träume besser beherrschen kann, und wenn ich mir eine Sache seit knapp achtundvierzig Stunden ständig selbst vorwerfe, dann dass ich zugelassen habe, dass er das Armband abnimmt und mir zurückgibt.« In meiner Verzweiflung werfe ich das Schmuckstück zu Boden. Es schlägt auf, rutscht über das Linoleum und bleibt vor Sterlings spitz zulaufenden Stiefeln liegen.
In langsamer Bedrohlichkeit sieht sie zum Armband vor ihren Füßen, dann zu mir. »Heb es auf«, fordert sie mit ihrer unbeugsamen Direktorinnenstimme.
Doch nicht ich bücke mich danach, sondern Elio. Er hebt es auf, überreicht es seinem Vater, und die Barbosas wechseln einen eindrücklichen Blick. »Esra, Nemesis und ich warten im Speisesaal auf euch«, sagt er schließlich.
Jupiter Sterling bläht die Nasenlöcher und schnauft, als wäre Elio der Nächste, der in ihren Gefühlssturm gerät, da schaltet sich Mister Barbosa ein. »Das ist eine gute Idee, mein Junge.« Er verschließt den Schmuck in seiner Faust. »In Absprache mit Doktor Kaya werden wir versuchen, Mercy Sternenmagie einzuflößen. Wenn sein Zustand tatsächlich etwas mit den ewig Schlafenden zu tun hat, können wir dann nur auf das Beste hoffen.«
Esra hakt sich bei mir unter und führt mich aus dem Krankenzimmer, als wäre ich eine gebrechliche Großmutter. Ich bin froh, dass mein letzter Blick nicht Jupiters fuchsteufelswildem Ausdruck gilt, auch nicht den alarmierenden Werten auf dem Monitor, sondern allein Mercy. Es kostet mich meinen letzten Rest Selbstbeherrschung, doch ich sehe zu ihm.
Ich lasse dich nicht allein.
Das hat er mir versprochen, bevor ich mich den Erinnerungen seiner Tante gestellt und so genau hingesehen habe, dass ich jetzt weiß, dass Neiro nicht durch ihre Hand gestorben ist.
Ich dich auch nicht, verspreche ich, ehe sich hinter Esra, Elio und mir die Zimmertür schließt.
4 Nemesis
Aufgrund der Winterferien ist die Akademie weitestgehend verlassen, sodass Elio, Esra, Victoria und ich die Einzigen sind, die im Speisesaal um einen Tisch sitzen. Wir trinken Tee aus wiederverwendbaren Hartplastikbechern, da der Mann hinter der Theke wenig erfreut über unser spätes Auftauchen war und uns kein Geschirr mehr rausgeben wollte. Doch für einen heiß aufgegossenen Teebeutel in Bechern, die wir morgen während der verkürzten Öffnungszeiten zurückbringen können, hat es noch gereicht.
Die Kerzen der ausladenden Kronleuchter sind nicht entflammt, stattdessen sorgt eine ramponierte Stehlampe für einen kleinen orangen Leuchtkegel. Es erklingt auch keine Violinmusik, die zu einer einschläfernden Atmosphäre beitragen soll, sondern nur unser erschöpfter Atem. Die dunklen Buntglasfenster versprühen den Charme einer Kirche, und es ist so kalt, dass ich meine Handflächen fest um den warmen Becher drücke und dennoch mit den Zähnen klappere.
»Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so fertig wie noch nie in meinem Leben, und das will was heißen.« Esra fällt mit der Stirn auf die Tischplatte aus Kirschholz.
»Du musst Rücksicht auf dich nehmen«, sagt Elio, was Victoria mit einem steifen Kopfnicken bestätigt. »Deine Sorge um Dornröschen in Ehren, aber deine Gesundheit steht an erster Stelle. Bitte pass auf dich auf.«
»Wie großartig«, brummt Esra. »Jetzt habe ich zwei Wachhunde an den Fersen kleben. Willst du mir auch noch einen unnützen Ratschlag geben, Nem?«
Ich schüttle den Kopf, doch das kann sie nicht sehen.
»Wisst ihr«, sie richtet sich auf, und Strähnen ihres langen Haars kehren über den Tisch. »Wenn Mercy wieder ganz der Alte ist, werde ich mich bei ihm bedanken. Es ist großzügig von ihm, mich aus dem Fokus der Sorgen zu nehmen.«
»Wenn …«





























