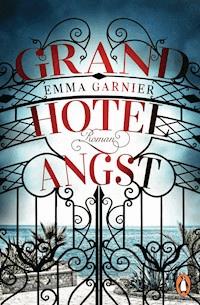
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Italien, März 1899. Die junge Nell reist mit ihrem Mann Oliver an die ligurische Küste, um in Bordighera ihre Flitterwochen zu verbringen. Das Paar logiert im luxuriösen Grandhotel Angst. Nell ist von dem großartigen Gebäude, dem exotischen Hotelpark und dem Blick aufs funkelnde Meer fasziniert. Doch zu ihrer Überraschung kennt Oliver nicht nur bereits das Personal und einige Gäste, sie scheinen auch Geheimnisse zu teilen. Als ein Hotelgast überraschend verstirbt, beginnt Nell, nachzuforschen. Und stößt auf eine Geschichte von Schuld und Verrat – und auf eine unheimliche Legende, die sie in ihren Bann zieht. Bis sie plötzlich selbst im Verdacht steht, ein Verbrechen begangen zu haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Sammlungen
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2017 Penguin Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Die Zitate (1) und (2) stammen aus:
Schillers Werke. Auswahl in zehn Teilen. Band 6-7, Deutsches Verlagshaus Bong & Co.
Das Zitat (3) stammt aus:
Hoffmann‘s sämtliche Werke in einem Bande, Bandry‘s Europäische Buchhandlung.
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: © severin/Anilah/Janis Smits/www.shutterstock.com
Redaktion: Lisa Wolf
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20151-7 V003
www.penguin-verlag.de
Prolog
Freitag, 24. März 1899
Nachmittags
Es gibt Legenden, die zaubern uns jenen feinen Schauder unter die Haut, der das Leben bereichert, ohne es zu bedrohen. Man hört sie, erzählt sie weiter – vielleicht ein wenig ausgeschmückt, um den inzwischen abgeschwächten Grusel zu vergrößern und sich der ungeteilten Aufmerksamkeit der Zuhörer zu vergewissern.
Manche dieser Geschichten entwickeln allerdings ein Eigenleben. In einem unbeobachteten Moment schlüpfen sie durch die Schranke der Vernunft und nisten sich an einer Stelle ein, von der wir bislang gar nicht wussten, dass sie ein Teil von uns ist. Sie haben die Macht zu vernichten, in den Wahnsinn zu treiben. Und es ist jener Wahnsinn, vor dem ich heute Morgen kopflos und in heller Panik davonlief, bis mir ein vollkommen Fremder in dieser Kammer fernab des Hotels Zuflucht gewährte.
Über Stunden hinweg presste ich mich zitternd an die Mauern, aus Sorge, SIE würde mich überall finden, auch hier. Erst langsam begreife ich, dass der Spuk vorüber ist. Dass mein Verstand wieder mir gehört. Zumindest in diesem Augenblick.
Nur was geschieht, wenn es dunkel wird?
Erschöpft reibe ich die Hände aneinander, und mit der Wärme, die in meine Glieder zurückströmt, wächst auch die Hoffnung, dass alles nur ein Hirngespinst war, eine unglückliche Verkettung von Umständen, die sich irgendwie erklären lässt, wenn ich mich nur richtig erinnere. Ich atme tief durch und zwinge meine Gedanken zurück zum heutigen Morgen, an dem das Unglück seinen Höhepunkt erreichte.
So viel Blut. Überall Blut!
Es klebte an meinen Händen und an seinem Körper, der leblos neben mir lag, sickerte ins Laken, drang in den Boden. Der grelle Schrei, der noch immer in meinen Ohren nachhallt, stammte von mir. Es dauerte Minuten, bis ich es begriff.
War das wirklich mein Werk gewesen?
Ich erinnere mich an den Moment des Erwachens, an das Gefühl der Benommenheit, als zerre mich jemand mit Gewalt aus einem tiefen Traum. Sofort beginnt mein Herz wieder zu hämmern, es ist, als wolle es meine Brust zersprengen. Ich betrachte meine Finger, spüre wieder den kühlen Griff des Messers, das in meinen Händen lag und das ich entsetzt von mir warf, als ich es erblickte.
Hatte SIE etwa meine Hand geführt? Hatte SIE von meiner Seele Besitz ergriffen, so wie man es mir vorhergesagt hatte?
Ich will es nicht glauben. Jetzt, bei Tageslicht betrachtet, erscheint es mir unmöglich. Doch ich habe Angst vor der Nacht. Ich fürchte mich vor dem, was geschieht, wenn ich die Augen schließe. Wenn ich mich dem Schlaf ergebe und die Kontrolle verliere.
Ich habe Angst vor mir selbst!
Ein lautes Krachen lässt mich auffahren. Doch es ist nur ein Ast, der nahe dem Fenster zu Boden gerissen wurde. Ich, die ich die Geräusche der Natur liebe, Gewitter nicht meide und selbst im lauten Tosen des Meeres einen Wohlklang zu entdecken vermag, bin schreckhaft geworden.
Vor meinen Augen tobt ein Sturm, der dem in meinem Inneren in nichts nachsteht. Er peitscht den Regen gegen die Fensterscheiben, rüttelt an den Verankerungen der Läden. Von hier aus kann ich den ganzen Ort überblicken, bis hinunter zum Meer, wo die Wellen sich auftürmen und schaumgekrönt an die Klippen schlagen.
Wie ruhig das Wasser gewesen war, als wir mit dem Zug eintrafen. Wie mild die Luft, wie sanft das Licht. Während Oliver dem Kutscher half, das Gepäck für den kurzen Weg zum Hotel im Wagen zu verstauen, konnte ich mich nicht sattsehen an der Schönheit dieses Ortes. An den Hängen weiße Villen mit grünen Fensterläden vor der Kulisse der Seealpen mit ihren schneebedeckten Kappen. Die Luft roch nach Jasmin, vom Meer wehte ein warmer Wind herauf und bewegte die silbrig grünen Blätter der Palmen, die den Strand säumen.
»Willkommen im Paradies«, hatte Oliver in meine Gedanken hinein gesagt und seine starken Arme um mich gelegt. »Habe ich dir zu viel versprochen?«
Ich halte inne, versuche, das Bild vollkommenen Glücks festzuhalten, doch es entschwindet, je fester ich mich daran klammere. Eine Illusion! Die Realität war damals schon eine andere, nur hatte ich das nicht erkennen wollen.
Ich trete ans Fenster und sehe hinaus auf den Hügel, wo sich ein Gebäude über die Stadt erhebt. Reglos, düster, der Name in großen Lettern wie eine Warnung weit sichtbar aufgemalt. Ein mächtiger Bau mit unzähligen Fenstern, die in meine Richtung starren, als würden sie mich suchen.
Hastig weiche ich zurück. Ich wünschte, ich wäre niemals hierhergekommen.
Doch wie hätte ich das Unheil ahnen können, als ich zusammen mit Oliver die Kutsche bestieg, die uns vom Bahnhof zum Grandhotel bringen sollte? Jenem Hotel, dem man mit Bedacht den Namen seines Besitzers gegeben hatte, um eben jenes angenehme Schaudern hervorzurufen, das wir Briten so sehr lieben: Angst.
»Warte nur ab, bis die ersten Stufen knarren, das Licht flackert oder gespenstische Gesänge erklingen«, hatte Oliver augenzwinkernd gesagt, als sei das alles Teil eines hoteleigenen Theaterstücks.
Er hätte es besser wissen müssen.
Von der Straße schallt Lärm hinauf, ein Rufen, auch auf Englisch. Ich spähe durch die Scheiben, sehe einige Polizisten, die unter dem Fenster vorbeihasten. Der ganze Ort scheint auf den Beinen. Bestimmt suchen sie nach mir. Ich bete, dass sie dem jungen Mann nicht begegnen, der mir dieses Zimmer hier gegeben hat, und dass er und seine Schwester über meinen Aufenthaltsort Stillschweigen bewahren.
Die Art, wie er sich um mich sorgt, gibt mir die Illusion, hier sei ich sicher. Aber irgendwann wird er beginnen, Fragen zu stellen, und Geld für seine Gastfreundlichkeit einfordern. Irgendwann wird er erfahren, wen er hier beherbergt. Und dann …
Ich merke, dass ich zittere. Die Zeit rinnt mir zwischen den Fingern hindurch, als wolle sie fliehen. Ich weiß, ich kann das Unheil nur aufhalten, wenn ich die Zusammenhänge verstehe.
Was habe ich übersehen? Habe ich überhaupt etwas übersehen?
Bilder und Gefühle drängen in einer ungeordneten Flut in meinen Kopf und verlangen, sortiert zu werden.
Bin ich in Gefahr? Oder bin ich selbst die Gefahr?
1. Teil Die Legende
»Auf einmal empfanden wir alle zugleich einen Streich wie vom Blitze, dass unsere Hände auseinanderflogen; ein plötzlicher Donnerschlag erschütterte das Haus, alle Schlösser klangen, alle Türen schlugen zusammen, der Deckel an der Kapsel fiel zu, das Licht löschte aus, und an der entgegenstehenden Wand über dem Kamine zeigte sich eine menschliche Figur, in blutigem Hemde, bleich und mit dem Gesicht eines Sterbenden.«
Friedrich Schiller, Der Geisterseher
1
Freitag, 17. März 1899
Eine Woche zuvor
Nie werde ich den Moment vergessen, als ich nach tagelanger Fahrt aus dem Zug stieg. Mir war, als tauchte ich ein in eine fremde Welt, in der die Luft eine andere war, das Licht weicher.
In den einundzwanzig Jahren meines bisherigen Lebens war ich nicht über die Grenzen Englands hinausgekommen, und so hatte ich ununterbrochen aus dem Fenster sehen müssen, als sich der Méditerrannée-Express der italienischen Küste näherte und erst Cannes, Nizza, Monte Carlo, dann Menton und Ventimiglia passierte. Vorbei an Klippen und Steinstränden, dem in der Sonne funkelnden Meer, dessen intensives Türkisblau mir den Atem verschlug. An in den Fels gebauten Häusern und der in einem unbändigen Farbenrausch prachtvoll erblühenden Natur.
Überwältigt stand ich schließlich auf dem Platz vor dem Bahnhof in Bordighera und blickte auf das Wasser, das nur wenige Schritte entfernt an die Kaimauer brandete. Das Meer war anders als das bei Mersea Island, wo Tante Rose lebt, die ich seit meiner Kindheit jeden Sommer für ein paar Wochen besuche. Verheißungsvoller und – so schien es mir in jenem Moment – von archaisch anmutender Schönheit.
Alles war so, wie Giovanni Ruffini es in seinem Roman Doctor Antonio beschrieben hatte. Ich bestaunte die durchsichtige Atmosphäre, das feine Blau des Himmels, den sanften Schwung der Berge, die sich einer über den anderen erheben, um im weichen Duft der Ferne zu verschwinden.
Schon als junges Mädchen hatte ich die Geschichte der Engländerin Lucy verschlungen, die sich erst in einen italienischen Arzt und dann in Bordighera verliebt. Oft hatte ich mir vorgestellt, wie es wäre, an ihrer Stelle zu sein, hatte sie in kalten Winternächten um die Wärme und Schönheit ihrer italienischen Heimat beneidet. Und nun war ich hier, an dem Ort, von dem die Frauen in ganz England träumten!
Es war früher Abend, und die vereinzelten Wolken über dem Wasser verfärbten sich bereits in zartem Apricot. Während sich in London das trübe Märzgrau in dichten Regenschleiern über die Stadt legte, atmete ich eine Luft, als frohlockten die Vorboten des Sommers. Ich zog den viel zu warmen Mantel aus, legte ihn über den Arm und dachte an die leichte Kleidung, zu der Oliver mir geraten hatte und die in einem der Schrankkoffer verstaut war, die noch verfrachtet werden mussten.
Ein Schwall fremdländischer Worte drang zu mir herüber, und ich drehte mich zu Oliver um. Er stand neben dem Kutscher und zeigte hinauf zu dem Hügel, der sich am Rande des Ortes erhob. Ich folgte seiner Geste, und dort oben sah ich es zum ersten Mal.
Majestätisch erhob sich das Grandhotel Angst aus einem Wald von Palmen und Zypressen. Die sinkende Sonne schimmerte auf der weißen Fassade. Von Weitem sah es aus wie ein Schloss. Mondän und einladend, bereit, seine Gäste mit angenehmem Luxus zu empfangen.
Man sagt, der erste Eindruck sei ein bleibender. Er sinke in die Erinnerung und lasse sich niemals auslöschen, selbst wenn die Erfahrung einen etwas anderes lehre. Die Menschen wissen nicht, wie unrecht sie damit haben. Eindrücke sind veränderlich wie die Gefühle eines sprunghaften Kavaliers.
An jenem Tag aber erfüllte mich der Anblick des Hotels mit unbändiger Vorfreude. Oliver hatte uns für die nächsten vier Wochen in einem wahren Palast eingemietet! Als Kunsthändler ist er weit über die Grenzen Englands hinaus bekannt und nicht unvermögend. Er besitzt ein Haus im Londoner Stadtteil Kensington, in das ich am Tag unserer Hochzeit zog, fährt eine motorisierte Kutsche von Daimler und kauft seine Kleidung bei den elegantesten Herrenschneidern der Savile Row. Dass das Ziel unserer Flitterwochen derart luxuriös sein würde, hätte ich dennoch nicht erwartet.
»Wie wundervoll«, rief ich aus und dachte an die Geschichten von barbarischen Südvölkern und mangelnder Hygiene, mit denen man mir die Reise hatte ausreden wollen. »Meine Eltern haben sich völlig umsonst um mein Wohlergehen gesorgt.«
»Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten wir unsere Flitterwochen in Wormingford verbracht«, sagte Oliver und zog die Brauen zusammen, sodass auf seiner Stirn eine steile Falte erschien.
»Wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, dann hätte ich dich gar nicht erst geheiratet«, antwortete ich ihm augenzwinkernd.
»Und? Warum hast du es dennoch getan?«
Um ihnen zu entfliehen. Ihnen und dem furchtbar begrenzten Leben in diesem viel zu großen, verstaubten Landgut, hätte ich am liebsten geantwortet. Doch es war nicht die ganze Wahrheit.
Nachdem ich Oliver während einer London-Reise kennengelernt hatte, nahm mein Leben eine Wendung, von der ich nie zu träumen gewagt hätte. Und das liegt nicht nur an dem gehobenen Lebensstil, den er mir bietet. Vielmehr daran, dass er sich für meine Ansichten zu interessieren scheint, statt mir seine aufzuzwängen. Er ist fünfzehn Jahre älter als ich, aber es störte mich nie, denn er hat mir als erster Mann das Gefühl gegeben, dass ich kein Mädchen mehr bin. Sondern eine erwachsene Frau, für die es sich lohnt zu werben, und der er die ganze Welt zu Füßen legen will.
»Weil ich dich liebe«, antwortete ich lächelnd und ließ mir von ihm ins Wageninnere helfen. »Dich und deine wunderbaren Ideen.«
Die Kutsche fuhr an, bog aus der dicht bebauten Via Imperiale Federico in die breitere Strada Romana ein, die allmählich anstieg. Vor uns erstreckte sich eine große, mit Olivenbäumen bepflanzte Ebene, dahinter bewaldete Hügel, rechts und links Villen mit prächtigen Gärten. Nach wenigen Hundert Metern lenkte der Kutscher den Wagen durch ein Tor mit weit geöffneten Flügeln und fuhr in den gewaltigen Hotelpark, hinter dem sich das Grandhotel über fünf Stockwerke erhob.
Die Luft schien zu vibrieren, während wir uns auf das elegante Gebäude zubewegten, ein weißglänzender Palast inmitten eines Meeres aus duftendem Grün. Üppige Blumenrabatten und gestutzter Rasen säumten die breite, kurvige Auffahrt. Seitlich davon erstreckten sich schmale Wege mit Parkbänken, auf denen Gäste saßen und die Gesichter in die Abendsonne hielten.
Je näher wir dem säulengetragenen Entree kamen, desto angespannter wirkte Oliver. Steif und aufrecht saß er da, reckte den Kopf zu allen Seiten, und ich glaubte zu bemerken, dass sich seine im Schoß gefalteten Hände plötzlich verkrampften, während ich mich an der Herrlichkeit des Gebäudes gar nicht sattsehen konnte.
Als die Kutsche auf dem Vorplatz bis zur geschwungenen Freitreppe rollte, wanderten meine Augen über die aufwendig gestaltete Fassade. Stuckelemente in Form von Löwenköpfen, Blumengirlanden und Ornamenten verbanden sich mit griechischen Säulenformationen in vollendeter Harmonie. Einige der Zimmer hatten schmiedeeiserne Balkone, die größeren sogar Balustraden.
»Wir werden in einer Suite mit Balkon wohnen«, sagte Oliver in diesem Moment, als könne er meine Gedanken lesen.
Und so lehnte ich mich noch ein Stück weiter hinaus, stellte mir vor, wie herrlich es sein würde, abends draußen zu sitzen, mit einem Likör oder Absinth in der Hand, und über die Wipfel der Palmen auf das Meer zu blicken.
Kaum hatte uns ein livrierter Hotelangestellter die Kutschentür geöffnet, lief ich auch schon die Treppe zum Hotel hinauf. »Das ist unglaublich, Oliver«, rief ich übermütig und breitete die Arme aus, »bei diesem Blick fühlt man sich, als sei man die Queen von England!«
Ein älterer Herr mit lederartigem Gesicht und gezwirbeltem Schnurrbart trat durch die Eingangstür ins Freie und runzelte bei meinem Anblick missbilligend die Stirn. Dabei strahlte er eine Strenge aus, die etwas Einschüchterndes hatte.
Vielleicht hätte ich mich für mein Benehmen entschuldigen müssen, doch ich wollte mir den Moment nicht verderben lassen. Ach, ich hätte die ganze Welt umarmen können! Oliver, Bordighera, die Flitterwochen weitab meiner Heimat – all das gab mir ein nie gekanntes Gefühl von Freiheit und Glück.
Noch einmal sog ich die weiche Luft ein, den Duft von Veilchen und Bougainvillea, dann schritt ich würdevoll an dem Herrn vorbei und nickte ihm freundlich zu. Er konnte vielleicht nichts für seine Griesgrämigkeit, hatte womöglich sein gesamtes Leben hinter blind gewordenen Fenstern eines altenglischen Landguts verbracht, und ich wollte mir in diesem Augenblick die Laune nicht verderben lassen. Also ließ ich ihn hinter mir und betrat die Vorhalle, um dort auf Oliver zu warten, der noch immer an der Kutsche stand und sich mit dem livrierten Angestellten unterhielt.
Beinahe wäre ich mit einer rundlichen Frau zusammengestoßen, die mit dem Portier ins Gespräch vertieft war. Ihr graues Haar steckte unter einer Haube, unter dem Arm trug sie einen geflochtenen Korb mit Tomaten, der ins Schwanken kam, als sie mit einer hastigen Bewegung versuchte, mir auszuweichen.
»Dio santo!«, rief sie aus und setzte einen Schwall italienischer Worte nach, die ich trotz des Sprachführers, den ich vor unserer Abreise ausgiebig studiert hatte, nicht verstand.
»Es tut mir leid, Signora«, sagte ich rasch und griff nach einer Tomate, die aus dem Korb zu fallen drohte.
Die Frau stand wie erstarrt da und schlug die Hand vor den Mund. Sie war leichenblass geworden. »Non ci credo! Sie sehen aus wie …« Mit den Fingern näherte sie sich meinem Gesicht, dann zuckte sie zurück.
»Maria, was soll der Unsinn? Du belästigst unseren Gast!«, fuhr der Portier sie an und machte eine energische Handbewegung.
Er wartete, bis die Frau sich zögernd von meinem Anblick löste und trippelnd im Dunkel eines Korridors verschwand. Nicht, ohne sich noch einmal mit kalkweißem Gesicht nach mir umzusehen. Dann verbeugte er sich mehrfach.
»Verzeihen Sie bitte vielmals, Signora. Dieser Vorfall ist mir äußerst unangenehm. Ich werde dafür sorgen, dass man diese Person für Ihre Belästigung zur Rechenschaft zieht.« Er verbeugte sich noch einmal. »Gestatten Sie mir, Sie in unserem Hause zu begrüßen?«
Ich nickte und wollte gerade antworten, dass ich mich gar nicht belästigt gefühlt hatte, als ein breites Strahlen sein Gesicht überzog.
»Ah, Signor Dickinson, buon giorno. Come sta?«, sagte er an mir vorbei und machte einen Schritt auf Oliver zu, der gerade erst das Hotel betreten hatte und mich mit einem kurzen, ungehaltenen Blick bedachte. »Ist diese bezaubernde Signora Ihre … Gemahlin?«
»Ja, das ist sie«, antwortete Oliver, er kam rasch näher und legte einen Arm um mich. »Sie heißt Eleonore.«
Der Portier begrüßte mich erneut, dieses Mal mit Namen. Dann nickte er Oliver freundlich zu. »Ich freue mich sehr, dass Sie uns auch in diesem Jahr wieder beehren.«
»Sie glauben doch nicht, dass ich Ihnen jemals untreu werde, Signore Bartelli?«
»Nein«, sagte der Hotelangestellte lachend. »Nicht Sie.«
Oliver zwinkerte ihm zu und sah sich suchend um. »Wo ist Adolf? Ich möchte ihn gerne begrüßen.«
»Oh, ich bin untröstlich, Herr Angst ist leider verhindert. Ein Krankheitsfall in der Familie. Er hatte sich in seine Bergresidenz nach San Dalmazzo di Tenda zurückgezogen, und nun sind die Abfahrtswege vom Schnee versperrt. Aber ich werde ihm mitteilen lassen, dass Sie eingetroffen sind, sobald er wieder in Bordighera ist. Er wird es sich gewiss nicht nehmen lassen, Sie persönlich willkommen zu heißen.«
Mit wachsendem Staunen verfolgte ich das vertraut wirkende Gespräch. »Du hast mir gar nicht erzählt, dass du regelmäßig hierherkommst«, raunte ich meinem Mann zu, während der Portier einen Pagen anwies, uns mit dem Handgepäck zur Suite zu begleiten. »Sogar mit dem Hoteldirektor bist du gut bekannt.«
»Es hat sich eben noch nicht ergeben«, antwortete Oliver nur kurz angebunden und ging voran.
Seufzend folgte ich ihm den Gang hinunter. Als ob zwei Tage mit Fähre und Zug nicht ausreichend gewesen wären, es zumindest zu erwähnen. Geschweige denn die Wochen zuvor, seitdem er mir eröffnet hatte, wohin die Flitterwochen gehen sollten. Vielleicht aber, räumte ich ein, als er mir mit einer ausladenden Bewegung den modernsten Fahrstuhl präsentierte, den ich je gesehen hatte, liebte er es einfach nur, mich immer wieder zu überraschen.
In der ersten Nacht tat ich kein Auge zu, obwohl wir uns nach einem üppigen Abendessen ein paar Gläser des hauseigenen Sherrys genehmigt hatten und ich vor Müdigkeit kaum noch aufrecht stehen konnte. Wieder und wieder ließ ich den Tag Revue passieren, noch immer staunend angesichts der hochwertigen Ausstattung des Hotels. Der elektrische Lift, fließend warmes Wasser und sogar Heizung in jedem Zimmer! Dazu diese Pracht: teure Gemälde, kostbare Tapeten, überall Stuck und Fresken, marmorne Tische, üppig behängte Kronleuchter und Kunstwerke aus getriebenem Silber.
Über alldem stand der Stolz in Olivers Blick, der scheinbar nicht genug davon bekommen konnte, mich beeindruckt zu sehen. Und so ergab ich mich der wohligen Leichtigkeit des Südens, statt ihn noch einmal auf seine langjährige Verbundenheit mit dem Hotel anzusprechen. Mit Sicherheit wird er es mir irgendwann erzählen, dachte ich, was macht es schon, darauf zu warten, dass er von selbst damit beginnt.
Nach einer Weile gab ich die Versuche auf, in den Schlaf zu finden, und drehte mich zu Oliver, der mir den Rücken zugewandt hatte und leise schnarchte. Behutsam erhob ich mich, setzte die nackten Füße auf den Läufer und ging in den angrenzenden Salon. Vorsichtig schob ich die Läden auf, entriegelte die Balkontür und öffnete sie weit.
Der zunehmende Mond warf sein silbriges Licht auf die Silhouetten der nahe gelegenen Hotels. Die Chiesa Anglicana erhob sich über die Dächer der Stadt, dahinter die nachtschlafende Bucht.
Ich trat hinaus in die kühle Abendluft und schlang die Arme um den Körper. Vom Park stiegen Dunstschwaden empor, die sich in der Höhe verloren. In den Palmen erklang ein leises Wispern, das mit jedem Windhauch anschwoll.
Nun war ich also hier, an jenem Ort, den man im fernen England wegen seiner milden Winter pries, wegen seines Klimas, das Atemwegserkrankungen zu heilen vermochte, wegen der tropisch anmutenden Vegetation und der prachtvollen Villen, deren Zahl alljährlich stieg. Wormingford und alles, was ich damit verband, schien auf einmal so fern. Das Einzige, woran ich mich in jenem Moment erinnerte, war die Dunkelheit der Räume, die sich selbst im Sommer dort nie ganz verlor.
Ein Knarren ließ mich herumfahren. Aus der Schwärze des Schlafzimmers kam Oliver auf mich zu und rieb sich die Augen.
»Was ist los, Nell?«
»Ich kann nicht schlafen. Es ist alles so aufregend!«
»Ja, das ist es.« Er stellte sich hinter mich, legte die Hände auf meine Schultern und bedeckte meinen Nacken und Hals mit sanften Küssen. Ich legte den Kopf schräg und genoss seine Liebkosungen, als ich seine Stimme dicht an meinem Ohr hörte.
»Ich werde dir ganz Ligurien zu Füßen legen«, wisperte er und hauchte dabei seinen warmen Atem auf meine Haut. »Die Küste, das Meer und die Blumenpracht, die das Klima hier hervorbringt. Vielleicht besuchen wir morgen den Giardino Winter. Sein Besitzer beliefert sogar den Münchner Viktualienmarkt. Oder wir fahren ins Val del Borghetto.« Er schlang die Arme um meinen Bauch und zog mich noch enger an sich. »Wir werden uns in den hübschen kleinen Bergdörfern herumtreiben, starken einheimischen Kaffee trinken und uns klebrige Dolci von den Fingern lecken. Vier Wochen werden nicht reichen, um dir die ganze Pracht der Riviera zu zeigen.«
Sein Atem wurde schwerer, wieder küsste er meinen Nacken, dann fasste er mich an den Schultern und drehte mich zu sich um. Das Mondlicht beleuchtete sein Gesicht, wo sich auf der Stirn wieder die steile Falte zeigte, während er mich mit seinen dunklen Augen ansah.
»Ich freue mich auf jeden einzelnen Tag mit dir«, antwortete ich leise, überrascht von der Eindringlichkeit in seinem Blick.
Behutsam strich ich ihm über die Arme. Betrachtete sein kantiges Gesicht, dessen scharf gezeichneter Mund von einem gestutzten Bart umrahmt war. Die schmalen Augen, die einen ebenso durchdringend wie liebevoll betrachten konnten. Wer uns nicht kannte, musste glauben, unsere Liebe sei eine Laune des Schicksals. Er, groß und blond, mit breiten Schultern und nordisch kühlem Wesen, ich, klein und schmal gebaut, mit dickem dunkelbraunem Haar.
Während ich auf dem Land aufgewachsen war und meine Kindheit in der fruchtbaren Landschaft von Essex zwischen Wiesen, Flusstälern und Wäldern verbracht hatte, war Oliver früh angehalten worden, sich elegant und selbstsicher in der Großstadt zu bewegen und einen ausgeprägten Sinn für die schönen Künste zu entwickeln.
Seine Eltern waren früh verstorben und hatten ihm ein beträchtliches Vermögen hinterlassen, was ihn, zusammen mit seiner unbestrittenen Attraktivität, zu einem begehrten Ziel weiblicher Sehnsüchte machte.
Oliver hätte unter Dutzenden von Verehrerinnen wählen können. Bereits kurz nach dem Tod seiner ersten Frau war er mit Einladungen überhäuft worden. Zu einem vertrauten Dinner, einem Spaziergang zu zweit. Er aber hatte alle Avancen ignoriert, sich verkrochen und seiner Schwermut nachgegeben, bis ich in sein Leben getreten war und es gehörig durcheinandergewirbelt hatte. Ebenso wie er meines.
»Lass uns schlafen gehen«, sagte er endlich, und sein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. »Sonst verpassen wir noch unseren ersten gemeinsamen Tag im Paradies.«
Ich reckte mich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss. Dann ging ich voraus ins Schlafzimmer, während er die Läden wieder schloss.
»Was war eigentlich heute bei unserer Ankunft am Empfang los?«, fragte er beiläufig, als ich gerade unter die Decke geschlüpft war. »Du hast irgendwie irritiert gewirkt. Habe ich etwas verpasst?«
»Eine der Angestellten hat mich wohl für eine Erscheinung gehalten«, murmelte ich und schmiegte mich in das weiche Federkissen. »Sie sagte, ich würde jemandem ähneln.«
Oliver, der sich auf seine Bettseite gesetzt hatte, hielt in der Bewegung inne und sah mich an. »Ach ja? Wem denn?«
»Das hat sie nicht gesagt. Aber sie ist leichenblass geworden, als sie mich erblickte. So als hätte sie einen Geist gesehen.«
Er legte sich zu mir und betrachtete mich ernst. Seine blauen Augen funkelten im Halbdunkel des Zimmers. »Das ist wirklich merkwürdig«, sagte er.
»Was meinst du damit?«
Er runzelte die Stirn, und als er endlich antwortete, klang er sehr nachdenklich. »Ich frage mich, ob diese Begegnung wirklich ein Zufall war …«
Damit zog er mich fest an sich, und ich ließ mich in einen tiefen, traumlosen Schlaf fallen, bis das erste Tageslicht langsam durch die Ritzen der Lamellen kroch und helle Streifen auf Tapeten und Möbel zauberte.
Jetzt, sieben Tage später, erinnere ich mich wieder, dass seine Antwort mich irritierte. Denn an jenem Abend war die Begegnung mit Maria für mich nichts weiter als eine Verwechslung.
2
Die ersten Tage verbrachten wir mit der Erkundung der näheren Umgebung. Hand in Hand schlenderten wir durch die mittelalterlichen Gassen der Altstadt und bestaunten die Mauern, die man zum Schutz gegen die Sarazenen errichtet hatte, besuchten die Kapelle von Sant’Ampelio und sahen über die Klippen des Kaps hinunter aufs Meer und bis zum tiefblauen Horizont.
Der Kern des Fischerortes war in seinem ursprünglichen Charakter unberührt, weiter westlich jedoch hatten Engländer deutliche Spuren hinterlassen. Oliver zeigte mir die Häuser britischer Ärzte und Anwälte, den Konzertsaal mit dem Namen Victoria Hall, den Bridge Club und die Tennisplätze. Sogar eine englische Bibliothek hatte man eingerichtet, die Biblioteca Bicknell, die sich vor allem an Regentagen großer Beliebtheit erfreute. Darüber hinaus hatten auch andere Nationen dem Ort ihren Stempel aufgedrückt. Es gab es ein deutsches Café mit Konditorei, in dem sich viele Künstler trafen, eine französische Buchhandlung und einen amerikanischen Zahnarzt.
Am Abend, wenn die bunte Gesellschaft herausgeputzt und nach Parfüm duftend aus ihren Hotelzimmern strömte, um sich über den im Lichtschein der Straßenlampen erhellten Ort zu verteilen, ließen wir uns einfach treiben, aßen Langusten in einem belebten Restaurant am neu erbauten Hafen und lauschten auf den Stufen vor dem Teatro Ruffini sitzend einer italienischen Oper.
Einmal, als wir uns nach einem langen Spaziergang auf einer Bank an der Promenade ausruhten und dem Geräusch sich brechender Wellen lauschten, glaubte ich, vor Seligkeit schier platzen zu müssen. Vor uns lag das in der Sonne silbrig funkelnde Meer, auf dem einige Fischerboote trieben. Oliver, der eng neben mir saß, beobachtete einen Seeadler, der über dem stahlblauen Himmel seine Kreise zog.
In diesem Moment des vollkommenen Glücks dachte ich an England und an meine Eltern, die in dieser lichtarmen Zeit allabendlich den Kamin entzündeten, um der feuchten Kälte zu entfliehen, die durch Fensterritzen und Mauerwerk drang, während ich – nur mit einem Sommermantel bekleidet – das Gesicht der Sonne entgegenreckte und mich an ihr wärmte.
Das viel zu große Haus mit den unzähligen Zimmern erschien mir schon immer zu düster. Was daran liegt, dass es von hohen Bäumen umringt ist, die es wie ein dichter Schutzwall umgeben. Meine Mutter, in deren Stammbaum sich auch ein deutscher Graf befindet, nannte es ihre Burg. Für mich hingegen hatte diese Enge immer etwas Bedrohliches, sodass ich als Kind jede Gelegenheit nutzte, ins Freie zu kommen, auch wenn man mir unbeaufsichtigte Ausflüge verbot.
»Du siehst bald aus wie eine dieser italienischen Marktfrauen«, neckte Oliver mich, während er mir das Sonnenschirmchen öffnete, das ich achtlos neben mich gelegt hatte. »Deine Wangen sind bereits gerötet.«
»Und wenn schon«, flüsterte ich lächelnd. »Die wenigsten Gäste scheinen sich um die edle Blässe zu scheren. Sie bewegen sich alle so frei, als hätten sie die puritanische Strenge der Heimat vollkommen abgeschüttelt. Selbst die vorösterliche Fastenzeit scheint bei den wenigsten ein Thema.«
Oliver sah mich erstaunt an. Dann schloss er das Schirmchen und legte es mit einem verschmitzten Lächeln wieder zurück auf die Bank. Nichts schien ihm mehr Vergnügen zu bereiten, als mich glücklich zu sehen. In jenem Moment dachte ich, dass das Schicksal es gut mit mir meinte. Und dass es bestimmt niemanden in ganz Italien gab, dem es besser erging als mir. Wie hätte ich auch ahnen sollen, dass dies der letzte unbeschwerte Tag gewesen war.
Am Morgen des dritten Tages drängte es Oliver nach einem Ausflug in die Berge, und so bestellte er eine Kutsche, die uns in ein Dorf namens Vallebona bringen sollte, das oberhalb von Bordighera lag.
»Dort gibt es ein Restaurant mit einer urtümlich italienischen Küche«, meinte er. »Alles schmeckt viel intensiver als die gewohnte Kost, aber es wird dir sicher gefallen, du wirst sehen.«
Der Weg führte über eine saftige Ebene, durch Oliven- und Mimosenhänge, wurde in der Höhe schmaler und presste sich schließlich so eng an Felswände, dass ich erschrocken den Atem anhielt und die Augen schloss, um nicht in die Tiefe sehen zu müssen. Nur ein unbedachter Schritt, ein rutschender Stein …
Oliver legte beruhigend den Arm um mich und rief dem Kutscher zu, das Tempo zu drosseln. Trotzdem drückte ich mich an ihn, spürte dem beständigen Rumpeln und Schlingern auf der unebenen Spur nach und stieß ein stilles Gebet aus. Von irgendwoher drang ein durchdringender Schrei, doch als ich die Augen aufriss, sah ich nur zwei Möwen, die in der Höhe einen Tanz aufführten.
Endlich erreichten wir Vallebona, einen zauberhaften Ort mit mittelalterlichen Steinbauten, die sich auf engstem Raum aneinanderdrängten. Oliver wies den Fahrer an, vor dem Stadttor zu halten und in zwei Stunden wieder zur Stelle zu sein. Dann stiegen wir die steile Straße hinauf, bis wir das verwunschene Dorf betraten. Zwischen den Pflastersteinen wuchs Gras, die Wege waren leer, und es war so still, dass ich erschrak, als die Glocken der alten Pfarrkirche zwölf Uhr schlugen.
»Das ist das Dall’Aprosio«, sagte Oliver und blieb vor einem unscheinbar wirkenden Steinhaus mit fahlrotem Ziegeldach stehen. »Eines der bezauberndsten Restaurants dieser Gegend. Nirgendwo sonst bekommt man bessere Pasta.«
Er führte mich durch einen weinberankten Torbogen auf die Terrasse des kleinen Lokals, von der man zwischen mit Olivenbäumen überdeckten Hügeln hindurch bis zur Küste sehen konnte.
Welch wunderbare Sicht, die mich augenblicklich für die holprige Fahrt entschädigte!
Wir setzten uns nahe der Steinmauer in den Schatten einer Platane. Ein sanfter Wind trug Meeresluft hinauf; ich glaubte, das Salz auf den Lippen schmecken zu können. Das blaue Tischtuch flatterte im Luftstrom und wäre sicher davongeweht, hätte es nicht ein Krug gehalten, in dem ein Strauß aus Veilchen und Hyazinthen steckte.
»Wie wunderschön es hier ist«, meinte ich versonnen und sah mich um.
Die Terrasse des kleinen Restaurants war gut gefüllt mit Gästen. Neben uns saßen zwei Damen mit breitkrempigen Strohhüten, schwatzend und lachend. Freundlich lächelnde Kellner mit gepflegten Schnurrbärten eilten durch die Tür ins Freie und balancierten dampfende Köstlichkeiten.
Während ich die urtümliche Schönheit dieses Lokals in mich aufnahm, studierte Oliver die Tagesgerichte, die mit Kreide auf einer Wandtafel geschrieben standen. Seine Brauen zogen sich zusammen, bis die steile Falte wieder sichtbar wurde, schließlich winkte er einen Kellner heran und ließ sich die Speisen aufzählen.
»Ich habe uns als Vorspeise Bianchetti bestellt und anschließend Linguine mit schwarzem Trüffel«, sagte er, nachdem wir wieder alleine waren. »Die italienischen Nudeln sind köstlich. Viel besser als die mit Ei, die sich die Hotels aus England kommen lassen. Und ich kenne niemanden, der sie besser zubereitet als Signore Aprosio.«
Ich sah ihn überrascht an. »Man lässt die Nudeln aus England kommen?«
»Nicht nur die. Brot, Fleisch, Gemüse – nahezu alles wird herbeigeschafft, damit der verwöhnte Gast sich auch wohlfühlt. Egal, um wie viel besser die hiesigen Speisen schmecken.«
Ich nickte. »Und was sind Bianchetti?«
»Das ist Fischbrut. Nun schau nicht so, das ist eine Delikatesse.«
»Ich glaube nicht, dass ich das mögen werde.«
Oliver hob die Brauen. »Dann gehörst du also auch zu denen, die nur das essen, was sie aus der Heimat kennen?«
»Nein«, erwiderte ich, erstaunt über seine plötzliche Strenge. »Es ist nur … Nun gut, ich werde es probieren.«
»Sieh an. Ich wusste doch, dass in deinem hübschen Körper ein kluges Mädchen steckt!« Damit strich er mir über das Kinn.
Während ich noch darüber nachdachte, ob ich ihn wegen seines arroganten Tonfalls zurechtweisen sollte, bemerkte ich einen Mann in dunklem Anzug und pomadeglänzendem braunen Haar, der sich zögernd näherte.
»Oliver?«
Mein Mann erhob sich ruckartig. »John Madroy. Was machst du hier? Ist deine Zeit nicht im Februar?«
»Ich habe beschlossen zu verlängern.« Madroy hielt inne und wies mit einer unmerklichen Geste auf mich. »Ist sie eine … Freundin?«
Oliver lachte, als hätte er einen guten Scherz gemacht. Dabei blieben seine Augen unbewegt. »John, darf ich dir meine Frau Eleonore vorstellen?«
Ich streckte Madroy die Hand entgegen, doch er reagierte nicht.
»Was ist mit Kate?«
»Sie ist im vergangenen Jahr verstorben«, sagte Oliver und setzte leise nach: »Ein Unfall.«
»Soso.« Madroy sah überrascht aus. »Und da ist dir nichts Besseres eingefallen, als gleich wieder zu heiraten?«
Ich zuckte zusammen. Nur wenige Worte hatten gereicht, um aus mir wieder das kleine Mädchen aus Wormingford zu machen. In diesem Moment hatte ich gehofft, dass Oliver ihn scharf zurechtweisen würde. Stattdessen überging er die Bemerkung.
»Möchtest du uns nicht Gesellschaft leisten?«
»Nein.« Der Mann hob abwehrend die Hände. »Mein Wagen wartet bereits vor dem Stadttor. Aber wir müssen reden. Dimitri wird ebenfalls anreisen.«
»Dimitri?« Nun sah es so aus, als würde Oliver tatsächlich die Fassung verlieren. »Findest du nicht, dass es ein wenig übertrieben ist?«
»Das sagst du. Ich meine, es war längst überfällig.« Damit grinste Madroy ihm zu und verschwand durch den berankten Torbogen nach draußen.
»Verdammt!«, fluchte Oliver und ließ sich zurück in den Stuhl sinken. Sein Gesicht war aschfahl.
Ich berührte seine Hand. »Wer war das?«
»Ein alter Geschäftsfreund.«
»So ein ungehobelter Kerl! Was meinte er mit ›längst überfällig‹?«
Oliver zog seine Hand weg, holte ein silbernes Etui aus seiner Jackentasche und schüttelte unwillig den Kopf. »Ich habe nicht vor, das mit dir zu besprechen.« Dann entnahm er eine Zigarette und zündete sie an.
Ich schürzte die Lippen. »Du hättest mir ruhig erzählen können, dass du hier Geschäfte machst. Dann käme ich mir jetzt nicht so fürchterlich dumm vor.«
»Ich habe gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen!« Seine Stimme war nun tief und düster.
»Aber mit Kate hast du über solche Dinge geredet, oder?«
Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich ihren Namen aussprach. Oliver blies den Rauch in kleinen Kringeln gegen das Blätterdach. »Ich bitte dich, rede nicht so. Kate …« Er brach ab und sah mich verärgert an. Dann atmete er tief ein. »Ich möchte nicht über Kate sprechen.«
»Du hast noch nie von ihr erzählt. Sie ist wie ein Geist, der immer wieder auftaucht. Bitte, Oliver, lass mich nicht im Unklaren. Ich bin doch deine Frau. Wie war Kate, und was ist damals geschehen?«
»Nell, du tust dir und uns keinen Gefallen damit!«
Er presste die Lippen aufeinander und starrte mich mit unverhohlener Missbilligung an.
»Aber …«
»Schluss jetzt! Ich verbiete es dir, das Thema noch einmal anzusprechen.«
Seine Worte schnitten kalt in mein Herz. Ich reckte den Kopf und schluckte die Tränen hinunter, doch es wollte mir nicht gelingen. Das Gefühl der Scham und der Demütigung trieben sie wieder hinauf, bis ich sie endlich mit der Spitze eines Taschentuches entfernte.
In diesem Augenblick kam das Essen. Vor meinen Augen begann Oliver, sich zu verwandeln. Ich beobachtete, wie er mit dem Kellner auf Italienisch scherzte und sich im Gespräch sichtlich entspannt zeigte.
Als ich mich weigerte, die großäugigen gallertartigen Winzlinge, die man uns mit aufgeschnittenen Zitronen vorsetzte, zu essen, sagte er keinen Ton. Stattdessen konzentrierte er sich auf seinen Teller, summte sogar, während er die Fischbrut in sich hineinschlürfte.
Es war, als hätte ich die Frage nach Kate und ihrem Tod niemals gestellt, und doch hatte sie etwas zwischen uns verändert. Ich war ihm zu nahe gekommen, eingedrungen in seine innere Welt, von der ich gehofft hatte, dass er sie irgendwann einmal mit mir teilen würde.
Auch die getrüffelten Nudeln aßen wir schweigend. Zum ersten Mal fragte ich mich, ob ich den Mann, den ich nach so kurzer Zeit geheiratet hatte, überhaupt kannte.
Er war ein ganz anderer gewesen, als ich ihn im September des vergangenen Jahres zum ersten Mal getroffen hatte. Zumindest erschien er mir damals beständiger, ausgeglichener.
Tante Rose, deren unbändige Reiselust die Familie immer wieder in Unruhe versetzte, hatte meine Eltern überreden können, dass ich sie nach London begleiten durfte. Ich weiß bis heute nicht, wie sie das geschafft hatte, und als ich sie fragte, zwinkerte sie mir nur verschwörerisch zu. Ich hatte mein Glück kaum fassen können, die Vorstellung, zehn Tage in einer Großstadt zu verbringen, die vor Lebensfreude geradezu pulsierte, brach wie ein Donnerwetter in meinen streng bewachten Alltag. In dem Moment, als Rose und ich die Kutsche bestiegen, ahnte ich, dass diese Reise etwas für mich bereithielt, das mein Leben für immer verändern würde.
Gleich am ersten Abend lernte ich ihn kennen. Oliver besuchte dasselbe Stück im Adelphi Theatre wie wir – eine überdrehte, musikalisch untermalte Komödie, die in einem Zigeunerlager spielte. Und wie der Zufall es wollte, war seine Cousine Patty, die ihn begleitete, eine alte Bekannte von Rose. Die Begegnung der beiden Frauen sollte mit dem Besuch eines Restaurants in der Maiden Lane gefeiert werden, und so fanden wir uns an einem gemeinsamen Tisch wieder, an dem Oliver und ich uns befangen anlächelten, während sich Rose und Patty in angeregter Unterhaltung austauschten.
Vom ersten Moment an nahm mich seine imposante Erscheinung gefangen. Sein gepflegtes Äußeres, die schlanken Finger, die Ernsthaftigkeit in seinem Blick, von der ich erst später erkannte, dass es Schwermut war.
Wie sehr es mich überraschte, dass er mich fragte, was ich vom Leben erwarte, plötzlich und ohne Vorwarnung.
»Die Welt entdecken, und sei diese nur wenige Meilen entfernt. Hauptsache weit genug von Wormingford«, antwortete ich lachend und ohne zu zögern.
Damit war das Eis gebrochen. Immer mehr wollte er von mir wissen. Welche Musik ich bevorzuge und welche kulinarischen Vorlieben ich hege – bis hin zu meinen Ansichten über Politik und Weltgeschehen. Von dem ich, das muss ich zugeben, nur wenig Ahnung habe. Daher bemühte ich mich, meine Belesenheit hervorzuheben und erzählte ihm von den Büchern, die mir am Herzen lagen. Wie sehr ich mich freute, als er meine Meinung teilte, dass H. G. Wells’ wissenschaftlich angelegte Romane von Chimären und Marsmenschen etwas Verstörendes haben und man sie in der Hoffnung beendet, dass kein Fünkchen von ihnen jemals Realität werden würde.
Sein offenkundiges Interesse löste ein inneres Beben in mir aus. Die Art, wie er mit mir umging, hatte etwas Galantes, Weltmännisches, es war so anders als die linkischen Annäherungen der Nachbarsjungen. Und auch an den folgenden Tagen, als er Rose und mich ins British Museum begleitete und zur St Paul’s Cathedral, hüllte er mich in eine mir ungewohnt zartfühlende Aufmerksamkeit.
Wie sehr ich sein Lächeln liebte, das sich in seine Gesichtszüge schlich, wenn er mich betrachtete. Es gab mir das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Dass ausgerechnet ich es war, die diesem Mann das Herz zu wärmen vermochte, machte mich stolz. Bis zu dem Tag, als er vollkommen überraschend um meine Hand anhielt, war er zuvorkommend, freundlich, ein vollendeter Kavalier. Die eisige Unnahbarkeit, zu der er sich soeben fähig gezeigt hatte, war hingegen neu für mich.
Ein plötzlicher Windstoß ließ mich frösteln.
Verwundert starrte ich auf den leeren Teller und stellte fest, dass ich gegessen hatte, ohne dem Geschmack des Trüffels, den man über die Nudeln gehobelt hatte, Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Vorstellung, dass diese Unnahbarkeit Teil seines Charakters war, erschreckte mich. Und erst jetzt fiel mir auf, dass er immer nur fragte, nie von sich erzählte.
In den Monaten seit unserem Kennenlernen hatte er nicht ein einziges Wort über Kate verloren. Doch auf einmal schien sie zwischen uns zu stehen wie ein gesichtsloser Fluch.
Unschlüssig strich ich mit der Fußspitze über den Kies und schob ihn beiseite, bis harter Kalkboden zum Vorschein kam. Sollte ich etwa so tun, als würde all dies mir nichts ausmachen?
Am liebsten hätte ich Oliver erzählt, dass ich mich nur als Zaungast fühlte, ausgeschlossen aus einem nicht unerheblichen Teil seines Lebens, dessen Zutritt er mir verweigerte. Stattdessen presste ich nur die Lippen aufeinander.
Als ich aufsah, bemerkte ich, dass Oliver mich beobachtete. Sein Blick war wieder weich geworden, zärtlich lächelte er mich an.
»Es tut mir leid«, sagte er, während er meine Hand nahm und über die Fingerspitzen strich. »Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
»Schon gut«, antwortete ich, dankbar über den Stimmungswechsel. »Aber versprich mir, irgendwann von ihr zu erzählen, ja? Tust du das?«
Er zögerte, nickte dann. »Irgendwann, Liebes. Aber wann der Moment gekommen ist, entscheide ich.«
3
John Madroy begegneten wir noch vor dem Dinner wieder. Wir saßen im Kaminzimmer des Hotels und warteten auf den vorabendlichen Cocktail, als er mit raschen Schritten den Raum durchmaß. Er nickte uns kurz zu und setzte seinen Weg in Richtung Speisesaal fort, ohne innezuhalten. Oliver runzelte die Stirn, schwieg aber.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich mit sanfter Stimme.
Oliver blickte auf. »Mein Engel, glaube nicht, dass du mich mit deinem besorgten Blick reinlegen kannst. Ich sehe es dir an, dass du vor Neugier platzt.« Er deutete ein Lächeln an. »Aber ich habe geschworen, mit niemandem darüber zu reden, auch nicht mit dir. Es belästigt mich schon genug, dass dieser Kerl ausgerechnet in meinen Flitterwochen auftaucht!«
»Unseren Flitterwochen.« Ich zog einen Schmollmund und startete einen letzten Versuch. »Bitte«, flehte ich. »Es würde mir helfen, dich noch besser zu verstehen.«
»Lass es gut sein, Nell!«, sagte er nachsichtig. Er rückte seinen Stuhl ein wenig näher an den meinen. Dann legte er einen Finger unter mein Kinn und hob es sanft an. »Du weißt, dass ich dich liebe«, sagte er leise. »Vergiss das bitte niemals, egal, was passiert. Hörst du? Das allein ist wichtig.«
Der Kellner kam und stellte ein Tablett mit zwei Kristallgläsern, einer Karaffe und einem Wasserkrug ab. Missmutig sah ich zu, wie er ein längliches, perforiertes Silberplättchen über die Gläser legte, ein Stück Zucker darauf platzierte und dieses schließlich mit dem Absinth aus der Karaffe übergoss. Erst als er den alkoholisierten Zucker entzündete und dieser langsam in das grüne Getränk tropfte, wich mein Groll einer erwartungsfrohen Stimmung. Oliver liebte mich, und nur das zählte. Alles andere – die Geheimnistuerei und seine zeitweilige Verschlossenheit – verschwand in grünklebriger Bedeutungslosigkeit.
Ich verdünnte die hochprozentige Mischung mit etwas eisgekühltem Wasser, lehnte mich im samtbezogenen Stuhl zurück und beobachtete die Gäste, die sich langsam im Kaminzimmer zur Cocktailstunde einfanden. Damen in eleganten Kleidern mit hochgeschlossenen Taillen und aufwendig gerüschten Ärmeln, die Haare zu Türmen aufgesteckt. Die Herren hatten ihr obligatorisches Tweedsakko gegen Frack oder Smoking getauscht, nur einer schien die Kleiderordnung nicht allzu ernst zu nehmen. Er mochte ein Künstler sein, der mit seiner Lässigkeit kokettieren durfte. Und dort drüben saß ja auch der griesgrämige ältere Herr mit der lederartigen Haut und dem gezwirbelten Schnurrbart und betrachtete das Geschehen mit distanziertem Stirnrunzeln, als fühle er sich fehl am Platz.
Kellner eilten umher und servierten die verheißungsvolle Flüssigkeit, die man nur noch grüne Fee nannte und die zu Ruhm gelangt war, weil sie bereits Oscar Wilde inspiriert und van Gogh das Ohr gekostet hatte, während leises Klappern aus den beiden angrenzenden Restaurants, von denen das elegantere nur den Hotelgästen vorbehalten war, die Vorbereitung des Abendessens verkündete.
Die wenigen Sitzgelegenheiten des Kaminzimmers waren rasch belegt, und bald erfüllte angeregtes Gemurmel den Raum, das sich in meinen Ohren mit der langsam einsetzenden Wirkung des Alkohols zu einem angenehmen Rauschen verband.
Plötzlich fiel mein Blick auf ein Ölbild, das über dem Kamin angebracht war, und ich erstarrte. Es zeigte eine Frau in einem schlichten, hochgeschlossenen Kleid, mit braunem, von weißen Strähnen durchzogenem Haar. Die Augen blickten am Betrachter vorbei in die Ferne. Und dennoch hatte sie etwas an sich, das mich bewegte, als sähe ihre Seele mir direkt ins Herz.
»Oliver«, flüsterte ich. »Wer ist das?«
Seine Augen folgten meinem Kopfnicken. »Das ist Lucrezia.«
»Lucrezia?«
»Ja.« Mehr sagte er nicht.
»Sie sieht mir ähnlich, nicht wahr? Oliver, schau doch mal hin! So könnte ich in dreißig Jahren aussehen. Meinst du, diese Frau im Vestibül hat mich ihretwegen so angestarrt?«
Er betrachtete das Bild, sah dann wieder zu mir. »Diese Frau hat übertrieben, sicher hat sie die Legende zu ernst genommen. Du musst wissen, dass die Menschen hier sehr abergläubisch sind. Sie beten Heiligenbilder an, fühlen sich ohne Amulett dem Unheil schutzlos ausgeliefert und kennen mehrere Dutzend Zaubersprüche, um den bösen Blick abzuwenden. In alles wird eine Bedeutung hineingelegt, selbst in den Handel mit den Palmen. Die Plantagenarbeiter binden die inneren Blätter nur am Tag des Vollmondes, in der Hoffnung, dass dies für Glück und Wohlstand sorgt.«
»Und wovon handelt diese Legende?«
Der Kellner servierte einen weiteren Cocktail, und Oliver wartete, bis er sich wieder entfernt hatte. Dann trank er einen Schluck und beugte sich vor. »Lucrezia ist eine ehemalige Bewohnerin dieses Grundstücks. Der Eigentümer des Grandhotels, Adolf Angst, hat das Porträt ihr zu Ehren aufgehängt.« Er senkte seine Stimme. »Man sagt, sie komme hierher, um nach dem Rechten zu sehen. Sie soll dieses Stück Erde so sehr geliebt haben, dass ihre Seele es auch nach dem Tod nicht loslassen will.«
Ein eiskalter Schauder lief über meinen Rücken. Entsetzt hielt ich mir die Hand vor den Mund. »Es spukt im Hotel?«
»Keine Sorge«, kommentierte Oliver mit belustigtem Unterton. »Das ist nur dummes Geschwätz. Du wirst sehen, in diesem Hotel gibt es so einiges, was man sich erzählt. Alles nur, um den Aufenthalt zu etwas Besonderem zu machen.«
»Du willst doch nicht sagen, dass die Gäste auch wegen dieser Geschichten anreisen?«
»Ich bin sogar sicher, dass es man es bewusst in Kauf nimmt. Die Legende wird zelebriert, obwohl niemand weiß, ob sie wahr ist. Warum glaubst du, hat man dem Hotel den Namen des Besitzers gegeben und ihn in großen Buchstaben weithin sichtbar angebracht, statt den guten Ausblick anzupreisen, wie es das Belvedere oder das Bellavista getan haben? Weshalb sollte man einem derartig hochpreisigen Hotel den Namen Angst verpassen, wenn nicht als Hommage an all die Schauergeschichten, die jeder gerne unter der Bettdecke liest? Warte nur ab, bis die ersten Stufen knarren, das Licht flackert oder gespenstische Gesänge erklingen!«
Ich sah ihn mit großen Augen an. »Ich ahne es! Die gelangweilte englische Oberschicht erhält ihr hoteleigenes Theaterstück.«
Neugierig betrachtete ich Lucrezias Gesicht. Es wirkte verbittert und streng, gleichzeitig aber auch verletzlich und auf unerklärliche Weise schön.
»Diese Ähnlichkeit ist eigenartig. Die Frau im Vestibül hatte also recht …«
»Das Bild ist nicht besonders gut getroffen. Lass dich davon nicht verrückt machen.«
»Woher weißt du das? Kanntest du sie denn persönlich?«
»Unsinn. So, und nun Schluss damit.«
Hätte Oliver mir damals nicht so abweisend geantwortet, hätte er belanglose Details über Lucrezia erzählt, mich zum Lachen gebracht – vielleicht hätte ich mich damit zufriedengegeben. Nun aber beugte auch ich mich in meinem Stuhl vor, bis mein Gesicht ganz nah an seinem war. »Was ist mit ihr passiert?«
»Man hat sie ermordet!« Eine laute Stimme ließ mich herumfahren. John Madroy stand vor uns, die Hände vor der Brust verschränkt. »Sie wollte nicht fortgehen, da hat man sie kurzerhand in Flammen aufgehen lassen!«
»Es heißt, es sei ihr eigenes Werk gewesen«, widersprach Oliver. »Eine Verzweiflungstat oder eine Art von Protest. Also untersteh dich, von einem Mord zu sprechen.«
»Das glaubst du doch selber nicht!« Madroys Blick verdunkelte sich. »Nein, Oliver, du weißt genauso gut wie ich, dass es damals nicht mit rechten Dingen zuging. Es hat nicht einmal eine Woche gedauert, da wurde ihre Hütte bis auf den letzten Stein niedergerissen. Und nun hängt ihr Spiegel – das Einzige, was davon übrig blieb – im Vestibül, als sei es ein letzter Triumph! Ich an ihrer Stelle würde mich auch rächen wollen.«
»Du wirst doch diese Ammenmärchen nicht glauben wollen? Der Spuk ist geplant. Eine Attraktion für die Hotelgäste!«
»Und warum amüsiert sich Adolf Angst nicht über die gelungene Vorstellung?« Madroy lachte und entblößte dabei eine Reihe tadelloser Zähne. Oliver hob zu einer Entgegnung an, doch in diesem Augenblick erklangen vom Speisesaal die ersten Töne des Orchesters, das zum Abendessen aufspielte. Die Gäste setzten sich in Bewegung, und das gleichförmige Stimmengemurmel schwoll an.
Madroy hatte mich während der gesamten Unterhaltung ignoriert, nun betrachtete er mich mit einer Mischung aus Geringschätzung und Mitleid. »Passen Sie gut auf sich auf, Madam. Sie sollten sich Ihren Ehemann genauer ansehen, bevor Sie ihm Vertrauen schenken.« Damit wandte er sich zum Gehen.
Jetzt sprang Oliver auf. »Das geht nun wirklich zu weit!« Er hob die Faust, doch Madroy bahnte sich bereits seinen Weg durch die Menschen in Richtung Ausgang. Kopfschüttelnd sah er ihm nach.
Auch ich stand auf und starrte Oliver an. Ich hätte entsetzt sein sollen über die Unverfrorenheit. Meinen Mann verteidigen müssen, zumindest in Gedanken. Doch Madroys letzter Satz bohrte sich in meinen Verstand, ohne dass ich mich dagegen wehren konnte.
»Was hat er damit gemeint?«
»Ich verstehe, wenn du eine Erklärung suchst, und ich werde sie dir geben«, sagte er mühsam beherrscht. »John und ich waren Geschäftspartner und sind es auf unglücklich verstrickte Weise noch immer. Er gibt mir die Schuld an etwas, das sich meiner Kontrolle entzieht.« Er verzog den Mund zu einem eisigen Lächeln, als würde er das Thema damit zum Abschluss bringen wollen, und legte seinen Arm um mich. »Aber du musst dir keine Gedanken machen. Es wird sich alles aufklären.«
Ich dachte an unser Zusammentreffen im Dall’Aprosio. »Ist dieser Dimitri, von dem John Madroy heute Mittag sprach, auch ein Geschäftspartner?«
»Ja. Wir waren zu viert.«
»Wer ist der vierte Mann? Was waren das eigentlich für Geschäfte? Und was hat das Ganze mit dieser Frau zu tun?«
Doch er kniff seine Lippen aufeinander.
»Oliver, du bist mir eine Erklärung schuldig!«
»Nein, das bin ich nicht, mein Engel«, zischte er. »Wir sind hier nicht in Wormingford, wo sich alles nur um deine Wünsche dreht. Das hier, Eleonore, ist die wirkliche Welt.«
Ich zuckte zurück, als hätte er mich geohrfeigt.
Noch während wir den anderen in den Speisesaal folgten, versuchte ich mühsam, meinen Ärger zu bezwingen. Grollend nahm ich zur Kenntnis, dass Oliver mir formvollendet den Stuhl zurechtrückte, als habe er mich nicht soeben zurechtgewiesen wie ein dummes kleines Mädchen. Sein aufgesetztes Lächeln erwiderte ich mit eisiger Miene.
Wenn er glaubte, das Thema sei damit für mich erledigt, dann hatte er sich geirrt. Er mochte denken, ich sei jung und unerfahren, vielleicht sogar ein wenig naiv. Aber sosehr ich Oliver auch liebte, so wenig wollte ich es durchgehen lassen, dass er mich derart kalt auflaufen ließ.
An jenem Abend, während das Personal nacheinander Gemüsesuppe, Beef à la mode und einen Mandelpudding auftrug, beschloss ich, alles über die Legende von Lucrezia und ihren rätselhaften Tod in Erfahrung zu bringen. Auch ohne Olivers Wissen.
4
Die Gelegenheit, Nachforschungen anzustellen, ergab sich bereits am nächsten Morgen. Oliver wollte sich nach dem Frühstück mit einer Zigarre ins Herrenzimmer zurückziehen und ermunterte mich, währenddessen den Hotelpark zu erkunden.
»Wir treffen uns in einer halben Stunde an der Bank neben der Weggabelung«, sagte er, nachdem er seinen Kaffee ausgetrunken hatte, und warf einen Blick aus dem Fenster. »Das Wetter ist herrlich, wir sollten heute einen Bootsausflug machen.«
Nur wenige Tage zuvor hätte ich es bedauert, für Minuten von ihm getrennt zu sein. Nun aber nickte ich und freute mich über die unverhoffte Möglichkeit, mich ein wenig umzuhören.
Ich begleitete Oliver zum Herrenzimmer, wartete, bis er im dunkel getäfelten Raum verschwunden war, dessen Tabaksqualm beharrlich gegen das Tageslicht antrotzte. Dann eilte ich ins Foyer und suchte nach dem Portier. Er würde mir gewiss ein wenig über die Geschichte des Hotels erzählen können.
Das Vestibül war leer. Ich setzte mich auf einen der in Grüppchen stehenden Stühle und sah mich um. Der gesamte Eingangsbereich war in strahlend weißem Marmor gehalten: die von schwarzen Rauten unterbrochenen Bodenfliesen, die das Entree tragenden Säulen, deren Enden in stuckverzierte Bögen übergingen. Selbst die breite Treppe, die dem Eingang gegenüber in die oberen Stockwerke führte, glänzte hell in der durch das Oberlicht fallenden Sonne.
Fröstelnd schlang ich die Arme um meinen Körper. Das Entree sollte großzügig wirken und luxuriös, doch weder die vielen Blumentöpfe noch die in große Kübel gepflanzten Palmen konnten darüber hinwegtäuschen, dass diesem Raum eines fehlte: Wärme.
Ein großer antiker Spiegel zog meine Aufmerksamkeit auf sich. War das etwa der Spiegel, von dem John Madroy gestern Abend erzählt hatte?
Er hing ein wenig abseits, war Teil einer Bilderreihe, die stuckumrahmte Nischen füllte. Er wäre mir nicht aufgefallen, hätte nicht eine der Messingstangen, die den Läufer hielt, das Sonnenlicht reflektiert und zu einem kleinen funkelnden Punkt gebündelt, der sich nun im Glas des Spiegels verfing.
Neugierig stand ich auf und ging näher, betrachtete den mit goldenen Blattornamenten üppig verzierten Rahmen. Als ich mein Gesicht in der beinahe blinden Fläche besah, spürte ich eine Unruhe, die ich mir nicht erklären konnte. Etwas Eigenartiges ging von diesem Spiegel aus. Verwirrend, seltsam machtvoll. Als berge sein Inneres eine furchtbare Geschichte, die nur darauf wartete, erzählt zu werden. Doch bevor ich diesem Gefühl nachgehen konnte, sah ich hinter mir einen Mann mit schütterem Haar auftauchen, der die Uniform des Hotels trug. Ich drehte mich um und sah in das Gesicht von Herrn Kaltenbach, dem Concierge des Hotels, der – laut Oliver – ebenso wie Adolf Angst aus der Schweiz stammte und neben dem Deutschen drei Sprachen beherrschte: Italienisch, Englisch und Französisch.
»Kann ich Ihnen helfen, Madam?«, fragte er höflich und deutete eine Verbeugung an.
»Ich suche den Portier.«
»Es tut mir leid, Signore Bartelli befindet sich gerade am Kutschenbahnhof. Kann ich Ihnen weiterhelfen?«
»Vielleicht …« Ich zögerte, wusste nicht, wie ich beginnen sollte. »Ich würde gerne ein wenig mehr über die Geschichte des Hotels erfahren.«
»Sehr gerne.« Herr Kaltenbach lächelte und setzte eine gewichtige Miene auf, spulte dann eine Erläuterung herunter, die wie auswendig gelernt klang. »Signore Adolf Angst besaß zunächst ein kleines Hotel direkt am Bahnhof. Beim großen Erdbeben vor zwölf Jahren wurde es vollständig zerstört. Da zu dieser Zeit die Riviera rasch an Beliebtheit gewann, plante er den Bau eines Hotels, das den höchsten Ansprüchen genügen sollte.« Der Concierge machte mit den Händen eine weite Bewegung, als wollte er mir die gesamte Pracht präsentieren. »Es ist ihm gelungen. Unter unseren Gästen befinden sich alle wichtigen Namen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Bankiers und Literaten, die Tiffanys aus New York, die Fürsten von Hohenzollern, Angehörige der Zarenfamilie ebenso wie die Witwe des preußischen Kaisers, die es sich zur Gewohnheit gemacht hat, hier einige Wochen im Jahr zu verbringen. Sie alle wollen nur ins Hotel Angst.«
Er sah mich erwartungsvoll an, und ich zeigte mich beeindruckt, bevor ich meine nächste Frage mit betontem Gleichmut präsentierte.
»Wie ich hörte, stand auf dem Grundstück zuvor die Hütte einer älteren Dame?«
»Das wird zuweilen erzählt.«
Die Antwort kam schmallippig, davon unbeirrt setzte ich nach: »Oh, dann kennen Sie sicher die Legende von Lucrezia?«
»Selbstverständlich. Eine Schilderung, die von Jahr zu Jahr abenteuerlicher wird, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Sein Blick war jetzt verschlossen. Es widersprach Olivers Erklärung vom hoteleigenen Theaterstück, aber vielleicht war der Concierge auch zu distinguiert, um sich dem anschließen zu wollen. Ich nickte, verbarg meine Enttäuschung hinter einem höflichen Lächeln und wollte mich gerade abwenden, als mir ein Gedanke kam.
»Kennen Sie eine Frau namens Maria? Sie ist ein wenig älter, klein und von rundlicher Statur. Sie trug einen Korb mit Tomaten und verschwand in dieser Richtung.« Ich zeigte zum Korridor, der links der Treppe zum nördlichen Seitenflügel führte.
»Maria …« Herr Kaltenbach legte den Kopf schräg. »Eine unserer Küchenhilfen heißt so. Ich hoffe, sie hat nichts angestellt!«
»Nein, nein. Ich habe lediglich eine Frage an sie. Nur …« Ich überlegte fieberhaft, wie ich mein Interesse an einer Küchenhilfe erklären könnte. »Sie versprach mir zu erzählen, wo die besten Tomaten wachsen«, setzte ich schließlich mit entwaffnendem Lächeln nach.
»Ach so.« Es war eine absurde Begründung, doch der Concierge wirkte erleichtert. »Soll ich sie rufen lassen?«
»Wenn es keine Umstände macht, gehe ich selbst hin.«
»Aber Mrs. Dickinson …« Er machte ein Gesicht, als schwanke er zwischen dem Bemühen, dem Gast jeden Wunsch zu erfüllen, und einer Anweisung, die er nicht zu übertreten wagte. »Das ist nicht üblich.«
»Bitte. Sagen Sie mir einfach, in welcher Richtung die Küche liegt. Ich werde sie gewiss alleine finden.«
»Nun, wenn Sie darauf bestehen …«, erwiderte er zögernd und beschrieb den Weg. »Wenn Sie erlauben, begleite ich Sie.«
Er wurde jedoch von einer Dame abgehalten, die laut zeternd das Vestibül betrat und auf der Stelle ein anderes Zimmer verlangte, neben dem kein Adelszögling wohnte, der nachts seine Partys feierte und dazu ganze Orchester lud. Noch während sich der Concierge ihrem Redeschwall stellte, nutzte ich die Gelegenheit und stahl mich davon.
Die Küche befand sich im Souterrain unterhalb des Speisesaals. Eine Servicetreppe führte in einen beleuchteten Trakt, in dem Speisekammer, Wein- und Vorratskeller, Spülraum und Hauptküche lagen. Der Concierge hatte mir erklärt, dass ich zunächst am Anrichtezimmer anfragen möge, ob man Maria aus der Küche holen könne; es befände sich gleich rechts der Treppe. Man sei sicher schon mit der Zubereitung des Mittagsmahls beschäftigt, es wäre nicht ungefährlich, sich zwischen hantierenden Köchen und in Betrieb befindlichen Feuerstätten zu bewegen.
Auf mein Klopfen hin reagierte niemand, also öffnete ich die Tür, und als ich den Raum leer fand, trat ich ein und wartete einen Augenblick. Hier also richteten die Kellner während der Mahlzeiten die Speisen an. Große Tische mit Servierhauben und Schüsseln, an der Wand Regale mit dem hoteleigenen Geschirr. Die Ornamente auf den Tellern, so hatte Oliver mir erklärt, seien aus reinem Blattgold.
Der Gedanke an meinen Mann versetzte mich in Unruhe. Ein rascher Blick auf die Uhr oberhalb der Regale trieb mich zur Eile, und ich durchquerte den Raum, folgte dem Lärm, der aus der angrenzenden Küche drang.
Die Tür war nur angelehnt. Ich blieb stehen, sog den herrlichen Geruch von gebratenem Fleisch und fremdartigen Kräutern ein und betrachtete das hektische Treiben. Köche und Küchenhilfen in weißen Jacken und Schürzen eilten geschäftig umher. Einer schob Brot in den riesigen Steinofen, andere kneteten Teig, putzten Gemüse, nahmen Fische aus oder rührten in kupfernen Töpfen, aus denen es mächtig dampfte.
Niemand schien mich zu bemerken, und so ließ ich den Blick weiter schweifen.
Die Küche war von beeindruckender Geräumigkeit und Modernität. In der Mitte stand eine breite gusseiserne Kochinsel mit mehreren Feuerstellen. Es gab einen Räucherofen, Borde mit unzähligen Töpfen und Pfannen in mehreren Größen, sogar einen Wasseranschluss und elektrisches Licht.
Ich staunte. Der Aufwand, ein derart exklusives Hotel zu bewirtschaften, war gigantisch!
Und dann sah ich sie. Maria saß weiter hinten, jenseits der Kochinsel, auf einer langen Holzbank. Sie hatte sich an die Wand gelehnt, die Augen fast geschlossen. Auf ihrem Schoß stand eine Schüssel Kartoffeln, der Boden vor ihr war mit Schalen bedeckt. Mit immer langsamer werdenden Bewegungen führte sie das Schälmesser über die sandigen Knollen. Im Näherkommen bemerkte ich, dass ihr Kopf langsam auf die Brust sank.
»Maria?«
Sie sah auf und erschrak. Dann murmelte sie etwas auf Italienisch, verzog dabei ihr Gesicht in tiefe, sorgenvolle Falten. Leise und mit angstvoller Miene fragte sie mich etwas und stellte die Schüssel mit den gelb glänzenden Kartoffeln neben sich ab, ohne den Blick von mir zu wenden.
»Ich verstehe leider kaum Italienisch.« Ich setzte mich zu ihr auf die Bank. Bei unserer ersten Begegnung hatte sie wenige Worte auf Englisch gesprochen. In der Hoffnung, sie würde mich verstehen, fuhr ich langsam und mit deutlicher Betonung fort. »Erinnerst du dich an mich? Wir sind vor ein paar Tagen in der Eingangshalle zusammengestoßen.«
In Marias Gesicht spiegelte sich Unglauben, dann schüttelte sie stumm den Kopf. Dabei löste sich eine graue Strähne aus ihrem sorgsam unter dem Häubchen verborgenen Haar. Während ich nach Worten suchte, wischte sie die Hände an der Schürze ab. Langsam und bedächtig. Ihre Lippen zitterten.
»Dio mio«, wisperte sie plötzlich und hob die Finger schützend vors Gesicht. »Verschone mich. Bitte.«
Es war, als sehe sie jemand anderen. Ihr Blick war starr und glasig. Vorsichtig nahm ich ihre Hände herunter, betrachtete ihr blasses Gesicht, die Angst in ihren Augen.
»Bitte sag, warum du dich vor mir fürchtest.«
Langsam schüttelte sie den Kopf. »Willst du mich auf die Probe stellen?«, entfuhr es ihr in akzentbehaftetem Englisch.





























